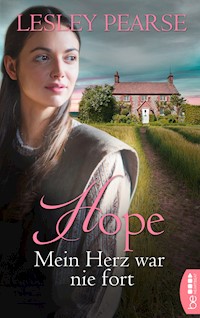7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Große Gefühle und bewegende Schicksale von Englands Besteller Autorin Lesley Pearse
- Sprache: Deutsch
Eine Erzählung von Mord, verlorener Unschuld und der Kraft der Freundschaft.
Seit fast dreißig Jahren haben sie sich nicht mehr gesehen: Beth und Susan, die in ihrer Kindheit eine innige Freundschaft verband. Als sie einander nun als erwachsene Frauen plötzlich wieder gegenüberstehen, ist Susan des zweifachen Mordes angeklagt - und Beth ihre Pflichtverteidigerin. Wie konnte aus dem fröhlichen Mädchen von einst bloß eine kaltblütige Mörderin werden? Doch nicht nur Susans Vergangenheit birgt viele Rätsel. Beth weiß, dass auch sie sich ihren eigenen Traumata endlich stellen muss, um ihr Glück zu finden.
»Eine gefühlvolle und menschliche Erzählung, die man nicht so bald vergisst.« WOMAN’S WEEKLY
Der Roman erschien im Original unter dem Titel Till We Meet Again.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 708
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
Cover
Inhalt
Grußwort des Verlags
Über dieses Buch
Titel
Widmung
DANKSAGUNG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
Über die Autorin
Weitere Titel der Autorin
Impressum
Liebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an: be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Melde dich hier für unseren Newsletter an:
Über dieses Buch
Seit fast dreißig Jahren haben sie sich nicht mehr gesehen: Beth und Susan, die in ihrer Kindheit eine innige Freundschaft verband. Als sie einander nun als erwachsene Frauen plötzlich wieder gegenüberstehen, ist Susan des zweifachen Mordes angeklagt - und Beth ihre Pflichtverteidigerin. Wie konnte aus dem fröhlichen Mädchen von einst bloß eine kaltblütige Mörderin werden? Doch nicht nur Susans Vergangenheit birgt viele Rätsel. Beth weiß, dass auch sie sich ihren eigenen Traumata endlich stellen muss, um ihr Glück zu finden.
LESLEY PEARSE
Denn dunkelistdein Herz
Aus dem britischen Englischvon Hans Link
FÜRALLE ELTERN, DIEEIN KINDDURCH
MENINGITISVERLORENHABEN.
ICHBINMITDEM HERZENBEIEUCHALLEN.
DANKSAGUNG
Ohne die Hilfe und Unterstützung zweier wundervoller Männer hätte ich dieses Buch nicht schreiben können: Inspector Jonathan Moore, der mich über die Ermittlungsmethoden der Polizei unterrichtet hat, und John Roberts, Strafverteidiger in Bristol, dem ich einen Einblick in die Welt des Rechts verdanke. Beide haben mir ohne jede Einschränkung geholfen und mir Ermutigung und Unterstützung geboten, wenn ich sie brauchte. Ich habe ihrer beider Humor, Geduld und ihre Freiheit von aller Großtuerei genossen. Gott segne Sie beide! Alle Fehler und Schnitzer gehen allein auf meine Kappe, und meine einzige Entschuldigung ist, dass es unmöglich ist, sich all ihre gewaltige Erfahrung und ihre Kenntnisse in so kurzer Zeit anzueignen. Falls sich irgendeine meiner Leserinnen in meinen Detective Inspector Roy Longhurst verlieben sollte, dann liegt das nur an der Hilfe, die diese beiden Schätze mir haben angedeihen lassen.
Ich danke auch Harriet Evans, meiner Lektorin bei Penguin Books. Wie jemand, der noch so jung ist, so klug und diplomatisch sein kann, ist mir völlig rätselhaft. Harriet, Sie sollen wissen, dass ich Ihre Notizen kein einziges Mal empört durchs Zimmer geworfen oder ausgerufen habe: »Was weiß die denn schon!« Denn Sie haben das Wissen, das es braucht. Sie haben einen scharfen Verstand, intuitiv und gutherzig - es ist eine Freude, mit Ihnen zu arbeiten. Danke, Harriet, und zwar nicht nur für Ihr fachmännisches Lektorat, sondern auch für den Trost und die Bestärkung, wann immer ich mir uns sicher war, und für die vielen Male, die wir zusammen gelacht haben.
Mein letztes Dankeschön geht an den Spencer Dayman Trust in Bristol.
KAPITEL 1
OKTOBER 1995
Als die Eingangstür der Praxis geöffnet wurde, blickte Pamela Parks vom Terminkalender auf. Um Viertel vor zehn am Donnerstagmorgen war das Wartezimmer bereits voller Patienten. Zu ihrem Erschrecken war die Person, die hereinkam, die ungepflegte Frau, die an den meisten Tagen auf einer Bank auf dem Platz vor dem medizinischen Versorgungszentrum saß.
Pamela war kein toleranter Mensch. Mit ihren fünfundvierzig Jahren und zwei erwachsenen Kindern rühmte sie sich ihrer schlanken Figur, ihrer Eleganz und ihrer Effizienz. Sie hatte nichts übrig für jemanden, der ihre eigenen hohen Maßstäbe nicht teilte. Und gewiss hatte sie nichts übrig für diese Frau, die einer der Arzthelferinnen den Spitznamen »Vinnie« verdankte - weil man sie oft aus einer Flasche billigen Weins trinken sah. Man hielt sie überwiegend für eine ehemalige Psychiatriepatientin, die man ohne angemessene Aufsicht auf die Gesellschaft losgelassen hatte.
Draußen regnete es heftig, und Vinnie blieb auf der Matte an der Tür stehen und schob sich das strähnige, nasse Haar aus ihrem dicklichen, roten Gesicht. Sie trug über einem kurzen Wollmantel einen durchsichtigen Plastikregenmantel und dazu alte Turnschuhe. Voller Entrüstung schob Pamela das Fenster vor dem Empfangstresen zurück. »Sie dürfen sich hier weder unterstellen«, rief sie, »noch unsere Toilette benutzen. Verschwinden Sie, oder ich rufe die Polizei.«
Vinnie beachtete sie nicht, sondern zog ihren Plastikregenmantel aus und hängte ihn an einen Haken neben der Tür. Erzürnt darüber, dass sie einfach ignoriert wurde, beugte Pamela sich über den Empfangstresen, um besser sehen zu können, was die Frau tat. Sie schien etwas aus der Tasche ihres Mantels zu holen.
»Ich sagte, Sie dürfen nicht hier hereinkommen«, wiederholte Pamela. Sie spürte, wie sie schwach in Panik geriet - es warteten mindestens zehn Patienten auf ihre Termine, zwei Ärzte waren wegen Notfällen zeitweilig verhindert, und Muriel, die dienstältere, für den Empfang zuständige Arzthelferin, befand sich im Nebenzimmer, um Patientenakten aus den Ordnern zusammenzusuchen.
»Ich bin Ihretwegen gekommen«, sagte Vinnie und trat entschlossen auf sie zu.
Pamela wich von der Empfangstheke zurück; plötzlich machten die Augen der Frau ihr Angst. Sie waren von einem blassen, grünlichen Blau, sehr kalt und hart. Aus der Nähe sah sie nicht so alt aus, wie Pamela sie eingeschätzt hatte. Sie war vermutlich etwa im gleichen Alter wie Pamela selbst.
»Sie erinnern sich nicht an mich, oder?«, fuhr die Frau fort, und ein schwaches Grinsen umspielte ihre Mundwinkel. »Natürlich habe ich mich verändert, wie es aussieht. Sie nicht. Sie sind immer noch genauso rüde und gefühllos wie damals.«
Die Stimme löste in Pamelas Gedächtnis etwas aus. Aber bevor sie irgendetwas sagen konnte, hob die Frau den Arm. Sie hielt eine Pistole in der Hand und richtete sie auf Pamela.
»Machen Sie sich nicht lächerlich!«, rief Pamela instinktiv, während sie angstvoll zurückwich. Aber es war zu spät zu fliehen, ein Schuss fiel, und gleichzeitig spürte sie einen sengenden Schmerz in der Brust.
Im angrenzenden Büro legte Muriel Olding in ebendiesem Augenblick einen wackligen Stapel Krankenakten auf die Ecke der offenen Schublade eines Schrankes. Sie hatte Pamela jemanden hinausschicken hören, aber sie hatte nicht sehen können, um wen es sich handelte, da der Raum keine Fenster zum Flur hatte. Wenn auch schockiert über Pamelas Schroffheit war Muriel neugierig zu erfahren, gegen wen sie sich richtete.
Als sie eine Frauenstimme gelassen erwidern hörte: »Sie erinnern sich nicht an mich, oder?«, statt Pamela Beschimpfungen an den Kopf zu werfen, schob Muriel die Akten auf den Schrank, wo sie sicherer lagen, und ging zu der Tür, die in den Flur führte, um festzustellen, mit wem Pamela sprach. Sie hatte die Tür gerade geöffnet, als es einen ohrenbetäubenden Knall gab.
Muriel kam nicht einmal auf den Gedanken, es könne ein Pistolenschuss gewesen sein. Sie dachte, es sei ein Feuerwerkskörper, denn es war fast Ende Oktober - kurz vor Halloween - und junge Rüpel hatten schon tagelang in der Nähe des medizinischen Zentrums Knaller gezündet. Als sie die Tür öffnete, Vinnie mit einer Pistole in der Hand sah und der Geruch von Kordit schwer und scharf im Flur hing, hielt sie ungläubig inne.
Eine Sekunde lang sah die Frau ihr in die Augen, aber als Dr. Wetherall die Tür seines Behandlungsraums aufriss, fuhr Vinnie so geschmeidig zu ihm herum, als stünde sie auf einer Drehscheibe.
»Was zum Teufel …!«, brüllte der Arzt. Weiter kam er nicht, weil die Frau ihm in die Brust schoss.
Muriel konnte nicht fassen, was sie sah. Sofort spritzte Blut aus Dr. Wetheralls Brust; er gab eine Art gequältes Stöhnen von sich und hob die Hände an die Wunde. Seine Augen waren vor Schreck geweitet, und er machte einige taumelnde Schritte rückwärts in seinen Behandlungsraum hinein.
Dann sah sie Pamela. Sie lag mit von sich gestreckten Gliedern auf dem Boden, und aus einem Loch in ihrer Brust quoll Blut.
Mit einem Satz gelang es Muriel, das Telefon zu packen. Hinter den Tresen geduckt wählte sie fieberhaft den Notruf.
Etwa vier Stunden später lag Muriel, in eine Decke gehüllt, auf der Couch in einem der oberen Sprechzimmer, und Detective Inspector Roy Longhurst saß neben ihr. Unten taten die Spurensicherung und Polizeifotografen ihre Arbeit. Alle anderen Angestellten und Patienten, die zum Zeitpunkt der Schießerei im Gebäude gewesen waren, hatten bei Longhursts Eintreffen unter Schock gestanden, und einige waren hysterisch gewesen, aber da keiner von ihnen tatsächlich Augenzeuge der Geschehnisse war, hatte man sie inzwischen fast alle nach Hause gefahren. Muriel hatte jedoch alles mit angesehen, und Longhurst machte sich große Sorgen um sie. Sie ging auf die sechzig zu, und ihr graues Haar und ihr gefurchtes Gesicht erinnerten ihn an seine eigene Mutter.
Er nahm eine ihrer Hände und rieb sie sachte zwischen seinen kräftigen Fingern. »Nun, Mrs. Olding«, sagte er. »Lassen Sie sich Zeit, und versuchen Sie, mir genau zu berichten, was Sie heute Morgen gesehen und gehört haben.«
Longhurst war fünfundvierzig, einen Meter fünfundachtzig groß und brachte gut und gern hundert Kilo purer Muskelmasse auf die Waage. Selbst in Zivil oder auf dem Rugbyfeld gelang es ihm immer noch, wie ein Polizist auszusehen, etwas, das seine Mutter sehr erheiterte, da sie immer gesagt hatte, er sei zum Polizisten geboren.
Wenn auch nicht direkt gut aussehend war Longhurst ein attraktiver Mann mit dichtem, dunklem, gewelltem Haar, olivfarbener Haut und seelenvollen, schwarzbraunen Augen. Er gehörte der alten Schule von Polizisten an, war durch und durch ehrlich, aber mit starren Ansichten. Er hatte nichts übrig für Ganoven, die eine schwierige Kindheit vorschützten. Er selbst hatte es als Kind auch schwer gehabt, ohne zu Verbrechen Zuflucht zu nehmen. Er hätte Hinrichtungen durch den Strang und die Rute wieder aufleben lassen, wenn es in seiner Macht gestanden hätte, und er fand, dass Gefängnisse viel härter sein sollten, als sie es waren. Doch trotz all dem war er von Natur ein mitfühlender Mensch und sparte sich sein Mitleid für jene auf, die es verdienten, wie zum Beispiel die Opfer eines Verbrechens. Obwohl Mrs. Olding körperlich unversehrt war, sah er in ihr ein Opfer, denn was sie an diesem Morgen erlebt hatte, hatte sie offensichtlich zutiefst erschüttert.
Der Dowry Square in Hotwells in Bristol war zu Beginn des neunzehnten Jahrhunderts für wohlhabende Kaufleute angelegt worden, die abseits des Gestanks der Hafenanlagen hatten leben wollen. Aber im Gegensatz zum benachbarten Clifton, das es größtenteils geschafft hatte, sein elitäres Image über zwei Jahrhunderte zu bewahren, hatte Hotwells Höhen und Tiefen erlebt. Ein gewaltiges Netzwerk viel befahrener Straßen, darunter eine monumentale Überführung, hatte es vor einigen Jahrzehnten in ein wenig erstrebenswertes Wohngebiet verwandelt. Aber seit Mitte der Achtzigerjahre am Fluss elegante neue Wohnkomplexe und Stadthäuser gebaut wurden, ging es mit Hotwells wieder aufwärts.
Das Gebäude, das jetzt das medizinische Versorgungszentrum beherbergte, spiegelte all diese Veränderungen wider. Zuerst ein elegantes Einfamilienhaus, dann eine anrüchige Pension und zu guter Letzt eine Praxis hatte es eine Vielzahl von Bewohnern und Mietern kommen und gehen sehen. Zu den Patienten des Gesundheitszentrums zählten stadtstreicherartige Existenzen aus billigsten Pensionen, Besitzer von Häusern, die mehr als eine halbe Million Pfund wert waren, Studenten, Mieter von Sozialwohnungen, alte Hippies und Yuppies.
Das medizinische Versorgungszentrum hatte den Charakter eines Wohnhauses bewahrt; Sprechzimmer, Wartezimmer und Behandlungsräume lagen rings um einen langen, zentralen Flur. Im oberen Stockwerk gab es weitere Sprechzimmer. Etwa vier bis fünf Meter trennten die Empfangstheke mit ihren Schiebeglasfenstern von der Eingangstür.
Als das Überfallkommando an diesem Morgen eingetroffen war, hatten die Männer gewusst, dass zwei Menschen bereits tot waren, dass im Wartezimmer etwa zehn Patienten warteten und Ärzte sowie Arzthelferinnen sich im Haus befanden. Sie hatten eine Geiselsituation erwartet und waren dafür gerüstet gewesen. Da man ihnen nichts Gegenteiliges mitgeteilt hatte, waren sie davon ausgegangen, dass die Person, die geschossen hatte, männlichen Geschlechts war, und sie vermuteten Drogen im Zusammenhang mit dem Verbrechen.
Doch als Longhurst kurze Zeit später eingetroffen war, berichteten ihm seine Kollegen etwas völlig anderes: Sie hatten die Vordertür weit offen vorgefunden, und eine Frau hatte im Flur auf dem Boden gesessen. Zuerst hatten sie angenommen, der Schütze müsse bereits geflüchtet sein und diese Frau stünde zu sehr unter Schock, um sich zu bewegen oder zu sprechen. Aber nachdem sie den bewaffneten Polizeibeamten in der Tür einen Moment lang schweigend angestarrt hatte, begann sie schließlich zu sprechen.
»Ich war diejenige, die sie erschossen hat«, sagte sie und deutete auf die Pistole, die neben ihr auf dem Boden lag, halb verborgen unter ihrem Mantel.
Der Beamte befahl ihr, sich von der Waffe wegzubewegen. Sie gehorchte und rutschte zur Seite. Nachdem die Waffe geborgen war, stand sie aus eigenem Antrieb auf und deutete auf ihre Opfer. Auf die Frage, warum sie sie erschossen habe, war ihre kryptische Antwort: »Die beiden wissen, warum.«
Longhurst war dafür verantwortlich gewesen, die Frau zu verhaften und über ihre Rechte zu belehren, bevor man sie nach Bridewell brachte. Obwohl er nur etwa zehn Minuten mit ihr verbracht hatte, fand er sie verwirrend. Der Aufruhr im ganzen Haus - außer in dem Raum, in dem sie festgehalten wurde - schien sie nicht im Mindesten zu berühren. Während sie erneut zugab, diejenige gewesen zu sein, die die beiden Personen erschossen hatte, weigerte sie sich, ihren Namen und ihre Adresse zu nennen, und ihr heruntergekommenes Äußeres stand in einem seltsamen Widerspruch zu ihrer weichen Stimme und ihrer würdevollen Haltung. Bei der Waffe handelte es sich, so hatte einer der Polizisten des Überfallkommandos befunden, um einen Armeerevolver, beinahe mit Sicherheit ein Relikt aus dem Zweiten Weltkrieg.
»Ich habe sie nicht hereinkommen sehen«, sagte Muriel, deren Stimme vor Schock zitterte. »Ich war in dem Raum neben der Empfangstheke. Es ist eigentlich weniger ein Raum als eine Kammer. Es gibt eine Tür zum Flur, aber keine Fenster. Ich habe nur gehört, dass Pam mit erhobener Stimme mit jemandem sprach. Sie sagte: ›Sie dürfen sich hier weder unterstellen noch unsere Toilette benutzen, also verschwinden Sie, oder ich rufe die Polizei.‹«
»Was haben Sie denn gedacht, mit wem sie sprach?«, fragte Longhurst.
Muriel zuckte mit den Schultern. »Ich habe eigentlich gar nicht darüber nachgedacht, vermutlich habe ich mir vorgestellt, es seien Kinder oder so. Ich habe allerdings gedacht, dass man so mit niemandem reden sollte, wer immer es war. Dann hörte ich eine Frauenstimme. Sie sagte etwas wie: ›Sie erkennen mich nicht, oder?‹ Sie klang nicht unhöflich oder irgendetwas. Ich war neugierig, und deshalb habe ich die Tür zum Flur geöffnet. Und genau in diesem Moment hörte ich den Knall. Ich nahm an, jemand hätte einen Feuerwerkskörper losgelassen.«
»Was haben Sie im Flur gesehen?«
»Vinnie, so haben wir sie genannt.«
»Dann kannten Sie sie also?«
»Ja, sie sitzt fast jeden Morgen draußen auf dem Platz, seit mindestens achtzehn Monaten. Aber sie ist noch nie zuvor zu uns hereingekommen, zumindest nicht, soweit ich weiß.«
Sie berichtete Longhurst, was sie sonst noch gesehen hatte und dass sie ins Büro zurückgelaufen sei und die Polizei angerufen habe. »Ich hatte solche Angst«, sagte sie und begann von Neuem zu weinen. »Ich arbeite seit fünfzehn Jahren hier, und noch nie ist etwas Derartiges geschehen.«
Man hatte Longhurst erzählt, dass Muriel bei der Ankunft des Überfallkommandos noch immer unter der Empfangstheke gekauert habe, nur wenige Schritte entfernt vom Leichnam der anderen Frau. Sie sei starr vor Entsetzen gewesen und zutiefst beschämt, weil sie nicht an die Patienten im Wartezimmer gedacht hatte, während sie selbst Schutz gesucht hatte.
Es dauerte ein Weilchen, bis der Polizist, der sie gefunden hatte, sie davon überzeugen konnte, dass es richtig und vernünftig gewesen war, sofort die Polizei zu verständigen und zu bleiben, wo sie gewesen war. Da eine Arzthelferin die Patienten alle aus dem Wartezimmer in einen angrenzenden Behandlungsraum in Sicherheit gebracht habe, sei keiner von ihnen verletzt worden, hatte der Beamte ihr versichert. Aber Muriel schien dennoch der Meinung zu sein, sie hätte mehr tun sollen.
»Wie lange hat Pamela Parks hier gearbeitet?«, erkundigte sich Longhurst.
»Etwa acht Jahre, denke ich«, antwortete Muriel, der wieder Tränen in die Augen schossen. »Ihr armer Mann und ihre Kinder! Was werden sie nur tun?«
Longhurst tätschelte ihr abermals die Hand und wartete darauf, dass die Tränen verebbten. »Waren Sie und Pamela Freundinnen?«, fragte er. »Ich meine, abgesehen davon, dass Sie zusammen gearbeitet haben.«
»Eigentlich nicht«, sagte Muriel und blickte mit feuchten Augen zu ihm auf. »Wir hatten nicht viel gemeinsam. Sie war sehr elegant, ganz anders als ich.«
Eine der Arzthelferinnen hatte Longhurst bereits erzählt, dass es Spannungen zwischen Muriel und Pamela gegeben habe. Ihr zufolge hatte Pamela die ältere Frau an den Rand gedrängt, weil sie mehr von Computern verstand als Muriel. Die Helferin hatte gesagt, Pamela sei ein wenig übereifrig gewesen und habe die ganze Verwaltung des medizinischen Versorgungszentrums modernisieren wollen.
Er hatte die Tote gesehen, bevor ihr Leichnam abtransportiert worden war. Sie war sehr attraktiv gewesen, in ihren frühen Vierzigern, mit blonden Strähnchen im Haar und sorgfältig manikürten Nägeln. Außerdem hatte er bereits in Erfahrung gebracht, dass sie in einem teuren Stadthaus in Clifton gewohnt und einen BMW gefahren hatte und dass ihr Ehemann, Roland Parks, ein erfolgreicher Geschäftsmann war. Ganz anders als die untersetzte schon etwas ältere Muriel.
»War diese Frau, die Sie gerade Vinnie nannten, eine Patientin?«, erkundigte er sich.
»Ich denke nicht«, erwiderte Muriel. »Natürlich könnte sie bei uns angemeldet gewesen sein. Das gilt für viele Leute, die wir niemals als Patienten zu Gesicht bekommen. Wir kennen nur die, die regelmäßig erscheinen. Aber soweit ich weiß, ist sie noch nie hier hereingekommen.«
»Dann erzählen Sie mir, was Sie von ihr gedacht haben, wenn Sie sie auf dem Platz haben sitzen sehen«, hakte er nach.
Muriel zuckte mit den Schultern. »Ich habe nicht besonders viel über sie nachgedacht und mich nur gefragt, warum die arme Seele jeden Tag dort hockte. Manchmal hatte sie eine Flasche Wein bei sich, daher nehme ich an, dass sie Alkoholikerin ist, doch sie hat nie mit den Armen gefuchtelt oder geschrien oder ist sonst irgendwie aus der Rolle gefallen.«
»Hat Pamela jemals eine Bemerkung über sie gemacht?«
»Ja, sie war ein wenig hart gegen Vinnie.« Muriel seufzte. »Sie sagte oft, die Frau solle irgendwo eingeschlossen werden. Ich nehme an, sie hatte am Ende doch recht.«
»Könnte Pamela dann vielleicht schon früher einen Zusammenstoß mit ihr gehabt haben?«, fragte Longhurst.
Muriel runzelte die Stirn, als versuchte sie, sich zu erinnern. »Das denke ich nicht, nun, sie hat jedenfalls nie etwas Derartiges erzählt. Wie dem auch sei, wenn es das gewesen wäre, warum hat die Frau dann auch Dr. Wetherall erschossen?«
»Vielleicht hat sie das nur getan, weil er aus seinem Zimmer kam«, meinte Longhurst.
»Nun, ich bin ebenfalls herausgekommen, aber mich hat sie nicht erschossen.«
Darüber hatte Longhurst bereits nachgegrübelt. Er konnte sich nicht entscheiden, ob Muriel nur Glück gehabt hatte oder ob die Schützin bestimmte Opfer im Auge gehabt hatte.
»Erzählen Sie mir, was Sie über Pamela wissen«, bat er sanft. »Alles. Wie sie mit Menschen umgegangen ist, mit Ihnen, mit den Ärzten, ihre Interessen, dergleichen Dinge.«
»Ich habe Ihnen schon gesagt, dass sie elegant war.« Muriel seufzte. »In ihrem Aussehen und ihrem Gehabe. Teure Kleider, und sie hat sich jede Woche das Haar und die Nägel machen lassen. Sie brauchte nicht zu arbeiten, sie hat es nur getan, weil es ihr gefiel. Sie und ihre Familie haben ihre Ferien zum Beispiel in Japan oder Afrika verbracht, und sie leben in einem vornehmen Haus. Über ihre Interessen weiß ich nichts, abgesehen davon, dass sie gern gekocht hat. Sie hat ständig Dinnerpartys gegeben und über Dinge wie sonnengetrocknete Tomaten geredet, als hätte ich wissen müssen, was das ist.«
Der trostlose Unterton in Muriels Stimme weckte in Longhurst die Vermutung, dass Muriel der Meinung war, sie und Pamela hätten sich an gegenüberliegenden Enden der gesellschaftlichen Skala befunden.
»Dann erzählen Sie mir etwas von sich«, schlug er vor.
»Ich bin von Pamela ungefähr so verschieden, wie man es nur sein kann«, sagte Muriel verdrossen. »Ich und mein Mann, Stan, wir wohnen in einer Sozialwohnung in Ashton. Stan arbeitet bei der Bahn. Wir waren nur ein einziges Mal im Ausland, in Spanien, und keins meiner vier Kinder hat auch nur einen Realschulabschluss erreicht, geschweige denn einen Studienplatz bekommen wie Pams Kinder.«
»Aber ich nehme an, dass Sie im Umgang mit Patienten die Verständnisvollere sind«, sagte Longhurst, bemüht, sie weiter aus ihrem Schneckenhaus zu holen.
»Ich versuche es«, erwiderte sie. In ihren Augen stand Furcht. »Ich weiß, wie es ist, wenn man sich um kranke Kinder sorgt, dann will man sofort mit dem Arzt sprechen. Pamela konnte ein wenig scharf mit den Leuten sein, vor allem mit den Armen und den Alten. Aber andererseits wollte sie dieses medizinische Versorgungszentrum wirklich zum effizientesten in Bristol machen, und es ist ihr auch gelungen, einige der Zeitvergeuder loszuwerden und Leute, die eigentlich keine Hausbesuche benötigten. Sie hat ihre Sache gut gemacht.«
Longhurst sah, wie grau Muriels Haut war und dass sie trotz der Decke immer noch zitterte. Sie war heute weiteren Fragen nicht gewachsen. »Ich werde Sie jetzt von jemandem nach Hause bringen lassen«, erklärte er. »In ein oder zwei Tagen werde ich einmal vorbeikommen müssen und mir Ihre Aussage abholen. Vielleicht werden Sie sich an weitere Einzelheiten erinnern, sobald Sie den Schock überwunden haben.«
»Ich glaube nicht, dass ich ihn jemals überwinden werde«, meinte Muriel bekümmert. »Ich habe miterlebt, wie dieses Zentrum mit nur zwei Ärzten begonnen und sich zu dem entwickelt hat, was es heute ist, einem sicheren, hübschen Ort. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals etwas Derartiges erleben würde! Das sind doch Dinge, die man sonst nur aus Amerika hört, nicht wahr?«
KAPITEL 2
Beth Powell saß an ihrem Schreibtisch in der Kanzlei Tarbuck, Stone und Aldridge und diktierte Mandantenbriefe auf Band. Jetzt, kurz vor vier Uhr nachmittags, war es schon fast dunkel, ein heftiger Regen trommelte gegen die Fensterscheiben, und die Schreibtischlampe warf ein goldenes Licht auf die Papiere und Akten vor der Anwältin.
Die meisten Menschen, mit denen Beth zu tun hatte, fanden sie umwerfend. Sie war fast einen Meter achtzig groß, trug ihr gelocktes, schwarzes Haar achtlos mit einer Spange hochgesteckt und hatte elfenbeinfarbene Haut, grüne Augen und einen breiten Mund. Als junges Mädchen hatte sie dieses Etikett gehasst und geglaubt, es sei eine höfliche Art zu sagen, dass jemand »seltsam« aussehe. Aber jetzt, mit vierundvierzig, kümmerte es sie nicht länger, was die Leute damit meinten oder dass man sie hochmütig und kalt nannte. Besser umwerfend als bedeutungslos, und sie fand nicht, dass es der Rolle einer Anwältin entsprach, eine Klatschtante zu sein, eine Mutterfigur oder eine Femme fatale.
Insgeheim war sie recht zufrieden mit ihrem Äußeren. Ihre Größe gab ihr einen Vorteil, und sie wusste, dass ihre Kleider ihr gut standen. Sie hatte den dramatischen Kontrast zwischen ihrem dunklen Haar und ihrer blassen Haut zu schätzen gelernt. Es hatte eine Zeit gegeben, da sie ihren breiten, sinnlichen Mund gehasst hatte, aber sie war Realistin, und da sie wusste, dass sie ihn nicht ändern konnte, akzeptierte sie ihn.
Sie akzeptierte auch den Umstand, dass die meisten der Klienten, die sie vor Gericht verteidigte, schuldig waren, und dass sie, wenn sie ihren Fall für sie gewann, bei der erstbesten Gelegenheit wieder straffällig werden würden. Aber andererseits liebte sie das Strafrecht: die ständigen Herausforderungen, die Mannigfaltigkeit von Fällen und die ungewöhnlichen Typen, die sie tagtäglich kennenlernte.
Beth war erst seit einem Jahr in Bristol. Davor hatte sie, seit sie erwachsen geworden war, in London gelebt und zwölf Jahre lang in derselben Kanzlei in der Chancery Lane gearbeitet.
Die Idee, von London wegzuziehen, war ihr gekommen, nachdem in ihre Wohnung in Fulham im Laufe eines Jahres drei Mal eingebrochen worden war. Für den Kauf einer sicheren Wohnung in London hätte sie sträflich viel Geld aufbringen müssen, daher hatte sie sich um Jobs in anderen Städten beworben und gedacht, ein Tapetenwechsel würde vielleicht auch eine positive Veränderung in ihrem Privatleben mit sich bringen.
Das Vorstellungsgespräch bei Tarbuck, Stone und Aldridge in Bristol war eins von vielen gewesen, in so weit verstreuten Städten wie York, Glasgow und Exeter. Beth hatte sich für diese Kanzlei einzig und allein deshalb entschieden, weil ihre Lage in einem vornehmen, georgianischen Bau an einer Ecke des Berkeley Square in Clifton, dem elegantesten Teil der Stadt, ihr gefallen hatte. Damals war Frühling gewesen, und in den Parkanlagen in der Mitte des Platzes hatten die Blüten und die Narzissen nur so geleuchtet. Das Gebäude bedurfte zwar dringend einer Innenrenovierung, wie Beth durchaus aufgefallen war, aber sie hatte sich darin nicht so beengt gefühlt wie in den Büros in der Chancery Lane. Ein zusätzlicher Vorteil war der Umstand, dass Immobilien in Bristol viel günstiger waren als in London. Es war ihr gelungen, eine sichere Wohnung im dritten Stock zu kaufen, die nur fünf Gehminuten vom Büro entfernt war und eine herrliche Panoramaaussicht auf die Stadt bot.
Bristol hatte sich als eine erheblich faszinierendere und kosmopolitischere Stadt entpuppt, als sie erwartet hatte. Seine lange und abwechslungsreiche Geschichte - schließlich war Bristol einst nach London die zweitwichtigste Hafenstadt des Landes gewesen - hatte ein Vermächtnis von erstaunlichen alten Gebäuden und einen ganz eigenen Charakter hinterlassen. Beth fand es herrlich, dass die Stadt ihre seefahrerische Vergangenheit nicht vergessen hatte; der neu instand gesetzte Hafenbereich mit einem Museum, einer Kunstgalerie und Dutzenden von Bars und Restaurants war sehr einladend. In den großen Einkaufsstraßen gab es alles, was man sich wünschen konnte, und in Clifton darüber hinaus Dutzende faszinierender, drolliger kleiner Läden, die häufig alles übertrafen, was Beth in London gefunden hatte. Aber es war kein Ehrfurcht gebietender Beton-Dschungel, hier hatte man Platz, Parks und das offene Land ganz in der Nähe. Von ihren Mandanten und aus Bemerkungen jüngerer Angestellter der Kanzlei wusste sie auch, dass es in Bristol ein reges Nachtleben gab. Aber das war etwas, das Beth nicht erkundete. Sie hatte das Alter für Discos und Nachtclubs überschritten, sagte sie sich, ebenso wie für den Versuch, jedes Restaurant, jeden Pub oder jede Kneipe auszuprobieren, doch die Wahrheit sah anders aus: Für solche Unternehmungen brauchte man Freunde. Und Freunde waren etwas, das sie nicht hatte.
»Du brauchst sie nicht«, murmelte sie vor sich hin, wie sie es immer tat, wenn dieser Gedanke ihr kam. »Du bist vollkommen glücklich mit deinem Leben, wie es jetzt ist.«
Plötzlich wurde die Tür zu Beth' Büro geöffnet, und Steven Smythe, einer der anderen in der Kanzlei tätigen Anwälte, kam hereingestürzt. Sein Gesicht glühte vor Aufregung und war rot vor Anstrengung, weil er die Treppe hinaufgelaufen war.
»Sie werden nach Bridewell gerufen«, stieß er hervor. »Als Pflichtverteidigerin.«
Beth wusste, was das bedeutete: Die Reihe war an ihr, jemandem, der verhaftet worden war, juristischen Beistand anzubieten. Wenn die Polizei feststellte, dass eine verhaftete Person keinen eigenen Anwalt hatte, konsultierte sie den Pflichtplan und rief denjenigen an, der als Nächster auf der Liste stand. Diesmal war es Beth, aber genauso gut hätte es Steven sein können oder jeder andere Anwalt. Es war einfach Zufall.
»Spielen Sie heute den Laufburschen?«, fragte sie sarkastisch. Die Empfangsdame unten hätte sie anrufen können, um es ihr mitzuteilen. Aber Steven suchte stets nach einer Gelegenheit, um mit ihr zu sprechen. Sie wusste nicht, warum, denn sie schenkte ihm nie viel Beachtung.
Er hatte es sich anscheinend in den Kopf gesetzt, sich mit ihr anzufreunden. Kurz nach ihrem Eintreffen in der Kanzlei hatte er gesagt, sie hätten seiner Meinung nach eine Menge gemeinsam. Obwohl es stimmte, dass sie im gleichen Alter waren, die gleiche Liebe zum Strafrecht hatten und aus ähnlichen Verhältnissen stammten, gefiel Beth die Art nicht, wie er an ihren Lippen hing, was auch immer sie sagte. Außerdem war er verheiratet und hatte zwei kleine Kinder, daher hatte sie nicht die Absicht, ihn zu ermutigen.
Ein Teil des Problems war vermutlich, dass er nirgendwo hinpasste. Er war weder der Typ, der mit seinen Kumpels abhing, noch ein Frauenheld. Sie vermutete, dass er in der Schule ein Streber gewesen war. Und obwohl er ganz nett aussah, hochgewachsen und gut gebaut war und ein kräftiges Kinn sowie attraktive blaue Augen hatte, waren seine Kleider stets zerknittert, und er brauchte dringend einen anständigen Haarschnitt.
»Ich bin hochgekommen, um es Ihnen selbst zu erzählen, weil es die Frau ist, die heute Morgen in Hotwells diese zwei Leute erschossen hat«, berichtete er.
Sofort wurde Beth von der gleichen Erregung durchflutet, die Steven die drei Etagen hinaufgetrieben hatte, um es ihr persönlich zu sagen. Aber es war nicht ihre Art, dergleichen offen zu erkennen zu geben.
»Tatsächlich!«, erwiderte sie kühl. Dann stand sie auf und griff nach ihrer Aktentasche. Die Nachricht über die Schüsse hatte die Kanzlei gegen Mittag erreicht und großes Entsetzen und reichlich Spekulationen ausgelöst. Niemand konnte sich daran erinnern, dass je zuvor eine Frau in Bristol auf jemanden geschossen hätte. Noch unglaublicher war die Tatsache, dass das Ganze in einer gut besuchten Gemeinschaftspraxis geschehen war.
»Ich nehme an, die Frau ist wahnsinnig«, meinte Steven. »Anscheinend weigert sie sich, auch nur ihren Namen zu nennen, und sie hat seit ihrer Verhaftung kein Wort gesagt.«
»Nun, selbst Wahnsinnige haben ein Anrecht auf juristischen Beistand«, entgegnete Beth energisch und wünschte, er würde verschwinden und sie gehen lassen.
»Haben Sie schon je zuvor einen Mörder verteidigt?«, fragte er. Er bekam scheinbar nicht mit, dass sie sofort aufbrechen wollte.
»Ja, das habe ich, Steven«, antwortete sie und bedachte ihn mit einem eisigen Blick. »So, ich muss gehen. Wir sehen uns morgen.«
Unten im Flur blieb Beth stehen, um ihren Regenmantel anzuziehen und sich einen Schirm aus dem Ständer zu nehmen. Sie ließ ihren Wagen tagsüber stets in der Garage hinter ihrem Wohnblock stehen, da sowohl das Polizeirevier als auch die Gerichte zu Fuß nur fünfzehn Minuten entfernt lagen und es meist schwierig war, einen Parkplatz zu ergattern. Aber es regnete so heftig, dass sie hoffte, heute ein Taxi zu bekommen. Es war jedoch eine schwache Hoffnung - in Bristol schienen Taxis seltener zu sein als Hühnerzähne.
Nach einigen Worten mit dem diensthabenden Sergeant in Bridewell blieb Beth vor dem Verhörraum stehen, wo die Angeklagte festgehalten wurde. Von hier aus konnte man sie sich zuerst durch das kleine Fenster in der Tür ansehen.
Für einen flüchtigen Augenblick blitzte so etwas wie Wiedererkennen in Beth auf, als sie die Frau betrachtete, die in sich zusammengesunken auf ihrem Stuhl saß, aber als sie genauer hinschaute, wurde ihr klar, dass das wahrscheinlich nur an dem überaus alltäglichen Aussehen der Frau lag. Sie war klein und plump, mit einem runden, rötlichen Gesicht und strähnigem, braunem Haar und trug eine dunkelblaue Polyesterhose und einen formlosen Pullover, beides sehr abgetragen und voller Zugfäden. Sie war nicht zu unterscheiden von ungezählten anderen abgehetzten Frauen, die an Bushaltestellen warteten, in Supermärkten einkauften oder davoneilten, um Büros zu putzen, vielleicht mit Ausnahme der Turnschuhe an ihren Füßen. Vermutlich war sie nicht viel älter als sie selbst, überlegte Beth, und gewiss sah sie nicht so aus, als wäre sie fähig, kaltblütig zwei Menschen zu töten.
Die Tür öffnete sich für Beth, und sie ging hinein. »Ich bin Beth Powell, Ihre Pflichtverteidigerin«, sagte sie energisch. »Man hat mich hinzugezogen, um Sie über Ihre Rechte zu belehren.«
Die Frau riss den Kopf herum, und eine Sekunde lang brachte ihr erschrockener, überraschter Blick Beth aus dem Gleichgewicht.
»Sind wir uns schon einmal begegnet?«, fragte Beth. Sie betrachtete das Gesicht der Frau eingehender, aber obwohl es etwas schrecklich Vertrautes hatte, konnte sie gewiss nicht sagen, von wo oder aus welcher Zeit diese Vertrautheit stammte.
Die Frau schüttelte den Kopf, und Beth musste annehmen, dass ihre überraschte Miene lediglich dem Umstand geschuldet war, dass man ihr plötzlich einen Rechtsbeistand angeboten hatte. Vielleicht hatte sie noch nicht ganz begriffen, was sie getan hatte.
Beth setzte sich an den Tisch und begann, genauer zu erklären, warum sie da war. Der diensthabende Beamte hatte ihr bereits alle Informationen gegeben, die über die Schüsse bekannt waren. Die Angeklagte hatte unumwunden zugegeben, dass sie dafür verantwortlich war, wollte aber nicht mehr sagen und war nicht einmal bereit, ihren Namen oder ihre Adresse zu nennen. Obwohl ihr Schweigen nicht ungewöhnlich war - sehr viele Menschen weigerten sich nach ihrer Verhaftung, ein Wort zu sprechen -, war es seltsam, dass jemand die Straftat zugab und dann verbissen schwieg.
Die Polizei versuchte jetzt festzustellen, wer sie war und wo sie wohnte, denn sie hatte nichts bei sich, anhand dessen man sie hätte identifizieren können. Doch der Revolver, den sie benutzt hatte, war der seltsamste Aspekt des Verbrechens. Die Polizei war der Meinung, es sei eine sehr alte Waffe, die sorgfältig gereinigt und gewartet worden war.
»Kommen Sie«, drängte Beth ein wenig ungeduldig, nachdem sie erklärt hatte, was sie bereits wusste. »Ich muss Ihren Namen wissen. Ich kann Ihnen nicht helfen, wenn ich nichts über Sie weiß.«
Die Frau blickte zu Beth auf. Ihre Augen waren von einem blassen, grünlichen Blau ohne jedes Licht darin. »Ich will keine Hilfe«, sagte sie.
»Aber Sie werden jemanden brauchen, der Sie verteidigt, wenn Sie vor Gericht gestellt werden«, erwiderte Beth. Sie dachte, dass die Frau die Ungeheuerlichkeit ihrer Tat noch immer nicht verstanden hatte. Oder war sie vielleicht einfältig?
»Sie haben zwei Menschen getötet. Sie werden deswegen wahrscheinlich den Rest Ihres Lebens im Gefängnis verbringen.«
Wieder sah die Frau zu ihr auf, und jetzt stand ein schwacher Funke in ihren Augen. »Das war es wert«, sagte sie.
Wieder stutzte Beth beim Klang der Stimme der Frau. Auch sie kam ihr irgendwie bekannt vor. Sie musterte ihr Gesicht und ging im Geiste Frauen durch, die sie in der Vergangenheit befragt oder die sie in der Kanzlei auf Kollegen hatte warten sehen. Aber obwohl sie sich an andere gleichermaßen schäbig gekleidete Frauen ihres Alters erinnern konnte, passte die Stimme zu keinem dieser Gesichter.
»Nun, ob es Sie nun kümmert, ob sie lebenslänglich bekommen, oder nicht - Sie könnten zumindest sowohl der Polizei als auch mir verraten, wer Sie sind, woher Sie kommen und warum Sie diese unschuldigen Menschen getötet haben«, bemerkte sie scharf.
»Sie waren nicht unschuldig«, blaffte die Frau. »Sie haben den Tod verdient.«
»Warum?«, fragte Beth. »Was haben Sie Ihnen getan?«
»Gehen Sie weg.« Die Frau drehte sich geringschätzig zur Wand um. »Ich habe Ihnen nichts mehr zu sagen. Die beiden wussten, warum, und das ist alles, was zählt.«
Beth saß eine Weile schweigend da, musterte die Frau und fragte sich, was sie als Nächstes tun sollte. Sie hatte Menschen aus allen Schichten wegen aller möglichen Verbrechen verteidigt. Fast alle hatten ihre Unschuld beteuert, obwohl ganz offensichtlich gewesen war, dass sie die Verbrechen begangen hatten. Manchmal erzählten sie ihr zu viel, manchmal nicht genug. Einige von ihnen hatte sie zu mögen begonnen, wie schwerwiegend ihr Verbrechen auch gewesen sein mochte, andere waren so unangenehm gewesen, dass sie beinahe froh gewesen war, wenn sie den Fall verloren hatte. Beth glaubte, inzwischen eine Menge über Straftäter und das Rechtswesen zu wissen. Aber obwohl sie nicht das erste Mal mit jemandem zu tun hatte, der seine Schuld offen eingestand und keine Reue zeigte, war es doch das erste Mal, dass ein Mandant sein Tun nicht erklären wollte oder versuchte, sie von der Richtigkeit seines Handelns zu überzeugen.
Einer der Polizeibeamten hatte gesagt, die Frau sei Alkoholikerin. Die Röte ihres Gesichtes schien das zu bestätigen. Doch soweit der Beamte wusste, war sie nie wegen Trunkenheit oder Störung der öffentlichen Ruhe in Gewahrsam genommen worden. Ihre Fingernägel waren abgekaut, und Beth glaubte nicht, dass ihr Haar während der letzten Tage eine Bürste oder einen Kamm gesehen hatte. Doch sie sah weder so aus noch roch sie so, als schliefe sie auf der Straße. Und dann war da noch die Sache mit der Waffe.
Wie sollte eine Frau wie sie an einen Armeerevolver kommen?
Revolver waren keine typisch »weiblichen« Waffen. Obwohl Beth glaubte, dass fast jede Frau unter Druck eine Pistole auf jemanden richten und abfeuern konnte, um einen geliebten Menschen zu verteidigen, war es doch extrem selten, dass eine Frau kaltblütig eine solche Waffe benutzte.
Wieder dachte sie über den vertrauten Klang ihrer Stimme nach, den sie sich nicht erklären konnte. Oder kam diese Stimme ihr nur bekannt vor, weil sie ihrer eigenen ähnelte: gut moduliertes, korrektes Englisch, das weder affektiert wirkte noch irgendeine Dialektfärbung erkennen ließ. Wahrscheinlich stammte die Frau aus bürgerlichen Verhältnissen, und vielleicht war in ihrem Umfeld gejagt und geschossen worden.
Normalerweise lag es Beth nicht zu betteln. Wäre dies irgendeine andere Art von Verbrechen gewesen, wäre sie einfach aufgestanden und gegangen und hätte gesagt: »Ich sehe Sie morgen vor Gericht.« Aber jetzt war sie neugierig, daher neigte sie dazu, ein wenig nachzugeben.
»Bitte, verraten Sie mir Ihren Namen, wenn schon nichts anderes«, begann sie. »Die Polizei wird ihn bald genug herausfinden, aber ich möchte ihn wissen, damit ich Sie richtig ansprechen kann. Bitte!«
Die Frau hielt den Kopf gesenkt, und es verging mindestens eine Minute, bevor sie sprach. »Also schön, ich heiße Fellows, Susan Fellows. Aber das ist alles, was ich Ihnen sagen werde. Ich weiß, Sie meinen es wahrscheinlich gut, daher bringen Sie mich vor Gericht und lassen Sie mich verurteilen! Ich habe es getan. Sie können mich bestrafen. Es gibt nichts mehr zu sagen.«
Die vornehme Herkunft der Frau schimmerte durch und berührte Beth auf eine Weise, die sie nicht erwartet hatte. Fast alle ihre bisherigen weiblichen Mandanten in Bristol waren aus einfachen Verhältnissen gewesen - in der Hauptsache Ladendiebinnen, Prostituierte und Drogensüchtige. Sie hatte nicht einmal versucht, sich mit ihnen zu identifizieren, und nur selten wirklich mit ihnen sympathisiert, wie hart das Leben sie auch behandelt haben mochte. Beth hatte immer geglaubt, das sei der Grund, warum sie als Verteidigerin so gut war, denn sie konnte die Fälle ihrer Mandanten kalt und leidenschaftslos betrachten und ihre Strategie planen, um um jeden Preis zu gewinnen. Zum ersten Mal seit vielen Jahren wusste sie einfach nicht, wie sie einen Fall angehen sollte.
Sie stand auf, hielt aber noch einmal inne, bevor sie den Raum verließ, und legte der Frau eine Hand auf die Schulter. »Man wird Sie morgen dem Richter vorführen, Susan, aber nur, damit die Polizei Sie noch einmal vierundzwanzig Stunden festhalten kann, während sie Erkundigungen über Sie einzieht. Dann werden Sie wieder vor Gericht kommen. Danach wird man Sie in Untersuchungshaft nehmen, was Gefängnis bedeutet. Sie werden dort eine lange Zeit verbringen, bevor es zur Verhandlung kommt. Der Arzt, den Sie erschossen haben, hat eine Frau und vier Kinder hinterlassen, die Arzthelferin hatte einen Ehemann und zwei Kinder. Diese Leute haben ein Recht zu erfahren, warum Sie das getan haben. Dann wäre da noch ich. Ich muss es ebenfalls wissen, wenn ich Sie vertreten und eine faire Verhandlung für Sie herausholen soll. Also möchte ich, dass Sie heute Abend darüber nachdenken, und morgen werde ich dann wieder mit Ihnen sprechen.«
Susan blickte auf, und ihre Augen waren immer noch kalt und ausdruckslos. Sie nickte nur, und Beth konnte nicht erkennen, ob es ein zustimmendes Nicken war oder ob sie einfach die Bitte zur Kenntnis nahm.
Beth fühlte sich mutlos, als sie den Verhörraum verließ. Die Medien würden nach Informationen über diesen Fall lechzen, er würde landesweites, vielleicht sogar weltweites Interesse erregen, und Beth war sich darüber im Klaren, dass sie mitten im Rampenlicht stehen würde. Sie musste mehr über diese Frau in Erfahrung bringen, es würde ihrem eigenen Ruf absolut nicht guttun, wenn sie bei ihrem ersten Gespräch mit ihrer Mandantin ein absolutes Versagen eingestehen musste.
Als sie durch die letzte Tür in den Empfangsbereich des Polizeireviers trat, dachte sie plötzlich an Detective Inspector Roy Longhurst. Er hatte die Verhaftung vorgenommen, und da sie ihm einige Male zuvor flüchtig begegnet war, konnte er ihr vielleicht etwas sagen, das sie benutzen konnte, um Susan Fellows zum Sprechen zu bringen.
Beth erkundigte sich am Empfangstresen, ob Detective Inspector Longhurst noch Dienst habe, und die junge Polizistin erklärte ihr, dass er gleich nach Hause fahren wolle. Sie erbot sich, in seinem Büro anzurufen und festzustellen, ob er noch da war.
Als die Polizistin nickte und Beth lächelnd das Telefon hinhielt, damit sie direkt mit dem Detective Inspector sprechen konnte, musste sie schnell nachdenken.
»Hier ist Beth Powell«, sagte sie und hoffte, dass er sich erstens an sie erinnern würde und dass die persönliche Beziehung, von der sie glaubte, sie bei ihrer letzten Begegnung mit ihm angeknüpft zu haben, nicht nur ihrer Fantasie entsprang. »Ich wurde als Pflichtverteidigerin für die Frau hinzugezogen, die wegen der Schießerei verhaftet worden ist.«
»Ich hoffe, sie hat Ihnen ein wenig mehr erzählt als mir«, antwortete er. Die Erschöpfung war ihm anzuhören.
»Ich fürchte, das hat sie nicht«, gestand Beth. »Sie hat mir lediglich ihren Namen genannt. Sie heißt Susan Fellows.«
»Nun, das ist immerhin ein Anfang«, meinte er.
»Ich habe mich gefragt, ob Sie Lust hätten, nach der Arbeit einen Drink mit mir zu nehmen«, sagte Beth und hoffte, nicht allzu leicht durchschaubar zu sein.
»Also, das ist das beste Angebot, das ich heute bekommen habe«, erwiderte er, und seine Stimme klang plötzlich unbeschwerter. »Ich bin gleich unten.«
Er grinste, als er wenig später durch die Tür trat. »Es ist nicht nur mein Charme, nicht wahr?«, fragte er, und seine dunkelbraunen Augen funkelten. »Sie wollen mich bloß über den Fall aushorchen.«
»Ich kann nicht lügen«, antwortete sie mit einem Lächeln. »Aber es war Ihr Charme, der mich dazu gebracht hat, die Frage zu riskieren.«
»Ich bin froh darüber.« Er fuhr sich mit den Fingern geistesabwesend durch das volle Haar. »Nach dem Tag, den ich gerade hinter mir habe, würde ich für ein Glas Bier meine Seele verkaufen.«
Sie gingen ins Assizes, einen Pub in der Small Street, der sich zur Mittagszeit einiger Beliebtheit beim juristischen Berufsstand erfreute. Jetzt war es ruhig, nur wenige Leute nahmen einen Drink, bevor sie nach Hause fuhren.
Beth war Longhurst das erste Mal im Krongericht von Bristol begegnet. Sie hatten beide dort gewartet und ein ziemlich kurzes Gespräch über Verbrecher im Allgemeinen geführt, und er war ihr wie der Typ vorgekommen, dessen Devise lautete: »Hängt ihn höher.« Er hatte ihr eine Geschichte über zwei junge Männer erzählt, die bei einem Autounfall ums Leben gekommen waren. Wie sich herausgestellt hatte, waren sie auf dem Heimweg gewesen, nachdem sie das Haus eines alten Pensionärs ausgeraubt hatten. Longhurst hatte mit einiger Zufriedenheit berichtet, dass die beiden Verbrecher nun nicht länger auf freiem Fuß waren, um jemand anderen zu terrorisieren.
Obwohl niemand, der bei Verstand war, das Dahinscheiden zweier so bösartiger Ganoven betrauern würde, kannte Beth doch nicht viele Menschen, die eine derartige Freude offen zugeben würden. Longhurst hatte die Geschichte außerdem mit einigem Humor erzählt, und es war erfrischend, jemanden kennenzulernen, der sich nicht dem Diktat der politischen Korrektheit unterwarf.
Während der letzten Monate hatte sie auch Mandanten gehabt, die von Longhurst gesprochen hatten. Es war interessant, dass sie ihn zwar fürchteten, ihn aber auch dafür bewunderten, dass er »geradeheraus« war. Ein Serientäter hatte gesagt, er lasse sich lieber von Roy Longhurst verhaften als von irgendjemandem sonst, weil der keine Beweise fälsche.
Bei einem Glas Bier erzählte Roy Longhurst Beth, was er von den Ereignissen in Hotwells an diesem Morgen hielt. »Ich bin nicht leicht zu schockieren«, meinte er stirnrunzelnd. »Aber wenn eine verdammte Säuferin zwei Menschen auslöscht und insgesamt sechs Kinder als Halbwaisen zurücklässt, kocht mir das Blut über. Ich wünschte, das Überfallkommando hätte sie ebenfalls erschossen. Jetzt wird sie vor Gericht gestellt und auf Kosten des Steuerzahlers im Gefängnis untergebracht. Wofür? Sie ist wertlos.«
»Tatsächlich kam sie mir nicht wie eine Säuferin vor«, entgegnete Beth scharf. »Und sie muss irgendeinen Groll gehegt haben, um zu tun, was sie getan hat.«
»Ersparen Sie mir das blutende Herz«, rief er vernichtend. »Sie muss wahnsinnig sein, wahrscheinlich aus irgendeinem Irrenhaus entlassen. Jeder andere mit einem Groll gegen eine Arztpraxis beschwert sich über die geziemenden Kanäle.«
Auf dem Weg zum Polizeirevier hatte Beth ganz ähnlich gedacht wie Longhurst. Obwohl Susan ihr keinen Grund gegeben hatte, ihre Meinung zu ändern, begann Beth automatisch, sie zu verteidigen.
»Vielleicht hat sie es versucht, und niemand wollte ihr zuhören«, gab sie zurück. »Sehen Sie sich selbst an, Detective Inspector Longhurst, wie Sie hier bei Ihrem Bier sitzen, überzeugt davon, dass diese Frau wertlos ist, nur weil sie schäbig gekleidet ist. Denken Sie an meine Worte, es wird einen verdammt guten Grund geben, warum sie es getan hat.«
Er lachte nur. »Mir ist noch nie jemand untergekommen, der einen echten Groll hegte und nicht darauf bestand, einem davon zu erzählen, und zwar haarklein. Sie hat kein Wort gesagt, hat nicht einmal geweint.«
Sie diskutierten noch eine Weile, aber zu Beth' Überraschung fand sie ihn eher witzig als bigott. Er machte umwälzende Vorschläge - er fand, Dieben sollten die Hände abgeschlagen werden, und wollte die Kastration für Pädophile und die Rute für junge Straftäter -, aber da Beth bei gewissen Mandanten ähnlich gedacht hatte und Longhurst seine Meinung auf so amüsante Weise vorbrachte, hörte sie auf, mit ihm zu diskutieren, und lachte lieber mit ihm.
»Nun, Susan Fellows kommt mir nicht wie eine richtige Irre vor«, sagte sie schließlich. »Vielleicht ein wenig einfältig, doch trotz ihres Aussehens und ihrer Kleidung hat sie etwas Kultiviertes an sich. Ich hatte das seltsame Gefühl, ihr schon einmal begegnet zu sein!«
»Wirklich?« Longhurst sah sie überrascht an. »Irgendeine Ahnung, wo?«
Beth schüttelte den Kopf. »Nicht die geringste. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es an ihrer Art zu reden liegt. Ich meine, ich habe hier sonst fast nur mit Leuten zu tun, die einen Dialekt sprechen, und wenn ich mal korrektes Englisch höre, ist das immer eine angenehme Überraschung.«
Longhurst grinste. »In den Zellen gibt es nicht allzu viele vornehme Stimmen«, gab er zu. »Dann ist da die Frage des Revolvers. Ich denke, wir werden herausfinden, dass er ihr gehört. Ihr Vater hat ihn ihr hinterlassen, etwas in der Art. Natürlich könnte jeder mit dieser Waffe einen direkten Treffer landen, vor allem aus solcher Nähe, aber ich würde sagen, dass sie den größten Teil ihres Lebens Umgang mit Waffen hatte.«
»Was ist mit den Opfern?«, fragte Beth. »Was wissen Sie über die beiden? Oder muss ich bis morgen warten und es aus der Zeitung erfahren?«
»Alle beide sehr gut vorzeigbar«, sagte er. »Dr. Wetherall war sechsundfünfzig, lebte draußen in Long Ashton, spielte Golf, ein guter Vater und Ehemann. Ganz das, was man von einem Familienarzt erwarten würde. Bei der Arzthelferin sah es ähnlich aus: auskömmliche Verhältnisse, zwei Kinder auf der Universität. Das einzig Nachteilige, was wir über sie erfahren konnten, ist, dass sie ein Drache war, schroff gegen die Patienten, ein wenig herrschsüchtig dem anderen Personal gegenüber. Ich denke nicht, dass sie in der Praxis sehr beliebt war. Aber das ist kein Grund, sie zu erschießen, in Arztpraxen gibt es immer solche Drachen.«
Longhurst konnte ihr nur wenig mehr erzählen, außer über die eigentliche Verhaftung und was die anderen Angestellten im Gesundheitszentrum ihm berichtet hatten, und nachdem er ihnen beiden einen zweiten Drink spendiert hatte, erkundigte er sich, wie sie sich in Bristol eingelebt habe. Bei ihrer ersten Begegnung war sie noch nicht sehr lange in der Stadt gewesen.
»Ziemlich gut«, antwortete sie. »Ruhige, wunderschöne Landschaft, und es ist großartig, nicht länger die U-Bahn ertragen zu müssen. Wenn ich nur jemand Verlässliches hätte, der einige Arbeiten in meiner Wohnung übernimmt, würde ich alles so ziemlich perfekt finden.«
»Dann haben Sie also noch keinen Mann?«, fragte er.
Beth war empört. Es machte sie immer wütend, wenn Leute am Ende wissen wollten, ob sie einen Partner habe. »Ist es das, wofür Ihrer Meinung nach eine Frau einen Mann braucht?«, blaffte sie ihn an. »Nur um einige Regale zusammenzusetzen und ein paar Schränke zu bauen? Ist das alles, was Ihre Frau an Ihnen schätzt?«
»Ich habe keine Frau.« Er zuckte mit den Schultern. »Zumindest nicht mehr. Und selbst als wir zusammen waren, war ich keine große Leuchte als Handwerker.«
Beth fühlte sich leicht getadelt. »Es tut mir leid«, sagte sie. »Ich habe nur angenommen, Sie seien herablassend. Weil ich ledig bin, höre ich diese Art von Bemerkung ständig, und es ärgert mich. Außerdem habe ich angenommen, Sie seien verheiratet.«
»Ich wollte gewiss nicht herablassend klingen«, erwiderte er niedergeschmettert. »Ich habe nur angenommen, eine gut aussehende, kluge Frau wie Sie wäre vergeben. So viel zum Thema Annahmen.« Er lachte. »Aber auf das Risiko hin, dass Sie mir gleich ein Messer in die Eingeweide rammen: Darf ich mich erkundigen, ob Sie freiwillig allein sind oder umständehalber?«
Er befand sich auf gefährlichem Terrain, doch aus irgendeinem Grund fand Beth es diesmal amüsant. »Ein wenig von beidem, schätze ich. Für die meisten Männer wäre ich zu engagiert, was meine Arbeit betrifft.«
»Das war der Vorwand meiner Exfrau, um mich zu verlassen«, gestand er und lächelte sie an. Beth bemerkte, dass sie sein Lächeln erwiderte.
Zwei Stunden später ging Beth nach Hause. Roy - er hatte darauf bestanden, dass sie ihn so nennen müsse - hatte sich erboten, sie nach Hause zu fahren, aber sie hatte die Ausrede vorgeschützt, zu Fuß schneller in Christmas Steps zu sein, wo sie in der Park Row wohnte. Das entsprach nicht ganz der Wahrheit, und in der Dunkelheit und bei dem schweren Regen war es kein angenehmer Spaziergang, doch Beth erlaubte einem Mann nur selten, etwas für sie zu tun. Sie hatte in der Vergangenheit leider die Erfahrung gemacht, dass selbst etwas so Simples wie eine Tasse Kaffee oder eine Fahrt nach Hause Männer zu der Annahme verleiten konnte, sie sei ihnen etwas schuldig.
Doch vielleicht war es töricht gewesen, Roys Angebot abzulehnen, dachte sie jetzt. Schließlich war es nett gewesen, mit ihm einen Drink zu nehmen und zu plaudern. Er war der erste Mann seit sehr langer Zeit, der sie faszinierte. Auf der einen Seite war er geradezu das Sinnbild eines Polizisten, ein Macho, voreingenommen, ein harter Bursche. Doch es hatte Augenblicke gegeben, in denen er eine so viel sanftere, empfindsame und nachdenkliche Seite offenbart hatte. Außerdem gefiel ihr sein simpler Humor.
Aber sie wusste nicht, warum sie all das interessieren sollte. Männer bedeuteten für sie nichts als Ärger. Während sie immer noch halb hoffte, dass irgendwo da draußen ein Mann war, der ebenso unabhängig und intelligent war wie sie selbst, liebevoll und empfindsam, ohne eine Menge emotionalen Ballast, war sie bereits zu abgestumpft, um wirklich an die Existenz eines solchen Traummannes zu glauben. Allein zu sein war nicht dasselbe wie Einsamkeit. Beth genoss es, die Freiheit zu haben, genau das zu tun, was ihr gefiel.
Als sie in ihre Wohnung im dritten Stockwerk trat, verspürte sie ein jähes Gefühl der Freude über die Panoramaaussicht aus ihrem Fenster auf die Lichter der Stadt. Die Wohnung selbst war ziemlich gewöhnlich und eng, aber die Aussicht war der Grund gewesen, warum sie sie gekauft hatte.
Sie hatte sie jetzt in ein gemütliches Heim verwandelt. Fast alles war in Cremetönen gehalten, von den Wänden bis zu den Teppichen und Gardinen - auf diese Weise wirkte die Wohnung größer. Die einzige Farbe kam von ihrer Bildersammlung, leuchtenden, modernen Kunstwerken, größtenteils Originalen von wenig bekannten Künstlern, die sie in kleinen Galerien und auf Handwerkermärkten in ganz England gekauft hatte. Ihr Lieblingsbild zeigte ein Stück Kirschpastete mit Eiercreme. Was ihr Vater wohl dazu gesagt hätte? Die Vorstellung erheiterte sie. Er war ein solcher Snob, er hatte sich auf all die grässlichen alten Gemälde gestürzt, die er von seinem Großvater geerbt hatte, allein weil er dachte, ihr Alter mache sie wertvoll. Niemals würde er ihre Ansicht teilen, dass man ein Bild haben sollte, weil man es gern anschaute, und dass sein monetärer Wert unwichtig war.
Nachdem sie die Schuhe von den Füßen geschleudert und ihren nassen Mantel zum Trocknen an die Flurtür gehängt hatte, warf sie sich aufs Sofa. Die Bequemlichkeit des Möbelstücks ließ sie wieder an Susan Fellows denken. Hatte sie schon einmal eine Nacht in einer Zelle verbracht? Machte es ihr Angst, morgen ihr Tun erklären zu müssen?
Es war frustrierend, nichts über sie zu wissen, und Beth wünschte, sie hätte aufhören können zu denken, dass sie der Frau schon einmal begegnet war. Was konnte Susan widerfahren sein, dass sie bei jeder Witterung vor einer Arztpraxis gesessen hatte? Und was hatte sie zu einer Mörderin werden lassen?
Beth erinnerte sich an eine Frau, die sie vor einigen Jahren in London verteidigt hatte. Sie hatte eine Affäre mit einem verheirateten Mann gehabt, der sie jahrelang mit der Behauptung hingehalten hatte, er werde seine Frau verlassen. Als er eines Nachts aus einem Pub kam, hatte sie ihn angesprungen und ihm ein Tranchiermesser in den Rücken gerammt. Die einzige Erklärung, die sie zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung hatte abgeben können, war die, dass sie ihn früher am Tag gesehen hatte, wie er zusammen mit seiner Frau Gardinen gekauft hatte.
Es hatte so nichtig geklungen, so absolut irrational, und doch hatte Beth, während sie die Frau näher kennenlernte, zu verstehen begonnen. Gardinen, hatte ihre Mandantin erklärt, waren etwas, das eine Frau für gewöhnlich allein kaufte. Die bloße Tatsache, dass ihr Mann sie begleitete, ganz vertieft in die Auswahl des Materials, war ein Beweis dafür, dass die beiden ein Paar waren, das alles teilte und das sein Zuhause gleichermaßen schätzte. Sie hatte daraus den Schluss gezogen, dass er nicht beabsichtigte, sein Heim oder seine Frau zu verlassen. Niemals.
Natürlich würde sich Susan kaum als die Geliebte des Arztes entpuppen. Und die Arzthelferin Pamela Parks war auch nicht ihre lesbische Liebhaberin gewesen. Also, was blieb übrig?
Vielleicht hatte man ihr in der Praxis irgendwann eine Behandlung verweigert?
Aber Roy hatte gesagt, eine der Helferinnen habe ihm erzählt, Susan sei dort nicht Patientin gewesen. Also hatten sie vielleicht jemandem, den sie liebte, etwas angetan?
Konnten die beiden Opfer eine Affäre gehabt haben, und einer ihrer Partner war ein Freund oder Verwandter von Susan? Es schien eine starke Möglichkeit zu sein. Sie waren im richtigen Alter für Affären gewesen, beide attraktive, sympathische Typen, so wie es sich anhörte, die täglich Zeit miteinander verbracht hatten. Doch sie dafür zu töten war ein wenig übertrieben.
Beth schaltete den Fernseher ein, um sich die Nachrichten anzusehen. Die tödlichen Schüsse in der Gemeinschaftspraxis würden dort zweifellos Thema sein, und vielleicht hatten einige der Journalisten bereits Einzelheiten herausgefunden, von denen sie und die Polizei nichts wussten.
KAPITEL 3
Während Beth darüber nachgrübelte, warum eine Frau wohl zwei Menschen erschoss, lag Susan Fellows auf ihrem Bett in der Gefängniszelle und versuchte, ihren Geist zur Ruhe kommen zu lassen. Das war die Art und Weise, wie sie schon früher im Leben schlimme Phasen durchgestanden hatte. Hier sollte es doch einfach sein, weil es keine Ablenkungen gab, sagte sie sich. Unpersönliche, leuchtend grün gestrichene Wände mit überraschend wenigen Graffiti, nichts als eine Toilettenschüssel und ein kleines Waschbecken, das man ansehen konnte.
Aber die grünen Wände erinnerten sie an Beth Powells Augen.
Sie wünschte, sie hätte sich einreden können, dass es purer Zufall sei, dass die Anwältin denselben Namen trug wie ihre Freundin aus Kindertagen - schließlich hatte Beth sie nicht wiedererkannt. Außerdem konnte das Schicksal doch gewiss nicht so grausam sein, sie in einer solchen Phase ihres Lebens zu ihr zurückzubringen?
Aber selbst mit zehn Jahren war ihre Beth sehr groß gewesen, und ihre grünen Augen, das schwarze Haar und die helle Haut hatten sie einzigartig gemacht. Susan war sich in einem Punkt ziemlich sicher: Wenn sie sich getraut hätte, ihr die Spange aus dem Haar zu ziehen, wären der Frau die Locken, um die sie ihre Freundin früher so oft beneidet hatte, auf die Schultern gefallen.
Susan wusste, dass es ihre Beth war, doch warum hatte sie sie nicht ebenfalls erkannt? Und weshalb war sie hier in Bristol?
Immer noch zitternd vom Schock der Begegnung ließ Susan ihre Gedanken vierunddreißig Jahre zurückwandern bis zu dem Tag ihrer ersten Begegnung, einem heißen Augusttag im Jahr 1961. Sie selbst war damals zehn Jahre alt gewesen. Ihr Vater hatte sich an jenem Tag erboten, sie nach dem Mittagessen zu Hause mit nach Stratford-upon-Avon zu nehmen, wo sie in die Bibliothek gehen und in den Läden herumstöbern konnte. Wenn er Feierabend machte und sein Büro schloss, wollten sie zusammen nach Hause fahren.
Susan war ihres Ladenbummels bald müde, weil es so heiß war, daher ging sie zum Fluss hinunter und setzte sich dort ins Gras, um die Leute auf den Ausflugsschiffen zu beobachten. Überall um sie herum waren Menschen, die picknickten oder in der Sonne dösten, Familien, alte Leute und viele ausländische Touristen. Sie hatte damals nicht viel über William Shakespeare gewusst, und es hatte sie immer wieder verblüfft, dass Menschen aus anderen Ländern kamen, nur um zu sehen, wo dieser Mann geboren worden war. Einmal hatte sie ihren Vater gefragt, ob er wie Jesus sei, und ihr Dad hatte vor Lachen gebrüllt.
Sie hatte schon ein Weilchen da gesessen, als sie ein anderes Mädchen unter einem Baum hatte stehen sehen. Es starrte sie an. Susan war sehr schüchtern, und ihr erster Gedanke war, dass mit ihr etwas ganz und gar nicht stimmen könne, wenn jemand sie so anschaute. Sie dachte außerdem, das Mädchen sei viel älter als sie selbst, denn es war groß, und sie beneidete es um sein gelocktes, schwarzes Haar, die weißen Shorts und die rosafarbene Bluse. Susan trug immer Kleider - ihre Mutter nähte sie, und einige Mädchen in der Schule lachten über diese Kleider, weil sie gesmokt waren und Puffärmel hatten, sodass sie irgendwie babyhaft aussahen.
»Weißt du, wohin die Boote fahren?«, fragte das Mädchen plötzlich.
»Eigentlich nirgendwohin, sie tuckern nur den Fluss rauf und runter«, antwortete Susan.
»Bist du mal mitgefahren?«, erkundigte sich das Mädchen weiter und kam dabei näher.
Susan schüttelte den Kopf. »Sie sind nur für Besucher und Leute, die hier Ferien machen«, erklärte sie.
»Nun, ich mache hier Ferien, aber ich war noch auf keinem Boot«, sagte das dunkelhaarige Mädchen beinahe vorwurfsvoll. »Darf ich mich zu dir setzen? Ich habe es satt, allein zu sein.«
Susan wusste nur allzu gut, wie es sich anfühlte, allein zu sein. Sie hatte keine richtigen Freundinnen, da sie sie nicht zum Spielen nach Hause einladen konnte, weil ihre Großmutter krank war. Daher war sie begeistert, dass dieses Mädchen anscheinend mit ihr Freundschaft schließen wollte.
»Ich bin Beth Powell«, sagte das Mädchen. »Ich bin zehn, und ich bin mit meiner Mutter aus Sussex hergekommen, um bei meiner Tante Rose Ferien zu machen. Wir sind erst Samstagnachmittag angekommen.«
»Ich bin Suzie Wright«, erwiderte Susan, da man sie in jener Zeit immer Suzie nannte, sogar in der Schule. »Ich bin auch zehn, und wir wohnen in Luddington, das ist ein Dorf weiter flussaufwärts. Ich warte darauf, dass Daddy mit der Arbeit fertig wird, damit ich mit ihm nach Hause fahren kann.«
Susan konnte sich nicht mehr genau daran erinnern, worüber sie an jenem Nachmittag gesprochen hatten, nur daran, wie schnell die Zeit verflogen war. Vermutlich hatte sie Beth erzählt, dass ihr Vater Versicherungen verkaufe, ihre Granny, die bei ihnen lebte, krank sei und ihr Bruder Martin die Universität besuche, aber es war ihr nicht im Gedächtnis geblieben. Am deutlichsten erinnerte sie sich daran, dass sie beide Socken und Sandalen ausgezogen, am Flussufer gesessen und ihre Füße in dem kalten, grünen Wasser hatten baumeln lassen. Außerdem hatten sie über alles und jedes gekichert.
Irgendwann am Nachmittag sagte Susan, dass sie finde, Beth sehe mit ihrem schwarzen Haar und der weißen Haut aus wie Schneewittchen.
Beth kicherte und freute sich ehrlich; sie erwiderte, jemand anders habe gemeint, sie sei zu groß und zu mager. »Ich wünschte, ich wäre so klein wie du«, gestand sie. »Und ich beneide dich geradezu um deine hübschen, rosigen Wangen.«
Susan hatte damals nicht gewusst, dass Beth ihrer ganzen Jugend Farbe geben oder dass ihre Freundschaft ihr so viel bedeuten würde. An jenem Tag zählte nur eins: Beth liebte Enid Blytons Fünf-Freunde-Bücher genauso wie sie selbst, und sie fuhren beide gern Fahrrad. Außerdem schien Beth den ganzen August mit ihr verbringen zu wollen.
Diesen August und die folgenden verlebte Susan tatsächlich ganz mit Beth. So viele lange, sonnige Tage, an denen sie auf ihren Fahrrädern die umliegende Landschaft erkundet, kleine Bäche im Wald aufgestaut hatten oder an verregneten Nachmittagen ins Kino gegangen waren und sich bei Woolworth's