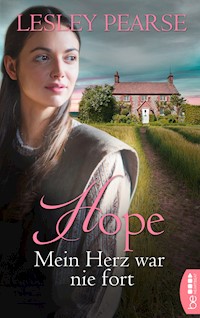7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bastei Lübbe
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Große Gefühle und bewegende Schicksale von Englands Besteller Autorin Lesley Pearse
- Sprache: Deutsch
Sie kam aus dem Nichts und wurde ein strahlender Stern am Musikhimmel. Doch Sterne können fallen ...
Nach langer Zeit im Waisenhaus findet die neunjährige Georgia endlich ein Zuhause. Sie kann ihr Glück kaum fassen. Doch als sie fünfzehn Jahre alt ist, zerbricht ihre heile Welt. Georgia flieht aus dem Elternhaus. Allein und verzweifelt bleibt ihr nur der Traum von einer Karriere als Sängerin. Sie taucht in die Musikszene Londons ein - eine Welt voller Glamour, doch dahinter lauern dunkle Abgründe. Mit wilder Entschlossenheit und ihrer außergewöhnlichen Stimme kämpft sich Georgia bis ganz nach oben. Sie wird eine gefeierte Sängerin, badet in Ruhm und Erfolg. Bis zu dem Tag, als ihre Vergangenheit sie wieder einholt. Erst jetzt erkennt sie, wer ihre wahren Freunde sind und wem ihr Herz wirklich gehört.
In der Ferne ein Lied erschien im Original unter dem Titel Georgia.
eBooks von beHEARTBEAT - Herzklopfen garantiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1019
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Inhalt
CoverGrußwort des VerlagsÜber dieses BuchTitelKapitel 1Kapitel 2Kapitel 3Kapitel 4Kapitel 5Kapitel 6Kapitel 7Kapitel 8Kapitel 9Kapitel 10Kapitel 11Kapitel 12Kapitel 13Kapitel 14Kapitel 15Kapitel 16Kapitel 17Kapitel 18Kapitel 19Kapitel 20Kapitel 21Kapitel 22Kapitel 23Kapitel 24Kapitel 25Kapitel 26Kapitel 27Über die AutorinWeitere Titel der AutorinImpressumLiebe Leserin, lieber Leser,
herzlichen Dank, dass du dich für ein Buch von beHEARTBEAT entschieden hast. Die Bücher in unserem Programm haben wir mit viel Liebe ausgewählt und mit Leidenschaft lektoriert. Denn wir möchten, dass du bei jedem beHEARTBEAT-Buch dieses unbeschreibliche Herzklopfen verspürst.
Wir freuen uns, wenn du Teil der beHEARTBEAT-Community werden möchtest und deine Liebe fürs Lesen mit uns und anderen Leserinnen und Lesern teilst. Du findest uns unter be-heartbeat.de oder auf Instagram und Facebook.
Du möchtest nie wieder neue Bücher aus unserem Programm, Gewinnspiele und Preis-Aktionen verpassen? Dann melde dich für unseren kostenlosen Newsletter an: be-heartbeat.de/newsletter
Viel Freude beim Lesen und Verlieben!
Dein beHEARTBEAT-Team
Über dieses Buch
Nach langer Zeit im Waisenhaus findet die neunjährige Georgia endlich ein Zuhause. Sie kann ihr Glück kaum fassen. Doch als sie fünfzehn Jahre alt ist, zerbricht ihre heile Welt. Georgia flieht aus dem Elternhaus. Allein und verzweifelt bleibt ihr nur der Traum von einer Karriere als Sängerin. Sie taucht in die Musikszene Londons ein - eine Welt voller Glamour, doch dahinter lauern dunkle Abgründe. Mit wilder Entschlossenheit und ihrer außergewöhnlichen Stimme kämpft sich Georgia bis ganz nach oben. Sie wird eine gefeierte Sängerin, badet in Ruhm und Erfolg. Bis zu dem Tag, als ihre Vergangenheit sie wieder einholt. Erst jetzt erkennt sie, wer ihre wahren Freunde sind und wem ihr Herz wirklich gehört.
Lesley Pearse
In der Ferneein Lied
Aus dem britischen Englisch von Beate Richter
Kapitel 1
Grove Park, Süd-London, Februar 1954
Schlüsselklirren und schwere Schritte weckten Georgia auf. Sie hatte ein so feines Gehör, dass sie nicht nur wusste, welche Nonne kam, sondern auch, wo diese sich gerade befand.
Dies war Schwester Agnes. Einige der Nonnen bewegten sich mit einer einzigen fließenden Bewegung die Treppen hinauf, andere keuchten und schnauften und legten auf halbem Wege eine Pause ein. Schwester Agnes allerdings kämpfte sich trotz ihres Alters und ihrer Körpermasse ohne Unterbrechung und mit leicht pfeifendem Atem bis ganz nach oben vor. Jetzt hatte sie den oberen Treppenabsatz erreicht und ging an dem langen, schmalen, vergitterten Fenster vorbei, um die Morgenglocke zu läuten. Georgia setzte sich im Bett auf und rieb sich die Augen. Trübes graues Licht fiel auf zwölf Eisenbetten, sechs auf jeder Seite des großen Raumes, in jedem Bett ein Körper, der eine kleine Erhebung bildete und noch fest schlief. Jetzt entfernten sich die schweren Schritte von ihrem Schlafsaal auf die Glocke zu, die genau neben dem großen Raum hing, in dem die Mädchen schliefen. Ein weiteres Paar Füße stieg vom darüberliegenden Stockwerk die Treppe hinunter, dieses jedoch leicht und federnd, ja fast im Laufschritt, je weiter es nach unten kam. Das war Schwester Theresa, die sich auf den Weg machte, um den morgendlichen Tee für die Mutter Oberin zu kochen. Georgia hörte ein Wimmern und wandte den Blick zu dem Bett, das links neben ihrem stand. Als das Kind darin sich bewegte, wehte ihr der unverwechselbare scharfe Geruch entgegen.
»Pamela!«, zischte sie. »Aggie wird jede Sekunde hier sein. Lauf schnell in den Waschraum. Ich versuche, sie solange abzulenken.«
Die Glocke erschallte in dem Flur mit dem nackten Fußboden, verschluckte Pamelas Antwort, und als das Echo des letzten Tones im ganzen Konvent nachhallte, näherten sich dumpfe Schritte dem Schlafsaal.
Pamelas erster Aufschrei war voller Bestürzung gewesen, weil sie ins Bett gemacht hatte, aber der zweite verriet Panik. Anstatt schnell aus dem Bett zu hüpfen und wie ein Hase vor der Gefahr davonzulaufen, kauerte sie einfach, die kleinen Arme über dem Kopf verschränkt, unter der Decke und wartete auf die Prügel, die sie mit Sicherheit gleich beziehen würde.
Georgia wusste, dass sie sich eine Ablenkung ausdenken musste, um Pamela zu schützen. Sie warf die Bettdecke von sich und vollführte einen Luftsprung. Schwester Agnes blieb einen Moment lang im Eingang stehen und beobachtete von dort Georgias Sprungversuch. Georgia landete mit weit gespreizten Beinen und hielt dabei ihr Schlafanzughose fest.
»Du kommst augenblicklich hierher!«, rief sie. Das Kind sah aus wie ein Schornsteinfeger. Spindeldürr war sie in ihrem zu großen gestreiften Schlafanzug, und der kurze schwarze Lockenschopf stand nach allen Seiten ab wie eine Drahtbürste.
Eine Hand flog aufwärts an ihren Nonnenschleier, damit er nicht verrutschte, und mit der anderen Hand hob Schwester Agnes ihr Gewand hoch, damit es den Boden nicht berührte.
»Wie kannst du es wagen?« Indigniert und mit rasselnder Stimme rauschte sie ins Zimmer.
Georgia grinste sie nur an: ein hellbraunes Gesicht, in dem eine Reihe weißer Zähne aufblitzte und es in zwei Teile spaltete. Noch ein kleiner Sprung, dann schnell ein kräftigerer, ein Überschlag in der Luft, und sie landete nur ein paar Meter entfernt von der Nonne, die mittlerweile außer sich war.
Diesem Salto hatte sie erst einige Tage zuvor im Spielzimmer den letzten Schliff gegeben, wo sie sich vor einem begeisterten Publikum von einer alten Couch auf einen Haufen Kissen geschleudert hatte. Jetzt war sie allerdings auf kaltem, hartem Linoleum gelandet, was sich sehr unsanft in ihren Beinen und ihrem Rücken bemerkbar machte. Sie stolperte gegen das Bettgestell.
»Morgen, Schwester Agnes«, keuchte sie und zog die ausgebeulte Hose wieder auf Taillenhöhe. »Haben Sie gesehen, wie gut ich das schon kann?«
Schwester Agnes war die älteste Nonne im Konvent. Humorlos, niederträchtig und grausam. Aus ihrer wabbeligen weißen Haut sprossen einzelne schwarze Haare, gleich daneben konkurrierten eine Hakennase und die darauf balancierende Warze um Aufmerksamkeit. Ihre scharfen Schweinsäuglein bemerkten eine Ungezogenheit fast noch durch die geschlossene Tür.
»Dies ist ein Schlafsaal und keine Turnhalle«, näselte sie. »Du bist jetzt neun Jahre alt, und es wird höchste Zeit, dass du den Jüngeren als gutes Beispiel vorangehst.«
Die alte Nonne wusste instinktiv, dass Georgia versuchte, sie abzulenken. Derart unverschämtes Benehmen konnte nicht geduldet werden. Georgia brachte sie zur Raserei. Nicht genug, dass sie ein dürres Kind mit riesigen Augen war, die ihr gelbliches Gesicht beherrschten – auch zahllose Strafen und Schläge konnten dem Grinsen von einem Ohr zum anderen keinen Abbruch tun. Trotz ihrer Magerkeit und ihrem Mischlingsblut hatte sie es geschafft, die Anführerin der jüngeren Mädchen zu werden. Und – noch schlimmer – sie unterstützte sie alle bei ihren Ungezogenheiten.
»Mit dir befasse ich mich später.« Schwester Agnes’ scharfe Augen schweiften durch den Schlafsaal. Kleine Mädchen schlüpften schnell in ihre marineblauen Schlüpfer und vermieden es, sie dabei anzusehen. »Was ist hier vorgefallen?«
»Da war ein Geräusch.« Georgia schlich sich von der Seite der Schwester fort und ließ die Augen mit gespieltem Schrecken durch den Raum gleiten. »Ich glaube, es ist wieder ein Vogel hier reingeflogen.«
Das war alles, was ihr auf die Schnelle einfiel. Erst im letzten Sommer hatte sich eine Taube in den Schlafsaal verirrt, und zur Belustigung der Kinder hatte die Schwester fast einen hysterischen Anfall bekommen. Es brachte sie immer noch zum Kichern, wenn sie daran dachte, wie sie aus dem Zimmer gerannt war, als der Vogel um ihren Schleier herumflatterte.
»Wir haben ihn auch gehört.« Der Chor der Zustimmung kam von drei Mädchen, mit denen Georgia besonders eng befreundet war. Während sie sich in ihre grauen Röcke und Pullover hineinkämpften, nickten sie einander zu und flatterten mit den Händen, als wollten sie andeuten, wohin der Vogel geflogen war.
Die Schwester wirbelte herum, gleichzeitig fuhren ihre Hände hoch zu ihrem Schleier, ihre Augen suchten den Raum ab, und sie spitzte die Ohren, um festzustellen, ob ein Flügelschlag oder ein Gurren zu hören war. Jennifer, das jüngste Kind im Schlafsaal, dem die Jacke des Schlafanzuges fast bis zu den dünnen, von Schrammen bedeckten Knien reichte, stand da, einen Daumen im Mund.
Jedes der Mädchen war in diesem Moment unbeweglich in Erwartung dessen, was kommen würde. Der Atem hing wie Rauch in der kalten Luft, die Blicke flogen zwischen der zögernden Nonne und Georgia hin und her. Aller Mut schwand jedoch, als die massige Frau sich langsam umdrehte. Die Mädchen wurden bleich unter ihrem forschenden Blick, Finger tasteten hastig nach Knöpfen, die Augen auf den Boden geheftet. Im günstigsten Fall war sie so ungenießbar wie ein Holzapfel. Wenn sie jedoch wütend war, wurde sie gefährlich.
»Hierher, Mädchen.« Die Stimme der Schwester hallte in dem nackten Raum wider. Ihr Kinn – eigentlich mehr als nur eines – zitterte unheilverkündend, und ihr Gesicht färbte sich rot.
Georgia warf Pamela einen verzweifelten Blick zu. Hoffentlich besaß sie den Verstand, sich jetzt endlich zu bewegen! Dann ging sie gemächlichen Schritts hinüber zu der Nonne.
Die Schwester packte sie mit einer Hand an der Schulter, während sie mit der anderen ausholte und Georgia mit aller Kraft quer übers Gesicht schlug.
Georgia geriet ins Stolpern und prallte seitwärts gegen ein Bettgestell. Aus Pamelas Bett an der anderen Seite des Zimmers kam ein Rascheln. Georgia knirschte mit den Zähnen und versuchte mit ihrer ganzen Willenskraft, die Schwester daran zu hindern, sich umzudrehen und das Mädchen zu entdecken. Aber die scharfen Ohren der Schwester hatten das Geräusch ebenfalls bemerkt. Sie wirbelte herum und rümpfte dann erzürnt die Nase. Das hastige Ankleiden wurde unterbrochen. Zehn Münder klappten vor Schrecken weit auf, Jennifer nuckelte heftig an ihrem Daumen. Pamela stand jetzt neben ihrem Bett – ihrem Schlafanzug entströmte der verräterische Geruch, sie versteckte die Augen hinter ihren Fäusten und wimmerte und zitterte vor Angst.
Sie war ein stilles, nervöses Kind, und sie litt immer noch sehr unter dem kürzlichen Verlust ihrer Mutter. Ihr wuscheliges braunes Haar, ein leichtes Schielen und eine Neigung zur Korpulenz hatten ihr bisher keine Zuneigung außer der Georgias gebracht.
»Sieben Jahre alt, und immer noch machst du ins Bett«, bellte die Schwester, und prompt schossen wieder ein paar Tropfen zu Boden. »Du bist ja schlimmer als ein Tier! Nicht mal die liegen in ihrem eigenen Schmutz!«
Wie eine Klaue schoss ihre Hand vor und packte das verängstigte Kind, das nicht den Verstand besaß, einfach davonzulaufen, während die Nonne Pamela mit der anderen Hand so heftig ohrfeigte, dass sie zu Boden fiel.
Die schlichte Gewalt dieser Attacke ließ Georgia auf sie zuspringen.
»Wagen Sie das ja nicht!«, schrie sie und warf sich auf die schwarze Schwesterntracht. Sie sah, wie ein schwerer schwarzer Schuh vorschnellte, um das hilflose Kind zu treten, und trommelte mit den Fäusten auf das breite Hinterteil der Nonne ein. »Sie kann nichts dafür. Sie machen ihr nur noch mehr Angst. Lassen Sie sie in Ruhe! Sie sind eine Tyrannin!«
Die anderen Kinder hüpften auf dem eisigen Linoleum von einem Fuß auf den anderen. Eines der älteren Mädchen griff sich Jennifer und fing an, ihr beim Anziehen zu helfen, bevor die Nonne auch noch auf die Kleine losgehen konnte.
Die Schwester drehte sich um und packte Georgia an den Handgelenken. Ihr Gesicht war jetzt violett angelaufen, ihre dünnen Lippen kräuselten sich aufwärts.
»Sieh zu, dass du nach unten kommst und die Kohleneimer vollmachst«, brüllte sie. Spucke spritzte dem Kind ins Gesicht. »Diese Unverschämtheit lasse ich dir nicht durchgehen.«
Georgia wich zu ihrem Kleiderhaufen zurück. Wenn sie noch ein Wort sagte, war es sehr wahrscheinlich, dass die Schwester sie in den Schrank einschloss, der als Strafzelle benutzt wurde. Nur bei Brot und Wasser hockte man so lange in diesem schwarzen Loch, bis es Zeit war, zu Bett zu gehen, und es würde nicht einmal eine Decke zum Einwickeln geben. Sie konnte Pamela jetzt nicht mehr helfen, und sie wollte ihr Frühstück haben.
Später, als Georgia im Schuppen kniete und Kohlen schaufelte, konnte sie hören, wie Pamela im Waschraum weinte – aber es war kein zorniges Schreien, sondern einfach ein verzweifeltes Jammern.
Sie konnte sich vorstellen, wie Schwester Agnes sie in eine mit kaltem Wasser gefüllte Badewanne gestellt und mit einer Bürste an ihr herumgeschrubbt hatte, dabei immer wieder Kniffe und Schläge austeilte und die ganze Zeit Sticheleien über Pamelas Bettnässerei von sich gab. Frühstück würde es für sie keines geben. Während die anderen Mädchen ihren Porridge aßen, saß Pamela in der Waschküche und kämpfte ganz allein mit dem Bettzeug, das sie zu waschen hatte. Wieso dachte Aggie bloß, dass Pamela nicht mehr ins Bett machen würde, wenn sie bestraft wurde? Sogar Georgia wusste, dass Pamela gar nichts dafür konnte.
»Aggie ist böse«, sang sie vor sich hin, als sie die Schaufel schwang, kräftig auf die Kohlen einschlug und sich dabei vorstellte, dass Schwester Agnes darunter lag. »Warum sorgt keiner dafür, dass sie aufhört?«
Georgia wurde dauernd bestraft – ob sie nun auf dem Nachhauseweg von der Schule trödelte, während der Mahlzeiten redete oder in der Schulandacht kicherte –, es geschah so häufig, dass es ihr kaum noch etwas ausmachte. Mit der Zeit lernte sie zu akzeptieren, dass Schwester Agnes sie niemals würde leiden können, ebenso wie sie akzeptierte, dass sie eine andere Hautfarbe hatte als die anderen Mädchen. Mittlerweile belustigte es sie sogar, wenn die Schwester sie als »Ausgeburt des Teufels« bezeichnete. Dies hatte sie einmal Schwester Mary erzählt, und ihr Lachen hatte sofort alle üblen Gedanken verjagt.
»Du bist wie eine kleine Kaulquappe«, hatte sie gesagt und dabei mit ihren blauen Augen gezwinkert. »Aber aus dir wird eine schöne Frau werden, warte es nur ab.«
Bis sie fünf oder sechs Jahre alt war, hatte für sie immer noch die Möglichkeit bestanden, eines Tages adoptiert zu werden. Sonntags kamen meistens Ehepaare nach St. Joseph’s, die ein Kind suchten, das sie lieb haben konnten. Einige waren schon alt, einige jung, die anderen reich, die kamen in Autos und trugen Pelzmäntel, andere wieder waren ganz normale Leute, so wie die Mütter der anderen Mädchen in der Schule. Aber eines hatten sie alle gemeinsam: Sie wollten hübsche blonde Mädchen mit blauen Augen, und je jünger und niedlicher sie waren, desto besser.
Manchmal hatte Georgia die Tricks ausprobiert, die die anderen Mädchen versuchten. Auf den Schoß klettern, an den Kleidern ziehen, ein betörendes Lächeln, Augen, die sich langsam mit Tränen füllten … aber jedes Mal hörte sie immer die gleiche Bemerkung. »Sie ist ein liebes kleines Ding, aber ich fürchte, wir würden mit einem Mischlingskind einfach nicht zurechtkommen.«
Georgia seufzte tief, als sie die beiden schweren Kohleneimer über den Hof und die Steintreppe hinunter in die Küche schleppte. Sie hatte sich damit abgefunden, dass sie hierbleiben würde, bis sie fünfzehn war. Dann musste sie Arbeit finden. Wenigstens hatte sie die Schule.
Die meisten anderen Mädchen hassten die Schule noch mehr als das Kloster. Sie wurden als »anders als die anderen Kinder« hingestellt: Zum einen wurden sie wie eine Schafherde von einer der Nonnen über die vielbefahrene Hauptstraße begleitet, und zudem fielen sie durch ihre schlecht sitzende Kleidung, die schweren Schuhe und das glanzlose Haar auf. Für Georgia jedoch war jeder Schultag ein Abenteuer, eine Chance, die Welt draußen zu sehen und etwas über andere Dinge und Orte zu lernen – sich normal zu fühlen.
Sie mochte die Bilder an den Wänden, die Musikgruppe mit den verschiedenen Schlaginstrumenten und die Geschichten; es gefiel ihr, auf Löschpapier Bohnen zu ziehen, Farbpulver zu mischen und Marionetten zu basteln. Aber am meisten liebte sie Miss Powell und ihre Musik.
Miss Powell war die Direktorin. Mit ihren dunklen Kostümen und weißen Rüschenblusen und dem gewellten blonden Haar, das sie im Nacken hochsteckte, strahlte sie eine Art Glamour aus. Aber am allerbesten war sie, wenn sie am Klavier saß und spielte.
Kirchenlieder, Shanties, Volkslieder, wunderschöne schwermütige Melodien, die in Georgias Vorstellung Bilder heraufbeschworen. Wäre Miss Powell nicht gewesen, hätte Georgia vielleicht nie entdeckt, dass sie singen konnte!
Sie fühlte sich gut, wenn sie sang. Sie konnte dann das Kloster und Schwester Agnes vergessen, ihre dunkle Haut und die Leute, die kein Mischlingskind wollten. Wenn sie sang, schauten die Leute sie an und hörten ihr zu. Sogar ihre eigene Lehrerin machte ein stolzes Gesicht, obwohl sie sonst immer schimpfte, weil Georgia ihr Einmaleins nicht lernte.
»Du hast ein ganz besonderes Geschenk mit auf den Weg bekommen, Georgia.« An dem Tag, als sie Georgia für die Rolle des Erzengels Gabriel in der Weihnachtsaufführung der Schule ausgewählt hatte, hatte Miss Powell sie angelächelt. »Ich habe dich ausgewählt, weil deine Stimme der Schönheit des Weihnachtsfestes gerecht wird. Alle sollen genauso stolz auf dich sein wie ich.«
An diesem Dezembernachmittag hatte sie auf der Bühne gestanden, eingehüllt in ein weißes Laken und mit einem Heiligenschein aus Rauschgold, und als der Applaus die ganze Aula füllte, war das der schönste Augenblick ihres Lebens gewesen.
»Mitten im trostlosen Winter«, erschien ihr jetzt genau das passende Lied, als sie den Kohlenstaub von ihren Händen spülte, bevor sie gemeinsam mit den anderen Kindern zum Frühstück ging. Ihre Wangen fühlten sich eisig an, ihre Hände und Oberschenkel waren aufgesprungen vor Kälte, und eben in diesem Moment plante Schwester Agnes ihre Strafe.
Als Schwester Agnes sie nach dem üblichen Samstagsfrühstück aus Porridge und gekochten Eiern nicht unverzüglich ihre Rache hatte spüren lassen, dachte Georgia nicht mehr länger über eine Bestrafung nach. Draußen auf dem Spielplatz warm zu bleiben war wichtiger, als sich darüber Gedanken zu machen, was später geschehen könnte.
Von außen gesehen vermittelte St. Joseph’s den Eindruck eines großes Landhauses. Die Kiesauffahrt, der weitläufige Rasen, der von einer Mauer umgebene Küchengarten und die alten knorrigen Bäume stammten alle aus einer eleganteren Zeit.
Tatsächlich lag das geräumige Haus nur einen Steinwurf von der Grove Park Station im Londoner Süden entfernt. Nur einige Minuten entfernt gab es Ladenreihen und eine Straße mit geschäftigem Auto- und Busverkehr.
Mit den drei Stockwerken, dem Keller und dem Dachboden war es zu groß, um vernünftig geheizt zu werden. Die einst kultivierten Salons und Speisezimmer waren jetzt zugige Schlafsäle. Nur das Wohnzimmer der Schwester Oberin strahlte etwas Gemütlichkeit aus. Sogar die kleine Kapelle im ersten Stock machte einen heruntergekommenen Eindruck, weil nötige Reparaturen nicht ausgeführt wurden.
Der Garten war im Sommer sehr schön. Die Kinder tobten auf dem Gras umher und jagten einander um die Bäume herum. Da gab es den Duft der Blumen, die großen Büsche, hinter denen sie sich verstecken konnten, und lange Tage, an denen sie kaum beaufsichtigt wurden.
Aber jetzt im Februar war es die reinste Folter. Der Wind pfiff durch die dünnen Gabardine-Regenmäntel. Er machte sich schneidend an aufgeschrammten Stellen an den nackten Beinen und auch an Ohren und Fingern bemerkbar. Wenn sie mit dem Schnee spielten, der rings um den Spielplatz zu Haufen aufgefegt war, froren sie schnell noch mehr. Alles, was sie tun konnten, war, sich enger an die Mauern zu drücken. Vierundzwanzig Mädchen zwischen vier und zwölf Jahren, die darauf warteten, dass die Glocke sie zum Mittagessen rief. Blasse, spitze Gesichter, die Augen sehnsuchtsvoll auf die dampfende Waschküche gerichtet, wo die älteren Mädchen den großen Vorteil genossen, bis zu den Ellbogen in Seifenwasser zu stecken oder über heißen Bügeleisen zu schwitzen.
»Sie wird dich gleich reinrufen.« Susan Mullins, eine Elfjährige mit karottenroten Haaren und Sommersprossen, rückte näher an Georgia heran. »Hast du Angst?«
Der Zusammenstoß mit Aggie hatte sich sogar bis zu den älteren Mädchen herumgesprochen. Wenn sie so die Zustimmung der Älteren bekommen konnte, war es die Bestrafung fast wert. Aber egal wie groß und abgehärtet sie sich hier unter all ihren bewundernden Freundinnen auch fühlte – der Drang, zur Toilette zu gehen verschwand genau so wenig wie die Augenblicke der Panik, wenn sie das Gesicht einer Nonne am Fenster sah.
»Nein.« Georgia grinste zittrig. »Ich besorge mir ein Messer und schneide ihre Warze ab. Dann verblutet sie und ist tot.«
Die Tür zum Spielzimmer öffnete sich ganz kurz vor dem Nachmittagstee. Georgia lag zusammengerollt auf einem der alten Sofas und las einen uralten Comic, ein paar jüngere Mädchen rannten durch das große, leere Zimmer, während die älteren sich in einer Ecke an den Heizungsrohren herumdrückten.
»Georgia.« Schwester Marys Stimme ließ sie hochfahren. »Die Schwester Oberin will mit dir sprechen.«
Schwester Mary war die jüngste Nonne, sie mochte Mitte Dreißig sein, aber eigentlich war es schwierig, ihr Alter zu schätzen. Sie war groß und schlank und hatte ein glattes Gesicht ohne Falten. Sie sah aus wie eine Porzellanpuppe mit feinen hellen Brauen über Augen, die wie der Sommerhimmel aussahen, und rosigen Lippen über kleinen weißen Zähnen. Trotz ihrer Jugend war Schwester Mary jedoch stark genug, um sich als Vermittlerin zwischen die Mädchen und Schwester Agnes zu stellen. Ihr perlendes Lachen, ihr Verständnis für die Mädchen, ihre liebe Art und die sanfte Stimme gaben jedem Kind ein Gefühl der Sicherheit. Sie war ausgebildete Krankenschwester. Während des Krieges war sie nahe an die feindlichen Linien geraten, und die älteren Mädchen spekulierten darüber, warum jemand, der so hübsch war, sich für das Kloster entschieden hatte, anstatt zu heiraten und selbst Kinder zu bekommen.
Die älteren Mädchen aus dem mittleren Schlafsaal sahen Georgia voller Schrecken an. Pamelas Augen füllten sich mit Tränen, und sie umklammerte Georgia mit ihren kleinen, pummeligen Händen.
»Es ist alles meine Schuld«, wimmerte sie. »Jetzt kriegst du Schläge, nur weil du dich für mich eingesetzt hast.«
»Keine Sorge«, sagte Georgia aufmunternd und schlang einen Arm um das kleinere Kind. »Ich hab keine Angst vor ihr. Und außerdem kann ich ihr jetzt vielleicht erzählen, wie grausam Schwester Agnes zu dir ist.«
»Du bist so tapfer«, seufzte Pamela, und dabei war das gesunde Auge auf Georgia und das andere auf das Fenster gerichtet. »Ich wünsche mir, dass ich so sein könnte wie du.«
In der Treppenwindung stand eine Statue der Jungfrau Maria mit einem kleinen Nachtlicht davor. Georgia knickste, kniff die Augen ganz fest zusammen und schickte eine schnelle Bitte um Gnade gen Himmel.
Der breite Flur war sehr dunkel. Er war eichengetäfelt, das einzige natürliche Licht fiel durch ein Fenster im Treppenhaus, und es gab eine einsame Kerze unter dem Bild des Herz Jesu. Es war sinnlos, auch nur einen Blick auf die Eingangstür zu werfen und daran zu denken, sich schnell aus dem Staub zu machen. Selbst wenn sie den mächtigen Riegel dort oben erreichen könnte – mit ihren Turnschuhen und ohne Mantel würde sie im Schnee nicht weit kommen. Stattdessen ballte sie ihre Hände zu Fäusten, wischte sich die Nase am Pulloverärmel ab und klopfte an die Tür der Schwester Oberin.
»Herein!« Die dünne alte Stimme der Schwester Oberin drang aus dem Zimmer heraus. Es klang wie raschelndes, uraltes Pergament.
Georgia drehte den Türknopf aus Messing mit beiden Händen, öffnete die Tür nur einen Spalt breit und griff vorsichtig nach innen. Die Mutter Oberin saß, den Rücken zum Fenster, an einem lodernden Holzfeuer – eine kleine, gebeugte Gestalt in einem übergroßen Armsessel.
»Komm schon rein, wir beißen nicht.«
Zu Georgias Überraschung klang die Stimme fast herzlich. Vielleicht lauerte Schwester Agnes hinter der Tür?
Georgia trat mit gesenktem Blick zögernd ein, ohne den Türknauf loszulassen.
»Mach die Tür zu«, schnappte die Oberin. »Wir wollen nicht frieren.«
Das »wir« ließ Georgia hochblicken. Eine Dame saß auf dem Sofa, das etwas vom Kamin entfernt stand. Sie sah Georgia an. Das Lächeln der Schwester Oberin war jenes, das sie sich normalerweise für Weihnachten und Besucher vorbehielt.
Vorsichtig schloss Georgia die Tür und rückte dabei den schweren Wollvorhang wieder zurecht, der gegen Zugluft schützen sollte. Diese Dame hatte sie schon früher ein- oder zweimal in der Schule gesehen. Eine Lehrerin war sie allerdings nicht. Hatte Georgia diesmal etwas so Schlimmes angestellt, dass sie jetzt jemanden von draußen zur Hilfe holen mussten, um sie zu bestrafen?
Die Mutter Oberin streckte eine winzige, knochige Hand aus und bedeutete Georgia, näher heranzutreten. Angeblich war sie achtzig. Georgia hatte keine Ahnung, ob das stimmte oder nicht, aber auf jeden Fall hatte sie eine Menge Falten – nicht nur um die Augen herum, sondern im ganzen Gesicht – als wäre sie um einen halben Meter geschrumpft und nun zu klein für die ganze Haut.
»Mrs. Anderson arbeitet für das Jugendamt. Sie ist hergekommen, um mit dir zu reden.« Mit einem mulmigen Gefühl stand Georgia auf dem Kaminvorleger. Vor lauter Angst drehte sich ihr Magen um. Sie wusste, was die Leute vom Jugendamt taten: Sie waren diejenigen, die herkamen und Mädchen aus dem Heim entfernten, wenn sie sich schlecht benahmen.
Allerdings sah Mrs. Anderson gar nicht böse aus. Sie hatte das gleiche autoritäre Aussehen wie Mrs. Powell, doch sie saß mit einem so heiteren Ausdruck auf ihrem Platz, als wäre sie in ihrem eigenen Haus. Ihr Gesicht war rund, ihr Haar war fast so geschnitten wie bei einem Mann, aber ihr Lächeln und ihre rosigen Wangen waren entschieden weiblich. »Hallo, Georgia.« Die Frau stand auf. Georgia war überrascht von der kräftigen, klaren Stimme, die den Raum füllte. »Ich vermute, du kannst dich nicht an mich erinnern. Ich habe dich in der Weihnachtsaufführung gesehen.«
»Nehmen Sie mich von hier weg?« Georgia streckte ihr kleines, spitzes Kinn trotzig heraus. »Ich hab’ nichts getan. Ich wollte nur Pamela helfen. Schwester Agnes ist grausam und gemein.«
Die Dame sah überrascht von Georgia zur Mutter Oberin.
Jetzt war Georgia verblüfft. Ihre ganze Kindheit hindurch hatte sie die geheimen Blicke der Erwachsenen studiert. Weswegen diese Dame auch gekommen war – der Grund war jedenfalls nicht, sie noch weiter zu bestrafen.
»Na, na, Georgia.« Die Stimme der Oberin war honigsüß, die Warnung vor einer Strafe versteckt und nur für sie beide wahrnehmbar. Sie stand unsicher auf und legte eine Hand auf Georgias Schulter. Knochige Finger gruben sich gerade kräftig genug in ihr Fleisch, um sie daran zu erinnern, dass sie nicht hereingerufen worden war, damit sie Geheimnisse über irgendjemanden verriet. »Mrs. Anderson ist heute hierhergekommen, um dir ein wunderbares Angebot zu machen. Versuch also nicht, Schwierigkeiten zu machen.«
»Vielleicht sollte ich für einen Moment mit Georgia allein sprechen?« Mrs. Andersons Vorschlag klang mehr wie eine Feststellung.
Georgia blickte von einer Erwachsenen zur anderen, verwirrt, aber nicht mehr ängstlich.
»Wenn Sie das für notwendig halten«, antwortete die ältere Frau steif. Sie richtete ihre kleine, gebeugte Gestalt auf, ihre blutleeren Lippen kräuselten sich vor Ärger. »Ich habe ohnehin einige dringende Aufgaben zu erledigen.« Sie eilte geschäftig auf die Tür zu, wobei sie mit jedem Schritt ihre Missbilligung demonstrierte.
Mrs. Anderson stand auf, nahm Georgias Hand und führte sie zurück zum Sofa.
»Sie war nicht sehr begeistert«, sagte sie und hob dabei Georgias Gesicht mit einem Finger an, um es zu studieren. »Also muss ich mich wohl beeilen.«
Georgia gefiel ihre Berührung. Sie war genau wie ihr ganzes Benehmen: zuversichtlich, lieb, vielleicht sogar mütterlich. Ihre Augen waren grau mit kleinen grünen Sprenkeln, leuchtend und unerschütterlich, mit ein paar kleinen Falten rundherum. Die Falten kamen vielleicht eher vom vielen Lachen als vom Alter, und sie roch so schön frisch – so wie Laken, wenn sie den ganzen Tag draußen im Sonnenschein gehangen hatten. Sie war nicht gerade zierlich mit ihren stattlichen Hüften und einem Busen, der die Vorderseite ihrer Jacke ausbeulte, aber sie war auch nicht richtig dick. Sie war auch nicht so elegant wie Mrs. Powell, aber dafür sah sie freundlicher aus.
»Ich habe dich beim Schulkonzert gesehen«, sagte sie leise, »und deine Stimme war so schön, dass ich dich nicht vergessen konnte. Als ich entdeckte, dass du jahrelang hier zugebracht hast, versuchte ich herauszufinden, ob ich dich adoptieren könnte.«
Georgia fiel vor Überraschung der Unterkiefer herunter.
»Offenbar ist das nicht möglich. Aber trotzdem will ich, dass du mein kleines Mädchen wirst. Ich möchte, dass du mit mir kommst und bei mir lebst, wenn du möchtest.«
Es war wie ein Traum, aber die rundliche, warme Hand, die ihre Hand hielt, war ganz wirklich.
»Sie wollen mich?« Georgias breite Lippen öffneten sich zu einem Grinsen, das von einem Ohr zum anderen reichte.
Zu ihrer Überraschung schienen sich Mrs. Andersons Augen mit Tränen zu füllen.
»Weinen Sie nicht.« Georgia lehnte sich näher an sie heran und berührte zögerlich das Gesicht der Dame. »In zehn Minuten bin ich fertig, wenn Sie wollen.«
Da lachte Mrs. Anderson. Diese Art Lachen hatte Georgia bei den Nonnen nie gehört. Es war der Klang der Freiheit, ein wunderbarer Klang, der auf eine Weise das Leben außerhalb der Klostermauern verkörperte. Georgia fiel in das Lachen ein, und ihre Nase zog sich vor Fröhlichkeit zusammen.
»O Georgia, ich wusste gleich, als ich dich zum ersten Mal sah, dass du mein kleines Mädchen bist«, lachte sie und drückte Georgias Hand noch fester. »Meine Güte, du bist wirklich ein Tonikum.«
»Was ist ein Tonikum?« Plötzlich machte Georgia ein ernsteres Gesicht.
»Das ist eine Art Medizin. Wenn du sie nimmst, fühlst du dich besser«, erklärte Mrs. Anderson, und ihre Augen sprühten immer noch vor Lachen. »Gerade hast du jeden Zweifel aus meinen Gedanken verbannt.«
»Wollen Sie mich wirklich mit zu sich nehmen?« Georgias Augen hatten einen misstrauischen Ausdruck. Auf Schwester Mary und Mrs. Powell konnte man sich verlassen, aber ihr waren noch keine anderen Erwachsenen begegnet, die nicht ihre Meinung geändert hätten.
»Ja, aber jetzt kann ich dich noch nicht mitnehmen. Erst morgen.«
Georgia dachte schnell nach. Sie war sich sicher, dass sie Mrs. Anderson vertrauen konnte. Sie gehörte nicht zu den hohlköpfigen Damen, die hierherkamen und nach kleinen, knuddeligen Spielzeugen Ausschau hielten. Sie hatte vor nichts und niemandem Angst.
»Können Sie dann etwas für mich tun?«, fragte Georgia.
»Ich werde es versuchen.«
»Na ja … finden Sie jemanden, der dafür sorgt, dass Schwester Agnes aufhört. Sie schlägt Pamela, weil sie ins Bett macht. Pamela kann aber gar nichts dafür.«
»Ich werde mein Bestes tun.« Mrs. Anderson sah schockiert aus.
»Hat sie dich jemals geschlagen?«
»Andauernd«, sagte Georgia lässig. »Aber ich bin ja auch größer und kann mehr einstecken. Ich kann mich selbst wehren. Pamela nicht. Sie ist erst sieben, und ihre Mummy und ihr Daddy sind tot.«
»Aber du hast doch auch keine Eltern?« Mrs. Andersons Stimme wurde tiefer, sie strich beruhigend über Georgias Wange und gab ihr dann einen Kuss auf das Haar.
»Stimmt.« Georgia blickte stolz zu ihr auf. »Aber ich bin schon allein, seit ich geboren bin. Ich habe gelernt, damit umzugehen, und außerdem mache ich nicht ins Bett.«
Das schien Mrs. Anderson amüsant zu finden.
»Mr. Anderson und ich wohnen in einem schönen großen Haus in Blackheath«, erklärte sie. »Und ich bin sehr froh, dass du nicht ins Bett machst, weil ich nämlich ein sehr schönes neues Bett für dich gekauft habe. Du wirst ganz in der Nähe zur Schule gehen, und die Heide und der Greenwich Park fangen gleich auf der anderen Straßenseite an. Aber sobald du dich bei uns eingelebt hast, werde ich sehen, was ich für deine Freundin tun kann.«
»Haben Sie noch viele andere Kinder?«, fragte Georgia.
»Nein, ich habe gar keine.« Mrs. Andersons Mund zuckte vor Vergnügen über Georgias verzückten Gesichtsausdruck. »Aber du wirst in der Schule bald neue Freunde finden.«
»Gibt es dort Musik?« Irgendeine versteckte Falle musste es geben, aber vielleicht waren ja Mrs. Powell und ihr Klavier nur ein kleiner Preis für das, was sie erwartete.
»Auf jeden Fall gibt es Musik! Ich spiele selbst Klavier, und wenn du willst, kannst du Musikunterricht und auch Gesangsunterricht bekommen.«
Georgias Augen leuchteten auf, ihr Unterkiefer fiel nach unten, und wenn sich nicht in diesem Moment die Tür wieder geöffnet hätte, hätte sie einen Freudenschrei losgelassen. Aber die Schwester Oberin schlurfte ins Zimmer, und ihr faltiges Gesicht war voller Argwohn.
»Haben wir jetzt genügend Zeit gehabt?« Selbst an Georgia ging ihr Sarkasmus nicht spurlos vorüber.
»Bald werden wir alle Zeit der Welt haben«, sagte Mrs. Anderson liebenswürdig. Sie bückte sich, um Georgia zu küssen.
»Wenn du erst mein kleines Mädchen bist.«
»Jetzt lauf, Georgia.« Die Schwester Oberin hatte nun wieder den für Besucher reservierten Gesichtsausdruck, zusammen mit einem falschen, einschmeichelnden Lächeln und einem herablassenden Ton. Gleichzeitig spielten ihre knochigen Finger die ganze Zeit mit ihrem Rosenkranz. »Mrs. Anderson holt dich morgen Früh ab.«
Der weiß gekachelte Waschraum war voller Dampf. Hier hatten vor weniger als vier Stunden noch zwanzig Kinder in den vier großen Wannen gebadet, aber jetzt war der Fußboden überschwemmt. Trotz des Dampfes war der Raum eiskalt, und die Fensterscheiben klirrten, geschüttelt von einem Wind, der mit Orkanstärke um die alten Klostergemäuer heulte.
Georgia war nach Tanzen und Singen zu Mute. Sie wollte der ganzen Welt erzählen, dass dies ihre letzte Nacht hier war. Morgen würde sie ein eigenes Zimmer haben. Eine Mutter, die sie warm zudeckte. Jemanden, der sie gern singen hörte und Klavier spielen konnte.
Seitdem sie an diesem Tag Mrs. Anderson kennengelernt hatte, war sie von den anderen Kindern ferngehalten worden. Die Schwester Oberin hatte sogar gesagt, dass sie diese Nacht im Isolierraum im obersten Geschoss des Hauses verbringen sollte. Aber heute Abend konnte niemand Georgias ausgelassene Laune dämpfen. Als sie allein im Waschraum war, zog sie den verfilzten grauen Pullover aus, dann den hässlichen langen Rock, ihren Flanellunterrock, das Liberty-Hemdchen und zuletzt den blauen, abgetragenen Schlüpfer. Mittlerweile hatte sie auch vergessen, dass man sich im Angesicht Gottes niemals nackt zeigen durfte, und warf das schäbige alte Unterhemd von sich.
Sie nahm ein kleines Handtuch, wickelte es wie ein Kleid um die Taille und tat so, als sei sie eine erwachsene Frau, die vor einem großen Publikum stand.
»In der schönen Stadt Dublin, wo die Mädchen so schön sind«, sang sie aus vollem Hals und tanzte dabei leichtfüßig durch den Raum. »Da sah ich zum ersten Mal die schöne Molly Mahne.« Die Tür öffnete sich leise. Georgia war so gefangen in ihrer Vorführung, dass sie die langsam näherkommende Schwester Agnes nicht sah. Sie hörte auch nicht, wie diese laut Luft holte. Klatsch!
Wie von einer Wespe gestochen, sprang Georgia auf und ließ ihr Handtuch zu Boden fallen.
Schwester Agnes hielt eine ihrer bevorzugten Waffen in der Hand. Es war nur ein dünnes, feuchtes Handtuch, aber in ihren Händen wurde es zur gefährlichen Waffe. Ihr Körper war vor lauter Bosheit angespannt, als sie das Handtuch wie eine Peitsche über Georgias Hinterbacken knallte.
»Wir bewundern uns also selbst, ja?« Ihr hässliches, aufgedunsenes Gesicht war zu einer argwöhnischen Maske verzerrt. Schon bereitete sie das kleine Handtuch für einen weiteren Hieb vor.
»Habe ich nicht«, gab das Mädchen voller Entrüstung zurück. Sie sprang zur Seite und hob schützend die Hände, um weitere Schläge abzuwehren. »Ich habe nur gesungen.«
»Lüg mich nicht an«, brüllte Schwester Agnes und schwang bedrohlich das Handtuch. »Du bist ein verdorbenes, sündiges Kind mit unsauberen Gedanken. Wie kannst du es wagen, dich zur Schau zu stellen?«
In ihrer Aufregung hatte Georgia vergessen, was im Schlafsaal passiert war. Schwester Agnes hatte es aber ganz eindeutig nicht vergessen. Aber ganz sicher würde sie sich doch jetzt nicht mehr trauen, ihr weh zu tun – wo doch Mrs. Anderson so bald zurückkommen wollte?
»Fassen Sie mich nicht an«, schrie sie aus Leibeskräften. »Ich habe jetzt eine Mutter!«
»Du wagst es tatsächlich?« Schwester Agnes ließ das Handtuch fallen und pirschte sich heran. Rund um ihren Nonnenschleier bebten ihre vielen Kinnrollen vor Wut, die wachsamen Augen waren von Bosheit erfüllt.
Georgia wich bis an die gekachelte Wand zurück, wobei sie mit den bloßen Zehen versuchte, Halt auf dem nassen Boden zu gewinnen. Sie war jetzt bereit, sich nicht unterkriegen zu lassen. Sie war entschlossen, dass die alte Frau nicht die Oberhand über sie gewann.
»Schlagen Sie mich bloß nicht«, schrie sie trotzig, und aus ihren Augen sprühte der neue Mut, den sie gefunden hatte. »Ich werd’s ihr erzählen.«
»Erzähl ihr, was du willst. Glaubst du, dass irgendjemand einem beschränkten Nigger glaubt und mir nicht?«
Georgia nahm allen Mut zusammen. Immer und immer wieder hatte Schwester Agnes ihr dieses Wort vor den Kopf geworfen.
»Ich bin kein Nigger.« Ihre Augen füllten sich mit Tränen. »Das ist ein böses Wort, und Sie sind auch böse.«
Die Schwester starrte sie einen Augenblick lang an, ganz deutlich überrascht, dass irgendein Kind den Mut hatte, ihr Widerworte zu geben. Hier, gegen die weißen Wände, zeigte sich Georgias dunkle Hautfarbe deutlicher. Nackt war sie so dünn, dass sie fast unterernährt aussah. Die Gliedmaßen glichen Stöcken, der Kopf schien zu groß für ihren Körper zu sein.
Für Schwester Agnes war das Kind vor ihr ein Produkt des Teufels – unehelich geboren, verlassen, als es wenige Monate alt war – für Schwester Agnes der Beweis, dass die Mutter eine Hure war.
Sie hegte einen Groll über die Art und Weise, wie Georgia sowohl bei den Erwachsenen wie auch bei den anderen Kindern Beachtung fand, wenn sie sang und in Rollen schlüpfte. Kein anderes Kind in St. Joseph’s besaß die Frechheit, Widerworte zu geben, so wie es Georgia tat, und jetzt war Georgia von dieser Frau ausgesucht worden, die ihr ein Zuhause geben wollte. Ausgerechnet diese unverschämte Mrs. Anderson, die die Frechheit besaß, anzudeuten, Georgia sei unterernährt. Mrs. Anderson war nicht einmal katholisch. Was gab ihr das Recht, die Fürsorge im Kinderheim von St. Joseph’s zu kritisieren?
Georgia hatte nicht damit gerechnet, dass die Schwester mit ihrem kleinen Stock bewaffnet war. Wie eine Schlange kam er plötzlich aus den Falten der Schwesterntracht hervor. Ungefähr dreißig Zentimeter dünnes, biegsames Holz, glatt und glänzend durch jahrelangen Gebrauch.
Schwester Agnes war alt, dick und außer Atem. Aber Georgia konnte es dennoch nicht mit der Schwester aufnehmen, die mittlerweile mit heiliger Entrüstung erfüllt war.
Während Georgia zurückwich, merkte sie, dass sie in der Ecke wie in einer Falle saß. Mit blankem Entsetzen sah sie zu, wie die alte Frau sich über die Badewanne beugte und die Wasserhähne voll aufdrehte, um alle Geräusche zu ersticken. Immer noch gebückt, mit dem Stock in einer Hand und mit der anderen Hand noch am Wasserhahn, drehte sie sich langsam zu Georgia um. Ihre Lippen verzogen sich zu einem höhnischen Grinsen.
Georgia versuchte, an der Wand entlangzuschlüpfen. Ihr Herz hämmerte, und sie hatte das Gefühl, dass ihre Beine in Zement eingeschlossen waren. Eine Hand krallte sich in Georgias knochige Schulter, die andere hob den Stock in die Höhe.
Es gab ein pfeifendes Geräusch, als der Stock blitzartig durch die Luft schnellte, den Arm des Kindes traf und mit brennendem Schmerz durch die Haut schnitt.
»Bitte nicht!«, schrie Georgia und bewegte sich in einen schmerzverzerrten Tanz.
»Bücken«, bellte die Schwester. »Das hier hättest du schon längst verdient gehabt.«
»Bitte, Schwester«, wimmerte Georgia. »Es tut mir leid, ich habe das nicht so gemeint.«
»O doch, das hast du. Du hältst dich für was Besonderes. Es wird langsam Zeit, dass sich dich mal jemand vorknöpft und diesen stolzen Blick aus dir rausprügelt.«
Georgia kauerte sich noch weiter in die Ecke hinein, ließ sich in die Hocke zusammensinken und hob den Kopf zum Protest.
Sie sah, wie ein schwarzer Schuh unter der Tracht hervorschoss und ihr die Beine wegtrat. Sie schlug mit dem Hinterteil auf den Boden auf.
Der nächste Schlag traf sie am Oberschenkel. Sie kroch über den Boden, um zu entkommen, machte aber den Fehler, dabei der Schwester den Rücken zuzuwenden.
Wieder und wieder schnitten sich die Stockhiebe in ihren Po, ihre Beine und ihren Rücken ein. Sie schrie in panischer Angst, aber die Schreie gingen im Rauschen des Badewassers unter.
»In die Wanne«, brüllte Schwester Agnes.
Schnell ging Georgia um die Schwester herum ans andere Ende der Wanne und sprang hinein. Das Wasser war siedend heiß, aber sie traute sich nicht, aufzuschreien. Es reichte ihr bis zu den Achseln und brannte in den Striemen, die der Stock hinterlassen hatte.
Georgia hatte keinen Kampfeswillen mehr übrig. Sie beugte sich der Schwester, die sie hochriss und mit einer Bürste bearbeitete.
»Jetzt trocknest du dich ab und gehst ins Bett«, zischte die Schwester. »Und sieh zu, dass du dich beeilst.«
Die Tür schlug hinter ihr zu, und Georgia tastete blindlings nach einem Handtuch. Sie zitterte vor Kälte. Ihre Augen brannten, und ihr Körper fühlte sich an, als stünde er in Flammen. Langsam kroch sie aus der Badewanne heraus und sank auf einen Hocker. Das Glücksgefühl, das sie vorher empfunden hatte, gurgelte mit dem Badewasser den Abfluss hinunter. Stattdessen kamen ihr Tränen der Verzweiflung.
»Georgia?«
Schwester Marys Stimme kam von der Tür. Georgia blinzelte.
»Was ist los?« Die Schwester kam über den nassen Boden, die Arme ausgestreckt, ihr Gesicht voller Besorgnis.
»Schwe-Schwester Agnes«, stammelte Georgia.
Ein trockenes, weicheres Handtuch wurde um sie gewickelt, das kleine mit einer flinken Bewegung weggenommen und wie ein Turban um ihr Haar gewickelt.
»Was ist passiert?«, fragte die Schwester, und wie immer war ihr Ton sanft, ein scharfer Kontrast zu Schwester Agnes’ Stimme.
Georgia versuchte, es ihr zu erklären, doch ein Hustenanfall machte es ihr unmöglich, und diesmal kam der Husten mit lauten Schreien heraus. Dabei kamen jedes Mal große Mengen Wasser mit herauf, die sie geschluckt hatte. Schließlich lag Georgia auf Schwester Marys Schoß. Sie drehte das Kind mit einer geschickten Bewegung auf den Bauch und klopfte ihr auf den Rücken, bis der Anfall vorbei war. Georgia fühlte, wie sie die Wunden behutsam mit dem Handtuch zu lindern versuchte.
»Was hast du gemacht?« Die Stimme der Schwester war sanft, aber gleichzeitig schwang ein stahlharter Ton mit.
»Ich habe gesungen und getanzt, und sie hat gesagt, dass ich mich bewundere. Sie hat Nigger zu mir gesagt«, schluchzte Georgia.
Die Schwester sagte nichts. Sie hob das Kind nur in ihre Arme, hielt es fest an ihre Brust gedrückt und besänftigte es mit Liebkosungen.
»Ich trockne dich jetzt ab und bringe dich zu Bett.« Ihre Stimme zitterte ein wenig. »Morgen hast du einen großen Tag vor dir. Schwester Agnes wird dich nie mehr anrühren.«
Sie hob Georgia, die immer noch nur in das Handtuch eingewickelt war, hoch und ging schnellen Schritts mit ihr die Treppe hinauf in Richtung des Isolierzimmers.
»Warte einen Augenblick«, sagte sie, als sie das Kind auf das Bett sinken ließ. »Ich sehe nur schnell nach, ob ich einen Schlafanzug finde.«
Bei Nacht war der Raum heimelig. Eine kleine Nachttischlampe und ein eingeschalteter Gaskamin mit künstlichen Flammen gaben dem spärlich eingerichteten Zimmer eine Wärme, die jedem anderen Raum der Klosterschule fehlte. Obwohl sie am ganzen Körper Schmerzen hatte, bemerkte Georgia, dass jemand saubere Kleider für den nächsten Morgen auf den Stuhl gelegt hatte. Ein Schottenrock und ein Pullover, der viel schöner war als die, die sie normalerweise anziehen musste. Ihre Schluchzer verblassten zu einem Schluckauf.
»So.« Mit einem Schlafanzug und einem Unterhemd über dem Arm kam Schwester Mary wieder ins Zimmer geeilt.
In einer Hand hielt sie einen Topf mit Salbe.
»Leg dich auf den Bauch«, sagte sie mit sanfter Stimme. »Hiermit wird es nicht mehr so weh tun.«
Zuerst wimmerte Georgia bei jeder leichten Berührung, doch nach und nach ließen die Schmerzen unter der Berührung von Schwester Marys heilenden Händen nach. Mit festem Griff drehte die Schwester sie auf den Rücken. Mehr Salbe wurde auf ihrem Bauch, ihrer Brust und ihren Armen verteilt.
»So ist es besser«, sagte die Schwester. Sie nahm das Unterhemd und zog es schnell über Georgias Kopf, und danach sofort den warmen Schlafanzug. »Und jetzt ins Bett mit dir. Ich trockne dir die Haare noch ein bisschen.«
»Warum ist Schwester Agnes so gemein?« Während ihre Haare kräftig gerubbelt wurden, hatte Georgia Mut für die Frage geschöpft.
»Ich kann nichts über eine andere Schwester sagen.« Mary erklärte dies vorwurfsvoll und mit einem Zwinkern in den Augen. »Aber du wirst noch herausfinden, dass die Welt voller ganz verschiedener Leute ist – manche sind nett, manche schlicht und einfach gemein. Sagen wir einfach, dass Schwester Agnes tief drinnen nicht so glücklich ist wie ich.«
»Warum sind Sie glücklich?« Georgia drehte den Kopf herum, damit sie Marys Gesicht richtig sehen konnte.
»Weil Gott es für richtig hielt, mich hierherzuschicken.« Die Schwester lächelte, und ihre blauen Augen zwinkerten wieder. »Wie hätte ich dich sonst kennenlernen sollen?«
»Warum nimmt mich diese Dame mit zu sich nach Hause?«
Die Schwester lachte und zeigte dabei eine Reihe gleichmäßiger, weißer Zähne im gedämpften Licht. »So viele Fragen! Ich denke, ihr haben dein Mut und deine Begeisterung gefallen. Genau wie mir.«
»Dann werde ich für immer ihr kleines Mädchen sein?« Jetzt leuchteten Georgias Augen. Der schmerzende Körper war vergessen.
»Ich denke schon.« Schwester Mary zwirbelte eine Locke um ihren Finger. »Sie ist eine starke und fürsorgliche Frau, Georgia. Du wirst es bei ihr und ihrem Mann gut haben. Sei einfach ein braves Mädchen, und sie wird sich um alles andere kümmern.«
»Wird sie mich hierher zurückschicken, wenn ich böse bin?« Vor Angst weiteten sich Georgias Augen.
»Irgendwie bezweifele ich das.« Die Schwester ließ ein leises, tiefes Lachen hören. »Ich glaube nicht, dass sie zu denen gehört, die einfach aufgeben – egal, wer oder was auch kommt. Aber komm nicht auf die Idee, sie auf die Probe zu stellen, hörst du? Sogar für die allernettesten Leute ist das Maß irgendwann voll.«
Sie zog einen Kamm aus ihrer Tasche und fuhr damit durch Georgias feuchtes Haar. Georgia blickte auf und sah, dass der Nonne eine Träne die Wange herunterlief.
»Warum weinen Sie?«, flüsterte sie.
»Ich bin nur traurig, weil ich weiß, dass dies die letzte Nacht ist, die wir hier zusammen sind«, erwiderte die Schwester und wischte mit einer Hand über die Wange. »Wir sind lange Freundinnen gewesen. Ich habe dich an deinem ersten Abend hier ausgezogen. Du hast dich an mich geklammert wie ein Äffchen.« Sie lächelte bei dieser Erinnerung.
Es war eine wilde Novembernacht, in der Georgia mit einer Sozialarbeiterin im Kinderheim eintraf. Gerade einundzwanzig Monate alt, pummelig und mit pechschwarzen Locken, die ihren Kopf wie einen Heiligenschein umgaben, den Daumen fest im Mund vergraben, die Augen so schwarz wie die Nacht.
Es war nicht bekannt, ob sie ausgesetzt worden oder eine Waise war. Nur der Name »Georgia« war weitergegeben worden. Ihr Geburtsdatum, der 6. Januar 1945, war nur ein ungefähr geschätztes Datum.
Schwester Mary war erst wenige Wochen in St. Joseph’s und entsetzt über den allgemeinen Zustand des Heims. Es gab kein Spielzeug und auch herzlich wenig warme Kleidung oder warmes Bettzeug, dafür aber Kinder mit eiternden Wunden, Würmern und Läusen. Sie war aufgrund ihres jugendlichen Alters hierhergeschickt worden und weil sie ausgebildete Krankenschwester war. Bisher war es ihr allerdings nicht gelungen, auch nur eine kleine Schneise durch den Berg der Missstände zu schlagen, die sie hier sah.
Sie nahm Georgia in die Arme, wiegte sie an ihrer Brust und sah zu, wie die dunklen Augen langsam zufielen. Sie hätte darauf bestehen sollen, das Kind an einen Ort zu bringen, wo ein Baby besser aufgehoben war, aber sie hörte die Verzweiflung in der Stimme der Sozialarbeiterin, die Klagen darüber, dass das Haus voll sei, und so schloss sie das Kind ins Herz.
Es war Liebe auf den ersten Blick. Baden, Anziehen, Lehren und Füttern waren nicht länger Pflicht, sondern eine Freude. Die kleinen braunen Arme, die sich um ihren Hals legten und die feuchten, süßen Küsse waren eine ständige Erinnerung an alles, was sie für ihr Gelübde aufgegeben hatte.
Aber als die Jahre vergingen, legte sich manchmal Angst über die Freude. Sie sah, wie sich Georgias Charakter formte. Sie entwickelte sich zu einem verwegenen Clown, sie wurde zur Anführerin und Unterhalterin; sie war ein Kind, das sofort allen Schwächeren zur Seite stand, und sie wusste auch, dass Schwester Agnes genügend Macht und Hass besaß, um all dies zu zerstören. Mary war es gelungen, viele Dinge in St. Joseph’s zum besseren zu wenden. Speiseplan, Hygiene und Gesundheit der Kinder besserten sich, aber die Mutter Oberin hatte immer noch einen blinden Fleck, wenn es um Schwester Agnes’ Grausamkeit ging. Sie weigerte sich, zuzugeben, dass Frauen mit einem solchen Charakter nichts mit Kindern zu tun haben sollten.
Als sie hörte, dass Mrs. Anderson Georgia als Pflegekind zu sich nehmen wollte, war es für Mary, als würde ihr das Herz aus dem Leib gerissen. Gleichzeitig aber war sie auch nicht bereit, weiter ruhig zuzusehen, wie Georgias stolzer Geist gebrochen wurde, ihre Stimme zum Verstummen gebracht und sie zu einer verschreckten, leeren Hülle wurde.
»Gute Nacht, mein kleiner Schatz.« Schwester Mary beugte sich über Georgia und küsste ihr die Wange. »Denk manchmal an mich, wenn du betest, und vielleicht schreibst du mir, wenn du Zeit dazu hast.«
»Ich komme zurück und besuche Sie«, sagte Georgia schläfrig, und ihre Augen fielen zu.
»Sing einfach ab und zu für mich.« Die Schwester wischte eine Träne von ihrer Wange. »Ich werde dich hören, wo immer ich auch sein werde. Gott schütze dich.«
Als sie die Tür erreicht hatte, schlief Georgia schon. Ihre dichten, dunklen Locken bildeten einen schwarzen Heiligenschein auf dem Kopfkissen, und einen Arm wand sie um ihren Kopf. Einen Moment sah Schwester Mary die Schönheit, die später kommen würde. Kaffeebraune Haut mit rosa Untertönen, eine perfekte Knochenstruktur. Zu gleichmäßige Gesichtszüge für ein erst neunjähriges Kind, jedoch der Grundstock für wirkliche Schönheit. Sie schloss leise die Tür und hielt für einen Moment inne, um ihre Fassung wiederzuerlangen.
Morgen würde Mrs. Anderson Striemen auf dem Körper des Kindes sehen, und Schwester Mary wusste mit absoluter Sicherheit, dass diese fürsorgliche Frau schnell und gnadenlos handeln würde. Durch das Leiden eines Kindes konnten vielleicht viele andere davon verschont bleiben.
»Beschütze und erhalte sie, Herr«, flüsterte sie. »Und gib mir die Stärke, es mit Schwester Agnes aufzunehmen.«
Kapitel 2
September 1956
Lass mich hier aussteigen, Daddy!« Unsicherheit machte Georgias Stimme ein wenig zittrig, als sie in die Kidbroke Lane einbogen und der Schulhof der Gesamtschule bedrohlich näher kam.
Es war ein heißer, sonniger Morgen mit lebhaften Farbklecksen in den Vorstadtgärten, und es sah aus, als wollten die Dahlien sich gegenseitig mit aller Macht in ihrer Leuchtkraft übertrumpfen.
»Willst du nicht, dass ich mit dir reingehe?« Brian Anderson fuhr an die Seite und wandte sich Georgia zu.
»Ich sehe ja wie ein Baby aus, wenn du das tust.«
»Du bist ja auch unser Baby.« Brian lachte leise. »Aber ich weiß schon, was du meinst. Mit manchen Dingen muss man allein fertig werden.«
»Hattest du an deinem ersten Tag in einer großen Schule denn Angst?« Georgia lehnte sich einen Augenblick lang an seine Schulter. Der Geruch des gestärkten Hemdes und der Duft des Aftershaves gaben ihr Kraft.
»Fürchterliche Angst«, gab er zu und tätschelte dabei ihre kleine Hand mit seiner großen. »Aber es war gar nicht so schlimm, wie ich erwartet hatte. Das ist mit allen Dingen so.«
»Dann gehe ich jetzt los.« Sie richtete sich auf und neigte sich näher zu Brian heran, um seine glatte Wange zu küssen. »Sehe ich auch wirklich vernünftig aus?«
»Vernünftig! Du siehst einfach toll aus«, lächelte er und wünschte sich dabei, er könnte sie noch einmal knuddeln und dieses besorgte Stirnrunzeln vertreiben. »Jetzt aber raus mit dir, und mach dir keine Sorgen mehr. Dort sind noch andere neue Mädchen. Hunderte, und sie sind genau wie du!«
Brian Anderson sah zu, wie sie die Straße überquerte und an der Umzäunung entlang auf das Tor zuging. Hunderte anderer Mädchen füllten die Allee. Mit dem Frieden war es hier vorbei. Das neue Schuljahr hatte begonnen. Aber Brian Anderson nahm die anderen Mädchen kaum wahr, seine Augen waren nur auf Georgia gerichtet.
Sie hatte sich in zwei Jahren so verändert, dass sie fast nicht wiederzuerkennen war. Sie war in die Höhe geschossen, ihre Arme und Beine, die früher Stöcken geglichen hatten, waren durch das gute Essen etwas runder geworden, das einst kurzgeschorene Haar konnte sich jetzt auf ihren Schultern kringeln, und ihre Haut hatte den gelblichen Farbton verloren.
Unter einem schicken neuen Blazer schwang ihr marineblauer Faltenrock, und ihr Barett saß frech auf ihrem Kopf. Und doch spürte er beim Anblick ihrer kindlichen braunen Beine in den langen grauen Socken und der steifen, glänzenden Schultasche über ihrer Schulter ganz unerwartet einen Kloß im Hals.
»Lass sie dich akzeptieren, Georgia«, sagte er leise, als er den Gang einlegte und anfuhr. »Genauso, wie du es bei mir geschafft hast.«
Brian Anderson kannte das Gefühl, anders zu sein, besser als irgendjemand sonst. Er war von seiner verwitweten Mutter allein in dem großen Haus in Blackheath großgezogen worden, wo er immer noch lebte. Er verstand es, wenn ein Kind das Bedürfnis hatte, genau wie alle anderen zu sein.
Seine Mutter hatte ihn mit den besten Absichten von anderen Kindern ferngehalten. Sie wollte ihn vor Leid bewahren, ihn in einen Kokon der Zuneigung einhüllen. Eine kleine, exklusive Privatschule, in der man auf die raueren Sportarten herabsah; Abende, die gemeinsam lesend mit ihr verbracht wurden oder lange Spaziergänge im Sommer. Er hatte sich bereitwillig in eine Banklaufbahn hineinbugsieren lassen. Männer, die Mädchen, Tanzen, Trinken oder Sport mochten, waren keine Gentlemen.
Brian hielt sich nicht für schwach, und er fand auch nicht, dass er sich den Wünschen seiner Mutter unterwarf. Er war einfach ein Einzelgänger, der keine Abwechslung und keine neuen Erfahrungen brauchte. Nicht einmal Herausforderungen. Manchmal allerdings wünschte er sich doch, dass sein bisheriges Leben etwas ereignisreicher hätte sein können.
Als Brian über die Heide in Richtung Lewisham fuhr, sah er bei einem kurzen Blick in den Rückspiegel sein Gesicht. Rotblondes Haar, das langsam dünner wurde, ordentlich zur Seite gekämmt. Ein rundes, volles Gesicht, das sich seit seiner Teenagerzeit kaum verändert hatte. Eine frische Gesichtsfarbe. Blassblaue Augen mit rötlichen Wimpern und Augenbrauen. Eine gerade, kleine Nase und gleichmäßige weiße Zähne, die vor allem das Produkt mütterlicher Fürsorge und Aufmerksamkeit waren. Kein gutaussehender Mann, aber, wie seine Mutter immer wieder betonte: »Kleider machen Leute.« Seine Anzüge waren sämtlich von Hand geschneidert: für die Bank marineblau mit einem kaum sichtbaren Nadelstreifen, helles Grau für öffentliche Anlässe und ein marineblauer Blazer für die Wochenenden und Ferien.
Seine Hemden wurden immer in die Wäscherei geschickt. Ihm gefiel es, wenn seine Kragen steif und gestärkt waren, die Krawatten in gedeckten Farben. Er besaß vier Paare identischer schwarzer Lederschnürschuhe, die er in täglichem Wechsel trug. Man sah ihm seinen Beruf an: ein fünfzigjähriger, angesehener, verlässlicher Bankfilialleiter, ordentlich und fleißig.
Es herrschte starker Verkehr, als Brian sich langsam der High Street in Lewisham näherte. Er unterdrückte einen Fluch und stellte fest, dass er zum allerersten Mal in seinem Leben zu spät kommen würde.
Er parkte seinen Humber in einer Seitenstraße in der Nähe der Bank, nahm seine Aktentasche vom Rücksitz und schloss hastig die Autotür ab.
»Guten Morgen, Mr. Anderson.«
Die Stimme seiner Sekretärin ließ ihn hochblicken.
»Guten Morgen, Miss Bowden.« Er lächelte. »Ich fürchte, ich bin ein bisschen spät dran. Ich habe Georgia heute Morgen zu ihrer neuen Schule gebracht.«
»Keine Sorge.« Miss Bowden entging das sorgenvolle Stirnrunzeln nicht. »Ich habe heute Morgen extra keine Termine vor zehn Uhr dreißig für Sie gemacht. Ich habe schon damit gerechnet, dass Sie heute ein wenig aufgehalten werden.«
Miss Bowden war seit drei Jahren seine Sekretärin. Eine vernünftige unverheiratete Frau Mitte dreißig und ihrer Arbeit ebenso mit Leib und Seele zugetan wie Anderson selbst. Ihr dunkles Kostüm und die weiße Bluse, die robusten, flachen Schuhe und das ordentlich frisierte braune Haar dienten anderen, jüngeren Angestellten als ständige Erinnerung, dass so eine Frau im Bankgeschäft auszusehen hatte.
»Ich will nur hoffen, dass Coulson pünktlich war.« Brian parkte den Wagen neben dem Bürgersteig. Noch mehr als sein Zuspätkommen irritierten ihn die vielen Menschen, die schon zu so früher Stunde ihre Einkaufswagen über den Markt schoben. »Es ist schon so lange her, dass man von ihm erwartete, die Bank aufzuschließen … ich bezweifle, dass er noch weiß, wie es geht.«
»Natürlich weiß er das«, versicherte Miss Bowden ihrem Chef.
»Schauen Sie selbst – die Lichter sind an.«
Eigentlich war es nicht notwendig, dass Anderson vor neun Uhr dreißig in der Bank war, aber er legt alte Angewohnheiten nur schwer ab. Oft saß er schon kurz nach acht Uhr dreißig an seinem Schreibtisch, lange, bevor die anderen Angestellten eintrafen. Diese Art Zuverlässigkeit war es gewesen, die ihm die Beförderung zum Filialleiter eingebracht hatte, und obwohl Celia ihm immer wieder sagte, dass es für ihn langsam Zeit war, sich zurückzulehnen und die Dinge etwas leichter zu nehmen, gefiel es ihm immer noch, da zu sein und die Bank aufzuschließen.
»Wie ging es Georgia denn heute Morgen?«, fragte Miss Bowden. »War sie nervös? Es ist ein großer Schritt, in eine so große Schule zu gehen.«
»Ein bisschen nervös war sie, aber sobald sie sich eingewöhnt hat, wird sie sich wohl fühlen.« Andersons Gesichtsausdruck wurde ein bisschen weicher. »Erinnern Sie mich dran, dass ich meine Frau später anrufe, ja?«
»Was für ein reizendes Mädchen sie ist!« Miss Bowden lächelte herzlich, als sie sich der Eingangstür näherten und klingelten, damit sie jemand hereinließ. »Sie macht Ihnen beiden Ehre.«
»Danke, Miss Bowden.« Das Kompliment ließ Brians rundes Gesicht strahlen. Manchmal hatte er das Gefühl, ein wenig in Georgias Schatten zu stehen. Deshalb war es nett zu wissen, dass wenigstens seine Angestellten merkten, dass er dafür verantwortlich war, wie vielversprechend sich Georgia entwickelt hatte. »Das war nicht alles leicht für sie, aber sie ist die Unruhe wert gewesen.«
Niemand wusste, welch einen Schrecken es ihm eingeflößt hatte, ein Kind mit unbekanntem Hintergrund in seinem Haus zu haben, am wenigsten Celia. Er verbarg es, so wie er viele andere Dinge verbarg. Celia war wie seine Mutter; es war einfacher, sich nach ihren Wünschen zu richten, als mit ihr zu streiten.
Jetzt trieb es ihm die Röte ins Gesicht, wenn er sich daran erinnerte, als er seinen Freunden und Kollegen erzählt hatte, wie Georgias Rücken bei ihrer Ankunft mit Striemen bedeckt war. Er nahm alle Anerkennung für Georgias gute Fürsorge für sich in Anspruch und ließ anklingen, dass er Himmel und Erde in Bewegung setzen wollte, damit St. Joseph’s geschlossen würde.
Ihre Verletzungen hatten ihn entsetzt, aber es war Celia und nicht er gewesen, die sich damit auseinandergesetzt hatte. Warum hatte er solche Furcht gehabt, ein kleines Kind könne ihr schönes, friedliches Haus zerstören? Warum hatte er sich beleidigt und stumm im Hintergrund gehalten, während Celia sich mit Leib und Seele in ihre Mutterrolle begeben hatte?
Natürlich hatte er damals nicht gewusst, wie viel Gutes ein einziges Kind mit sich bringen konnte. Hätte er es bemerkt, so wäre er vielleicht das Etikett »Der langweilige alte Anderson« über Nacht losgeworden, und vielleicht wäre er auch weniger trotzig gewesen. Es war, als sei er einem exklusiven Club beigetreten. Plötzlich stand er bei Gesprächen, in denen sich alles um das Familienleben drehte, nicht länger außen vor. Seine Angestellten hatten größeres Interesse an ihm, und zum ersten Mal in seinem Leben hatte er das Gefühl, ganz akzeptiert zu werden.
Für ihn hatte es vielleicht ein wenig länger gedauert, ein richtiger Vater zu werden, als er es seine Kollegen hatte bemerken lassen, aber in dieser Zeit gab es Augenblicke des Erstaunens. Wenn er Spaziergänge mit Georgia unternahm, ihr das Radfahren beibrachte oder ihr bei den Rechenaufgaben half – all dies bereitete ihm ein Vergnügen, das er nicht erwartet hatte. Frauen sahen ihn anders an und blieben stehen, um mit ihm zu reden. Er fühlte sich mächtig, als Mann der Tat und nicht mehr nur als ein Mann in den mittleren Jahren mit rötlichem Haar, der sich an einer Aktentasche festhielt.
Nun, vielleicht ging der Zauber nicht so weit, dass Celia ihm nun mit echter Leidenschaft begegnete. Auch war ein Mischlingskind kein richtiger Ersatz für ein eigenes Kind. Aber wenigstens hatten er und Celia ein gemeinsames Interesse. Sie sah jünger und hübscher aus, lachte häufiger und kuschelte sich nachts an ihn. Vielleicht würde sich diese neue Wärme mit der Zeit in Begehren verwandeln.
Sein Büro roch nach frischer Möbelpolitur. Ein sauberes Blatt Papier lag auf seiner Schreibunterlage, und seine Stifte waren ordentlich auf einer Schreibtischablage angeordnet. Bald würde ihm eine der kleineren Angestellten frischen Kaffee bringen, und dank Miss Bowdens Aufmerksamkeit hatte er Zeit, sich zu sammeln und seine Gedanken nicht länger bei Georgia aufzuhalten.
Erinnerungen an sie umgaben ihn überall: der kleine Tintenwischer, auf den sie »Daddy« gestickt hatte und den sie ihm zum letzten Weihnachtsfest geschenkt hatte; ein Bild von ihm, von Celia sorgfältig gerahmt. Früher hätte er niemals daran gedacht, das Bild eines Mannes mit flammend rotem Haar in seinem Büro aufzuhängen, aber insgeheim liebte er das Bild, das Georgia von ihm gemalt hatte. Sie hatte sein verborgenes Selbst eingefangen; ein stark aussehender Mann, der Kricket spielte. Es bot den Kunden Gesprächsstoff, ließ sie lockerer werden; sie erkannten, dass er mehr war als nur ein Stockfisch.
Schließlich war da noch das Foto aus dem Urlaub in Bournemouth, auf dem sie alle drei zu sehen waren. Celia in einem tief ausgeschnittenen Cocktailkleid, er in einer Smokingjacke, Georgia zwischen ihnen. Sie lachte sie beide an, ganz dunkle Locken, große Augen und Grübchen.