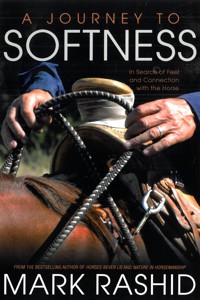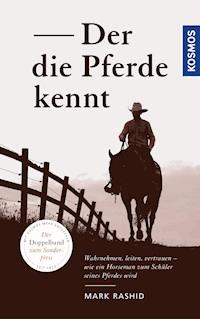14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Kosmos
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Der so oft propagierten "Dominanz" gegenüber dem Pferd setzt Mark Rashid das Prinzip des "sanften Führers" entgegen. Ihm schließen sich die Pferde freiwillig an, weil sie seinen Fähigkeiten vertrauen und sich in seiner Gegenwart wohl fühlen. Wie man diese erstrebenswerte Position einnehmen kann, zeigt Mark Rashid anhand vieler konkreter Fallbeispiele.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2013
Ähnliche
Dieses EBook ist die digitale Umsetzung der Printausgabe, die unter demselben Titel bei KOSMOS erschienen ist. Da es bei EBooks aufgrund der variablen Leseeinstellungen keine Seitenzahlen gibt, können Seitenverweise der Printausgabe hier nicht verwendet werden. Statt dessen können Sie über die integrierte Volltextsuche alle Querverweise und inhaltlichen Bezüge schnell komfortabel herstellen.
Für alle Menschen auf dieser Erde, die mir die Ehre erwiesen, mit ihnen und ihren Pferden zu arbeiten zu dürfen.
Zugegeben: Ich bin ein Rashid-Fan
Meine erste Bekanntschaft mit Mark Rashid kostete mich eine schlaflose Nacht. Es war ein Donnerstagabend Ende 1997, und ich sollte am nächsten Morgen ein Radio-Interview mit ihm aufnehmen. Es ging um sein erstes Buch »Der auf die Pferde hört«. Ich dachte, eine Stunde oder so würden genügen, um mich über seine Trainingsmethoden zu informieren. Ein paar tiefschürfende Fragen dazu könnte ich mir ja auf meinem altgedienten gelben Block notieren. Also setzte ich mich an den Schreibtisch, öffnete das Buch und machte mich ans Querlesen. Darin bin ich ziemlich gut, und die meisten Bücher über Pferdeausbildung eignen sich auch sehr gut dafür, weil sie als Textsachbücher geschrieben sind. Dieses Buch aber war anders, und ehe ich mich’s versah, hing ich am Haken. Ich las bis in die frühen Morgenstunden und hatte meinen gelben Block total vergessen.
Ich las jedes einzelne Wort im Buch und später auch den Nachfolgeband »A Good Horse is Never a Bad Color« sowie das Buch, das Sie jetzt in Händen halten und das mir Mark freundlicherweise kapitelweise, so wie sie fertig wurden, per E-Mail übersandte. Ich gebe es zu: Ich bin ein Fan.
Mark Rashid ist als Ausbilder einzigartig. Es kommt ihm immer darauf an, den Standpunkt des Pferdes zu berücksichtigen, und mit dieser Methode erzielt er verblüffende Veränderungen bei Pferden und den Menschen, die sie lieben. Er ist außerdem ein wunderbarer Geschichtenerzähler, der es fertig bringt, seine Prinzipien der Horsemanship nahtlos mit spannenden Anekdoten aus seinem eigenen Leben zu verweben, besonders von seinen Lehrjahren bei einem ergrauten alten Pferdemann, der einfach »der alte Mann« heißt. Vermutlich werden Sie, wie ich, in Marks Geschichten Ihre eigene Jugend wiederfinden, eine Zeit, die bittersüß, verwirrend und berauschend sein konnte, alles an einem Tag.
Mark Rashid stützt seine sanfte, undogmatische Trainingsphilosophie auf den passive leader, was man am besten auch mit »sanfter Führer« übersetzt. Das ist in der Herde das Pferd, das mehr durch sein Beispiel führt als durch Druck. Mir ist aufgefallen, dass dies eine gute Beschreibung von Mark selbst ist. Mark drängt Ihnen seine Methode genauso wenig auf, wie er sie einem Pferd aufzwingen würde. Er erklärt, was es in seinen Augen für Wahlmöglichkeiten gibt, und lässt Sie dann Ihre eigene Entscheidung treffen.
Glauben Sie mir: Dies ist kein Buch zum Querlesen. Sie werden es sich neben das Bett legen, jedes Wort mit Genuss lesen und süße Pferdeträume träumen. Wer weiß? Vielleicht wachen Sie auf und sind ein besserer Pferdemensch, ein besserer Mensch überhaupt.
Rick Lamb
Radio-Moderator der bekannten amerikanischen Sendung
»The Horse Show«
Wie alles anfing, oder: Die Idee zu diesem Buch
Im Frühjahr 1997 sollte ich auf einem Distanzreiter-Treffen in Oregon einen Vortrag halten. Das Thema des Vortrags blieb mir überlassen, aber die Organisatorin ließ durchblicken, dass sich sicher viele der Teilnehmer für meine Arbeit mit Problempferden interessieren würden.
Ich überlegte lange hin und her, bevor ich mich an den Computer setzte und versuchte, ein paar Stichpunkte zu Papier zu bringen. Aus irgendeinem Grund fiel es mir schwer, meine Gedanken für den Vortrag auf eine Linie zu bringen, und es dauerte fast sechs Monate, bevor er wenigstens in Umrissen stand. Aber auch dann fand ich das, was ich geschrieben hatte, nicht übermäßig aufregend. Ich hatte jahrelang so viele Vorträge über Problempferde gehalten, dass ich das Gefühl nicht loswerde, mich nur zu wiederholen. Da es aber das war, was sie offensichtlich hören wollten, würde ich den Vortrag wohl auch wie geplant halten.
Der Termin war etwa Mitte Februar 1997, und ich war erst ein paar Wochen vorher mit meinen Notizen fertig geworden. Ich war mir vorgekommen wie beim Zähneziehen und heilfroh, diesen Teil hinter mir zu haben.
Nun war ich nie besonders gut mit Computern und habe nie richtig verstanden, wie sie funktionieren. Ich hatte keine Ahnung, dass man das, was man in den Computer eingetippt hatte, noch auf einer Diskette sichern sollte für den Fall, dass der Computer abstürzt. Ich dachte, wenn die Informationen erst einmal im Computer wären, könnte ich sie dort auch jederzeit wieder abrufen. Schließlich gingen sie in einen Kasten, und es war nur logisch, dass man, wenn man etwas in einen Kasten tut, dies auch wieder aus dem Kasten herausholen kann. Zu meinem Leidwesen sollte ich bald feststellen, dass meine Vorstellung davon, wie ein Computer arbeitet, in keiner Weise mit der Vorstellung des Computers übereinstimmte.
Eines Nachmittags hatten wir einen ziemlich bösen Sturm, der die Stromversorgung auf der Ranch unterbrach. Der Strom ging schließlich wieder an, aber der Computer nicht. Er ging nicht nur nicht wieder an, er hatte auch alles, was er zur Zeit des Stromausfalls in sich gehabt hatte, für alle Zeit verloren. Die Notizen, die ich mir über Monate so mühsam abgerungen hatte, waren auf Nimmerwiedersehen irgendwo in den winzigen Stromkreisen verschwunden.
Der Termin für meinen Vortrag rückte in Windeseile näher, also setzte ich mich hin und versuchte, meine Notizen wiederherzustellen. Keine Chance. Je mehr ich mich bemühte, desto mehr schweiften meine Gedanken ab, bis ich schlussendlich die Idee, über Problempferde zu sprechen, aufgab und über etwas völlig Neues nachzudenken begann.
Was mir immer wieder einfiel, war eine Idee, die mich schon seit zwölf Jahren beschäftigte. Sie hat mit dem zu tun, was für mein Gefühl der Kern einer erfolgreichen Arbeit mit Pferden ist. Sie hat zu tun mit einigen der Dinge, die wir in all den Jahren auf unserer Ranch gemacht und die es uns ermöglicht hatten, eine Art bedingungsloses Vertrauensverhältnis zu unserer etwa 80-köpfigen Herde aufzubauen. Ich hatte das Gefühl, die Vortragsbesucher könnten das Thema interessant finden, denn bei unserer Suche nach Wegen, das Vertrauen unserer Herde zu gewinnen, hatten wir auch festgestellt, dass sie uns als Führer zu betrachten schienen, die sie sich freiwillig aussuchten und denen sie folgen wollten. Das Ergebnis waren Pferde, die nicht nur extrem einfach auszubilden waren, sondern die auch später rittig und verlässlich blieben, ganz gleich, wer im Sattel saß.
Ich glaube, es gab einen primären Grund für den Erfolg, den wir bei der Entstehung dieser Art von Beziehung zwischen uns und den Pferden hatten – wir arbeiteten sehr intensiv daran, das Verhalten eines bestimmten »Führers« in der Herde nachzuahmen. Dieses Pferd, dem wir zu gleichen versuchten, war nicht das Alpha oder das dominanteste Tier der Herde, wie viele vielleicht annehmen würden. Wir wollten so sein wie ein Pferd mit einem ganz anderen Temperament, einer ganz anderen Rolle innerhalb der Herde – ein Pferd, das durch sein Beispiel führt, nicht durch Druck. Ein Pferd, das extrem zuverlässig und voller Selbstvertrauen ist, eines, dem die große Mehrheit der Pferde nicht nur bereitwillig folgt, sondern das sie sich tatsächlich selbst aussuchen.
Um meinen Zuhörern bei dem Treffen erklären zu können, was wir mit unserer Herde gemacht hatten, musste ich eine große sprachliche Hürde überwinden: Das Pferd, dem wir zu gleichen versuchten, hatte keine Bezeichnung. Genau genommen hatte ich überhaupt noch nie irgendjemanden von solch einem Pferd reden hören. Ich musste mir einen Begriff oder einen Titel einfallen lassen, der seine Rolle in der Herde so gut wie möglich erklärte. Wenn es mir gelang, würde es mir leichterfallen zu erklären, warum wir es so wichtig fanden, dieses Pferd bei unserer Arbeit mit der Herde nachzuahmen.
Nach einigen Tagen kam mir ein Einfall, der mir bestens geeignet schien, ein Begriff, den ich bei meinem Vortrag verwenden konnte: der des passive leader. Er war nicht gerade sehr wissenschaftlich, aber etwas Besseres fiel mir nicht ein. Und die Zeit wurde knapp.
Jedenfalls wählte ich diesen Titel, weil das betreffende Pferd keines war, das sich die führende Rolle aktiv erkämpfen würde. Stattdessen wurde es von den Herdenmitgliedern gewählt als dasjenige, dem sie folgen wollten. Die Rolle des Führers wurde dem Pferd auf passive Weise verliehen. Mit anderen Worten: Dieses Pferd strebte nicht unbedingt nach der Führung der Herde, lehnte seine Rolle aber auch nicht ab, als es gewählt wurde. Der Titel bezieht sich auf die Art, wie das Pferd für seine Rolle ausgewählt wird, nicht auf das, was es tut, wenn es erst einmal »ernannt« worden ist.
Nach dem Treffen stellte sich heraus, dass ich die Idee hinter dem Titel etwas klarer hätte herausstellen sollen. Als mein Vortrag sich allmählich in der Pferdeszene herumsprach, nahmen die meisten automatisch an, dass wir unsere Pferde, damit sie in uns ihre passiven Führer sahen, auf eine passive Weise behandeln mussten.
Dieses schlichte Missverständnis verursachte nicht wenig Verwirrung. Viele Leute konnten nicht verstehen, wie sie jemals bei ihren Pferden etwas erreichen sollten, wenn sie sie immer auf eine passive Art und Weise behandelten. Schließlich bedeutet das Wort »passiv« »nicht handelnd«.
Wie konnten wir unsere Pferde trainieren oder arbeiten, wenn wir »nicht handelten«? Die Antwort auf diese Frage lautet: Können wir auch nicht! Noch einmal, der Begriff passive leader sollte nicht illustrieren, was das betreffende Pferd tut, nachdem es gewählt wurde, sondern eher die Art, wie es überhaupt gewählt wurde.1› Hinweis
Die Frage ist nun, wie wir unsere Pferde dazu bekommen, dass sie uns zu ihrem Führer wählen wollen. Meiner Beobachtung nach muss ein Pferd (oder ein Mensch), bevor er oder es überhaupt als passive leader in Betracht kommt, zunächst einmal die Qualitäten besitzen, die es zum Wunschkandidaten machen. Diese Qualitäten sind ruhiges Selbstvertrauen, Zuverlässigkeit, Beständigkeit und die Bereitschaft, keinen Druck auszuüben.
In diesem Buch habe ich versucht, einige der Dinge zu erklären, die sich im Laufe der Zeit als hilfreich dabei erwiesen haben, diese Qualitäten in den Augen unserer Pferde zu besitzen. Wir bemühten uns, die genannten Eigenschaften zu verkörpern und stellten schnell fest, dass unsere Pferde uns vertrauten. Hatten wir erst ihr Vertrauen gewonnen, schien es für sie leichter zu sein, uns als jemanden zu betrachten, dem sie bereitwillig folgen, den sie sich sogar als Führer aussuchen würden, um sich sicher zu fühlen.
Ich fürchte, Sie werden in diesem Buch wenig über neue oder andere Techniken oder Ausrüstungen finden, die Sie verwenden sollten, wenn Sie sich als »sanfter Führer« etablieren wollen. Hilfsmittel und Techniken machen meiner Erfahrung nach nicht so viel Unterschied, solange sie mit der richtigen Einstellung angewendet werden. Und das ist es, worum es in diesem Buch schlussendlich vermutlich wirklich geht – um die Einstellung.
Eine gute Freundin sagte einmal, dass für sie die Arbeit mit Pferden wie eine lange Reise sei. Eine Reise ohne Ziel – ein unendlicher Prozess –, und wichtig ist das »Gehen«, nicht das »Ankommen«.
Ich hoffe, dass Sie die Gedanken, die ich hier zum Thema Horsemanship zu teilen versuche, um einen weiteren Schritt auf dieser langen Reise voranbringen.
Der Wendepunkt, oder: Mit dem alten Mann wird alles anders
Als Kind habe ich mich immer auf den Sonntag gefreut. Nicht auf den ganzen Tag, das nicht. Meistens auf den Nachmittag, wenn meine Eltern uns Kinder ins Auto luden und wir unsere wöchentliche Fahrt aufs Land unternahmen.
»Aufs Land« zu fahren, bedeutete im Grunde nicht viel, denn wir wohnten schon ziemlich »auf dem Lande«. Wir wohnten in einem Vorort der Stadt, an der letzten gepflasterten Straße, bevor sich die unbekannte Ferne auftat. So jedenfalls sah ich es. Mit acht Jahren war für mich alles, was jenseits der Ecke von Weis & Stow lag, unentdecktes, auf keiner Landkarte verzeichnetes Territorium. Ich konnte an dieser Ecke stehen und hinausschauen auf – wie mir schien – Tausende von Meilen offenes Gelände, Äcker und Viehweiden. Und ich konnte mir nur vorstellen, was für furchterregende Ungetüme dort draußen lauern mochten.
Wenn ich meine Augen anstrengte, konnte ich gerade noch die Überreste einer Scheune erkennen, die vor langer Zeit niedergebrannt war. Vielleicht war sie auch einfach zusammengefallen – es war schwer zu sagen. Auf jeden Fall aber war das alte, verlassene Haus neben der verfallenen Scheune verhext, und das war schon Grund genug, dass ich mich nicht weit weg traute von der Sicherheit jener Ecke.
Außer am Sonntag. Sonntags kletterten wir alle ins Auto und fuhren den Feldweg entlang genau an dem alten Haus vorbei. Und verdammt will ich sein, wenn es sonntags nicht viel weniger gruselig aussah. Besonders wenn man es vom sicheren Rücksitz eines 58er Oldsmobiles aus sah. Nichts ist so richtig gruselig, wenn man von vier Tonnen glitzerndem Stahl umgeben ist.
Wenn wir an dem verhexten Haus vorbei waren, bogen wir links auf einen anderen Feldweg ein, der uns auf den Highway brachte. Dieser Feldweg war ungefähr 3 km lang, und etwa in der Mitte lag auf der rechten Seite noch eine verlassene Ranch. Die Zufahrt war ca. 500 m lang und führte zu ein paar schäbigen Scheunen. Rechts und links von der Zufahrt lagen verwahrloste Weiden. Alle Zäune waren verrottet und alles sah einfach heruntergekommen aus.
Ich hatte dem Ort nie viel Aufmerksamkeit geschenkt, aber das änderte sich an einem Sonntagnachmittag von Grund auf.
An diesem Sonntag waren wir am verhexten Haus vorbeigefahren, waren links abgebogen und näherten uns der alten Ranch, als mir etwas Ungewöhnliches auffiel. Pferde. Es waren Pferde auf den Weiden. Nicht nur ein Pferd oder zwei, sondern viele. Vielleicht an die zwanzig, womöglich sogar dreißig!
Als wir näher kamen, sah ich, dass sich ganz entschieden etwas verändert hatte. Die Ranch sah gar nicht mehr so schlecht aus. Die Zäune waren gerichtet, die Türen waren an ihrem Platz und in den Fenstern waren Glasscheiben. Der Platz sah sogar richtig gut aus. Es war jemand eingezogen und hatte aufgeräumt. Und nicht nur das – sie hatten Pferde mitgebracht.
Mein ganzes kurzes Leben lang hatte ich Pferde geliebt. Ich weiß nicht einmal, warum. Schließlich war ich überhaupt noch nicht mit richtigen Pferden in Berührung gekommen. Ich hatte nur Roy Rogers auf Trigger gesehen, Marshal Dillon auf seinem Rotschimmel und Joe Cartwright auf seinem Paint. Ich habe also keine einleuchtende Erklärung dafür, warum ich von ihnen so hingerissen war. Aber ich war es, wie so viele andere Jungen und Mädchen in meinem Alter.
Pferde so nah bei unserem Haus war eine Menge mehr, als ich aushalten konnte. Ich hatte mich zwar noch nie allein in diese Richtung gewagt, aber richtige Pferde in Fahrrad-Entfernung besaßen eine Anziehungskraft, die das Risiko wert war, von den Gespenstern im verhexten Haus gepackt zu werden, wenn ich daran vorbeiradelte. Gleich am nächsten Tag sprang ich auf mein Rad und fuhr hinaus.
Mit dem Rad zu der alten Ranch hinauszufahren, dauerte erheblich länger als im Oldsmobile, das stand einmal fest. Der Weg schien kein Ende zu nehmen, außer auf den paar Metern vorbei am verhexten Haus. Für diese Strecke brauchte ich überhaupt keine Zeit, da sorgte ich schon dafür.
Jedenfalls stand ich nach Stunden, wie mir vorkam, mit meinem Rad vor der Ranch, wo all diese Pferde friedlich grasten. Komisch, aber erst jetzt ging mir etwas Wichtiges auf:
Was hatte ich eigentlich vor? Okay, ich war hier. Aber zunächst einmal: Warum war ich überhaupt gekommen? Und was würde ich jetzt machen, nachdem ich einmal hier war? Umdrehen und wieder heimfahren? Oder wie ein Idiot den ganzen Tag in der Einfahrt herumstehen?
Es war traurig, aber wahr: Ich hatte keinen Plan. Vermutlich hatte ich mir so viele Sorgen gemacht, wie ich dorthin kommen sollte, dass ich mir überhaupt nicht überlegt hatte, warum ich dorthin wollte und was ich dort tun würde.
Nun, darüber musste nachgedacht werden. Ich schob mein Rad über den Straßenrand und ließ es in das hohe Gras gleiten, das den Graben überwucherte. Ich setzte mich daneben und starrte auf die Weide mit den Pferden, während ich versuchte, mir einen Plan zu machen. Nach einer Weile – ich dachte so angestrengt nach, wie ich nur konnte – hob eines der Pferde den Kopf und sah mich direkt an. Es war ein großes Pferd mit rötlichem Fell und einem kleinen, weißen Fleck auf der Stirn. Ein schönes Pferd, soweit ich mich erinnere. Ich erinnere mich, dass seine Ohren ganz aufrecht standen und es den Kopf sehr hoch trug, während es mich ansah. Ich saß absolut still, um es nicht zu erschrecken (und weil ich keine Ahnung hatte, was ich sonst hätte machen sollen). Kurz darauf bewegte es den Kopf langsam auf und ab – eine sonderbare Aktion, die ich bei Trigger in keinem der RoyRogers-Filme gesehen hatte. Diese Kopfbewegungen machte es eine ganze Weile, bis es schließlich den Kopf senkte und langsam auf mich zukam.
Eines war sicher: Das hatte ich nicht erwartet. Von allen Szenarien, die ich mir bezüglich dessen, was auf der Ranch passieren würde, wenn ich da wäre, nicht vorgestellt hatte, war dies mit Sicherheit ein Teil. Zu sagen, dass mich das näher kommende Pferd ein bisschen nervös machte, wäre eine Art Understatement gewesen. Während es näher kam, dachte ich dauernd: Das ist wirklich ein großes Pferd! Je näher es kam, desto schneller schlug mein Herz. Schließlich stand es genau auf der anderen Seite des Zauns und ich war schweißgebadet. Außerdem merkte ich, dass ich besser noch zu Hause auf die Toilette gegangen wäre.
Das Pferd senkte den Kopf, um mich genau betrachten zu können. Es ging kein Wind und die späte Morgensonne brannte auf uns beide herunter. Ich erinnere mich an das Brummen von Fliegen und das Rascheln von Grashüpfern, die hierhin und dorthin segelten. Und ich erinnere mich daran, dass ich das Pferd atmen hörte. Lange, entspannte Atemzüge, gelegentlich unterbrochen von einem etwas schnelleren Ausatmen. Wenn das Pferd einatmete, weiteten sich jedesmal seine Nüstern. Meine vermutlich ebenfalls.
Ich saß weiter ganz still und bemühte mich, keine Bewegung zu machen, die das Pferd veranlassen könnte, zu beißen, zu stampfen, zu schlagen oder mich sonst wie zu verstümmeln oder zu Tode zu bringen. Das Pferd verhielt sich ähnlich, blieb in sicherer Entfernung mit dem Zaun zwischen uns. Nach einiger Zeit siegte bei uns beiden vermutlich die Neugier. Das Pferd ging langsam noch näher an den Zaun heran. Mir war immer noch nicht ganz geheuer, aber mit jeder Minute wurde ich mutiger. Ich stand auf und bewegte mich zentimeterweise ebenfalls auf den Zaun zu.
Ich musste durch den Grabengrund, um näher heranzukommen, und das tat ich so ruhig, wie ich konnte. Als ich es geschafft hatte, hing der Pferdekopf über dem Zaun und das Pferd streckte mir seine Nase entgegen, wo ich sie leicht erreichen konnte. Unglaublich, wie weich diese Nase war.
In Minutenschnelle war meine Angst so gut wie verschwunden und ich schloss ganz schnell Freundschaft mit dem großen, roten Pferd. Es ließ sich von mir an der Nase, an den Backen und an der Stirn streicheln, dort, wo der weiße Fleck war. Im Gegenzug riss ich etwas von dem hüfthohen Gras ab und bot es ihm an. Der Rote nahm es mir höflich, um nicht zu sagen, delikat aus der Hand, und während er kaute, streichelte ich.
So ging das eine ganze Zeit lang, bis ich plötzlich einen Riesenkrach oben bei der Scheune hörte. Das Pferd drehte sich lässig um und schaute in die Richtung, aus der der Lärm kam, und ich musste mich ein wenig nach links bewegen, um zu sehen, was los war. Der Lärm kam von einem alten Lkw neben der Scheune. Jemand hatte den Motor angelassen und aus dem Auspuff kamen blaue Rauchwolken. Das konnte nur eines bedeuten – jemand hatte mich gesehen und kam nun, um mich zusammenzuschimpfen, weil ich mich bei seinem Pferd herumgetrieben hatte.
Ich geriet in Panik. Ich machte auf dem Absatz kehrt und einen großen Schritt auf mein Fahrrad zu. Das Gras im Graben war aber so hoch, dass ich den Boden nicht sehen konnte. Ich dachte, ich würde auf festen Boden treten, sank stattdessen aber in das hohe Gras ein, stolperte und fiel längelang auf die andere Seite des Grabens. Mein Sturz erschreckte das Pferd. Es rannte davon, was mich noch mehr in Panik versetzte. Ich kletterte den Abhang hoch und zerrte an meinem Rad, aber es hatte sich im Gras verfangen. Ich zog und zerrte, bekam es aber nicht frei. Ich sah hoch zur Scheune. Der Lkw hatte gewendet und kam die Einfahrt herunter auf mich zu.
Ich zerrte weiter und der Lkw kam näher. Mithilfe eines erheblichen Adrenalinschubs bekam ich das Rad endlich mit einem Ruck frei. Ich schwang es auf den Weg, sprang auf und trat in die Pedale, was das Zeug hielt. Ich drehte mich kein einziges Mal um, und der Lastwagen holte mich nicht ein.
Es dauerte ein paar Tage, bis ich mich traute, wieder auf die Ranch zu fahren. Aber diesmal hatte ich einen Plan.
Zuerst würde ich feststellen, ob der Lkw da war. Wenn ja, würde ich einfach kehrt machen und nach Hause fahren. Wenn nicht, würde ich mein Rad im Graben verstecken und darauf warten, dass ein Pferd oder zwei an den Zaun kämen. Dort würde ich sie mit Gras füttern und sie streicheln, wenn sie mich ließen. Es war ein guter Plan und über die nächsten Wochen auch erfolgreich.
Den Rest des Sommers fuhr ich jede Woche ein paarmal auf die Ranch. Manchmal konnte ich Pferde streicheln, manchmal nicht. Aber wie auch immer – ich fand es immer der Mühe wert hinzuradeln. Auf jeden Fall hatte ich keine Angst mehr vor dem verhexten Haus.
Herbst, Winter und Frühling gingen vorbei, ohne dass ich allzu oft zur Ranch gefahren wäre. Zu kalt, um so weit zu radeln, und sowieso viel zu viel anderes zu tun – im Herbst war Fußballsaison, im Winter spielte ich Basketball, im Frühling Baseball. Aber kaum waren Sommerferien, als ich mich auch schon wieder aufs Rad schwang und mich in Richtung Ranch auf den Weg machte. Dieses Mal hatte ich allerdings meinen Plan erweitert.
Wissen Sie, manchmal waren die Pferde zu weit weg oder überhaupt auf einer ganz anderen Weide, die ich nicht erreichen konnte. Dann hatte ich nichts zum Streicheln und betrachtete die Fahrt als Zeitverschwendung. Um also meine Chancen zu verbessern, ein Pferd zum Streicheln zu finden, umfasste der neue Plan auch das widerrechtliche Betreten fremden Landes.
Von da an kroch ich, falls der Lkw nicht da war und die Pferde zu weit weg grasten, durch den Zaun und ging zu ihnen hin, statt darauf zu warten, dass sie zu mir kamen.
Dieser Teil des Plans funktionierte fabelhaft – bis zu einem Tag im Juni.
An diesem Tag radelte ich zur Ranch und vergewisserte mich, dass der Lkw nirgends zu sehen war. War er nicht, also legte ich mein Rad wie immer in den Graben, kroch ohne zu zögern durch den Zaun und ging auf die Pferde zu. Sie waren diesmal in der Nähe der Scheune, viel näher, als ich je gewesen war. Es machte mir aber nichts aus, weil der Lkw nicht da war, was bedeutete, dass auch der Fahrer nicht da war. Der Lkw machte so viel Krach, dass ich ihn kilometerweit hören würde, vielleicht sogar aus zwei oder drei Kilometern Entfernung, wenn der Wind richtig stand. Genug Vorwarnzeit, dass ich mich aus dem Staub machen konnte.
Inzwischen kannten mich die Pferde und ich kannte sie. Sie schienen sich richtig zu freuen, wenn ich kam, und versammelten sich alle um mich herum. An diesem Tag stand ich mit dem Rücken zur Scheune und fütterte sie mit Gras. Natürlich streichelte ich sie, während sie mir das Gras aus der Hand fraßen, und so profitierten wir alle davon.
Im Rückblick hätte ich wahrscheinlich merken müssen, dass die Pferde gelegentlich an mir vorbei in Richtung Scheune blickten … als ob dort jemand wäre, der womöglich in meine Richtung ging. Ich merkte aber nichts. Sie können sich meine Überraschung vorstellen, als ich – Pferde streichelnd und dabei vor mich hinschwätzend wie eine Elster – plötzlich fühlte, dass mir jemand auf die Schulter tippte.
Ich gab einen leisen Schrei von mir, während ich herumfuhr. Geschockt erblickte ich einen alten Mann mit einem fleckigen Cowboyhut, in schmutzigen Jeans und einem verblichenen Hemd. Sein Gesicht war ziemlich braun und verwittert, und die grauen Bartstoppeln waren sicher eine Woche alt. Ein paar Sekunden stand er ganz still und sah mich nur an. Es war ein interessierter Blick, der bei meinen Tennisschuhen begann, sich zu meinem Kopf hocharbeitete und wieder zu meinen Tennisschuhen zurückkehrte – als ob er Maß nehmen wollte für einen Sarg.
»Machst’n da?«, fragte er nach einer kleinen Ewigkeit.
»Ich … ich will, ähhh … ich wollte …«
Langsam griff er in seine Hemdtasche und zog eine Packung filterlose Camel heraus. Er klopfte mit der Packung ein paarmal auf den Handrücken und ließ mit einem mühelosen Fingerschnippser das Ende einer Zigarette herausgleiten. Lässig nahm er sie zwischen die Lippen und zog sie ganz heraus, bevor er die Packung wieder einsteckte.
»Das ist hier Privatbesitz«, murmelte er, während er in seine verbeulte Hosentasche griff und ein angelaufenes silbernes Feuerzeug hervorholte.
Er schnippte den Deckel auf, fuhr mit dem Daumen über das Rädchen und hatte mit einer einzigen Bewegung nicht nur Feuer, sondern auch das Ende der Zigarette angezündet. In weniger als einer Sekunde kam blauer Rauch aus seinem Mundwinkel.
Es war klar, dass ich mir schnell etwas einfallen lassen musste, und bevor ich es richtig wusste, versuchte ich wieder zu sprechen.
»Ich … es tut mir leid …«
Der alte Mann klappte den Deckel des Feuerzeugs mit einer Hand zu und ließ es in die Uhrentasche seiner Jeans gleiten. Mit der anderen Hand nahm er die Zigarette aus dem Mund und stieß eine Rauchwolke aus. Er nickte langsam.
»Gut«, sagte er, während er sich umdrehte und wegging. »Komm mit.«
Komm mit? Was sollte das heißen, »komm mit«? Wo ging er hin? Und noch wichtiger: Warum sollte ich mitkommen? Meine nächste Bewegung wollte schnell und gut überlegt sein. Er drehte mir den Rücken zu und ging von mir weg. Ich konnte weglaufen! Er konnte mich sicher nicht fangen … er war alt! Und ich war einer der Schnellsten in unserer Gegend. Ich konnte schneller laufen als er, keine Frage. Ein paar Schritte nach links – genug für einen kleinen Vorsprung – und ab die Post. Bis zum Zaun waren es etwa 200 Meter. Das konnte ich schaffen. Er war ja nicht nur alt, er rauchte auch noch! Ihm würde auf halbem Weg schon die Puste ausgehen. Bis dahin wäre ich bei meinem Rad und unterwegs. Er würde mich nie einholen! Es war ein guter Plan. Es war sogar ein sehr guter Plan und ich wollte gerade loslegen, als ...
»Kommst du?«, fragte er, ohne sich umzudrehen.
Ob ich komme? Warum sollte ich? Nichts Gutes war zu erwarten, eher hatte ich gute Chancen, mein Leben einzubüßen. Nein, ich musste die Beine in die Hand nehmen, und jetzt war der Moment dafür.
Ich sah auf den Zaun 200 Meter weit weg, überlegte mir meine Schritte und schaute dann zurück zu dem alten Mann, der auf die Scheune zuging. Ich schaute zurück zum Zaun und wieder auf den alten Mann. Ich machte mich bereit zum Weglaufen.
»Wenn du weg willst, dann geh«, sagte er, wieder ohne sich umzusehen. »Wenn nicht, dann komm.«
Der Ton war nicht bedrohlich, er beruhigte mich sogar ein wenig. Es war komisch, aber nach diesem einen Satz war mir überhaupt nicht mehr nach Weglaufen. Wahrscheinlich weil er sagte, dass ich es könnte. Verstehen Sie mich nicht falsch, mir war immer noch nicht ganz geheuer. Aber ich dachte, es könnte ganz interessant sein herauszufinden, was er vorhatte. Also drehte ich mich langsam um und ging hinter ihm her zur Scheune.
Auf dem Weg öffnete er das große Holztor, das die Weiden trennte. Er ging hindurch und ließ es offen, und ich ging ebenfalls durch und dachte überhaupt nicht daran, es wieder zu schließen. Der alte Mann hielt abrupt an, drehte sich um und schaute auf das Tor. Ich schloss zu ihm auf, aber er sah immer noch auf das Tor. Er zog einmal an seiner Zigarette und wendete mir den Blick zu. Er stieß Rauch aus Mund und Nase aus und schaute zurück zum Tor.
»Soll ich es zumachen?«, fragte ich ziemlich dämlich.
»Ganz wie du meinst«, war seine Antwort.
Ich rannte zurück zum Tor, schloss es und legte den Riegel vor. Der alte Mann ging schon wieder weiter auf die Scheune zu, und ich musste rennen, um ihn einzuholen. Er kam zuerst bei der Scheune an, ging hinein und zu einer Wand, an der verschiedene Schaufeln und andere Geräte hingen. Zielsicher nahm er eine große Stahlschaufel herunter und drückte sie mir in die Hand.
»Hier«, sagte er schlicht. »Wenn du sie streicheln willst, musst du auch hinter ihnen sauber machen.«
Und damit begann meine Karriere als Pferdemann. Nicht gerade sehr feierlich, schon wahr, aber immerhin ein Anfang.
Normalerweise würde ich solch eine Geschichte kaum je erzählen. Oberflächlich gesehen ist es nicht einmal eine richtige Geschichte. Aber manchmal hilft es, sich an erste Eindrücke zu erinnern. Im Leben sind es sehr oft nicht die großen Dinge, die die größte Wirkung auf uns haben, sondern die kleinen.
Ich merkte bald, dass das, was der alte Mann getan hatte, als er mich widerrechtlich auf seiner Weide fand, seine Art war, mit jeder Situation umzugehen. Er sprach immer leise, aber mit großer Bestimmtheit. Bei unserem ersten Zusammentreffen war es seine Absicht gewesen, eines von zwei Dingen zu erreichen – mich entweder so zu erschrecken, dass ich nicht mehr wiederkommen würde, oder mir eine Tür zu öffnen, damit ich noch näher kommen konnte. Wie auch immer – es war meine Entscheidung.
Mit Pferden ging er sehr ähnlich um. Er stellte das Pferd vor eine Entscheidung und ließ es selbst diese Entscheidung treffen. Er schien nie besonders erpicht darauf, ein Pferd zu etwas zu zwingen, das ihm nicht geheuer war, oder es für eine falsche Entscheidung zu strafen. Er ließ einfach geschehen, was geschah und ging von da aus weiter. Es war eine einfache Idee, aber sehr wirkungsvoll – für Menschen wie für Pferde.
Ich hatte schon eine Weile für den alten Mann gearbeitet, als er ein junges Pferd kaufte. Diese Geschichte veranschaulicht seine Einstellung sehr schön. Es war ein vierjähriger Wallach, der mit 18 Monaten in Arbeit genommen worden war. Als Zweijähriger hatte er mit einigem Erfolg an Western Pleasure-Wettbewerben teilgenommen. Das Ergebnis war, dass sein Besitzer ihn bei jeder Gelegenheit turniermäßig vorstellte. Mit zweieinhalb hatte der Wallach langsam genug von den Anstrengungen eines Turniers und fing an, sich bei unpassenden Gelegenheiten danebenzubenehmen, meist wenn er in den Showring hinein sollte. Er ließ sich auch nur noch schwer einfangen und stand nicht mehr beim Aufsitzen. Mit drei Jahren benahm er sich so schlimm, dass er »zur Korrektur« zu einem Trainer geschickt wurde. Dieser ging zugegebenermaßen nicht gerade zimperlich mit dem jungen Pferd um, aber seine Taktik führte immerhin dazu, dass der Wallach sich besser benahm, jedenfalls eine Weile.
Trotzdem wurde er noch schwieriger zu fangen und hatte außerdem angefangen zu beißen, wenn er gesattelt und gegurtet wurde. Mit dreieinhalb weigerte er sich wieder, den Showring zu betreten, ließ sich nicht mehr beschlagen und war mehrmals mit seinem Besitzer und dem Trainer durchgegangen. Jedesmal wenn er mit dem Trainer durchging, erhielt er eine Riesentracht Prügel.
Als er vier wurde, gab der Besitzer ihn auf. Aber mehr noch: Das Pferd hatte seinen Besitzer aufgegeben. Da er ihn als hoffnungslosen Fall betrachtete, brachte er ihn zu einer Versteigerung, wo die Pferdemetzger einkauften, und das wäre dann das Ende gewesen. Aber wie es der Zufall wollte, war der alte Mann auf der Versteigerung und dachte, das junge Pferd könne vielleicht doch noch zu etwas anderem als Hundefutter taugen. Er kaufte es für ‘nen Appel und ’n Ei und ließ sich vom Vorbesitzer die ganze Geschichte erzählen. Dann brachte er das Pferd nach Hause und stellte es zu den anderen auf die große Weide. Sehr schnell freundete sich der Wallach mit einer kleinen Gruppe anderer Wallache an und hielt sich immer bei ihnen auf.
Es war von Anfang an klar, dass Salty – so nannte ihn der alte Mann wegen der weißen Stichelhaare auf der Stirn – eine harte Nuss werden würde. Mit seinen Weidefreunden fühlte er sich wohl, aber von Menschen, die die Weide betraten, wollte er nichts wissen. Wenn er dachte, du würdest auf ihn zugehen, raste er wie ein Verrückter ans andere Ende der Weide. Ihn zu fangen kam überhaupt nicht in Frage. Seltsamerweise schien dies den alten Mann nicht zu kümmern. Er versuchte einfach gar nicht erst, ihn zu fangen.
Salty war ungefähr drei Wochen auf der Ranch, als es Zeit wurde, die Herde auf eine andere Weide am anderen Ende des Geländes zu bringen. Wie immer ging der alte Mann ans Tor und rief: »Herkommen!« Wo die Pferde auch waren, ihre Köpfe flogen dann hoch und eines nach dem anderen sah in seine Richtung.
»Herkommen!«, rief der alte Mann dann noch einmal. Das genügte meist, damit sich die Herde in seine Richtung in Bewegung setzte. Rief er noch einmal, verfielen alle in Trab. Ehe man es sich versah, standen sie alle am Tor. So war es auch dieses Mal. In weniger als fünf Minuten nach dem ersten Ruf waren alle Pferde am Tor versammelt – alle außer Salty.
Salty war zwar mit den anderen herangekommen, hielt aber nun einen Sicherheitsabstand ein. Der alte Mann und ich halfterten die Pferde auf, nahmen je zwei oder drei an jede Hand und führten sie durch das Tor und auf die andere Weide. Bis schließlich Salty als einziges Pferd übrig blieb. Er war jedesmal weggerannt, wenn einer von uns sich ihm genähert hatte, und fand sich nun von der Herde getrennt. Wir versuchten noch einige Male, an ihn heranzukommen, aber er wollte nichts davon wissen. Nach vielleicht zwanzig Minuten war klar, dass er uns nicht auf Greifdistanz an sich herankommen lassen würde, von Aufhalftern schon gar nicht zu reden. Der alte Mann schob sich das Halfter unter den Arm und zündete sich eine Zigarette an.
»Sieht so aus, als ob er hierbleiben wollte«, sagte er nach einem langen Zug. »Also lassen wir ihn hier, denke ich.«
Und damit gingen wir hinaus. Etwa gleichzeitig stellte Salty fest, dass er allein war, und das gefiel ihm kein bisschen. Kaum waren wir draußen, kam er Hals über Kopf ans Tor geschossen. Er wieherte, was die Lungen hergaben und rannte in der Nähe des Tors am Zaun auf und ab. Der alte Mann wartete eine halbe Stunde ab, bevor er mit dem Halfter in der Hand wieder zum Tor ging. Sobald er das Tor erreicht hatte, drehte Salty um und lief so schnell er konnte ans andere Ende der Weide. Der alte Mann machte keine Anstalten, hinter ihm herzulaufen. Er drehte sich einfach um und ging zurück zu seiner Arbeit. Als Salty sah, dass sich der alte Mann zurückzog, rannte er zurück zum Tor und begann wieder zu wiehern und auf und ab zu laufen.
Nach einer weiteren halben Stunde ging der alte Mann wieder ans Tor, und wieder lief Salty weg. Den ganzen Tag über gab der alte Mann dem jungen Wallach immer wieder Gelegenheit, sich fangen zu lassen. Und jedesmal lief Salty weg. Als es dunkel wurde, war Salty immer noch allein auf der Weide und wieherte verzweifelt. So ließen wir ihn über Nacht zurück.
Am nächsten Tag war Salty immer noch am Tor und wieherte. Man konnte sehen, dass er eine ziemlich ungemütliche Nacht verbracht hatte, denn er hatte neben dem Zaun eine tiefe Rinne ausgetreten und sein Fell war schweißverklebt. Der alte Mann ging ans Tor und Salty lief wieder weg. Diesmal lief er aber bei Weitem nicht so weit, bevor er anhielt und sich nach dem alten Mann umsah. Der alte Mann öffnete das Tor und stand mit dem Halfter in der Hand im Eingang. Der Wallach beobachtete ihn genau, blieb aber auf Distanz. Nach vielleicht zehn Minuten drehte sich der alte Mann um und verließ die Weide wieder.
Der Wallach lief sofort wieder zum Tor und begann zu wiehern. Diesmal blieb der alte Mann stehen und kam langsam zum Tor zurück. Der Wallach rannte weg, aber nur ein paar Meter. Der alte Mann ging durch das Tor und blieb gerade innerhalb der Weide stehen. Salty blieb auf Distanz.
Nach etwa fünf Minuten drehte sich der alte Mann um und war dabei, die Weide zu verlassen, als Salty langsam anfing, auf das Tor zuzugehen. Der alte Mann blieb am Tor stehen und wartete ab. Salty schlich auf den alten Mann zu und blieb in kurzer Entfernung stehen. Der alte Mann versuchte nicht, sich ihm zu nähern; er stand da, als ob er auf den Bus wartete. Nach einigen weiteren Minuten drehte er sich wieder um und tat, als ob er weggehen wollte, und überraschenderweise ging Salty direkt auf ihn zu. Der alte Mann drehte sich ganz langsam um und begann, das junge Pferd sanft an der Schulter zu klopfen. Bald darauf ließ Salty sich das Halfter überstreifen und der alte Mann führte ihn aus der Koppel hinaus und zum Rest der Herde.
Es war das letzte Mal, dass Salty sich nicht fangen lassen wollte.
Dies ist ein perfektes Beispiel dafür, wie der alte Mann arbeitete. Er brachte Salty in eine Situation, in der er eine Entscheidung treffen musste, und ließ ihn selbst entscheiden.
So weit es den alten Mann betraf, gab es keine richtige oder falsche Entscheidung. Schließlich machte es für ihn nicht viel Unterschied. Der direkt Betroffene war Salty. Welche Entscheidung er auch traf, er würde damit leben müssen. Wenn ihm die Konsequenzen nicht gefielen, war es an ihm, einen anderen Ausweg zu finden.