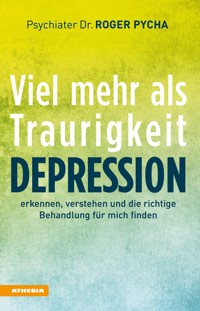
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Schätzungen zufolge leiden weltweit etwa 350 Millionen Menschen unter einer Depression. Dabei sind Frauen doppelt so häufig davon betroffen wie Männer. Aus Schamgefühl, Verdrängung oder Unwissenheit suchen viele Betroffene keinen Arzt auf. Viele davon sind sich deshalb auch nicht sicher, ob sie unter der psychischen Erkrankung leiden. Generell ist Depression eher ein Tabuthema, weshalb die meisten Menschen sie nicht verstehen können. Sind Schlafstörungen schon Vorboten einer Depression? Dieses Buch klärt Betroffene, Gefährdete, Mitmenschen von Betroffenen aber auch einfach nur psychologisch Interessierte über die Krankheit auf. Immerhin ist Depression eine der bedeutendsten und unterschätztesten Krankheiten des 21. Jahrhunderts. Dr. Roger Pycha ist langjährig als Psychiater tätig und teilt seine Expertise und Erfahrung mit Leser*innen seines ersten Buches: von den Ursprüngen der Erkrankung, über Kennzeichen und Symptome bis hin zu Hilfen und Psychotherapie. Begriffe wie Schizophrenie, Burn-out, Panikattacken, Psychose, bipolar, Psychosomatik oder manisch depressiv werden geklärt. Ebenso die Vorsorge spielt eine wichtige Rolle in diesem für Laien verständlichen Sachbuch, sowie in einem depressionsfreien und glücklichen Leben.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 350
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird bei Personenbezeichnungen und personenbezogenen Hauptwörtern in diesem Buch die männliche Form verwendet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für alle Geschlechter. Die verkürzte Sprachform hat nur redaktionelle Gründe und beinhaltet keine Wertung.
DEPRESSION ERKENNEN
DIAGNOSE DEPRESSION
Hauptsymptome
Sieben weitere Zeichen
Die Wirklichkeit ist noch komplizierter
Biorhythmus und modernes Leben
Der seltene schwere Fall – die wahnhafte Depression
Depressionen bei Kindern und Jugendlichen
AUSGRENZUNG UND SCHAM
VERLÄUFE DER DEPRESSION UND IHRE ABGRENZUNG
Die depressive Episode
Die wiederkehrende depressive Störung
Die Dysthymie
Die bipolare affektive Störung
Wenn nicht Depression, was dann?
DIE WICHTIGSTE ERKRANKUNG DES 21. JAHRHUNDERTS
AUSLÖSER, EINFLÜSSE, AUFSCHAUKELUNG
Wir lieben einfache Lösungen
Wir brauchen die Angst
Auslöser
Einflüsse
DAS GEGENTEIL DER DEPRESSION: GLÜCK UND ZUFRIEDENHEIT
Das Belohnungssystem macht uns glücklich
Besser als erwartet
An nichts Bestimmtes denken
Tut Tagträumen gut?
Dreierlei Arten von Glück
DEPRESSION HEILEN
SELBSTHILFE
Bewegung und Sport
Naturkontakt und Waldbaden
Frühes Aufstehen und Verzicht auf Mittagsschlaf
Schlafentzug oder Wachtherapie
Ernährung
Meditation
Entspannung und Hypnose
Facebook und Internet aus, Blaulicht aus
Tagesstruktur
Erreichbare Ziele und nützliche Dinge
Für Lebewesen sorgen
Selbsthilfegruppen, Selbsthilfeorganisationen
Feiern der Erfolge
Umgang mit Zeit
HILFEN, THERAPIEN, ERFOLGSAUSSICHTEN
Biologische Hilfen: Licht, Medikamente, Magnetismus und Strom
Psychologische Hilfen
Kreative Hilfen
Soziale Hilfen
Übersicht Therapieerfolg
Was die Richtung weist
GENDERMEDIZIN
Wer mehr genetische Information hat, geht lieber zum Arzt
Die männliche Depression
Schwangerschaft und Stillzeit
Frauen hören zu
Das männliche Gehirn – das weibliche Gehirn
SUIZIDPRÄVENTION
Psychische Erste Hilfe
Das Risiko bestimmen
THERAPIEFÜHRUNG
NETZWERKE
ANGEHÖRIGE UND FREUNDE
PHILOSOPHIE
Quellennachweis
DEPRESSION ERKENNEN
„Alle glücklichen Familien sind sich ähnlich, aber jede unglückliche Familie ist auf ihre eigene Weise unglücklich.“
Leo Tolstoi, Anna Karenina
Ärzte lieben ihre Patienten, und Psychiater tun dies wohl auf eine besondere Art. Immer wieder erkenne ich in meinen Patientinnen und Patienten Züge oder Eigenschaften meiner Kinder, meiner Frau, meiner Freunde oder meiner verstorbenen Eltern. Oft sehe ich in ihnen auch mich selbst, wie ich früher war, wie ich sein möchte oder wie ich geworden sein könnte. Und doch sind Patienten wieder anders. Wenn ich mich zu weit in ihren Kopf, ihre Gedanken und Gefühle hineinwage, spüre ich das Mitleid, das mich schwächt. Entferne ich mich zu sehr von ihnen, verstehe ich sie nicht mehr. Die Kunst ist, in Kontakt zu sein und dabei den Überblick zu wahren. Jedes Mal, jeden Tag neu: mittlere Nähe und mittlere Distanz; mitschwingen, ohne gefangen zu sein. Bei Menschen, die an Depression leiden, heißt das, die dunkle Seite zu spüren, ohne gelähmt zu sein. Wenn ich das schaffe, kann ich die Depression beeinflussen. Bei mir und bei anderen.
So auch bei meinem Patienten Hubert: Er wurde von seinem Bürgermeister telefonisch angemeldet. Hubert hätte ein Alkoholproblem, das er verleugnete. Jetzt aber fühlte er sich elend, weinte viel und hätte auch Suizidgedanken geäußert. Es ginge um ein Menschenleben, betonte der Bürgermeister. Hubert war vom Hausarzt sehr gut durchuntersucht worden, gerade auch auf Alkoholismus hin, und mein neuer Patient brachte seine Laborergebnisse mit. Er hatte eher wenige und etwas groß geratene rote Blutkörperchen, ohne eigentlich blutarm zu sein. Das konnte ein Hinweis auf einen beginnenden Mangel an Vitamin B12 oder Folsäure (oder beider) sein, als Folge längeren schwereren Alkoholkonsums. Auch seine Harnsäure war leicht erhöht. Wahrscheinlich neigte er von Geburt an zu Gicht, und der viele Alkohol hatte die Werte etwas über die Norm erhöht, aber im Übrigen war Hubert, vor allem, was die Leberfunktion anging, praktisch gesund.
Im Gespräch mit ihm war alles ganz anders. Er war wortkarg, wirkte fast abweisend, sprach nur stockend. Er wüsste nicht, was er bei mir sollte, das hatte alles keinen Sinn für ihn. Ich fragte ihn, ob ihm noch etwas Sinnloseres einfallen würde als der Besuch bei mir. Da deutete er ein Lächeln an und meinte, eigentlich nicht. Müde erklärte ich ihm, ich hätte mich auch nur von seinem Bürgermeister am Telefon breitschlagen lassen. Streng genommen säßen wir im gleichen Boot. Ich wäre erschöpft von der Arbeit, könnte mich nicht mehr recht konzentrieren. Er nickte und meinte fast tonlos, es wäre bei ihm doch anders, ihm fehlte die Energie, auch wenn er nicht arbeitete. Er hatte sich immer wieder zu Hause auszuruhen versucht, sich krankgemeldet, aber das hätte ihn nur noch nervöser gemacht. Vor allem vormittags, fuhr er etwas lebendiger fort, war er ganz unruhig, da hatte er ein Kribbeln im Bauch mit Übelkeit und einen Kopfdruck, er fühlte sich wie erschlagen. Und er musste immer wieder ohne Grund weinen. Auch fiel ihm sein Sohn ein, den er durch einen Unfall verloren hatte. Das Grübeln und die Trauer konnte er nicht zurückdrängen. Wenn er aufstand, fühlte er sich schwach und geriet ins Wanken. Auch erlebte er sich in allem gebremst, und kleine Entscheidungen fielen ihm unsäglich schwer. Hergekommen wäre er nur, weil er begleitet worden war. Oft dachte er, das ganze Leben würde ihm zu viel werden.
Hubert fühlte sich krank, mehr noch: am Ende. Er hatte fast nicht die Kraft, das zu schildern, und schämte sich auch irgendwie, als könnte er etwas für die Situation. Die Zukunft machte ihm Angst. Körperlich und von den Blutbefunden her schien kaum etwas gestört. Aber gefühlsmäßig litt er sehr. Er war psychisch krank, depressiv.
Der berühmteste Arzt des alten Griechenlandes ist Hippokrates (460– 370 v. Chr.). Er gilt als der Begründer der Medizin und schreibt in seinem Werk Über die heilige Krankheit: „Auf jeden Fall müssen die Menschen wissen, dass die einzige Quelle von Lust und Freude, von Lachen und Scherzen, aber auch von Traurigkeit und Sorge, von Ärger und Weinen das Gehirn ist. Durch das Gehirn werden wir verrückt oder geraten in Rage, wir bekommen Ängste und Befürchtungen, die uns in der Nacht oder auch tagsüber befallen, und Schlaflosigkeit, oder wir machen Fehler, wir machen uns grundlose Sorgen, wir sind unfähig, die Realität zu erkennen, und stehen teilnahmslos dem gewöhnlichen sozialen Leben gegenüber. Alle diese Dinge erleiden wir durch das Gehirn, wenn es nicht gesund ist.“1
Einfühlsam begreift Hippokrates vor 2400 Jahren, wo die Zentrale unseres Erlebens und Handelns sitzt. Er unterscheidet drei psychische Krankheiten, nämlich Manie, Paranoia und Melancholie. Alle drei werden heute noch diagnostiziert. Die „Manie“ hat sogar ihren ursprünglichen Namen behalten. Darunter versteht man einen unnormalen Zustand erhöhter Kraft und Energie mit unnatürlich positiver Stimmung und Größenwahn. Die Paranoia heißt inzwischen „Schizophrenie“. Sie ist eine Störung der Wahrnehmung und des Denkens. Erkrankte hören Stimmen, die es nicht gibt, und haben auch andere Halluzinationen. Sie bilden sich ein, sie würden verfolgt, beeinträchtigt, beobachtet, manipuliert oder ferngesteuert. Die Melancholie hingegen wird heute „Depression“ genannt.
DIAGNOSE DEPRESSION
„Die Welt des Glücklichen ist eine andere als die des Unglücklichen.“
Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-philosophicus
Seit 1948 erfasst die Weltgesundheitsorganisation WHO alle Krankheiten der Welt in der „Internationalen Klassifikation der Krankheiten“ (International Classification of Diseases ICD). Elfmal ist diese Liste aller bekannten Störungen neu geschrieben worden. Das war nötig, weil medizinischer Fortschritt und wissenschaftliche Erkenntnisse große Veränderungen mit sich brachten, besonders auch auf dem Gebiet der psychischen Krankheiten. So galt Homosexualität bis 1990 noch als Erkrankung, die behandelt werden musste. Dies brachte unsägliches Leid über Homophile.
Eine besonders tragische Verstrickung erlebte der englische Logiker und Wissenschaftler Alan Turing, der heute allgemein als der Entwickler der alten Rechenmaschine zum Computer gilt. 1952 wurde er wegen homosexueller Handlungen verurteilt und konnte zwischen einer Behandlung oder dem Gefängnis wählen. Er wählte die Therapie, und der Amtsarzt verschrieb ihm das weibliche Geschlechtshormon Östrogen, das er regelmäßig injiziert erhielt. Es ließ seine Brust wachsen und hemmte seine Sportlichkeit. Man hatte ihn zu einer chemischen Kastration verurteilt, um seinen Trieb zu bremsen. Er verfiel in eine Depression und nahm sich 1954 das Leben.
Heute ist Homosexualität eine Normvariante der sexuellen Ausrichtung, und Menschen, die sie verspüren, leben endlich freier. Die aktuelle Ausgabe aller psychischen Krankheiten enthält diesen Makel nicht mehr. Diese elfte umgeschriebene Liste gilt seit erstem Januar 2022. Sie ist immer genauer geworden und soll Diagnosen möglichst sicher machen. Die Depression steht übrigens seit 1948 darauf.2
Das Wort Diagnose geht auch auf Hippokrates zurück und kommt vom Griechischen diagignoskein, was so viel wie „den Durchblick haben“ bedeutet. Der richtige Durchblick ist wichtig, um zu wissen, was man gegen die jeweilige Krankheit unternehmen kann und welche Therapie angebracht ist. Auch der Begriff Therapie stammt aus dem Altgriechischen, therapeuein bedeutet „pflegen“ und „heilen“.
Eine Diagnose darf nicht von den Vorurteilen des einzelnen Untersuchers abhängen. Zu diesem Zweck muss sich der Experte auf die bemerkbaren Zeichen konzentrieren und möglichst wenig selbst dazudeuten. Das ist schwierig, weil wir beim Beobachten menschlichen Verhaltens alle rasch Erklärungen suchen. Unser Denken lässt sich beim Wahrnehmen kaum ausschalten, umso weniger, wenn wir Experten in einem bestimmten Bereich sind. Ein Tiefenpsychologe würde über Hubert, meinen eingangs vorgestellten Patienten, vielleicht sagen, er hat viel Unterdrückung und Entwertung in der Kindheit erfahren. Ein Verhaltenstherapeut erklärt sich seinen Zustand dadurch, dass er Trinkmuster erlernt hat, um seine Depression selbst zu behandeln. Ein Traumatherapeut wird den plötzlichen Verlust des Sohnes als wichtigsten Auslöser sehen, ein Transaktionsanalytiker wird vermuten, dass er im Beisein seiner sehr vernünftigen Frau ein „trotziges Kind-Ich“ zeigt, und ein Familientherapeut wird sich fragen, welchen Zweck Depression und Alkoholismus in Huberts Zusammenleben erfüllen. Wichtig ist, dass all diese Experten jenseits ihrer Fantasien zur Entstehungsgeschichte von Huberts Leiden auch ganz nüchtern Zeichen erfassen können und sie im Sinn einer simplen Rechenoperation miteinander verknüpfen. Moderne Diagnosen sind Vorgänge des Abfragens und Zusammenzählens, sogenannte Algorithmen.
In der aktuell gültigen Klassifikation der Krankheiten sind drei Hauptzeichen und sieben Nebensymptome der Depression aufgeführt. Sie werden uns in diesem Kapitel länger beschäftigen. Der Algorithmus besagt: Wenn mindestens zwei Hauptsymptome und mindestens zwei Nebensymptome mindestens zwei Wochen lang bestehen, spricht man von Depression. Alles, was weniger oder kürzer ist, ist keine. Diese Grenze ist ganz klar, aber auch willkürlich gezogen.
HAUPT- UND NEBENSYMPTOME DER DEPRESSION
Dieses Vorgehen verbessert die Übereinstimmung von Diagnosen bei verschiedenen Untersuchern. Darauf gekommen sind die US-amerikanischen Psychiater, als sie sich regelmäßig ausgetauscht haben und genauso regelmäßig in Streit darüber geraten sind, ob eine Depression vorlag, eine Trauerreaktion, eine Verdrängung, eine Anpassungsstörung oder Ähnliches. Sie haben 1980 ein detailliertes Handbuch (Diagnostic Statistic Manual, DSM) entwickelt, das die Forschung bis heute weltweit benutzt. Seitdem sind die Diagnosen wissenschaftlich brauchbarer und sicherer, aber nach wie vor schwierig.3 Denn keine Laboruntersuchung, kein Gerät zeigt an, ob jemand depressiv ist. Was die Körpermedizin an Sicherheiten hat – chemische Befunde und elektrische Messungen –, fehlt der Seelenheilkunde weitgehend. Wir Psychiater beobachten deshalb menschliches Verhalten, wie es sich zum Zeitpunkt verschiedener Untersuchungen zeigt, und leiten daraus Störungen und ihren Verlauf ab.
Hauptsymptome
Sie heulte herzzerreißend. Jana war etwas über zwanzig, unglücklich mit einem Hotelier zusammen, der sie so betrog, dass sie es merkte, und von ihm bereits das zweite Mal schwanger. Sie war ihm nach Südtirol gefolgt, hatte eine Tochter bekommen, Pläne über gemeinsame Verwirklichung geschmiedet. Seine vielen Freundinnen waren ihre einzigen Bekannten, sie fühlte sich eingesperrt und etwas fremd mit ihrer gradlinigen Offenheit bei aller Heimlichtuerei. Sie wollte eigentlich nicht zu mir kommen und erwartete sich auch nicht viel. Sie würde eine mütterliche Therapeutin brauchen, dachte ich, als sie in meiner Ambulanz saß. Vor allem aber sah sie schwarz. Sie sei eine schlechte Partnerin und Mutter, als Autorin an der Kippe, sie habe keine Zukunft in der Kleinstadt, ihre Partnerschaft sei praktisch gescheitert, und überhaupt sei das Tal, in dem sie nun lebte, materialistisch, gefühllos und fremd. Dazu war sie aufgeregt und ängstlich. Sie wusste nicht genau wovor, doch am schlimmsten war es früh morgens, da zitterte sie geradezu vor Unruhe, hatte schlecht und zu wenig geschlafen, grübelte dauernd und war sich sicher, den Tag nicht zu überstehen. Bis zum Abend ging es ihr regelmäßig besser, sie wurde ruhiger und schöpfte wieder Hoffnung. Aber der nächste frühe Morgen, um vier Uhr bereits gequält wach, machte alles wieder zunichte.
Jana fühlt die ganze Zeit quälende Bedrücktheit. Das lateinische Wort dafür ist depressio. Jana empfindet das, was der amerikanische Psychiater Aaron T. Beck die drei Zeichen der Depression nennt: Sie sieht sich selbst, ihre Zukunft und die Welt dauernd negativ. Körperlich fehlt ihr gar nichts, diesbezüglich ist sie gesund.
Gedrückte Stimmung
„Depressio“ kommt vom Lateinischen deprimere, was so viel wie „niederdrücken“ heißt, und meint Schwermut oder dauernde Niedergeschlagenheit. Sie ist das sichtbarste der drei Hauptsymptome und hat der gesamten Krankheitsgruppe den Namen gegeben. Die dauerhaft gedrückte Stimmung, Tag für Tag, grau in grau, ist zu unterscheiden von vorübergehenden Stimmungstiefs, von Trauer, von ängstlichen Erlebnissen und von Krisen des Erwachsenwerdens. All diese Zustände sind keine Krankheiten und zeichnen sich dadurch aus, dass die Gefühle zwischendurch auch wieder aufhellen: Das Tief kann durch Gespräche mit lieben Freunden, durch Kontakt zur Familie, durch Ablenkungen, Hobbys und Beschäftigung ziemlich leicht unterbrochen werden.
Verminderter Antrieb
Die Depression ist ein bleibender energetischer Mangelzustand. In ihr nützt der Nachschub von Energie in Form von Essen und Trinken zur Stärkung nichts. Die seelische Kraft fehlt, was viele Folgen hat: Entscheidungen können fast nicht mehr getroffen werden, und bis sie gelingen, treten endlose Schleifen von Zweifeln auf. Routinetätigkeiten wie Aufstehen, Waschen oder Ankleiden fallen schwer, soziale Kontakte werden mühsam. Meist erklären Betroffene, die Konzentrationsfähigkeit und das Gedächtnis seien plötzlich massiv verschlechtert. Viele befürchten, an Alzheimer-Demenz zu leiden und wünschen entsprechende Abklärung. Im Gespräch mit ihnen fällt zwar auf, dass sie etwas verlangsamt sind und verhalten reagieren. Wenn man ihnen aber genügend Zeit einräumt, schaffen sie geistige Leistung weiterhin gut, und auch das Gedächtnis ist objektiv (also für den Untersucher) unauffällig, nur subjektiv für den Depressiven verschlechtert. Häufig beklagt dann ein Patient, der seine Lebens- und Leidensgeschichte exzellent erzählen kann, er könne sich praktisch an nichts mehr erinnern. Auch bezogen auf eigene Gefühle berichten Betroffene oft, dass sie nichts mehr empfinden, nicht einmal Niedergeschlagenheit. Innere Leere oder das Gefühl der Gefühllosigkeit sind Beschreibungen, die von Depressionskranken gewählt werden, wenn sie versuchen, ihr schwieriges Innenleben verständlich zu machen. Der Energiemangel wirkt sich auf alles aus, was mit dem Betroffenen zu tun hat. Er schmälert deshalb auch das Selbstwertgefühl.
Dieser Energieverlust geht in zwei Richtungen, die unterschiedliche Formen von Depression bedingen: die gehemmte und die agitierte (lateinisch für „aufgeregte“) Depression.
Bei der gehemmten Depression schlägt sich die psychische Kraftlosigkeit im Körper und im Bewegungsmuster nieder. Der Kopf ist gebeugt, die Mundwinkel fallen, die Augen wirken schwer und halb geschlossen, die Schultern sind eingefallen, die Bewegungen verlangsamt. Auf Antworten und Reaktionen muss länger gewartet werden. Der Gang ist kleinschrittig, oft stolpernd. Häufig werden ausgedehnte Druckschmerzen beklagt, typischerweise im Nacken, am Rücken oder beidseits am Kopf im Stirnbereich oder ringförmig. Auch die Muskeln können schmerzen, der Brustkorb kann unter Druck stehen, Beschwerden können in die linke Schulter und den linken Arm ausstrahlen, was die Befürchtung eines Herzinfarkts aufkommen lässt.
Bei der agitierten Depression entsteht Energieverlust durch Energievergeudung: Betroffene wirken fahrig und unruhig, sie schwitzen kalt, oft mit unterkühlten Fingerspitzen und nassen Handinnenseiten, zittern feinschlägig (also rasch und mit geringem Bewegungsumfang), beklagen Muskelzuckungen, Herzrasen oder Herzstolpern. Öfter haben sie ein Kribbeln im Bauch, auch Stechen, Blähungen oder Durchfall (während bei der gehemmten Depression Verstopfung nicht selten ist), die Atmung ist schwer und zugleich beschleunigt bis hin zum Hecheln, manchmal spüren Betroffene in der Folge Ameisenlaufen oder ein Taubheitsgefühl an den Fingerspitzen und um den Mund herum. Ihr Grundgefühl ist die Angst, die sich zur Panik (kurz dauernde Todesangst) steigern kann. Psyche und Körper sind überreizt, es bestehen Schreckhaftigkeit, Licht- und Lärmempfindlichkeit, Mundtrockenheit, Schluckbeschwerden mit dem Eindruck, einen Fremdkörper im Hals zu haben, häufiges (genauso wie bei der gehemmten Depression zu seltenes) Wasserlassen. Diese diffus gesteigerte, nicht mehr lenkbare Energie kann manchmal sogar zu vermehrtem Sexualverhalten führen, das aber nicht als erfüllend erlebt wird. Betroffenen geht es vor allem darum, sich von ihrer Nervosität abzulenken.
Verlust von Freude und Interesse
Das dritte wesentliche Kennzeichen der Depression ist der weitgehende Verlust von Freude und Interesse. Es ist die Folge vom negativen Erleben der beiden ersten Zeichen, die sich gegenseitig verstärken. Verständlicherweise wird dann die Pflege von Freundschaften, Partnerschaften und sozialen Kontakten fast unmöglich, weil sie als viel zu aufwändig erlebt wird und eher Quell von Ängsten zu versagen oder von Befürchtungen, nicht akzeptiert zu werden, ist. Die Pflege von Hobbys und angenehmem Zeitvertreib unterliegt derselben Beschränkung: Wenn die Annehmlichkeit und die Anregung durch sie nicht empfunden wird, werden Briefmarkensammeln, Wandern, Fotografieren oder Lesen zur reinen Anstrengung und, bei agitierter Depression, auch zum Zeitverlust. Passives Dösen, Berieselung durch Radio oder Fernseher oder müßiges Beobachten gelingen noch am ehesten, aber ohne dass ihnen großer Entspannungswert oder deutliche Kräftigung entspringen. Selbst die Bedürfnisse wie Essen, Trinken, Schlaf und vor allem Sexualität verlieren den genießerischen Zug, werden gewissermaßen erzwungen oder im Fall von Intimitäten (die ja nicht lebensnotwendig sind) weitgehend vermieden. Abgestumpft ziehen sich viele Betroffene auch tagsüber ins Bett zurück. Besonders beeinträchtigt ist die Freude am Fürsorgeverhalten, das wohl der stärkste Bindungsmechanismus ist. Am schmerzlichsten erkennt man dies bei Depressionen von Müttern im Kindbett, wenn sie klagen, dass sie keine Beziehung zu diesem Neugeborenen aufzubauen imstande sind, nur Stress und Ablehnung empfinden, wenn es schreit. Dabei möchten sie es so gerne versorgen und lieben können.
Sieben weitere Zeichen
Sie entstehen als direkte Folge der drei Hauptsymptome im Erleben und Verhalten.
Verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit
Verminderte Konzentration und Aufmerksamkeit wird von depressiven Menschen viel stärker und quälender empfunden, als sie von außen bemerkt wird. Alltagshandlungen wie Waschen, Ankleiden und der Gang zur Arbeit erfordern hohe geistige Anstrengung und erschöpfen rasch. Das Denken wird zäh und langsam, in immer wieder gleichen Schleifen um Sorgen oder Ängste kreisend – wird zum Grübeln. Unangenehme Tätigkeiten werden immer wieder vertagt. Dieses Verhalten bezeichnet man als „Prokrastination“. Es kommt bei Gesunden noch häufiger vor, sie leiden aber viel weniger darunter. Ganz einfache Entscheidungen werden endlos lange hinausgezögert und schließlich mit größter Mühe gefällt. Kaum sind sie getroffen, wird an ihnen gezweifelt.
Gefühle von Schuld oder Wertlosigkeit
Gefühle von Schuld oder Wertlosigkeit treten auf, je nachdem, ob sich die Grübelei mehr mit der Vergangenheit oder mit der Gegenwart auseinandersetzt. Kleine Fehler der Vergangenheit werden im Erleben zu nicht wiedergutmachbaren Katastrophen, aktuelle Herausforderungen in Schule, Beruf oder Sozialleben erlebt man verstärkt als beängstigende, unüberwindbare Hindernisse.
Negative und pessimistische Zukunftsperspektiven
Negativ verzerrt sind auch die Zukunftsaussichten der Betroffenen. In aller Regel empfinden sie sich als schwer krank, ja unheilbar, auch von Ärzten unverstanden, wenn sie körperlich ohne Ergebnis abgeklärt werden. Wenn man ihnen lange nicht sagen konnte, woran sie leiden, kann selbst eine unangenehme psychiatrische Diagnose eine Erleichterung darstellen. Allerdings glauben Patienten dann nicht an Heilung. Oft wird die Zukunft der Familie oder sogar der gesamten Menschheit als aussichtslos erlebt. Jeder neue Tag stellt eine Belastung dar.
Vermindertes Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen
Das Selbstvertrauen ist generell herabgesetzt, Depressive fühlen sich in vielen oder allen Lebensbereichen (Partnerschaft, Beruf, Familie, Kontakte, Hobbys) unzulänglich und wundern sich oft, dass andere das nicht bemerken. Entsprechend ist ihr Auftreten wie geduckt oder schüchtern, sie wagen nicht zu widersprechen und akzeptieren auch für sie sehr schwierige Situationen resigniert, weil sie nicht die Energie zur Auseinandersetzung haben.
Suizidgedanken und suizidale Handlungen
Wenn das Leben auf diese Weise kaum mehr ertragen werden kann, entstehen manchmal auch die verzweifelten Ideen, es zu beenden. Viele Betroffene beschreiben Lebensüberdruss, eine tiefe Müdigkeit und Unfähigkeit, weiterzumachen. Oft tritt der Wunsch auf, von einer schweren Krankheit dahingerafft zu werden oder rasch an einem Unfall zu sterben. Depressiven Menschen geht es vor allem um eine Pause des unerträglichen Erlebens. All diese Erwägungen können fließend in den Entschluss übergehen, das eigene Leben zu beenden – mehr oder weniger aktiv und mehr oder weniger dem Schicksal oder dem Zufall überlassen. Von der Erwägung bis zur Durchführung einer Selbsttötung werden verschiedene Phasen durchlaufen, von denen jeweils Umkehr möglich ist. Depressiv Erkrankte können aber auch wahnhaft überzeugt davon sein, dass sie oder ihre ganze Familie ohnehin dem Tod geweiht sind oder eine Schuld abtragen müssen, und begehen deshalb Suizidhandlungen. Im Kapitel „Suizidprävention“ (siehe S. →) gehe ich genauer auf dieses Thema ein.
Appetitminderung
Typischerweise verändert sich bei Depression auch der Appetit. Da kaum mehr etwas schmeckt, öfter auch Verdauungsbeschwerden, Übelkeit und Brechreiz auftreten, verlieren Erkrankte an Gewicht. Eine Ausnahme stellt die sogenannte saisonale Depression oder Winterdepression dar, die alljährlich von November bis März auftreten kann und in dieser Zeit Heißhunger auf Süßspeisen, vor allem auf Schokolade, erzeugt. Dabei nehmen Betroffene oft massiv an Gewicht zu, bis zu 15 Kilogramm und mehr sind nicht ungewöhnlich.
Schlafstörungen
Der Schlaf ist der sensibelste Gradmesser für eine depressive Störung. Leichtere Depressionen beginnen oft mit Einschlafschwierigkeiten, die bei zunehmender Schwere des Krankheitsbildes zu Durchschlafstörungen werden und bei starker Ausprägung frühes Erwachen zeigen. Dabei schreckt man bereits um zwei oder drei Uhr aus dem Schlaf hoch, grübelt oder ist verängstigt und erwartet bekümmert bis verzweifelt das Morgengrauen. Am Tagesbeginn ist man bereits erschöpft und von der Angst gezeichnet, den Anlauf nicht zu schaffen.
Die Winterdepression stellt wieder eine Ausnahme dar. Sie zeigt sich durch langen Nachtschlaf und erhöhtes Schlafbedürfnis untertags, so als gehe der Betroffene in den Winterschlaf. Natürlicherweise essen und schlafen wir alle im Winter mehr. Bei der Winterdepression ist dieser Zustand jedoch um ein Vielfaches intensiviert und geht mit einem Stimmungstief einher. 18 Stunden Schlaf bei fortgesetzter Müdigkeit im Wachzustand sind keine Seltenheit.
Die Wirklichkeit ist noch komplizierter
Körpergefühle
Die bedrückte Psyche drückt auf den Körper. Das muss nicht geschehen, ist aber häufig. Dabei ist die zentrale Wahrnehmung des Körpers, das Körperbild in unserem Innern, negativ gefiltert, angstbesetzt und führt zu aufgeregten Reaktionen, die leicht als körperliche Krankheiten wahrgenommen und von den Betroffenen nicht mit einer bedrückten Psyche in Verbindung gebracht werden. Viele Menschen schaffen es grundsätzlich kaum, eigene seelische Befindlichkeiten wahrzunehmen oder zu beschreiben (Frauen sind diesbezüglich allerdings begabter als Männer). Bei Hausärzten klagen Depressive beiderlei Geschlechts in 69 Prozent über rein körperliche Beschwerden, die dann auch korrekterweise abgeklärt werden. Dieser Weg fällt beiden, Ärzten und Patienten, meist leichter. Und er ist auch der klügere als das sofortige Fokussieren auf die Depression.
Der berühmte Psychiater und Philosoph Karl Jaspers hat für alle Seelenärzte festgeschrieben, wie man in der Psychiatrie vorgehen soll. Seine Schichtenregel lautet: Zuerst alle körperlichen Ursachen für ein seelisches Leiden ausschließen, das ist die wichtigste Schicht der Erkenntnis. Dann auf typische Symptome und Verläufe für sogenannte Psychosen achten, und wenn diese ausgeschlossen sind, neurotische Störungen erkennen.
WAS BEKLAGEN DEPRESSIVE BEIM HAUSARZT?
4
Psychosen sind ausgeprägte Erkrankungszustände, die eine ganze Person betreffen und sie psychisch so sehr verändern, dass man glaubt, es stecke jemand anders im selben Körper. Schizophrenie und manische Episoden sind Beispiele dafür, aber auch schwere depressive Verläufe. Neurotische Störungen hingegen sind Schwierigkeiten in nur einem Lebensbereich, während die Funktionsfähigkeit der ganzen Person weiter aufrecht bleibt. Das Leben eines Patienten mit Schlangenphobie oder Flugangst ist grundsätzlich wenig eingeschränkt. Er muss sich nur einer Therapie stellen, wenn er es mit Schlangen häufig zu tun bekommt oder beruflich unbedingt viel fliegen muss.
Von der Unterscheidung zwischen Psychose und Neurose, die Sigmund Freud benötigt hat, um behandelbare von nicht behandelbaren Psychoanalysepatienten zu unterscheiden, kommt man seit 1990 ab. Man wählt heute möglichst nüchterne Beschreibungen, die nichts mit Erklärungsmodellen für psychische Störungen zu tun haben. Die Psychoanalyse hat zwar spannende Erläuterungen für seelisches Leiden entwickelt, die mit nicht bewältigten psychosexuellen Konflikten zusammenhängen und von Sigmund Freud als „Neurosen“ bezeichnet worden sind. Aber kein Mensch kann heute wissenschaftlich präzise sagen, ob Freud recht hatte. Man kann genauso wenig sicher sagen, er hatte unrecht. Deshalb lässt man Erklärungen wie „neurotisches Leiden“ am liebsten weg und spricht von Angststörung, Zwangsstörung oder Somatoformer Störung, weil diese Bezeichnungen darstellen, welche Symptome auftreten und welches Leid sie verursachen.
Unter Somatoformer Störung versteht man psychosomatische Leiden, also Schmerzen oder Beschwerden, die eine Körperkrankheit vortäuschen, aber psychisches Leid oder soziale Spannungen als Hauptauslöser haben. Solche Beschwerden sind uns als vorübergehende Ereignisse allen bekannt, bei uns selbst und aus der Familie. Wenn ein Kind vor der Schule immer wieder über Übelkeit und Bauchschmerzen klagt, sollte man auch nach Vorfällen in der Klasse fragen. Manchmal gibt es Schularbeiten oder Prüfungen am selben Tag, auf die das Kind nicht vorbereitet ist. Wenn es dann gelingt, es noch rasch den Stoff nachpauken zu lassen oder für die Prüfungsstunde eine Entschuldigung zu finden, sodass es die Befragung vermeiden kann, klingt der Bauchschmerz ab.
Ganz selbstverständlich stellt der körperliche Ausdruck die allererste gelernte und verwendete Sprache, die Körpersprache dar. Der Säugling strampelt, weint oder schreit, empfindet Schmerz oder Freude, noch lange bevor er sprechen kann.
Der Rückzug auf diese körperliche Ursprache kann lebenslang jederzeit unbewusst erfolgen. Jeder weiß davon. Jeder kann versuchen, diese seine Sprache besser zu verstehen. Ich beginne bei mir selbst: Zu schwierigen Begegnungen begleitet mich Kopfdruck, und mir kommt vor, ich sehe besonders unscharf. Wenn ich diese Empfindungen registrieren kann und sie einordne, sage ich mir: „Achtung, das ist Aufregung! Stell dir vor, dieses Treffen ist bald vorbei, und es ist eigentlich egal, wie es läuft. Es ist kein Duell und deshalb nicht tödlich!“ Und schon reduziert dieser Umstand meinen Kopfschmerz.
Die Depression kann vorübergehend oder andauernd Haarausfall, unscharfes Sehen, Doppelbilder, Kopfschmerzen, Mundtrockenheit, Brennen an der Zunge und im Schlund, Fremdkörpergefühl beim Schlucken, Würgen im Hals, Räusperzwang, Druck auf der Brust, Herzrasen, Herzstolpern, schweres Atmen, Blähungen, Bauchschmerzen, Verstopfung oder Durchfall oder beides, Schwitzen, Zittern, Ameisenlaufen oder Gefühllosigkeit in verschiedenen Körperteilen, Schmerzen in allen auch noch so unwahrscheinlichen Bereichen des Körpers (eine Frau hatte mir einmal von Haarschmerzen berichtet, die morgens beim Frisieren unerträglich würden), halbseitige Schwäche, seltenes oder häufiges Wasserlassen, sexuelle Lustlosigkeit, Erektionsstörungen, Orgasmusschwierigkeiten und Schmerzen beim Geschlechtsverkehr verursachen. Eher für eine Depression sprechen mehrfache Beschwerden mit schwankendem Verlauf, die auch vollständig verschwinden können, aber morgens stärker ausgeprägt sind, oder wechselnde Beschwerden, in typischer Weise Schmerzen, die von Muskelgruppe zu Muskelgruppe springen. Diesen körperlichen Schwierigkeiten und Funktionsstörungen muss nachgegangen werden. Am häufigsten sind Hausärzte mit der Suche danach beschäftigt.
Sie besitzen auch die größte Erfahrung darin, die Symptome korrekt einzuordnen. Auch Internisten, Neurologen und Kinderärzte sind sehr gut darin. Wenn eine Vielzahl körperlicher Ursachen ausgeschlossen ist, wird die Depression als Krankheit zunehmend wahrscheinlicher. Kluge Ärzte werden von Anfang an die drei Hauptsymptome ermitteln und den Patienten Zeit lassen, das Thema der psychischen Störung allmählich zu akzeptieren.
Biorhythmus und modernes Leben
In der Depression ist der Biorhythmus massiv gestört. Darunter versteht man die regelmäßige Abfolge unterschiedlicher Aktivitätszustände bei Lebewesen. Warum Depressionen im Herbst und Frühjahr häufiger auftreten, wissen wir bis heute nicht genau. Ebenso wenig, warum schwere Depressionen morgens bleiern lähmen und abends so weit aufhellen können, dass Betroffene die Hoffnung entwickeln, alles könne vorbei sein. Bekannt ist, dass das Tageslicht der stärkste Taktgeber für unseren Biorhythmus ist. Wenn wir aber lange in Bunkern eingesperrt bleiben, verlängert sich der Schlaf-Wach-Rhythmus auf etwa 25 Stunden. Er wird also vom Tageslicht überholt und verkürzt.5 Wir tendieren deshalb unmerklich zur Verlängerung des Tages. Das war an der Geburtsstätte der Menschheit, sei sie Marokko vor 300.000 Jahren oder Ostafrika vor 200.000 Jahren, kein Problem. Rasch einfallende Nächte und die über das ganze Jahr schnell aufgehende Sonne zwangen den ersten Menschen ihren starken Rhythmus auf.
Modernes Leben in hoch entwickelten Gesellschaften liefert hingegen viele Gelegenheiten dazu, in künstlichem Licht länger wach zu bleiben und dadurch unserem inneren langsameren Rhythmus näherzukommen. Lichtverschmutzung durch dauernde Helligkeit in den Städten, Nachtschichten, lange Arbeitszeiten in der Leistungsgesellschaft und die unscharfe Trennung zwischen beruflicher Tätigkeit und Ruhe bei elektronischer Heimarbeit stören den Schlaf-Wach-Rhythmus oft unmerklich, aber nachhaltig. Er ist unser sensibelster Biorhythmus und unterliegt breiten Schwankungen. Napoleon Bonaparte war ein Kurzschläfer, der mit drei bis vier Stunden nachts auskam, allerdings untertags immer wieder in sogenannten Etappenschlaf fiel, wenn er reiste oder zuhören sollte. Johann Wolfgang von Goethe war ein Langschläfer, der auch in hohem Alter, wenn man allgemein immer weniger Schlaf benötigt, noch zwölf Stunden gern und leicht durchschlief. Es ist also wesentlich, den eigenen Rhythmus und dessen Veränderungen gut zu kennen. Beobachten Sie Ihren eigenen Schlaf! Er sagt Ihnen viel über Ihre Psyche.
Der Tagesrhythmus ist in unserer Erbinformation gespeichert und in unserem Gehirn abgebildet. Bei Fruchtfliegen hat man ähnliche Zeitgeber-Gene entdeckt wie bei Menschen, da alles Leben auf unserem Planeten sich an den Wechsel von Licht und Dunkelheit anpassen muss. Gesteuert wird diese innere Uhr beim Menschen von einer Ansammlung von etwa 20.000 Nervenzellen, dem Nucleus suprachiasmaticus, der im erblich vorgegebenen Rhythmus schwingt. Er ist ein kleiner Teil des Hypothalamus, einer wichtigen Region unterhalb der Großhirnrinde, die vor allem für die Ausrichtung unbewusster Regulierungsvorgänge zuständig ist und die Hormonzentrale des Menschen darstellt. Der Hypothalamus produziert Steuerungshormone, die in der direkt unter ihm liegenden Hypophyse oder Hirnanhangdrüse Aktivierungshormone für die Geschlechtsdrüsen, die Schilddrüse und die Nebenniere ausschütten lassen. Körpertemperatur, Blutdruck, Blutzusammensetzung, Hunger und Durst, Umgang mit Stress und Lust auf Sex werden hier geregelt. Da ist der Schlaf in bester Gesellschaft.
Die Illustration zeigt den Nucleus suprachiasmaticus im Hypothalamus, darunter die Hypophyse oder Hirnanhangdrüse. Im Hirnstamm nimmt das ARAS, das aufsteigende retikuläre Aktivierungssystem, viel Raum ein, es garantiert die Wachheit. Der anteriore cinguläre Cortex ist eine Region im Stirnhirn. An seinem oberen Abschnitt liegt ein Zentrum, das bei sozialem, körperlichem und psychischem
Leiden gleichermaßen aktiv wird. Da wird Trauer, Einsamkeit und Schmerz gespürt.
Unsere drei Zeitgeber
Drei Zeitgeber beeinflussen Schlaf und Wachsein: Licht, Gespräche und regelmäßiges Leben. Der weitaus stärkste ist das Licht. Seine erste und wichtigste Eigenschaft ist die Intensität oder Helligkeit. Sie hält uns wach, wird in Lux gemessen und macht das Licht dämmerig, angenehm oder zu stark. Die Helligkeit eines Sommermorgens erreicht 2500 Lux. Licht über 10.000 Lux kann Kopfschmerzen verursachen, weil es als zu grell erlebt wird. Dadurch macht es außerordentlich wach und aktiv, verstärkt aber unter Umständen auch die Unruhe. Es ist kein Zufall, dass manische Erregungszustände auf der Nordhalbkugel gehäuft im Sommer auftreten, und auf der Südhalbkugel öfter im Winter.6 Vor der Erfindung der Glühlampe war die nächtliche Beleuchtung wirklich bescheiden. Eine Kerze liefert ungefähr ein Lux Helligkeit, genauso viel wie eine Vollmondnacht in den Tropen. Ein beleuchtetes Wohnzimmer kommt auf 200 Lux, ein Computerbildschirm auf 40 Lux.7
Die zweite Eigenschaft des Lichtes ist seine Farbe oder Wellenlänge. Violettes Licht ist das energiereichste, rotes Licht ist das energieärmste. Je roter das Licht ist, desto weniger aktiviert und blendet es. Bildschirme und Smartphones werden eingesetzt, um wichtige Informationen zu vermitteln und die geistige Leistungsfähigkeit zu erhöhen. Wir bauen sie so, dass sie viel Blaulicht ausstrahlen. Sie sollen uns wach und aktiv halten. Die beruhigenden Anteile der anderen Farben treten in den Hintergrund. Abends hat der moderne Mensch unter Umständen keine romantischen Erlebnisse von Sonnenuntergängen und Dämmerung mehr, sondern ist den härtesten Wellenlängen ausgesetzt, die ihn unerbittlich wach peitschen. Er merkt nicht viel davon. Nur Einschlafen kann dann schwierig werden. Dabei wäre es ganz einfach, das Blaulicht aus unseren Bildschirmen auszufiltern.
Normalerweise ist der Mensch um drei Uhr nachts am müdesten. Dann atmet er am langsamsten, der Blutdruck ist am niedrigsten, die nachhaltige Verdauung am aktivsten. Alles ist der Erholung und dem Aufbau unterstellt. Die Körpertemperatur ist am niedrigsten, das Gehirn mit dem langsamen Nacharbeiten der Tageserlebnisse und dem Ausbilden dauernder Verdrahtungen zwischen den Nervenzellen schwer beschäftigt. Man nennt diese Zustände auch Schlaf und Traum. Die Zirbeldrüse im Zwischenhirn reagiert auf tiefe Dunkelheit: Sie schüttet viel Melatonin aus. Dieses Hormon fördert den Schlaf und macht dösend niedergeschlagen. Wer dann noch wach ist, sieht die Welt grau. Aber die Zirbeldrüse ist sehr lichtempfindlich. Der erste helle Streifen am Himmel ab drei Lux (oder der Touchscreen vom läutenden Smartphone, die angeschaltete Nachttischlampe …) blockiert sofort die Ausschüttung von Melatonin. Sein Gegenspieler ist das in der Rinde der Nebenniere gebildete Cortisol. Cortisol beginnt, ab drei Uhr morgens im Blut zu steigen, und bereitet das Erwachen vor, wobei es gegen sechs Uhr seinen höchsten Wert erreicht. Es steigert den Blutdruck und den Blutzucker, hemmt die Immunabwehr und stellt Energie zur Verfügung. Morgens garantiert es höchste Wachheit und Belastbarkeit. Noch viel stärker als am Morgen wird Cortisol aber bei Stress ausgeschüttet. Bei dauerndem Stress wirkt es zu lange, flaut nicht mehr recht ab, steigt gerade in der Früh viel zu stark an und verbreitet ängstliche Unruhe, mit dem quälenden Drang zu kämpfen oder zu fliehen. Man spricht auch vom „Morgenpessimum der Depression“.
Es gibt einen zweiten Zeitpunkt der Ermüdung im Tagesverlauf gegen 13 Uhr, der ja häufig für das Mittagsschläfchen genutzt wird. Auch vier Stunden vorher und nachher bestehen leichtere Neigungen zur Ermüdung. Besonders wach und leistungsfähig ist man hingegen am frühen Morgen, gegen elf Uhr, gegen 15 Uhr und abends zur Fernsehzeit. Vor dem Schlafengehen starren wir abwechselnd lange auf einen bis drei Bildschirme (Fernseher, Tablet, Smartphone) mit je 40 Lux, während unsere Vorfahren ein bis drei Lux Kerzenlicht hatten, die ihr Einschlummern vorbereiteten. Wir sind viel länger wach, viel besser informiert, offensichtlich auch zunehmend intelligenter (zumindest kann dies für die Generationen von 1909 bis etwa 2013 gelten, wie vom neuseeländischen Politologen James Flynn entdeckt)8 als die Generationen vor uns. Unser Biorhythmus aber ist markanteren Störmechanismen ausgesetzt, und das hat unweigerlich Auswirkungen auf unsere Psyche.
Der zweitstärkste Zeitgeber sind die Gespräche mit anderen, besonders bei hellem Licht. Sie halten wach, geistig rege, verführen zu neuen Perspektiven, bieten witzige Ablenkung und vertiefen persönliche Beziehungen. Zuletzt ermüden sie. Wer hat sich nach einer Einladung nicht schon spätnachts gewünscht, die Gäste würden gehen oder man könne sich endlich verabschieden? Man schläft dann auch ganz leicht ein, besonders wenn im Hintergrund noch andere Stimmen gedämpft miteinander im Gespräch sind. Kinder schlummern durch ruhig erzählte Gutenachtgeschichten oder mit Schlafliedern sanft ein. Vor Zehntausenden Jahren waren unsere Vorfahren in ihren Höhlen oder Zelten dann am meisten entspannt, wenn andere weiter weg noch rücksichtsvoll plauderten und über ihren eintretenden Schlaf wachten. Heute können wir in Kleinsthaushalten das Radio oder das Handy so nutzen. Beide können menschliche Stimmen reproduzieren, die oft warm und beruhigend wirken und Nähe vermitteln. Praktisch alle Sender machen die Stimmen heute sonorer, voller tönend, als sie in Wirklichkeit sind. Das strahlt Ruhe aus und lenkt die Aufmerksamkeit auf das Gesagte. Menschliche Stimmen im Hintergrund sind zum Einschlafen noch besser geeignet als Musik. Auch den Fernseher oder Laptop können wir so verwenden, wenn wir die Augen geschlossen halten und uns durch ruhige Stimmen berieseln lassen. Das Risiko ist, dass plötzliches Getöse, ein lauter Knall oder Geschrei im Film uns wecken und wir dann auf dem Bildschirm statt rot blau sehen und hellwach werden.
Der dritte Zeitgeber ist unsere innere Uhr: Es ist die Fähigkeit, immer wieder dasselbe um dieselbe Zeit zu tun. Dadurch entsteht eine Routine, die den Tagesablauf dauernd sicherer macht. Immanuel Kant, einer der größten Denker der Menschheit, hatte das ganz richtig erkannt und zu seinem Lebensgrundsatz erhoben. Er richtete sich, als er 1770 Professor in Königsberg wurde, seinen Tagesrhythmus streng ein. Sein Diener Lampe musste ihn morgens pünktlich um fünf Uhr wecken, zum Frühstück gab es immer zwei Tassen Tee und eine Pfeife, von sieben bis elf Uhr hielt er Vorlesungen, zu Mittag aß er auswärts, nach seinem Nachmittagsspaziergang konnten die Städter ihre Uhr stellen, und abends besuchte er täglich den englischen Kaufmann Joseph Green. Zum Einschlafen hüllte er sich in einer komplizierten Zeremonie von zwei Seiten in zwei Decken ein. Jede Abweichung von seinem Rhythmus störte ihn massiv, und er regte sich sofort darüber auf. Vor allem weil er dann schlechter schlief.
Das Spiel mit den Zeitgebern
Wir wissen heute aus verschiedenen Studien, dass eine Zeitverschiebung durch Flüge in westöstliche Richtung ab sieben Stunden den Biorhythmus empfindlich stört. Bei Flügen nach Osten ist der negative Effekt viel stärker. Man fliegt der Sonne entgegen, verliert damit zusätzlich Zeit und landet viele Stunden später, als die Reise eigentlich gedauert hat. Die Folge ist der Jetlag, eine massive Störung des Schlafes mit etwas vermehrten Angst- und Depressionssymptomen. Ähnlich wirkt ein „sozialer Jetlag“ mit Nächten, die durchgearbeitet oder durchgefeiert werden. Das ist besonders für abendliche Löwen und morgendliche Spätaufsteher eine wiederkehrende Herausforderung. Die größten Schwierigkeiten macht das verzögerte Schlafengehen aber den Schülern und Studenten, die besonders früh besonders viel geistig leisten müssen. In angelsächsischen Ländern hat man den Unterrichtsbeginn auf neun Uhr vormittags festgelegt und damit beste Erfahrungen gemacht. Beim ersten Läuten der Schulglocke sind die Schüler so einfach wacher.
Wer aber glaubt, man könne sich gut anpassen, indem man seinen Schlaf-Wach-Rhythmus grundsätzlich umstellt, irrt. Es ist keine Frage der Gewohnheit. Immer nachts wach zu bleiben und untertags zu schlafen, macht eher psychisch krank. Reine Nachtschichtarbeiter haben ein 40 Prozent höheres Risiko, an Depression zu erkranken, als Tagschichtarbeiter.9
Kaum jemand von uns lebt so zwanghaft genau wie Immanuel Kant. Aber jeder macht die Erfahrung: Je länger ich wach bleibe, desto müder werde ich. Das hat mit dem Energieverlust im Körper zu tun. Wir speichern chemische Energie in Molekülen aus Adenosintriphosphat. Wenn sie von unseren Zellen verbraucht wird, entsteht die Substanz Adenosin als Abbauprodukt. Die Zellen bauen daraus zwar wieder das kraftspeichernde Adenosintriphosphat auf, aber ein Teil des Adenosins gelangt allmählich unverwendet auch ins Gehirn, genau genommen in einen bestimmten Bereich des Zwischenhirns, den ventrolateralen präoptischen Kern. Er ist dafür verantwortlich, dass Tiefschlaf entstehen kann, und Adenosin aktiviert ihn. Im Hirnstamm arbeitet das aufsteigende retikuläre Aktivierungssystem ARAS, ein weit verzweigtes Netzwerk, das uns Wachheit garantiert. Adenosin dämpft seine Tätigkeit, sodass auf doppelte Weise immer stärkere Ermüdung entsteht, je mehr sich Adenosin im Gehirn sammelt. Im Schlaf baue ich es dann wieder zum energiereichen Adenosintriphosphat um. Es ist also ganz einfach: Je länger ich wach bleibe, mich körperlich oder noch mehr geistig bewege und damit Energie verbrauche, desto mehr Adenosin sammelt sich in meinem Gehirn, und desto müder werde ich.
Das Gehirn umfasst zwei Prozent des Körpergewichts und verbraucht 25 Prozent der gesamten Energie, in Gefahrensituationen sogar 35 Prozent. Geistige Prozesse wie Denken, Empfinden und das Planen von Handlungen schlucken folglich viel mehr Energie als die Handlungen selbst. Im Alter von fünf Jahren braucht das Gehirn durchschnittlich 43 Prozent der Gesamtenergie eines Kindes. Während das Körperwachstum in der Zeit fast stillsteht, wächst und lernt das Gehirn wie wild. Nicht zufällig fängt da bald die Schule an.10
Wacher als wach
Das Adenosin hat einen Gegenspieler, der die beliebteste Droge der Welt geworden ist: Koffein. Kaffee, Cola-Getränke und Energydrinks enthalten große Mengen an Koffein, die in den USA von bis zu 90 Prozent der Bevölkerung, in Europa von bis zu 80 Prozent der Bewohner regelmäßig getrunken werden. 2019 war Luxemburg der Spitzenreiter des Kaffeekonsums weltweit, 2017 Finnland, Österreich stand an sechster und Italien an siebter Stelle. Auch Kakao enthält etwas Koffein, die Zartbitterschokolade ebenso und Milchschokolade etwas weniger.
Koffein ist die weltweit beliebteste stimulierende Substanz und wird bevorzugt während der Arbeit zur Leistungssteigerung getrunken. Es blockiert im Gehirn die Bindungsstellen für Adenosin, sodass dieses vorübergehend nicht mehr müde machen kann. Der Konsument wird wacher und aufmerksamer, ein besserer Mitspieler der Leistungsgesellschaft. Das Problem ist die langsame Abbaugeschwindigkeit von Koffein. Die Zeit, die benötigt wird, um eine Substanz zu 50 Prozent aus dem Körper zu entfernen, nennt man Halbwertszeit. Die meisten chemischen Mittel entfalten ihre Wirkung ungefähr eine Halbwertszeit lang und verbleiben fünf Halbwertszeiten lang im Körper. Koffein hat eine Halbwertszeit von fünf Stunden. Umgelegt auf Kaffee oder Energydrinks heißt das, sie halten durchschnittlich fünf Stunden lang wach. Nach fünf Stunden ist die Hälfte des Koffeins abgebaut, aber es bleibt 25 Stunden im Körper. Frauen, die die Pille nehmen oder schwanger sind, bauen Koffein viel langsamer ab, Kinder extrem langsam, Raucher um 20 Prozent schneller. Koffein ist also kein verlässlicher Wirkstoff. Dennoch wird es überall auf der Welt in zunehmendem Maße eingenommen. Wacher als wach sein, ist die Devise.
Parallel zum steigenden Koffeinkonsum werden Schlaflosigkeit und Tagesmüdigkeit häufiger, wie Forscher klar erkannt haben. Wenn man noch sechs Stunden vor dem Schlafengehen Kaffee trinkt, verkürzt das die Schlafdauer um mehr als eine Stunde.11
Deutlich wird, dass modernes Leben uns allen viel Flexibilität erlaubt, aber auch abverlangt. Wir spielen die wichtigsten drei Zeitgeber durch unsere eigenen Entscheidungen und spontanen Verhaltensweisen gegeneinander aus12 und regulieren unsere Wachheit mit Substanzen. Der Wunsch nach verlängertem Tag und das jederzeit verfügbare, auch intensive künstliche Blaulicht stellen Versuchungen dar. Die leicht regelbare Temperatur in Innenräumen verstärkt diese Möglichkeiten noch. Mitten in der Nacht kann mir wohlig warm sein, wenn ich die Heizung entsprechend reguliere. Noch vor drei Generationen war das nur sehr wohlhabenden Menschen vorbehalten. Und die Klimaanlage, die mich auch größte Außenhitze ohne Schläfrigkeit am Steuer des Autos überstehen lässt, ist eine Errungenschaft unserer Zeit. Die Chance auf jederzeit führbare Gespräche in hell erleuchteten Räumen, die nächtliche elektronische und telefonische Kontaktaufnahme, das Beobachten interessanter sozialer Vorgänge (Liebe, Verbrechen, Sport, Politik, Gesundheit, Alltagskomik) am Bildschirm erhöhen unsere Wachheit unterschwellig. Koffeingenuss und zeitverschobene Tätigkeiten wie Jogging oder Squash, Tanzen oder Feiern, Baden oder Duschen, Briefmarkensammeln oder E-Mails-Beantworten spätnachts kennzeichnen ein bewegtes Leben. Aber bewegt heißt noch lange nicht erfüllt. Das mögliche Chaos in unserer Lebensführung müssen wir selbst ordnen, weil uns heutzutage weder die Natur noch die Gesellschaft dazu bringen.
Depressive schlafen weniger und träumen mehr
Durchschnittlich 97 Prozent aller Depressiven klagen über Schlafstörungen, 83 Prozent weisen wissenschaftlich nachweisbare Schlafstörungen auf. Damit ist schlechter Schlaf der sensibelste erste Hinweis auf Depression, eine Art Warnschild. Nur der Umkehrschluss gilt nicht: Längst nicht jede Schlafstörung hat ihre Ursache in einer Depression. Allerdings ist der Zusammenhang nicht selten. 70 Prozent aller Schlafstörungen sind auf psychische Ursachen zurückzuführen. Das kann die Folge eines Streites in der Partnerschaft sein, die Sorge um das finanzielle Auskommen, eine berufliche Unsicherheit oder Angst um die zu spät heimkehrenden Kinder. Es kann sich aber auch eine Depression dahinter verbergen.
Das Schlafmuster depressiv Erkrankter ist in ganz typischer Weise verändert. Der normale Schlaf wickelt sich in vier bis fünf Zyklen pro Nacht ab, wobei sich die leichten Schlafstadien 1 und 2 mit schnellen Wellen im Elektroenzephalogramm oder EEG (das ist ein Gerät zur Messung der Hirnströme) von den Stadien des Tiefschlafs 3 und 4 mit sehr langsamen Wellen und hohen Wellenbergen im EEG unterscheiden. Mitten im Stadium 2 entsteht eine Phase aktiven Schlafes, in dem sich die Augen massiv bewegen und das EEG wieder schnell wird, fast als wäre man wach. Wer in dieser Zeit der raschen Augenbewegung oder des „rapid eye movement“ (REM) geweckt wird, berichtet meist von lebhaften Träumen. Normalerweise erreicht man nach ungefähr 45 Minuten Schlafens die erste REM-Phase. Depressive erreichen sie früher, bereits nach 20 Minuten, haben pro Schlafzeit mehr und längere REM-Phasen, träumen also mehr und deutlich mehr schwarz-weiß statt farbig. So paradox es klingen mag: Um den Schlaf depressiv Erkrankter zu normalisieren, müssen ihm Phasen des Traumschlafes entzogen werden.12





























