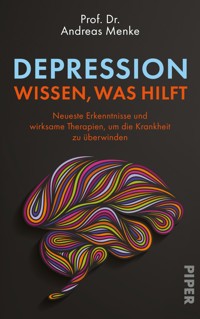
21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Piper ebooks
- Kategorie: Ratgeber
- Sprache: Deutsch
Wege aus der Depression In einem Zeitalter grassierender Depression, mit großem Leidensdruck und oft weitreichenden persönlichen und sozialen Folgen, wird es immer wichtiger, dem etwas entgegenzusetzen. In seinem großen Depressionsbuch klärt Prof. Dr. med. Andreas Menke wissenschaftlich fundiert und verständlich darüber auf, wie Depressionen entstehen, was man selbst dagegen tun kann und wie man die passende Therapiemethode findet. Von den ersten Symptomen bis zur Therapieplatzsuche ist dieses Buch ein verlässlicher Begleiter und gibt Werkzeuge an die Hand, um die Depression begreifen und überwinden zu können.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Mehr über unsere Autorinnen, Autoren und Bücher:
www.piper.de
Die in der vorliegenden Arbeit verwendeten Personenbezeichnungen beziehen sich gleichermaßen auf weibliche, männliche und diverse Personen. Auf eine Doppelnennung oder gegenderte Bezeichnungen wird zugunsten einer besseren Lesbarkeit verzichtet.
Die Namen und Orte der Personen in den Fallbeispielen wurden aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen verändert.
© Piper Verlag GmbH, München 2024
Covergestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Covermotiv: Getty Images / J614
Konvertierung auf Grundlage eines CSS-Layouts von digital publishing competence (München) mit abavo vlow (Buchloe)
Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.
Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht. Wir behalten uns eine Nutzung des Werks für Text und Data Mining im Sinne von § 44b UrhG vor.
Inhalt
Inhaltsübersicht
Cover & Impressum
Widmung
Vorwort
Bin ich depressiv?
Die Symptomatik
Die unterschiedlichen Ausprägungen
Die melancholische Depression
Die atypische Depression
Die agitierte Depression
Die psychotische Depression
Die somatisierte Depression/larvierte Depression
Die Altersdepression
Die saisonale affektive Störung
Die postpartale Depression – Wochenbettdepression
Die ängstliche Depression
Depression bei Kindern
Verlaufsformen
Interview mit Clara Louise
Abgrenzung zu anderen Krankheitsbildern
Burnout: Unterschied Depression vs. Burnout
Bipolare Depression im Rahmen einer bipolaren affektiven Störung
ADHS und Depression
Interview mit Angelina Boerger
Wir müssen nun über Suizidalität sprechen
Kurze Geschichte der Depression
Wie entsteht eine Depression?
Genetische Verwundbarkeit
Psychologische Verwundbarkeit
Die Umwelt – was ist toxischer Stress?
Exkurs: Stress and the City
Mechanismen der Depressionsentstehung
Die Monoaminmangel-Hypothese – zu wenig Serotonin?
Oder doch nur Stress: die Stress-Systeme des Körpers
Das Stress-Hormon-System
Das Immunsystem
Das autonome Nervensystem
Exkurs: Die großen Krisen: Corona, Klima, Ukraine …
Veränderungen in der Struktur und der Funktion des Gehirns
Neuroplastizität, Neurogenese oder auch die Anpassungsfähigkeit des Gehirns
Die Darm-Gehirn-Achse – oder das Mikrobiom
Was sind denn nun die Mechanismen der Depressionsentwicklung?
Was macht die Depression mit meinem Körper?
Psychologische Faktoren, die Depression und körperliche Erkrankungen begünstigen
Depressionsmanagement, Rückfallprophylaxe und Prävention – 10 Wege aus der Depression
1. Psychotherapie
Kognitive Verhaltenstherapie (KVT)
Akzeptanz- und Commitment-Therapie (ACT)
Achtsamkeitsbasierte kognitive Therapie (Mindfulness Based Cognitive Therapy, MBCT)
Cognitive Behavioral Analysis System for Psychotherapy (CBASP)
Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie
Systemische Therapie
Nebenwirkungen der Psychotherapie
2. Hilfe auf Rezept – Antidepressiva
Exkurs: Therapie der bipolaren Depression
3. Psychedelika – den Geist offenbaren
4. Weitere biologische Verfahren: Elektrokrampftherapie und Co.
Exkurs: Therapie der therapieresistenten Depression
Exkurs: Personalisierte Medizin – Therapeutisches Drug Monitoring und Gentests
5. DIGAs und weitere internet- und mobilbasierte Therapiemöglichkeiten
6. Stressmanagement: Achtsamkeit und Entspannungsverfahren
7. Sport
8. Ernährung
9. Natur als Therapie: Waldbaden
10. Freunde und Beziehungen
Mein Angehöriger ist depressiv, wie kann ich helfen?
Wer hilft mir?
Nützliche Adressen
Ausblick
Prävention: Steinzeitmenschen auf der Überholspur …
Anhang
Quellen
Buchnavigation
Inhaltsübersicht
Cover
Textanfang
Impressum
Widmung
Für meine Eltern Siegrun und Klaus
Vorwort
Wieso braucht es ein weiteres Buch über Depression? Gibt es nicht schon genug davon?, werden Sie sich vielleicht fragen. Während ich im November 2023 an diesem Buch schrieb, wurden die Suizidzahlen für 2022 veröffentlicht. Es war zu einem deutlichen Anstieg der Suizide in Deutschland gekommen, mit 10 119 Toten sind es fast 10 % mehr als im Jahr zuvor. Die Suizidrate war seit 1980, von 18 451 ausgehend, stetig mit jeweils nur kleinen Rückschritten gesunken, seit damals gab es keinen so deutlichen Anstieg mehr. Der stetige Rückgang reflektierte die verbesserten Behandlungsoptionen, aber auch das gestiegene Bewusstsein um die Depression und die wachsende Entstigmatisierung der Depression und Suizidalität. Wieso haben wir aber jetzt diesen starken Anstieg der Suizidalität zu verzeichnen?
Wir waren schon sehr weit gekommen; viele bekannte Persönlichkeiten wie Wincent Weiss, Bruce Springsteen, Ed Sheeran, Katty Salié, Nora Tschirner, Kurt Krömer, Lewis Hamilton, Hazel Brugger, Sarah Connor, Stefanie Giesinger, Gesine Schwan, Clara Louise, Torsten Sträter und noch viele mehr haben über ihre Depression gesprochen. Aber offensichtlich reicht dies nicht. Es gibt immer noch eine Stigmatisierung. Immer noch werden Patienten mit einem Herzinfarkt anders behandelt als mit einer Depression.
Die Depression ist in gewisser Hinsicht wie ein zweischneidiges Schwert: auf der einen Seite die Krankheitsbelastung durch die Symptome, die ein normales Leben nahezu unmöglich macht, auf der anderen Seite die Stigmatisierung durch die Gesellschaft, die Vorurteile und Ängste, die Menschen mit einer Depression diskriminieren und von vielen Möglichkeiten des Lebens, seien es berufliche oder gesellschaftliche, ausschließen [1, 2].
Die Stigmatisierung führt sogar so weit, dass Behandlungsmöglichkeiten nicht ausreichend angeboten, zu spät aufgesucht oder gar nicht aufgesucht werden. Manche Behandlungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel die Antidepressiva, werden ebenfalls stigmatisiert. Zudem werden wirksame Medikamente, die eine Krankheit in letzter Konsequenz sogar heilen können, von manchen regelrecht verteufelt. Bei Betablockern, die nach einem Herzinfarkt helfen, konnte man so eine Abneigung noch nie beobachten.
Manche Betroffene mit einer Depression vertrauen sich selbst ihren Nächsten nicht an, weil sie befürchten, von ihnen missverstanden zu werden. Ähnlich verhält es sich am Arbeitsplatz, kaum jemand möchte offen vor seinen Vorgesetzten oder seinen Kollegen über Depression sprechen. Ein Patient von mir, eine Führungskraft auf Direktorenebene in einem weltweit agierenden, allseits bekannten Konzern, zitierte seinen Vorstand: »Sagen Sie niemandem, dass Sie eine Depression haben. Erzählen Sie etwas von einer Kur, und nehmen Sie sich eine Auszeit …«
Nun frage ich Sie: Würden Sie nach einem Herzinfarkt zögern, Ihren Kollegen und Ihrem Vorgesetzten davon zu berichten? Wenn ja, warum? Da ist also wirklich noch einiges zu tun. Immerhin gibt es schon verschiedene, von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und auch von anderen initiierte Programme, um die Entstigmatisierung voranzubringen [3–5].
Anzahl der Suizide in Deutschland seit 1980 [6].
Was sind nun die Fakten? Etwa jeder Fünfte erleidet mindestens eine depressive Episode in seinem Leben. Wir gehen davon aus, dass in einem Jahr etwa 8,2 % der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland an einer Depression leiden, das sind 5,3 Millionen Menschen [7, 8]. In dieser Zahl sind allerdings Kinder und Jugendliche sowie Menschen über 79 Jahre nicht berücksichtigt. Depression ist also eine Volkserkrankung, die wirklich jeden treffen kann, und stellt eine massive Belastung in allen Lebensbereichen dar.
Lange waren Herz-Kreislauf-Erkrankungen als Ursache für eine Frühberentung führend, dann wurden die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten des Herz-Kreislauf-Systems immer besser, und so lösten Muskel-Skelett-Erkrankungen, also der klassische »Rücken«, die Herzerkrankungen ab. Mittlerweile ist mit die Depression 16,2 % die führende Ursache bei Frühberentungen [9, 10]. Bei der Arbeitsunfähigkeit liegt sie zwar noch auf dem zweiten Platz, allerdings führt sie mit riesigem Abstand bei der Erkrankungsdauer je Fall mit durchschnittlich mehr als 39 Tagen [11, 12]. Und laut der Global-Burden-of-Disease-Studie ist Depression weltweit ebenfalls auf dem zweiten Platz, diesmal aber bezogen auf die gesunden Lebensjahre, die durch die Erkrankung verloren werden, also noch vor Herzinfarkten, Schlaganfällen oder Krebserkrankung [13].
Es gehen aber nicht nur Jahre an gesundem Leben, mit Teilnahme am gesellschaftlichen und beruflichen Leben, verloren, sondern auch Lebensjahre überhaupt. Die Sterblichkeit ist durch Suizide, aber auch durch die Entwicklung oder Verschlechterung von vielen anderen körperlichen Erkrankungen erhöht, wie etwa Herzerkrankungen, Schlaganfällen, Diabetes mellitus, das Metabolische Syndrom und Krebserkrankungen [14, 15]. Bei schweren psychischen Erkrankungen wie einer schweren Depression kostet es Betroffene möglicherweise mehr als zehn Jahre, die sie früher sterben [16].
Das durch die Depression verursachte Leid lässt sich aber eigentlich nicht in Zahlen ausdrücken. Der wirtschaftliche Schaden, den sie verursacht, lässt sich jedoch schon errechnen. In Europa, so schätzt man, sind etwa 30 Millionen Menschen von der Depression betroffen, was geschätzt 92 Milliarden Euro kostet [17]. Die Allianz-Versicherung hat in Zusammenarbeit mit dem Wirtschaftsinstitut RWI für das Jahr 2008 berechnet, welche Kosten genau durch die Depression entstehen. Dies sind zum einen die direkten Krankheitskosten, die für ambulante, teilstationäre und stationäre Behandlungen sowie medizinische Heil-, Präventions- und Rehabilitationsbehandlungen zu entrichten sind [18].
Es entstehen aber auch indirekte Kosten, insbesondere durch Präsentismus und Absentismus bei der Arbeit. Präsentismus ist ein Maß für das Arbeiten mit eingeschränkter Leistungsfähigkeit, zum Beispiel durch Konzentrations- und Merkfähigkeitsstörungen. Absentismus sind die Fehlzeiten, die typischerweise bei einer Depression mehrere Wochen bis Monate betragen können. Somit gehen dem Unternehmen das Wissen und die Kompetenz der Mitarbeitenden, zumindest für eine gewisse Dauer, verloren. Im Report der Allianz werden die direkten Krankheitskosten mit 5,2 Milliarden Euro angegeben, was sich zusammensetzt aus 1,8 Milliarden Euro für den ambulanten und 2,9 Milliarden für den stationären einschließlich teilstationären Bereich.
Die indirekten Kosten sind weit schwieriger zu berechnen, sie ergeben sich aus Mortalität und Morbidität, also aus der Sterblichkeit und den erkrankungsbedingten Folgen auf die Arbeit, hier werden im Report der Allianz 1,3 Milliarden Euro angegeben. Weitere Komponenten der indirekten Kosten sind die Arbeitsunfähigkeit mit 1,6 Milliarden Euro, die Erwerbsunfähigkeit, also Frühberentung, mit 4,6 Milliarden Euro, und der Präsentismus lässt sich auf 9,3 Milliarden Euro schätzen, wenn man von einem Produktivitätsverlust von etwa 1,8 Stunden pro Tag ausgeht. Somit kam es im Jahr 2008 zu geschätzten Gesamtkosten von etwa 22 Milliarden Euro [18].
Lassen Sie mich ein paar weitere Zahlen hinzufügen. Die Stiftung Deutsche Depressionshilfe und Suizidprävention untersucht jährlich in einer repräsentativen Umfrage die Einstellungen und Erfahrungen zur Depression und zu deren Behandlungssituation in der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland. Das Barometer Depression hat im Jahr 2022 ermittelt, dass im Durchschnitt 20 Monate vergehen, bis sich Menschen mit einer Depression Hilfe suchen [19].
Die Gründe liegen in der erkrankungsbedingten Antriebslosigkeit, aber auch in der Stigmatisierung durch die Gesellschaft und in den Versorgungsengpässen. Die Befragten gaben an, dass sie, wenn sie sich Hilfe gesucht hatten, etwa acht Wochen auf einen Termin beim Facharzt und etwa zehn Wochen auf ein psychotherapeutisches Erstgespräch warten mussten. Für dieses Erstgespräch mussten die Betroffenen durchschnittlich fünf Psychotherapeuten kontaktieren [19]. Nach dem Erstgespräch geht es aber leider weiter mit der Warterei. Die Bundespsychotherapeutenkammer hat sich die Abrechnungsdaten der Kassenärztlichen Bundesvereinigung angeschaut, daraus wurde offensichtlich, dass die durchschnittliche Wartezeit vom Erstgespräch bis zum Therapiebeginn im Jahr 2019 mehr als 20 Wochen betrug [20].
Stellen Sie sich vor, Sie sind massiv belastet durch Traurigkeit oder Gefühllosigkeit, durch Ängste, Unruhe und Anspannung, können sich nicht mehr konzentrieren und nicht mehr richtig schlafen. Und dann müssen Sie diese Wartezeit in Kauf nehmen, bis Sie Hilfe bekommen …
Wir sehen also, dass es leider immer noch eine gesellschaftliche Stigmatisierung gibt, sodass es Betroffenen nicht leichtfällt, sich Hilfe zu suchen und Hilfe zu bekommen. Ebenfalls sehen wir, dass es in ihrem unmittelbaren Umfeld zu Hause zu Schwierigkeiten kommt. Und leider sehen wir auch, dass die Suizidrate in Deutschland seit Langem wieder substanziell gestiegen ist. Daher denke ich, dass ein weiteres Buch zur Erkrankung Depression richtig und wichtig ist. Meiner Meinung nach kann es nicht genug Bücher über die Depression geben, von Experten, aber auch Betroffenen. Je mehr Erfahrungs- und Wissensaustausch stattfindet, umso mehr wird sich die Stigmatisierung reduzieren und der Zugang zur Behandlung aber auch die Behandlungsmöglichkeiten sich verbessern.
In diesem Buch werde ich – wie es dem Thema angemessen ist – auch belastende Aspekte wie Traumatisierungen oder suizidspezifische Momente beschreiben. Trotzdem werde ich in den einzelnen Kapiteln keine Trigger-Warnungen anzeigen. Warum nicht? In Studien wurde gezeigt, dass Trigger-Warnungen eben nicht die negativen emotionalen Konsequenzen abfangen oder vermindern konnten, auch kam es nicht zu einer Verbesserung der Bewältigungskompetenzen [21]. Somit seien Sie sich bitte bewusst, dass ich auch belastende Aspekte in einzelnen Kapiteln thematisieren werde, ohne dass dies davor angezeigt wird.
Eine weitere Anmerkung ist mir auch noch wichtig. Im Folgenden werde ich Ihnen von verschiedenen Patientinnen und Patienten berichten, um Ihnen ein möglichst umfängliches Bild der Depression vermitteln zu können. Alle Krankheitsgeschichten haben sich so ähnlich zugetragen, aber eben nur so ähnlich. Damit keine Rückschlüsse auf einzelne Personen gezogen werden können, sind die Krankheitsgeschichten grundsätzlich in einzelnen soziodemografischen Angaben verfremdet. Die Namen stimmen nie, aber auch Orts- oder Zeitangaben sowie manche Zusammenhänge entsprechen meistens nicht der wahren Krankheitsgeschichte. Somit ist es unmöglich, mit den Beschreibungen aus diesem Buch Rückschlüsse auf existierende Personen zu ziehen.
Bevor es nun losgeht, möchte ich Ihnen noch eine Frage stellen, die ich auch gerne den Zuhörern meiner Vorträge stelle. Wie viel Stress hatten Sie im letzten Jahr? Keinen, so mäßig viel oder richtig viel? Und wie haben Sie die Stressbelastung empfunden? Haben Sie sich Sorgen um Ihre Gesundheit gemacht? Bitte merken Sie sich Ihre Antwort, die Auflösung gibt es im Kapitel über die psychologische Verwundbarkeit …
Bin ich depressiv?
Warum interessieren Sie sich für dieses Buch über Depression? Machen Sie sich schon länger Sorgen über seltsame Gefühle, die Sie nicht verstehen können? Gefühle, die unangenehm sind und die Sie im Alltag einschränken und belasten? Oder fragen Sie sich, ob eine Freundin oder ein Familienmitglied eine Depression haben könnte?
Im Sprachgebrauch gehen wir sehr leichtfertig mit den Begriffen »Depression« oder »depressiv sein« um. »Heute bin ich deprimiert, gestern hat mein Verein verloren und ist in der Bundesliga abgestiegen«, hört man immer wieder; »Wenn ich diese Schuhe nicht bekomme, dann werde ich depressiv« oder »Das Wetter deprimiert mich heute« sind andere Beispiele. Aber all das hat nichts mit der psychischen Erkrankung Depression zu tun.
Die Symptomatik
Was also ist die Depression? Zugegeben, in manchen Fällen ist es nicht immer leicht zu unterscheiden, ob eine traurige Stimmung »normal« oder schon klinisch relevant ist. Stimmungsschwankungen gehören zum Leben dazu, sind sogar sehr wichtig für ein erfülltes Leben. Ohne Stimmungsschwankungen wäre es fad und eintönig. Wenn ich einen geliebten Menschen oder ein geliebtes Tier verliere, ist es völlig nachvollziehbar, dass ich traurig bin. Wenn ich mich lange auf eine bestimmte Aufgabe vorbereitet habe und diese dann nicht gelingt, ist es ebenso natürlich, dass ich enttäuscht und traurig bin. Das Ende einer wichtigen Beziehung führt auch üblicherweise zu Trauer und vielleicht sogar zu Verzweiflung. Dies zeigt aber nur, dass die jeweiligen Situationen mich berühren und eben nicht kaltlassen. Wer möchte nun festlegen, wie lange ich trauern darf, damit es noch »normal« ist? Schließlich ist der Trauerprozess hochindividuell, wir trauern unterschiedlich lange.
Es ist also nicht immer einfach zu entscheiden, ob ein Stimmungstief noch nachvollziehbar ist oder ob es sich schon um eine psychische Erkrankung handelt. Ein paar Merkmale können bei der Unterscheidung aber helfen:
Mir geht es so schlecht, dass ich immer wieder in der Schule oder in der Arbeit fehle, und wenn ich nicht fehle, wollen mir die Aufgaben nicht richtig gelingen.
Die Tätigkeiten des Alltags wie Einkaufen, Öffnen der Post, Kochen und Putzen führen zu Schwierigkeiten.
Bei positiven Nachrichten kann ich mich nicht mehr freuen, auch nicht, wenn ich geliebte Menschen treffe.
Ich hatte schon eine depressive Episode.
Ich habe Verwandte, die schon eine depressive Episode hatten.
Es gibt auch Fragebögen, die bei dem Verdacht »Bin ich depressiv?« helfen können. Zum Beispiel eignet sich der »Patient Health Questionnaire (PHQ-9) dafür [siehe Tabelle 1 im Anhang]. Er enthält neun Fragen zu möglichen depressiven Symptomen, die mit jeweils 0 für »nicht vorhanden« bis 3 für »fast jeden Tag vorhanden« beantwortet werden müssen. Ab einem Punktwert von 10 geht man von einer relevanten depressiven Episode aus [22].
Manche stellen sich nun aber ganz andere Fragen: »Mir geht es schlecht, ich fühle mich furchtbar, aber es gibt keinen Grund dafür. Niemand ist gestorben, es besteht eine wunderbare Partnerschaft, auch Geld ist genug vorhanden, und doch fühlt sich alles sehr miserabel an. Darf ich dann überhaupt depressiv sein?« In dieser Konstellation tauchen häufig Schuldgefühle auf: »Anderen geht es doch so viel schlechter als mir …« und »Ich müsste mich einfach mal zusammenreißen …«. Tatsächlich sagen einem das manche: »Schau dich doch an, du hast doch alles, was du brauchst, schlaf doch mal aus, nimm mal Urlaub, und dann reiß dich bitte schön zusammen …«
Wann aber ist nun die Diagnose zu stellen? Die Kriterien der Depression sind klar definiert. In Deutschland richten wir uns nach dem medizinischen Klassifikationssystem der Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO), das »Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme« genannt wird, oder auf Englisch »International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems«, abgekürzt ICD-10 für die derzeit noch gültige 10. Version [siehe auch Tabelle 1]. Mittlerweile wurde schon eine 11. Version veröffentlicht, also ICD-11, die aber in Deutschland noch nicht umgesetzt wurde [siehe Tabelle 2 im Anhang]. In wissenschaftlichen Studien wird neben der ICD-10 auch häufig das Manual der Amerikanischen Psychiatrischen Gesellschaft (American Psychiatric Association, APA) verwendet, das »Diagnostische und Statistische Manual psychischer Störungen«, auf Englisch »Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders«, abgekürzt DSM-V [siehe Tabelle 3 im Anhang].
Aber egal, nach welchem Klassifikationssystem man sich richtet, im Zentrum der Erkrankung steht immer die niedergedrückte Stimmung. Das lateinische Wort für »niederdrücken«, deprimere, hat der Erkrankung ihren Namen gegeben. Dabei bestehen eine Herabgestimmtheit der Stimmung, eine Traurigkeit und nicht selten eine Verzweiflung. Auch kann die Freudfähigkeit deutlich eingeschränkt sein. Je nach Schweregrad kommt es zudem zu einer kompletten Anhedonie, also Freudlosigkeit. Patienten mit einer schweren Depression können sich z. B. nicht mehr über ein Treffen mit ihren Liebsten, Kindern, Enkeln oder Freunden freuen. Manche beklagen, dass sie gar nichts mehr fühlen, noch nicht einmal mehr Trauer. Sie fühlen sich innerlich leer, gleichgültig, empfinden sich als leeres oder welkes Blatt. Sie reagieren kaum noch auf die Umwelt.
Diese Gefühllosigkeit kennzeichnet eine noch ausgeprägtere Schwere der Depression, als wenn »nur« Traurigkeit besteht. Manche sind hingegen gar nicht traurig, sondern eher gereizt. Gerade bei Männern tritt häufig eine leichte Reizbarkeit und Dünnhäutigkeit auf. Auch das Interesse oder die Motivation, irgendetwas zu tun oder anzufangen, ist häufig reduziert oder sogar aufgehoben. Dies betrifft nicht nur Tätigkeiten, die landläufig ohnehin keine Freude machen, sondern tatsächlich auch angenehme Vorhaben wie Kinobesuche oder mit Freunden essen zu gehen.
Eine weitere Kernsymptomatik ist der reduzierte Antrieb. Depressive Patienten fühlen sich ausgelaugt, haben keine Kraft mehr. Alles, jede noch so kleinste Tätigkeit, kostet enorm viel Kraft, die Akkus sind leer. Je nach Schweregrad verlassen depressive Patienten ihre Wohnung oder ihr Haus nicht mehr, gehen nicht mehr arbeiten, nicht mehr einkaufen, können auch zu Hause keine Aufgabe mehr erledigen oder vernachlässigen sogar die Körperpflege.
Neben dieser Kernsymptomatik gibt es noch ein breites Spektrum an weiteren Symptomen und Beschwerden. Grundsätzlich sind die ersten Symptome häufig Konzentrations-, Merkfähigkeits- und Gedächtnisstörungen. Die Konzentration reicht nicht mehr, die Tageszeitung oder ein Buch zu lesen, einfache Dinge fallen einem nicht mehr ein, man vergisst, wo man das Auto abgestellt hat oder was man im Keller wollte. Während der Arbeit oder in der Schule häufen sich Fehler, es stellen sich immer größere Gedächtnislücken ein, Denken und Sprechen ist gehemmt, langsam und monoton. Häufig wird es einfach als eine Leere im Kopf beschrieben. Einige Patienten fürchten sogar, aufgrund der Schwere dieser kognitiven Defizite an einer Demenz erkrankt zu sein.
Das Denken an sich ist ebenfalls beeinträchtigt. Manchmal ist es verlangsamt, häufig besteht ein Grübeln und Kreisdenken. Wie in einem Karussell drehen sich die Gedanken immer wieder im Kreis, ohne dass sich dabei eine Klärung für irgendein Problem ergibt. Ganz im Gegenteil, häufig treten klassische depressive Denkfehler auf: Die Gedanken kreisen um das Nichtkönnen, Versagen, die eigene Unfähigkeit, es kommt zu einem Schwarz-Weiß-Sehen, zu einem Katastrophisieren, Generalisieren und stets negativen Bewertungen.
Aaron Beck, einer der bekanntesten Psychotherapeuten, der u. a. die kognitive Verhaltenstherapie prägte, hat die kognitive Theorie der Depression beschrieben [23]. Ein wichtiger Bestandteil seiner Theorie ist die kognitive Triade. Nach Beck ist nicht nur ein negatives Ereignis schuld an der Entwicklung an einer Depression, sondern vielmehr die persönliche Bewertung dieses Ereignisses. Bei depressiven Patienten ist die Bewertung oder die Sicht auf die Dinge meist negativ geprägt. Bestandteile der kognitiven Triade sind daher ein negatives Selbstbild, damit einhergehend ein negatives Weltbild und dann konsequenterweise auch eine negative Sicht auf die Zukunft. Die depressiven Patienten fühlen sich wertlos, mangelhaft, als Versager. Die Umwelt wird von ihnen gleichermaßen als negativ wahrgenommen, man fühlt sich nicht verstanden, ungerecht behandelt. Wenn das Selbstbild und das Weltbild schlecht sind, kann die Sicht auf die Zukunft kaum positiv ausfallen. Somit sind depressive Patienten meist hoffnungslos, sehen keinen Ausweg aus der misslichen Lage, kein Licht am Ende des Tunnels.
Zusammenfassend könnte man sagen, die Depression legt sich wie ein schwerer schwarzer Teppich über alles, färbt alles negativ ein. Grundsätzlich bewerten und denken depressive Patienten nicht anders als Menschen ohne Depression, allerdings ist der Schwerpunkt der Bewertung deutlich ins Negative verschoben. Negative Aspekte werden der eigenen Person und dem eigenen unzulänglichen Verhalten zugeschrieben, während positive Aspekte erst einmal nicht gesehen werden, und wenn doch, dann werden sie externen Faktoren oder dem Zufall zugeschrieben.
Gerade bei einer schweren Ausprägung der Depression kommt es manchmal zu Gedanken und Überzeugungen, die zwar unrealistisch sind, aber von den Patienten als richtig und gegeben wahrgenommen werden. Fachlich nennt man dies Wahnerleben. Schuld ist dabei ein sehr häufiges Thema. Die depressiven Patienten sind dabei überzeugt, an etwas oder auch an ihrer Erkrankung selbst schuld zu sein. Sie glauben – und das ist durch Außenstehende nicht korrigierbar –, dass sie Fehler gemacht, sich versündigt haben. Andere glauben, dass sie und ihre Familien verarmen werden; auch wenn es z. B. durch Kontoauszüge leicht belegbar ist, dass es sich um eine eklatante Fehleinschätzung handelt, halten die Patienten an dieser Überzeugung fest. Der nihilistische Wahn ist ein weiteres klassisches Wahnerleben, die Patienten sind fest davon überzeugt, minderwertig zu sein bzw. nicht zu existieren.
Viele Patienten mit einer Depression berichten von einer inneren Unruhe, einer Anspannung oder sogar inneren Getriebenheit. Dies kann besonders belastend sein, wenn auf der einen Seite der Antrieb fehlt, etwas zu tun, auf der anderen Seite aber diese innere Getriebenheit einen dazu auffordert. Das Ergebnis ist ein sehr quälendes Gefühl, aus dem sich Patienten kaum befreien können.
Neben dieser motorischen Unruhe gibt es noch weitere »körperliche« Veränderungen. Die meisten Patienten haben weniger oder gar keinen Appetit mehr, nichts schmeckt mehr, sie haben keine Kraft und keinen Antrieb zum Essen. Folglich nehmen viele Patienten an Gewicht ab. Es gibt aber auch depressive Patienten, die deutlich mehr Appetit haben. Sie verspüren einen Drang, immer mehr zu essen, ständig zu essen, und meist richtet sich dieser Appetit nicht gerade auf gesunde Nahrungsmittel wie Gemüse oder Obst, sondern eher auf zucker- oder fettreiche Nahrung. Diese Patienten nehmen dann nicht selten an Gewicht zu.
Die Betroffenen fühlen sich also unwohl, psychisch und körperlich, sind massiv belastet. Selbstwert und Selbstbewusstsein sind kaum noch vorhanden. Daher verwundert es nicht, dass auch das sexuelle Erleben verändert ist. Häufig berichten depressive Patienten von mangelnder Libido, sprich, sie haben keine Lust auf Sex. Außerdem fehlen der Antrieb und die Kraft dafür, sie wollen sich lieber zurückziehen. Wenn es dann doch zum Sex kommt, leiden männliche Patienten oft unter Erektions- und Ejakulationsstörungen, Patientinnen unter Lubrikationsstörungen und Schmerzen. Nun treten häufig auch Schuldgefühle gegenüber dem Partner oder der Partnerin auf, was die Patienten weiter belastet.
Bei den meisten Patienten beginnt die Depression mit den Konzentrations- und Merkfähigkeitsstörungen, wie oben beschrieben, aber auch mit Ein- und Durchschlafstörungen. Sie brauchen viel länger zum Einschlafen – wenn es früher 15–30 Minuten gedauert hat, brauchen viele nun 1–2 Stunden. Der Schlaf wird unruhiger, die Patienten wachen immer wieder auf, bis hin zum morgendlichen Früherwachen, z. B. um fünf Uhr, und können nicht mehr einschlafen. Aber ähnlich wie beim Appetit gibt es auch hier Patienten, die statt zu wenig zu viel schlafen. Sie sind immer müde, obwohl sie sogar zu viel schlafen, weit mehr als die gewünschten 7–8 Stunden.
Wie bereits erwähnt leiden viele depressive Patienten unter großen Selbstwertproblemen, sie fühlen sich wertlos, sind verzweifelt, hoffnungslos, glauben nicht, dass es wieder besser werden könnte. Sie fühlen sich als Belastung für ihre Umwelt, für ihre Angehörigen und Freunde. Manche haben auch unrealistische, wahnhafte Überzeugungen, dass sie schuld an etwas Schlimmem sind oder verarmen werden. Bei einer so schweren Ausprägung der Depression kommt es nicht selten zu einem Lebensüberdruss. Die Patienten sehen keinen Sinn mehr im Leben, wenn sie morgen nicht mehr aufwachen würden, wäre es in Ordnung für sie. Manche entwickeln dann Suizidgedanken, erst diffuse, dann konkrete. Manchmal entstehen daraufhin Pläne: Wie könnte es gehen, und wann wäre ein guter Zeitpunkt? Leider werden diese Suizidgedanken und Suizidpläne von manchen auch umgesetzt, und es kommt zu einem Suizidversuch bzw. einem Suizid. Suizidalität ist das gefährlichste Symptom der Erkrankung!
Patientin Manuela B., 21 Jahre
Manuela B. war eine meiner ersten Patientinnen. Sie hatte gerade in München mit ihrem Biologiestudium begonnen, davor hatte sie ein freiwilliges soziales Jahr in einem Altenheim absolviert. Sie hatte einen liebevollen Freund, mit dem sie schon drei Jahre zusammen war. Alles lief gut für sie, das Leben machte Spaß, und es schien ihr alles zu gelingen.
Aber irgendwann machte das Leben nicht mehr so viel Spaß. Sie konnte nicht sagen, was sich geändert hatte. Das Studium wurde schwieriger, sie konnte sich nicht mehr richtig auf den Lernstoff konzentrieren. In den Testaten machte sie Fehler, die sie vorher nicht gemacht hatte. Sie konnte nicht mehr richtig einschlafen, lag eineinhalb Stunden wach und dachte über den Tag nach. Sie grübelte, was sie hätte besser machen können.
Zunehmend ging es ihr schlechter. Sie schämte sich, weil ihre Leistungen im Studium immer schlechter wurden, obwohl sie jede freie Minute lernte. Sie wollte sich nicht mehr mit ihren Freundinnen treffen, zog sich zurück und erledigte nur noch das Notwendigste. Ihr Freund verstand sie nicht, er fragte immer, was los sei, aber sie konnte es ihm nicht sagen.
Schließlich hatte sie nicht mal mehr die Kraft, um an die Uni zu gehen, sie besuchte keine Vorlesungen mehr, wollte niemanden mehr sehen. Sie war sehr unruhig, sehr angespannt und innerlich getrieben. Zu Hause konnte sie nicht mehr einfach dasitzen und ein Buch lesen, sie musste immer aufstehen, sich bewegen, damit sie mit der Unruhe einigermaßen umgehen konnte. Sie war sehr verzweifelt, fühlte sich leer, konnte gar nichts mehr fühlen, alles war ihr gleichgültig. Wenn ihr Freund sie besuchte, kam kein Lächeln mehr über ihre Lippen. Sie konnte sich überhaupt nicht erklären, was mit ihr los war. Noch nie zuvor hatte sie sich so gefühlt. Als ihre Eltern begannen, sich Sorgen zu machen, sagte sie immer nur, im Studium sei es gerade sehr stressig, das gehe bald wieder vorbei.
Doch irgendwann hatte sie keine Hoffnung mehr, dass es besser werden würde. Sie war der festen Überzeugung, dass sie verdammt sei und niemand ihr mehr helfen könne. Sie wollte nicht mehr leben, sie konnte es nicht mehr aushalten. Innerhalb weniger Tage fasste sie den Entschluss, sterben zu wollen. Sie nahm alle Tabletten, die sie in ihrer Wohnung finden konnte, und wartete ab.
Wenige Stunden später kam ihr Freund und fand sie schlafend in ihrer Wohnung. Weil er sie nicht gleich wecken konnte und die leeren Tablettenblister fand, rief er den Notarzt. Sie wurde ins Schwabinger Krankenhaus in München gebracht und in der inneren Nothilfe aufgenommen. Zum Glück hatten die Tabletten keinen größeren Schaden angerichtet, Manuela B. wurde schnell wieder wach. In dieser Nacht hatte ich Bereitschaftsdienst am Max-Planck-Institut für Psychiatrie. Wir versorgten das Schwabinger Krankenhaus konsiliarisch für psychiatrische Fragestellungen, daher wurde ich gerufen.
Manuela B. berichtete mir, wie es ihr die letzten Wochen gegangen war. Aufgrund ihrer Schilderungen war klar, dass sie eine schwere depressive Episode entwickelt und in diesem Rahmen versucht hatte, sich das Leben zu nehmen. Sie war erleichtert, dass ihr Suizidversuch nicht gelungen war, und einverstanden, im Max-Planck-Institut für Psychiatrie weiterbehandelt zu werden.
Nun ist aber Depression nicht gleich Depression. Tatsächlich gibt es mehrere Subtypen oder auch anders gesagt: unterschiedliche Ausprägungen.
Die unterschiedlichen Ausprägungen
Die melancholische Depression
Sie ist sozusagen der Klassiker, im Zentrum stehen eine Freudlosigkeit, niedergedrückte Stimmung und Antriebsverlust. Die Betroffenen können kaum noch schlafen, auch der Appetit hat sich vermindert. Viele haben ein Morgentief, was bedeutet, dass die Symptomatik morgens am schlimmsten ist und sich über den Tag etwas aufhellt. Im Wesentlichen entspricht das Bild der oben bereits beschriebenen Symptomatik.
Die atypische Depression
In manchen Teilen ist sie das Gegenteil der melancholischen Depression. Es kann eine gewisse Auslenkbarkeit bestehen, was bedeutet, dass Betroffene sich über positive Situationen kurz freuen können. Zentral ist zudem eine bleierne Schwere der Arme und Beine, eine erhöhte Empfindlichkeit auf Kritik oder Zurückweisung sowie eine Zunahme von Schlaf und Appetit.
Die agitierte Depression
Sie ist geprägt von einer ängstlichen Getriebenheit und einer Bewegungsunruhe. Betroffene können kaum stillsitzen, sondern müssen sich fast pausenlos bewegen. Auch ein unproduktives und hektisches Verhalten sowie ein ausgeprägtes Klagen und Jammern können das Bild bestimmen.
Die psychotische Depression
Dies ist die schwerste Ausprägung der Depression. Die Beschwerden sind meist die gleichen wie bei dem melancholischen Subtyp. Allerdings kommt es hier zu psychotischen Symptomen in Form von Wahnerleben. Ein Wahn ist eine Vorstellung oder ein Gedanke, der nicht der Wahrheit entspricht. Die Betroffenen sind aber unumstößlich von der Richtigkeit und Wahrheit überzeugt, auch das Vorlegen von Beweisen kann daran nichts ändern.
Typischerweise können bei der Depression ein Verarmungs-, Schuld-, hypochondrischer oder nihilistischer Wahn auftreten. Beim Verarmungswahn ist der Betroffene davon überzeugt, dass das Geld nicht mehr reichen wird, um den Lebensunterhalt zu bestreiten. Beim Schuldwahn besteht die Gewissheit, unermessliche Schuld auf sich geladen zu haben und nun bestraft werden zu müssen. Ein hypochondrischer Wahn kennzeichnet die Gewissheit, an einer Krankheit erkrankt zu sein und möglicherweise bald sterben zu müssen. Beim nihilistischen Wahn ist man der Überzeugung, dass man nicht mehr existiert und alles den Bach runtergeht, hier besteht eine komplette Hoffnungslosigkeit. In seltenen Fällen kann sich die psychotische Symptomatik auch in Form von Sinnestäuschungen/Halluzinationen zeigen. Dann hören die Betroffenen eine oder mehrere Stimmen, die ihnen Befehle geben, sie beschimpfen oder ihr Verhalten negativ kommentieren.
Bei diesem Depressionstyp gilt es zu beachten, dass von allen Subtypen das Suizidalitätsrisiko am höchsten ist. Liegt eine Depression mit Wahnerleben vor, sollte unbedingt eine fachärztliche Behandlung und am besten auch eine stationäre Aufnahme in eine psychiatrische Klinik in die Wege geleitet werden.
Patient Dr. Thomas B., 52 Jahre
Thomas war Zahnarzt und führte mit einem Kollegen eine Praxis auf dem Land. Sie wurden von ihren Patienten sehr geschätzt. Alle waren sehr zufrieden, die Behandlung war stets fachkundig, es gab keine Komplikationen, und beide Zahnärzte waren sehr nett, die Patienten fühlten sich gut aufgehoben und hatten volles Vertrauen. Dementsprechend lief die Praxis gut, und beide Teilhaber hatten keine finanziellen Sorgen.
Allerdings erlitt Thomas’ Kollege einen Herzinfarkt, er wurde operiert, bekam zwei Bypässe und musste sich anschließend für mehrere Wochen in eine Rehabilitation begeben. Thomas führte die Praxis allein weiter. Anfänglich ging es gut, aber die Arbeit wurde immer mehr, und er hatte Probleme, alles allein zu schaffen. Erst konnte er sich bei seiner Arbeit nicht mehr gut konzentrieren, dann wurde sein Schlaf schlechter, und zuletzt stand er komplett neben sich. Er fühlte sich ausgebrannt, hatte keine Gefühle mehr, keine Kraft, keine Energie.
Außerdem war er der festen Überzeugung, dass er seine Patienten falsch behandelt habe, dass er bei seinen zahnärztlichen Eingriffen erhebliche Fehler gemacht habe, die zu großem Leid bei seinen Patienten geführt hätten. Allerdings entsprach diese Vorstellung nicht der Realität. Die Mitarbeiter der Praxis bestätigten, dass immer noch alle Patienten hochzufrieden waren, auch in der Zeit, in der Thomas die Praxis allein führte. Dies konnte er aber nicht glauben.
Seine Ehefrau schaffte es immerhin, ihn zu überzeugen, sich in einer psychiatrischen Klinik aufnehmen zu lassen. Eine psychotherapeutische Behandlung war aufgrund des Wahnerlebens nicht möglich, daher stand die Behandlung mit Medikamenten im Vordergrund. Nach etwa neun Wochen zeigte sich eine deutliche Besserung, Thomas konnte die Situation wieder richtig einschätzen, er wusste, dass er keine Fehler gemacht hatte, sondern nur überlastet war und eine Depression entwickelt hatte. Wir konnten ihn entlassen, und er begann eine ambulante Behandlung.
Die somatisierte Depression/larvierte Depression
Wie bislang gezeigt kann die Depression unterschiedliche Ausprägungen haben. Der Subtyp der somatisierten Depression ist sicherlich derjenige, der am spätesten als Depression erkannt wird. Hier stehen nämlich körperliche Beschwerden im Vordergrund. Patienten leiden zum Beispiel unter chronischen Kopfschmerzen, einem mit Spannungsgefühlen verbundenen Schmerz, der immer wieder auftritt. Folgt eine neurologische Abklärung einschließlich Kernspintomogramm des Gehirns, zeigt sich allerdings keine Auffälligkeit. Andere haben chronische Rückenschmerzen, gerade im Lendenbereich. Zunächst wird es auf mangelnde Bewegung, falsches Sitzen und zu wenig Stehen geschoben. Eine orthopädische Abklärung einschließlich Kernspintomogramm der Lendenwirbelsäule zeigt die üblichen altersentsprechenden Verschleißerscheinungen, aber keine Ursache für den Schmerz, insbesondere keinen Bandscheibenvorfall oder auch keine Spinalkanalstenose (Verengung im Wirbelkanal).
Bei anderen stellen sich immer wieder ein Engegefühl im Brustkorb ein, Schmerzen beim Atmen oder ein Globusgefühl im Hals. Andere beklagen chronische Magenschmerzen oder auch Unregelmäßigkeiten beim Stuhlgang. Auch hier zeigt eine differentialdiagnostische Abklärung mit einer Gastroskopie (Magenspiegelung) keinen pathologischen, also krankhaften Befund. Betroffene finden meist erst mit einiger Verspätung nach ein bis zwei Jahren den Weg zur fachärztlichen Behandlung in der Psychiatrie oder Psychosomatik. Diese Latenz ist natürlich verständlich; treten die oben genannten Beschwerden auf, sollten sie zunächst abgeklärt werden. Ohne organische/somatische Abklärung eine psychische Ursache anzunehmen, ist nicht ratsam.
Die Altersdepression
Bei Menschen ab dem 65. Lebensjahr werden Depressionen oft nicht erkannt. Symptome der Depression werden gerne dem natürlichen Alterungsprozess zugeschrieben, gerade Merkfähigkeits- und Konzentrationsstörungen, mangelnder Antrieb und Energie oder auch eine reduzierte Freudfähigkeit. Außerdem zeigt sich die Altersdepression häufig mit körperlichen Beschwerden, mit hypochondrischen Befürchtungen und diffusen Angstsymptomen. Die körperlichen Beschwerden wie z. B. Rückenschmerzen oder Ohrgeräusche (wie Tinnitus) werden stärker wahrgenommen und als unerträglich und bedrohlich empfunden. Die Gedächtnisstörungen sind mit der Angst verbunden, an einer Demenz erkrankt zu sein.
Die Diagnose wird auch erschwert durch eine Multimorbidität, also das Vorliegen mehrerer Erkrankungen einhergehend mit einer Polypharmazie: Ältere Menschen bekommen oft eine Vielzahl an unterschiedlichen Medikamenten, manche müssen bereits in der Frühe eine ganze Handvoll schlucken. Diese Medikamente können in Teilen auch die Nebenwirkungen haben, eine Depression auszulösen. Wichtig zu wissen ist ebenfalls, dass die Suizidalität bei älteren Menschen erhöht ist, gerade bei Männern. Einsamkeit, unzureichende soziale Anbindungen und keine sinnstiftende Tätigkeit sind weitere depressions- und suizidalitätsfördernde Faktoren. Auslöser sind häufig der Eintritt in das Rentenalter, der Auszug der Kinder oder der Tod des Partners.
Die saisonale affektive Störung
Fühlen Sie sich mit Beginn der dunklen Jahreszeit auch schlechter? Wird Ihre Stimmung so dunkel wie das Licht draußen? Möchten Sie am liebsten das Haus nicht mehr verlassen und sich zurückziehen? Bei der saisonalen affektiven Störung folgt die Symptomatik einem jahreszeitlichen Muster mit Beginn im Herbst/Winter und Ende im Frühjahr.
Die Symptomatik ist gekennzeichnet durch ein erhöhtes Schlafbedürfnis mit gesteigertem Appetit und Gewichtszunahme, durch Energie- und Kraftmangel sowie eine reduzierte Stimmung. Die Symptomatik ist im Allgemeinen etwas leichter ausgeprägt als die anderen Subtypen. Eine Behandlungsmöglichkeit wäre, sich eine Finca auf Mallorca zu kaufen und Deutschland im Winter zu entfliehen. Allerdings würde dies von den meisten Krankenkassen nicht erstattet. Eine dagegen zugelassene Behandlungsmöglichkeit stellt die Lichttherapie dar. Diese beeinflusst den zirkadianen Rhythmus – bildlich gesprochen unsere innere Uhr, die unseren biologischen Rhythmus steuert – mit hellem fluoreszierendem Licht hoher Lichtstärke, die man in den frühen Morgenstunden anwenden sollte.
Die postpartale Depression – Wochenbettdepression
Bei vielen Müttern treten in den Stunden oder Tagen nach der Entbindung Stimmungsschwankungen, scheinbar grundloses Weinen oder ausgeprägte Erschöpfung auf. Diese als »Babyblues« bezeichnete Phase tritt bei 50–70 % der Frauen nach der Entbindung auf, sie hat keinen Krankheitswert und klingt nach wenigen Tagen ohne Behandlung wieder ab. Bei etwa 10–15 % der Frauen entwickelt sich aber Wochen bis Monate nach der Entbindung eine Depression.
Grundsätzlich unterscheidet sich die Symptomatik nicht von den bereits oben beschriebenen Symptomen. Allerdings zeigen sich bestimmte Besonderheiten. Betroffene haben Schwierigkeiten, Gefühle für ihr Kind zu entwickeln, sie glauben, es nicht zu schaffen, eine gute Mutter zu sein, haben Schuld- und Schamgefühle, übermäßige Angst um das Kind und leiden unter ausgeprägten Stimmungsschwankungen. Manche entwickeln sogar Zwangsgedanken, sie könnten das Kind schädigen, was natürlich noch zu einer größeren Angst führt. Risikofaktoren für die Entwicklung einer postpartalen Depression können bereits frühere depressive Episoden sein, aber auch Probleme bei der Schwangerschaft oder eine komplizierte Geburt, mangelnde Unterstützung oder partnerschaftliche Probleme. Die hormonelle Umstellung nach der Geburt mit dem Östrogenabfall stellt einen weiteren wichtigen Faktor dar.
Eine unbehandelte postpartale Depression kann schwere Langzeitfolgen nicht nur für die Mutter, sondern auch für das Kind haben. Es ist mir wichtig zu betonen, dass eine postpartale Depression kein persönliches Versagen der jungen Mutter ist, dass sie keineswegs eine schlechte Mutter ist oder ihr Kind nicht liebt. Vielmehr ist eine professionelle Hilfe notwendig. Hier handelt es sich ebenfalls um eine Erkrankung, die gut behandelbar ist.
Die ängstliche Depression
Mit etwa 45–55 % Auftreten ist die ängstliche Depression tatsächlich ein häufiger Subtyp, wird allerdings noch nicht als offizieller Subtyp geführt. Die ängstliche Depression ist gekennzeichnet durch eine schwerere Symptomatik [24], schlechteres Ansprechen auf die Behandlung [25, 26] und erhöhte Suizidalität [27].
Die Symptomatik wiederum ist gekennzeichnet durch eine erhöhte Ängstlichkeit bzw. vermehrtes Auftreten von Ängsten, aber auch von körperlichen Korrelaten von Angst, ihr als diagnostisch zugehörigen Befunden wie z. B. Herzklopfen, Diarrhoe oder Engegefühl im Brustkorb [25, 26, 28, 29]. An der psychiatrischen Universitätsklinik in Würzburg, an der ich früher tätig war, konnten wir zeigen, dass die ängstliche Depression auch maßgeblich von Kindheitstraumata beeinflusst wurde und in diesem Rahmen auch das Stress-Hormon-System prägte [28].
Depression bei Kindern
Können Kinder überhaupt depressiv werden? Diese Frage lässt sich leider ganz einfach beantworten: Ja, sie können. Zuletzt wurde dies in der Corona-Pandemie beobachtet, als immer mehr Kinder und Jugendliche depressiv wurden [30, 31]. Bei Vorschulkindern nimmt man eine Depressionsrate von etwa 1 % an, im Schulalter sind dann bis zu 2–3 % der Kinder betroffen. Bereits 3–10 % der Jugendlichen zwischen 12 und 17 Jahren leiden unter einer Depression [32].
Bis zur Pubertät gibt es keine Geschlechtsunterschiede bei den Kindern, danach gleicht es sich dem Verhältnis der Erwachsenen an, sodass Mädchen ungefähr doppelt so häufig betroffen sind wie Jungen. Bei Kindern und Jugendlichen gibt es auch eine hohe Komorbidität, also das gleichzeitige Auftreten anderer psychischer Erkrankungen wie Angststörungen, Essstörungen, Störungen im Sozialverhalten oder die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) [32].
Die Symptomatik bei Kindern und Jugendlichen unterscheidet sich von dem Erscheinungsbild im Erwachsenenalter. Im Vorschulalter bis sechs Jahre weinen die Kinder, sind leichter reizbar, stimmungslabil, haben vermehrt aggressive Durchbrüche. Manche ziehen sich zurück, sind eher passiv, wollen weniger spielen und haben eine verminderte Mimik und Gestik. Auch sind Ein- und Durchschlafstörungen sowie Essstörungen mit Gewichtsverlust zu beobachten. Die jüngeren Schulkinder im Alter bis zwölf Jahre sagen bereits, dass es ihnen nicht gut geht, dass sie traurig und antriebslos sind. Es können auch suizidale Gedanken auftreten, in der Schule zeigt sich häufig ein Leistungsabfall. Körperliche Beschwerden wie Bauch- oder Kopfschmerzen jeden Morgen vor der Schule sind auch keine Seltenheit.
Besonders in der Jugend sind einzelne depressive Symptome nur schwer von den alterstypischen Entwicklungsschwierigkeiten zu unterscheiden und werden daher häufig von Eltern, Lehrern und Ärzten übersehen. Stimmungsschwankungen im Rahmen von sozialen Konflikten oder schulischen Problemen gehören zur Entwicklung dazu, auch Lustlosigkeit, Überforderung oder Selbstzweifel sind häufig und müssen nicht sofort als krankhaft gewertet werden. Auch in diesem Alter kann ein Leistungsabfall in der Schule ein Zeichen für Depression sein, zusammen mit einem verlangsamten Denken, Apathie, Grübeln und Zukunftsängsten.
Grundsätzlich lässt sich beobachten, dass sich die Symptomatik mit zunehmendem Alter von eher körperlichen Symptomen wie Bauchschmerzen zu kognitiven wie Grübeln und Zukunftsangst verschiebt. Bei jüngeren Kindern sollte das Ess- und Spielverhalten beobachtet werden, bei älteren eher die schulischen Leistungen. Empfehlenswert ist dabei auch, alle Bezugspersonen im Elternhaus, in der Schule oder im Kindergarten mit einzubeziehen. An dieser Stelle ist es wichtig zu betonen, dass ein depressives Kind nicht aus bösem Willen die Eltern oder Lehrkräfte ärgern will oder faul ist und sich nicht für die Schule interessiert. Es ist vielmehr psychisch krank und braucht Hilfe.
Eine Depression des Kindes sagt erst einmal nichts über die elterlichen Fähigkeiten aus, daher ist es kein Grund, daran zu zweifeln. Vielmehr ist es ein Grund, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Leider kommt es immer noch in manchen Familien zu einer Stigmatisierung von psychischen Erkrankungen, dies sollte aber auf keinen Fall einer professionellen Behandlung im Wege stehen.
Verlaufsformen
Wie lange dauert eine Depression? Typischerweise verlaufen Depressionen episodisch, die Krankheitsphasen sind zeitlich begrenzt. Eine Depression kann dabei abhängig vom Schweregrad auch ohne therapeutische Maßnahme wieder abklingen, eine durchschnittliche Erkrankungsdauer wird auf sechs bis acht Monate geschätzt [33]. Eine wirksame Behandlung verkürzt die Dauer der Depression auf etwa drei Monate [34]. Der individuelle Verlauf kann sehr unterschiedlich sein:
Depressive Episode mit vollständiger Remission – die Symptomatik klingt vollständig ab, es bestehen keine Beschwerden mehr.
Depressive Episode mit unvollständiger Remission – es kommt zu einer deutlichen Besserung der Symptomatik, es besteht aber eine Restsymptomatik.
Rezidivierende Depression – im Verlauf kam es zu mindestens zwei depressiven Episoden.
Dysthymie – besteht über zwei Jahre eine depressionsähnliche Symptomatik, die aber nicht die Kriterien für eine Depression erfüllt, spricht man von Dysthymie.
»Double Depression« – entwickelt sich auf dem Boden einer Dysthymie eine depressive Episode, spricht man von einer Double Depression.
Chronifizierte Depression – die depressive Episode dauert länger als zwei Jahre.





























