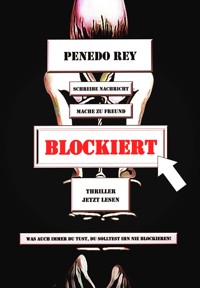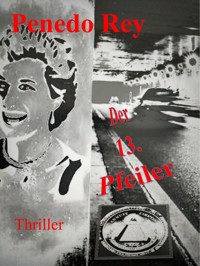
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Ist Lady Di wirklich bei einem Autounfall gestorben oder wurde sie im Auftrag der Illuminaten getötet? Mit dieser Frage beschäftigt sich Martin Schenkenberg eines Tages, als ihm über einen Freund Bild- und Textmaterial vom letzten Moment im Leben von Lady Di angeboten wird. Das kommt dem ehemaligen Journalisten, der seit seine Ausscheiden bei der Zeitung seinen Lebensunterhalt mit dem Schreiben von Blogs finanziert nur recht, da er für seine Anhängerschaft im Internet dringend einen richtig guten Knüller braucht um mehr Leser zu erreichen. Dass er damit jedoch direkt ins Fadenkreuz der Illuminati gerät erfährt er erst, als es fast schon zu spät ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 490
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Für Matthias
Ebenfalls vom Autor erschienen:
Der Seher 2022
Der 13. Pfeiler
Von Markus Penedo Rey
Prolog
30. August 1997
Es sollte ein schöner Abend für sie werden und in gewisser Weise war er das bestimmt auch, wären da nur nicht diese lästigen Paparazzi, die sie in fast jeden Moment ihres Lebens bedrängten. Dodi, charmant wie immer, hatte ihr Komplimente über ihr Aussehen gemacht. Die Schwangerschaft würde sie noch schöner machen, als ohnehin schon, hatte er gesagt. Sie hatte ihn dafür mit einem Lächeln belohnt, wie sie es immer tat, seitdem sie sich bei einem Polo-Spiel auf Windsor kennengelernt hatten.
An Speisen hatte sie etwas Leichtes gewählt – eine Suppe und anschließend Salat -, um ihren eh schon nervösen Magen so wenig wie möglich zu strapazieren.
Nun lief sie hinter ihm her zum Hinterausgang des Pariser Hotels Ritz, wohin der Parkservice den Wagen bringen sollte. Um die Wartezeit zu überbrücken, schmiegte sie sich an ihm, suchte seine Nähe, erfreute sich des Glücks mit ihm. Doch kaum hatte sie den Kopf an seine Schulter gelegt, vermeldete der Chauffeur das Eintreffen des Wagens. Kaum umwehte die kühle Nachtluft ihre Nase, begrüßte sie einmal mehr das Blitzlichtgewitter der Paparazzi, das, seit sie in die Königsfamilie eingeheiratet hatte, zu ihrem ständigen Begleiter geworden war. Diesen sensationslüsternen Frauen und Männern verdankte sie nicht zuletzt ihren depressiven Zustand. Schützend hielt sich Lady Di die Hand vors Gesicht, wollte, dass es aufhörte. Dodi schottete sie so gut ab, wie er konnte, während ihr Leibwächter bereits die hintere Wagentür offenhielt. Schnell huschten sie ins Wageninnere, Dodi voraus, Lady Di hinterher, was die Paparazzi nicht daran hinderte, sich um die schwarze Mercedeslimousine zu positionieren, wie Aasgeier auf der Suche nach dem besten Stück Fleisch, oder wie in diesem Fall, auf der Jagd nach dem besten Foto.
Diana versteckte sich hinter der Kopfstütze des Vordersitzes, auf dem ihr Leibwächter Platz genommen hatte. Die Prinzessin saß hier am liebsten, weil in den meisten Fällen die Fotos von der Fahrerseite gemacht wurden.
Endlich fuhr die Limousine an, was die Paparazzi wiederum nicht im Geringsten störte, ohne Rücksicht auf Verluste oder dem Wohlbefinden der Prinzessin weiter auf den Auslöser zu drücken.
Der Fahrer, Henri Paul, trat das Gaspedal durch und rauschte in die Nacht. Ziel: Dodis Pied-à-Terre in der Rue Arsène-Houssaye, einer ruhigen Straße in einer Wohnsiedlung in Paris. Einst starb in diesem historischen Gebäude Philippe Henri Delacroix-Durrieux, mutmaßlicher Sohn von Leopold II. von Belgien und seiner damaligen nicht ebenbürtiger Geliebten Blanche Delacroix.
Ein Omen? Ein Fluch? Wer wusste das schon? Dodi Al-Fayed am allerwenigsten.
Motoren heulten auf. Die Paparazzi rasten auf Motorrollern und Motorrädern in einer beispiellosen Hetzjagd der Limousine hinterher, die auf über einhundert Kilometer pro Stunde beschleunigte, bis es im Alma-Tunnel zu dem in aller Welt bekannten Unglück kam …
Der weiße Fiat, der die Limousine kurz zuvor abgedrängt haben soll, wurde nie gefunden.
Kapitel 1
22. November 2023
Die heiße Dusche tat ihm gut, besonders da es die letzten Tage enorm abgekühlt hatte. Während er das heiße Nass auf seinen Körper prasseln ließ und er jeden Zentimeter seines Körpers wusch, machte er sich Gedanken, was er in seinem neuesten Blog zum sechzigsten Todestag von John F. Kennedy schreiben sollte.
Seit seiner frühesten Jugend faszinierte ihn dieses Attentat auf den US-Präsidenten nicht nur wegen des Films von Oliver Stone, sondern wegen der Widersprüche, die heute noch die ganze Welt beschäftigt. So auch Martin Schenkenberg, der sein morgendliches Ritual beendete und aus der Dusche auf den Vorleger trat.
Schon oft hatte er überlegt dieses Ding mit seinen japanischen Schriftzeichen wegzuwerfen, da es ihn viel zu sehr an seine gescheiterte Beziehung mit Kimiko Lee erinnerte. Der Name Kimiko bedeutete die Einzigartige, und das war sie wirklich. Nie hatte er eine wie sie kennengelernt. Sie war nicht nur wunderschön anzusehen, sondern besaß zudem noch Witz. Mit ihr hatte er nächtelang Lachen können, nur am Ende war ihr das Lachen vergangen, als er seinen Job als Journalist bei der Zeitung gekündigt hatte, um mehr Zeit für seine Podcasts und seine Blogs zu haben. „Wie konntest du einen sicheren, gut bezahlten Job für diesen Quatsch kündigen?“, hatte sie ihn vorgeworfen. Sie hatte einfach nicht verstanden, dass er kein „Werkzeug“ mehr sein wollte für die verlogene Medienwelt. Das wollte er lieber anderen überlassen, die kein Problem damit besaßen sich instrumentalisieren zu lassen. So wie diesen Speichellecker Fin Becker. Fin war der Typ, der seine Großmutter verkaufen würde, wenn der Preis stimmt. So wollte Martin nicht enden, zumal er seine Großmutter liebte. Gott hab sie selig.
Nachdem Martin sich abgetrocknet und angezogen hatte, ging er geradewegs durch den Flur in sein Arbeitszimmer, vorbei an dem Kratzbaum von Bruce Lee, dem Kater von Kim, den sie bei ihrem Auszug selbstverständlich mitgenommen hatte. Warum sie allerdings das Katzenspielzeug zurückgelassen hatte, verstand er genauso wenig wie ihren Entschluss für die Trennung, zumal sie sich im Bett und außerhalb wirklich hervorragend verstanden hatten. Sogar mit dem Kater hatte er sich nach anfänglichen Schwierigkeiten mehr und mehr angefreundet. Das kleine nervige und hochnäsige Fellknäuel hatte es tatsächlich geschafft, ihn um den kleinen Finger zu wickeln, und Martin nahm es diesen pelzigen Kameraden überhaupt nicht mehr übel, dass er statt des Katzenklos seine Schuhe benutzt hatte. Die anfängliche Abneigung hatte wohl auf Gegenseitigkeit beruht. Mit dessen Weggehen samt Frauchen blieben Martin nur noch Rocky und Rambo: seinen beiden kleinen grünen Wasserschildkröten. Rechts und links von diesem mannshohen Ungetüm von Kratzbaum hingen Fotos aus glücklicheren Tagen. Eines zeigte ein Selfie auf dem Nürnberger Volksfest, auf dem sie ihm ein Küsschen auf die Wange drückte; ein anderes zeigte sie eng umschlungen in ihrem gemeinsamen Italienurlaub vor dem Kolosseum in Rom, und in einem weiteren Bilderrahmen befand sich aus einem Passbildautomaten ein Fotostreifen, auf dem sie auf vier darauffolgenden Fotos die ein oder andere Grimasse schnitten.
Im Arbeitszimmer zwischen schmutzigen Tellern und benutzten Kaffeetassen stand sein Laptop, der bereits lief. Über der integrierten Webcam war ein Klebestreifen angebracht. NSA lässt grüßen! Hinter dem Laptop stand Paul, eine etwa fünfunddreißig Zentimeter hohe Figur eines Außerirdischen mit kurzen Hosen, der ein Peace-Zeichen zeigte. Paul war nicht etwa einer dieser hässlichen Außerirdischen wie man sie aus den meisten Filmen kannte, nein, Paul war einer derjenigen, die in Fachkreisen den Namen „Die Grauen“ tragen. Graue Haut, großer kahler Kopf mit ellipsenförmigen großen schwarzen Augen und dünnen Gliedmaßen.
Einige Poster von Bands wie Metallica und VolBeat schmückten eine der Wände. Gegenüber den Postern standen zwei Regale vollgestopft mit Büchern. Einige davon behandelten Verschwörungstheorien um die Neue Weltordnung, wieder andere gingen um OFOs, weitere um Freimaurerlogen und ein paar wenige setzten sich mit dem Kennedy-Attentat auseinander. Es war eben Martins Reich, und das war es immer schon gewesen, selbst als Kim noch hier gewohnt hatte. „In diesem Schweinestall mache ich nicht sauber“, hatte sie immer wieder betont. Das wiederum hatte Martin kein einziges Mal von ihr verlangt.
Jetzt wo ihm ihre Worte wieder einfielen, nahm er die Teller und die Tassen und trug sie in die Küche, wo er sie sogleich in die Spülmaschine einräumte, und nicht etwa obendrauf, woran sich Kim ebenfalls immer gestört hatte. Ebenso an seine vollen Aschenbecher, die beinahe vor jedem Fenster standen. Im Grunde galt nur das Schlafzimmer als raucherfreie Zone.
Für Martin gehörte das Schreiben und das Rauchen einfach zusammen. Es war schon schlimm genug für ihn gewesen, dass er nicht im Verlag hatte rauchen dürfen, stattdessen hatte er kiloweise Schokolade gefuttert. Irgendwas brauchte das Gehirn schließlich um während des Schreibens einwandfrei zu funktionieren: Schokolade, Kaffee und Zigaretten. Nicht gerade die gesündesten Energiebringer, das wusste er selbst, aber konnte nicht widerstehen.
Martin nahm den Aschenbecher vom Fensterbrett, entleerte ihn in den Müll, öffnete das Fenster und zündete sich eine Zigarette an. In der Morgenluft lag der Geruch von Sauerbraten, der eindeutig aus der Küche der alten Frau Brecht von oben drüber kommen musste, woraufhin Martin ein sehnsüchtiges Gesicht machte. Keine Oma mehr, keine Kim mehr, ich bin verdammt, dachte er sich. Und die beiden hatten gut gekocht. Wobei es Kim heute bestimmt immer noch tat. Ob sie in diesem Moment für einen anderen Kerl kochte? Martin wollte gar nicht darüber nachdenken, denn er liebte sie noch immer.
„Wie konntest du nur deinen Job kündigen?“, hallten ihre Worte in seinen Ohren nach. „Wovon willst du denn jetzt leben?“
„Von den Werbeeinnahmen für meine Blogs und meine Podcasts“, hatte er daraufhin erwidert.
„Es gibt echt jemand, der bei sowas Werbung schaltet?“
„Ja, und das gar nicht mal schlecht. Immerhin habe ich 100.000 Abonnenten.“
„Und wer bitte sind diese Leute, die da Werbung machen? Die Men in Black?“
„Sehr witzig, Kim, du weißt genau, die gibt es nur im Film.“
„Aber wolltest du nicht ein Buch schreiben?“
„Ja, das mach‘ ich ja auch noch.“
„Und wann das?“
„Wenn ich genug Material zusammen habe.“
„Etwa über den Quatsch, über den du in deinen Blogs schreibst?“
„Das ist kein Quatsch!“
Stundenlang hatten sie diskutiert, wieder und wieder und immer wieder, bis zu dem Tag, an dem Kim ihre Koffer gepackt hatte.
„Ich will mit diesen Illuminatenmist nichts zu tun haben!“, waren ihre letzten Worte gewesen. Dann hatte sie ihn verlassen.
„Illuminatenmist“, wiederholte Martin, während er am offenen Fenster stand und auf den Hinterhof hinaussah, wo Frau Senftleben von schräg gegenüber ihre Wäsche aufhing. Wäsche aufhängen bei dieser Kälte, dachte sich Martin, als ihn eine Gänsehaut überkam. Ob das was wird?
Frau Senftleben trug wie so oft einen blauen Wickelkittel, wie in heutzutage kaum jemand noch tragen würde, außer Frau Brecht vielleicht noch.
Martin kam der Gedanke, dass er auch mal wieder Wäsche waschen müsste. Die Jogginghose, die er Tag wie Nacht trug, war gute zwei Wochen alt. Nicht ganz so alt wie das T-Shirt. Einmal mehr musste er sich eingestehen, dass mit Kims Auszug irgendwie alles vor die Hunde ging. Na ja, nicht alles. Wenigstens wechselte er täglich seine Unterwäsche und duschte ebenso oft. Also war noch nicht alles verloren. Nur rasieren könnte er sich mal wieder, stellte er fest, als er sich mit der Hand ans Kinn fasste, was er sogleich nachholen würde, sobald er mit seiner Zigarette fertig wäre. Er war der Meinung, er sähe immer so alt aus, wenn die grauen Haare zwischen den schwarzen aus seinem Gesicht wuchsen, dabei war er erst zweiundvierzig Jahre alt. Kim hingegen hatte es sexy gefunden. Einen Hauch von dem jungen George Clooney hatte sie es genannt.
Das Klingeln seines Handys riss ihn aus seinen Gedanken. Martin drückte die Zigarette aus, schloss das Fenster und ging ins Wohnzimmer, wo sein altes Samsung Galaxy noch von gestern Abend auf dem Couchtisch lag.
Im Wohnzimmer sah es nicht besser aus als im Arbeitszimmer. Die Socken vom Vortag lagen auf dem Teppich, der nach einem Staubsauger bettelte; eine Baumwolldecke hing halb auf der Couch und halb auf dem Boden und auf dem Couchtisch reihten sich die Kaffeetassen aneinander, daneben eine offene Tüte Kartoffelchips, die bereits seit Tagen nur noch für den Müll taugte und in der Luft hing der Geruch von kaltem Zigarettenrauch.
„Na, Alter, schon auf?“, quäkte die Stimme von Manni aus dem Handy.
„Wie spät haben wir es denn?“, fragte Martin, wobei er es sich denken konnte. Wenn Frau Brecht kochte, musste es in etwa zehn Uhr sein, da sie um elf Uhr zu Mittag aß.
„Ob Wochenende oder nicht, ich frühstücke jeden Morgen um sechs Uhr und Mittag gibt es bei mir schon um elf“, hatte sie ihm mal erzählt, nur in welchem Zusammenhang das stattgefunden hatte, das war ihm entfallen.
„Wir haben viertel elf“, erwiderte Manni mit einem Lachen. „Hattest du noch keinen Kaffee?“
„Noch nicht“, seufzte Martin. Er und Manni hatten sich vor etwa fünf Jahren auf der Frankfurter Buchmesse kennengelernt, als Manni in einem Verschwörungsthriller von Dan Brown geschmökert hatte. Der Ex-Informatiker und angehender Schriftsteller war mit seiner Leibesfülle auch nicht zu übersehen gewesen. Kunststück, wenn man sich ausschließlich fast nur von Fast-Food und Cola ernährte. Ein oder zwei Big Mac mit Pommes und dem schwarzen Zuckergetränk, was zusammengenommen weit über 1.500 Kalorien ergab – was soll’s?! Martin hatte ihn im Gedrängel der Buchmesse aus Versehen angerempelt, so waren sie ins Gespräch gekommen.
„Dann wird es aber Zeit, mein Alter“, entgegnete Manni. „Mit einem Kaffee kommt dein Gehirn besser auf Touren, was du brauchen wirst, wenn du weißt, welchen Tag wir heute haben?“
„Natürlich weiß ich das“, sagte Martin nachdenklich. „Oder hast du gedacht, ich würde das vergessen?“
Manni lachte. „Nein, nicht wirklich. Worüber wirst du schreiben?“
„Über Kennedy. Über wen sonst?“
„Ja, schon klar, aber worüber genau? Ich wünsche Details zu erfahren.“
Martin sah nachdenklich aus dem Wohnzimmerfenster auf den Verkehr hinunter, der sich mal wieder wegen der Baustelle in „seiner“ Straße am Haus vorbei staute. Beim Anblick eines augenscheinlich älteren Paares in einem Cabrio überkam ihm erneut ein Kälteschauer mit ausgeprägter Gänsehaut. Früher hatte er irgendwie mehr ausgehalten, doch mit Kim war auch der Drang, täglich an die frische Lust zu gehen, verschwunden. Ob gutes oder schlechtes Wetter, diese Frau war einfach keine Nesthockerin. „Lass uns in den Park gehen! Lass uns ins Bad gehen! Lass uns in die Stadt gehen! Lass uns …!“ Sie konnte einfach niemals ruhig sitzen bleiben. Vielleicht war sie deswegen nicht einer dieser Frauen, die noch bei dreißig Grad über kalte Füße klagen. Sie hatte jedenfalls kein einziges Mal irgendetwas in dieser Richtung geäußert. Einen Menschen mit einer derart guten Durchblutung nennt man im Volksmund einen wandelnden Heizofen. Einen Umstand, den Martin beneiden würde, hätte er da nicht ganz andere Probleme.
Worüber sollte er schreiben, worüber er noch nicht geschrieben hatte?, grübelte er. Er besaß einfach keinen Schimmer. Manni hatte recht, was den Kaffee anging, ohne Benzin im Tank ging einfach nichts.
„Warum lässt du dich nicht einfach überraschen?“
„Das wird aber nicht wieder so ein Blog, indem du behauptest, dass JFK geheime UFO-Dokumente preisgeben wollte, oder doch?“
Martin seufzte.
„Nur weil du nicht daran glaubst, kann ich es doch tun.“
Es entstand eine Pause, bevor Manni sagte: „Natürlich kannst du das. Meinetwegen glaubst du auch an das Monster von Loch Ness, aber ich glaube nun mal nicht daran.“
„Meinen Lesern hat es aber anscheinend gefallen.“
„Wie dem auch sei … Aber mal was anderes: Ich habe kürzlich Kontakt geschmiedet zu jemanden aus England. Du weißt schon, dem Land mit den Royals?“
Martin durchschritt das Wohnzimmer und nahm vom Couchtisch sein Etui mit den selbstgestopften Zigaretten und den vollen Aschenbecher und ging zurück an Fenster, das er sogleich öffnete. Autolärm drang an seine Ohren und irgendwer hupte.
„Fahrt halt mal zu!“, schrie irgendwer dort unten inmitten des Chaos.
„Ich weiß um England, Manni“, entgegnete Martin, „du musst mich nicht aufklären. Was ist damit?“
„Sagt dir der Name Jean Paul Andason was?“, fragte er plötzlich mit einem ernsten Ton in seiner Stimme.
Martin blies den Zigarettenrauch in die kühle Morgenluft und sah zum grauen Himmel auf, der kein bisschen blau oder einen Sonnenstrahl zeigte. Eine trübe, grau-schwarze Suppe, hätte seine Oma gesagt.
„Kenne ich nicht. Was ist mit dem?“
Ein Schlürfen kam aus der Leitung. Manni musste demnach aus einer Dose trinken.
„Du kennst ja schon niemanden, Martin! Das war einer der Paparazzo, die angeblich Lady Di in den Tod gehetzt haben sollen.“
„Okay … und was ist mit dem?“
„Na zum einen ist er bereits seit dreiundzwanzig Jahren tot ...“
„Sag bloß … und was soll ich nun damit anfangen?“
„Jetzt warte doch mal! Du wirst nie erraten, wie er gestorben ist.“
Martin blies aus. Er war ein Freund klarer Worte und hasste dieses Rätselraten, nur leider musste er diesen dicken Typen schon immer alles aus der Nase ziehen.
„Na sag‘ schon, hat er sich mit dem Blitzlicht seiner eigenen Kamera getötet?“
„Immer für einen Scherz gut, Martin. Nein, es war angeblich Selbstmord.“
„Wieso angeblich?“
„Na ja, wie viele Leute fahren in den Wald und zünden sich an?“
Martin blies aus und drückte anschließend die Zigarette im Aschenbecher aus. Die Zeiten, in den er die Kippen einfach auf die Straße geschnippt hatte, waren ein für alle Mal vorbei, nachdem er von einem Langzeitprojekt in einem Park mitbekommen hatte, wie lange so eine Kippe braucht um zu verwesen.
„Nicht viele, schätze ich.“
Manni schlürfte erneut an seiner Dose. Entweder das, oder die Leitung besaß eine Störung.
„Ja, eben … und dieser Andason soll sich angeblich … ja … in seinem Auto selbst verbrannt haben. Das stinkt doch zum Himmel, oder wie siehst du das?“
Ein Blick auf seine Füße verriet Martin, warum es ihm so schweinekalt war. Er trug weder Socken noch seine Crocs. Er betätigte die Lautsprecherfunktion seines Handys, legte es auf den Couchtisch, nahm die Socken vom Vortag vom Boden und zog sie an. Vornübergebeugt mit seinem Hintern auf der Couch sprach er ins Handy: „Jedenfalls ist es eine ungewöhnliche Tötungsmethode um sich selbst umzubringen.“
Wieder war da dieses Schlürfen in der Leitung, das über Lautsprecher noch ekelhafter klang.
„Worauf du einen lassen kannst, Martin. Ich persönlich würde Schlaftabletten bevorzugen, wenn ich es tun würde, aber mich ganz bestimmt nicht bei lebendigem Leib selbst anzünden.“
„Bei unlebendigem Leib geht das ja auch etwas schlecht … mit dem selbst anzünden jedenfalls.“
„Ach, Martin, du bist schon echt eine Knalltüte. Aber wo du recht hast, hast du recht.“
„Nur weiß ich jetzt immer noch nicht, was ich damit anfangen soll.“
„Dann halt dich mal gut fest, Martin, denn es hat sich jemand bei mir gemeldet, der von Lady Di’s Unfall Fotos haben will, die umgehend nach dem angeblichen Unfall entstanden sind, und diese sollen von unserem toten Paparazzi Andason sein.“
Dieses ständige Geschlürfe hatte Martin selbst durstig gemacht, weswegen er das Handy aufnahm und in die Küche ging, wo eine halbvolle Flasche Wasser stand. Die Nacht und die Unterhaltung mit Manni hatten ihn ausgetrocknet. Vor allem aber die Nacht. Gierig nahm er mehrere Schlucke bevor er die Flasche absetzte.
„Okay … und was zeigen die Bilder?“
Manni kicherte gekünstelt, ehe er sagte: „Jedenfalls ein ganz anderes Auto, als das, was uns die Medien gezeigt haben.“
Martin könnte diesen Knallkopf durchs Handy ziehen. Was sollte dieses ewige Drumherumgerede?
„Also ich spiel‘ dein Spiel mal mit. Wieso ein anderes Auto?“
Wieder dieses gekünstelte Gekicher.
„Na ja, nicht direkt ein anderes Auto … schon dasselbe … aber in einem viel unversehrteren Zustand.“
Im Hof nahm Frau Senftleben in Windeseile ihre Wäsche wieder ab, da es begonnen hatte zu regnen. Wem hätte das schon bei diesem grauen Himmel gewundert? Martin wäre dieses Risiko jedenfalls nicht eingegangen. Oben klapperte Frau Brecht mit Besteck und Tellern. Demnach räumte sie ihre Spülmaschine aus.
„Wie unversehrt? Jetzt komm mal auf den Punkt!“
„Du bist aber auch schon immer ungeduldig“, merkte Manni an.
„Hallooo? Keinen Kaffee!“
„Ach, stimmt ja. Ich hab dir doch gesagt, du sollst dir einen Kaffee machen.“
„Wenn du mich hier stundenlang zutextest.“
„Hallooo? Freisprecheinrichtung!“
Martin schnaufte geräuschvoll.
„Jetzt sag‘ schon wie unversehrt?“
Ein weiteres Schlürfen. Wann ist die Dose endlich leer?
„Meine Quelle sagt …“
„Ach, du hast schon Quellen?“, fiel ihm Martin ins Wort.
„Ja, meinst du, du bist der Einzige mit Kontakten?“
„Also, sprich!“
„Meine Quelle sagt, die Motorhaube von Dianas Limousine ist noch lange nicht so verbeult wie in den Medien.“
***
Mit seinem müden Kopf und dem kräftezehrenden Gespräch mit Manni fiel es Martin schwer, sich die Bilder der Mercedeslimousine ins Gedächtnis zu rufen, die er sehr wohl auch kannte. Er ging ins Arbeitszimmer und rief die Bilder auf seinem Laptop auf. Keine Sekunde später wurde ihn ein total zerstörtes Auto gezeigt, der Motorraum auf die Hälfte zusammengeschoben.
„Okay, ich habe das Bild jetzt mal auf meinem Laptop. Du sagst also, die Motorhaube ist noch lange nicht so verbeult wie auf den Bildern … was genau bedeutet das?“
„Ich selbst habe die Bilder noch nicht gesehen. Meine Quelle will Cash dafür sehen.“
Der Bürostuhl quietschte und stöhnte, als sich Martin zurücksinken ließ. Die Uhr am Laptop zeigte 10:33 Uhr. Um diese Uhrzeit trank er für gewöhnlich seine zweite Tasse Kaffee.
„Über wie viel Geld reden wir da?“
„Zehntausend englische Pfund.“
Martin pfiff durch die Zähne. Zehntausend englische Pfund! Wo sollte er das Geld hernehmen? Flink rief er einen passenden Umrechner im Internet auf und gab die Summe ein. Elftausendfünfhundertdreiundneunzig Euro und einundachtzig Cent! Das müsste sein ganzes Erspartes sein.
„Wieso geht deine Quelle damit nicht an die Zeitung? Da bekäme er bestimmt Millionen.“
„Martin, das weißt du doch am besten. Soll er etwa an dieselben Medien gehen, die in solchen Dingen immer nur lügen? Da kann er sich gleich selbst einen Kopfschuss verpassen.“
„Auch wieder wahr“, gestand sich Martin ein. „Hast du die Bilder gesehen?“
Es entstand eine kurze Pause, ehe Manni antwortete.
„Nein, das nicht. Ich hab nur mal mit ihm gechattet … auf Englisch versteht sich.“
„Wie ist er überhaupt an die Bilder gekommen? Ich habe hier gerade gelesen, dass die Polizei deinen Andason direkt nach dem Unfall festgenommen haben. Die werden doch die Kamera und die Bilder beschlagnahmt haben, oder nicht?“
„Wie Andason das gemacht hat, weiß ich auch nicht. Vielleicht hat er sich den Film in den Arsch geschoben, was weiß ich? Die Bilder und weitere Dokumente will meine Quelle jedenfalls aus einer Lagerraumauktion erstanden haben.“
Martin legte die Stirn in tiefe Falten.
„Einer was? Sag bloß, deine Quelle hat die Bilder auf einem Flohmarkt erstanden?“
Manni lachte. „Doch nicht auf einen Flohmarkt, Mann! Einer Lagerraumauktion. Noch nie davon gehört? Da können Leute wie du und ich so ´ne Art Überraschungseier kaufen. Kartons und Koffer und so weiter … die kaufen, ohne zu wissen, was da drin ist.“
Bei Martin fiel der Groschen. Er glaubte das amerikanische Format schon mal im Fernsehen gesehen zu haben.
„Ah ja …“
„Ja … und meine Quelle hatte eben eine dieser Lagerräume beziehungsweise den Inhalt aus einem dieser Lagerräume gekauft.“
„Verstehe. Und nun will deine sogenannte Quelle den – ich nenne es mal Kram – für zehntausend englische Pfund verkaufen?“
Ein weiteres Schlürfen, worauf anschließend ein Krachen ertönte, als würde Manni anfangen Kartoffelchips zu futtern.
„Das ist korrekt“, sagte er mit vollem Mund.
„Warum kommst du damit zu mir?“
„Wen sollte ich es sonst erzählen? Außerdem dachte ich, dass es voll dein Ding ist.“
„Dachtest du?“, entgegnete Martin mit einem schiefen Grinsen. „Könnte es vielleicht daran liegen, dass du, mein lieber Freund, keine zehntausend Pfund hast?“
Wieder ein Krachen. Der Kerl isst tatsächlich während wir telefonieren.
„Ja, daff auch.“
„Manni?“
„Ja?“
„Du bist ´ne echte Sau!“
„Wieso?“, fragte er unschuldig.
„Na, weil du frisst wie ´ne Sau, während wir hier quatschen.“
„Forry …“
***
Blog zu Kennedys 60. Todestag
Liebe Leserinnen und Leser,
heute jährt sich das Kennedy-Attentat zum sechzigsten Mal und ich wollte diesen Tag nicht verpasst haben, um mich erneut mit dem Attentat auseinanderzusetzen.
Wieder einmal möchte ich Euer Augenmerk auf den Abraham-Zapruder-Film lenken, der den Mord an John F. Kennedy für die Ewigkeit festgehalten hat.
Sehen wir uns doch mal den Fahrer, den Secret Service Agent William Robert Greer und dessen Beifahrer an. Wenn man sich die beiden betrachtet, möchte man fast den Eindruck gewinnen, als würden sie mit eingezogenen Köpfen (demnach waren sie sich nach dem ersten Schuss längst der Gefahr bewusst gewesen) miteinander diskutieren, wann endlich einer der Schützen den finalen Treffer landen würde. Nein? Tatsache ist jedenfalls, dass William Greer nach dem ersten Schuss anstatt zu beschleunigen, sogar noch abgebremst hat. Wusste also Greer, wo der finale Kopfschuss erfolgen sollte? Jedenfalls haben mehrere der damaligen Augenzeugen Greer für das Abbremsen und das damit verbundene Fehlverhalten kritisiert. Fehlverhalten deswegen, weil Secret Service Agenten speziell darauf trainiert sind, in Gefahrensituationen besonders schnell zu reagieren. Greer hat selbst dann nicht reagiert, als Gouverneur Connally, der schräg hinter ihm saß, geschrien hat: „Mein Gott, sie bringen uns alle um!“ Es sei erwähnt, dass zu diesem Zeitpunkt Kennedy wie auch Gouverneur Connally zwar schon verwundet war, aber noch gelebt hat. Erst als der finale Kopfschuss Kennedy das Hirn im wahrsten Sinne des Wortes herausgeblasen hat, hat Greer endlich mal nach langen Sekunden reagiert, und auch erst dann, als die First Lady, Jackie Kennedy, über den Kofferraum flüchten wollte. Ich behaupte, Spezial Agent William Robert Greer hatte es gewusst. Er war eingeweiht gewesen. Und wenn dem so ist, dann kann man einfach nicht umhin, dass der Secret Service in das Attentat involviert gewesen war. Special Agents, die den Präsidenten eigentlich beschützen sollten hatten ihn verraten!
Greer hat sich im Nachhinein aufgrund der Kritiken der damaligen Augenzeugen bei der damaligen First Lady Jackie Kennedy für sein Fehlverhalten entschuldigt. Als ob sie sich davon noch hätte etwas kaufen können! Dass ihm dann noch erlaubt worden ist, den Leichnam des Präsidenten zu dessen letzten Gang zum Friedhof zu fahren, musste für diese Frau, die soeben in einem Horrorszenario ihren Mann verloren hat, der blanke Hohn gewesen sein. Apropos Hohn! Was musste diese arme Frau wohl gedacht haben, als sie im Nachhinein das Foto von Lyndon B. Johnson bei dessen Vereidigung in der Air Force One gesehen hat, auf dem im Hintergrund Congressman Albert Thomas den neuen Präsidenten mit einem Lächeln und einem Augenzwinkern gratuliert? Für jeden hier nachzusehen: https://www.dailymail.co.uk/news/article-5782341/Photos-Lyndon-B-Johnson-sworn-comforting-Jackie-Kennedy-two-hours-JFKs-death.html
Wer genau hinsieht, kann sogar erkennen, wie Lyndon B. Johnson das Lächeln erwidert, während unmittelbar nebendran Jackie Kennedy vollkommen fertig mit der Welt noch immer in ihrer blutbefleckten Kleidung steckt. Pietätloser ging es wohl wirklich nicht mehr! Aber was wichtiger ist: Sind diese beiden etwa Mitverschwörer oder zumindest Mitwisser an dem Attentat gewesen?
In den vorangegangenen Blogs habe ich Euch auf den Bretterzaun aufmerksam gemacht, der sich zur Rechten Kennedys oben auf dem Grashügel befand. Dieser besagte Bretterzaun war geradezu der perfekte Platz für einen Kopfschuss von vorne. Schauen wir uns dazu John F. Kennedy selbst an. Sein Kopf wird nach hinten links gerissen, der Schuss kam demnach von vorne rechts. Also vom Bretterzaun, was wiederum mehrere der damaligen dabei gewesenen Augenzeugen ausgesagt hatten. Das widerlegt den tödlichen Schuss aus dem Schulbuchlagerhaus, das hinter der Limousine mit dem Präsidenten liegt, wo sich angeblich Lee Harvey Oswald aufgehalten haben soll. Übrigens hat laut Jim Garrisons Werk – `On the Trail of the Assassins´, das mit dem deutschen Titel `Wer erschoss John F. Kennedy?´ erschienen war – Oswald an dem Tag des 22. November 1963 keine Waffe abgefeuert. Jedenfalls hat die Polizei laut Garrison nach der Festnahme von Oswald keine Schmauchspuren an dessen Händen gefunden, und das obwohl er an diesem Tag angeblich 7 Schüsse – 3 auf den Präsidenten und später auf seiner Flucht 4 auf den Streifenpolizisten Tippet – abgegeben haben soll! Wer Jim Garrison nicht kennt, er war der Staatsanwalt, der Ende der sechziger Jahre das Kennedy-Attentat überhaupt erst vor Gericht gebracht hat. Interessant hierzu auch der Film von Oliver Stone `JFK – Tatort Dallas´ mit Kevin Costner.
Was geschieht nach dem Kopfschuss? Greer gibt endlich mal Gas (War sein Job mit dem finalen Kopfschuss erledigt? Hatte er Order den Präsidenten nicht lebendig aus der Gefahrenzone zu fahren?). Hier endet der Zapruder-Film.
Greer fuhr in das vier Meilen entfernte Parkland Hospital, wo Kennedy um 12:35 Uhr ankam und sofort vierzehn Ärzte um sein Leben kämpften.
Ich frage Euch, was genau hatte es denn da noch zu kämpfen gegeben? Teile von Kennedys Gehirn waren nachweislich auf dem Kofferraum verteilt! Für jeden normal denkenden gibt es keine zweite Meinung: Das bedeutet den Tod eines Menschen!
Ganz interessant ist hierfür der Film Jackie aus dem Jahr 2016, in dem man am Ende des Streifens nachgestellt das riesige Loch im Kopf ihres Gatten und dessen verteiltes Gehirn auf dem Kofferraum sehen kann.
Aber wieder zurück zu den Wiederbelebungsversuchen an den 35. Präsidenten. Ich behaupte an dieser Stelle, dass John F. Kennedy nicht vor 13 Uhr sterben durfte. 13? War da nicht was? Ja, meine verehrten Leserinnen und Leser, da wären wir wieder bei den Illuminaten. In meinen im Vorfeld veröffentlichen Blogs habe ich auf die Visitenkarte der Illuminaten auf dem amerikanischen ein Dollarschein hingewiesen. Wir erinnern uns? Der Schriftzug Novus Ordo Seclorum unter der Pyramide ist Latein und bedeutet Neue Ordnung der Zeitalter oder auch Neue Weltordnung. Die Stufen der Pyramide bis einschließlich des Allsehenden Auges betragen genau 13 Stufen. Auf der rechten Seite des ein Dollar Scheins befindet sich ein Adler, der in der einen Klaue 13 Pfeile hält und in der anderen Klaue einen Zweig mit 13 Blättern. Über dem Adler befinden sich 13 Sterne.
Demnach musste John F. Kennedy genau um 13 Uhr sterben – keine Minute früher, keine Minute später – um den Freimaurern in der ganzen Welt eine Botschaft zu senden.
Zufall sagen hier manche? Dann schauen wir uns doch mal das Attentat auf dessen Bruder, Robert F. Kennedy an, der kaum als er die Vorwahl in Kalifornien gewonnen hatte, bei einer Liveübertragung im TV einem Attentat zum Opfer gefallen war. Die spätere Auswertung der Audiobände dieses Abends hat ergeben, dass auf Robert F. Kennedy dreizehnmal geschossen worden ist, obwohl die Waffe des Einzeltäters, Sirhan Bishara Sirhan, nur acht Patronen beinhaltet hatte. Demnach musste also ein zweiter Schütze anwesend gewesen sein, von dem aber bis heute jede Spur fehlt und nachdem nie gefahndet worden war. Die dunklen Machenschaften hinter den Kennedy-Morden hatten wohl geglaubt, dass sie nach dem Attentat auf John F. Kennedy der Weltöffentlichkeit einen weiteren durchgeknallten Einzeltäter präsentieren und Tatsachen und Zeugenaussagen außer Acht lassen können.
Dreizehn Schüsse live im TV! Wer von den Eingeweihten wusste, worauf er an diesem Tag sein Augenmerk richten sollte bzw. hinhören musste, hatte die Visitenkarte jedenfalls erkannt. Es sei vielleicht noch vermerkt, dass Sirhan Bishara Sirhan, der voraussichtlich bis zu seinem Lebensende im Gefängnis sitzen muss, bis heute seine Unschuld beteuert. Er gibt an, erst wenige Minuten nach dem Attentat wieder zu sich gekommen zu sein, so als hätte er unter Hypnose gestanden. Wie dem auch sei, zum Schluss möchte ich jedenfalls noch anmerken, verehrte Leserinnen und Leser, dass sich für meinen Geschmack, die Zahl 13 meines Erachtens ein bisschen zu oft wiederholt!
***
Es war nicht Martins bester Blog, aber er konnte damit leben. Jedenfalls war es besser, als dieses Jubiläum unkommentiert zu lassen. Und wenigstens hatte er mal angesprochen, was sich bisher, seiner Kenntnis nach zumindest, niemand zuvor getraut hatte. Jedenfalls redete er sich das ein. Dabei wusste er nur zu gut von zig Verschwörungstheorien rund um den Präsidenten und dessen Bruder. Er gehörte also keiner Minderheit an.
Wenn er doch nur eine Zeitmaschine besäße, dann wäre alles so viel einfacher. Doch würde er sich trauen, hohe Persönlichkeiten zu retten? Wahrscheinlich würde er bei dem Versuch dabei selbst umkommen. Und wenn nicht, wäre er der mit Abstand am verabscheuungswürdigste Mensch auf dem Planeten. Jedenfalls was die Geheimdienste anging. Doch die Frage war Science-Fiction.
Martin räumte die Spülmaschine ein, da er dringend saubere Kaffeetassen brauchte. Seinen heutigen Morgenkaffee hatte er aus einem Bierkrug trinken müssen, in dem schon lange kein Bier mehr gewesen war. Vieles hatte sich mit dem Auszug von Kim verändert, wobei ihm die plötzliche Alkoholabstinenz schon sonderlich erschien, normal müsste er jetzt erst recht trinken, doch ihm war nicht danach. Mit Kim waren ebenso die Freunde verschwunden, mit denen es schon mal gelegentlich ein feuchtfröhliches Besäufnis gegeben hatte. Vielleicht hatte es aber auch an seinen plötzlichen Stimmungsschwankungen gelegen. Wer möchte sich auf Dauer schon so einen Trauerkloß ansehen? Tja, wahre Freunde erkennt man wohl immer daran, ob sie mit einem durch dick und dünn gehen.
Wenigstens blieb ihm noch Manni. Der zwar zwei Autostunden weit entfernt wohnte, aber mit ihm konnte er wenigstens besser über gewisse Dinge reden, über die er mit anderen nicht reden konnte, und dies manches Mal bis spät in die Nacht. Sogenannte Verschwörungstheorien. Der Gedanke brachte ihn wieder auf das heutige Telefonat und der Preisvorstellung Mannis besagter Quelle. Zehntausend englische Pfund. Ein wahrhaft stolzer Preis. Nur was hatte er schon mit Prinzessin Diana und ihrer Verbindung zum Königshaus am Hut? Martin sah darin keine Verbindung zu den Illuminaten. Zugegeben dieser Selbstmord von diesen Jean Paul Andason war schon starker Tobak, in seinem Auto selbst in Brand gesteckt, wo er doch unzählige angenehmere Selbstmordmethoden hätte wählen können, nur reichte das Martin nicht aus, eine solche Summe hinzulegen, zumal er noch nicht einmal eine „Kostprobe“ gesehen hatte. Er würde einfach bei seiner kostenlosen Quelle dem Internet bleiben und dem, was er sich selbst zusammenreimte. Damit ließ sich immerhin gutes Geld mit Werbeeinnahmen verdienen.
Martin schaltete die Spülmaschine ein und vernahm gleich darauf das zufriedene Rumpeln des Geräts. Diese Errungenschaft eines modernen Zeitalters war für ihn ein Segen, da er von Hand abspülen nicht wirklich mochte. Bevor er zum Rauchen ans Fenster ging, leerte er den Aschenbecher in den übervollen Mülleimer. Hätte er noch seinen Job bei der Zeitung, könnte er sich ohne weiteres eine Putzfrau leisten.
Martin sah zu dem bewölkten aber sonnigen Himmel hinauf. Frau Senftleben wäre gut beraten gewesen, hätte sie mit ihrer Wäsche noch einige Stunden gewartet. Doch kaum als er an sie dachte, kam sie auch schon in den Hof gelaufen. Auf zum zweiten Versuch.
Die gute Frau Senftleben. Letztes Jahr hatte sie ihren Mann an der heimtückischen Krankheit Krebs verloren. Derselben Krankheit, an der auch William Robert Greer gestorben war. Hatte er damit bekommen, was er verdient hatte? Wer wusste das schon? Nach sechzig Jahren waren mit Sicherheit alle Hintermänner um die Verschwörung um John F. Kennedy schon längst tot. Oder wenn nicht tot, dann zumindest steinalt. Wie dem auch sei, mit jedem Jahr mehr wuchs mehr Gras darüber, trotzdem lebte die Legende um Lee Harvey Oswald, dem durchgeknallten Einzeltäter, weiter.
Der alte Herr Senftleben jedenfalls, der bei allem beliebte Heinz, hatte einen solchen Tod nicht verdient. Martin hatte ihn gelegentlich auf den Fluren des Hauses getroffen, wo er immer nett gegrüßt und Zeit für einen Plausch hatte. Angeln und Kegeln war seit jeher seine Leidenschaft gewesen und manches Mal hatte er Martin einen Fisch geschenkt, den dann Kim auf japanische Art köstlich zubereitet hatte. Ja, Kim konnte hervorragend kochen und ihre Kochkünste vermisste Martin beinahe so sehr wie ihre Wärme und ihr makellos schönes Gesicht.
Die kleine Frau Senftleben mit ihren einen Meter sechzig und ihren neunundsiebzig Jahren musste sich gut strecken, um an die Leine zu kommen, die an drei Metallkonstruktionen im Hof hing. Leine genug, damit mehrere Mieter gleichzeitig ihre Wäsche aufhängen konnten, was die Hausverwaltung gerne sehen würde, anstatt die nassen Sachen in der Wohnung aufzuhängen, zumindest hatten sie ihm das bei der Wohnungsbegehung gesagt.
In den Sommermonaten besaß Martin kein Problem damit, nur sah er in den kühleren Monaten keinen Sinn dahinter. Ob Wunsch oder nicht, er hängte seine Wäsche in der Wohnung auf, womit er bisher kein einziges Mal Ärger mit Schimmel bekommen hatte. Jetzt wo er darüber nachdachte und die alte Frau Senftleben dabei beobachtete, kam ihn wieder der Gedanke von heute Morgen in den Sinn. Jedenfalls sagte der Berg an Dreckwäsche wieder einmal, dass es an der Zeit wäre.
Martin drückte die Kippe in den Aschenbecher und schloss das Fenster. Sechs Zigaretten und noch kein Frühstück außer einem Krug voll Kaffee, sein Leben besaß wirklich keinerlei normale Struktur mehr.
Aus dem Brotkasten, ein Geschenk seiner Großmutter, nahm er zwei Scheiben Brot heraus, und öffnete mit der anderen Hand einen Hängeschrank, dem er einen Teller entnahm. Dann holte er sich aus dem Kühlschrank Margarine und Wurst und aus einer Schublade ein Brotmesser. Mit allem beladen ging er an den Wohnzimmertisch und schaltete den Fernseher ein. Die Nachrichten berichteten über einen weiteren Banküberfall in Nordrhein-Westfalen, der zweite in diesem Jahr. Wie bei den vorhergegangenen Banküberfällen auch schon hatte man ein Bekennerschreiben der Terrorgruppe `Rote rechte Hand´ zurückgelassen. Rote rechte Hand, oder besser gesagt ein Ableger der RAF, machte seit einigen Jahren bereits Schlagzeilen. In ihren Bekennerschreiben machten sie wie früher wieder einmal deutlich, dass sie nicht das Volk um ihr Geld bringen wollen, sondern das System. Nur in Gegensatz zu früher, wusste mit der neuen Generation niemand, wer sich hinter der Gruppe verbarg. So gab es zum Beispiel kein Kommando Andreas Baader oder Ulrike Meinhof oder soundso, nichts. Demnach konnten es sowohl im Untergrund verborgene, sowie Familienväter und -mütter oder der liebenswerte Nachbar von nebenan sein. Man wusste es einfach nicht. Sie waren Frauen und Männer ohne Gesichter.
Nachdem Martin fertig zu Mittag gegessen hatte – fürs Frühstück war es schon reichlich spät – trug er alles zurück in die Küche, wo er sich sogleich die volle Mülltüte nahm. Dann zog er den Schlüssel von der Wohnungstür ab und ging das Treppenhaus hinunter zu den Mülltonnen.
Draußen traf er auf Frau Brecht, die bereits von den Mülltonnen kam.
„Guten Tag, Herr Schenkenberg“, begrüßte sie ihn.
„Grüße Sie, Frau Brecht, ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass Sie mich Martin nennen sollen.“
„Das muss ich wohl vergessen haben. Ich vergesse ja so viel allerweil.“
„Das ist bestimmt nur eine Phase. Sie sind doch noch gut beieinander“, log er, um ihr im Angesicht der etwas nach vorn gebückten Haltung zu schmeicheln.
„Danke. Aber ich weiß zufällig, dass mit meinen achtundachtzig Jahren nichts mehr gut beieinander ist.“
„Ach, man ist immer so alt, wie man sich fühlt.“ Wenn das stimmt, muss ich heute sechzig sein, dachte sich Martin.
Frau Brecht machte eine wegwerfende Handbewegung.
„Genau dasselbe hat die junge Frau von der Sparkasse gestern auch gesagt, woraufhin ich gesagt habe: Na, Sie haben gut reden, Sie können doch nicht älter als fünfundzwanzig sein.“
Martin lachte.
„Was hat sie dann darauf gewusst?“
Mit nickendem Kopf sah Frau Brecht ihr Gegenüber spitzbübisch an. Ihre blaugrauen Augen glänzten dabei, als hätte sie in einem Krimi den Mörder überführt bevor es der Fernsehkommissar hätte tun können.
„Das sie neunzehn ist. Glaubt man das? Diese jungen Frauen sind heutzutage so aufgeschminkt, dass man nicht mehr weiß, ob sie Kinder sind oder schon erwachsene Frauen. In meiner Jugend hatte es so ein Geschmiere nicht gegeben, da war man von Natur aus schön oder auch nicht. Das haben alles die Amis und die Franzosen mitgebracht, das sage ich Ihnen.“
„Martin.“
„Mmh …?“
„Sie dürfen mich Martin nennen.“
Frau Brecht blinzelte mehrmals, in ihrem Gesicht ein großes Fragezeichen. Wo bin ich nun schon wieder mit meinem Kopf?
„Hab ich schon wieder Sie gesagt?“
„Ja, haben Sie“, erwiderte Martin mit einem sanften Lächeln.
Sie machte abermals eine wegwerfende Handbewegung.
„Das liegt bestimmt an diesen verrückten Zeiten, die wir haben. Jedes Mal, wenn ich zur Bank gehe, hab‘ ich Angst, dass dort ein Überfall stattfinden könnte. Haben Sie das mitbekommen, in den Nachrichten, von dieser roten rechten Hand?“
Martin nickte.
„Ich hab gedacht“, fuhr Frau Brecht fort, „die hätten damals alle Terroristen geschnappt und eingesperrt, jetzt laufen da schon wieder welche frei herum. Ich sag‘ Ihnen was: Der Adolf hätte die damals alle weggemacht.“
Mit einer Handbewegung, die etwas Endgültiges an sich hatte, durchschnitt sie die Luft.
Martin riss die Augen auf. So aufgebracht kannte er die gute Frau Brecht gar nicht. Gewiss sie war achtundachtzig und in diesem Alter ließ man ihr so einiges durchgehen, nur sollte sie nicht jedem gegenüber den Führer erwähnen. Martin allerdings nahm es gelassen, da er die alte Dame schon zu lange kannte. Schon mehrmals war er bei ihr zum Essen gewesen, wobei sie ihm von ihrem verstorbenen Mann, Sven, erzählt hatte. Die Stasi hatte Sven seinerzeit einkassiert und ins Stasigefängnis Hohenschönhausen gebracht, und das alles nur, weil er in seiner Stammkneipe etwas zu locker dahergeredet hatte. Die Stasi hatte wirklich überall ihre Ohren und ihre Spitzel gehabt. Als Sven dann nach einem Jahr Haft entlassen worden war, war nicht mehr derselbe gewesen; von seinem lebhaften Wesen ganz zu schweigen. In sich gekehrt war er kurz nach dem Mauerfall gestorben, und so hatte er sich an den „goldenen Westen“ und dem Niedergang des Kommunismus gar nicht so richtig erfreuen können.
Seit dem Tod ihres Mannes trug Frau Brecht schwarz, was sie nach eigener Aussage noch bis zu ihrem Tode tragen würde. Sven war ihre große Liebe gewesen und der Kommunismus hatte ihn zerstört.
„Hab‘ ich sie jetzt damit schockiert?“, fragte sie und legte ihre Hand auf die Brust, ihr Blick besaß etwas Eindringliches. „Mich hat die Vertreibung nicht gebrochen und der Kommunismus auch nicht, ich sage nach wie vor, was ich denke, und das bis zu meinem Tod.“
„Mir gegenüber dürfen Sie sagen, was Sie denken – und bis zu ihrem Tod ist es hoffentlich noch ein wenig hin“, erwiderte Martin, den allmählich die Kälte der kalten Novemberluft in die Knochen fuhr.
„Frieren Sie, Herr Schenkenberg?“
„Nein. Wieso? Sieht man das?“
„Und ob. Sie sind ja auch nur noch Haut und Knochen. Wollen Sie nicht mit nach oben kommen? Ich hab noch etwas von meinem Sauerbraten übrig. Ich hab mal wieder zu viel gekocht. Mein Sven hat ja immer so viel gegessen … jedenfalls bis zu seiner Inhaftierung. Wie dem auch sei, ich hab mir die Mengen – also die ich gekocht hab‘ – nie mehr abgewöhnt.“
„Das ist nett von Ihnen, Frau Brecht, aber ich habe soeben zu Mittag gegessen“, entgegnete Martin.
„Und was hat’s gegeben?“
„Brot mit …“
„Ach, papperlapapp Brot“, fiel sie ihm ins Wort und zog ihn mit sich mit. „Sie kommen jetzt mit und bekommen etwas Gescheites.“
Ehe er sich versah, war er auch schon oben in der Wohnung. Die Dachwohnung von Frau Brecht war geschmackvoll eingerichtet; jedenfalls für eine ältere Dame. Sehr gut erhaltene antike, aber robuste Möbel standen im Flur und im Wohnzimmer, die Küche war in Weiß gehalten, bis auf den Esstisch und den dazugehörigen Stühlen, die von Eichenholz stammen. Überall sah es wie geleckt aus, was Martin etwas beschämte. Er war gerade mal halb so alt wie die alte Dame, dennoch sah es bei ihm aus, als wäre eine Bombe hereingeflogen. Auf dem Herd standen zwei Töpfe, einer mit Klößen, der andere mit Fleisch und brauner Bratensoße. Auf einem Brett an der Wand dudelte ein Radio in leisen Tönen Schlagermusik vor sich hin. Das gekippte Fenster ließ kalte Luft herein.
Frau Brecht eilte so schnell es ihre von Krampfadern durchzogenen Beine zuließen ans Fenster, um es zu schließen.
„Ach, herrje, das Fenster hab ich ja schon ganz vergessen … ich mach‘ immer ein bisschen auf, nachdem ich gekocht habe … gleich wird’s warm, die Heizung läuft ja. Setzen Sie sich, setzen Sie sich. Kaffee?“
„Danke, Frau Brecht, aber ich will wirklich keine Mühe machen“, erwiderte Martin, der am Kopfende des Tisches Platz nahm. Auf dem Tisch lagen zwei Platzmatten passend zum Eichenton. In unmittelbarer Nähe stand ein Salz- und ein Pfefferstreuer in Hahnendekor auf einem kunstvoll gehäkelten Untersetzer, der wie selbstgemacht aussah.
Frau Brecht winkte ab.
„Das macht mir überhaupt keine Mühe … macht doch alles die Maschine. Außerdem kennt eine Frau, die einen Mann und drei Kinder durchgefüttert hatte, keine Mühen.“
„Ich wusste gar nicht, dass Sie drei Kinder haben.“
„Hab ich nie erzählt?“, fragte sie in einen spitzen und überraschten Ton.
„Nein. Ich habe zwar schon die letzten Male, die ich hier war, Bilder von Kindern an den Wänden gesehen, aber erzählt haben Sie nie davon.“
„Jetzt bin ich aber baff. Wo ich doch immer damit angebe …“, sie kicherte, „… dass ich schon Uroma bin.“
Martin machte ein erstauntes Gesicht.
„Uroma! Ja, meinen Respekt und Glückwunsch nachträglich.“
Sie winkte ab und widmete sich der elektrischen Kaffeemühle. Im Nu durchzog das Aroma von frisch gemahlenen Kaffeepulver die Küche. Wer benutzt heutzutage schon noch eine Kaffeemühle? Jedenfalls roch es zusammen mit dem Essen auf den Herd eben wie bei Großmutter.
„Beglückwünschen muss man mich dafür nicht mehr. Die Urenkel sind sogar schon alle in der Arbeit. Was Sie gesehen haben, waren alte Bilder. Die kommen mal weg, wenn die wieder Kinder bekommen. Mal sehen, vielleicht erlebe ich es noch, Ur-Uroma zu werden.“
Über so viel positiven Lebenswillen musste Martin lächeln. Gleichzeitig schämte er sich etwas. Da hatte diese Frau so viel durchgemacht und lebte nun alleine, bewahrte aber trotzdem ihr sonniges Gemüt. Respekt.
„Wenn Sie weiter so gut beieinanderbleiben, dann schaffen Sie das ganz bestimmt.“
„Dasselbe sagt mein Arzt auch. Wie viele Knödel wollen Sie? Ein oder zwei?“
„Ich denke, einer reicht.“
„Man wird sehen“, wimmelte sie ihn ab. „Wie geht es eigentlich Ihrer Kim? Noch mal was von ihr gehört?“
„Nein, nichts mehr“, erwiderte er und ließ den Kopf sinken.
„Vielleicht wird es ja noch mal?“
„Ich denke eher nicht.“
Sie hielt ihn mahnend ihren verkrümmten Finger vors Gesicht und sah ihn streng an, wobei sie wie eine Lehrerin wirkte, die ihren Schüler beim Schummeln erwischt hatte.
„Man soll nie die Hoffnung aufgeben. Das hab ich auch schon meinen Sven immer gepredigt.“
„Mmh …“
Von diesem mutlosen Brummen vorerst ausgebremst, ließ sie es für den Moment darauf bewenden und wandte sich der Kaffeemaschine zu. Kaum erwachte diese röchelnd zum Leben, machte sie sich daran, das Essen aufzuwärmen. Sie war eben Hausfrau mit Leib und Seele. Immer nach dem Motto, welches sie schon von ihrer Mutter übernommen hatte: Ein satter Mann ist ein zufriedener Mann.
„Ein Mann braucht bloß eine gute Frau an seiner Seite. Und sollte ihre Kim nicht zurückkommen, dann gibt es noch andere Frauen da draußen.“ Vollkommen überzeugt von ihren Worten, zeigte sie mit dem Finger in Richtung des Fensters. „Andere Mütter haben schließlich auch schöne Töchter.“
Martin fand nur wenig Trost in dem Gerede über schöne Töchter, mit welchen ihm Manni zuweilen nervte. Ich will keine anderen Töchter, ich will Kim!
Die warme Mahlzeit zerging geradezu auf der Zunge und schmeckte herrlich. Eine willkommene Abwechslung zu dem Brot, das es sonst gab. Demnach konnte die alte Frau mit sich zufrieden sein, und nippte mit einem Schmunzeln an ihrem Kaffee. „Schmeckt es denn?“
„Ja, sehr gut“, erwiderte Martin.
„Warum ist Ihre Kim denn eigentlich ausgezogen?“
„Wir hatten verschiedene Auffassungen, wie ich meinen Lebensunterhalt zu bestreiten habe.“
Frau Brecht kräuselte die Lippen. Sie und ihr Sven hatten nie über Geld gestritten, entweder es war am Ende vom Monat noch eines da oder nicht. Wenn nicht, hatte es eben tagelang Eintopf gegeben, aber darüber gestritten hatten sie nie. Man hatte eben irgendwie mit einem Verdienst und einer fünfköpfigen Familie zurechtkommen müssen.
„Aber arbeiten Sie nicht bei der Zeitung? Verdient man da nicht genug?“
Martin schluckte hinunter, ehe er antwortete. Das Thema war ihn gänzlich unangenehm.
„Ich habe bei der Zeitung gearbeitet. Aber nach achtzehn Jahren habe ich mich sozusagen selbstständig gemacht. Ich arbeite jetzt von zu Hause aus.“
„Aber schreiben Sie noch?“
„Bücher?“, fragte sie begeistert. Ihr gefiel der Gedanke, einen Schriftsteller im Haus zu haben. Leidenschaftlich gerne las sie Kriminalromane. Wozu sie früher nie gekommen war, konnte sie nun nachholen. Jetzt da sie neben ihrem Haushalt genügend Zeit besaß.
„Nicht ganz“, erwiderte Martin. „Ein Buch ist zwar geplant, aber im Moment schreibe ich nur online.“
„Was ist … online?“
Er überlegte kurz, wie er ihr das erklären sollte.
„Kennen Sie das Internet?“
„Schon mal von meinen Kindern und Enkelkindern gehört, nur vorstellen kann ich mir darunter nichts.“
„Haben ihre Kinder und Enkelkinder Ihnen noch nie Videos oder Fotos auf dem Handy gezeigt oder so?“
„Doch … schon …“
„Da haben Sie es!“, sagte Martin und breitete die Hände aus. „Diese stammten bestimmt aus dem Internet.“
„Ah ja …“
Er sah ihn ihrem Gesicht nach wie vor ein großes Fragezeichen, und er fragte sich erneut, wie man jemanden die digitale Welt erklären sollte.
„Wissen Sie, was ein Computer ist?“
„Natürlich“, erwiderte mit einer Selbstverständlichkeit.
„Okay“, lächelte er. „Wenn jetzt ich etwas auf meinem Computer schreibe und Sie ebenfalls einen besitzen würden, dann könnten Sie lesen, was ich geschrieben habe, das ist online.“
Das war nicht die beste Erklärung, dennoch konnte er damit leben. Frau Brecht anscheinend ebenso.
„Ah … verstehe … und damit verdienen Sie Geld?“
Martin nickte.
„Ja, tue ich. Zwar nicht mehr so viel wie bei der Zeitung, aber ich kann davon leben und meine Miete bezahlen.“
Dass er über die Illuminaten schrieb, die seit ihrer Gründung die Weltherrschaft anstrebten und dies teilweise bereits erreicht hatten, indem sie Staatsmänner in führende Positionen gebracht hatten, behielt er für sich.
Martin war nach dem Verzehr seines zweiten Mittagessens pappsatt.
„Wollen Sie noch einen zweiten Kloß.“
Er lehnte ab und fasste sich an den Bauch; dass Frau Brecht in nach wie vor siezte, überhörte er. Ich habe es ihr jetzt mehrmals angeboten.
„Nein, Frau Brecht, vielen Dank, aber ich platze sonst.“ Was ich jetzt wirklich brauche, ist ein Sofa.
Die alte Frau räumte das Geschirr ab und stellte es sogleich in die Spülmaschine, dann nahm sie wieder am Tisch Platz, um das Gespräch fortzuführen.
„Und Ihre Kim war damit nicht einverstanden gewesen, dass Sie sich selbstständig gemacht haben?“
„Genau.“
Kapitel 2
Die Freimaurerfibel
Blog über das Erbe Kennedys
Liebe Leserinnen und Leser,
wir alle haben das weltberühmte Foto von John F. Kennedy Jr., als er an seinem dritten Geburtstag am Sarg seines Vaters salutierte, noch genau vor Augen. Ein Foto, das einen die Tränen in die Augen treibt.
1982 mit seinem Studium in der Tasche schrieb er sich an der juristischen Fakultät der New York University Law School ein. Er schaffte das Anwaltsexamen und arbeite bis 1993 bei der Staatsanwaltschaft New York. Wenn man den Gerüchten um seine Nachforschungen nach den Beweggründen und den wahren Hintermännern, die an den Mord an seinem Vater verantwortlich sind, Glauben schenken will, war das vielleicht genau die richtige Stelle, um Akteneinsicht in verborgene Dokumente zu bekommen. Demnach hat JFK Jr. nicht an die Einzeltätertheorie eines Lee Harvey Oswalds geglaubt, denn warum hätte er sonst Nachforschungen betrieben? Und hatte er gerade deswegen für die Staatsanwaltschaft arbeiten wollen? Fakt ist: Die Suche nach Gerechtigkeit und der Wahrheit liegt den Kennedys im Blut. Da fragt man sich doch, was hat Kennedy Jr. herausgefunden? Vielleicht dass sein Vater hatte sterben müssen, weil dieser nicht US-Soldaten nach Vietnam schicken wollte? Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass es einen Vietnamkrieg von Seiten des 35. Präsidenten der USA nie gegeben hätte. Hat sein Sohn wegen seiner Suche nach der Wahrheit am 16. Juli 1999 sterben müssen?
***
Martin nahm mürrisch die Finger von der Tastatur. Er hatte gehofft, bei John F. Kennedy Jr. irgendeinen Anhaltspunkt auf die Illuminaten zu finden, doch alle Spuren waren ins Leere gelaufen. Weder im Todesdatum, der Todeszeit, noch im Breitengrad der Absturzstelle hatte er die Zahl 13 gefunden. So hatte er sich beim Schreiben seines Blogs zu seinem Leidwesen auf Gerüchte stützen müssen. Er mochte keine Gerüchte, genauso wenig wie seine Leser. Harte, unwiderlegbare Fakten waren das A und O. Dabei musste er an Manni und dessen Quelle denken und an den stolzen Preis von zehntausend englischen Pfund. Bei diesem Preis müssten es wirklich gute, wenn nicht sogar sehr gute Fotos sein.
Bestimmt hatte diese sogenannte Quelle noch anderen potenziellen Käufern das Angebot gemacht. Wenn dem so wäre, tickte die Zeit. Nur wollte Martin diese Fotos wirklich? Wenn er sich dafür entscheiden würde, würde es einige Monate an Werbeeinnahmen brauchen, damit er wieder auf null käme.
Er rief im Internet das Foto der Limousine auf, mit der Lady Di verunglückt war. Das Foto auf der Website zeigte ein total zerstörtes schwarzes Auto. Sogar das Dach hatte man abnehmen müssen. Und die Motorhaube … ach was, die ganze Front besaß in ihrem eingedrückten Zustand keinerlei Ähnlichkeit mehr mit der Front einer Mercedeslimousine. Auf einer Verkaufsplattform fand er zu einem stolzen Preis eine Tageszeitung vom Tag nach dem Unfall; auf der Titelseite ein kleines Foto, das das unversehrte Heck der Limousine zeigte. Ebenso das Dach wies keinerlei Beschädigung auf. Die hintere Tür auf der Beifahrerseite stand offen und zwei Sanitäter beugte sich hinein. Der Text: Das Unglücksauto mit Di und Dodi im Todestunnel, Retter versuchen verzweifelt, an die eingeklemmten Opfer heranzukommen.
Dem Leibwächter, der den Unfall als einziger schwer verletzt überlebt hatte, fehlen nach eigenen Angaben bis heute viele Erinnerungen. Aber obwohl er behauptete sich nicht mehr an diese Nacht des 31. Augusts 1997 erinnern zu können, hatte er mit einem Ghostwriter über eben diese schicksalhafte Nacht ein Buch schreiben können. Wie bringt man das denn bitte fertig?, fragte sich Martin.
Irgendetwas an dieser Geschichte stinkt gewaltig, das kann ich förmlich riechen.
Martin jedenfalls fiel das Schreiben schon schwer, wenn er eine schlaflose Nacht durchlebt hatte. Wie dem auch sei, er konnte auf Aussagen von Sicherheitsleuten, die bei Lady Di oder John F. Kennedy dabei gewesen waren, gut und gerne verzichten. Zumindest nachdem der Secret-Service-Agent William Robert Greer gegen die Wahrnehmung mehrerer Augenzeugen an den Einzeltäter Lee Harvey Oswald und dessen abgegebene drei Schüsse aus dem Schulbuchlagerhaus festgehalten hatte. Drei Schüsse, aber insgesamt sieben Wunden an Kennedy und Gouverneur Connally! Wie soll das bitte gehen? Doch wer stehlt sich auch schon gegen die Hand die einen füttert, beziehungsweise für die Mittäterschaft bezahlt hat?
Von Frau Brechts tadellosen Haushalt angespornt, machte sich Martin daran, Ordnung zu schaffen. Er wollte damit beginnen, die gesamte Wohnung zu saugen, musste allerdings feststellen, dass der beutellose Behälter des Staubsaugers übervoll war. Draußen regnete es in Strömen, was ihn angesichts des bevorstehenden Gangs zu den Mülltonnen nicht unbedingt frohlocken ließ. Martin tat es trotzdem. Diesmal begegnete er Frau Brecht nicht, was ihn trotz ihres hohen Alters keine Sorgen bereitete, da es wie jeden Tag aus ihrer Wohnung köstlich nach Mittagessen roch. Der intensive und sogleich unnachahmliche Geruch von Rotkohl hing im Treppenhaus. Die gute alte Frau Brecht. Sollte es eines Tages mal nicht mehr nach Essen riechen, wäre das ein herber Verlust für das ganze Haus. Martin erinnerte sich an die würzigen Gerüche, die beim Zaubern von schmackhaften Gerichten entstanden waren, als Kim noch in seiner Wohnung gekocht hatte. Besser hatte er bisher auswärts bei keinem Asiaten gespeist.
Zurück in der Wohnung konnte er nun endlich zur Tat schreiten. Hier und da fiel sein Blick auf die Möbel und er fragte sich, ob es vielleicht besser gewesen wäre, er hätte zuerst abgestaubt. Mit dem Finger ging er über ein Regal und schob auf ein paar Zentimeter den Staub zu einem länglichen kleinen Haufen auf.
„Da kannst du ja Karotten drin anpflanzen!“, würde seine Mutter bei diesem Anblick klagen. Wäre sie hier, würde es erst gar nicht so aussehen.
Maria Schenkenberg hatte ebenfalls wie Frau Brecht einen Narren an Kim gefressen. Die erste Frau nach langem in Martins Leben, die sie nicht mit Argwohn betrachtet hatte. Und es hatte so einige gegeben. Michelle war ihr zu aufgedonnert, Sabine zu verwöhnt und Silke zu arrogant gewesen.
„Warum hast du Kim gehen lassen?“, hatte Maria ihren Sohn gefragt. „Das war endlich mal eine gescheite Frau gewesen.“
„Was hätte ich denn machen sollen?“, hatte er entgegnet. „Sie ist eben ausgezogen.“
„Mit allen Mitteln um sie kämpfen. Das hättest du machen sollen!“
„Ich bin aber nun mal nicht der Typ, der Frauen hinterherläuft, Mutter.“
„Du bist genauso stur wie dein Vater.“
„Was hat das denn mit stur zu tun?“
„Ach, ich will gar nicht mehr darüber reden.“
Trotzdem hatte ihr Streit noch ewig gedauert. Wie eben Mütter so sind, dachte er sich.
Martin machte Pause für eine Zigarette, den Rauch blies er nach tiefen Zügen in den Regen hinaus. Auf dem gegenüberliegenden Dach saß ein Schwarm Vögel, die bei diesem Wetter keine Lust zu fliegen hatten. Möglicherweise waren es Tauben, aber wen interessierte das? Martin jedenfalls nicht. Am Himmel zogen schwarze Wolken vorüber, die bis zum Horizont reichten. Ein richtiges Sauwetter.
Vereinzelt brannte in den Fenstern Licht. Anscheinend haben die Bewohner ebenfalls keine große Lust auszufliegen. Frau Senftleben jedenfalls stand mit dem Rücken an ihrem Fenster und bügelte ihre Wäsche, während im Fernseher das Vormittagsprogramm lief. Im Fenster darüber zeichnete sich hinter Vorhängen eine Silhouette ab. Die zierliche Isabella stand auf einem Bein, die Hände gefaltet über den Kopf. Demnach machte sie Yoga. Im Erdgeschoss wurde ein Milchglasfenster gekippt. Dort hatte wohl jemand geduscht oder war auf dem Klo gewesen. Wer dort wohnte, entzog sich Martins Kenntnis. Er konnte schließlich nicht jeden kennen und war darauf auch überhaupt nicht aus. Immerhin hieß er nicht L. B. Jefferies alias James Stewart aus dem Hitchcock-Thriller. Martin liebte diese alten Schinken. Das Fenster zum Hof, ein großartiger Film.
Hinter der Gardine berührte Isabella nun im Stehen mit den Fingerspitzen ihre Fußzehen. Dabei berührte ihr langer Pferdeschwanz den Boden. Ein Anblick, der die Fantasie fast eines jeden Mannes beflügeln würde. Eine Sünde wäre diese Frau allemal wert, überkam es Martin, der sich beim Begaffen dieser Grazie sogleich schuldbewusst eingestehen musste, Kim für einen Moment vergessen zu haben. Ja, er hatte sich sogar vorgestellt, ein Techtelmechtel mit ihr einzugehen, obwohl sie vom Alter her seine Tochter sein könnte. Sofort verwarf er den Gedanken wieder, als vor seinem geistigen Auge Kims liebliches Antlitz erschien. Er kam einfach nicht über sie hinweg. Kim, Kim, immer nur Kim!
Niedergeschlagen senkte er seinen Blick für einen Moment und sah als nächstes, wie Isabella hochschnellte. Da er nicht sicher sein konnte, ob diese plötzliche Handlung der jungen Frau ihn galt, wich er in den Schatten seiner Küche zurück. Doch die nach wie vor unwissende Isabella kam nicht wie erwartet zum Fenster gelaufen, um ihren Spanner auf frischer Tat zu ertappen, sondern lief federleicht wie eine Gazelle in freudigen Sprüngen zur Tür. Sie machte auf und fiel sofort einer ebenso durch die Gardinen nur schemenhaft erkennbaren großen – und vermutlich – männlichen Gestalt um den Hals, deren Gesicht sie sofort mit Küssen eindeckte.
Allerdings interessierte das den Kerl, der so breit war wie die Tür selbst, nicht im Geringsten, jedenfalls machte er mit seinen schlaffen, am Körper hängenden Armen, nicht die leiseste Andeutung, Isabellas Liebesbekundungen zu erwidern. Stattdessen machte er unter der Last der zierlichen Frau schwerfällig einen Schritt in den Raum und schloss die Tür. Dann stand er wieder einfach nur so da und für Martin passierte nichts Aufregendes. Bis dieser Hüne seine „menschliche Last“ vor sich abstellte. Gleich darauf entstand augenscheinlich eine von ihm aus kühle, aber dennoch hitzige Diskussion, wobei sie ebenso nur an ihren schemenhaft erkennbaren Gestiken die Deeskalation und die Versöhnung suchte. Das Ganze gipfelte darin, dass er ihr mit dem Finger drohte und anschließend die Wohnung verließ. Zurück blieb eine aufgelöste Isabella, deren Schatten in sich zusammenfiel. Ihr verzweifeltes Schluchzen konnte Martin anhand des geschlossenen Fensters und der Entfernung nicht hören.
***
Das Jahr ging zu Ende und Martins Wohnung sah wieder genauso chaotisch aus wie vor wenigen Wochen: volle Aschenbecher, ein dreckiger Herd, Chipskrümel auf dem Wohnzimmertisch und auf dem Teppich und in der Abstellkammer lagerten säckeweise Pfandflaschen aus Plastik. Martin war zwar für den täglichen Bedarf an Lebensmitteln einkaufen gewesen, nur hatte er sie jedes Mal vergessen mitzunehmen. Für das Pfand, das er erhalten würde, würde er gut und gerne für eine Woche zu essen bekommen. Vielleicht auch für zwei. Nur ging er überhaupt nicht gerne einkaufen. In den Supermarkt am Ende der Straße schon überhaupt nicht. Zu viele schlechte Erlebnisse. Einmal als er sich am Abend noch schnell eine Tiefkühlpizza hatte besorgen wollen, war ihn ein Mann mit blutiger Hand entgegen getaumelt. Gekleidet war er in der Arbeitskluft eines Landschaftsgärtners. Da Martin ihn für einen besoffenen Arbeiter gehalten hatte, der auch gut alleine zurechtkommen würde, hatte er ihn vorerst ignoriert. Wieder einer, der nach Feierabend einen über den Durst getrunken hat!