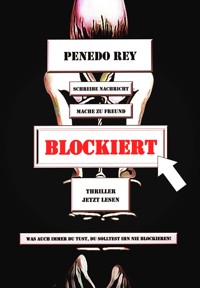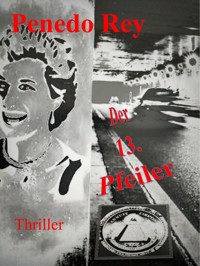0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Gottes Dünnschiss erzählt die Geschichte von Michael und Susanne, die eine Sache verbindet: Beide sind sie von ihrer Mutter aus dem Elternhaus geworfen worden. Während Michael in die Drogenszene abrutscht landet Susanne mit ihren zarten sechzehn Jahren in einem Bordell, wo sie unter dem Namen Sugar arbeitet. Bei Michael kommt es wie es kommen musste, er wird bei einer Beschaffungsfahrt aus den Niederlanden von der Polizei erwischt und eingesperrt. Nach der Haft hat er den Drogen abgeschworen, doch er fängt mit dem Trinken an, wodurch er ein zweites Mal eine Familie verliert, aus der die Tochter Jessica hervorgegangen ist. Fortan auf sich allein gestellt zieht es den jungen Vater in eine heruntergekommene Gegend in Nürnberg, wo er auf die mittlerweile 21-Jährige Susanne trifft. Schnell freunden sie sich an und stellen fest, dass sie keineswegs Gottes Ebenbild sind, sondern Ausgestoßene. Mit anderen Worten Gottes Dünnschiss.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 888
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Markus Penedo Rey
Gottes Dünnschiss
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Ebenfalls vom Autor erschienen:
Nach 17 Jahren – das Wiedersehen mit meiner Oma
Vorbemerkung des Autors
Alles hat einmal ein Ende!
Home sweet Home
Die Symphonie des Speedy Gonzales
Süß wie Zucker
Eine Spur zu dick!
Leben in Gefahr?
Ärger im Paradies!
Zu Hause ist es nicht immer am schönsten!
Trautes Heim – Scherz muss sein!
Das Leben ist hart – wer ist härter?
Freud und Leid
Frohe Weihnachten und komm gut rüber
Ein neuer Anfang
Widmung
Nachwort
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Impressum neobooks
Ebenfalls vom Autor erschienen:
Der Seher 2022
Der 13. Pfeiler 2024
Nach 17 Jahren – das Wiedersehen mit meiner Oma
Ein Wort des Autors vorweg
Sehr verehrte Leserinnen, sehr verehrte Leser,
darüber, ob ich das Folgende schreiben sollte oder nicht, musste ich mir keine langen Gedanken machen, da es einfach etwas so Fantastisches ist, dass ich es mit Ihnen teilen möchte. Viele tun es bei Facebook, ich mache es ganz einfach hier, als Vorwort, wenn Sie so wollen, zu meinem Buch. Apropos Buch! Das Fantastische, was ich Ihnen hier erzählen möchte, wäre ein Stoff, den ich sicherlich mal zu Papier in einem weiteren Buch bringen werde. Warum auch nicht? Alles ist möglich!
Kennen Sie das? Kennen Sie das Gefühl, bei dem Sie die „berühmten Bäume“ ausreißen könnten? Dass Sie das Gefühl haben, als würden Sie auf einer Welle des Glücks surfen, die Ihnen wieder neues Leben einhaucht? So geht es mir momentan.
Aber es gab auch mal andere Zeiten. Und ich denke, da schreibe ich über etwas, was Sie genauso gut kennen wie ich. Zeiten, in denen man allen Mut verloren hat. Zeiten, in denen man sich fragt: Wie lange soll ich eigentlich noch leiden?
Vielleicht befinden Sie sich ja auch gerade in einem Konflikt mit Ihrer Familie und haben, so wie ich es hatte, keinen Kontakt mehr zu ihnen.
Irgendwann hatte man sich zerstritten, wobei ein Wort das andere ergeben hatte, und man hatte sich dazu entschlossen, einen Schlussstrich zu ziehen.
Natürlich steckt man so eine Entscheidung nicht einfach so weg, zu seiner kompletten Familie (den Eltern, den Großeltern, den Geschwistern, zu den Onkeln und den Tanten) den Kontakt abzubrechen ist schmerzhaft, sehr schmerzhaft, ich weiß es.
Manchmal ist man einfach nur wütend, und manchmal ist man am Boden zerstört, man strauchelt, man fällt, man fühlt sich einfach nur leer. Aber eines steht fest: Es gibt kein Zurück mehr!
Siebzehn Jahre sind seither vergangen. Eine Zeit, in der ich viele Höhen und Tiefen erlebt hatte. Eine Zeit, in der ich viele Male einfach zusammengebrochen bin und der Notarzt mich in die Klinik eingewiesen hatte. Einige Male sogar mit Krampfanfällen. Eine Zeit, in der ich zum Großteil dem Alkohol verfallen war. Natürlich war ich blind gewesen, um das zu erkennen. Die Säufer waren die anderen, nicht ich! Die anderen, die von früh bis spät besoffen sind, solche Leute eben, aber ich nicht!
Eine 15-wöchige Therapie hatte mir dann die Augen geöffnet. Die und das Schreiben hatten mir sehr geholfen.
Es dauert ja einfach seine Zeit, bis der Antrag für so eine Therapie mal durch ist. Und in dieser Zeit – und während meines Aufenthalts in der Klinik – habe ich all meinen Schmerz, all meine Trauer zu Papier gebracht. Natürlich hatte es mir außerdem auch Spaß gemacht.
Und auf dieser Therapie war uns der Film `Scherben des Lebens´ gezeigt worden. Im Vorfeld hatte uns bereits unsere Therapeutin während der Therapiestunden von „wahren Wundern“ erzählt. Viele positive Dinge, die sich einfach so mal eben von alleine ergeben hatten, weil man aufgehört hatte zu saufen. Jedenfalls gibt es in diesem Film eine Szene in der Martin Sheen (Vater von Charlie Sheen) nach langen Hin und Her endlich zu den Anonymen Alkoholikern geht. Und wen trifft er dort rein zufällig? Seinen ehemaligen Chef, der ihn wegen dessen Jähzorns gekündigt hatte. Sie treffen sich also, kommen ins Gespräch – „Nein, Sie auch hier … blablabla!“ – und dann bekommt Martin Sheen ganz einfach mal so, weil ehemalige Trinker einfach mal zusammenhalten, seinen Job wieder.
Vielleicht fällt Ihnen an dieser Stelle genauso die Kinnlade runter wie mir damals und Sie denken sich: Was ein Scheiß!
Unter ehemaligen Trinkern mag das vielleicht gehen! Aber was ist, wenn Ihr Chef überhaupt nie ein Problem mit Alkohol hatte? Ja, genau! Das ist blöd!
Nun wieder zurück zu mir und meinem Schlussstrich, den ich zwischen mir und meiner Familie vor 17 Jahren gezogen hatte.
Zwei Wochen nachdem ein erster Entwurf von diesem Buch erschienen war, hatte ich plötzlich Post von meiner Mutter erhalten. Sie hatte geschrieben, dass mich meine Oma, die sich mittlerweile in einem Seniorenheim befindet, mich noch mal sehen möchte, bevor sie sterben würde.
Zu der Zeit aber, als mich dieser Brief erreicht hatte, war ich selbst auf einer weiteren Rehamaßnahme wegen zweier Bandscheibenvorfälle gewesen. Ich musste also selbst erst mal nach Hause kommen. Als ich dann aus der Klinik entlassen wurde, bin ich (fast) anschließend darauf zu meiner Oma gefahren.
Siebzehn Jahre waren eine verdammt lange Zeit, und natürlich sah meine Oma nicht mehr so aus, wie ich sie in Erinnerung hatte. Sie hatte aufgehört, ihre Haare zu färben, hatte etwas mehr Falten, und sie war nicht mehr so dynamisch wie damals. Was ihr aber geblieben war, war ihre sanfte Stimme und die liebevollen, sanften Augen, wie ich sie nie mehr bei einem anderen Menschen gesehen habe.
Was jedoch – bestimmt sogar – nur an dem Band lag, das sich zwischen meiner Oma und mir befindet.
Ich wette, Ihre Oma hat auch die liebsten und gütigsten Augen, die Sie je gesehen haben. Ist es nicht so?
Es war überwältigend nach all dieser langen Zeit meiner Oma gegenüberzustehen, der man erst mal erklären musste, wer man überhaupt war und dass man es tatsächlich sei, und zwar in Fleisch und Blut.
Ich fuhr also zwei Tage nachdem ich wieder zu Hause war zu dem Seniorenheim, in dem meine Oma nun wohnte. Beim Einbiegen in das Grundstück konnte ich schon einen kurzen Blick durch die Fenster des Aufenthaltsraums auf einige ältere Frauen erhaschen. Eine von ihnen erwiderte etwas misstrauisch meinen Blick. Mein erster Eindruck war nicht ganz so gelinde gewählt: „Na, die schauen ja angepisst! Wen wundert´s? Mir würde es da drin bestimmt auch keinen Spaß machen!“
Die wenigen Parkplätze, die zu dem Seniorenheim gehörten, waren, wie bereits von mir befürchtet, alle belegt.
Ich musste also wenden und gleich noch einmal an dem Fenster vorbeifahren. Als ich das Auto dann endlich auf der Straße abgestellt hatte, schnappte ich mir den Blumenstrauß für Oma und etwas, was ich während meiner Suchtherapie gemacht hatte: Eine ovale, dünne Sperrholzplatte, auf dessen Vorderseite ich das Bild eines Phönix (wie der legendäre Phönix aus der Asche) mit einem Brandmalkolben eingebrannt hatte. Drumherum hatte ich einen Rahmen aus zweieinhalb Millimetern dickem Flechtmaterial geflochten, und unten links hatte ich ein Passfoto, was eigentlich mal ein Bewerbungsfoto war, von mir aufgeklebt. Es war zwar nicht mehr ganz so aktuell, aber ein anderes, auf dem ich lächle, hatte ich nicht. Für den Reisepass und so weiter muss man ja neuerdings wie ein Schwerverbrecher gucken, also hatte ich kurzerhand dieses genommen. Ich ging also mit meinen Geschenken in Händen hinein und versuchte, mich erst einmal zu orientieren. Eine Pflegerin fragte mich dann, ob sie mir helfen könnte, und erklärte mir anschließend, dass meine Oma gerade zu Mittag essen würde und ich mich doch noch einen Moment gedulden sollte. Kein Ding, dachte ich mir. Nach 17 Jahren kam es auf ein paar Minuten auch nicht mehr an.
Ich setzte mich also auf einen der Stühle vor dem Aufenthaltsraum, in dem noch zwei ältere Damen und ein älterer Herr zu Mittag aßen. Bereits nach kurzer Zeit fragte ich mich dann doch, wer denn von diesen beiden Omis die meine wäre.
Die, die mir am nächsten saß, konnte es nicht sein. So sehr verändern konnte sich niemand. Und meine Oma hatte früher nicht einmal ansatzweise so ausgesehen. Da sie einige Male zu mir hinausgesehen hatte, hatte ich sie recht gut in Augenschein nehmen können. Nichts passte. Die Augen nicht, das Gesicht nicht, irgendwie alles nicht.
Dann blieb ja nur noch die Omi, die einen Stuhl weiter saß. Ich hatte sie gleich wiedererkannt. Sie war nämlich die ältere Frau gewesen, die so giftig durch die Scheibe geglotzt hatte.
Niemals!, dachte ich mir. Meine Oma muss irgendwo in einer Ecke sitzen, die ich von meinem Sitzplatz aus nicht einsehen konnte.
Diese Oma da war es beim besten Willen nicht! Meine Oma hat niemals so grantig geguckt.
Und meine Oma sah auch nicht so aus! Nee, meine Oma musste irgendwo anders sitzen, wo ich sie nicht sehen konnte!
Also hatte ich mich in Geduld geübt. Sie muss ja irgendwann mit dem Essen fertig sein, sagte ich mir.
Dann war es so weit. Beinahe gleichzeitig erhob sich das Trio vom Tisch und kam, einer nach dem anderen, nach draußen. Voran ging die Oma, die ich gleich als Erstes ausgeschlossen hatte. Die, die einige Male zu mir hinausgesehen hatte. Dahinter kam die ältere Frau, die es schon mal überhaupt nicht sein konnte!
Als sie mich ansah – und ich sie –, kristallisierten sich doch ein paar Merkmale aus ihrem Gesicht, die mir bekannt vorkamen.
Die Augen, ein bisschen noch das Gesicht, wenn auch stark verändert, und ihr einzigartiges Wesen.
Später erfuhr ich dann von meiner Mutter, mit der ich telefoniert hatte, wie meine Oma ihren ersten Eindruck geschildert hatte: „Da saß dann ein junger Mann, der mich so doof angeglotzt hat!“
Das mit dem „doof angeglotzt“ hatte ich sofort geglaubt! Die Oma, die niemals meine Oma sein konnte, war dann tatsächlich doch meine Oma gewesen. Für einen kurzen Moment war ich wieder ein kleiner Junge und mir fiel nichts Besseres ein, die ältere Frau, die vor mir stand, mit dem Wort „Oma?“ anzusprechen.
„Ja, und wer bist du?“
Das Weiche in ihrer Stimme hatte sie niemals verloren.
„Ich bin's, der Markus!“
Ihr Gesicht werde ich nie wieder vergessen. Diesen Zauber auf einem Gesicht erlebt man vielleicht noch an Weihnachten, oder wenn man seiner Liebsten einen Antrag macht, es war einfach nur wunderschön gewesen.
„Bist du es wirklich?“, fragte sie. Ja, ich war es wirklich – nach 17 Jahren!
Das, meine Freunde, war der Beginn eines neuen Abschnitts und zugleich das Ende einer langen Talfahrt. Einer Talfahrt, in der ich mein Leben so gut wie es eben ging, gelebt hatte, an deren Anfang es oft verdammt wehgetan hatte, und ich unzählige Male gestorben bin. Dennoch sagt man sich, dass trotz alledem, das Leben weitergehen muss.
Was hätte ich auch sonst tun sollen? Hin und wieder in ein Loch zu fallen kennt doch jeder. Aber dann hat man die Wahl: Bleibt man liegen oder rappelt man sich wieder auf? Ich rappelte mich viele Male wieder auf, und klebte ein imaginäres Pflaster in Form von Alkohol und Drogen auf meine Wunden. So hatte ich mehr oder weniger die letzten 17 Jahre verbracht. Darum war auch meine allererste Arbeit in der Suchtklinik der Phönix gewesen. Da er für den Neuanfang steht, den ich vor fast einem Jahr eingeschlagen hatte. Und da ich als Kind meiner Oma schon immer gerne etwas Selbstgebasteltes geschenkt hatte, hatte ich ihr kurzerhand meine erste Brandmalerei mitgebracht, als ein Symbol des Neuanfangs.
In dem Brief, den ich von meiner Mutter erhalten hatte, hatte sie sich außerdem noch bei mir entschuldigt, für all das, was sie mir angetan hatte. Zudem würde sie sich sehr freuen, wenn man sich mal wieder sehen könnte.
Also hatte ich wenige Tage, nachdem ich meine Oma besucht hatte, wobei ich ihr versprochen hatte, dass ich meine Mutter besuchen würde, sie aufgesucht. Wir sprachen viel, räumten alte Missverständnisse aus der Welt und konnten sogar gemeinsam über so manches lachen. Aber dennoch wollte sich in meinem Gemütszustand kein Gefühl des Friedens einfinden. Es war einfach zu viel passiert, und die Wunden auf meiner Seele waren dementsprechend tief. Erst nach einem weiteren Telefonat, bei der ich ihr – auch endlich – sagen konnte, wie ich das alles damals so empfunden hatte, da endlich konnte sich der Heilungsprozess einstellen. Ich konnte anfangen, ihr zu vergeben. Und, meine Freunde, das fühlt sich gut an. Ich sag's euch!
Natürlich hatte sie ihrerseits auch viel zu berichten, was ihr so Unschönes widerfahren war. Wobei ich allerdings ebenfalls nicht ins Detail gehen möchte.
Zum Schluss hin noch eine klitzekleine Anekdote, die meine Oma im wahrsten Sinne des Wortes auf die Beine gestellt hatte.
Wie bereits erwähnt, lebt meine 84-jährige Oma in einem Seniorenheim, wo sie sich, wie die meisten, mit einer Gehhilfe vorwärtsbewegt, und beim Ein- und Aussteigen ins Auto man ihren Fuß anheben muss, weil sie es aus eigener Kraft nicht mehr schafft. Zwei Schlaganfälle, die sie hatte, waren eben auch nicht spurlos an ihr vorbeigegangen. Deren Augen auch nicht mehr so wollten, weswegen sie im Übrigen nicht giftig guckte, sondern es sie lediglich nur anstrengt, Dinge zu erkennen, die weiter weg waren.
Doch ich möchte endlich zum Punkt kommen.
Als ich sie das letzte Mal besucht hatte, hab ich sie spontan gefragt, ob wir uns ins Auto setzen und zu meiner Mutter (im Übrigen ist meine Mutter, ihre Tochter – nur zum besseren Verständnis) fahren wollen. Wie aus der Pistole geschossen sagte sie sofort zu, womit ich nicht wirklich gerechnet hatte. Immerhin war sie alt, war auf eine Gehhilfe angewiesen, und meine Mutter wohnt in einem Altbau im zweiten Stock unterm Dach. Wie da die Treppen sind, muss ich, glaub‘ ich, nicht groß erklären! Nachdem ich sie aber gefragt hatte, ob die Treppen eventuell zum Problem werden könnten, winkte sie ab. Die würde sie packen! Also jetzt im Ernst, Freunde: Respekt vor dieser alten Frau! Ich jedenfalls ziehe meinen Hut.
Also lange Rede, kurzer Sinn, mit vereinten Kräften, wobei meine Oma mit Sicherheit den Löwenanteil geleistet hatte, hatte sie es dieser wirklich fiesen Treppe gezeigt.
Im ersten Stockwerk allerdings hatte sie eine Pause eingelegt, wo sie mich auch gefragt hatte, ob das nun noch weiter hochgehen würde.
Ich hatte sie dann aufgeklärt.
„Ja, Oma, wir haben jetzt gerade mal die Hälfte!“
Sie hatte daraufhin nicht viel gesagt.
„Ui-jui-jui …!“
Nachdem sie oben angelangt war, hatten wir – meine Mutter, ihr Freund, meine Freundin und ich – sie bejubelt.
Ehre, wem Ehre gebührt!
Ich glaube ja, dass sie sich da hochgekämpft hatte, um mit ihren eigenen Augen sehen zu können, dass Mutter und Sohn nach so langer Zeit, wieder gemeinsam an einem Tisch sitzen und einen Kaffee trinken können.
An ihrem 65. Geburtstag hatte ich meiner Oma ihren Geburtstagswunsch verwehren müssen. Sie hatte sich gewünscht, dass ich mich mit meiner Mutter wieder vertragen sollte. Aber dazu war ich nicht bereit gewesen.
Ich bin sehr froh, dass meine Oma zu Lebzeiten noch diesen Frieden bekommen hatte. Und ich bin sehr froh darüber, dass ich daran teilhaben durfte. Sie hatte sich mit ihren 84 Jahren diese Treppe hochgekämpft und hatte mir damit eines demonstriert: Das nichts unmöglich ist!
Dafür, und weil du so bist, wie du bist, Oma, hab ich dich lieb!
Markus Penedo Rey
Reichenschwand, den 06.04.2015
Für meinen kleinen Bruder, Matthias.
Die Familie kam für Dich immer an erster Stelle.
Wir werden Dich nie vergessen.
In Liebe, Deine Familie.
Ruhe in Frieden.
Bezeichne dich nicht als arm,
wenn deine Träume nicht in Erfüllung gegangen sind.
Wirklich arm ist doch nur der, der nie geträumt hat.
Marie von Ebner-Eschenbach
Gottes
Dünnschiss
Von Markus Penedo Rey
Trenne dich nie von deinen Illusionen
und Träumen.
Wenn sie verschwunden sind, wirst du
weiter existieren, aber aufgehört haben
zu leben.
Mark Twain
Es gibt im Leben nur eine Sünde,
und die ist: den Mut zu verlieren.
Johannes Mario Simmel
1924 – 2009
Vorbemerkung des Autors
Dieser Roman wurde durch mehrere wahren Begebenheiten inspiriert, diese mit Fiktionen vermischt wurden. Sämtliche Namen der Personen sind frei erfunden, manchmal sogar ganze Charaktere. Bei der Namensvergabe von Straßen und Schauplätzen habe ich mir einige schriftstellerische Freiheiten erlaubt. Den ortskundigen Leser bitte ich daher um Nachsicht.
Alles hat einmal ein Ende!
1
Wie er hierhergekommen war, wusste er nicht. Auch nicht was er hier mit seinen fünf Jahren zu suchen hatte. Doch das waren Fragen, die er sich erst gar nicht stellte, hier an diesem dunklen Ort, da er mit seiner Angst allein schon viel zu beschäftigt war. Genauso wenig fragte er sich, warum er dieses weiße Gewand anhatte, das aussah wie ein Totenhemd, welches im Wind unkontrolliert flatterte und in die unendliche Schwärze, die sich direkt vor im aufgetan hatte, züngelte.
Die nackte Angst stand nicht nur in seinem kindlichen Gesicht geschrieben, sondern er spürte sie in jeder Faser seines Körpers. Er fühlte sich dieser Naturgewalt, oder was es auch immer war, das drohte ihn in die Tiefe zu schubsen, nicht nur machtlos ausgeliefert, er war machtlos. So musste sich Todesangst anfühlen! Wenn es ein Ende der Welt gab oder ein Ende im Universum, eine Kante – was auch immer –, dann war es vielleicht dieser Ort hier. Oder dieser Ort war das, wie man sich ein Ende im Universum vorstellen musste.
Seine nackten Füße standen auf den Felsen, der gleichzeitig die Kante in dieses schwarze Nichts war. Hinter ihm rauschte ein dichter Tannenwald in diesem erbarmungslosen Wind. Als würden die Bäume nur darauf warten, dass Michael endlich abstürzte, damit sie die Nächsten sein konnten, die ihm nachfolgten. Doch einen Wimpernschlag später sah es dann wieder so aus, als wollten die Bäume dem Wind die Arbeit nur zu gerne abnehmen. Als würden sie nur zu gerne Michael den nötigen Schubs über die Klippe geben.
Wie man es auch betrachtete: Michael besaß gegen diese Macht keine Chance, und das wusste er auch. Und es schien fast so als würde der tiefdunkle, wolkenverhangene Himmel über ihm, dem Jungen mit einem teuflischen, wütenden, gesichtslosen Grinsen, zu dieser Erkenntnis gratulieren wollen. Alles: Der Wind, die Bäume, der Himmel sagte unmissverständlich: Los spring schon!
Sich an irgendetwas zu klammern war vergebens, an die Bäume kam Michael unmöglich heran. Dafür standen sie einfach zu weit von ihm entfernt.
Sich zu bewegen, oder gar umzudrehen, konnte er ebenfalls vergessen. Tief in seinem Innersten wusste er, dass es nur einen Weg gab, und der war einen Schritt nach vorne zu gehen …
05. Januar 2007
Doch all das waren Erinnerungen an einen Albtraum aus Kindertagen. Einen Albtraum, den er viele Male geträumt hatte, und aus dem er viele Male aufgeschreckt hochgefahren war und anschließend aufrecht in seinem Bett gesessen hatte. Nicht ohne einen Laut der tiefen Furcht aus seiner Kehle.
Ob ihn die Grube vor ihm gerade jetzt daran erinnerte, oder der dunkelgraue Himmel über ihm?Er hatte keine Ahnung. Und es war ihm auch egal.
Er stand hier und spürte statt der Angst, wie er sie in seinem Traum gefühlt hatte, Trauer. Herzzerreißende Trauer, weil er hier und heute von einem geliebten Menschen für immer Abschied nehmen musste. Der Regen trommelte auf den weißen Sarg in dem am Tag zuvor frisch ausgehobenen Grab, vor dem Michael mit seinen guten Schuhen – passend zum Anzug – auf einigen platt getretenen Brocken stand, die von der aufgehäuften Erde des Grabes stammte.
Beides: Seine Schuhe und sein Anzug waren triefnass vom Regen. Aber es war ihm egal. Das weiße Hemd, das er unter dem schwarzen Anzug trug, klebte ihm wie seine dunkelbraunen Haare auf seiner nassen, kalten Haut. Und auch das interessierte ihn nicht. Ebenso, dass er dicke Tränen weinte, die sich auf seinem Gesicht mit den Tränen des Himmels vermischten.
Eine kleine Gruppe aus Menschen, hauptsächlich ältere, waren Michael bis hierhin gefolgt. Sie hatten der Verstorbenen die letzte Ehre erwiesen. Nun gingen sie unter ihren Regenschirmen Schutz suchend mit gesenkten Köpfen nach und nach ihrer Wege. Mehr konnten sie hier nicht für den Mann im schwarzen Anzug tun, mehr Trost konnten sie ihm nicht spenden.
Kopfschüttelnd versuchte Michael, das Leben zu begreifen. Dieses manchmal so verdammt grausame Leben, das so hart und erbarmungslos zuschlagen kann. Letzten Endes holt der Tod uns alle, waren die Worte des Geistlichen gewesen. Oder war es doch: Letzten Endes ruft Gott der Allmächtige uns alle zu sich?
Michael wusste es nicht mehr. Und wenn schon! Was machte das schon für einen Unterschied? Tot war tot. Ob sie nun Gott oder der Sensenmann geholt hatte, machte letzten Endes keinen Unterschied.
Das Leben ist grausam! So verdammt grausam. O ja, in solchen Momenten schon!
Michaels Kehlkopf schmerzte vor Trauer, aber noch mehr sein Herz, das zerrissen in seiner Brust schlug. Wenige Tage davor hatte es noch gelacht, und nun war es zerrissen. Einfach so. Hart und erbarmungslos, wie eine todbringende Welle, die einen Ozeankreuzer packt und kentern lässt, hatte das Leben zugeschlagen. O ja, hart und erbarmungslos! Und grausam!
So grausam wie es kein Raubtier sein kann, so grausam ist nur das Leben! Das beschissene Leben!
Er kannte die Geschichte der Verstorbenen. Seine Eigene war nicht weniger leicht zu verkraften gewesen. Waren sie im Schicksal vereint gewesen? Sie und er? Wer wusste das schon?
Geschichten. Schicksalsschläge. Was sollte das?
Was sollte es zum Beispiel: dass Eltern ihr eigenes Kind töten? Wie es dieses eine Ehepaar vor einigen Jahren getan hatte, als Michael noch ein junger Auszubildender gewesen war. Dieses Verbrechen, das sich ereignet hatte, war ihn nicht nur ans Herz gegangen, sondern es hatte ihn zu tief betroffen gemacht, weil es ein Verbrechen war, das nur zwei Gemeinden entfernt von seinem damaligen Wohnort Strubendorf stattgefunden hatte.
Warum nehmen Menschen Verbrechen, die weit weg geschehen mal ebenso zur Kenntnis, aber geben sich betroffen, wenn es fast unmittelbar vor deren Haustüre geschieht, und warum hat es im Vergleich die Wucht eines Vorschlaghammers, wenn es einen selbst betrifft?, fragte sich Michael.
Nichtsdestotrotz war die Geschichte, die ihm mit einem Mal wieder einfiel, ein Verbrechen, was niemanden in Deutschland kaltgelassen hatte. Auch ihn nicht.
Es war die traurige Geschichte des kleinen Tobias.
Es war an einem Augusttag 1993. Der Fünfte des Monats, als die Mutter des kleinen Tobias, Gisela, lautstark in Bambergs Innenstadt um Hilfe gerufen hatte. Herbeigeeilte Passanten hatte sie berichtet, dass ihr eineinhalb Jahre junger Sohn, der eben noch neben ihr gestanden hatte, plötzlich verschwunden sei. Daraufhin hatten sich Passanten und Verkäuferinnen ein Herz gefasst und hatten sich der Mutter, die dann später einen Nervenzusammenbruch erlitten hatte, bei der Suche angeschlossen. Auch als die Polizei Gisela immer wieder befragt hatte, war sie bei ihrer Geschichte geblieben, dass ihr Sohn beim gemeinsamen Bummeln mit einem Mal verschwunden sei, während sie mit dem Kinderwagen und der sechs Wochen alten Tochter Jasmin darin vor einem Schaufenster gestanden hatte. Das ganze Land hatte um den verschwundenen Jungen gebangt als Giselas Mann Frank die vermeintlichen Entführer über die Medien angefleht hatte, dass sie ihren Jungen wieder haben wollen.
Auch um den göttlichen Beistand bei einem Geistlichen hatten die jungen Eltern gebeten.
Bitte beten Sie für uns!, hatte der Vater zu dem Dorfpfarrer gesagt.
Ja, das Leben kann schon grausam sein, wenn es Eltern seine Kinder nimmt, keine Frage.
Doch die Wahrheit war noch viel erschreckender gewesen.
Die späteren Ermittlungen der Polizei hatten ergeben, dass Gisela gemeinsam mit ihrem Mann, den kleinen Tobias schwer misshandelt hatten und er daraufhin an seinen Verletzungen verstorben war. Damit sein kleiner Körper anschließend in zwei schwarze Müllsäcke passte, hatten sie ihn Kopf und Gliedmaßen abgetrennt. Die Müllsäcke hatten sie auf einem Campingplatz in den Müll geworfen, von wo sie mit großer Wahrscheinlichkeit ihren Weg in die Müllverbrennung gefunden hatten.
Michael war es nach dieser Schreckensmeldung damals nicht anders ergangen, als unzähligen Menschen im ganzen Land auch. Das Bangen mit den Eltern hatte sich in Abscheu und Hass auf sie verwandelt. Kindestötung gehörte und gehört noch immer zu den unverzeihlichen Verbrechen, die ein Mensch begehen kann.
Michael hatte es damals nicht begriffen und begriff es heute genauso wenig: Was ist das nur für eine Welt?
Menschlichkeit. Gerechtigkeit. Fairness. Bah! Das sind doch nur schöne Worte, die im Moment so wenig wert hatten wie der Dreck, auf dem er stand.
Das Leben ist nicht fair. Oder war es vielleicht fair, dass er einen geliebten Menschen zu Grabe tragen musste?
Frank und Gisela waren damals zu Freiheitsstrafen wegen Körperverletzung mit Todesfolge und unterlassener Hilfeleistung und wegen Vortäuschung einer Entführung zu neun und sieben Jahren Haft verurteilt worden.
Sie hatten ihre Strafe bekommen. Doch wer bestraft die Verantwortlichen für dieses Verbrechen? Für das Verbrechen an der Toten, die da unten im weißen Sarg lag?
Vermutlich niemand!
Wieder schüttelte Michael fassungslos den Kopf.
Schon komisch, was einem so einfällt, wenn man aufs Leben schimpft und Gerechtigkeit fordert. Seine Trauerrede auf die Verstorbene hatte mehr einem Anklageplädoyer geglichen. Geschrieben im Schmerz und in Erinnerung an das junge Leben, das tot vor ihm lag, aber auch unbewusst geschrieben mit Schmerz aus seiner eigenen Seele.
Wenn er hier stand, und das Leben verfluchte, und nach dem Warum fragte, dann zu Recht.
Menschen können einander schon grausame Dinge antun. O ja! Michaels Seele hatte ebenfalls so einige Narben, die hin und wieder pochten und schmerzten.
Gestern hatte man noch gemeinsam gelacht, und plötzlich, von heute auf morgen, zerfiel eine Welt.
Das Leben kann genauso erbarmungslos sein wie der Regen, der Michael mittlerweile vollkommen durchnässt hatte. Er machte sich Vorwürfe wegen ihrem Tod, wegen des jungen Lebens, das hier beerdigt wurde. Schwere Vorwürfe. Hätte er sie doch nicht alleine gelassen, vielleicht könnte sie ja dann noch leben!
Gemeinsam gelacht, ja. Ein Schmunzeln bildete sich auf seinem kalten, nassen Gesicht, schmerzverzerrt, aber er lächelte. Hervorgerufen durch eine Erinnerung mit ihr, als die Verstorbene noch gelebt hatte.
„Ich liebe dich.“ Worte des Abschieds.
„Das hat sie bestimmt gehört“, sagte die Frau, die hinter ihn getreten war. Er erkannte die Frau wieder, er erkannte ihre Stimme, und gemeinsam gingen sie weg.
2
1980
Wenn Michaels Mutter den Holzofen anschürte, über dem sich der große Wasserboiler befand, dann wusste der Dreijährige, dass es wieder Samstag war. Und vielleicht noch deswegen, weil er heute nicht in den Kindergarten gemusst hatte. Alle anderen Tage waren nicht so schön wie der Badetag. Denn an diesen Tagen gab es „nur“ die Katzenwäsche mit dem Waschlappen. Baden machte einfach viel mehr Spaß. Wann hat man sonst schon die Gelegenheit mit seinen Playmobilfiguren im Wasser zu spielen?
Manchmal wünschte sich Michael, er hätte dieses Piratenschiff, das er schon oft durchs Schaufenster bewundert hatte. Anstatt sich mit der Seifenschale behelfen zu müssen, die nicht wirklich schwimmen wollte.
Doch heute dachte Michael nicht an das Piratenschiff aus dem Schaufenster. Heute beschäftigte ihn etwas ganz anderes. Es war jemand beerdigt worden. Ein Kind. Ein Kind in einem kleinen, weißen Sarg. Ein Mädchen war es wohl gewesen. Das Baby seiner Tante. Es war auf die Welt gekommen und war tot! Einfach so! So hatte er es zumindest verstanden. Warum?, fragte er sich. Er hatte keine Ahnung.
Die Tante hatte geweint. Und auch sein Onkel Eddi, sein Lieblingsonkel, hatte ganz traurig ausgesehen.
„Onkel Eddi. Onkel Eddi“, hatte Michael ihm zugeflüstert, als sie auf dem Friedhof gewesen waren und er an seinem Hosenbein gezupft hatte.
„Nicht jetzt, Michael. Später. Ja?“, hatte er zurück geflüstert. Und damit war Michael zufrieden gewesen, denn sein Patenonkel würde sich später für ihn Zeit nehmen, so hatte er es ja gesagt.
Und als sie den Friedhof verlassen hatten, hatte er sich Zeit für ihn genommen. Auch wenn es nicht dasselbe gewesen war wie sonst. Irgendwas war anders gewesen. Aber die Gründe zu verstehen, dafür war Michael zu jung gewesen. Er hatte sich stattdessen gefreut, als er erfahren hatte, dass er seinen Onkel heute sehen würde, und er hatte sich gefreut, als es dann endlich so weit gewesen war. Auch wenn die Stimmung heute etwas gedrückter gewesen war, war das Wiedersehen mit seinem Onkel Eddie trotzdem schön gewesen.
Michaels Mutter betrat das Badezimmer. Ihr Gesicht trug noch dieselbe Traurigkeit wie Stunden zuvor auf dem Friedhof. Eigentlich machte sie schon seit Tagen so ein bedrücktes Gesicht.
Wortlos nahm sie sich den Waschlappen vom Badewannenrand und Michael, der wusste, was nun anstehen sollte, stand auf um sich abwaschen zu lassen. Ihm gefiel das traurige Gesicht von seiner Mutter überhaupt nicht und er verstand es mit seiner kindlichen Unbekümmertheit auch nicht. Trotzdem machte er sich Gedanken, wie man die Stimmung seiner Mutter aufhellen könnte. Mit etwas Schönem kann man immer andere zum Lachen bringen. Und es war schön, dass er seinen Onkel Eddi gesehen hatte. Schon allein der Gedanke an ihn brachte Michael zum Lächeln, während er von seiner jungen Mutter mit dem Waschlappen gründlich und etwas grober als sonst gewaschen wurde. Vielleicht …? Ja, vielleicht würde sich ja seine Mama mit ihm freuen.
„Heute war es lustig!“, sagte er schließlich.
Michaels Mutter packte das blanke Entsetzen. Sie fragte nicht nach dem Wieso und Weshalb, oder nach dem tieferen Sinn der ausgesprochenen Worte, stattdessen sagte sie:
„Wenn du mal stirbst, dann lach‘ ich auch!“
3
2001
Die Dusche fühlte sich gut auf ihrem Körper an. Einem Körper, der sich mehr und mehr veränderte, und diesen sie deswegen immer weniger mochte. Etwas wärmer hätte das Wasser schon sein können, dachte sich Susanne, als der lauwarme Regen aus der Brause für Sekundenbruchteile ins Kältere gewechselt hatte.
„Verschwende nicht wieder das ganze warme Wasser!“, hatte ihre Mutter sie vorher noch ermahnt, noch bevor sie ins Bad gegangen war. Also stand Susanne nun unter noch kälterem Wasser als beim letzten Mal. Doch das machte ihr recht wenig aus, da sie sich eh beeilen wollte. Ihre Brüste wusch sie noch hastiger als alles andere.
Diese Brüste, die einfach nicht aufhören wollten zu wachsen. Als sie elf Jahre alt gewesen war, hatte sie sich noch gefreut, bald eine Frau zu sein. Doch nun mit ihren sechzehn Jahren hatte sie den größten Busen in ihrer Klasse. Sogar noch einen größeren als den von ihrer Lehrerin. Als Monstertitte wurde sie von ihren männlichen Mitschülern gehänselt. „Schaut mal, da kommt die Monstertitte!“
Solche Idioten! Alle miteinander!
Auch das Tragen von viel zu weiten Pullovern hatte nicht wirklich viel geholfen. Diese Ekelpakete wussten ja schließlich was sie darunter zu verbergen versuchte. Manni stach dabei als der Schlimmere von allen heraus. Nicht einmal eine Ermahnung der Lehrerin hatte ihn lange das Maul stopfen können, denn schon nach wenigen Tagen machte er dort weiter, wo er aufgehört hatte. Aus eben diesem Grund mochte Susanne an ihrem Körper die Brüste noch vor ihrem Hintern am allerwenigsten. Hin und wieder hatte sie sich schon gefragt, ob der sich ein Wettrennen mit ihren Titten liefern wollte. Sie fühlte sich schlichtweg einfach nicht wohl in ihrer Haut. Und immer diese gierigen Blicke von dem neuen Freund ihrer Mutter. Wolfgang, das Schwein!
Ihre Mutter nannte ihn Wolfi. Wolfi?! Für einen erwachsenen Mann einfach nur lächerlich! Dieser Hohlkopf glaubte doch wirklich, dass seine Stielaugen, die ihm jedes Mal beinahe aus dem Kopf fielen, nicht auffallen würden. Und all das nur wegen dieser verdammten Pubertät!
4
Im Wohnzimmer, nur ein paar wenige Meter weiter vom Badezimmer entfernt, indem sich die junge Brünette wusch, rekelte sich Susannes Mutter mit Wolfgang auf der Couch. Sie hatten sich gesucht und gefunden, denn beide hingen sie an der Flasche. Nur waren sie dafür zu kurzsichtig, um dies zu erkennen. Wir sind doch keine Säufer! Die Penner am Hauptbahnhof, oder die, die unter der Brücke schliefen, die hatten ein ernsthaftes Problem. Renate und Wolfgang bezogen zwar alle beide Hilfe vom Staat, aber das machte sie noch lange nicht zu Säufern. Kennengelernt hatten sie sich auf dem Arbeitsamt, als sie ihrer Pflicht nachgekommen waren und sich erneut arbeitslos – oder wie man auch so schön sagte: arbeitssuchend – gemeldet hatten.
In der Luft hing der Rauch mehrerer bereits gerauchter Zigaretten und der kleine Fernseher lief wie so oft einfach mal für die Katz. Vom Stockwerk darüber drang Kindergetrampel an Wolfgangs gesundem Ohr. Auf dem anderen war er seit einer wilden Schlägerei im vergangenen Jahr so gut wie taub. Unruhig wandte er sich hin und her und löste sich schließlich von den Lippen der 41-Jährigen, die halb auf ihm und halb auf der durchgelegenen, fleckigen Couch lag. Dann rollte er mit den Augen.
„Verdammte Kinder! Müssen die immer so rennen?“
Renate seufzte entnervt.
„Ja, ich hab der blöden Schlampe von oben schon tausend Mal gesagt, dass man das Getrampel ihrer Schratzen so laut hören kann. Hat die blöde Sau nicht wirklich interessiert.“
Wolfgang drückte Renate von sich herunter, um sich aufsetzen zu können. Dann griff er nach einer offenen Bierdose und trank mit gierigen Zügen.
Als er die leere Dose wieder absetzte, sagte er: „Kinder können echt nerven. Zum Glück hab ich nie welche gemacht!“
Mit beiden Armen umschlang Renate den Mann von hinten. „Heißt das, dass du mir kein Baby mehr machen willst?“ Noch bevor er sie fragen konnte, ob sie noch alle Latten am Zaun besitzen würde, kicherte Renate auch schon in sich hinein.
„Ich hab doch nur einen Witz gemacht, du Dummchen“, meinte sie schließlich, als sie ihre Umarmung wieder löste und ihn mit ihren ungepflegten, gelben Zähnen angrinste.
„Mir reicht auch das eine Maul, das ich zu stopfen habe!“
Sie schielte mit einem giftigen Blick hinüber in Richtung der Badezimmertür.
„Frag mich, was dieses Balg da drin so lange treibt?“
Wolfgang grinste dreckig.
„Vielleicht macht sie es sich ja gerade selber!“
Für diesen Spruch kassierte er von seiner Liebsten einen Ellbogenstoß in die Rippen, der ihn mit einem Uff! in sich zusammenklappen ließ.
„Du bist so ein Schwein!“, schimpfte sie, während sie gleichzeitig nach den Zigaretten auf dem Couchtisch griff.
„Mann, Schnecke! Das war doch nur ein Witz!“
Sie zog an der Zigarette und blies durch die Nase aus, dann grinste sie.
„Weiß ich doch. Und dass du so ein Schwein bist, liebe ich ja so an dir.“
Wolfgang grinste breit, womit er den Blick auf seine braunen Stumpen im Mund freigab, die mal Zähne gewesen waren.
„Dafür bekommst du von mir einen Kuss.“
Erneut zog Renate von ihrer Zigarette und öffnete dann leicht den Mund. Weit genug, sodass er das qualmende Spiel des konzentrierten Rauchs sehen konnte, dem sie ihm schließlich direkt ins Gesicht blies.
„Nicht jetzt.“
Das bekommst du wieder!, dachte sich Wolfgang, der wölfisch dreinsah, nachdem er zum Schutz seiner Augen, diese für dem Moment zusammengekniffen hatte. Nun schielte er zum Badezimmer hinüber, von wo er eindeutige Geräusche vernehmen konnte, die ihm verrieten, dass Susanne just in dem Moment aus der Dusche stieg.
„Du, Perle?“
Renate drückte ihre Zigarette im Aschenbecher aus, ehe sie antwortete.
„Ja, Schatz?“
„Was würdest du eigentlich mal von einem gepflegten Dreier halten?“
Renate hatte mit so einigen gerechnet, aber mit einer derartigen Frage nicht. Allerdings verstand sie nur Bahnhof.
„Was ist denn ein gepflegter Dreier?“
Einmal mehr rollte Wolfgang entnervt mit den Augen. Begriffsstutzige Weiber konnte er genauso wenig leiden wie Kindergetrampel.
„Ach, du weißt schon! Einen flotten Dreier, meine ich!“
„Warum sagst du dann nicht einen flotten Dreier?!“, zickte sie ebenso angepisst zurück. Wenn sie irgendetwas an ihrem Freund nicht leiden konnte, dann war es seine von jetzt auf gleich genervte Art. Dieser wiederum schimpfte in Gedanken auf alle Weiber dieser Welt, bevor er eine andere Schiene fuhr, indem er sein wölfisches Grinsen gegen einen unschuldigen Schafsblick tauschte.
„Ich wollte es einfach bisschen anständiger ausdrücken, Perle!“
Renate guckte blöde. „Wie kann man denn so was anständig ausdrücken, du Schwein?!“
Hektisch winkte Wolfgang ab. Er wollte zum Punkt kommen, noch bevor Susanne aus dem Bad kam.
„Mensch, das ist doch jetzt scheißegal!“
Die dürre Frau mit ihren ungepflegten, fettigen Haaren war ein Stück zurückgewichen, sie hatte nicht die Absicht, sich von seinen wild gestikulierenden Händen ein paar einzufangen. Dann platzte es aus ihm heraus, wobei sein Blick aussah wie der eines Geisteskranken.
„Was hältst du von einem flotten Dreier mit uns zwei und Susanne?“
5
Wenn Renate auf den Spruch ihres Freundes standesgemäß reagiert hätte, hätte sie ihn eigentlich eine herunterhauen müssen, das wusste sie auch. Aber da eine derartige Aktion möglicherweise zu einer Trennung führen würde, die sie nach Jahren der Entbehrung und der Einsamkeit nicht riskieren wollte, schon gar nicht, nachdem sie die vierzig überschritten hatte, beließ sie es bei einem bösen Blick. Dieser musste genügen, um ihren Standpunkt klarzumachen, denn ganz ohne wollte sie Wolfgang, dessen Miene sich mehr und mehr versteinerte, keinesfalls davonkommen lassen. Er hingegen stand zudem, was er gesagt hatte. Er hätte es zwar anders formulieren können, aber dieser Zug war längst abgefahren. Wie dem auch sei, er stand zu seinem Wort. Ein Mann, ein Wort – das war sein Leitsatz. Und es war genau dieser Standpunkt, der Renate schwer schlucken ließ, denn sie konnte seine Entschlossenheit förmlich spüren. Was sollte sie also tun? Sollte sie ihm doch eine scheuern? Das könnte sie machen. Doch vor ihrem geistigen Auge sah sie schon die Konsequenz in Form eines Echos. Eine zweite Option wäre, ihn für heute einfach vor die Tür zu setzen, nur stand sie damit wieder vor dem Problem, dass er möglicherweise nicht wieder zurückkommen würde. Er würde einfach verschwinden und das wäre es dann gewesen. Würde sie ihn fragen, was Susanne hatte, was sie nicht hatte, würde er möglicherweise den Altersunterschied als Begründung angeben. Na ja, Perle, ganz einfach: Du bist alt und sie ist jung!
So ein Schwein!, dachte sich Renate. Aber sie brauchte dieses Schwein. Zu einsam und zu schmerzhaft waren die Nächte der vergangenen Jahre gewesen.
Im Badezimmer klapperte wieder was. Susanne musste mit dem Abtrocknen fertig sein und musste ihren Bademantel vom Haken genommen haben, der in kantiger S-Form einfach oben über den Kanten der Tür hing. Renate, die hastig seinem zu allem entschlossenen Blick zur Badezimmertür folgte, schluckte ein weiteres Mal einen Kloß hinunter. Einen weitaus dickeren Kloß.
Und wenn mein Wolfgang sie erst einmal gefickt hat, dann könnte ich in Zukunft mit meinem verschrumpelten Körper nur noch dabei zusehen!, malte sie mit weiteren düsteren Gedanken den Teufel an die Wand.
Den dritten Kloß, den man schlucken muss, ist wohl immer der Schwerste!
„Ich komme gleich wieder“, sagte sie zögernd und stand genauso zögernd auf, als hätte sie bereits jetzt Arthritis in den Beinen. Dann hatte sie es plötzlich eilig aus dem Zimmer zu kommen. Wolfgang sah ihr nach.
Die muss jetzt bestimmt kotzen!, kicherte er innerlich, was in boshaft grinsen ließ. Renate schickte sich aber nicht, weil ihr das morgendliche Bier hochkam, sie verfolgte einen anderen Plan. Einen teuflischen Plan.
Auf ihren dünnen Beinen eilte sie an der Badezimmertür vorbei, die Susanne just im selben Moment von innen aufsperrte und auf den Flur trat, wo sie einmal mehr Wolfgangs gierigem Blick ausgeliefert war. Augen, die sie lüstern auszogen, um sonst was mit ihr anzustellen, worauf das junge Mädchen absolut keine Lust hatte, und das schon gar nicht mit so einem widerlichen Kerl wie Wolfgang. Schon der pure Gedanke erweckte in ihr Ekel, weswegen sie nicht verstand, warum ausgerechnet ihre Mutter auf ihn stand. Männer gibt es schließlich wie Sand am Meer, da kann man leicht einen anderen finden, wenn man nur will! Angewidert wandte sich Susanne ab und ging den mit Laminat ausgelegten Flur hinunter, an dessen Ende ihre Mutter mit eiskalten Augen in der offenen Wohnungstüre stand, als würde sie auf jemanden warten. Um dies zu erfahren hätte es nur wenige Worte bedarf, doch Susanne wollte so zügig wie nur möglich in ihrem Zimmer verschwinden, das zur Linken der Wohnungstüre lag. Renates Blick hatte etwas Entschlossenes an sich. Etwas, das man vielleicht noch in den Gesichtern von Attentäter sehen kann, die kurz davor sind zuzuschlagen. Als Susanne sie erreicht hatte, packte Renate auf einmal zu. Sie bekam den Bademantel zu fassen, an dem sie ihre zur Last gewordene Tochter erst zu sich heranzog, um dann mit ihr eine halbe Drehung zu vollführen, um sie anschließend wieder von sich weg und zur Tür hinauszubefördern. Alles passierte so schnell, so unfassbar schnell, dass die 16-Jährige gar nicht groß reagieren konnte. Eine Schrecksekunde, die Renate auszunutzen wusste, denn während ihre zur Konkurrentin gewordene Tochter nicht einmal im Ansatz begreifen konnte, wie ihr geschah, flog schon mit einem Wumms die Wohnungstüre ins Schloss. Ein Rauswurf, der für immer sein sollte. Eben noch im wohltemperierten Badezimmer, jetzt auf der Fußmatte im kalten Treppenhaus, stand Susanne fassungslos im sechsten Stock dieses Mietshauses inmitten der Mannertstraße, welche am äußersten Stadtrand von Frankfurt am Main lag, mit nichts weiter am Leib als ihren Bademantel. Mehr als diesen sollte sie auch nicht bekommen. Keine Unterwäsche, keine warme Kleidung, nichts! Als sich das Mädchen darüber im Klaren wurde, was soeben geschehen war, dass sie soeben vor die Tür gesetzt worden war, krampfte sich ihr Herz zusammen. Ein Schmerz, der ebenfalls ihre Kehle in Besitz nahm, was sich noch viel schlimmer anfühlte als damals, als sie eine Fischgräte verschluckt hatte. Dieser Schmerz stach wie tausend Nadeln. Und diesem war es auch geschuldet, dass sie in ihrer Qual nichts als stammelnde und fiepende Worte über die Lippen brachte.
„Ma … Ma … Mama? Mama … was machst du?“
Dann verlor sie das Gefühl für Zeit und Raum, das einherging mit dem Gefühl des freien Falls und dem einer Ohnmacht.
Renate stand mit der Stirn an die Türe gelehnt, ihre Arme angewinkelt dagegengestemmt, die Hände zu Fäusten geballt. Eine Körperhaltung, die unmissverständlich sagte: Hau ab, und komm nicht wieder! Du kommst hier nicht mehr rein!
Im Nächsten Moment wurde ihr allerdings klar, dass, so abweisend ihre Körperhaltung auch ein mochte, ihre Tochter diese ja gar nicht sehen konnte. Sie musste also deutlicher werden.
„Verschwinde, du Miststück, du hast mir lange genug die Haare vom Kopf gefressen!“
6
1997
Er war fest entschlossen, alles, was er hatte, zu vernichten, um diesen ersehnten ersten Kick, wiederzubekommen. All das Hasch zu rauchen und all das Speed zu schnupfen. Zu schön war er einfach gewesen, dieser allererste Kick, als er zum ersten Mal Crystal Meth durch die Nase gezogen hatte.
Na ja, okay, dachte sich Michael, vielleicht nicht wirklich alles! Da, von wo er das Zeugs bezogen hatte, würde es zwar mehr geben, aber wenn man eh schon bei seinem Dealer in der Kreide stand, wie er es tat, dann könnte sich das als schwierig erweisen, noch mehr Kredit zu bekommen. Michaels Bankkonto sah sogar noch schlimmer aus. Irgendwie war es nicht wirklich beruhigend, dass ihm niemand glauben wollte, dass er sich bereits mit über 9.000 Mark in den Miesen befand. Er wunderte sich selbst jedes Mal wieder aufs Neue, wenn der Geldautomat ohne Probleme zu machen die geforderten Scheine ausspuckte. So viel Schulden zu besitzen war schon belastend, doch sobald er das Geld in seinen Händen hielt, um es dann für ein Stück Hasch oder ein wenig Gras oder für etwas Speed eintauschen konnte, machte es die Sorgen vergessen.
Sorgfältig hackte er mit einer Rasierklinge das weiße grobkörnige Pulver, das er zuvor aus einem Briefchen entnommen und auf einen kleinen Spiegel zu einem winzigen Berg aufgehäuft hatte, feiner und noch feiner – je feiner, desto besser. Eigentlich besaß er bereits einen ganz ordentlichen Rausch, zwei Bongs gehen an keinem spurlos vorüber, aber er möchte unbedingt und auf Teufel komm raus dieses Gefühl erreichen, wie er es beim ersten Mal gespürt hatte. Damals, bei seiner allerersten Line, da war er ebenfalls ziemlich gut bekifft gewesen, weswegen sein Vorhaben theoretisch funktionieren müsste. So glaubte er jedenfalls.
Mit einigen bereits geübten Handbewegungen brachte er nun das fein gehackte Amphetamin mit der Rasierklinge in eine gleichmäßige dünne Linie. Auch bereits die Dritte an diesem Abend, und weiß Gott die wievielte an diesem Tag.
Sollte ihn aktuell jemand fragen, warum er Drogen nimmt, so bestünde die Antwort aus nicht mehr als einem Schulterzucken. Doch wenn er gezwungen war sich zu erinnern, dann wusste er es sehr wohl, er packte es einfach nicht mehr! So sagte man es in seinem Umfeld: Ich packe es einfach nicht mehr!
Seine Hoffnung lag jetzt in dieser einen Line. Diese musste einfach endlich die gewünschte Wirkung bringen, dieses Gefühl wie beim allerersten Mal. Schon allein der Anblick dieser Line wirkte befriedigend, so wie sie so vor ihm lag. Fünf bis sechs Zentimeter lang und etwa drei Millimeter dick. Auch der einzigartige Duft betörte ihn. Es gab nichts Vergleichbares was ihn so tief befriedigte. Michael nahm sich das in etwa fünf Zentimeter lange Stück Plastikröhrchen vom Tisch, das er sich irgendwann mal von einem dreimal so langen Trinkhalm abgeschnitten hatte, und steckte es sich ins rechte Nasenloch. Er benutzte zum Schnupfen ausschließlichTrinkhalme, da er die Meinung vertrat, dass nur Idioten Geldscheine benutzen würden. Dann setzte er an und schnupfte die Line ein.
Das Brennen in seiner Nasenhöhle kannte er bereits von unzähligen Linien, die er geschnupft hatte. Auch der bittere Nachgeschmack, den der hintere Teil seiner Zunge wahrnahm und dieser dann durch seine Speiseröhre hinunterlief. Das waren Empfindungen, die ihn bereits die erste Befriedigung verschaffte. Aber wo blieb dieses Gefühl? Dieses Gefühl wie beim ersten Mal? Endlich kam es über ihn. Er hatte es geschafft!
Oh Gott, danke!
Das Prickeln, welches sich wie eine ganze Armee Ameisen anfühlte, die über sein Gehirn krabbelten, das war dieses ersehnte Gefühl, das er beim allerersten Mal empfunden hatte. Und eben dies hatte er nie vergessen! Oh Gott wie hatte er das vermisst. Es war ein Gefühl der Schwerelosigkeit, eines Schwebens – Arm in Arm mit einem Gefühl des freien Fallens, und gleichzeitig ein Gefühl, einer nie dagewesenen Befriedigung. Für einen kurzen Moment frei sein von allem: keine Probleme, keine Schmerzen – und keine seelischen Qualen. Es war einfach nicht von dieser Welt. Doch irgendwas war anders! Irgendwas stimmte hier nicht! Irgendwas stimmte hier ganz und gar nicht!
Fuck, was ist los? Plötzlich wurde Michael von Panik ergriffen …
7
2001
So wölfisch grinsen wie Wolfgang es vorhin noch getan hatte konnte Renate auch. Von wegen! Du fickst mir keine anderen Weiber! Und schon gar nicht meine Tochter! Nicht, solange ich noch da bin!, dachte sie sich, als sie zurück ins Wohnzimmer kam und ihren verdutzt dreinschauenden Freund erblickte.
In seinem doofen Schafsblick mit offenem Mund stand nur eine Frage: Was hast du getan?
Mit jedem Schritt, den Renate näherkam, wiegte sie ihren Körper hin und her, womit sie allerdings keineswegs aussah wie nach dem Vorbild einer erotischen Tänzerin, sondern eher wie ein besoffener Matrose mit zwei Beinprothesen. Wolfgang sah sie mit einer einzigen, flüssigen Bewegung seines Kopfes von oben bis unten an. Das durchgeknallte Bild dieser Freibeuterin für Arme auf Landgang ließ ihn die eh schon auf halbmast offene Kinnlade noch gar herunterfallen.
Ist die nun völlig durchgeknallt?
Und während er sich noch selbst für sein Händchen für Frauen gratulierte – sarkastisch natürlich –, antwortete ihn Renate endlich.
„Du wirst hier keine andere ficken außer mich!“
Sie blieb vor ihm stehen, legte ihre Hände auf seine Schultern, schubste ihn zurück in die Rücklehne der Couch und setze sich dann breitbeinig auf seine Oberschenkel, sodass sie ihm direkt ins Gesicht sehen konnte.
„Hast du das verstanden?“
8
Der Schock saß noch nach wie vor tief und auf der Straße war es bitterkalt. Viel zu kalt, um nur mit einem Bademantel bekleidet bei Nacht hier draußen ins Ungewisse zu laufen. Aber was sollte Susanne tun, die soeben ihr Zuhause verloren hatte? Diese Frage stellte sie sich immer und immer wieder, während sie krampfhaft in dem einzigen, was ihr geblieben war, Schutz vor der Kälte suchte. Ebenso fragte sie sich, was sie zum Teufel noch mal getan hatte, um so bestraft zu werden. Ihr fiel beim besten Willen nichts ein. Wie auch, wenn der Kopf dicht gemacht hatte? So wusste sie nur eines, dass sie aus der Dusche direkt auf die Straße befördert worden war. In was für einen verdammten Film bin ich eigentlich? Und wieder fragte sie sich, was sie denn eigentlich falsch gemacht hatte. Wo sollte sie denn jetzt hin?
Sie fror. Die Tränen liefen ihr übers Gesicht. Langsam setzte sie einen Fuß vor den anderen. Sie musste gehen. Aber wohin wusste sie nicht. Ein Auto, das sich ihr von hinten genähert hatte, fuhr in Schritttempo neben sie her.
„Hey, du Schlampe, hast wohl kein Geld für einen richtigen Nuttenfummel, oder wie!?“, schrie der Beifahrer heraus. Dann gab das Auto Gas, womit das dämliche Lachen der Insassen in der Ferne von der Nacht verschluckt wurde. Susanne war mit ihren Gedanken zu weit weg, als dass sie darauf hätte reagieren können. Alles schien so unwirklich, so fremd.
9
Eine gefühlte Ewigkeit war sie einfach nur so dahin gelaufen. Ihr Blick haftete auf dem Gehweg.
„Nein … nein …“, stammelte sie. Und ihr Stammeln wurde zu einem schmerzhaften, stotterten Wimmern. „Wa … wa … warum?“
Mit jedem Schritt, den sie tat, klatschten ihre nackten Füße leise auf den kalten Asphalt, der alle paar Meter in ein gelbweißes Licht getaucht wurde. Aber nicht nur der Asphalt wurde gut ausgeleuchtet, sondern auch ihre zarten Füße, und sie konnte sehen, wie schmutzig diese bereits waren. Doch das berührte sie erst gar nicht, da sie es gar nicht erst registrierte.
Wo sollte sie denn jetzt hin?
Zu deiner Freundin! Geh zu deiner Freundin!, meldete sich eine innere Stimme. Wieder kam ein Fahrzeug von hinten angefahren. Und wieder fuhr es absichtlich langsamer.
Tut … tut …
Susanne schrak kaum merklich auf. Für einen kurzen Augenblick ließ sie ihren Blick vom Boden und versuchte, ohne den Kopf zu bewegen, nur mit Rollen ihrer Augen, über ihre Schulter zu spähen, was ihr natürlich nicht gelingen sollte, weswegen sie aufgab und wieder desorientiert auf den Gehweg starrte.
Wieder hupte es hinter ihr zweimal. Susanne machte einen Schritt zur Seite, und lief ganz dicht an der Hauswand entlang, in der Hoffnung, dass dieser Blödmann nun endlich zufrieden wäre und sie in Ruhe lassen würde. Ihr Bademantel schleifte am rauen Außenputz der Hausfassade irgendeines Hauses. Wie weit sie mittlerweile gelaufen war, wusste sie nicht. Ging es nach ihrer Wahrnehmung, einmal quer durch Frankfurt.
„Hey, Mädchen!“, rief jemand. Ein männlicher Jemand mit einem türkischen Akzent. „Hey, Mädchen, bleib doch mal stehen!“
Susanne tat wie befohlen. Wut stieg in ihr auf. Was würde denn jetzt kommen?, fragte sie sich. Will dieses blöde Arschloch mich jetzt fragen, was ich koste, oder was?
„Wo willst du denn hin, Mädchen? Vielleicht kann ich dich mitnehmen!“
10
1997
Michaels Pupillen hatten sich so sehr geweitet, dass das Schwarz fast vollständig das Braun der Iris vertrieben hatte. Das war aber nur ein geringes Problem. Das eigentliche Problem bestand darin, dass er vollkommen neben sich stand. Er hatte Mühe zu atmen. Sein Herz hämmerte im Takt eines Presslufthammers. Und der Schweiß trat ihn aus jeder Pore seines Körpers, womit er das Gefühl bekam, binnen eines Augenblicks klatschnass zu sein. Ein Trugbild. Denn es war allein seine Wahrnehmung, die ihn das Gefühl von Hitze vermittelte, wie unter der gnadenlosen Sonne der Sahara. Damit aber noch nicht genug. Die Möbel – der Fernseher, der Wohnzimmerschrank und das Regal mit der Plasmakugel – bekamen ein Eigenleben und wummerten wie Subwoofer auf einem Technokonzert. Gar so, als wären sie auf einer Wellenlänge mit Michaels erhöhten Pulsschlag, den jeden Notarzt der Welt umgehend in Alarmzustand versetzt hätte. Kurzum: Er hätte den Krankenwagen angewiesen auf der Fahrt in die Klinik den ein oder anderen Rekord zu brechen. Doch das kam für Michael überhaupt nicht infrage. Er würde lieber seinen eigenen Tod in Kauf nehmen, als dass das Geheimnis um seine Drogensucht bekannt werden würde. Entdeckt zu werden würde nicht nur die Nachbarschaft in Kenntnis setzen, die einen Notarzteinsatz mit Sicherheit mitbekommen würden, es würde außerdem die Polizei auf den Plan rufen, was es tunlichst zu vermeiden galt. Nein, er musste selbst damit zurechtkommen, und das, obwohl er bis in die Zehenspitzen eine noch nie dagewesene Angst verspürte. Die wummernden Möbel und die Gegenstände darauf drohten damit, ihn anzuspringen. Dass das nur in seinem Kopf geschah und außerdem gegen jedes Naturgesetz sprach, kam Michael gar nicht erst in den Sinn, da er körperlich und geistig nur noch auf dem Zahnfleisch kroch, weswegen er auch ein Übermaß an Kraft benötigte, um von der Couch auf den Boden zu gleiten, da Gehen nicht zur Option stand. Wie sollte das außerdem funktionieren, wenn die Beine bereits ihren Dienst quittiert hatten? Trotzdem musste er es ins Schlafzimmer zu seiner Freundin schaffen … egal wie. Alternativ hätte er rufen können, doch dazu fehlte ihm die Luft, und gerade jetzt benötigte er jeden Atemzug, um bei Bewusstsein zu bleiben. Denn sollte er hier und jetzt ohnmächtig werden, dann wäre das sein Todesurteil, so seine Befürchtung. Diese zum Trotz kämpfte er sich mit aller Kraft aus der Bauchlage hoch auf alle viere. Ins Schlafzimmer wären es ein paar Meter, doch in diesem Zustand, in dem er sich befand, waren diese paar Meter vergleichbar mit einem Aufstieg auf die Zugspitze.
Schon allein zum Umrunden des Tisches hatte er Minuten gebraucht. Vielleicht auch weniger, er wusste es einfach nicht, da er sein Zeitgefühl vollkommen verloren hatte. Nur noch ein kleines Stück, dann hatte er die Tür zum Flur erreicht. Bis hierhin war es bereits ein Kampf gewesen. Und dieser war noch nicht zu Ende.
11
2001
Susanne verdrehte Augen. Sie war mit ihrem Nerven am Ende, und das Letzte, was sie benötigte, war dieses Gequatsche von diesem Vollhorst: Hey, Mädchen! Hey, Mädchen! Was wollte dieser Depp?
Langsam wie ein Häufchen Elend drehte sie sich um. Sie fror. Deswegen zitterte sie. Sie war wütend und verletzt zugleich. Deswegen sagte ihr Blick Verpiss dich!
Auf der Straße stand ein roter BMW, dessen Motor noch lief und dessen Scheinwerfer noch brannten. Über das Dach hinweg sah sie ein südosteuropäischer aussehender Mann an, ein Bein auf der Straße, ein Bein im Fahrzeug. Sein Blick wies sanfte und zugleich fragende Züge auf.
„Sag mal, Mädchen, ist dir nicht kalt?“, fragte er im guten Deutsch mit leichtem südosteuropäischem Akzent.
Was du nicht sagst, du Arschloch!, dachte sich Susanne, die ihn ihrem Bademantel natürlich wie Espenlaub fror. Einen Augenblick wartete der Mann ab. Als jedoch die Frau keine Anstalten dazu zeigte, auch nur irgendetwas zu sagen, übernahm er wieder das Reden.
„Kann ich dich irgendwohin mitnehmen?“
Irgendwohin mitnehmen? In Susannes Gesicht stand ein großes Fragezeichen. Mit offenem Mund sah sie auf den Weg zurück, auf dem sie gekommen war und erschrak, da sie erkannte, dass ihr Zuhause schon mehrere Querstraßen weit zurücklag. Sie war doch eben erst losgelaufen! Tatsächlich hatte sie gefangen in ihrem Schock bereits eine Stunde Wegzeit hinter sich gebracht. Sechzig Minuten, in der sie nur funktioniert, aber nicht wirklich etwas wahrgenommen hatte. Jetzt, da sich der Nebel in ihrem Kopf nach und nach lichtete, kam Stück für Stück die Erinnerung wieder. Mehrere Fahrzeuge große wie kleine waren an ihr vorbeigefahren. Darunter auch das Auto mit diesen beiden Blödmännern: Hey, du Fotze, hast wohl kein Geld für einen richtigen Nuttenfummel, oder wie?! – oder so ähnlich. Auch was die Querstraßen anbelangte, kristallisierten sich einzelne Fragmente heraus. Ihr Zuhause war weit weg.
„Sag mal, Mädchen, ist mit dir alles in Ordnung?“
Dieser Satz holte sie aus ihren Gedanken. Hastig blickte sie wieder rüber zu dem Mann mit dem roten BMW.
„Was?“, stammelte Susanne.
„Ob mit dir alles in Ordnung ist, hab ich gefragt!“ Er hatte seine Stimme erhoben, aber sie klang nach wie vor sanft und einfühlsam. Dann musste er grinsen.
„Ich hab einen Cousin, der hat mal Stechapfel geraucht, und war genauso unterwegs gewesen wie du jetzt. Nur hatte der keinen Bademantel mit, wenn du verstehst, was ich meine.“
Susanne rang sich ein schmerzhaftes Lächeln ab. Aber nur ein kleines. Für mehr musste man schon weitaus mehr auffahren, als das Bild einer zugedröhnten, nackten Dumpfbacke. Und solange der BMW keine getarnte Zeitmaschine war, mit der sie ein oder zwei Stunden zurückkönnte, würde so schnell gar nichts in Ordnung kommen.
„Hast du auch Stechapfel geraucht?“, fragte der Mann halb im Scherz und halb im Ernst. Doch Susanne war auch ohne Zeitmaschine in die Mannertstraße zurückgekehrt, wo sie verzweifelt an der Wohnungstür im sechsten Stock kratzte.
„Was?“
„Mmh … okay … verstehe. Wart mal! Ich komm‘ mal zu dir rüber.“ Er schlug die Autotür zu und eilte anschließend um den Wagen herum, bis er mit einem Mal vor ihr stand. Jetzt so unmittelbar vor ihr staunte er nun doch metergroße Bauklötze, denn erstens sah die Frau plötzlich viel jünger aus, als eben noch, und zum zweiten hatte er es gar nicht registriert, dass sie unter dem Bademantel splitterfasernackt war.
„Mmh? Nein, mein Cousin hatte größere Pupillen als du!“, sagte er schließlich, während er kaum wahrnehmbar mit dem Kopf schüttelte. Mit anderen Worten: Nein, keine Anzeichen von Drogen! Du bist so sauber wie Allahs Augapfel!
Die Bemerkung über ihre Pupillen zwang Susanne ein weiteres Lächeln ab, was aus ihrer Sicht vollkommen verständlich war, da sie momentan alles Positive gebrauchen konnte, was sie bekommen konnte, selbst wenn es ein nicht ganz ernstgemeinter Drogenschnelltest war. Tränen, die sie vorhin noch geweint hatte, waren bereits versiegt und schimmerten im Licht der Straßenlaterne als ein dünner Film auf ihren Wangen.
„Wie heißt du denn?“, fragte der Mann, der nicht älter als fünfunddreißig sein konnte.
„Susanne“, erwiderte sie schüchtern.
Nickend nahm er die Antwort zur Kenntnis, aber zeigte gleichzeitig an, dass er auf noch mehr Informationen wartete.
„Susanne. Und weiter?“
Aber Susanne antwortete nicht, da sie abermals von düsteren Schatten eingeholt wurde.
Schatten bestehend aus Erinnerungsfetzen, die ihr zum wiederholten Mal in seiner ganzen Härte den Film über ihren unfreiwilligen Auszug mit anschließendem Nervenzusammenbruch zeigten, wie sie fortwährend geschluchzt und geklopft hatte.
Solange bis sie die Furie in ihrer Mutter geweckt und sie durch die verschlossene Türe gekreischt hatte, dass sie sich zum Teufel scheren soll.
Du hast mir schon deinen Vater vertrieben, aber Wolfgang wirst du mir nicht vertreiben! Verschwinde endlich! Worte so hart und so endgültig wie der Tod selbst.
Susanne sah auf. Vor ihr stand ja immer noch dieser Mann, der sie immer noch fragend ansah.
„Was?“
Manchmal kommt es vor, dass die Verwirrung des einen auf den anderen überspringt, und so musste auch der Mann für den Augenblick eines Moments darüber nachdenken, was er noch vor wenigen Sekunden erst gefragt hatte.
„Ähm …?“
Dann fiel es ihm wieder ein, woraufhin er direkt einen zweiten Versuch startete, für den er direkter, aber noch ein Ticken sanfter vorgehen wollte. Und was wäre sanfter als Händchen halten? Der Mann nahm gleich beide, womit er nun die volle Aufmerksamkeit besitzen sollte. So hoffte er zumindest. Denn wie heißt es so schön? Die Hoffnung stirbt zuletzt.
„Mensch, Mädchen. Wie du noch heißt, hab ich gefragt.“
Als Antwort weinte sie eine einzelne Träne, die sich ihren Weg über die zitternde Haut ihrer Wange bahnte, von der sie schließlich herabtropfte und auf dem dicken Stoff des Bademantels landete, wo sie im Nu aufgesogen wurde, gar so als wäre sie ein Sinnbild von Susannes geistigen Zustand, denn obwohl ihr der Mann direkt in die Augen sah war sie weit, weit weg.
„Was?“
„Okay, wir kommen hier wohl nicht weiter, Susanne. Pass auf, du kommst jetzt mit mir mit! In meinem Auto ist es schön warm. Du bist ja vollkommen durchgefroren, deine Hände sind eiskalt. Du weißt schon, dass wir Januar haben, oder?“
Susanne reagierte wie ferngesteuert: leere Auge, ein ungläubiger Gesichtsausdruck, ein geflüstertes Wort, das sich wie eine Frage anhörte: „Januar?“
12
1997
„Spring schon!“, riefen die Bäume, die zornig im Wind wehten. Dunkel und teuflisch lächelte der Nachthimmel. Und das schwarze Loch zu seinen Füßen hatte alle Zeit der Welt, bis es endlich so weit sein würde, um das Kind in seine Arme zu schließen. Todesangst ließ ihn hier kämpfen, lieh ihn die nötige Kraft, sich diesen Mächten entgegenzustemmen. Einen Kampf, den er nur schwer gewinnen konnte, und das wusste er auch – wenn dieser überhaupt zu gewinnen war.
Wild flatterte das Totenhemd im Sturm, während der Träger, Michael, eine nie dagewesene Angst erlebte. Von irgendwoher hörte er die Stimme seiner Mutter: Ich schlag‘ dich noch tot, du Krüppel!
Zudem tauchte wie ein Hologramm das Bild eines weiteren Peinigers aus seiner Kindheit auf: Das zähnefletschende Gesicht des zwei Jahre älteren Jungen aus der Nachbarschaft, der ihn bei jeder Gelegenheit, ob auf dem Schulweg oder direkt vor dem Zuhause, verprügelt hatte, und das mit aller Kraft, zu der er imstande gewesen war. Mit einer harmlosen Rangelei unter Jungs hatte das nichts mehr zu tun gehabt, das war purer Hass gewesen. Der Stärkere gegen den Schwächeren; ein von den Eltern vernachlässigte Arschlochkind auf der Suche nach einem geeigneten Ventil.