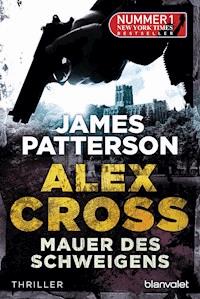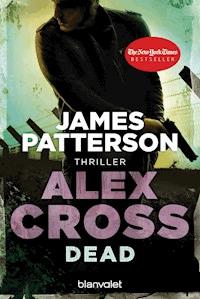8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Limes Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Women's Murder Club
- Sprache: Deutsch
Eine Serie von seltsamen Morden und ein schrecklicher Verrat, der Detective Lindsay Boxer alles kosten könnte – der neue Pageturner des internationalen Bestsellerautors!
Vor einem Jahr schien Lindsay Boxers Leben noch perfekt. Doch nun steht der Bombenleger, den sie damals mithilfe ihres Mannes Joe dingfest machen konnte, vor Gericht und wirft verheerende Fragen über dessen Beteiligung an den Ermittlungen auf. Lindsay weiß nicht mehr, wem sie vertrauen soll – dem Mann, den sie liebt, von dem sie aber verraten wurde, oder doch dem vermeintlichen Verbrecher. Und als wäre das nicht genug, wird San Francisco auch noch von einer Reihe mysteriöser Todesfälle erschüttert. Haben diese womöglich ebenfalls mit der Gerichtsverhandlung zu tun?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Buch
Vor einem Jahr schien das Leben Lindsay Boxers noch perfekt. Doch nun steht der Bombenleger, den sie damals mithilfe ihres Mannes Joe dingfest machen konnte, vor Gericht und wirft verheerende Fragen über dessen Beteiligung an den Ermittlungen auf. Lindsay weiß nicht mehr, wem sie vertrauen soll – dem Mann, den sie liebt, von dem sie aber verraten wurde, oder doch dem vermeintlichen Verbrecher. Und als wäre das nicht genug, wird San Francisco auch noch von einer Reihe mysteriöser Todesfälle erschüttert. Haben diese womöglich ebenfalls mit der Gerichtsverhandlung zu tun?
Autor
James Patterson wurde 1947 geboren. Seine Thriller um den Profiler Alex Cross machten ihn zu einem der erfolgreichsten Bestsellerautoren der Welt. Inzwischen erreicht auch jeder Roman seiner packenden Thrillerserie um den »Women’s Murder Club« regelmäßig die Spitzenplätze der Bestsellerlisten. James Patterson lebt mit seiner Familie in Palm Beach und Westchester, N.Y.Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
James Patterson
mit Maxine Paetro
Der 16. Betrug
Thriller
Deutsch von Leo Strohm
Die Originalausgabe erschien 2017 unter dem Titel »16th Seduction« bei Little, Brown and Company, Hachette Book Group, New York.Die Figuren und Ereignisse in diesem Buch sind fiktional. Ähnlichkeiten zu realen Personen, lebend oder verstorben, wären rein zufällig und vom Autor nicht beabsichtigt.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2017 by James Patterson
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2020 by Limes in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Gerhard Seidl, text in form
Umschlaggestaltung und -motiv: www.buerosued.de
DN · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-25613-5V001www.limes-verlag.de
Für Harry Cronin
Prolog
Der Mann, der J. genannt wurde
1 Es war ein schwüler Vormittag im Juli. Mein Partner Rich Conklin und ich hatten uns in einem der verrufensten Stadtviertel von San Francisco mit einer der höchsten Kriminalitätsraten der ganzen Stadt, dem Tenderloin District, auf die Lauer gelegt. Unsere 1998er Chevy-Limousine parkte an einer Stelle, von der wir freie Sicht auf das sechsgeschossige Wohnhaus an der Ecke Leavenworth Street und Turk Street hatten.
Es heißt ja immer, ein Beschattungsauftrag sei noch langweiliger, als frischer Wandfarbe beim Trocknen zuzuschauen, aber das hier, das war die Ausnahme von der Regel.
Wir waren aufgekratzt und zu allem entschlossen.
Erst vor Kurzem waren wir in eine Sonderkommission zur Terrorismusbekämpfung berufen worden, die dem Polizeichef des San Francisco Police Department, Warren Jacobi, sowie Dean Reardon, stellvertretender Direktor des Heimatschutzministeriums in Washington, D. C., unterstellt war.
Diese Sonderkommission war eine gezielte Maßnahme gegen die Bedrohung durch eine international operierende Terrorgruppe namens GAR, die für insgesamt sechs katastrophale Bombenanschläge innerhalb der vergangenen fünf Tage verantwortlich war.
Zumindest eines schien klar zu sein: Die ethnische Zugehörigkeit der Opfer spielte für die Attentäter keine Rolle. Die Bomben waren in drei Gotteshäusern – einer Moschee, einer Kirche und einer Synagoge – sowie an zwei Universitäten und einem Flughafen explodiert und hatten in sechs verschiedenen Ländern insgesamt über neunhundert Menschen jeder Hautfarbe und jeden Alters getötet.
Soweit wir wussten, war der GAR (Great Antiestablishment Reset) aus den Überresten verschiedener Terrororganisationen des Nahen Ostens entstanden. Ein paar überlebende Anführer hatten junge Aufrührer von überall auf dem Erdball zusammengetrommelt, darunter auch eine stattliche Anzahl Fanatiker aus den westlichen Industrienationen, die mit der digitalen Revolution aufgewachsen waren.
Die Identität dieser Attentäter ließ sich unmöglich feststellen, da der GAR seine Aktivitäten im Darknet versteckte – jenem Bereich des weltumfassenden Internets, der sich perfekt als Versammlungsort für all diejenigen eignete, die sich treffen wollten, ohne einander jemals zu begegnen.
Nichtsdestotrotz brachten diese Leute im echten Leben echte Menschen um.
Und anschließend brüsteten sie sich damit.
Nachdem der GAR ein ganzes Jahr lang unschuldige Opfer verbrannt, gequält und in die Luft gesprengt hatte, war er endlich mit seinen Zielen an die Öffentlichkeit gegangen. Sie ließen sich auf einen einfachen Nenner bringen: jedes Land auf der Welt zu unterwandern und religiöse Institutionen, Staaten und Behörden aller Art zu Fall zu bringen. Ohne einen wirklichen Anführer oder eine Art Hauptquartier konnte man die Gruppe jedoch nur sehr schwer angreifen, und bis jetzt war jedes Bestreben, diesem Open-Source-Terrorismus Einhalt zu gebieten, genauso wirkungsvoll gewesen wie der Versuch, mit bloßen Händen die Ausbreitung von Giftgas zu verhindern.
Aufgrund der erbarmungslosen Anschlagsserie des GAR herrschte an diesem Wochenende rund um den 4. Juli, dem US-amerikanischen Nationalfeiertag, in San Francisco wie in den meisten Großstädten erhöhte Alarmbereitschaft.
Conklin und ich hatten nur sehr spärliche Informationen über die Hintergründe unseres Auftrags erhalten. Wir wussten lediglich, dass ein mutmaßlicher GAR-Terrorist, der J. genannt wurde, seit Neuestem ganz oben auf unserer Liste der zu beobachtenden Personen stand.
Während der vergangenen Tage war J. mehrfach gesehen worden, wie er das graubraune Mietshaus an der Ecke Turk und Leavenworth mit den beiden Feuerleitern und dem einsamen Baum, der neben der Haustür aus dem Bürgersteig wuchs, verlassen und wieder betreten hatte.
Wir hatten den Auftrag, die Augen offen zu halten und jeden seiner Schritte per Funk weiterzumelden, und das, obwohl auf irgendeinem Luftwaffenstützpunkt in Nevada oder Arizona oder vielleicht auch in Washington, D. C., ebenfalls Leute saßen, die die Kreuzung via Satellit genau im Auge hatten.
Wir sollten nichts anderes tun, als zu beobachten. Als dann eine männliche Gestalt, die eine gewisse Ähnlichkeit mit dem grobkörnigen Foto aufwies, das wir bekommen hatten – Vollbart, 1,75 Meter groß, Mütze –, das graubraune Mietshaus verließ, sahen wir aufmerksam hin.
Als die Gestalt die Straße überquerte und sich in den weißen Kühllaster setzte, der vor dem T. L. Market and Deli parkte, meldeten wir es weiter.
Conklin und ich sind schon so lange Zeit Partner, dass wir beinahe unsere Gedanken lesen können. Wir wechselten einen Blick und wussten, dass wir nicht einfach nur zuschauen konnten, wie ein mutmaßlicher Terrorist durch die Straßen unserer Stadt fuhr.
Ich sagte: »Wenn wir ihn beobachten wollen, müssen wir ihn verfolgen.«
Rich erwiderte: »Ganz kurz, Lindsay, okay?«
Sein Telefonat mit Deputy Reardon dauerte nur wenige Sekunden, dann reckte er den Daumen nach oben, und ich ließ den Motor an. Zwei Wagenlängen hinter dem weißen Lastwagen mit einem vermutlich brandgefährlichen Terroristen namens J. am Steuer reihten wir uns in den Verkehr ein.
2 Ich lenkte unseren haifischförmigen Chevy die Turk Street entlang und bog dann nach links ab auf die Hyde Street, hielt immer so viel Abstand zu J.s Kühllaster, dass ich nicht in seinem Rückspiegel auftauchte, ihn aber trotzdem noch sehen konnte. Nach mehreren schnellen Abbiegemanövern verlor ich ihn jedoch bei einer roten Ampel an der Tenth Street aus dem Blick. Ich musste mich in Sekundenbruchteilen entscheiden.
Und ich entschied mich dafür, Gas zu geben.
Mit schweißnassen Händen jagte ich über die Kreuzung. Das schrille Hupkonzert, das ich damit auslöste, bescherte uns eine Menge Aufmerksamkeit, und das war alles andere als erfreulich.
Conklin sagte: »Da vorne ist er.«
Der weiße Lastwagen bewegte sich in einem Pulk aus mehreren anderen Fahrzeugen ungefähr mit der erlaubten Höchstgeschwindigkeit fort. Ich hielt mich in sicherem Abstand dahinter, dann bog der Kühllaster auf die US Route 101 nach Süden in Richtung San José ab.
Der Highway war schön breit und gut befahren, sodass J. unseren Chevy nicht entdecken würde.
Conklin war ununterbrochen am Funk und wechselte immer wieder den Kanal, um entweder mit dem Polizeichef Warren Jacobi oder mit Dean Reardon, dem drei Zeitzonen entfernten stellvertretenden Direktor der Heimatschutzbehörde, zu sprechen. Derweil hielt uns die Funkzentrale über die Standorte und Fahrtrouten der anderen Einheiten unserer Sonderkommission auf dem Laufenden. Zusammen bildeten wir eine Art gestaffelter Karawane, sodass wir uns immer wieder abwechseln, Fahrspuren kreuzen und abwechselnd schneller oder langsamer werden konnten.
Wir verfolgten also J.s Lastwagen. Nach rund zwanzig sonnenbeschienenen Kilometern auf der 101 in Richtung Süden fuhr er nicht etwa weiter an der Bucht entlang nach San José, sondern nahm die Abbiegespur zum Internationalen Flughafen.
Conklin sprach mit Jacobi.
»Chef, er will zum Flughafen.«
Aus dem Funkgerät drang ein Gewirr aus mehreren, knisternden Stimmen, aber ich hielt den Blick starr auf den Kühllaster gerichtet, der sich in gleichmäßigem Tempo dem Internationalen Flughafen von San Francisco näherte.
Dieser Kühllaster war im Augenblick das am meisten besorgniserregende Fahrzeug, das ich mir vorstellen konnte. Der GAR hatte uns alle für die schlimmsten nur denkbaren Katastrophen sensibilisiert, und in ein Fahrzeug dieser Größe passte eine Menge Sprengstoff. Ein Terrorist musste kein Flugzeug besteigen, ja, er musste nicht einmal einen Flughafenterminal betreten. Ich konnte mir gut vorstellen, wie J. mit seinem Kühllaster in die Schalterhalle raste und durch die Plexiglasscheiben brach, bevor er schließlich die Bombe zündete.
Conklin hatte sein Gespräch mit Jacobi mittlerweile beendet und sagte zu mir: »Lindsay, die Flughafensicherheit setzt Feuerwehren und Baufahrzeuge ein, um sämtliche Zufahrtsstraßen zum Flughafen zu blockieren.«
Gut.
Ich gab Vollgas und schaltete die Sirenen ein. Die anderen, die noch weiter hinter uns waren, taten es mir nach, und ich sah, wie aus Norden Blinklichter auf die Anliegerstraße neben dem Highway abbogen.
Pkw wichen auf den Randstreifen aus, um uns durchzulassen, und schon nach wenigen Sekunden, bei der Einfahrt in den Bereich für die internationalen Abflüge, überholten wir J.s Lastwagen.
Über uns tauchten Schilder mit den Namen verschiedener Fluggesellschaften auf, und auf der rechten Seite erhob sich das Parkhaus des Flughafens. Unter unserer Fahrspur, die jetzt zur Überführung geworden war, kreuzten sich Ausfahrtrampen und Zubringerstraßen. Die Konturen des Terminalgebäudes kamen stetig näher.
Rich und ich fuhren an der Spitze einer ganzen Gruppe von Fahrzeugen auf den Flughafen zu. Dann sah ich, wie sich vom Terminal aus mehrere Streifenwagen in unsere Richtung in Bewegung setzten.
Ein Zangenangriff in Hochgeschwindigkeit.
J. sah, was los war. Jetzt hatte er nur zwei Möglichkeiten: weiterfahren oder anhalten. Er riss das Lenkrad nach rechts, und sein Lastwagen schlitterte auf die äußerste rechte Fahrspur, wo noch eine letzte Ausfahrt zu einer Tankstelle führte. Hundert Meter weiter besaß die Tankstelle einen Anschluss an die South Link Road. Der Anschluss war offen und unbewacht.
Ich brüllte: »Festhalten!«
Dann zog ich links an dem weißen Lastwagen vorbei, trat das Gaspedal bis zum Anschlag durch, riss das Steuer herum und blockierte die Ausfahrt. Im allerletzten Augenblick, als ich mich innerlich schon auf einen Zusammenprall gefasst gemacht hatte, riss J. das Steuer nach links und schlitterte an uns vorbei.
Inzwischen war die Zufahrt zum Flughafen voller Streifenwagen mit blinkenden Lichtleisten und jaulenden Sirenen.
Mit kreischenden Reifen kam der Kühllaster zum Stehen.
Das Adrenalin hatte meine Herzfrequenz in ziemlich ungesunde Höhen getrieben, und ich war schweißgebadet.
Rich und ich erkundigten uns gegenseitig, ob wir unverletzt waren, während die Streifenwagen uns von allen Seiten einkesselten und eine undurchdringliche Mauer bildeten.
Ein Beamter der Flughafensicherheit wandte sich mit einem Megafon an J.
»Steigen Sie aus dem Fahrzeug. Hände über den Kopf. Na los, nun kommen Sie schon raus. Niemand will Ihnen etwas antun.«
Würde J. jetzt durchdrehen?
Ich stellte mir vor, wie der ganze Kühllaster von einer Explosion zerfetzt wurde, während ich gut zehn Meter entfernt in einer altersschwachen Limousine hockte. Für einen Moment blitzte vor meinem inneren Auge ein Bild meiner kleinen Tochter auf, wie sie heute Morgen in ihrem entenkükengelben Strampler am Tisch gesessen und mit dem Löffel auf die Tischplatte geklopft hatte. Würde ich sie je wiedersehen?
Jetzt schwang die Beifahrertür des weißen Lasters auf, und J. sprang heraus. Eine vielfach verstärkte Stimme dröhnte: »Keine Bewegung! Hände über den Kopf!«
J. ignorierte die Warnung.
Er rannte quer über alle vier Fahrspuren bis zu der Betonmauer, warf einen Blick über die Brüstung und hielt inne.
Zwischen ihm und der darunter liegenden Straße lagen zwölf Meter Luft, sonst nichts.
Die ersten Schüsse fielen.
Ich sah J. springen.
Rich brüllte mich an: »Runter!«
Wir duckten uns unter das Armaturenbrett und verschränkten die Hände im Nacken, als eine dröhnende Explosion unser Fahrzeug durchschüttelte, die Alarmanlage auslöste und uns mit ihrem grellen Licht blendete.
Dieses miese Arschloch hatte seine Bombe gezündet.
3 Rich und ich saßen in unserem Auto in der Parkverbotszone vor dem Flughafengebäude und konnten immer noch nicht fassen, was sich da gerade eben in etwa zweihundert Metern Entfernung abgespielt hatte.
Wir hatten gesehen, wie J. von der Zufahrt zum Abflugterminal auf eine Zubringerstraße gesprungen war, und wussten, dass er noch vor dem Aufprall seine Sprengweste gezündet hatte.
Wir hatten uns überlegt, was er sich dabei gedacht hatte. Im Moment erschien es uns am wahrscheinlichsten, dass er auf keinen Fall festgenommen werden, auf keinen Fall mit uns reden wollte.
Conklin sagte: »Vielleicht hat er ja geglaubt, er könnte gesund und munter auf einem unterhalb vorbeifahrenden Fahrzeug landen, so wie in einem Jackie-Chan-Film.«
Als sich eine Gestalt zum Seitenfenster hereinbeugte, zuckte ich vor Schreck zusammen. Die Gestalt war Tom Generosa, Leiter der Abteilung Terrorismusbekämpfung. Er wollte uns auf dem Laufenden halten.
»Also, bisher wissen wir Folgendes«, sagte er. »Der Kerl, den ihr J. nennt, wollte einen Massenmord begehen, das steht außer Frage. Seine Sprengweste war eindeutig darauf ausgelegt, vollgestopft mit Nägeln und Kugellagern und Rattengift. Das verhindert die Blutgerinnung. Die Sprengladung sollte die Splitterteile in alle Richtungen jagen, und das hat sie auch getan. Allerdings hat der Laster den Großteil der Ladung abbekommen. Das einzige Todesopfer war der Terrorist selbst.«
Ich nickte, und Generosa fuhr fort:
»Die Nägel und das andere Zeug haben seinen gesamten Körper und alles, was er möglicherweise bei sich gehabt hat, in winzige Fetzen gerissen. Er hat einen Krater im Straßenbelag hinterlassen und dazu jede Menge menschliches Gewebe und Bombensplitter.«
»Und der Lastwagen?«, erkundigte ich mich.
»Die Sprengstoffexperten haben ihn bereits freigegeben. Das FBI will ihn auf einen Tieflader hieven und ins Labor schaffen. Fest steht, dass J. das Fahrzeug vom Markt in der Turk Street gestohlen hat. Vielleicht finden wir am Lenkrad sogar seine Fingerabdrücke, aber es würde mich nicht überraschen, wenn wir ihn trotzdem nicht identifizieren könnten.«
Des Weiteren berichtete Generosa, dass Bundesbeamte und die Kriminaltechniker des San Francisco Police Department gerade dabei waren, den Ort der Explosion zu untersuchen. Sobald alles gründlich vermessen und fotografiert war, würden die Überreste des Mannes, der J. genannt wurde, sowie des Sprengkörpers per Kühltransport in die Labors des FBI und des SFPD gebracht werden.
Natürlich hatte J.s Bombe den Betrieb auf dem Internationalen Flughafen von San Francisco zum Erliegen gebracht.
Sämtliche Passagiere waren mit Bussen zu anderen Flughäfen transportiert worden. Keine einzige Maschine durfte starten oder landen. Wir konnten mit eigenen Augen sehen, dass es in den Flughafengebäuden von Beamten der CIA, des FBI, des Heimatschutzes und der Flughafensicherheit sowie den dazugehörigen Sprengstoffhunden nur so wimmelte.
Generosa konnte nicht mit Sicherheit sagen, wie lange der Flughafen außer Betrieb sein würde, doch so nachteilig sich das auch auf die Fluggesellschaften, ihre Passagiere und den Luftverkehr im Allgemeinen auswirken mochte, zumindest war am heutigen Tag in San Francisco ein Anschlag des GAR vereitelt worden.
Wir bedankten uns bei Generosa.
Er verabschiedete sich mit einem »Machen Sie’s gut« und ging zum nächsten Wagen weiter. Als wir gerade zum Funkgerät greifen und um weitere Anweisungen bitten wollten, knisterte es im Lautsprecher und Jacobis Stimme ertönte. Sowohl Conklin als auch ich waren schon lange vor seiner Ernennung zum Polizeichef mit Jacobi Streife gefahren, und es tat gut, seine Stimme zu hören.
»Ihr zwei seid der Hammer, das ist euch doch klar, oder? Ihr habt verhindert, dass J. sein eigentliches Ziel erreicht hat. Gott sei Dank.«
Ich erwiderte: »Mannomann. Ich will mir gar nicht vorstellen, was alles hätte passieren können.«
Aber ich stellte es mir trotzdem vor, hatte einen Flughafen in Paris vor Augen und einen zweiten in der Türkei. Es war nicht schwer zu erkennen, was geschehen wäre, wenn J. in einen Terminal oder zumindest in die Nähe gelangt wäre. Am Anfang meiner Karriere bei der Mordkommission war ein Bombenattentat auf einen Flughafen noch ein Ding der Unmöglichkeit gewesen. Aber jetzt? Jetzt kam es mir fast so vor, als wären solche Grausamkeiten an der Tagesordnung.
Jacobis Stimme war immer noch zu hören.
Er sagte: »Sobald ich euren Bericht auf dem Schreibtisch habe, habt ihr dienstfrei. Boxer. Conklin. Ich bin stolz auf euch. Deputy Reardon und ich und jede Menge Leute, die noch nie von euch gehört haben und nie von euch hören werden, sind euch unendlich dankbar. Ihr habt vielen Menschen das Leben gerettet. Und jetzt kommt ins Präsidium. Das FBI übernimmt die Ermittlungen.«
Ich zitterte vor Erleichterung und drückte Conklin die Autoschlüssel in die Hand. Dann setzte ich mich auf den Beifahrersitz, ließ mich gegen die Lehne sinken und machte die Augen zu, während er uns in die Hall of Justice kutschierte.
ERSTER TEIL
Einen Monat später
1 Es war unser Hochzeitstag und gleichzeitig unsere erste Abendverabredung seit unserer Trennung vor sechs Monaten. Joe hatte mich überraschend angerufen, als ich gerade Feierabend machen wollte, und gesagt: »Ich habe einen Fenstertisch reserviert. Sag ja, Lindsay. Ich stehe direkt vor der Tür.«
Ich hatte nachgegeben, und jetzt saßen wir im Crested Cormorant, einem neuen, sehr angesagten Fischrestaurant am Pier 9 mit freier Sicht auf die Bucht von San Francisco. Überall auf den Tischen flackerten Kerzen, während der Sonnenuntergang den Himmel bis zum Horizont in ein pinkfarbenes Licht tauchte, das auch die sanften Meereswellen erfasste. Gleichzeitig zogen die ersten Nebelschwaden auf.
Joe erzählte mir gerade von seinem kleinen Bruder.
»Und jetzt hat Petey im zarten Alter von vierzig Jahren endlich die Liebe seines Lebens gefunden, in einer Waschanlage für Feuerwehrautos.« Er lachte. »Amanda hat seine Weißwandreifen abgespritzt, und er hat plötzlich Herzrasen bekommen, warum auch immer.«
»Vielleicht hat ihr T-Shirt ein paar Wasserspritzer abbekommen?«
Joe lachte erneut. Ich liebte sein Lachen.
»Höchstwahrscheinlich, ja«, erwiderte er. »Sie haben uns zu ihrer Hochzeit nach Cozumel eingeladen, nächsten Monat. Denk darüber nach, okay?«
Ich sah meinem Ehemann in die Augen und merkte, wie sehr er unsere eigene Hochzeit in einem kleinen Pavillon mit Blick über die Half Moon Bay wieder mit Leben erfüllen wollte. Wir hatten einander vor unseren engsten Freunden und unserer Familie versprochen, uns von nun an bis in alle Ewigkeit zu lieben.
Damals war ich mir absolut sicher gewesen, dass ich dieses Versprechen würde halten können.
Aber weiter als bis zur nächsten Ecke hatte mein Blick damals nicht gereicht. Noch nicht. Und Joe hoffte hier und jetzt, dass er den Zauber von damals erneut zum Leben erwecken konnte. Aber was mich anging – ich hatte meine Unschuld verloren.
Zu meinem großen Bedauern.
Ich war hin- und hergerissen. Sollte ich sanft Joes Hand drücken und ihn bitten, nach Hause zu kommen? Oder mussten wir uns endlich eingestehen, dass unsere zerbrochene Ehe sich nicht wieder kitten ließ?
Joe hob das Weinglas und sagte: »Auf glückliche Zeiten.«
In diesem Augenblick ertönte ein dröhnendes Knacken – als hätte sich ein Spalt in der Erde aufgetan –, gefolgt von einem grollenden Donner und einem grellen Blitz auf dem benachbarten Pier.
Ich brüllte: »Neeeeiiiin!«
Dann packte ich Joe am Arm und starrte mit offenem Mund über das Wasser zum Pier 15 mit dem Scientific-Tron, einem naturwissenschaftlichen Museum, das meist nur »Sci-Tron« genannt wurde. Die gewaltige, geometrische Konstruktion aus Stahl und Glas lud mit ihren vielen interaktiven Ausstellungsstücken zur aktiven Begegnung des Menschen mit der Vergangenheit, besonders aber mit der Zukunft ein. Jetzt entfaltete sich das Bauwerk direkt vor meinen Augen wie eine aufplatzende Blüte. Metallpaneele flogen auf uns zu, und über dem Pier 15 bildete sich eine pilzförmige Wolke. Ein Hagelschauer aus glitzernden Glasscherben fiel prasselnd in das Wasser der Bucht.
Joe sagte: »Mein Gott. Was ist denn das?« Auf seinem Gesicht spiegelte sich genau dasselbe Entsetzen, das ich empfand. Noch eine Bombe.
Das Sci-Tron hatte sieben Tage die Woche geöffnet, donnerstags auch abends, allerdings nur für Erwachsene. Und heute war Donnerstag, oder? Ja, da waren Menschen im Museum.
War das ein Anschlag des GAR? Was sonst?
Joe warf seine Kreditkarte auf den Tisch, griff nach seinem Handy und rief in seinem Büro an. Gleichzeitig meldete ich mich bei der SFPD-Funkzentrale und berichtete, was ich sah.
»Explosion mit Feuerentwicklung im Sci-Tron am Pier 15. Alle Wagen hierher. Feuerwehr. Bombenkommando. Notarztwagen. Und richten Sie Lieutenant Brady aus, dass ich vor Ort bin.«
Joe sagte: »Lindsay, du wartest hier. Ich bin gleich wieder …«
»Das soll doch ein Witz sein, oder?«
»Willst du etwa sterben?«
»Und du?«
Hastig folgte ich Joe nach draußen. Einen langen Augenblick lang standen wir nur an der Reling des Piers und sahen zu, wie die zweigeschossige Stahlrahmenkonstruktion des Sci-Tron in sich zusammenfiel.
Es war ein grauenhafter Anblick, und ich konnte es beinahe nicht glauben, aber es war wahr. Das Sci-Tron war in die Luft gesprengt worden.
Joe und ich liefen los.
2 Joe rannte vor mir her den Pier entlang, um vom Restaurant auf den Embarcadero zu gelangen, die breite Hauptverkehrsstraße an der westlichen Seite der Bucht von San Francisco.
Auf dem Bürgersteig angekommen wandten wir uns nach rechts und liefen noch ein paar hundert Meter weiter, passierten das historische Hafengebäude und blieben kurz vor der Mündung des Piers 15 stehen. Flammen schlugen aus dem qualmenden Kadaver des Sci-Tron hervor.
Auf den Fahrbahnen des Embarcadero herrschte völliges Chaos. Viele Autofahrer hatten bei dem grauenhaften Anblick und den ohrenbetäubenden Geräuschen der Katastrophe ruckartig gebremst, sodass andere auf benachbarte Spuren hatten ausweichen müssen, während gleichzeitig kreischende, zu Tode erschreckte Fußgänger auf die Straße gelaufen waren. Dazu noch die zahlreichen quietschenden Reifen und das dröhnende Hupkonzert … ich kam mir vor wie am Tag des Jüngsten Gerichts.
Eine Explosion in nächster Nähe hat immer gravierende Auswirkungen auf die Sinneswahrnehmung … der krachende Donner, der Gestank des Sprengstoffs, das Entsetzen auf den Gesichtern der Mitmenschen. Das alles hatte ich erst vor Kurzem am eigenen Leib erfahren, aber es fiel mir immer noch schwer zu begreifen, wie ein ruhiger, schöner Abend sich von einem Augenblick auf den anderen so ins Gegenteil verkehren konnte, wie es zu einem solchen Chaos, einer solch unfassbaren Zerstörungsorgie kommen konnte.
Joe zerrte mich vom Bürgersteig an die Reling auf der Wasserseite und hielt mich fest im Arm, während die Menschenmassen an uns vorbeistürmten, um den Schauplatz der Explosion möglichst schnell hinter sich zu lassen.
Während ich das Tohuwabohu betrachtete, blieb ich an einem ungewöhnlichen Anblick hängen. Da stand ein Mann regungslos auf dem Bürgersteig, wie ein Fels in einem tosenden Fluss aus erschreckten Fußgängern.
Während meiner Ausbildung habe ich gelernt, genau solche Anomalien wahrzunehmen, und ich registrierte jede Einzelheit. Weiße Hautfarbe, braune Haare, Mitte vierzig, durchschnittlich groß und schwer. Er trug eine Jeans, ein blaues Flanellhemd und eine Drahtgestellbrille. Quer durch seine Oberlippe zog sich eine Narbe und lenkte meinen Blick auf sein schmales Lächeln.
Er lächelte.
Stand er unter Schock? War er der Explosion entronnen und versuchte zu verstehen, was da gerade geschehen war? Oder war er einfach nur fasziniert von den Flammen und dem Qualm?
Was immer er auch denken oder fühlen mochte, ich reagierte, wie eine Polizistin eben reagiert. Während um ihn herum alles in die Brüche ging, stach er aus dem Chaos und der Verwüstung heraus. Ich arbeitete mich gegen den Strom der fliehenden Menschen bis in sein Blickfeld vor und schlug meine Jacke zurück, damit er meine Dienstmarke sehen konnte. Joe beendete sein Telefonat und kam zu mir.
Wir stellten uns dicht vor den blau gekleideten Mann, und ich sagte mit lauter Stimme: »Sir. Ich bin Polizeibeamtin. Haben Sie gesehen, was sich hier abgespielt hat?«
In seinem Gesicht, in seinen weit aufgerissenen Augen spiegelte sich nichts als das reinste Entzücken. »Ob ich es gesehen habe? Ich habe dieses … dieses überwältigende Spektakel geschaffen. Es ist mein Werk.«
Es war sein Werk? Er behauptete, dass er dafür verantwortlich war? Ich starrte Joe an, und mein Blick besagte: Hast du das gehört?
»Wie heißen Sie, Sir?«
»Connor Grant. Bürger, Genie und Künstler par excellence.«
Ich erwiderte: »Ich glaube, ich habe Sie nicht richtig verstanden, Mr. Grant. Wollen Sie etwa behaupten, dass Sie das Sci-Tron in die Luft gesprengt haben?«
»Sehr richtig.«
Ich hatte sowieso schon zu viel Adrenalin im Blut und brauchte meine gesamte Willenskraft, um nicht laut zu brüllen: Sind Sie denn vollkommen wahnsinnig geworden? Da drin waren doch Menschen!
Grant war entweder verrückt oder voll mit Drogen oder etwas in der Richtung, jedenfalls redete er im Höchsttempo weiter.
»Gute Arbeit, finden Sie nicht auch? Haben Sie denn das ganze Schauspiel mitbekommen? Die pilzförmige Rauchwolke? Oh mein Gott. Das war noch besser, als ich gehofft hatte. Und für den Sonnenuntergang gebe ich mir eine glatte Eins mit Sternchen. Wenn Sie mich fragen, warum, dann antworte ich: ›Wieso denn warum?‹ Schönheit braucht keine Erklärungen.«
Ja, das war ein Geständnis. Die Frage war nur, ob es auch wirklich stimmte.
Ich fragte Grant noch einmal, ob er tatsächlich die Bombe in dem Museum gelegt hatte, und erneut bestätigte er nachdrücklich, dass er es getan hatte. Dabei lächelte er die ganze Zeit wie ein Kind an Heiligabend.
»Alleine?«
»Wie gesagt«, erwiderte der gewöhnlich aussehende Mann in Blau. »Das ist mein Werk. Ich habe es getan, und zwar in Vollendung.«
»Geht es Ihnen gut, Mr. Grant?«
»Absolut! Warum fragen Sie?«
War Connor Grant, der Bürger-Genie-Künstler, geisteskrank? Ich wusste nicht, was ich glauben sollte.
Joe hatte seine Waffe gezückt und richtete sie auf Grant, während ich ihm befahl, die Hände auf den Kopf zu legen. Er gehorchte, ohne den Blick von der verwüsteten Stätte der Explosion zu wenden, und behielt seinen verzückten Gesichtsausdruck bei. Ich tastete ihn ab, fand jedoch nur einen Schlüsselbund, ein bisschen Kleingeld und eine Brieftasche. Sein Ausweis bestätigte seine Identität, und jetzt hatte ich auch seine Adresse und seine Kreditkarten.
Ich legte dem lächelnden Irren Handschellen an, nahm ihn wegen Zerstörung öffentlichen Eigentums fest, sodass wir ihn vorerst in Gewahrsam nehmen konnten, und las ihm seine Rechte vor.
Mit quietschenden Reifen hielten die ersten Streifenwagen am Straßenrand, und ich führte Grant hinüber. Den uniformierten Beamten, der sich gerade aus dem Beifahrersitz schälte, kannte ich.
Ich sagte zu dem jungen Officer Einhorn und seinem Partner: »Mr. Grant behauptet, dass er das Sci-Tron in die Luft gejagt hat. Ich rufe gleich Lieutenant Brady an und bitte ihn, Sie in Empfang zu nehmen. Sie lassen diesen Mann nicht aus den Augen, bis Sie ihn an Brady übergeben haben. Ich meine es ernst: Sie lassen ihn nicht einmal für eine Sekunde aus dem Blick. Noch Fragen, Marty?«
Nachdem der Streifenwagen losgefahren war, rief ich Brady an und berichtete ihm von Connor Grant, der behauptete, die Bombe im Sci-Tron gelegt zu haben.
»Ich weiß ehrlich nicht, was ich davon halten soll, Lieutenant. Er hat zugegeben, dass er es getan hat. Ich komme so schnell wie möglich ins Präsidium.«
Joe hatte Fotos von den eintreffenden Beamten und den Aktivitäten auf dem Pier gemacht. Dann steckte er sein Handy ein und sagte: »Warte hier, Linds. Ich will mich nur schnell vor Ort umsehen, bevor die Feuerwehr überall durchtrampelt. Nur fünf Minuten.«
Mit diesen Worten rannte Joe auf das zerstörte Sci-Tron zu. Ich hatte kein gutes Gefühl. Das Gebäude qualmte und wirkte ziemlich instabil. Und Joe war ganz auf sich allein gestellt.
Ich rief ihm hinterher, aber auf der Straße herrschte ein solcher Lärm, dass er mich wahrscheinlich wirklich nicht gehört hatte.
3 Joe schritt über die Schwelle des Trümmerhaufens, der bis vor wenigen Minuten noch ein futuristisches, naturwissenschaftliches Museum gewesen war.
Es kam ihm vor, als würde er einen Regenwald betreten.
Die Sprinkleranlage ließ Wasser auf ihn herabrieseln, und es roch nach verfaulten Eiern. Das war ein Hinweis auf Erdgas, vielleicht Propan, und dann stellte er noch andere Gerüche fest: verbranntes Plastik, Haare, Fleisch.
Rauchwolken und Nebelschwaden verdeckten das verbliebene Tageslicht.
Joe hob den Blick und sah nur verdrehte Stützen und röhrenartiges Strebenwerk. Auf dem Fußboden lagen überall umgestürzte Ausstellungsstücke und von den Wänden gerissene Schautafeln, während sich gleichzeitig immer mehr Pfützen bildeten. Und dann waren da noch die unförmigen Silhouetten der Opfer.
Ohne hinzusehen, machte Joe ein Foto nach dem anderen.
Die Explosion hatte zwar die Fenster zerstört, die Innenräume waren jedoch stehen geblieben. Das bedeutete, dass es sich wahrscheinlich nicht um eine industriell gefertigte Bombe gehandelt hatte, sondern um eine selbst gebastelte Sprengvorrichtung, zum Beispiel eine Aerosolbombe, also einen mit einer brennbaren Substanz gefüllten Behälter, der mit einer Sprengladung gezündet worden war.
Das Sci-Tron war zu einem tückischen Hindernisparcours voller Glasscherben und abgerissenen Metallrohren, umgestürzten Ausstellungsstücken und offen gelegten Stromkabeln geworden. Behutsam, nur beleuchtet von seiner Handylampe und den überall verstreuten kleinen Feuern, bahnte Joe sich einen Weg durch die Geröllhalde.
Er rief: »Haaaalloooo! Kann mich jemand hören?«
Zu seiner Rechten ertönte als Antwort ein leises Stöhnen. Joe rief: »Ich komme!« und ging dem Stöhnen entgegen. Da wickelte sich etwas um seinen Knöchel. Reflexartig trat er aus und riss sich los, erst dann nahm er die blasse Hand wahr, den Arm, den Oberkörper, die Frau, die mit dem Gesicht nach unten auf dem Fußboden lag. Eine Vitrine war auf sie gestürzt und hatte sie halb unter sich begraben.
Sie sagte: »Ich kann mich … nicht … bewegen.«
Joe beugte sich zu ihr hinunter.
»Ich helfe Ihnen. Wie heißen Sie?«
»Sophie Fields.«
»Ich bin Joe. Haben Sie Schmerzen, Sophie?«
»Ich komme mir vor wie betäubt.«
»Ich glaube, Sie liegen unter einem umgekippten Schaukasten. Ich versuche mal, ob ich den herunterheben kann. Einen Moment.«
»Sagen Sie meinem Mann … Robbie … dass ich ihn liebe. Der Schlüssel liegt … in der … Angelkiste.«
»Das können Sie ihm auch selbst sagen, Sophie. Hören Sie gut zu. Wir sind jetzt ein Team. Ich versuche, Sie von diesem Ding da zu befreien. Leider kann ich kaum etwas sehen. Falls Sie Schmerzen haben, sagen Sie Bescheid.«
Sophie stöhnte, dann wurde sie wieder still.
Joe nahm den zwei mal zwei mal vier Meter großen Kasten in den Blick. Er bestand aus Metall und Glas, besaß schartige Kanten und, so wie es aussah, einen schweren Stahlsockel. Wenn er einen vernünftigen Winkel bekam und einen festen Griff ansetzen konnte … wenn er das Ding gleichzeitig anheben und wegschieben konnte … wenn Sophie nicht unter irgendetwas eingeklemmt war, was er gar nicht sehen konnte … das waren eine Menge Wenn.
Aber er musste es zumindest versuchen.
Er sagte Sophie, was er vorhatte, und setzte alle Hoffnung auf Gott, schlang die Arme um die Rückwand, schob die Knie unter den Sockel und spannte alle Muskeln an.
Das Ding knirschte und schaukelte bedenklich, aber dann rutschte die Vitrine ein Stück zur Seite und stabilisierte sich wieder. Joe war sich ziemlich sicher, dass Sophie darunter hervorrutschen konnte, vorausgesetzt, sie hatte sich nicht das Rückgrat gebrochen.
Er sagte: »Sophie, können Sie sich auf die Seite drehen? Können Sie mich anschauen?«
Aber er bekam nie eine Antwort.
Über ihm zuckte ein kleiner blauer Lichtbogen auf, unmittelbar gefolgt von einem krachenden Donner. Etwas Schweres prallte gegen Joes Hinterkopf. Sterne tanzten über seine Netzhaut, und dann schwebte er leicht wie eine Feder in die Dunkelheit davon.
4 Extrem angespannt und aufgewühlt stand ich ein kleines Stück außerhalb des Menschenstroms, der sich vom Pier 15 auf den Bürgersteig ergoss, und betrachtete die von Halogenscheinwerfern beleuchtete Szenerie.
Streifenpolizisten in Uniform schleppten Absperrgitter auf den Embarcadero und blockierten den gesamten Abschnitt von der Bay Street bis zur Market Street.
Der Einsatzleiter mit seiner neongelben Weste dirigierte die Notarztwagen zu dem Parkplatz auf Pier 9, wo eine improvisierte Notaufnahme eingerichtet worden war.
Die Löschzüge der Feuerwehr fuhren mit blinkenden Lichtern und jaulenden Sirenen über den Bürgersteig bis vor das Eingangstor. Männer und Frauen in Sanitäterkluft machten sich bereit, während die Feuerwehrleute vorrückten.
»Nur fünf Minuten«, hatte Joe gesagt.
Die Zeit war um. Als er das gesagt hatte, hatte er da wirklich geglaubt, dass fünf Minuten reichen würden, um sich umzusehen? Er hatte sich verschätzt, aber ich widerstand der drängenden Versuchung, ihn anzurufen. Ich sagte mir, dass er fieberhaft arbeitete und wirklich keine Zeit hatte, mit mir zu telefonieren. Trotzdem war ich innerlich zerrissen. Steckte Joe in Schwierigkeiten? War ihm im Inneren dieses zerbombten Gebäudes etwas zugestoßen? Sollte ich wirklich einfach nur hier stehen bleiben? Oder sollte ich Hilfe holen?
Ich warf einen Blick auf meine Armbanduhr. Er war jetzt seit zwölf Minuten weg. Dreizehn.
Ich rief Mrs. Rose an, meine Nachbarin, Freundin und Babysitterin. Ich brüllte ihr über den Lärm hinweg zu, dass ich beim Sci-Tron war und dass es später werden würde. Danach rief ich Brady an. In dem Moment, als ich das Display antippte, explodierte noch eine Bombe … als hätte ich sie mit meiner Fingerspitze ausgelöst.
Die Wucht der Explosion löschte jedes andere Geräusch aus, auch das meiner eigenen Stimme, als ich aus voller Kehle kreischte: »Joe!«
Ich rannte auf die Mündung des Piers zu, doch noch bevor ich dort war, bauten sich drei Feuerwehrmänner vor mir auf und zerrten mich beiseite.
Ich wehrte mich.
»Mein Gott! Ich bin Polizistin! Mein Mann ist da drin. Helfen Sie mir, bitte! Ich muss ihn finden.«
Einer der Feuerwehrmänner erwiderte: »Officer, Sie können da nicht reingehen. Nicht jetzt. Bitte halten Sie sich zurück und bleiben Sie stehen. Wir holen ihn raus, sobald es möglich ist.«
Die Feuerwehrleute taten ihr Möglichstes, um eine äußerst labile Situation unter Kontrolle zu bringen, und ich konnte es ihnen nicht verübeln. Also blieb ich stehen, wo sie gesagt hatten, um den Rettungskräften nicht in die Quere zu kommen, und hatte freie Sicht auf die Stelle, wo bis vor Kurzem noch der Eingang des Sci-Tron gewesen war. Ich betete, dass Joe dort herauskam und den Bürgersteig betrat.
Bitte, Gott. Mach, dass Joe nichts passiert ist.
Diese Worte gingen mir durch den Kopf, während der Kühlanhänger der Gerichtsmedizin durch eine Lücke in der Absperrung rumpelte und auf den Straßenbahnschienen in der Mitte des Embarcadero zum Stehen kam.
Ich wandte mich vom Anblick der mobilen Leichenhalle ab und schaute hinaus auf die Bucht. Dabei wählte ich immer wieder Joes Handynummer, aber es war vergeblich. Er nahm nicht ab.
Da er nicht reagierte, rief ich alle meine Freundinnen und meinen Partner an. Mir war klar, dass sie das Entsetzen in meiner Stimme laut und deutlich hören konnten. Aber mehr, als mich zu fragen: »Wie kann ich dir helfen?«, konnten sie auch nicht machen.
Ich sagte zu allen: »Ich melde mich später noch mal.«
Und dann stand ich vollkommen ohne Rettungsanker da.
In der folgenden Stunde dieses grässlichen, widerwärtigen Abends sah ich zu, wie Sanitäter mit leeren Tragen durch den zerstörten Museumseingang hasteten und gefüllte Leichensäcke nach draußen auf den Bürgersteig brachten. Von dort wurden die Toten in das Fahrzeug der Gerichtsmedizin verladen.
Und die Überlebenden? Gelegentlich kam ein Bombenopfer, auf einen Feuerwehrmann gestützt, zu Fuß nach draußen. Andere wurden auf Tragen ins Freie gebracht.
Ich wählte Joes Nummer.
Joe, jetzt nimm doch endlich ab.
Dieses Mal war mir, als hörte ich tatsächlich die fünf vertrauten Klänge seines Klingeltons, und sie wurden stetig lauter, je näher zwei Sanitäter mit einer weiteren Rolltrage dem Bürgersteig kamen. Ich rannte zu der Trage, voller Hoffnung und voller grausamer Furcht angesichts dessen, was ich dort womöglich entdecken würde. Da erklang erneut der Klingelton.
»Joe?«
Das Gesicht des Mannes auf der Trage war fürchterlich geschwollen, mit Prellungen übersät und voller Blut. Sein linker Arm rutschte unter der Decke hervor, die die Sanitäter über ihn gebreitet hatten, und ich erkannte den Ehering, den ich ihm damals, in einem Pavillon mit Blick auf die Half Moon Bay, an den Finger gesteckt hatte. Damals, als wir versprochen hatten, einander zu lieben, an guten wie an bösen Tagen.
Ich packte ihn an der Schulter und sagte: »Joe. Ich bin’s, Lindsay. Ich bin bei dir.«
Er gab keine Antwort. War er überhaupt noch am Leben?
Ich lief neben seiner Trage her, blieb in der improvisierten Notaufnahme bei ihm, wo er hastig untersucht und dann in einen Krankenwagen geschoben wurde.
Ungeschickt fummelte ich meine Dienstmarke hervor und sagte heiser: »Das ist mein Mann. Ich bin seine Frau.«
Eine Sanitäterin nickte und streckte mir die Hand entgegen. Ich ergriff sie, und sie zog mich ins Innere.
5 Ich hielt Joes Hand, während die Sanitäter ihm eine Sauerstoffmaske überstreiften, und beantwortete ihre Fragen bezüglich Joes Alter, seiner Blutgruppe und seines Berufs. »Freiberuflicher Sicherheitsberater.«
Trotz der Polizeisperren und Verkehrsstaus war es ein kurzer, wilder Ritt bis ins Krankenhaus. Joe wurde von der Notaufnahme direkt in den Operationssaal gebracht, und ich setzte mich in den Warteraum. Dort saßen viele Menschen, deren Verletzungen nichts mit der Bombe zu tun hatten, aber auch Freunde und Angehörige von Explosionsopfern.
Der Fernseher in der Ecke war zwar stumm gestellt, aber es gab ja noch das Nachrichtenband mit den aktuellen Meldungen am unteren Bildschirmrand.
Bombenexplosion zerstört Sci-Tron.
Inzwischen schon 20 Tote, 30 Verletzte.
Noch keine Verlautbarungen der Polizei oder des Heimatschutzes, aber der GAR steht im Verdacht, Urheber des Terroranschlags zu sein.
Bis jetzt hat sich niemand zu der Tat bekannt.
Dann folgten Videoschnipsel von der Explosion, der Menschenmenge, dem Verkehrschaos, den umherhastenden Sanitätern und Notärzten. Die Videos waren schrecklich anzusehen und heizten meine eigenen, noch viel zu lebendigen Erinnerungen an die Explosion, an das, was ich gesehen und gespürt hatte, zusätzlich an. Wie eine Endlosschleife rauschten die Bilder wieder und wieder an meinem inneren Auge vorbei.
Dann wurde der Einsatzleiter eingeblendet. Jemand hielt ihm ein Mikrofon vor die Nase, und ein Journalist rief ihm eine Frage zu. Der Einsatzleiter signalisierte, dass er bereit war zu antworten.
Er nannte seinen Namen, buchstabierte ihn und sagte dann, dass er für die Koordination der verschiedenen Hilfs- und Einsatzkräfte vor Ort zuständig war.
»Feuerwehr, Sanitäter, Ärzte und Polizei sind allesamt vor Ort. Es ist im Moment noch viel zu früh, um zu gesicherten Erkenntnissen über das, was hier passiert ist, zu gelangen oder die Opfer zu identifizieren. Die Einsatzkräfte sind hervorragend ausgebildet, unsere besten Leute. Ich muss jetzt wieder zurück. Sobald es etwas zu berichten gibt, werden wir das tun.«
Als Nächstes war der Bürgermeister zu sehen. Er stand hemdsärmelig und mit einem Schutzhelm auf dem Kopf vor dem Pier 15 und hielt eine Ansprache.
»Dies ist ein schrecklicher Tag für unsere Stadt, für die gesamten Vereinigten Staaten. Wir trauern mit den Hinterbliebenen der Opfer und beten für die Verletzten. Wir bitten Sie alle zunächst um ein wenig Geduld, während wir diesem blindwütigen Terrorakt auf den Grund gehen. Inzwischen sind auch Vertreter der Bundesbehörden zu unseren tapferen Ersthelfern und den Beamten des SFPD gestoßen. Wir werden diejenigen, die für diese Tragödie verantwortlich sind, zur Strecke bringen, darauf können Sie sich verlassen.«
Um mich herum im Warteraum brachen Menschen zusammen, sanken schluchzend in die Arme ihrer Freunde oder Verwandten.
Was hatte Connor Grant vorhin zu mir gesagt? »Ich habe dieses … dieses überwältigende Spektakel geschaffen.«
Da hörte ich meinen Namen.
Ich sprang auf und sah eine dunkelhaarige Chirurgin in blauer Operationskleidung in der Tür stehen. Um ihren Hals baumelte eine Atemschutzmaske. Ich suchte in ihrer Miene nach einem Hinweis auf gute Nachrichten, aber außer Traurigkeit konnte ich nichts entdecken.
Sie stellte sich als Dr. Janet Dalrymple vor. Ich begleitete sie hinaus auf den Flur, und sie sagte, dass Joe ein akutes subdurales Hämatom – also einen Bluterguss im Schädelinneren – erlitten hatte, das sich schnell ausbreitete und den Schädelinnendruck ansteigen ließ.
»Ich habe eine Drainage gelegt, damit die Flüssigkeit abfließen kann«, fuhr sie fort. »Außerdem bekommt er Medikamente, die die Schwellung eindämmen sollten. Zunächst einmal müssen wir ihn ununterbrochen beobachten und besonders den Schädelinnendruck genau im Blick behalten.«
Die nächste Frage musste ich stellen. »Wie stehen seine Chancen?«
»Ich beschäftige mich nicht mit Chancen, Lindsay. Jeder Patient mit Kopfverletzung reagiert anders. Ich möchte Ihnen keine falsche Hoffnung machen. Er ist sehr schwer verletzt, trotzdem kann es sein, dass er schon in ein paar Stunden das Schlimmste überstanden hat. Wir verlegen ihn jetzt auf die Intensivstation.«
Ich kehrte zurück in den Warteraum und dachte an die andere Bombe, die unsere Ehe zerstört hatte.
Vor sechs Monaten hatte ich erfahren, dass mein Mann mich belogen hatte, und zwar seit … wie lange eigentlich? Ich hatte keine Ahnung. Als ich ihn zur Rede gestellt hatte, hatte er zugegeben, dass er mir gewisse Dinge vorenthalten hatte, aber auch, dass er mir den Grund dafür nicht nennen konnte. Weil das alles nämlich streng geheim sei. Er hatte gesagt, dass er sein Land an die erste Stelle setzen musste.
»Ich konnte es dir nicht sagen, Lindsay. Es war alles streng geheim. Und für mich steht mein Land nun einmal an erster Stelle.«
Obwohl ich ihn vielleicht immer noch liebte, hatten die Worte »mein Land an erster Stelle« so vieles verändert, woran ich fraglos geglaubt hatte. Während ich davon ausgegangen war, mein Mann würde von zu Hause aus seiner Beratertätigkeit nachgehen und nebenbei unsere Tochter betreuen, hatte er in Wirklichkeit für die CIA gearbeitet. Eine Frau war auch beteiligt gewesen. Ich wusste nicht genau, was sie einander bedeutet hatten, aber es war jedenfalls mehr als nur eine flüchtige Bekanntschaft gewesen. Ich hatte einen Spion geheiratet. Und das bedeutete, dass ich Joseph Molinari nie wirklich gekannt hatte. Dass ich ihm nie wieder wirklich vertrauen konnte.
Obwohl ich so wahnsinnig wütend auf Joe gewesen war, wäre ich jetzt, in diesem Augenblick, zu allem bereit gewesen, wenn er nur wieder ganz gesund werden würde. Ich traf eine Absprache mit Gott und wartete auf weitere Neuigkeiten.
6 Das, was ich dann zu hören bekam, war allerdings nicht das, worauf ich gehofft hatte.
Auf dem Fernseher im stillen Warteraum der Intensivstation lief eine alte Folge von Big Bang Theory, die jedoch plötzlich unterbrochen wurde. Stattdessen wirbelte eine leuchtend rote Schrifttafel ins Bild, bis der Schriftzug EILMELDUNG! den ganzen Bildschirm ausfüllte. Als Nächstes war Susan Margulies Steinhardt im Studio von Channel 5 zu sehen. Sie sah aus, als sei sie frisch aus dem Bett geschlüpft, hätte während der Fahrt ins Studio ihren Lippenstift aufgetragen und wäre dann sofort auf Sendung gegangen.
»Wir haben Neuigkeiten für Sie«, sagte sie.
Den folgenden Text las sie von einem Blatt Papier ab.
»Das Terrornetzwerk GAR hat die Verantwortung für den Bombenanschlag auf das Sci-Tron übernommen. Bis jetzt wurden dort nach offiziellen Angaben fünfundzwanzig Tote und fünfundvierzig Verletzte registriert.«
Ich hatte ein bisschen vor mich hin gedöst, aber jetzt war ich schlagartig hellwach und krampfte mich an die Armlehnen meines Stuhls.
Die Nachrichtensprecherin fuhr fort: »Vor wenigen Augenblicken wurde im Internet das folgende Video veröffentlicht. Zur Authentizität des Materials kann KPIX 5 keinerlei Angaben machen.«
Eine männliche Silhouette erschien auf dem Bildschirm. Das Gesicht lag tief im Schatten, und hinter seinem Kopf hing eine Art Kreis. Es sah fast aus wie ein Heiligenschein. Seine Stimme klang akzentfrei und digital bearbeitet, vielleicht war sie sogar vollkommen am Computer entstanden.
Der Mann mit der künstlichen Stimme sagte: »Der GAR ist stolz auf seinen treu ergebenen Soldaten SF65, Teil des Great Antiestablishment Reset. Er hat große Tapferkeit bewiesen und das Sci-Tron zum Einsturz gebracht, ein schamloses Unternehmen, finanziert von korrupten Konzernen und Universitätssponsoren. – Der GAR arbeitet im Verborgenen und explodiert in aller Öffentlichkeit. Und wir werden unser Werk fortsetzen, so lange, bis alle Menschen auf dieser Welt ein freies, selbstbestimmtes Leben führen können.«
Der Bildschirm wurde für einen Moment schwarz, dann war wieder Miss Steinhardt zu sehen.
Sie sagte: »Das ist alles, was wir Ihnen im Moment zeigen können, aber sobald wir neue Informationen bekommen, halten wir Sie natürlich auf dem Laufenden. Und jetzt unterbrechen wir das ursprünglich vorgesehene Programm und schalten in unser Studio in New York, um das Geschehen weiter zu verfolgen und zu analysieren.«
Außer mir hatten noch sechs weitere Personen diese spektakulären Neuigkeiten hier im Warteraum verfolgt.
»Hab ich’s doch gewusst«, sagte einer. »Das kann gar niemand anders als der GAR gewesen sein.«
»Widerliche Arschlöcher«, sagte ein Zweiter.
Die Räume des kleinen Lokalsenders wurden ausgeblendet, und dann tauchte das elegante, repräsentative New Yorker Studio auf dem Bildschirm auf. Hinter dem rechteckigen Tisch, an dem sich Korrespondenten und Terrorexperten versammelt hatten, die jeder, der einen Fernseher besaß, schon einmal gesehen hatte, liefen auf riesigen Monitoren verschiedene Bilder der Explosion.
Der Chefsprecher, Dallas Greer, fragte die Experten nach ihrer Meinung zu dem Bekennervideo, und die Mehrheit hielt das Video für echt.
Nur Roger Watkins, der bärbeißige internationale CBS