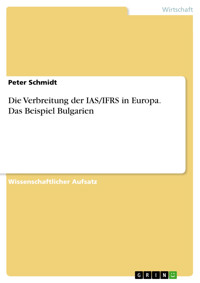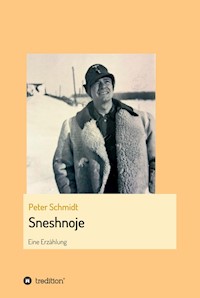Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Er liegt entkleidet zwischen zwei großen Basaltsteinen – mit einem weißen Lendentuch als einzigem Schutz. Dem örtlichen Comisario kommt seine Hautfarbe merkwürdig vor, die seltsam blass und grünlich durchscheinend ist … Faber, sein Kollege, fliegt nach Guatemala, um die Beerdigung zu arrangieren. Nach Ansicht der örtlichen Polizei ist Reuben ein Opfer marxistischer Guerillas geworden. Doch Faber versucht herauszufinden, was Reuben eigentlich in Mittelamerika wollte. Dabei stößt er auf merkwürdige Fakten, die seinen Tod in anderem Licht erscheinen lassen. Offensichtlich war Reubens offizieller Auftrag nur ein Vorwand. Aber wofür? Die Theorie vom Anschlag marxistischer Guerillas wird immer unglaubwürdiger. Faber kommt ein furchtbarer Verdacht … –– PRESSESTIMMEN: –– autor-peter-schmidt-pressestimmen.blogspot.de/ ––– "Faszinierend – Geheimdienst-Thrill vom Feinsten! Im Spannungsfeld östlicher und westlicher Machenschaften ein auch atmosphärisch außerordentlich reizvoller Blick auf die rätselhafte und bedrohliche Welt Mittelamerikas zwischen Kommunismus und einheimischer Guerilla." (Hans Walther, Kritiker) –– Ungekürzte, überarbeitete Fassung der gedruckten Ausgabe im Rowohlt Verlag, Reinbek, Copyright © 2013 Peter Schmidt
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 343
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Peter Schmidt
Der Agentenjäger
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
ZUM BUCH
PRESSESTIMMEN
Die Hauptpersonen
Prolog
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
Epilog
WEITERE TITEL
Impressum neobooks
ZUM BUCH
Der deutsche Abwehrspezialist Reuben ist seit zweieinhalb Wochen in Mittelamerika verschollen, als man seine Leiche an einer Wegkreuzung im dünnbesiedelten Nordosten Guatemalas findet. Er liegt entkleidet zwischen zwei großen Basaltsteinen – mit einem weißen Lendentuch als einzigem Schutz. Dem örtlichen comisario kommt seine Hautfarbe merkwürdig vor, die seltsam blass und grünlich durchscheinend ist …
Faber, sein Kollege, fliegt nach Guatemala, um die Beerdigung zu arrangieren. Nach Ansicht der örtlichen Polizei ist Reuben ein Opfer marxistischer Guerillas geworden. Doch Faber versucht herauszufinden, was Reuben eigentlich in Mittelamerika wollte. Dabei stößt er auf merkwürdige Fakten, die seinen Tod in anderem Licht erscheinen lassen. Offensichtlich war Reubens offizieller Auftrag nur ein Vorwand. Aber wofür? Die Theorie vom Anschlag marxistischer Guerillas wird immer unglaubwürdiger. Faber kommt ein furchtbarer Verdacht …
PRESSESTIMMEN
http://autor-peter-schmidt-pressestimmen.blogspot.de/
Faszinierend – Geheimdienst-Thrill vom Feinsten … Im Spannungsfeld östlicher und westlicher Machenschaften ein auch atmosphärisch außerordentlich reizvoller Blick auf die rätselhafte und bedrohliche Welt Mittelamerikas zwischen Kommunismus und einheimischer Guerilla.
(Hans Walther, Kritiker)
Unter den deutschen Kriminalschriftstellern ist der Westfale Schmidt fraglos einer der wenigen, die wirklich erzählerisches Format besitzen.
(Hamburger Abendblatt)
Auffallend an Schmidts dramaturgisch raffinierten Agenten-Storys sind - neben der Detailtreue - die skeptische Weltanschauung und eine geradezu undeutsch klare kühle Prosa.
(stern)
Deutschlands einziger (jedenfalls einziger ernst zu nehmender) Autor im Agenten-Genre.
(Vorwärts)
So wichtig die raffiniert eingefädelte, doppelbödige, absichtlich verwirrte Handlung auch ist (und in der Hinsicht ist beispielshalber Erfindergeist kaum zu überbieten): Hinter den Plots steckt mehr, anderes, als die dürre Nacherzählung vermuten lässt. Es geht Peter Schmidt immer um die Menschen, die agieren oder reagieren müssen. Es geht um die Macher, die gnadenlos ihre Komplotte einfädeln, es geht um die Opfer, die sich im Netz der Intrigen verheddern, und schaut man genau hin, ist jeder Macher und Opfer zugleich. Der kleine Macher das Opfer der großen Macher, die großen die Opfer ihrer selbst.
Was da ausgeheckt und durchgezogen wird, ist allenfalls noch in der literarischen Schlusspointe zu durchschauen. Das Komplott gewinnt eine solche Eigendynamik, dass sich keiner mehr entziehen kann, auch die Initiatoren nicht, dass es im Grunde nicht mehr zu stoppen ist.
(Krimikritiker Rudi Kost)
Die Hauptpersonen
Thomas Bud Faber – kämpft auf eigene Faust
Karl Reuben – hat den Kampf schon verloren
Lea – ist Figur im Machtspiel der anderen
Corinna Menge – lässt sich nicht leicht abschütteln
Brzinsky – verfolgt ausdauernd seine Ziele
Hauptmann Alvarez – macht sich die Hände nicht schmutzig
Ross – bleibt gerne Sieger
Prolog
Der Mann, der im trüben Schein der Gaslaternen durch die Straße kam, war auffallend groß und breitschultrig; ein hellblonder Hüne, etwa vierzig Jahre alt. Seine leicht wippenden Fäuste erinnerten an einen kampfbereiten Boxer, dem es nur noch am passenden Sparringspartner fehlte …
Noch auffallender aber war die Geschmeidigkeit seiner Bewegungen, seiner Schultern und Arme ebenso wie der Beine – als habe er seinen Körper völlig unter Kontrolle und sei zugleich hellwach und aufmerksam auf alles, was um ihn herum passierte.
Es war eine Kleinstadt dicht bei der Zonengrenze. Über die Dächer hinweg konnte Marten von seinem Beobachtungsposten im Erker eines altmodischen Hauses aus der Vorkriegszeit ihre angestrahlten Grenzbefestigungen sehen.
Der Himmel darüber war milchiggrau und in den Fenstern der Wachtürme, die hier gut zwanzig Meter näher zur Absperrung standen als außerhalb der Stadt, bewegten sich manchmal Silhouetten von Wachsoldaten.
Irgendwo weiter links gab es einen Übergang für den sogenannten kleinen «Grenzverkehr», dessen Barackengebäude von den dazwischenliegenden Hauswänden verdeckt wurden.
Der blonde Hüne war in der Straße nahe genug herangekommen, um ihn am dunklen Fenster über sich erkennen zu können.
Marten ließ mit einer abrupten Handbewegung die Gardine fahren. Er zündete sich eine Zigarette an, wobei er sich ins Zimmer wandte und die Flamme nach außen mit dem Körper und den Händen abschirmte.
«Faber?», fragte der junge Mann an seiner Seite; er war in Zivil, machte aber mit seiner etwas unterwürfigen und übertrieben korrekten Sprechweise den Eindruck eines Beamten, der sich für einen Augenblick seiner Uniform entledigt hatte.
«Unverkennbar.»
«Ich hätte nicht geglaubt, dass er tatsächlich kommt.»
«Er riskiert‘s einfach», nickte Marten und wandte sich mit seiner Zigarette wieder dem Fenster zu. «Diese Frau scheint ihm viel zu bedeuten; mehr als sie sollte. Wie wir angenommen hatten», fügte er nach einer Pause hinzu.
«Heißt das, wir könnten ihn jetzt hochnehmen?»
«Nicht jetzt», sagte Marten unbestimmt. «Später. Wir halten uns streng an die Anweisungen.»
Der blonde Hüne blieb auf der anderen Straßenseite vor einem zweistöckigen Haus stehen. Es war hell gestrichen, mit ordentlichen glatten Gardinen in den Parterrefenstern, die eher an Büros als an Wohnräume erinnerten.
Er las das weiß emaillierte Schild der Rechtsanwaltskanzlei neben dem Eingang und warf einen prüfenden Blick über seine Schulter in die menschenleere Straße. Seine blasse Hautfarbe verriet, dass er sich zu viele Nächte um die Ohren geschlagen hatte. Als er den Arm zur Klingel hob und das Licht der Straßenlaterne auf sein Profil fiel, wirkte er für einen Augenblick sogar etwas hinfällig.
Die Spannung, und damit auch die Geschmeidigkeit und Eleganz seiner Bewegungen, war von ihm abgefallen, als habe er jetzt sein Ziel erreicht und unwiderruflich eine Grenze überschritten.
Hinter den Milchglasscheiben der Kanzlei ging das Licht an; in allen vier Fenstern gleichzeitig. Die Tür wurde geöffnet, ohne dass Marten hätte erkennen können, wer es war – er sah nicht mehr als einen Arm und ein dunkelblaues Hosenbein –‚ dann hatte der Eingang Faber auch schon verschluckt, als habe es ihn nie gegeben.
Das Klingeln des Telefons ließ Marten herumfahren. Der Mann im grauen Anzug, der schweigend unter der kahlen Wand am Tisch gesessen hatte, hob ab und fragte: «Ja?»
Er horchte eine Weile. Dann nickte er zweimal, erwiderte: «Habe verstanden!» und legte auf.
Als er sich Marten zuwandte, war etwas wie Triumph in seiner Stimme:
«Schwarzer Saab ... passiert eben den Kontrollpunkt. Wie wir erwartet hatten …»
«Vogel persönlich?»
«Sie glauben, es sei einer seiner engsten Mitarbeiter aus der Ostberliner Anwaltskanzlei. Aber so genau konnten sie das wegen der Dunkelheit nicht erkennen.»
«Wenn es nicht Vogel selbst ist, dreht sich‘s erst um Vorverhandlungen», sagte Marten nüchtern. Er wirkte ein wenig enttäuscht. «Dann ist Faber noch nicht so weit, wie wir geglaubt hatten.»
«Immerhin führt er mit der Gegenseite Geheimverhandlungen wegen der Freilassung seiner Freundin», wandte der andere ein. Er war einen Kopf kleiner als Marten und hatte ein frühzeitig gealtertes, am Kinn stark eingefallenes Gesicht, das aussah, als habe er sein Gebiss verlegt. «Klarer Verstoß gegen die Dienstvorschriften.»
«Wir sind nicht an kleinen Fischen interessiert», wehrte Marten ab. «Ein Verfahren in diesem Stadium würde ihn nur zu unüberlegten Reaktionen provozieren.»
«Möchte zu gern wissen, was wirklich hinter ihrer Verhaftung steckt.»
«So viel ist jedenfalls sicher.» Marten machte eine Handbewegung, die Verachtung ausdrückte. «Lea gehört zu dieser verrückten Sorte von Journalistinnen, die glauben, sie könnten den Staatssicherheitsdienst mit der linken Hand in die Tasche stecken. Ihm gefahrlos auf der Nase herumtanzen und den offenen Grenzverkehr praktizieren – im Namen der Menschlichkeit für ein paar Ausreisewillige den Samariter spielen! Immer Unzufriedene, die sich besonders gut auf die Mitleidsmasche verstehen.
Aber Fluchthilfe hat sich noch nie ausgezahlt. Sie wurde in einem Ostberliner Kaufhaus verhaftet. Missbrauch der Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung, Menschenhandel – so nennt man das drüben – in acht Fällen. Lea war voll geständig. Ein paar Tage in den Gefängnissen des Staatssicherheitsdienstes reichten aus, um sie zum Reden zu bringen. Sie hätte sich besser an die Gesetze halten sollen. Damit hat sie nur ihre Arbeitskollegen aus dem Westen in Schwierigkeiten gebracht.»
«Und ihr Freund? Welche Rolle spielte er dabei?»
«Ich glaube, Faber hatte von alledem keine Ahnung. Er ist einfach von ihrer Verhaftung überrascht worden und jetzt versucht er‘s auf nicht ganz legale Weise auszubügeln.» Marten wandte sich wieder der Straße zu.
Scheinwerfer huschten über die Hauswand am Ende der Fahrbahn. Ihr Saab bog langsam aus der Querstraße ein; sein Motorgeräusch war ungewöhnlich leise. Marten schloss daraus, dass sie im dritten Gang fuhren, um bei den Anwohnern der Straße kein unnötiges Aufsehen zu erregen. Eine seiner Scheiben war heruntergekurbelt und für einen Moment beleuchtete die Laterne die wohlgenährten, gleichgültig wirkenden Züge eines Mannes, der sich sofort wieder in den Wagenschatten zurückbeugte.
«Wendland», stellte er fest. «Sie haben einen ihrer besten Verhandlungsführer geschickt.»
Der Mann auf dem Rücksitz stieg aus. Er war unauffällig gekleidet und hielt ein ledernes Diplomatenköfferchen in der Rechten.
Noch ehe er die ersten Treppenstufen erreicht und geläutet hatte, wurde geöffnet. Im gleichen Augenblick setzte sich auch der dunkle Saab wieder in Bewegung, er rollte fast unhörbar die Straße hinunter. Alles machte den Eindruck einer perfekt eingespielten Aktion.
Marten verschränkte seine Hände auf dem Rücken und sah schweigend auf das Schattenspiel hinter den Milchglasscheiben. Der junge Mann an seiner Seite schien seine Gedanken zu erraten, als er sagte:
«Möchte hebend gern erfahren, worüber jetzt da drüben verhandelt wird …»
«Das würde viele Fragen klären», bestätigte Marten.
«Mit ein paar Mikrofonen wär‘s einfacher gewesen.»
«Dazu reichen die Verdachtsmomente gegen Faber nicht aus. Waldmann ist ein angesehener Anwalt. Und er verfügt über gute Verbindungen nach Bonn.»
«Also auch keine Ausnahmegenehmigung drin?», fragte der andere vorsichtig.
«Wenn etwas gegen ihn oder seine Kanzlei vorläge, ja. Dann vielleicht. Aber Waldmann tritt gegenüber Wendland nur als Vermittler für Vogel und seine Klientin auf. Wir hätten niemals grünes Licht dafür bekommen.»
Sie warteten eine Zeit lang ab, obwohl sie wussten, dass es nicht mehr viel zu tun gab. In einer halben Stunde würde der Wagen des Unterhändlers wieder vor der Haustür der Kanzlei auftauchen, Wendland einladen und ihn über den Kontrollpunkt nach Ost-Berlin zurückbringen.
Marten strich sich gedankenverloren mit drei Fingern über die Stoppeln an seiner Kehle.
«Die Dienste sind zahnlos und fromm geworden …», sagte er mehr zu sich selbst als an seinen Begleiter gerichtet. «Zahme Haushunde, die sich nur noch von durchgedrehtem Fleisch und gekochten Kartoffeln ernähren! Bellen zwar und verbuddeln ihren Knochen, als sei‘s das alte Spiel, aber dann geht ihnen schnell der Atem aus. Eines Tages wird es uns das Genick brechen ... wie im Fall Tiedge. Ja, genau wie im Fall Tiedge», bekräftigte er, als drohe ihm damit eine persönliche Gefahr.
«Ich bin gar nicht mal so sicher, ob eine Weibergeschichte das Risiko überhaupt wert ist», erklärte der junge Mann. «Ich selbst würde an seiner Stelle lieber …»
«Sie vergessen, dass auch Leas Tochter drüben ist. Er hat sie angenommen wie sein eigenes Kind.»
«Und wenn er jetzt einfach in ihren Wagen stiege? Der Grenzübergang ist nicht weit.»
«Nein, Faber ist einer unser erfahrensten Abwehrspezialisten. Deshalb würde er es nie ohne Gegenleistung tun. Er müsste sicher sein, dass sie freikommen – und dass Lea überhaupt zurückkehren will. Der fragliche Punkt an dieser dubiosen Fluchthilfegeschichte … sehr mysteriös.»
Marten wiegte skeptisch den Kopf.
«Auf jeden Fall aber würde Faber es nur als direkten Austausch akzeptieren. Im Gegenzug, Person um Person. Und natürlich würden wir ihn daran zu hindern wissen.»
«Natürlich. Ja, natürlich», sagte der junge Mann.
1
Reuben war zweieinhalb Wochen in Mittelamerika verschollen gewesen, ehe man seine Leiche an einer Wegkreuzung im dünnbesiedelten Nordosten Guatemalas fand. Die nächste Ortschaft, eine Ansammlung armseliger Hütten, lag etwa fünfzehn Kilometer entfernt.
Seine Identifizierung bereitete den örtlichen Behörden keine Schwierigkeiten; Gerüchten nach, die überall im Umlauf waren, sollte er für einen westdeutschen Geheimdienst gearbeitet haben. Das zuständige Konsulat in der Hauptstadt sah wenig Anlass, diese Version zu leugnen.
Er hatte entkleidet zwischen zwei großen, glattgewaschenen Basaltsteinen gelegen – mit einem weißen Lendentuch als einzigem Schutz.
Seine Haut war von seltsamer Blässe und grünlich durchscheinend, als man eine Lampe auf sie richtete. Anfangs glaubte der herbeigerufene comisario, ein dicklicher, völlig kahlköpfiger Mann, dessen Wangen von Pigmentflecken übersät waren, Reuben sei die Kehle durchgeschnitten worden.
An seinem Hals hatte man eine blutverkrustete Schnittwunde gefunden. Das wäre eine Todesursache nach Urbicos Geschmack gewesen, sie passte ins politische Bild. Die Guerillatrupps der kommunistischen PGT hatten niemals Skrupel gezeigt, was diese einfache und erfolgreiche Mordmethode anbelangte.
Einen Tag danach widerrief man Reubens Berufsstand und behauptete, er sei Mitarbeiter der deutschen Botschaft in Guatemala gewesen. Ein bedauerlicher Fauxpas. Eine Namensverwechslung, dazu derselbe Geburtsort.
Faber, der zwei Tage später mit der Bahn aus Guatemala City eintraf erklärte sich als Beauftragter der deutschen Behörden und Reubens Schwester.
Sobald die Obduktion abgeschlossen sei und die Genehmigung des zuständigen Amtes in Zacapa vorliege, werde er für seine Beerdigung in der Provinzstadt sorgen. Seine Schwester, die Deutschland nicht verlassen könne, lehne Reubens Überführung aus Kostengründen ab. «Arme Leute», erklärte Faber hinter vorgehaltener Hand. Er wolle ihr telegrafisch übermitteln lassen, dass hinter der Kirche ein hübscher kleiner Friedhofliege, auf dem Reuben zweifellos seinen Frieden finden werde.
Dem comisario kam es so vor, als sei Faber überhaupt nicht an der Todesursache interessiert. Er schien eigentümlich gleichgültig zu werden, ja fast vor Abneigung zu erstarren, wenn Urbico die Sprache auf seine ungewöhnliche, grüngraue Hautfärbung brachte. Es erweckte den Eindruck, als hinge sein Tod mit seinem Auftrag zusammen; und damit halte man besser hinterm Berg.
«Machen Sie sich darüber nur keine Gedanken, comisario», sagte Faber, als Urbico erwähnte, dass Reubens Obduktion noch immer keine Hinweise gebracht hatte. «Er trank zuviel mexikanischen Tequila. Zusammen mit Zitrone und Salz … Ich meine: im Übermaß genossen, und wenn sich die Leber zu zersetzen beginnt – soll sich dabei nicht genau jene Hautfarbe einstellen?»
«Nicht, dass ich wüsste.»
«Die Zeit eingerechnet, die er dort in der Sonne lag?»
«Im Schatten. Er lag im Schatten zwischen zwei Basaltsteinen. Man fand ihn in den späten Abendstunden und er konnte nicht vor dem Nachmittag gestorben sein.»
«Das beweist wohl, wie betrunken er war. Oder gehe ich fehl in der Annahme? Wer, außer einem Betrunkenen, verirrt sich schon in ein so abgelegenes Stück Sumpfland?»
«Bei Leberzirrhose sind die Augäpfel gelb. Man erkennt die zersetzte Leber auch an der Rotfärbung der Fingerkuppen und des Handballens. Nichts davon ist bei Reuben zu finden.»
«Und sein Blutalkohol?»
«Normal. Ich würde sagen, völlig normal. Was mir mysteriös erscheint, ist seine grüne Hautfarbe.»
Sie standen auf der Dachterrasse des Hotels Incommente.
Unter ihnen bewegten sich Indiomädchen, die Obst und Gemüse und bemalte Tonkrüge zum Markt trugen. Straßenverkäufer boten laut ausrufend tacos an, flache, gerollte Maisfladen, mit Schweine- und Truthahnfleisch in pikanter Soße gefüllt. Heilhäutige Mädchen, eine Gruppe ladinos, Mestizinnen auf dem Wege zu irgendeiner Fachschule, nahm Faber wegen der blauen Uniformjacken an, winkten ausgelassen zu ihnen hinauf, als sie die beiden Männer auf dem Dach erblickten.
Faber winkte zurück. Gleich darauf schien er sich der Pietätlosigkeit seiner Gebärde angesichts eines unaufgeklärter Mordfalls bewusst zu werden und er fragte mit ernstem Gesicht:
«Dafür gibt es doch sicher irgendwelche Vergleichsfälle, comisario?»
«Nein, keine.»
«Nicht einen einzigen?»
«Wie ich schon sagte: völlig mysteriös.»
«Und was vermuten Ihre Chemiker?»
«Sie sind noch nicht mit den Analysen zu Rande. Möglich, dass es sich um einen indianischen Zaubertrunk handelt.»
«Einen Zaubertrunk?»
«Diese Burschen sind sehr abergläubisch. Und manches ist ja auch nicht von der Hand zu weisen», setzte er hinzu; dabei deutete er mit den Fingerspitzen auf seinen Jackenärmel. «Ich hatte selbst einmal ein sehr hartnäckiges Nervenleiden im linken Arm, dauernde Schmerzen, als kröchen Ameisenströme durch meine Adern. Kein Arzt in der Stadt konnte mir helfen.
Dann traf ich eine alte Indiofrau, die vom Land kam, um auf dem Markt ihre Heilkräuter anzubieten. Sie empfahl mir, meinen Arm zu besprechen. Das könne ich selbst tun, es komme nur auf die richtigen Worte an.
Glücklicherweise nahm ich ihren Rat ernst. Ich setzte mich in eine ruhige, abgedunkelte Ecke meiner taberna, wo ich auch zu essen pflegte, und sagte dreimal: Weiche von mir, Satan! Es waren die Worte, die sie mir auf den Weg gegeben hatte. Und seitdem sind meine Beschwerden verschwunden …»
Er sah Faber so ungläubig an, als müsse er selbst für ihn ein gehöriges Maß an Skepsis übernehmen.
«Bemerkenswert. Wirklich bemerkenswert», sagte Faber und versuchte seiner Stimme einen überzeugten Klang zu geben. Er nahm, dankbar für die Ablenkung, den Zettel in Empfang, den ihm der Hotelboy auf einem silbernen Tablett reichte:
Erwarte Sie an der Rezeption. Fräulein Menge Botschaft der Bundesrepublik Deutschland in Guatemala
stand dort in zierlicher Frauenhandschrift mit leicht verwischter blauer Tinte geschrieben.
«Richten Sie der Dame aus, ich sei momentan verhindert.» Faber gab dem Boy einen halben Quetzal. Zu viel, wie er sofort argwöhnte, denn der Quetzal stand mit dem Dollar eins zu eins. «Wenn es wirklich dringend ist, soll sie gegen Abend wiederkommen. Kurz vor dem Abendessen.» Damit wandte er sich wieder dem comisario zu, der, die Arme über das Geländer der Dachterrasse gestützt, den Kampf zweier roter Hähne im Straßenstaub beobachtete.
«Und die Schnittwunde an seinem Hals?»
«Keine Schnittwunde. Das war unsere erste Vermutung, aber schon nicht mehr die zweite … nur von einem dünnen Strick oder Draht! Man muss ihn ein wenig damit stranguliert haben. Es reichte nicht aus, um ihn zu töten.»
«Soll das heißen, Sie tappen noch immer im Dunkeln?»
«Es ist schon sehr mysteriös», bestätigte der comisario. Er schien das Wort «mysteriös» zu lieben, weil es seine tägliche Arbeit charakterisierte. Es gehörte zum Beruf.
«Und die Beerdigung?»
«Verschoben, bis eine neue Obduktion der Leiche eindeutige Ergebnisse gebracht hat. Wir haben ihn ein wenig auf Eis gelegt, Señor Faber.»
«Mit anderen Worten – ich muss bleiben, bis es Ihnen einfällt, seine Leiche freizugeben?»
«Sie haben Gelegenheit, noch einige Tage unser schönes Land zu genießen. Es gehört zu den interessantesten in ganz Mittelamerika. Ihre Botschaft wird sicher für die Spesen aufkommen.» Er betonte das Wort Botschaft. «Ja, wenn es sich um einen Einheimischen handelte ... Bei Ausländern nehmen wir die Dinge sehr genau. Man kommt zu leicht in Verruf.»
Der kleinere der beiden Hähne hatte aufgegeben, er blutete aus einer tiefen Wunde am Hals, und seine rechte Flugfeder schleifte abgeknickt durch den Straßenstaub, als er das Weite suchte. Faber setzte sich missmutig in den Schatten des Sonnenschirms. Er sog an seinem hellen Zigarillo und trank einen kleinen Schluck Martini, bis die Eiswürfel gegen seine Zähne stießen, dann stellte er das leere Glas abrupt auf die Tischplatte zurück.
«Was macht Sie eigentlich so sicher, dass es die Guerillas waren? Wenn ich richtig informiert bin, gibt es in Ihrem Land über dreißig ultrarechte Todesschwadronen?»
«Zweiunddreißig – nach einer Zählung unserer Tageszeitung Unomasuno», bestätigte Urbico. «Von der ESA, der antikommunistischen Geheimarmee einmal abgesehen. Aber das sind alte Zahlen, wahrscheinlich hat sich ihre Zahl längst verdoppelt.»
«Was macht Sie so sicher?» wiederholte er.
«Nun, sehr einfach: Sie pflegen ihr Zeichen zu hinterlassen. Den Farbabdruck einer weißen Hand, eine rote Rose … Und außerdem lieben sie es, ihren Opfern die Genitalien abzuschneiden. Oder wenigstens die Zunge oder die linke Hand. Nichts von alledem bei Ihrem Freund Reuben.»
«Wie kommen Sie darauf, dass Reuben mein Freund war?»
«Ein Kollege, nehme ich an?»
«Sie glauben noch immer diesen dummen Fauxpas des Konsulats? Dass er für einen westdeutschen Geheimdienst gearbeitet hat? Wie gesagt, eine Namensverwechslung.»
«Ja, natürlich.»
«Man nannte Ihnen einen Dienst, der eigentlich für die innere Sicherheit unseres Landes zuständig ist, für die Treue der Verfassung gegenüber. Schon daran erkennen Sie, dass Reuben gar nicht für die Auslandsaufklärung zuständig sein konnte. Bei uns werden diese Bestimmungen sehr streng gehandhabt. Selbständige Gruppen, wie Ihre Todesschwadronen, die den Regierenden zuarbeiten, wären in unserem Lande völlig undenkbar … Ganz abgesehen von der Brutalität, mit der sie zu Werke gehen.»
«Nun, Sie haben auch keine Indios! Unsere Generäle glauben – und wohl zu Recht –‚ dass diese Menschen besonders anfällig sind für exotische Ideologien. Aus Tradition streben sie nicht nach Grundbesitz und geben sich gern mit Gemeineigentum zufrieden. Es macht ihnen keinerlei Schwierigkeiten.
Daher auch die Namen unserer Schwadronen, wie Adler der Gerechtigkeit, Purpur-Rose, Weiße Hand und so weiter. Eine Art Gegengewicht. Die andere Seite hat ihre Namen, und Namen beschwören in den Augen der Indios uralte mythische Kräfte. Alle diese Organisationen sind durchaus von der Rechtmäßigkeit ihrer nationalen Aufgabe überzeugt.»
Er setzte sich zu Faber an den Tisch, schob seinen Strohhut in den Nacken und stocherte mit dem Zahnstocher in einer Kirsche, die auf dem längst zerflossenen Vanilleeis schwamm.
«Wie ich hörte», fuhr er fort, «ist Ihre Angst vor den Kommunisten drüben im alten Europa kaum geringer? Nur dass Sie weniger öffentlichen Aufhebens davon machen? Alles spielt sich mehr im Verborgenen ab?»
2
Ehe Faber die Halle des Hotelrestaurants betrat, blieb er stehen und musterte durch eine Wand aus Hartblattgewächsen kurz die Gäste an den Tischen.
Er erinnerte sich, dass es in der Botschaft einige ältere Fräulein gab, die, hinter ihren Schreibmaschinen sitzend, die goldgeränderten Brillen hochgeschoben oder sich überrascht an den Hals gegriffen hatten, als er hereinkam; es brauchte nicht viel Phantasie, um zu verstehen, was diese vertrockneten Jungfern an ihm fanden.
Es war seine hochgewachsene Gestalt, die sich für ihre gelangweilten Blicke wohltuend von den kleinwüchsigen Indios abhob. Und sein hellblondes Haar. Vielleicht weckte es in ihnen unbestimmte Sehnsüchte nach dem kühlen Norden.
Erleichtert bemerkte er, dass keine von ihnen in der Halle saß. «Fräulein Menge» klang etwas zu blutleer und erinnerte ihn eher an Fencheltee und Nierenwärmer aus Katzen- oder Kaninchenfell, als dass er Neugier verspürt hätte, ihre Bekanntschaft zu machen. Zu dieser frühen Stunde – man pflegte hier erst am späten Abend zu essen – gab es überhaupt nur ein weibliches Wesen im Restaurant.
Es saß unter der Nachbildung eines Wandgemäldes aus der Mayazeit, das, in roten und tiefgrünen Farben schwelgend, zwei Priester mit hohem Kopfschmuck zeigte. Sie beugten sich über eine menschliche Gestalt – ein weibliches Wesen, den schlanken Gliedmaßen nach zu urteilen –‚ das als Opfergabe diente.
Einer der beiden hielt die Blutschale, der andere das Messer. Faber umrundete den Raumteiler aus hartblättrigen Pflanzen und setzte sich an einen Tisch, von dem er den Eingang überblicken konnte.
Marten hatte ihm gesagt, dass man den Kontakt zur Botschaft besser einschränkte: dort zwei- oder dreimal in der Woche ein und aus zu gehen, würde nur den alten Verdacht nähren, Reubens Auftrag habe mit den politischen Verhältnissen zu tun gehabt. Es hätte leicht den Geheimdienst des Landes auf den Plan rufen können.
Wenn man jetzt von sich aus mit ihm Kontakt aufnahm, gab es sicher neue Informationen über Reubens Ermordung …
Faber betrachtete das Mädchen am Nachbartisch.
Es hatte ein wenig Ähnlichkeit mit Lea, und diese Beobachtung versetzte ihm einen Stich. Die gleichen ebenmäßigen Züge, die gleiche glatte Haut. Und es besaß nicht jenen manchmal ein wenig verbissen wirkenden Zug um den schmallippigen Mund, den sich Lea in ihren langen Jahren als freie Journalistin erworben hatte.
Diese Lippen dort drüben waren von der einladenden, schon beinahe herausfordernden Röte, wie sie eher auf kitschigen Öldrucken bei dunkelhäutigen Zigeunerinnen zu finden ist. Der himmlische Maler da oben mußte trotzdem gewollt haben, dass sie es nicht zu leicht mit den Männern haben würde, denn ihre Augen standen ein wenig schief, wenn auch nur ganz unmerklich.
Oder tat er ihr Unrecht? Legte sie es gar nicht darauf an, gleich beim Abendessen die Blicke aller Kerle zwischen sechs und sechsundsechzig auf sich zu lenken?
Faber saugte unschlüssig an seinem kalten Zigarillo. Das Mädchen bemerkte seinen aufdringlichen Blick und nickte ihm lächelnd zu.
Ernüchtert beugte er sich wieder über die Speisekarte.
«War es wirklich nötig, mich so lange warten zu lassen?», fragte sie.
Er hob überrascht den Kopf. «Was denn, sind Sie etwa …?»
«Corinna Menge von der Botschaft», bestätigte sie. «Ich erledige die Sonderaufgaben – seitdem ich meine journalistische Arbeit an den Nagel gehängt habe.»
«Doch nicht auch noch Journalistin?», fragte er. «Habe ich das richtig verstanden?»
«Was soll daran so ungewöhnlich sein?»
«Eine gute Freundin von mir hat den gleichen Beruf Sie wird in der DDR wegen Fluchthilfe festgehalten, aber das ist eine andere Geschichte … Darf ich mich zu Ihnen setzen?»
«Sicher, ich bitte sogar darum.»
Faber kam ein wenig zu schwungvoll um den Tisch herum und winkte zum anderen Ende des Saales. Doch der Kellner beachtete ihn nicht, obwohl er ihm kurz das Gesicht zugewandt hatte; er kniete weiter mit einem Stapel weißer Tischtücher über dem Arm vor dem hohen Kommodenschrank.
«Hier müssen Sie bei allem etwas mehr Geduld haben», sagte das Mädchen. «In Mittelamerika gehen die Uhren anders. Er hat sie gesehen, deshalb wird er es sich als eine besondere Aufmerksamkeit anrechnen, dass er sich nachher noch an Sie erinnert.»
«Um ein besseres Trinkgeld herauszuschinden?»
«Wieso nicht?»
Faber zuckte die Achseln und versuchte nachzudenken. Aus irgendeinem Grund fiel ihm nur ein schäbiger und etwas zu anrüchiger Witz über ihre langen Beine ein. Er unterdrückte ihn gerade noch rechtzeitig und fragte:
«Sie kommen wegen Reuben, habe ich recht?»
«Die Botschaft hat mich Ihnen als Begleiterin zugeteilt – als Assistentin, wenn Sie so wollen.»
«Als Assistentin? Aber ich habe niemanden angefordert!»
«Sie fahren doch nach Baril, stimmt‘s?»
«Wer sagt das?»
«Sie wollen den jungen Goldstein befragen, der dort an einem Entwicklungshilfeprojekt arbeitet. Der Mann, um dessentwillen Reuben herkam …»
«Mir ist schleierhaft, wie Sie auf diese Idee kommen?»
«Haben Sie gestern Abend etwa keinen Busfahrschein nach Baril gelöst?»
«Ja. Und es war die letzte Karte.»
«Nun, nicht ganz die letzte. Hier ist mein Fahrschein.» Sie zeigte ihm ein gelbes Billett aus hauchdünnem Papier, das den Nachbarplatz belegte. Er erinnerte sich, dass seine Sitzplatznummer 50 lautete, und ihre war 51».
Der Kellner tauchte neben ihnen auf – das Gesicht mit den schwarzen Hirschaugen treuherzig lächelnd. Faber bestellte bis auf Nachtisch und Vorsuppe die Zusammenstellung des Menüs, die aus drei weiteren Gängen bestand, ließ sich dann aber überreden, auch den Nachtisch – heißen Pfirsich mit Eis – zu nehmen. Er war im Preis inbegriffen. Nachlass für seinen Verzicht würde es nicht geben.
Es bereitete ihm Vergnügen, in ihren Augen als knauserig zu gelten.
«Ich verstehe wirklich nicht, was das alles soll?», fragte er, als der Wein eingeschenkt wurde. «Warum man mir eine Aufpasserin zuteilt, meine ich.»
«Keine Aufpasserin. Die Fahrt im Landesinnern ist ziemlich riskant. Gerade in den abgelegenen Dörfern. Guerillas, Todesschwadronen, Militär ... Es gibt Ausgangssperren für die Anwohner, und wer sie nicht beachtet, wird erschossen. Dazu eine Menge Zivilpatrouillen, einfache Leute, Analphabeten vom Lande, die 24 Stunden pro Woche Dienst ableisten müssen und nicht immer zwischen erwünschten und unerwünschten Ausländern unterscheiden können.
Wahrscheinlich würden Sie wegen ihres blonden Haars für einen Russen gehalten.»
«Ich wüsste nicht, dass meine Haarfarbe für Kommunisten besonders typisch wäre?»
Sie schien einen Augenblick zu erstarren, seine harmlos gemeinte Antwort veränderte ihren Gesichtsausdruck so krass und unerwartet, dass Faber sich etwas vorbeugte, damit etwas mehr Licht von der Wandlampe auf ihr Gesicht fiel. Aber sie hatte sich schon wieder gefangen.
«Diese einfachen Leute machen keinen Unterschied zwischen Skandinaviern und Russen. Es wäre wohl auch etwas zuviel verlangt, die meisten von ihnen haben noch nie eine Landkarte gesehen.»
«Vielleicht sollte ich telefonieren», sagte Faber missmutig. «Mit dem Botschafter.»
Sie aßen schweigend. Das einzig wirklich Genießbare, fand er, waren die heißen Pfirsiche mit Eis. Dosenpfirsiche, aber immerhin. Er beglückwünschte sich noch im Nachhinein, dass er nicht darauf verzichtet hatte. Seine Körpergröße verlangte nach ausreichend Kalorien.
Darin glich er seinem übergelaufenen Kollegen Tiedge, der in keinen Anzug von der Stange passte. Angeblich fraß er bei festlichen Veranstaltungen regelrechte Schneisen ins kalte Büfett.
«Weil Sie niemand in Ihrer Nähe dulden?», fragte sie. «Oder weil es Sie stört, dass Ihnen jemand nachläuft?»
«So ungefähr.»
«Sie werden noch froh über meine Begleitung sein.»
«Kann ich mir schlecht vorstellen.»
«Waren Sie jemals im Landesinnern?»
«Das klingt ja, als gingen wir auf Expedition?»
«Meiner Meinung nach sollten Sie Ihre Nachforschungen besser einstellen. Wie mir der Botschafter sagte, gehört es gar nicht zu Ihrem Auftrag. Ihre Vorgesetzten in Köln werden sehr ungehalten sein.»
«Der Botschafter?»
«Er gab mir den Auftrag. Er ist besorgt um Sie.»
«Ich schlage mir nur die paar Tage bis zur Freigabe von Reubens Leiche um die Ohren. Und dabei versuche ich mir ein Bild über seine Arbeit hier in Guatemala zu machen, über seine wirklichen Absichten. Er kam wegen Goldstein her. Ich werde ihm einige Fragen dazu stellen. Das ist alles.»
Sie schürzte die Lippen und betastete sie mit ihrem Zeigefinger, dessen Nagel perlmuttfarben lackiert war. «Wenn Sie nur auf die Freigabe seiner Leiche warten», sagte sie nachdenklich, «könnte ich das für Sie erledigen.»
«Sieht ganz so aus, als wollten Sie mich loswerden?»
«Und Sie mich ebenfalls!»
«Na prächtig, dann sind wir uns ja einig. Ich schlage vor, dass wir uns bis zu meinem Rückflug aus dem Weg gehen.»
Er stand auf, und sie folgte ihm in einigem Abstand zur Saaltür. Der Kellner kam eilig aus seinem Verschlag hinter den Lamellenwänden, die Rechnung mit ihren verschiedenartigen Durchschlägen wie einen welkenden Blumenstrauß in der Hand.
«Geht alles zu Lasten des deutschen Botschafters», sagte Faber. «Einschließlich 15 Prozent Trinkgeld. Ich glaube, ich war von der Dame eingeladen.»
Als er unmerklich den Kopf drehte, bemerkte er aus den Augenwinkeln, dass sie zahlte. Sie drückte dem Kellner eine größere Banknote in die Hand, ohne das Wechselgeld abzuwarten. Sie war Lea wirklich sehr ähnlich. «Nur noch etwas langbeiniger …», murmelte er mit einem Anflug von Selbstironie. «Ein Anblick, der mir bei der Arbeit gar nicht bekommt.»
Selbst ihre Art, sich zu bewegen, war die gleiche. Manchmal hielt sie für Sekunden inne und legte den Kopf ein wenig schief, als erwarte sie irgendeine Lügengeschichte. Wie eine jüngere Schwester, genauso hartnäckig und verbissen!
Wenn etwas an dieser Fluchthilfegeschichte dran war, wenn sie kein Vorwand war, um sie in Ostberliner Untersuchungshaft zu halten – Lea hätte eine ebenbürtige Helferin gefunden.
Am Fuß der Treppe wandte er sich nach ihr um und versuchte seiner Stimme einen mürrischen Tonfall zu geben. «Verschwinden Sie …»
«Wollen Sie mir den Weg verbieten?»
Sie folgte ihm die Treppe hinauf.
«Was werden Sie jetzt tun?», fragte sie an Fabers Zimmertür.
«Mich betrinken. Ich werde mir eine Flasche aufs Zimmer bestellen und mich besaufen.»
«Und massenweise Zigarillos rauchen?»
«Sicher. Der Qualm würde Sie nur stören.»
«Könnte ich Ihnen denn nicht … dabei helfen?»
«Beim Trinken? Sind Sie dem Alkohol verfallen?»
«Nein, Sie etwa?»
«Wie man‘s nimmt. Die Jungs in den Diensten halten es alle mit dem Alkohol, heimlich oder ganz offen. Er ist wie ein verständnisvoller älterer Bruder für sie. Die Nerven, das unruhige Leben. Ohne Flasche sinkt ihre Leistung um ~o Prozent, deshalb achten sie immer auf Vorrat, auf ausreichenden Vorrat. Ausnahmslos alle, Tiedge, Reuben ... und auch ich», setzte er mit Nachdruck hinzu.
«Tiedge …» Sie dachte nach. «War das nicht dieser Überläufer?
Dieser große, kranke Agent mit den hohen Schulden, der nach Ost-
Berlin ging, als er keinen Ausweg mehr sah? Einer der größten
Spionageskandale seit dem Krieg? Und in Ihrer Abteilung?»
«Kein Agent – Agentenjäger.»
«Richtig. Das ist wohl ein ziemlich wichtiger Unterschied, nicht wahr?»
Während der Blick ihrer etwas schräg stehenden Augen fragend auf seinem Gesicht ruhte, wurde ihm bewusst, dass er sich mit Tiedge und Reuben in eine Reihe gestellt hatte. Er hätte ebenso gut andere Namen nennen können. Es war ganz unbewusst passiert.
Sie hatten wie er in der Abteilung IV für Spionageabwehr gearbeitet, und es machte ihn wütend, dass er diesen Umstand ohne zwingenden Grund preisgegeben hatte. Er schob ärgerlich über sich selbst die Tür auf, trat ein und drückte sie bis auf einen Spaltbreit zu.
«Machen Sie, dass Sie wegkommen!»
Corinna sah, überrascht von seinem barschen Ton, auf ihre Füße hinunter, die in Stöckelschuhen aus dünnen Wildlederriemen steckten. Sie schien ihren Fuß in den Türspalt schieben zu wollen; aber dann ließ sie es bleiben. Faber streckte das Schild DON‘T DISTURB hinaus und hängte es von außen an den Messingknauf. Er schloss die Tür.
Am nächsten Morgen gab er sich zwar wie jemand, dem es nicht einmal eine Kopfbewegung wert war, um sie zwischen den wartenden Fahrgästen an der Busstation zu entdecken …
Aber sein Blick wanderte von Zeit zu Zeit argwöhnisch – und aus alter Gewohnheit so gründlich, als versuche er sich jedes Gesicht für immer einzuprägen – über Körbe und Kisten und die Menge behuteter Köpfe. Zu seinen Füßen schlugen an den Beinen zusammengebundene Hühner mit den Flügeln, und ein Mulatte von der Nordostküste sang, am Bus neben dem Gepäck lehnend, auf karibisch-englisch ein sarkastisch klingendes Lied.
Sein Text schien sich über das unterwürfige, halblaute Sprechen der anderen Passagiere lustig zu machen.
Faber stellte erleichtert fest, dass Corinna nicht gekommen war. Die meisten Indios trugen Hüte und dunkle Jacken westlichen Schnitts, und wie von ihren Jacken oder Ponchos trennten sie sich auch von ihren Hüten nur ausnahmsweise, obwohl kein Lüftchen wehte und die Sonne auf Fabers Wagenseite durch die Scheiben brannte, als lege sie es darauf an, alles um sie herum in Flammen aufgehen zu lassen.
Man konnte glauben, es explodiere gleich eine Bombe der einen oder anderen Seite, oder bei Maschinengewehrsalven von den Dächern der umliegenden Hotels würde ihnen keine Zeit mehr bleiben, ihre armselige Habe zusammenzuraffen.
Der Fahrer band einen Ziegenbock auf den Holzrippen des Wagendachs fest, und jugendliche, barfüßige Straßenverkäufer boten in zerschlissenen Körben Früchte und Nüsse an. Dann wurde der Motor angeworfen. Er versetzte das altersschwache Gefährt sofort in allgegenwärtiges Zittern. Faber musterte besorgt die rostigen Schrauben und Nieten der Wandverstrebungen. Seine Scheibe hing schräg in der Halterung. Wo sich ihre Rundung in den Rahmen hätte einpassen sollen, fehlte ein faustgroßes Stück Glas, das ein Steinwurf oder Schuss herausgerissen haben mußte. In der feuchten Hitze tummelten sich die Fliegen. Das Fahrzeug hupte gellend, ihr Abfahrtssignal, und aus dem Schatten der cantina lösten sich die letzten Passagiere.
Dann sah er Corinna mit einer ledernen Umhängetasche über den Platz eilen …
Sie winkte aufgeregt dem Fahrer.
«Rapido, no pare», rief Faber ihm zu.
Einige Passagiere, alte Männer, lachten wegen seiner Dreistigkeit. Frauen waren es nicht wert, dass man für sie Bremsbelag vergeudete; schon gar nicht, wenn sie so offensichtlich der Rasse der Gringos angehörten.
Einen Augenblick lang schien es tatsächlich, als rumpele das Gefährt über den mit Asphalt gefüllten Löchern des Sandplatzes weiter, dann kam es abrupt zum Stehen. Der Ziegenbock über ihnen auf dem Dach gab ein lautes Meckern von sich, und die Hühner zu seinen Füßen schlugen wild mit den Flügeln.
Faber spuckte ein Stück flaumiger Feder aus, das ihm zwischen die Lippen geraten war.
Als er aufblickte, plumpste Corinna neben ihm auf den Sitz.
«Das haben Sie sich so gedacht», fauchte sie.
«Gedacht, was?»
«Ich konnte hören, was Sie dem Fahrer zuriefen»
«Ich wollte, dass er anhielt. Vielleicht ist mein Spanisch zu schlecht.»
«Ihr Spanisch ist ausgezeichnet. Sie haben no pare, nicht anhalten, gerufen.»
«So? Na, das wundert mich nicht. Wahrscheinlich ist der Motor beim Bremsmanöver in die Brüche gegangen.»
Tatsächlich war der Fahrer ausgestiegen und horchte besorgt auf den metallischen Klang unter der Motorhaube. Es hörte sich an, als schüttele man leere Konservendosen in einem Waschzuber. Je länger sie im Leerlauf standen, desto rasselnder wurde das Geräusch, untermalt vom dumpfen Geklapper der Ventile. Doch nachdem er irgend etwas im Motorraum laut fluchend mit einem Stück Draht befestigt hatte, setzten sie die Fahrt ohne größere Unterbrechungen fort.
Als sie hoch genug aus dem Tal mit seinen grünen Hängen aufgestiegen waren, sahen sie milchigblau und weit entfernt im Dunst die Kegel zweier Vulkane aufragen. Ihr Anblick strahlte etwas Entrücktes und Erhabenes aus – als blickten ihre Gipfel mit milder Nachsicht aus einer fernen Zeit auf sie herab, die so unendlich viel bedeutender als die Gegenwart war, dass darüber alles andere verblasste.
Dann wurden sie unvermittelt in die Wirklichkeit zurückgeholt:
Auf dem schwarzen Stoppelfeld vor ihnen stand eine ausgebrannte Maschine der AVIATECA, der staatlichen Luftfahrtlinie; Sitzgestelle, aus denen noch die Federspiralen ragten, und leere Gepäckcontainer waren weit über den Boden verstreut. Die beiden Alten vorn beim Fahrer, Indiofrauen von derbem Bauernschlag, verhüllten ihre Gesichter mit weißen Taschentüchern, als böte das Schutz vor kommendem Unheil.
Augenblicke später fuhren sie durch dichten Mischwald, und es wurde angenehm kühl im Bus. In den Tierras templadas, dem zentralen Hochland, lagen die Temperaturen das ganze Jahr über bei 20 Grad.
Ein paar Minuten lang genoss Faber die Fahrt. Die Straßen waren mustergültig für mittelamerikanische Verhältnisse. Lea im fernen Ost-Berlin schien ihm so wenig wirklich wie jemand, der nur noch in der Einbildung existierte.
Er hatte Ross dazu bringen können, ihm diesen Auftrag zu überlassen, weil sie beide, Reuben und er, viele Jahre lang Kollegen in derselben Abteilung gewesen waren, «alte Kameraden» – was immer das bedeuten mochte. Von echter Freundschaft war zwischen ihnen nie die Rede gewesen. Obwohl Faber manchmal das Gefühl gehabt hatte, und Reuben wohl nicht minder, sie ständen dicht davor. Den wirklichen Grund, warum er hinter dem Auslandsauftrag her war, hätte er Ross nicht gut nennen können.
Eine Verschnaufpause – Abstand zu gewinnen von dem, was ihm zu schaffen machte, war kein Motiv, das für einen Mann seiner Position irgendeine Geltung beanspruchen konnte. Es wäre ein Eingeständnis von Schwäche gewesen.
Als «ewiger Vize» und langjährige rechte Hand wechselnder Chefs, die so unnahbar wie Kometen an ihm vorübergezogen waren, schätzte Ross es nicht sonderlich, wenn man Sonderwünsche äußerte. Er bereitete sich darauf vor, die höchste Stufe in der Hierarchie zu erklimmen – vergeblich, wie man in der Organisation mit gewohnter Schadenfreude orakelte –, und auf diesem dornenreichen Weg erschien ihm selbst der harmlos gemeinte Vorschlag eines Auslandsauftrags als Einmischung in die Planungen der Führungsspitze. Das galt noch strikter für Aufträge, die wie dieser so weit außerhalb von Fabers gewohnten Aufgaben lagen.
Ross und Marten hatten ihn nach allen Regeln der Kunst davon zu überzeugen versucht, dass ein Geheimnisträger seines Ranges besser im eigenen Land blieb. Deshalb hatte Ross‘ plötzliches Einlenken zwei Tage nach dem ergebnislosen Treffen mit Leas Anwalt in Faber sofort den Verdacht erregt, sie seien ihm auf der Spur.
Aber genaugenommen gab es dafür keine Beweise. Er versuchte sich auszumalen, wie sie reagieren würden, wenn sie entdeckten, dass er sich schon ziemlich weit vorgewagt hatte – vorgewagt ohne Ergebnis für Lea … Es fiel nicht zu seinen Gunsten aus. Er war dankbar für die Ablenkungen der Reise.
Einer der Indios im Bus bekreuzigte sich, und die anderen stimmten in sein Gebetsmurmeln ein. Der Mischwald war unvermittelt zum Regenwald geworden …
«Was ist los?», fragte Faber.
«Sie glauben, dass im Dschungel dvendes hausen, kleine, über und über mit grauem Haar bedeckte Männchen, die jedem den Daumen abschneiden, der nicht achtgibt.»
«Den Daumen?», fragte er verständnislos. «Wozu?»
«Ich weiß nicht … vielleicht, weil sie selbst keinen haben.»
Fabers Blick streifte skeptisch die wie in Erwartung kommenden Unheils dasitzenden Gestalten. «Deshalb verstecken sie ihre Hände in den Hosentaschen?»
«Man kann nie wissen.»
«Ist das nicht reichlich abwegig? Wenn man bedenkt, wer ihre wirklichen Feinde sind?»
«Wen haben Sie denn da im Auge?»
«Die Militärs zum Beispiel. Oder die Amerikaner. United Brands, Castle & Cook, Del Monte, die Nachfolger der United-Fruit-Company.»
«Das sagen Sie – als Mitarbeiter eines westlichen Geheimdienstes?»
«Sie werden mich doch deswegen nicht bei Ihrem Vorgesetzten anschwärzen?»
«Hängt ganz von Ihren Manieren ab.»
Die Landschaft nahm unvermittelt das Aussehen eines schmierigen braunen Sandkastens an.
Baril lag in einer Senke, es war nicht mehr als eine Ansammlung verstreuter ein- und zweistöckiger Häuser, zum Zentrum hin etwas dichter, mit der Maisbierbrauerei und dem zerschossenen Kirchturm inmitten eines vertrockneten Parks, um den sich sonnendurchglühte Gassen gruppierten; streunende Hunde, so gelb wie der Straßenstaub, schienen ihre einzigen Bewohner zu sein.
Doch dann öffnete sich für Sekunden der Blick auf den im Schatten großer Hallen liegenden Marktplatz, und sie sahen, dass sich dort zwischen schwerbeladenen Obst- und Gemüseständen halb Baril ein Stelldichein gab.
Am Ortseingang, vor der einzigen Erhebung, die für den Kampf gegen die Guerillas strategisch bedeutsam war – einem etwa fünfzehn Meter hohen Basaltstein –‚ wurden sie von der üblichen Zivilpatrouille gestoppt.
Indios mit den Gesichtern früh gealterter Kinder sammelten ihre Pässe und Papiere ein. Sie stiegen aus und vertraten sich die Füße unter der Felswand.
Das Ganze kam Faber wie die Aufführung eines schäbigen Hinterhoftheaters vor. Er war ziemlich sicher, dass niemand in der Zivilpatrouille einwandfrei lesen konnte; die dunkelhäutigen Gestalten in ihrer zerlumpten Kleidung ließen sich nur von den amtlich aussehenden Stempeln ihrer Pässe beeindrucken.
Keiner der Einheimischen war ohne Genehmigung unterwegs, und Gringos betrachtete man offenbar immer als Touristen, wenn sie nicht gerade der kommunistischen Untergrundtätigkeit verdächtigt wurden. Diesmal winkte man sie durch.
«Goldstein arbeitet drüben in dem Projekt hinter den Hügeln», sagte Corinna, als sie neben der Post hielten. «Von hier aus ist es nicht zu sehen.»
«Und Reubens Hotel?», fragte er.
«Das Gebäude neben dem Wollbaum.»
Fabers Blick folgte ihrer ausgestreckten Hand. Der zweistöckige Bau besaß eine umlaufende Holzgalerie, die momentan zum Trocknen von weißen Bettlaken zweckentfremdet wurde und dem Dachgeschoss das Aussehen eines in Tücher gehüllten, überdimensionalen Sitzmöbels verlieh.
Sie betraten das Hotel nicht durch die große dunkle Halle, weil dort gesägt und gehämmert wurde, sondern über den Eingang der cantina. Der Wirt war damit beschäftigt, die Außenseite eines schmierig aussehenden Glaskastens zu polieren. Faber fragte ihn nach Zimmern.
«Doppelzimmer?»
«Zwei Einzel», sagte Corinna.
«Hier nimmt‘s niemand wegen des Trauscheins so genau», meinte der Wirt und wischte mit einer Armbewegung über die am Tisch sitzenden Einheimischen hinweg, als seien es Gespenster. «Erst recht nicht bei Fremden. Wenn Sie ein Doppel wünschen …?»
«Geht in Ordnung», nickte Faber.
«Unterstehen Sie sich», sagte Corinna; sie begann ihren Meldezettel auszufüllen. «Wir sind dienstlich unterwegs.»
Faber zwinkerte dem Wirt zu. Sein Gesicht war feist und stoppelig und erinnerte ihn an einen Griechen, den er vor vielen Jahren gekannt hatte. Er trug seinen Namen – Baredo – als kleinen gestickten Schriftzug am Hemd.