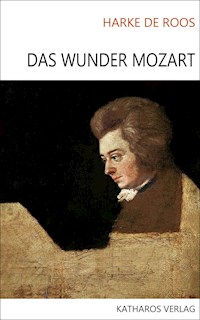Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Buch taucht unvermittelt in die Mitte des Lebens Beethovens ein. Es erzählt von der Zusammenarbeit und vom nachfolgenden Konflikt zwischen dem ertaubenden Komponist und dem geschäftstüchtigen Mechaniker Johann Nepomuk Mälzel. Im Fokus steht Beethovens Stellung in der Gesellschaft der 1810er Jahre. Verehrung und Ausbeutung seines Genies halten sich sich die Waage, nicht nur in Wien, sondern auch in London. Dem Komponisten, dessen Urheberrechte mit Füßen getreten werden, entgleitet immer mehr die Kontrolle über seine Werke. Viele werden geraubt, die schönsten verkannt, manche verstümmelt und allesamt verhunzt. Die Erscheinung von Mälzels Metronom 1817 ergreift er als wilkommene Gelegenheit, verrätselte und somit stark kodierte Tempovorschriften zu veröffentlichen, wodurch jede korrekte Aufführung seiner Kompositionen von vornherein blockiert wird. Die völlig gleichgültige Reaktion der Musikwelt bestätigt Beethoven in seiner Vermutung, dass das Metronom nicht den geringsten Einfluss haben wird auf die musikalischen Unsitten seiner Interpreten. Mälzels Metronom zeigt einen tiefen Riss zwischen Beethoven und den ausführenden Musikern auf, der auf einen größeren, womöglich gesellschaftlichen Konflikt hindeutet. Zur Ermittlung dieses Konflikts wird die Lebensuhr des Komponisten im Buch zurückgedreht und fängt jetzt mit sensibilisiertem Wachsinn von vorne an. Dadurch sehen wir, dass die volle Anerkennung und gnadenlose Ausbeutung des musikalischen Genies zum festen Programm gehört und bereits in der frühen Kindheit angelegt wurde. Eine ebenso inspirierende wie störende Wirkung auf die Entwicklung Beethovens ging von Mozarts spektakulärer Laufbahn aus, die nicht nur bei den eigenen Eltern falsche Ambitionen weckte. Für die übermächtige, aber durch die Französische Revolution stark bedrängte Adelskaste, war der respektlose Untertan aus Salzburg schon seit 1786 zum persona non grata geworden, doch auf dessen geniale Musik wollte niemand verzichten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 376
Veröffentlichungsjahr: 2013
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Harke de Roos
Der andere Beethoven
Das Rätselmetronom oder Die dunklen Tränen
Dieses ebook wurde erstellt bei
Inhaltsverzeichnis
Titel
Trugstart
Beethovens Zusammenarbeit mit Mälzel
Beethovens Streit mit Mälzel
Beethovens Künstlerehre in Gefahr
Beethovens Gegenwehr
Zweiteilung oder Zerschlagung
Beethovens Verhältnis zur Obrigkeit
Beethovens Todestraurigkeit
Beethovens Bekenntnis zum Irrweg
Das Rätselmetronom als Beethovens Ausweg
Das Rätselmetronom als Apfel Schneewittchens
Beethovens Kindheit
Beethovens Verknüpfung mit Mozart
Beethovens Schuldverstrickung
Beethovens Gewissensnot
Prometheus als Richter seiner Geschöpfe
Das Gehörorgan als Sühneopfer
Die Vertreibung aus dem Paradies
Der verschlungene Weg zum Himmel
Beethoven als Don Juan
Die Eroica als Heldendenkmal eines Musikers
Ferdinand Ries als verhinderter Parsifal
Beethoven bekommt sein Kind
Die Neunte als Sühneangebot
Der Spitzel als Biograph
Die symbolische Rücknahme der Neunten
Beethovens heimlicher Weg zum Himmel
Epilog
Impressum neobooks
Trugstart
Es war einmal ein Seher, der nicht sehen konnte und vor fast drei Jahrtausenden auf unserer Erde lebte.
Dieser Anfang, liebe Leser, ist das Gegenstück von dem, was wir Musiker einen Trugschluss nennen. Ein Trugschluss ist ein spannungsgeladener Akkord, der gelegentlich in der Musik anstelle eines erwarteten Abschlusses auftritt. Der gewünschte Effekt beim Zuhören ist eine gewisse Freude darüber, dass das simulierte Ende nicht das wirkliche Ende der Musik ist und dass das Genießen weiter gehen darf. Das Gegenstück müsste demnach eine Genugtuung darüber auslösen, dass der Beginn nicht der wirkliche Beginn ist, sondern dass die Musik schon spielt. Mein Anfangssatz ist nämlich gar kein regulärer Beginn, denn vom blinden Seher Teiresias sollte gar nicht die Rede sein und noch viel weniger wollte ich Ihnen ein Märchen erzählen.
Der griechische Prophet hat aber einen seelischen Verwandten, der vor zwei Jahrhunderten lebte. Von diesem nun, von jenem Tonschöpfer, der keine Töne hören konnte, ist in unserer Geschichte hauptsächlich die Rede. Sein Name: Ludwig van Beethoven, in jungen Jahren vornehmlich Louis van Beethoven, für intime Freunde auch einfach Luigi.
Zur Sicherung der Strecke, die etliche Klippen und Spalten aufweist, stelle ich Ihnen einen Wegbegleiter zur Seite, der selbst nicht richtig gehen kann. Sein Name: Rätselmetronom. Das Rätselmetronom ist das genaue Gegenstück eines normalen Metronoms. Deshalb ist es ratsam, sorgfältig zwischen Metronom und Rätselmetronom zu unterscheiden und die beiden nicht durcheinander zu bringen.
Beethovens Zusammenarbeit mit Mälzel
Metronom und Rätselmetronom erschienen beide im zweiten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts. Damals wurde das Metronom auch Zeitmesser genannt. Es handelte sich demnach um ein mechanisches Hilfsmittel, mit dem die musikalische Zeit gemessen wurde. Als Erfinder gilt Johann Nepomuk Mälzel, Schöpfer seines rätselhaften Gegenstücks war Ludwig van Beethoven höchstpersönlich.
Zum Zeitpunkt des Erscheinens hatten Beethoven und Mälzel ihren vierzigsten Geburtstag einige Jahre hinter sich und kannten sich gut. Sie waren beide im Jahr 1792 nach Wien gezogen. Beethoven aus Bonn, Mälzel aus Regensburg. Bis Anfang 1814 wohnten Komponist und Mechaniker gemeinsam in der Donaumetropole, danach verließ Mälzel die Stadt auf immer.
Zunächst einmal werfen wir die Frage auf, wer oder was Mälzel dazu veranlasst haben mag, ein Metronom zu konstruieren. Die Musik war nicht sein Spezialgebiet, die Zeit auch nicht. Ebenso wenig hatte Beethoven ein derartiges Gerät bei ihm bestellt. Die musikalische Zeitmessung war um 1810 aber fällig. Sie lag irgendwie in der Luft. Und Mälzel hatte ein ausgezeichnetes Gespür für den Geist der Zeit. Aktualität war sein Metier.
Mälzels Vater, Orgelbauer und Mechaniker von Beruf, hat seine Söhne Johann und Leonhard sowohl an den Tasten als in der Mechanik ausgebildet. Von ihm lernte Johann sein Handwerk aufs beste. Darüber hinaus schien sich gerade in seiner Person ein Genius zu regen, der eindeutig zu früh auf die Welt gekommen war. Mit einem selbst fahrenden Fahrzeug, einer Gasmaske für Feuerwehrleute, einem selbst spielenden Orchester, einem Schachroboter und mit Puppen, die „Mama“ sagen und die Augen aufschlagen konnten, um nur einen Teil seiner Projekte anzudeuten, macht Mälzel auf uns im 21. Jahrhundert den Eindruck, ein verhinderter Vertreter unserer eigenen Epoche zu sein. Man könnte glauben, er sei durch eine Laune des Schicksals durch den Boden der Gegenwart in die Vergangenheit gestürzt und zwei Jahrhunderte früher stecken geblieben.
Wer denkt bei Betrachtung seiner detailgetreuen Darstellung des großen Brandes von Moskau 1812, mit der er eine Rekordquote an Besuchern erzielte, nicht an einen Filmemacher oder Fernsehreporter? Die russische Hauptstadt erscheint in dieser Darstellung in perspektivisch richtigem Maßstab mit Kreml, Kirchen und Mauern. Die Illusion des großen Brandes wurde mit Bühnenflammen, Rauch und Funkenschlag erweckt, während Bühnenarbeiter, die für das Publikum unsichtbar waren, die Kulissen im richtigen Augenblick einrissen.
Ebenso realistisch wirkte ein anderes Projekt von Johann und Leonhard Mälzel: der mechanische Trompeter. Dieser war mannsgroß und blies so laut Trompete, dass er einen Trupp Soldaten in die Flucht geschlagen haben soll, als dieser bei der Revolution von 1848 Bruder Leonhard bedrängte.
Eine weitere Begabung, welche ebenfalls gut zu unserer Zeit passt, bestand darin, dass Mälzel sich selbst hervorragend verkaufen konnte. Die Art, wie er die Presse bespielte oder Public Relations mobilisierte, zeugt von hohem Können. Als Geschäftsmann war er erfolgreich, verlor aber hohe Geldsummen im Spiel. Dennoch hinterließ er bei seinem Tod 1838 in den USA ein Vermögen.
Bei aller Professionalität hatte Mälzel eine unübersehbare Schwachstelle. Seine eigene Erfindungskraft entfaltete sich nicht in dem Maße wie seine übrigen Talente, sie verhielt sich eher umgekehrt proportional zu ihnen. Für das Business bedeutete dieses Defizit kein allzu großes Hindernis, weil Mälzel es durch eine äußerst geschickte Technik in der Aneignung und Verwertung von Fremdideen zu kompensieren wusste.
So war, um nur ein einziges Beispiel zu nennen, sein Schachroboter, mit dem er überall in Europa und ab 1825 in Nord-Amerika Furore machte, keineswegs eine Erfindung von ihm selbst. Anfangs hatte er nicht einmal den Trick entdeckt. Er wusste nicht, dass im Spielkasten ein Mensch verborgen war, der die Figuren zog. Nach dem Tod des Erfinders Baron Wolfgang von Kempelen im Jahre 1804 erwarb Mälzel den „Schachtürken“ vom Sohn des Verstorbenen, zum halbierten Preis versteht sich. Dabei war ihm nützlich, dass die letzte Vorstellung mit dem Automaten mehr als zwanzig Jahre vorher stattgefunden hatte. Dadurch konnte er sich mit zunehmendem Erfolg als Erfinder des Geräts präsentieren.
Es ist nicht das einzige Mal, dass Mälzel sich mit fremden Federn schmückte. Plagiatsvorwürfe sollten ihn sein ganzes Leben begleiten. Charakteristisch für erfindungsschwache Menschen ist der feine Sensor für die Kreativität anderer. So wurde der kreativste Mensch, den er kannte, förmlich von ihm umgarnt, wenigstens, solange beide noch in Wien wohnten. Es war wohl so, dass Mälzel Beethoven brauchte, aber Beethoven brauchte umgekehrt auch ihn.
Im Dezember 1812 war der Komponist 42 Jahre alt geworden und hatte den größten Teil seines unsterblichen Oeuvres bereits komponiert. Acht seiner neun Symphonien, 11 seiner 18 Streichquartette, 26 seiner 32 Klaviersonaten, seine Klavierkonzerte, sein Violinkonzert, zwei Fassungen seiner einzigen Oper und viele andere Werke standen unveränderlich auf dem Papier.
Beethoven mag als Komponist seiner Zeit zwar weit voraus gewesen sein, er betrachtete sich selbst aber keineswegs als einen zu früh Geborenen. Für das junge Jahrhundert hatte er kein gutes Wort übrig, für seine noch im 18. Jahrhundert verstorbenen Kollegen Mozart und Gluck, Bach und Händel dagegen sehr viele. Zusätzlich fühlte er sich noch weit früheren Jahrhunderten als dem 18. und anderen Disziplinen als der Musik verpflichtet. Ich zitiere seine Worte:
– noch eins! Es gibt keine Abhandlung, die sobald zu gelehrt für mich wäre; ohne auch im mindesten Anspruch auf eigentliche Gelehrsamkeit zu machen, habe ich mich doch bestrebt von Kindheit an, den Sinn der besseren und weisen jedes Zeitalters zu fassen, schande für einen Künstler, der es nicht für schuldigkeit hält, es hierin wenigstens so weit zu bringen.
(Mittwoch, 22. November 1809 – an Gottfried Christoph Härtel)
Beethoven war somit Mälzels Antithese oder Mälzel Beethovens Antithese, je nachdem. Im Spannungsfeld, das in der Begegnung beider Persönlichkeiten entstand, trafen sich zwei Zeitalter. Auf der einen Seite steht unsere Epoche mit unserem Wissen samt kollektiver Torheit, auf der anderen sämtliche Zeitalter vor der Aufklärung, in denen so viel Weisheit erblüht und verwelkt ist.
Der Komponist hatte bekanntlich ebenfalls eine Schwäche. Sein schwindendes Gehör machte ihm 1813 sehr schwer zu schaffen und wirkte lähmend auf seine Schöpferkraft. Die letzte Hoffnung, seine geliebte Musik hören zu können, hatte er auf den kaiserlichen Hofkammermaschinisten Mälzel gesetzt. Dieser baute 1812/1813 vier verschiedene Hörgeräte für ihn, von denen das Letzte am besten funktionierte und mehrere Jahre auf seinem Flügel stand.
Für diese Dienste erwartete Mälzel handfeste Gegenleistungen. So verlangte er neue Kompositionen für seine verschiedenen Spielautomaten, insbesondere für sein mechanisches Orchester, Panharmonikum genannt. Und selbstverständlich rechnete er mit Beethovens Mitarbeit bei seinem Metronomprojekt. In Wien war es ihm noch nicht gelungen, ein wirklich brauchbares Instrument zu konstruieren, aber 1813 bekam er bereits das Patent auf ein Vorläufermodell des Metronoms, Chronometer genannt.
Als Beethoven ihn in seiner Werkstatt besuchte, traf er zum ersten Mal auf dieses Gerät. Seine Reaktion ist uns überliefert aus dem Mund von Mälzel selbst. Diese war jedoch ganz anders als erwartet. Keine Spur von freudiger Überraschtheit! Im Gegenteil, der Meister muss ordentlich geschimpft haben, Mälzel teilt uns mit, dass er „ganz unwillig“ wurde und die folgenden Worte ausrief: „Es ist dummes Zeug, man muss die Tempos fühlen!“
Mälzel machte sich nicht viel aus diesem Zornesausbruch und ließ in einem Zeitungsartikel vom 13. Oktober 1813 in den Wiener Vaterländischen Blättern neben Erwähnung von Salieri, Weigl, Gyrowetz auch Beethovens Worte einrücken:
Herr Beethoven ergreift diese Erfindung als ein willkommenes Mittel, seinen genialen Compositionen aller Orten die Ausführung in dem ihnen zugedachten Zeitmaß, das er so häufig verfehlt bedauert, zu verschaffen.
Hat Beethoven dies wirklich so gesagt? Ist es ein Zufall, dass er in diesen Tagen (9.Oktober 1813) die folgenden Worte an seinen Freund Baron Nikolaus Zmeskall schrieb?
Lieber guter Z. werden Sie nicht unwillig, Wenn ich Sie bitte, auf beyliegenden Brief beyliegende Adresse zu schreiben, derjenige beklagt sich immer, an welchen der Brief ist, warum keine Briefe von mir ankommen, gestern brachte ich einen Brief auf die Post, wo man mich fragte Wo der Brief hin soll? – Ich sehe daher, daß meine Schrift vieleicht ebenso oft als ich selbst mißdeutet werde.
- Daher meine Bitte an sie
ihr Beethowen.
Nun, die Missdeutung Beethovens im von Mälzel redigierten Zeitungsartikel liegt klar auf der Hand. So schnell pflegte der Komponist seine Meinung nicht zu ändern, dass er den Zeitmesser so kurz nach seinem Zornausbruch auf einmal freudig begrüßen konnte. Glaubhaft ist zwar der Satz, dass Beethoven die häufige Verfehlung seiner Tempi (damals schon!) bedauerte, aber dass er in Bezug auf die mechanische Zeitmessung seine Ablehnung überwunden hätte, ist äußerst unwahrscheinlich.
Bei der ersten Begegnung mit Mälzels Chronometer hat Beethoven genauso reagiert, wie man es von einem guten Klavierstimmer erwarten würde, der zum ersten Mal mit einem mechanischen oder elektronischen Stimmgerät konfrontiert wird. Instinktiv wittert die wahre Künstlernatur die Gefahr, die von der Mechanik ausgeht. Sie weiß, dass die Berichtigung unsauberer Töne oder falscher Tempoproportionen von innen kommen muss und nicht von außen auferlegt werden kann. Die richtige Stimmung der Grundtempi muss man fühlen, nicht von einem Messgerät ablesen!
Beethovens Streit mit Mälzel
Die Szene in Mälzels Werkstatt war nicht gerade das, was man ein Weltereignis nennt. Weder der Lauf der Geschichte noch das alltägliche Leben wurden auch nur im geringsten Maße tangiert. Auch Beethoven und Mälzel selbst hatten Wichtigeres zu tun als sich lange über den Chronometer zu unterhalten, zumal das Gerät noch offensichtliche Mängel hatte. Das Kriegsgeschehen hielt die Gemüter der Europäer ununterbrochen in Atem. Die Wahlwiener Beethoven und Mälzel bildeten in dieser Hinsicht keine Ausnahme.
Am 21. Juni 1813 hatte es bei Vitoria im spanischen Baskenland eine große Schlacht gegeben zwischen englischen, spanischen und portugiesischen Truppen auf der einen Seite und französischen auf der anderen. Ein Heer von fast 80.000 gut trainierten Soldaten unter dem Oberbefehl von Wellington hatte die französische Besatzungsarmee der Iberischen Halbinsel angegriffen, die von einem Bruder Napoleons angeführt wurde. Das französische Heer war geschwächt, weil viele Soldaten wegen des katastrophalen Russlandfeldzugs abberufen worden waren und bestand nunmehr aus 66.000 Mann. So konnte es geschehen, dass die Franzosen unter großen Verlusten für immer aus Spanien verjagt wurden.
Mälzel hätte nicht Mälzel geheißen, wenn er nicht den sofortigen Antrieb verspürt hätte, dieses das Abendland bewegende Ereignis als Erlebnis reproduzierbar zu machen. Vor allem in London, der Hauptstadt der Siegernation, erhoffte er sich ein blendendes Geschäft mit der Vorführung des Spektakels. Weil Beethoven unbestritten als größter unter den lebenden Komponisten galt und auch in England glühend verehrt wurde, besprach Mälzel sich mit ihm. Er sollte für sein Panharmonikum eine Schlachtmusik komponieren, welche auf das Ereignis passte. Mälzel wollte, dass Rule Britannia sich mit dem französischen Kampflied Marlboroughs’en va-t-en guerre abwechselte und dass zum Schluss God save the King kam. Von Geld war noch nicht die Rede. Es heißt, dass Mälzel die Schlachtmusik zwar bei Beethoven bestellt habe, aber als Honorar für die Komposition sei die Anfertigung eines Hörgeräts gedacht gewesen. Die Tatsache, dass der Komponist sich im Laufe des Projekts Geld von Mälzel lieh, sollte das Tauschgeschäft etwas komplizierter machen, aber in der ersten Phase der Zusammenarbeit war das Einvernehmen noch ungetrübt. Die beiden ungleichen Geschäftspartner planten sogar eine gemeinsame Reise nach London.
Am Anfang lief alles bestens. Aber im Oktober, als die Partitur für das mechanische Orchester fertig geworden war, musste der Plan bereits grundlegend geändert werden, denn es zeigte sich, dass die künstlichen Musiker des Panharmonikums von Beethovens Anforderungen heillos überfordert zu werden drohten. Wie zu erwarten, wollte der Komponist, der auch die überlieferten Gattungen von Symphonien, Klaviersonaten oder Variationswerken mit der Eroica, der Hammerklaviersonate und den Diabelli-Variationen ins Gigantische ausweitete, alle Dimensionen der herkömmlichen Schlachtmusiken sprengen.
So wurde beschlossen, den ursprünglichen Plan fallen zu lassen und nunmehr ein echtes Orchester für die Darstellung von Wellingtons Sieg zu engagieren. Die Partitur wurde in kürzester Zeit für großes Symphonie- Orchester samt Kanonendonner auf großen Trommeln und Gewehrsalven auf Ratschen umgeschrieben. Am 8. Dezember fand im Saal der Universität die Uraufführung statt mit einem Orchester von über 100 Mann, dirigiert von Beethoven selbst und unter Mitwirkung der besten Musiker Wiens wie Schuppanzigh, Dragonetti und Romberg. An den Kanonen und Gewehren standen Salieri, Meyerbeer und Hummel.
Die Aufführung wurde ein Riesentriumph. Nebenbei wurde die Siebte Symphonie in vollendeter Interpretation uraufgeführt, aber alle Konzertbesucher schienen nur Ohr und Auge für die Schlachtsinfonie zu haben. Zur Erhöhung der Freude trug bei, dass der Ausgang der Völkerschlacht bei Leipzig (16.-19. Oktober) ein baldiges Ende des Krieges zu versprechen schien und dass die Einnahmen den österreichischen Soldaten gewidmet wurden, welche bei der in militärischer Hinsicht völlig überflüssigen Schlacht bei Hanau (30. und 31. Oktober) verstümmelt worden waren.
Die „unbeschreiblichen Ovationen“ des zahlreichen Publikums galten in erster Linie der Musik der Schlachtsinfonie, von der der Publizist Darko Bunderla mit Recht sagt, dass sie absolut neu war:
Beethoven schuf ein musikalisches Werk, das den Zuhörer unmittelbar in das Geschehen einer Schlacht einbezieht……
Ein spürbares Nacherleben ist allgegenwärtig. Hier werden unmittelbare Empfindungen geweckt, die den Zuhörer fesseln.
(Darko Bunderla: Beethovens Wellingtons Sieg – Versuch einer ästhetischen Diskussion)
Applaus fördernd war der Umstand, dass der Kaiser, Metternich und die gesamten Minister des Staates Napoleon jagten und nicht mit Beethoven um die Gunst des Publikums wetteiferten. Der Komponist stand ganz allein im Zentrum der Verehrung und kam den Konzertbesuchern wie ein veritabler Gott vor.
So dichtete Clemens Brentano in seinen Nachklängen Beethovenscher Musik unmittelbar nach dem Erlebnis Worte wie folgt:
Ew’ger Gott! Mich dein erinnern.
Alles andere ist vergebens.
und
Nein, ohne Sinne, dem Gott gleich,
Selbst sich nur wissend und dichtend,
Schafft er die Welt, die er selbst ist
Unter den Besuchern befand sich ein junger Jurastudent und Amateurgeiger aus der mährischen Stadt Brünn. Auch für ihn, Anton Schindler, erschien Beethoven wie ein ferner Gott, dem sich zu nähern man nicht einmal zu träumen wagt. Wenn jemand ihm zu diesem Zeitpunkt vorhergesagt hätte, dass sein eigenes Lebensschicksal sich auf verhängnisvolle Weise mit dem seines Idols verknüpfen würde, hätte er ihn für verrückt erklärt. In verschiedener Hinsicht bildeten die Akademien vom 8. und 12. Dezember 1813 einen Schnittpunkt in Beethovens gesellschaftlichem Lebenslauf. Die Schlachtsinfonie war der größte Erfolg zu seinen Lebzeiten. Für Johann Mälzel war die Aufnahme der Schlachtsinfonie durch das Publikum eine große Überraschung, aber ungeteilt war seine Freude nicht. Voller Sorge sah er seinen eigenen Anteil am Erfolg schrumpfen. Er gab sich nicht damit zufrieden, dass Beethoven seine Erkenntlichkeitsbezeugungen auch an ihn richtete. Er wollte mehr. Im Gegenzug gab er öffentlich bekannt, dass er die Sinfonie als seinen eigenen Besitz betrachte. Er habe das Werk bestellt und bezahlt, die Idee dazu geliefert, also gehöre es ihm. Als Reaktion hierauf organisierte Beethoven eine Wiederholung der Akademie am 2. Januar 1814, diesmal ohne Mälzel.
In den darauf folgenden Wochen entbrannte ein heftiger Streit um die Eigentumsrechte an der Schlachtsinfonie. Am Anfang schien ein Vergleich in Sicht, aber als die Fronten sich verhärteten, ließ der nächste Schritt nicht lange auf sich warten. Mälzel hatte genug Orchesterstimmen zur Verfügung um daraus heimlich eine Partitur abschreiben zu lassen. Ohne etwas zu sagen, brach er nach München auf und ließ Wellingtons Sieg für eigenen Profit am 16. und 17. März 1814 aufführen, wiederum mit großem Erfolg beim Publikum.
Als Beethoven Wochen später von diesen Konzerten erfuhr, eröffnete er unverzüglich ein Gerichtsverfahren gegen Mälzel und veröffentlichte Warnungen in der Presse gegen seinen früheren Partner, in welchen er ihn als „ein ganz roher Mensch, gänzlich ohne Erziehung und Bildung“ beschrieb. Auch ließ er die Musiker in London wissen, dass Mälzel keine Erlaubnis von ihm bekommen habe, das Werk dort aufzuführen. Offensichtlich befürchtete der Komponist, dass Mälzel sich in London mit seinem Werk bereichern würde. Diese Furcht war zwar nicht unbegründet, aber sie lenkte Beethovens Wachsamkeit ab von jenen Räubern, „gänzlich mit Erziehung und Bildung“, welche es ebenfalls auf sein geistiges Eigentum abgesehen hatten.
Zunächst einmal führte Mälzels Weg nicht nach London, sondern nach Amsterdam, wo er im Herbst 1814 sein Panharmonikum und seinen mechanischen Trompeter vor den staunenden Holländern musizieren ließ. In der niederländischen Hauptstadt machte er eine wichtige Entdeckung, als er einen Kollegen namens Diederich Nikolaus Winkel in seiner Werkstatt besuchte. Dieser aus Deutschland stammende Mechaniker hatte nichts weniger als das perfekte Metronom erfunden, nach dem Mälzel so lange gesucht hatte. Stolz führte Winkel seine Erfindung dem berühmten Kollegen aus Wien vor. Dieser studierte die Mechanik Winkels genau, machte sich das Prinzip zu eigen und kehrte Amsterdam für immer den Rücken.
Innerhalb von zwei Jahren ließ Mälzel Winkels Erfindung als eigene Erfindung in München, Paris und London patentieren. In Paris gründete er 1816 eine Fabrik zur Herstellung von Metronomen. Als Winkel von Mälzels Plagiat erfuhr, war es bereits zu spät. 1820 gewann er zwar den Prozess um die Urheberschaft der Erfindung, aber zu diesem Zeitpunkt war das Gerät bereits überall als Mälzels Metronom (M.M.) im Handel.
Man mag sich vielleicht wundern, warum das Monopol auf einen Zeitmesser so begehrt war. So groß kann der Bedarf an musikalischen Tachometern doch nicht gewesen sein, dass man damit das große Geschäft machen konnte. Tatsächlich ist das Messen des musikalischen Zeitmaßes eine Beschäftigung, die nur eine Handvoll Musiker beglücken kann.
Das Metronom hat aber noch eine zweite Eigenschaft, die sehr wohl auf einen großen Umsatz hoffen ließ, vor allem zum Zeitpunkt seines Entstehens. Auf Wunsch liefert es nämlich das absolute Gleichmaß in jeder beliebigen Geschwindigkeit. Das Gleichmaß ist ja so eine Sache, die oft gering geschätzt wird, aber zum festen Prinzip der Schöpfung gehört. Ohne dieses Prinzip würde das Universum im Bruchteil einer Sekunde auseinander fallen.
Aber auch in der Musik ist dieses Prinzip allgegenwärtig. Im Barock und in der Wiener Klassik regierte das gleichmäßige Zeitmaß mit festem Impuls über die ganze abendländische Musik vom Kaukasus bis zum Atlantik, von Lappland bis nach Sizilien. Die Spuren dieses Stilmittels trifft man in allen geschriebenen Noten an. Die Bezeichnungen für die Beschleunigung (accelerando) oder Verzögerung (ritenuto, ritardando) sind bis zur Musik von Franz Schubert Ausnahmeerscheinungen, im ganzen 18. Jahrhundert kommen sie so gut wie nie vor. Anscheinend hatte der regelmäßige Impuls in der damaligen Musik eine ähnliche Funktion wie in den Jazzkellern des 20. Jahrhunderts.
Dieses Gefühl für Ebenmaß steckte dem musizierenden Menschen des 18. Jahrhunderts so sehr im Blut, dass auch bei größeren Orchestern kein Dirigent vor der Gruppe stand. Es genügte der Konzertmeister, der Geiger am ersten Pult, der sogenannte Director.
Mit dem beginnenden 19. Jahrhundert wuchs ein anderes Gefühl der Tempogestaltung heran. Es entstand allmählich Bedarf an flexiblen Tempi, an variablen Geschwindigkeiten, welche sich biegsam und schmiegsam um den musizierenden Genius ranken. In der Renaissance und im Barock mussten die Meister der Musik den Tempi folgen, in der Periode der Hochromantik hatten die Tempi ihrem Meister zu folgen. Für die Orchestermusiker bedeutete diese Akzentverlagerung, dass sie plötzlich einen taktierenden Vorgesetzten brauchten. Ohne Dirigent kommt kein romantisches Orchester zurecht. Es leuchtet ein, dass es eine Übergangszeit gegeben haben muss, in der beide Prinzipien parallel in der Musikpraxis vorhanden waren, das Prinzip des Gleichmaßes und das Prinzip der Tempofreiheit.
Es leuchtet ebenfalls ein, dass diese Übergangszeit gekennzeichnet wird durch die Suche nach dem Metronom als Sinnbild des gleichmäßigen Tempos und Garant für die gute alte Zeit. Der Bedarf nach dem gleichmäßigen Ticken des Metronompendels war wie der Ruf nach einem mechanischen Taktschläger, nach einem Kapellmeister-Roboter, der den übenden Schüler unerbittlich im richtigen Rhythmus hält. So gesehen war die Einführung des Metronoms ein rückwärts gerichteter Schritt, ein Symptom der Restauration und ihres Meisters Fürst Metternich.
Gar kein Zufall ist, dass die aktivsten Vorkämpfer des Metronoms zu den reaktionärsten Musikern ihrer Epoche zählten. Voran Antonio Salieri, der im Goldenen Jahrzehnt der Wiener Klassik als Opernkomponist noch große Erfolge buchen konnte, aber sich seit dem Tod Mozarts auf die Kirchenmusik und das Unterrichten seiner Schüler beschränkte. Im zweiten Jahrzehnt des neuen Jahrhunderts hatte der ehemalige Avantgardist sich zu einer konservativen Musikautorität entwickelt.
Neben ihm stand, Schulter an Schulter, der ultrakonservative Ignaz Mosel, der unter Metternich einen dominierenden Posten im Wiener Musikleben einnahm und wegen seiner – für uns absolut schleierhaften – Verdienste für die Musik 1817 in den Adelstand erhoben wurde. Beethovens Kommentar zu ihm:
Trübe fließt die Mosel in den Rhein.
Mosel ging noch weiter als Salieri und wollte das Metronom bei jeder Form von Musikausübung einführen. Hier spürt man die Atmosphäre im Polizeistaat Metternichs mit seiner flächendeckenden Überwachung der Privatsphäre und erstickende Wirkung auf jedes Gefühl von Freiheit, selbst wenn sich diese in einer so unpolitischen Art wie der Musik äußert. Johann Nepomuk Mälzel war ein Geschäftsmann: die Politik war ihm herzlich egal, solange sie seinen geschäftlichen Aussichten nicht im Weg stand. Wenn Mosel das Bedürfnis hatte, aus dieser „Erfindung“ einen Überwachungsapparat zu machen, bitte schön! Mälzel hatte ein anderes Problem.
Im Jahre 1817 war es so weit, dass Mälzels Metronom auf den Markt kam. In London, Paris und München lag der Weg zum Markt offen und frei, aber in Wien, der Haupstadt der Musik, lebte Beethoven, der ungekrönte König aller Komponisten, der berühmteste Musiker der ganzen Welt. Ohne Mitwirkung dieser Person war das Geschäft in Österreich nur halb so lukrativ.
Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria heißt die Schlachtsinfonie wörtlich. Das 91. Opus Beethovens besteht aus zwei Teilen. Der 1. Teil stellt die Schlacht selbst dar, der 2. Teil, die Siegessymphonie genannt, ist eine Siegesfeier der Engländer, bei der der englischen Gefallenen gedacht und die Nationalhymne gespielt wird. Dieser Teil, in dem Beethoven nach eigener Aussage den Engländern ein wenig zeigen wollte, welch ein Segen in „God save the King“ ruht, klingt zu Ehren des englischen Königs. Folgerichtig ist der englische König der Widmungsträger der ganzen Partitur. In der Zeit der Komposition wurde England regiert vom Prinzregenten George, stellvertretend für seinen erkrankten Vater George III.
Um diese Widmung zu bekräftigen, ließ Beethoven eine prachtvolle Kopie seiner Komposition anfertigen und durch Lord Castlereagh oder einen Boten des russischen Gesandten in Österreich, des Grafen Rasumowsky, in die Hände des Prinzregenten legen. Zu welchem Zeitpunkt dies geschah, ist nicht eindeutig geklärt. Hätte der Prinzregent eine Empfangsquittung oder ein Dankesschreiben an den Komponisten geschickt, wäre das Datum kein Rätsel. Dass das Geschenk tatsächlich angekommen ist, steht aber fest.
Überliefert ist, dass der Prinzregent sich mit dem Leiter seiner Kapelle, Franz Cramer, über die Partitur der Schlachtsymphonie besprochen hat. Franz Cramer war der Bruder des Pianisten John Baptist Cramer, ein alter Bekannter Beethovens und Mitbegründer der Philharmonic Society in London, die als erster Konzertverein Großbritanniens seit Anfang 1813 existierte. Das Eröffnungskonzert der Philharmonischen Gesellschaft hatte am 8. März 1813 unter Leitung des berühmten Geigers Johann Peter Salomon stattgefunden.
Die Musikgeschichte kennt Salomon als jenen Konzertveranstalter, der Joseph Haydn nach London eingeladen und vergeblich versucht hatte, auch Mozart nach England zu holen. Der gebürtige Bonner war mit Beethoven befreundet und es wundert denn auch nicht, dass Symphonien von Haydn und Beethoven auf dem Programm des ersten Konzertes standen.
Haydn, Mozart und Beethoven bildeten den Kern des Repertoires, das von der wohlhabenden und anspruchsvollen Konzertgesellschaft gepflegt wurde. Die zahlreichen Mitglieder verstanden sich durchaus als eine Gemeinschaft von musikalischen Gralshütern. Im Jahre 1813 verehrten sie Haydn und Mozart bereits als wahre Gralskönige und betrachteten Beethoven als legitimen Nachfolger. Nur allzu gerne hätten die Londoner ihren neuen König einmal in ihrer Mitte erlebt. An Bemühungen, Beethoven nach London zu holen, hat es in der Philharmonic Society nicht gefehlt.
Beim genaueren Vergleich zwischen der musikalischen Gralsgemeinschaft und ihrem sakralen Vorbild fällt aber auch ein gravierender Unterschied auf. Im Mittelalter hatte die Treue zum König einen deutlich höheren Stellenwert. Ganz unvorstellbar, dass die Gralspriester ihren erkrankten König Amfortas so behandelt hätten wie George Smart und Ferdinand Ries, beide Mitglieder der Gesellschaft, ihren verehrten Meister Beethoven.
Auf Anraten Cramers übergab der Prinzregent die Schlachtsinfonie der Philharmonischen Gesellschaft, die zu dieser Zeit vom Dirigenten George Smart, ganz gewiss ein hoch gebildeter und wohl erzogener Gentleman, präsidiert wurde. Dieser witterte sofort den blanken Profit und veranstaltete im Londoner Drurylane Theater ab dem 10. Februar 1815 eine Serie von Aufführungen der Schlachtsymphonie, zum ureigenen Vorteil versteht sich. George Smart konnte nach Ende der über mehrere Konzertsaisons verteilten Aufführungsserie einen Reingewinn von 1000 Pfund einstreichen, ein Vermögen nach damaliger Valuta.
Zuvor hatte er die Partitur aber gemeinsam mit Ferdinand Ries grässlich verstümmelt. Ries war der älteste Sohn des ehemaligen Bonner Konzertmeisters Franz Anton Ries, der Beethoven in dessen Bonner Zeit Geigenunterricht erteilt hatte. Im ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts war Ferdinand mit Unterbrechungen Beethovens Schüler gewesen. Nach langem Umherziehen durch ganz Europa zwischen 1809 und 1813 hatte er sich in London angesiedelt, wo er von Salomon in die Philharmonische Gesellschaft eingeführt worden war.
Aufgrund seiner einmaligen Kontakte mit Beethoven besaß Ferdinand Ries eine hohe Autorität bei seinen Kollegen. So wurde er von George Smart zu Rate gezogen beim Problem, wie mit Beethovens Partitur zu verfahren sei.
Die beiden Herren waren der Auffassung, dass der Fugato-Teil gestrichen werden sollte, weil man einem englischen Publikum angeblich keine Fuge auf ihre Nationalhymne zumuten konnte. Damit wurde aber, wie ich vermute, genau die Stelle gestrichen, bei der Beethoven den Engländern „ein wenig“ zeigen wollte, welch ein Segen in God save the King ruht. Außerdem wurde der Schluss des Werkes von Smart und Ries so geändert, dass die Nationalhymne noch einmal in voller Länge vom vollen Orchester gespielt wird. Sie wurde dann vom ganzen Haus aus vollem Hals mitgesungen. Voller Erfolg war garantiert.
Vom Gewinn hat Beethoven keinen Kreuzer erhalten, er wurde nicht einmal über die Aufführung seines Werkes informiert. Auch der Prinzregent hat sein Versäumnis niemals nachgeholt, so dass der Komponist sogar noch auf den überaus hohen Kopierkosten der Prachtpartitur sitzen blieb:
..ich fange schon an zu glauben, daß auch die Engelländer nur im Auslande großmüthig sind, so auch mit dem Prinzregenten, von dem ich für meine überschickte schlacht nicht einmal die Kopiaturkosten erhalte, ja nicht einmal einen schriftlichen oder mündlichen Dank
(An Ferdinand Ries, 8. May 1816)
Merkwürdigerweise hat kein Biograph dieses Verhalten von Prinzregent, Smart und Ries jemals beanstandet, als wäre die Missachtung Beethovens die normalste Sache der Welt. Der Komponist musste erleben, dass er sich immer weniger gegen Raub und Verstümmelung seiner Werke wehren konnte, je größer deren Wirkungskreis wurde. Zu dieser Verstümmelung gehörten auch Druckfehler und verfehlte Tempi.
Zu dieser lebensbegleitenden Erfahrung kam eine zweite. Beethoven lernte schon früh, dass er am meisten misshandelt wurde von jenen Leuten, die es gut mit ihm meinten oder meinten, es gut mit ihm zu meinen. Man spürt, dass offene Feindschaft ihm lieber war als verletzende Freundschaftsbezeugungen. Es machte ihm Spaß, mit „Kontrasubjekten“ umzugehen, gegenüber falschen Freunden war er dagegen hilflos. Hilflosigkeit war jedoch eine Eigenschaft, die ganz und gar nicht zu seinem Charakter passte. Mitleid mit seiner Person konnte er absolut nicht ausstehen, was zu Taten und Handlungen Anlass gegeben hat, die, gelinde gesagt, etwas interpretationsbedürftig sind.
In Ignaz von Mosel treffen wir ein Schulbeispiel eines falschen Freundes des Komponisten. Der selbstherrliche Publizist und Meinungsmacher betrachtete sich selbst als einen der größten Verehrer Beethovens. In seinen eigenen Worten klingt diese Bewunderung wie folgt:
Für Klavier- und Violinspieler begann eine neue Epoche durch Louis van Beethoven. Seine ersten Sonaten, seine ersten Quartette wurden mit wohlbegründetem Jubel aufgenommen… Indessen dürfte doch die Frage sein, ob nicht Beethoven selbst, wenigstens zum Teil, mit Ursache war, wenn die größere Zahl der Musikfreunde sich allmählich von seinen Kompositionen abgewendet hat. Wer erinnert sich nicht des Enthusiasmus, welchen seine ersten Sinfonien, seine Sonaten, seine Quartette erregt haben? Alle Musikfreunde waren entzückt, so bald nach Mozarts Tode einen Mann sich erheben zu sehen, der jenen so schwer Vermissten zu ersetzen versprach. Obschon ein völlig eigener Geist und Geschmack in seinen Werken atmete, waren doch – wie schon früher erwähnt- Stil und Form denen des geliebten Verklärten ähnlich. Wären sie es geblieben, so hätten wir in der Tat Mozart wiedererlangt; ….Aber siehe da, zwar allmählich, aber immer mehr entfernte er sich von der anfänglich eingeschlagenen Bahn, wollte sich eine durchaus neue brechen und geriet endlich auf Abwege.
Die Botschaft dieses Berichts lautet, dass die Individualität Beethovens – oder wie Beethoven es selbst ausdrückt: seine Eigenthümlichkeit – als eine Abirrung beschrieben wird. Nur jene Werke, in denen der Einfluss von Mozart und Haydn dominiert, lässt der Kunstrichter gelten. Als Mozart-Ersatz war Beethoven akzeptiert worden, ein Beethoven durfte Beethoven nicht sein.
Gerne würde man dieses Urteil eines dritt- oder viertrangigen Musikkenners belächeln und schnell übergehen, wäre es nicht so, dass die überwiegende Mehrheit der Zeitgenossen Beethovens eine ähnliche Meinung vertrat. Dass es hier um eine Meinung ging, welche an den Stammtischen Wiens lebendig ventiliert wurde, mag noch zu verzeihen sein. Der Mensch ist nun einmal ein Herdentier, was die kollektiven Hirngehege betrifft. Aber dass Komponisten wie Carl Maria von Weber oder Louis Spohr genau das Gleiche über Beethoven dachten wie Ignaz von Mosel, stimmt bedenklich. Auch in London war dieses Rezeptionsmuster angekommen. So hatte John Baptist Cramer um die Jahrhundertwende, als er zum ersten Mal Beethovens Klaviertrio Opus 1 mit Salomon und einem Cellisten durchspielte, noch laut ausgerufen:
Das ist der Mann, der uns für den Verlust Mozarts trösten wird.
Zehn Jahre später hielt er, wie die meisten seiner Landsleute, Beethoven für einen Komponisten, der sich seit seiner Dritten Symphonie eindeutig auf Abwegen befinde und dringend wieder solche Symphonien komponieren sollte wie die ersten zwei.
Sogar Ferdinand Ries hielt sämtliche neueren Werke seines früheren Lehrers für verrücktes Zeug, wobei bei ihm auch wohl der Ehrgeiz mit im Spiel war. Er hielt sich selbst für genauso begabt wie Beethoven und konnte es kaum abwarten, dessen Nachfolger zu werden. Er wollte kein Gralspriester sein, er wollte selber Gralskönig werden.
Es mag wie ein Paradox erscheinen, aber Beethovens Königstitel konnte niemand auch nur im Entferntesten etwas anhaben. Je mehr über die neueren Werke des Komponisten geschimpft und je schwächer dessen Gehörorgan wurde, desto klarer stand für die Welt fest, dass es nur einen unumschränkten Herrscher im Reich der Musik gab. Ludwig van Beethoven aus Wien galt unbestritten als größter Komponist unter den Lebenden.
Nicht einmal der listenreiche Metternich vermochte mit seinem Protektionskind Gioacchino Rossini gegen diese unheimliche Autorität anzukommen, auch wenn es eine Zeitlang den Anschein hatte, als würde die Beliebtheit Beethovens in Wien abnehmen. Die Wiener zeigten jedoch ihr eigenes Naturell. Auch wenn sie mal auf den eigensinnigen Komponisten schimpften, wenn es darauf ankam, ließen sie nichts auf ihren Beethoven kommen, sehr zum Verdruss Metternichs und seiner Beamten. Im unsichtbaren Machtkampf zwischen Staat und Individuum spielte Mälzels Metronom die Rolle eines Herrschaftssymbols. Ausgerechnet Beethoven sollte sich vor diesem Symbol verneigen wie der Gläubige vor dem Kreuz. Die unterschwellige Aufforderung dazu ist einem Artikel Mosels in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung vom 27. November 1817 zu entnehmen. Darin wird den „geübtesten Componisten“, und es kann kein Zweifel daran bestehen, dass diese Bezeichnung auf Beethoven gemünzt war, in umschweifender Beamtensprache nahegelegt, das Metronom während des Komponierens ununterbrochen ticken zu lassen:
Es geschieht nämlich selbst den geübtesten Componisten, dass sie, während der Erfindung eines Tonstückes von grösserem Umfange, im Laufe der Arbeit, zumahl wenn sie zufällig unterbrochen wurde, sich des Zeitmasses nicht mehr ganz genau erinnern, welches sie sich beym Anfange desselben dachten, und dann Mittelsätze anbringen, die in dem Tempo, welches für das Hauptmotiv gewählt wurde, den gewünschten Effect nicht machen…..
Lässt nun der Componist den Metronome, während er schreibt, sich fortan bewegen, so wird ihm durch die hörbaren Schläge desselben, ohne von seinem Papier wegsehen zu müssen, sein Tempo immer gegenwärtig bleiben, und er vor der Gefahr gesichert seyn, eine übrigens gelungene Composition umarbeiten oder gar bey Seite legen zu müssen, weil er in der Fortsetzung seiner Arbeit das anfänglich gewählte Tempo nicht mehr ganz getreu im Gedächtnisse behielt.
Solche Sätze gingen an die Künstlerehre Beethovens, das ist klar:
Fühllos selbst für ihres Künstlers Ehre,
Gleich dem toten Schlag der Pendeluhr,
Beethovens Gegenwehr
Nachdem Mälzel Anfang 1814 Wien verlassen hatte, war für Beethoven die Sache mit dem Metronom vorerst erledigt. Mälzels mangelhafter Chronometer wurde nicht produziert und somit bestand für den Komponisten kein Handlungsbedarf. Erst drei Jahre später, in den ersten Wochen des Jahres 1817, als Beethoven das Metronom auspackte, welches ihm von Mälzel als Werbegeschenk zugeschickt worden war, wurde er wieder in das Projekt einbezogen. In der Zwischenzeit gab es keine nachweisliche Beschäftigung mit dem Gegenstand, was nicht sagen will, dass das Problem der mechanischen Zeitmessung ihn nicht gedanklich beschäftigt hätte.
Im Prinzip hätte Beethoven sich über das Metronom freuen müssen. Jeder Komponist kennt die Schwierigkeit beim Übermitteln eigener Kompositionen. So hielt Maurizio Kagel es für absolut ausgeschlossen, dass seine Musik von anderen Musikern so gespielt werden könne, wie er sie komponiert hatte. Nach eigener Aussage habe er als junger Komponist noch die Illusion gehabt, dass Profi-Musiker imstande seien, die Notenschrift so zu lesen und zu interpretieren, wie es auf dem Papier steht. Nach harten Kämpfen und bitteren Enttäuschungen habe er eines Tages einsehen müssen, dass diese vermeintliche Selbstverständlichkeit auf einer strukturellen Unmöglichkeit basiere. Du bist nicht ich, ich bist nicht du: die Trenngrenze zwischen ich und du stehe der originalgetreuen Musikinterpretation unerbittlich im Wege. Auf diesem Hintergrund müsste jeder Komponist froh sein, dass es ein Instrument gibt, mit dem er seine Tempovorstellungen exakt festlegen kann. Damit wird die Chance erhöht, dass seine Interpreten wenigstens die Tempi richtig spielen. Musikalische Anweisungen können ja nicht deutlich genug sein. Gerade Beethoven, der nie zufrieden war mit seinen Mitstreitern, weder mit seinen Verlegern, noch mit seinen Interpreten, müsste doch an Mälzels Zeitmessung interessiert sein!
Zur Illustration der notorischen Unzufriedenheit Beethovens folgen hier einige Textstellen, die aus dem ersten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts stammen. Die erste Textstelle betrifft das Problem der Druckfehler. Weil damals die Noten noch nicht gedruckt, sondern gestochen wurden, sollte man vielleicht besser von Stechfehlern sprechen:
Hr. Mollo hat wieder neuerdings meine Quartette sage: voller Fehler und Errata
– in großer „Manier“ und kleiner Manier herausgegeben sie wimmeln wie die kleinen Fische im Wasser d.h. ins unendliche – questo è un piacere per un autore – das heiß ich stechen, in Wahrheit meine Haut ist voller Stiche und Rize – von dieser schönen Auflage meiner Quartetten –
(Beethoven an den Verlag Hoffmeister & Kühnel in Leipzig, am 8. April 1802)
In der zweiten Textstelle bemängelt Beethoven die Dynamik (=Lautstärke) des von ihm dirigierten Orchesters nach einer Aufführung seiner Oper „Leonore“:
Lieber Mayer! Ich bitte dich, Hr. Von Seyfried zu ersuchen, daß er heute meine oper dirigirt, ich will sie heute selbst in der Ferne ansehen und hören, wenigstens wird dadurch meine Geduld nicht so auf die probe gesezt, als so nahe bey, meine Musick verhunzen zu hören – Ich kann nicht anders glauben, als daß es mir zu Fleiß geschieht. Von den Blasenden Instrumenten will ich nichts sagen, aber – laß alle p. pp. cres. alle decresc. und alle f. ff. aus meiner oper ausstreichen; sie werden doch alle nicht gemacht. mir vergeht alle Lust weiter etwas zu schreiben, wenn ichs so hören soll – Morgen oder übermorgen hole ich dich ab zum Eßen – ich bin heute wider übel auf –
Dein Freund Beethowen
(Beethoven an Sebastian Mayer, Schwager Mozarts, am 10. April 1806)
Die dritte Textstelle stammt aus der Feder eines 22-jährigen Wienbesuchers aus Dessau. Der Inhalt spricht für sich:
Du wünschest gern von Beethoven etwas zu hören; ….. Was ich sonst von ihm weiß, werde ich Dir jetzt erzählen. Er ist ein eben so origineller und eigner Mensch als seine Compositionen; gewöhnlich ernst, zuweilen auch lustig, aber immer satyrisch und bitter. Auf der anderen Seite ist er auch wieder sehr kindlich und auch gewiß recht innig.
Er ist sehr wahrheitsliebend und geht darin wohl oft zu weit; denn er schmeichelt nie, und macht sich deswegen viel Feinde. Ein junger Mensch spielte bei ihm, und als er aufhörte, sagte Beethoven zu ihm. Sie müssen noch lange spielen, ehe Sie einsehen lernen, dass Sie nichts können. ….. Einmal traf ich ihn in einem Speisehause, wo er mit einigen Bekannten zusammen saß. Da schimpfte er gewaltig auf Wien und auf die dasige Musik und den Verfall derselben. Hierin hat er gewiß recht und ich war froh, dies Urtheil von ihm zu hören, da ich es schon vorher bei mir empfand. Vorigen Winter war ich häufig im Liebhaberkonzert, wovon die ersten unter Beethovens Direction sehr schön waren. Nachher aber, als er abging, wurden sie so schlecht, dass nicht eins verging, wo nicht irgend etwas wäre verhunzt worden. - - -
(Wilhelm Rust an seine Schwester Jette, am 9. Juli 1808)
Die vierte Textstelle spricht das Problem des Zusammenspiels an, welches unter die Verantwortung des Konzertmeisters (Direktors) fiel:
Dies ist nöthig, in einem Jahrhundert, wo es keine Konserwatorien mehr gibt, und daher kein Direktor mehr wie alles andere auch nicht gebildet wird, sondern dem Zufall überlassen wird, dafür haben wir geld für einen OhneHodenMann wobey die Kunst nichts gewinnt, aber der Gaumen unserer ohnedem appetitlosen reizlosen sogenannten Großen gekizelt wird
(Beethoven an Gottfried Christoph Härtel, am 21. August 1810)
Aus keiner dieser zitierten Passagen tritt uns ein zufriedener Musiker entgegen. Ganz offensichtlich war Beethoven oft unglücklich mit der Interpretation seiner Werke. Trotzdem greift er niemals wie ein Schulmeister ein. Wenn seinen Vorschriften nicht nachgekommen wird, neigt er eher dazu, die Anweisungen gänzlich zu tilgen als dass er sie mit Nachdruck durchsetzt.
Aber wir wollen nicht nur wissen, was Beethoven an der Wiedergabe seiner Kompositionen schlecht findet, wir wollen auch wissen, was er gut findet. Es ist ja nicht so, dass er sich darüber nie geäußert hat. Nach seiner Lehre sollte jeder Interpret über drei Eigenschaften verfügen. Er muss über Kenntnis verfügen, er muss Gefühl haben und – wohl das Allerwichtigste – er muss „achtsam“ sein. Merkwürdigerweise nimmt gerade die Achtsamkeit auch in der buddhistischen Lehre eine zentrale Position ein. Achtsamkeit! Bedeutet es doch, dass der Mensch seine Sinnesorgane öffnet und die Verbindung zwischen Geist und Materie scharf stellt. Man beachte die folgende Textpassage von Ferdinand Ries:
Wenn Beethoven mir Lection gab, war er, ich möchte sagen, gegen seine Natur, auffallend geduldig. Ich wusste dieses, sowie sein nur selten unterbrochenes freundschaftliches Benehmen gegen mich größthentheils seiner Anhänglichkeit und Liebe für meinen Vater zuzuschreiben. So ließ er sich manchmal eine Sache zehnmal, ja noch öfter, wiederholen. In den Variationen in F-Dur, der Fürstin Odescalchi gewidmet (Opus 34), habe ich die letzten Adagio-Variationen siebenzehnmal fast ganz wiederholen müssen; er war mit dem Ausdrucke in der kleinen Cadenze immer noch nicht zufrieden, obschon ich glaubte, sie eben so gut zu spielen, wie er. Ich erhielt an diesem Tage beinahe zwei volle Stunden Unterricht. Wenn ich in einer Passage etwas verfehlte, oder Noten und Sprünge, die er öfter recht herausgehoben haben wollte, falsch anschlug, sagte er selten etwas; allein, wenn ich am Ausdrucke, an Crescendos u.s.w. oder am Charakter des Stückes etwas mangeln ließ, wurde er aufgebracht, weil, wie er sagte, das Erstere Zufall, das Andere Mangel an Kenntnis, an Gefühl, oder an Achtsamkeit sei.
Mälzels Metronom würde Beethoven die Gelegenheit verschaffen, die Tempi seiner Werke mit einer Eindeutigkeit vorzuschreiben, wie sie sonst nur beim Militär üblich ist. Aber wollte er das auch? Hatte er nicht schon längst mitbekommen, dass Vorschriften, je eindeutiger sie sind, umso weniger beachtet werden?
Aber sogar wenn es möglich gewesen wäre, die Tempi von allen Sätzen des Gesamt-Oeuvres mit Zahlen festzulegen und bei allen Interpretationen durchzusetzen, was wäre denn gewonnen? Beethoven kannte Platons Phaidros. Das Buch stand in seinem Bücherregal und enthält eigenhändige Eintragungen des Komponisten. Die Überschrift über dem 60. Kapitel lautet:
Schwäche des durch die Schrift überlieferten toten Wissens.
Bei den folgenden Sätzen könnte man denken, Platon spricht von Mälzels Metronom und nicht vom Alphabet:
Denn diese Erfindung wird den Seelen der Lernenden vielmehr Vergessenheit einflößen aus Vernachlässigung der Erinnerung, weil sie im Vertrauen auf die Schrift sich nur vermittels fremder Zeichen, nicht aber innerlich sich selbst und unmittelbar erinnern werden. Nicht also für die Erinnerung, sondern nur für das Erinnern hast du ein Mittel erfunden, und von der Weisheit bringst du deinen Lehrlingen nur den Schein bei, nicht die Sache selbst.
Dabei gilt zu bedenken, dass Beethoven ohnehin der Überzeugung war, dass die Tempi seiner Werke, wie auch die Tempi von Haydn und Mozart, aus den Noten selbst ablesbar sind. Voraussetzung dazu sind Grundkenntnisse der klassischen Temporelationen, wie sie im 18. Jahrhundert in den Konservatorien gelehrt wurden, aber eben nicht mehr im ersten Jahrzehnt des neuen 19. Jahrhunderts.
Das Hauptproblem der damaligen neuen Zeit war, dass die sogenannten langsamen Sätze der klassischen Werke bereits zu langsam, die schnellen Sätze zu schnell gespielt wurden. Das klassische Maß wurde nicht mehr eingehalten und zeigte überall Risse. Dieses Auseinanderdriften der Adagio- und Andantesätze auf der einen Seite und der Allegro- und Prestosätze auf der anderen ist ein Phänomen, das durch Rezensionen in der Allgemeinen Musikalischen Zeitung Leipzig gut belegt ist.
So heißt es in einem Beitrag der AMZ vom Januar 1807:
Die Sucht, musikal. Werke immer geschwinder zu spielen, nimmt auch hier immer mehr über Hand, so dass man sich oft einen Spaß und auch wohl ein Verdienst daraus macht, z. B. die Sinfonie, herunter „gestäubt“ zu haben. So wurde vor einiger Zeit ein Mozartsches Klavierkonzert gerade noch einmal so geschwind gespielt, als ich es selbst von Mozart vortragen hörte.
Um auch von übertriebenem Zögern wenigstens ein Beyspiel anzuführen, nenne ich das von Lamarc, der während seines Aufenthaltes in Wien das zweyte Stück des zweyten der konzertirenden Mozartschen Quartetten fast noch einmal so langsam nahm, als ich es unter Mozarts Leitung habe spielen hören.
Ein anderes Beispiel steht in der AMZ von Oktober 1811: