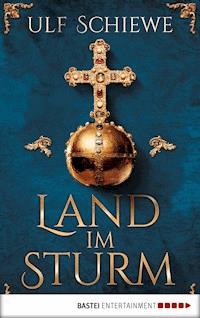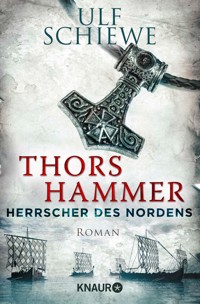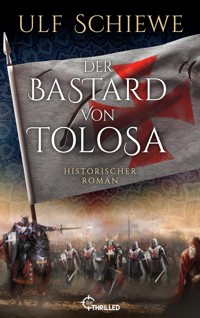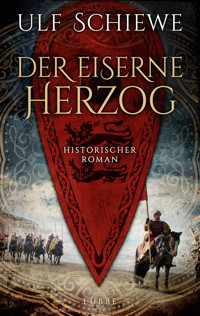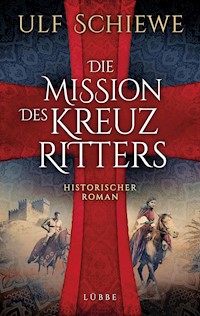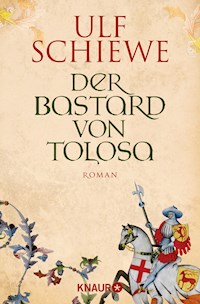
4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Wie Tausende »Soldaten Christi« folgt auch der junge Edelmann Jaufré Montalban 1096 dem Aufruf des Papstes, Jerusalem von den Ungläubigen zu befreien. Viele grausame Schlachten später beginnt er, am Sinn des Kreuzzugs zu zweifeln. Als seine Geliebte brutal niedergemetzelt wird, will er sich auf seine Burg nahe dem heutigen Toulouse zurückziehen. Doch dort erwartet ihn eine Gattin, die er nur unter Zwang geheiratet hatte – und eine tödliche Intrige um das Rätsel seiner Herkunft. Der Bastard von Tolosa von Ulf Schiewe: historischer Roman im eBook!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1375
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Ulf Schiewe
Der Bastard von Tolosa
Roman
Knaur e-books
Über dieses Buch
Inhaltsübersicht
Für meine Frau Sandra
Buch I
»Wer lange Räuber war, soll nun Ritter werden. Wer gegen Brüder und Verwandte kämpfte, soll fortan auf gerechte Weise gegen die Barbaren kämpfen. Wer bisher für wenig Lohn als Söldner diente, soll seinen Lohn in der Ewigkeit finden.«
Papst Urban II. (*1042 – †1099) Aufruf zum Kreuzzug auf dem Konzil von Clermont (1095), berichtet von Fulcher von Chartres (*1059 – †1127)
»Das Schicksal zerbricht uns, als seien wir Glas, und die Scherben finden niemals wieder zusammen.«
Abu al-Ala’ al-Ma’arri Syrischer Poet (*973 – †1057)
Castel Rocafort
Las Corbieras, Anno Domini 1131
Es waren die Gänse, die zuerst Alarm schlugen.
Ich trat an eines der Turmfenster. Eigentlich nur eine schmale Öffnung in den rauhen Quadern des alten Turms. Von hier oben überblickt man unser Dorf und dahinter das sich nach Osten zu leicht absenkende Tal.
Auf der Gemeindewiese hinter der Schmiede sammelten sich unruhig schnatternd die großen, weißen Vögel. Sie reckten ihre langen Hälse und stießen durchdringende Warnschreie aus, stets ein Zeichen, dass sich Fremde dem Dorf nähern. Ich konnte mir nicht helfen, aber im Geiste sah ich wieder gepanzerte Reiter mit erhobenen Schwertern ins Dorf galoppieren, die ersten Leute niedermachen, Brandfackeln auf die Hüttendächer werfen und schreiendes Dorfvolk zusammentreiben.
Ich horchte.
Keine Hufgeräusche. Kein Reitertrupp, dachte ich erleichtert und atmete tief durch, um die üblen Gedanken zu verscheuchen. Warum waren mir diese Bilder in den Sinn gekommen? Das lag doch schon so weit zurück. Und hatten wir seitdem nicht friedlich gelebt? Ich schalt mich einen misstrauischen Toren, der sich hinterrücks von bösen Erinnerungen überfallen lässt. Trotzdem, alte Soldatengewohnheiten sterben langsam, und so bin ich wachsam und unruhig, wenn fremde Kriegsleute durch mein Land reiten. Aber danach sah es heute nicht aus. Alles schien wie gewöhnlich.
Draußen ließ eine warme Nachmittagssonne die Herbstfarben leuchten. Die Gänse waren schwer und fett dieses Jahr, dachte ich zufrieden. Ich werde der Köchin auftragen, mir zum Tag des Herrn einen der Vögel zu schlachten. Doch vielleicht sollte ich warten, bis die Maronen für eine gute Füllung eingesammelt waren oder bis die Bauern im Wald die Schweine nach Trüffeln suchen ließen. Beim Gedanken an solche Leckereien meldete sich aufdringlich mein Magen.
Ich kniff die Augen zusammen und spähte noch einmal angestrengt aus dem Turmfenster. Unten auf der Straße, die durch mein Land führt, war nichts zu erkennen. Bis hier oben verirrt sich selten jemand, denn die Burg thront auf einem Felsen hoch über der Straße und dahinter, gegen Süden zu, liegt, halb versteckt, unser Dorf auf einer sanft ansteigenden Hochebene, die sich bis zum Fuß des Berges Bugarach erstreckt.
Irgendwo am Dorfeingang schlug ein Hund an. Ich erkannte die rauhe Stimme des zottigen, einäugigen Hirtenhundes, der dem alten Schäfer Berard gehört. Über die Hüttendächer hinweg starrte ich auf den staubigen Weg, der sich zwischen Bäumen den Hang heraufschlängelt. Nachdem sich nun auch der Hofhund des leibeigenen Bauern Peire vernehmen ließ, entdeckte ich endlich eine schmale Gestalt, die zu uns aufstieg. War es der Schreiberling, den ich erwartete?
Der Wanderer näherte sich dem Dorfeingang, und ich konnte tatsächlich die graue Kutte eines Mönches ausmachen. Aber keine Schuhe. Der Kerl marschierte unbekümmert mit bloßen Füßen einher. An einem Stock, den er über der Schulter trug, hing ein Leinenbündel, und, nach den lebhaften Bewegungen zu urteilen, musste es sich um einen jungen Burschen handeln.
Inzwischen waren alle Hunde des Dorfs in Aufruhr geraten, und ihr wütender Lärm schallte zu mir empor. Verdammte Köter! Eine Rotte von ihnen umringte laut bellend den kleinen Mönch, der verschreckt stehen geblieben war. Sein Bündel lag im Staub, und er erwehrte sich der Hunde mit dem Stock, was diese umso mehr reizte. Jetzt liefen auch die Kinder herbei und hüpften lachend um den Mönch herum, der immer heftiger nach den Hunden stieß.
Bauer Peires stämmige Frau und ein paar Knechte kamen dem armen Kerl zu Hilfe. Sie verscheuchten die Hunde mit scharfen Worten und gut gezielten Erdklumpen. Die Bauersfrau wollte ihn gerade willkommen heißen, als der sein Bündel an sich riss, eine Lücke in der Hundemeute nutzte und rannte, was die Beine hergaben, verfolgt von einem Schwarm schreiender Kinder und kläffender Köter. Neugieriges Volk lief aus den Hütten und machte große Augen, wie der Junge mit fliegenden Rockschößen den steilen Weg zur Burg heraufjagte und sich über die Zugbrücke in den engen Hof der Vorburg rettete.
Dorthin wagte die Meute nicht, ihm zu folgen. Enttäuscht standen sie draußen. Die Kinder johlten und schnitten Grimassen, und die Hunde bellten überreizt, bis einer der Wachmänner sie verscheuchte. Vor seinem langen Spieß traten sie widerwillig den Rückzug an. Langsam kehrte die gewohnte Ruhe wieder ein, nur ein paar Dörfler steckten die Köpfe zusammen, um den Vorfall zu erörtern. Ich schüttelte belustigt den Kopf und trat vom Fenster zurück.
Vielleicht war es doch mein Schreiber. Ich hatte wichtige Schriftstücke aufzusetzen. Das war Arbeit für einen Pfaffen und nicht für einen Edelmann, wenngleich heutzutage auch mancher senher gern das Schwert gegen die Feder zu tauschen scheint. Trobadors nennen sie sich, Versefinder und Dichter. Neumodischer Unsinn für höfische Gecken, so sage ich dagegen. Obwohl manches Lied, das muss ich zugeben, mir schon gefallen hat. Nun, ich kann meinen Namen schreiben, und das hat bisher immer genügt. Wenn es nach mir ginge, sollte ein jeder bei dem bleiben, was unser Herrgott für ihn bestimmt hat. Der eine pflügt den Acker, der andere lenkt das Schlachtross. Und zum Schreiben schickt man nach einem Klosterbruder. Basta!
»Herr!«, schrie die Köchin von unten herauf, dass es durch den Turm hallte. Wie oft habe ich dem Weib nicht schon gesagt, sie soll nicht schreien. Warum schickte sie nicht eine Magd? Aber es war zwecklos, ihr noch Anstand beibringen zu wollen. Ohne ihre Künste in der Küche wäre ich längst nicht so geduldig mit ihr.
»Was ist?«, brüllte ich zurück.
»Ein komisches Bürschlein im Mönchsgewand will Euch sprechen«, rief sie fröhlich.
»Dann schick ihn herauf!«
Wenig später hörte ich einen leichten Fußtritt auf der langen, gewundenen Steinstiege, bis er prustend und schwitzend vor mir stand. Ein junger Kerl mit dünnem Flaum am Kinn, hochrot vor Anstrengung und schwer atmend. Er musste sich am Pferdetrog erfrischt haben, denn es tropfte noch Wasser vom Gesicht auf die Kutte.
»Seid gegrüßt, Mossenher!«, stammelte er und machte eine tiefe Verbeugung. »Prior Jacobus schickt mich.« Dabei musste er wieder schnaufend Luft holen.
Ich besah mir den Jungen von allen Seiten.
Eine stoppelige Tonsur, die längst hätte neu geschoren werden müssen. Darunter dunkle, strähnige Haare. Die graue Kutte aus rauhem Sacktuch, mehrfach geflickt, hing in Fetzen über nackte, verstaubte Füße. Er war nicht groß, hatte schlanke Glieder, ein ebenes Gesicht. Aber Herrgott, wie scheußlich er nach altem Schweiß und ungewaschenen Füßen stank! Ich rümpfte die Nase. Was hatten sie mir denn hier für einen verdreckten Milchbart geschickt?
Doch aus dem Elend seiner Lumpen starrten unschuldige, blaue Augen. Obwohl er die Lider nicht unterwürfig senkte, wie es einfache Leute im Angesicht eines Edelmannes tun, so war sein Blick doch nicht aufmüpfig. Nein, er sah mich treuherzig an, mit einer unbefangenen Neugierde in den Augen und leicht geöffneten Lippen, denn sein Atem hatte sich noch nicht beruhigt. Etwas Wasser lief aus dem strähnigen Haar, und er wischte sich mit dem Ärmel der Kutte verschämt übers Gesicht. Diese kindliche Geste und die großen Augen, die er nun doch verlegen niederschlug, verstärkten den Eindruck von Unschuld und Verletzlichkeit. Er erinnerte mich plötzlich an meine eigenen Kinder. Mon Dieu!, wie lang war das nun schon her?
Ich unterdrückte den Fluch, den ich wegen seiner verlotterten Erscheinung auf den Lippen gehabt hatte. Es geschah mir ganz recht. Niemandem hatte ich trauen wollen. Zumindest nicht den Brüdern des nahen Klosters Cubaria, auch wenn die mir sicher einen fähigen Schreiber gesandt hätten. Aber sie hatten mich schon einmal verraten, obwohl es lange her war. Überhaupt war ich auf größte Vorsicht bedacht. Es gab Dinge zu regeln, vor allem diese vertrackte Familiengeschichte, an die ich kaum denken mochte. Bei mir war sie nur tal res, jene dunkle Angelegenheit, die man besser nicht beim Namen nennen sollte. Nein, nein, es war schon richtig, jemanden aus der alten Einsiedelei zu holen. Die plapperten nicht. Und dorthin verirrte sich auch niemand, um Dinge zu erfahren, die nicht für seine Ohren bestimmt waren.
»Was gehst du ohne Schuhe?«, fuhr ich den Jungen unwirsch an. Der blickte auf seine schwieligen Füße und zuckte mit den Schultern.
»Ich habe keine, Senher. Wir dienen dem Herrn in Demut und Armut, wie es der Heilige Benedikt befiehlt.«
»Ich weiß das. Aber selbst Christus trug Sandalen.«
Darauf wusste er nichts zu sagen und schlug beschämt die Augen nieder.
»Du bist zu jung für einen Schreiberling.«
»Prior Jacobus vertraut mir, Herr.« Mit diesen Worten nahm er die Schultern zurück, und auch seine Stimme klang fester.
»Offensichtlich«, brummte ich. »Und wie heißt du?«
»Aimar, Mossenher.«
Unwillkürlich zuckte ich zusammen, denn der Name rührte an alte Erinnerungen. »Weißt du, wer der Kirchenfürst war, der deinen Namen trug?«
»Meint Ihr Bischof Aimar de Lo Puei?«
»Du hast von ihm gehört?«
Er nickte. »Der geistliche Führer des Pilgerzugs nach Jerusalem, Legat des Heiligen Stuhls und von Urbanus selbst ernannt.«
»Oho!«, rief ich erstaunt. »Woher weißt du denn das?«
»Unser Prior erzählt mir Dinge aus der Welt. Dabei spricht er gern von den frommen Kriegern, die ins Heilige Land zogen.« Er beugte sich vertraulich vor. »Außerdem haben wir eine Abschrift der chronica in der Einsiedelei.«
»Was für eine chronica?«
»Die von Paire d’Aguiliers. Der war doch dabei.«
»Was? Meinst du den Beichtvater des alten Grafen?«
»Jawohl, Herr. Und ich habe schon mehr als die Hälfte gelesen. Historia Francorum qui ceperint Jerusalem«, fügte er stolz und mit ernster Miene hinzu, als müsse allein der lateinische Titel für Geltung und Glaubwürdigkeit der Schrift bürgen.
Aha, dachte ich. So hat er sie doch zu Ende geschrieben, seine Geschichte der Franken, die Jerusalem eroberten. Ich erinnerte mich noch gut an Paire d’Aguiliers, jenen hochnäsigen Hofkaplan meines Herrn, des einäugigen Fürsten Raimon Sant Gille von Tolosa. Der weißhaarige, alte Graf hatte den Pfaffen beauftragt, alles niederzuschreiben, was uns auf der Pilgerreise widerfuhr. Oft hatte man ihn bei aufgeschlagener Zeltwand an seinem Reisepult sitzen sehen. Nun ja. Um ehrlich zu sein, ich hatte diesen frommen Wichtigtuer nie gemocht. Für meinen Geschmack redete er zu viel von Wundern und Erscheinungen. Man mochte glauben, allein der Heilige Andreas habe Jerusalem erobert und nicht die vielen mutigen Männer, die ihr Leben vor den Mauern gelassen hatten.
»Ich wusste nicht, dass sich jemand für solches Gekritzel erwärmen könnte. Was weiß ein Pfaffe schon vom Kriegshandwerk?«
»Doch, Herr. Viele lesen diese chronica, und es werden häufig Abschriften verlangt, wie unser Prior sagt. Ich selbst habe zur Übung damit begonnen. Es ist eine wundersame Geschichte, Herr.« Sein Gesicht war vor Eifer gerötet. »Unsere Christenkrieger haben viel erlitten und dennoch mit Gottes Hilfe wahre Wunder vollbracht.«
»Ist das wahr?«, fragte ich scheinheilig.
»In Nicaea haben sie ein ganzes Türkenheer vernichtet und in Antiochia … die Heilige Lanze, Herr, die hat alles zum Guten gewendet und …«
»Genug jetzt!«, unterbrach ich ihn barsch. »Wir sind nicht hier, um uns mit dummem Geschwätz aufzuhalten! Du hast einen Auftrag, oder?«
Aimars Mund klappte zu. Er hielt den Blick zu Boden gesenkt und die Hände hinter dem Rücken verschränkt, so als stähle er sich gegen weitere Schelte. Fast tat mir meine Grobheit leid.
»Hast du alles Nötige mitgebracht?«, fragte ich in sanfterem Tonfall.
Er nickte eilfertig. Ich wies auf den klobigen Holztisch hinter ihm, und dort legte er sorgfältig die Gegenstände aus, die er aus seinem Beutel zog. Die Geräte seines Schreiberhandwerks, durch häufigen Gebrauch abgenutzt, schien er mit Vertrautheit zu handhaben. Ein Holzschälchen zum Anrühren der Tinte, das Federmesser, eine Dose mit feinem Streusand, ein Knäuel Schafswolle zum Reinigen der Gänsekiele, einen flachen Bimsstein zum Glätten des Pergaments.
Ich musterte ihn streng und sagte: »Also schön. Lassen wir es auf einen Versuch mit dir ankommen.«
Er nickte demütig und zog einen Schemel heran, um sich vor dem Tisch niederzulassen. Ich bemerkte, wie dünn der Junge war. Und da fiel mir die karge Kost ein, die jene armen Teufel in der Einsiedelei bekamen.
»Bist du nicht hungrig nach deiner Wanderung?«
»O ja, Herr.« Man konnte fast sehen, wie ihm bei meinen Worten das Wasser im Mund zusammenlief.
»Es ist schon spät, und du hast einen langen Weg hinter dir. Lassen wir es also für heute gut sein. Geh runter zur Köchin und bitte sie, dir einen Teller Suppe zu geben und ein Stück Käse dazu. Über dem Pferdestall ist eine leere Kammer. Du darfst dir frisches Stroh für dein Bett nehmen. Dein Schreibgerät lass hier, und morgen früh, nach dem Morgenmahl, beginnen wir mit der Arbeit.«
Aimar ließ sich dies nicht zweimal sagen. Mit scheuem Lächeln murmelte er »habt Dank, Herr!« und war im Nu die enge Stiege hinunter verschwunden.
»Und nimm ein Bad!«, schrie ich hinterher. »Du stinkst erbärmlich!«
»Ja, Herr!«, hallte es durch den Treppengang.
Morgen würde er nicht mehr derselbe sein, dachte ich belustigt. Die Köchin würde ihn in den Zuber stecken und gnadenlos von oben bis unten abschrubben lassen, denn Sauberkeit war ihr oberstes Gebot.
Es war Abend geworden.
Ein letzter Strahl der Oktobersonne trat durch das schmale Turmfenster und zeichnete einen hellen Fleck auf die Steinblöcke der gegenüberliegenden Wand. Der Rest der Kammer lag schon im Halbdunkel. Von fern hörte man das Lied einer Magd heraufklingen, und auf den Turmzinnen gurrten zur Antwort die Tauben. Das Vieh und auch die Gänse waren längst in ihren Ställen. Stille lag über dem Dorf, denn die Leute nahmen ihr einfaches Abendmahl ein.
Ich liebe es hier oben auf dem Turm. Man schaut in die Ferne, wo das Grün der Hügel allmählich in das sanfte Blau der entfernten Kämme übergeht. Hier bin ich dem Himmel nah und den irdischen Dingen entrückt. Die Sorgen der Menschen erscheinen kleiner und unwichtiger. Und doch überblicke ich alles und kann sehen, was im Burghof oder im Dorf geschieht. Hier habe ich unzählige Stunden verbracht, und auch jetzt hielt mich der Ausblick auf die Schönheit der bergigen Corbieras noch ein Weilchen gefangen.
Unten im Tal am Flüsschen Agli lagen bereits tiefe Schatten. Dort verläuft die alte Handelsstraße, die die südliche Corbieras durchquert und am Kloster Cubaria vorbei über unseren Besitz weiter nach Limos führt. Keine wichtige Straße, aber Handelsleute aus der Hafenstadt Colliur, im Süden, nehmen diese Abkürzung nach Carcassona und Tolosa und weiter bis zum großen Meer im Westen, nahe dem die Stadt Bordeu liegt. Die Strecke ist steinig, an Stellen abschüssig, besser geeignet für Maultiere als für Ochsengespanne. Und zudem unsicher in dieser stillen Gegend.
An der alten Holzbrücke, wo der Aufstieg zum Dorf beginnt, unterhalten wir einen Wachposten, denn Rocafort besitzt verbrieftes Recht auf Wegezoll, den Kaufleute, die sich durch unser Gebiet wagen, zu entrichten haben. Dieser verbessert die Einkünfte und ist daher sehr willkommen, besonders wenn sie Zinn von den Inseln tragen, die man Britannien nennt, oder Gewürz und Seide aus den Häfen des Orients. Deshalb bin ich bemüht, Wegelagerer aus meinen Wäldern zu vertreiben und die Straße in einem guten Zustand zu halten, was leider nicht immer gelingt. An den Hängen des Bugarach, bis zu denen mein Land reicht, gibt es zu viele Schlupflöcher für herrenloses Gesindel. Und was die nur spärlich befestigte Straße betrifft, so sorgen Frost und Regen immer wieder für Schäden.
Die Abendsonne versank hinter einem Gehölz dunkler Tannen, zwischen denen die Straße verschwindet. Einer meiner Waffenknechte, ich erkannte ihn trotz der Entfernung am Lanzenwimpel, näherte sich von dort in gemächlichem Trab. Zurück von seinem Streifenritt war auch für ihn das Tagewerk beendet. Gewiss hatte die cosiniera, unsere Köchin, für ihn und seinesgleichen einen kräftigen Eintopf auf dem Feuer und ein Stück Brot zum Eintunken. Wenn sie es gut mit den Männern meint, findet sich auch ein Stück Speck in der Suppe oder eine Blutwurst. Danach gibt es Wein, Geschichten und derbe Scherze, bis die einen erschöpft auf ihr Strohlager fallen und die anderen heimlich zu den Mägden ins Dorf schleichen.
Dem Herrn sei Dank, denn wir kommen gut zurecht auf Rocafort. Besonders in dieser Jahreszeit, nach der Ernte, nach dem Schlachten des überzähligen Viehs und dem Einlagern des Herbstobstes sind alle Speicher und Vorratskammern voll. Die Erträge reichen aus, um die benachbarte Abtei mit Gemüse zu versorgen und Weizen und Roggen bis nach Quilhan zu liefern. Von der Küste dagegen kommen nicht viele Händler den langen Weg bis zu uns herauf. Meist erst im Spätsommer oder im Herbst nach der Weinpresse und bevor das schlechte Wetter einsetzt. Aber es sind genug, so dass wir jedes Jahr mit unserer Schafswolle, unserem Wein und Öl ein nettes Sümmchen verdienen oder gegen Roheisen, gegerbtes Leder und feines Tuch tauschen können.
Ja, wir können zufrieden sein. Das Land hier im Süden, in dem man die lenga romana spricht, ist ein reiches und schönes Land, und ob Tolosaner, Gascogner, Provenzalen oder Katalanen, wir alle sollten Gott danken, dass wir hier leben dürfen.
Und dennoch hat jedes Paradies seine Schlange, und manch schöner Apfel verbirgt den Wurm, der ihn von innen höhlt. So ist es auch bei uns. Zu Zeiten, als der große Franke Carolus noch lebte, da herrschten Gerechtigkeit und Ordnung, so wie man es sich erzählt. In unseren Zeiten hingegen haben die Könige der Franken nichts zu sagen. Man merkt sich nicht einmal ihre Namen. Ludwig der Dicke ist, glaube ich, immer noch König, und obwohl er dem Namen nach oberster Lehnsherr ist, so macht hier jeder, was er will. Dem Land fehlt der mäßigende Einfluss der alten Herrscher. Jeder castelan ist sein eigener Herr, jedes Adelshaus steht im Wettkampf mit den anderen großen Familien. Die drei mächtigsten Geschlechter sind die Herzöge von Aquitania im Westen, dann die Grafen von Tolosa, deren Einfluss bis zum Mittelmeer reicht, und schließlich die Grafen von Barcelona im Süden. Dazwischen gibt es viele, unabhängige Barone und kleinere Grafschaften, die sich mal hier, mal dort verbünden oder dem einen oder anderen Herrn die Treue schwören.
In dieser unruhigen Welt zählt selten Gerechtigkeit, umso mehr aber Einfluss und Stärke. Es werden Kriegsknechte verdingt, man übt sich im Gebrauch der Waffen, und immer neue Burgen werden errichtet. Vasallen verbünden sich gegen ihren dominus, die Herren selbst lassen es oft an Treue fehlen. Es geht um Macht und Reichtum, um fruchtbare Landstriche, auf denen Wein, Oliven und Schafe gedeihen, um Minen in den Bergen, Mühlen am Fluss, um Zölle an den Handelsstraßen und Umschlagplätzen, um Macht über Klöster und Diözesen und Zugriff auf deren fette Pfründe. Verrat und blutige Fehden sind nicht selten. Diese Habgier der Menschen ist Gottes Rechnung für das schöne, reiche Land, in dem wir leben.
Ich danke Gott auf Knien, dass es mir in den letzten zwanzig Jahren gelungen ist, meinen Besitz aus diesen Wirren herauszuhalten. Aber wie lange noch? Und wenn ich stürbe? Was würde dann aus Rocafort? Diese vermaledeite Angelegenheit, an die ich kaum denken mag, tal res, hängt immer noch drohend über uns. Fast hätte es uns damals vernichtet. Mich schauderte, als ob mich die schwarzen Schwingen des Todesengels berührt hätten.
Dabei geht es um nichts Geringeres als um das Erbe des Grafen Guilhem, nun schon seit vierzig Jahren tot. Um die Herrschaft über das reiche Tolosa, das ihm Raimon, der eigene Bruder, geraubt hatte. Um nicht weniger als die Ansprüche dreier mächtiger Fürstenfamilien, Tolosa, Aquitania und Tripolis in Outremer, unter denen der alte Streit um dieses Erbe jederzeit neu entflammen könnte. Was würden sie tun, wenn sie von Guilhems geheimem Testament erführen, dessen Inhalt ein Feuer in der ganzen Region entfachen könnte, wenn er bekannt würde. Würden sie nicht jede Spur eines vierten Erbanspruchs mit Schwert oder Gift zu unterdrücken suchen? Und das verdammte Ding liegt immer noch in meiner Obhut! Das Vermächtnis der mächtigsten Familie des Südens versteckt auf einer kleinen Burg mit einem alten Mann als Wächter. Zum Lachen, eigentlich.
Nicht zu vergessen das Gold. Auch dies würde sie anziehen wie Kuhfladen die Fliegen, wenn nur jemand davon wüsste. Denn Graf Guilhems Kriegshort liegt hier vergraben. Mein Onkel Odo, ehemals Erzbischof von Narbona und Graf Guilhems langjähriger Vertrauter, hatte Testament und Gold vor Raimons Zugriff hier versteckt. Tolosaner Gold.
Über all diese Dinge habe ich seitdem geschwiegen, denn meines ist ein gefährliches Wissen. Allerdings, in letzter Zeit ist mir schmerzlich bewusst geworden, dass ich mit meinen fünfundfünfzig Wintern langsam alt werde. Auch wenn ich es mir ungern eingestehe, aber in Wahrheit schmerzt das Knie beim Treppensteigen, und nach langem Ritt habe ich’s im Kreuz. Ich schlafe schlecht und wache in der Nacht auf, weil mich die Blase drückt. Nachher wälze ich mich missmutig auf dem Lager und warte auf den ersten Hahnenschrei. Der bedrückende Gedanke an Alter und Tod hat sich in mein Leben geschlichen, eine neue und wenig angenehme Erfahrung.
Die zunehmende Dämmerung breitete ihre Schatten über die Landschaft. Wie jeden Abend in diesen Jahren blickte ich grübelnd auf mein Land und wünschte, mein Sohn Raol wäre an meiner Seite. Ich erinnerte mich an seinen Blick, als er, nicht älter als sechzehn, sich von mir abgewandt und davongeritten war. Liebe hatte ich ihm schenken wollen, aber in Wahrheit war nur Hass und Unverständnis zwischen uns gewesen. Auch er war, wie sein Vater, vor der Wirklichkeit ins Abenteuer geflohen und hatte dann vergessen, heimzukehren. Wusste er nicht, dass ich ungeduldig auf ihn wartete, schon seit über zwanzig Jahren? Dass er lebte, davon war ich überzeugt, und irgendwann würde er wiederkommen, so hoffte ich jedenfalls und sehnte mir diesen Tag herbei.
Ich seufzte. Allzu gern hätte ich das Testament vernichtet, um für immer den Mantel des Vergessens darüberzubreiten. Doch in Wahrheit fühle ich mich nicht dazu berechtigt. So ist es meine Pflicht, die Bürde im Geheimen weiterzureichen, an einen Jüngeren. Das war der Grund, warum ich den Schreiber gerufen hatte.
»Willst du mich wieder mästen, Weib?«, knurrte ich die Köchin am nächsten Morgen an, als sie meinen Napf mit einem kräftigen Schlag von ihrem zähflüssigen Hirsebrei versah und darin ein Stück Butter zergehen ließ. Ein Holzbrett mit Brot, Wurst, Zwiebelringen und Oliven lag auf dem mächtigen Eichentisch in der Küche.
Sie warf mir einen finsteren Blick zu und murmelte etwas Unverständliches. Dabei schob sie mir den Honigtopf zum Süßen hin und eine Schale mit zerstoßenen Nüssen. Sie kennt meine Schwäche für Nüsse. Sie hält mich für zu knochig und versucht alles, damit ich Speck ansetze. Ein Mann meines Ranges und Alters, sagt sie, dürfe nicht wie ein junger Hungerleider aussehen.
Die Sonne lugte gerade erst hinter den Bergen hervor. Der junge Brudersaß an einer Ecke des Tisches und löffelte von seinem dampfenden Napf. Ich hatte abgewunken, als er sich ehrerbietig erheben wollte. Wie gewohnt murmelte ich ein schnelles Morgengebet, und Aimar bekreuzigte sich dazu. Statt seiner Kutte trug er heute ein Paar rauher Beinkleider und das lange Hemd eines der Knechte. Das Mönchsgewand hing wahrscheinlich auf der Wäscheleine. Seine Haare waren sauber, und er stank nicht mehr, wie ich zufrieden zur Kenntnis nahm.
Wir haben eine gemauerte, offene Feuerstelle mitten in der Küche, und manchmal qualmt es aufdringlich, wenn der Wind schlecht steht. Wieder nahm ich mir vor, im nächsten Jahr einen richtigen Kamin mit Rauchabzug mauern zu lassen, wie es ihn inzwischen in der aula, dem Herrensaal über der Küche, und in meinem Turmgemach gibt. Ein Kamin in einem Bergfried ist sicher ungewöhnlich. Aber warum soll ich an meinem Lieblingsort frieren? »Da sitzt unser Herr wieder in seinem vermaledeiten Turm!«, kann ich sie fast hören, da unten im Dorf, wenn im Winter der Rauch aus meinem Kamin steigt. Sollen sie ruhig lästern, solange ich es warm habe.
Aimar kaute mit vollen Backen. Die Köchin war geschäftig bei der Arbeit und klapperte mit Pfannen und Gefäßen. Sie schürte die Glut und legte ein paar Scheite nach. Dann nahm sie den Topf von der Eisenkette über dem Feuer und kratzte die Reste aus. Schließlich betrachtete sie den Jungen wohlwollend und klopfte ihm kräftig auf den Rücken.
»Aus dem wird wenigstens noch was, so wie der isst!« Dann lachte sie über ihren Seitenhieb in meine Richtung. »Und sauber ist er jetzt auch.« Als Bruder Aimar bei der Bemerkung rote Ohren bekam, musste sie noch lauter lachen.
Sie ist ein gutherziges Weib, wenn auch etwas, nun, nicht gerade derb, aber eben handfest und geradeheraus. Sie wird bald vierzig Jahre zählen, besitzt aber noch alle Zähne, und nie habe ich sie einen Tag krank erlebt. Sie hat kräftige Arme, stämmige Beine und einen verschwenderisch ausgestatteten Leib. Dazu sagt sie, Gott müsse ihr besonders zugetan sein, denn er habe ihr alles gegeben, was ein rechtes Weibsbild ausmache. Dabei lacht sie herzhaft, nicht ohne mir einen herausfordernden Blick zuzuwerfen.
Aber darauf gehe ich nicht ein. Hochmut kommt vor dem Fall, antworte ich für gewöhnlich, doch da verschwendet man seinen Atem, denn Demut kennt diese Frau nicht. Sie herrscht mit strenger Hand über das Gesinde, und da es nun seit langem keine domina, keine Burgherrin, mehr auf Rocafort gibt, hat sie stillschweigend, dank ihres beherzten Wesens, die Rolle eines weiblichen maior domus an sich gerissen, zumindest, was Haus und Hof betrifft, ganz als sei sie Mundschenk, Seneschall und Kämmerer in einer Person. Und das Wort la Cosiniera ist auf Rocafort fast zu einem Herrschaftstitel geworden. Niemand wagt, sie anders anzureden, und dies nur mit Ehrerbietung. Ich lasse sie gewähren, denn mit Ausnahme gelegentlicher Anmaßungen versorgt sie alles zu meiner besten Zufriedenheit.
»Hast du dein Bad genossen?«, fragte ich verschmitzt. »Und hat dich die Köchin eigenhändig abgeschrubbt?«
Aimar glühte tiefrot vor Verlegenheit. Mit vollem Mund mochte er nicht antworten und fuchtelte wild verneinend in der Luft herum. Die Köchin brach erneut in so schallende Heiterkeit aus, dass ihr die Tränen kamen und sie sich mit dem Handrücken über die Augen fuhr. Noch kichernd räumte sie den Tisch ab und wischte ihn mit ihrer Schürze sauber. So wie sie sich über die Eichenplatte beugte, sah man ihre strammen Hinterbacken. Ein durchaus angenehmer Anblick, fand ich, auch am frühen Morgen. Als ich dem Jungen vielsagend zuzwinkerte, wand er sich vor Verlegenheit und wäre am liebsten unter den Tisch gekrochen. Unschuldig ist er auch noch, dachte ich belustigt.
»So, nun trollt euch. Heute ist Backtag. Da gibt’s zu tun.«
Sie stemmte eine Faust in die Hüfte und winkte uns hinaus aus ihrem Reich. Wir ließen es uns nicht zweimal sagen, denn nichts ist schlimmer, als einem Heer von Frauen unter ihrer Führung in die Quere zu kommen. In der Vorburg steht der große Backofen, und einmal in der Woche wird dort das Brot unserer kleinen Gemeinde gebacken. Da wird geknetet, gerollt und geformt, geredet und gelacht und dabei der Dorfklatsch genauso kräftig durchgerührt wie der Teig für die großen, krustigen Brotlaibe. Die Backstube wird zum Schlachtfeld und die Cosiniera zum Heermeister über die mehlbestäubten Weiber. Nein, da flüchten wir Männer lieber rechtzeitig.
Aimar kletterte flink die enge Turmtreppe hinauf. Ich folgte etwas gemächlicher. Als ich ins Turmgemach trat, hatte er schon seine Gerätschaften ausgebreitet, und ich sah zu, wie er etwas von der harten Tintenmasse abschnitt und in einem Schälchen mit ein paar Wassertropfen auflöste.
Vor ein paar Tagen hatten sie den Fußboden mit frischem Stroh ausgelegt, so wie immer im Herbst und Winter, damit man die Kälte nicht so empfindlich im Bein spürt. Das Turmgemach ist nur spärlich eingerichtet. Neben meinem alten Lehnstuhl, auf dem ich mich nun niederließ, befinden sich hier ein paar Bänke und Schemel, ein solider Tisch aus Fichte und eine große Truhe, in der ich Erinnerungsstücke von meinen Reisen aufbewahre. Ein einfaches Bett steht in einer Ecke, für den Fall, dass es mir gefällt, hier oben zu nächtigen.
Das schönste Stück ist mein türkischer Wandteppich, in herrlichen Farben aus feiner Wolle geknüpft. Er hat mich einige solidi in Gold in den Souks von Tripolis gekostet und stellt eine Reiterschlacht dar, galoppierende Bogenschützen in hellen Turbanen mit den leicht schrägen Augen der turkmenischen Reitervölker. Ich kenne diese seldschukischen Krieger nur zu gut aus eigener Erfahrung. Mit Teppichen dieser Art legen sie den Boden ihrer Zelte aus. Aimar starrte das gute Stück mit offenem Mund an.
»Kommt aus dem Land der sarasins. Du weißt, so nennt man die Anhänger Mohammeds«, erklärte ich ihm. Er nickte scheu und traute sich nicht, weiter zu fragen, obwohl er den Teppich lange verstohlen musterte.
»Ich nehme an, du weißt, warum du hier bist«, kam ich zur Sache.
»Ich soll Euer Testament aufsetzen.«
»Hast du Erfahrung darin?«
»Nein, Herr.«
»Und wie soll es gehen, wenn du es noch nie gemacht hast?«, fragte ich gereizt.
Woraufhin er sich an den Kopf fasste, laut »Jes Maria!« hervorstieß und hastig in seinem Beutel kramte. Schon bald zog er triumphierend ein vergilbtes Pergament hervor und hielt es mir unter die Nase. »Ich vergaß. Das hat unser Prior in einer Truhe gefunden. Es soll mir als Beispiel dienen. Seht, hier steht es. Ultima voluntas!« Er grinste selbstzufrieden.
»Wie kommt es, dass du schreiben kannst?«, fragte ich misstrauisch und nur halb besänftigt. Selbst unter Mönchen war das nicht alltäglich, außerdem war dieser hier noch sehr jung. Mit scheuem Blick erzählte er, dass er nicht zur Arbeit auf dem Feld tauge, und deshalb habe ihm der Prior die Kunst der Buchstaben beigebracht. Seitdem dürfe er die Annalen der Einsiedelei führen und den Brüdern aus der Bibel vorlesen.
»Und wie ist dein Latein?«
»Der Prior ist mein Lehrer«, erwiderte er zu meinem Erstaunen recht fließend auf Lateinisch. »Ich lese und mache Abschriften. Jeden Tag drei Stunden. Er redet nur noch Latein mit mir, außer wenn er mich einen Dummkopf schilt.« Sein Lachen zeigte, dass er die Schelte des Priors nicht allzu ernst nahm.
»Für Wichtiges wie Urkunden ist Latein besser«, sagte ich, »denn die lenga romana des Volkes ist je nach Ort verschieden. Außerdem gibt es selbst am anderen Ende der Welt genug Menschen, die dieser Sprache mächtig sind. So kann man sich überall verständlich machen.«
»Ich wünsche mir sehnlichst, eines Tages eine Wallfahrt zu machen. Am liebsten zum Heiligen Jacobus nach Compostela.«
»Nun, bevor du dich gleich auf den Weg machst«, erwiderte ich spöttisch, »wollen wir es erst mal mit deinen Schreibkünsten versuchen. Gehen wir ans Werk.«
In Wahrheit wäre ich lieber zu Pferde in den Feldern oder mit meinem Wildhüter auf der Pirsch gewesen. Aber das Testament war wichtiger.
»Ich, Jaufré Montalban«, hob ich an, »Senher de Rocafort …« Da verließ mich schon die Eingebung. Der Titel Senher entsprach dem Stand meines Geschlechts. Aber nur als adeliger Gutsherr habe ich mich nie gesehen. Denn ich bin Krieger, bin mein Lebtag lang ein cavalier gewesen. Nicht, dass ich den Krieg liebe. Nur Grünschnäbel und Dummköpfe ziehen begeistert in den Kampf. Dennoch bin ich stolz darauf, ein Ritter zu sein, der die Achtung seiner Freunde genießt und seinen Feinden Furcht einflößt.
»Also nochmals! Ich, Jaufré Montalban, Cavalier und Castelan von Rocafort, Sohn der Domna Cecilia de Monisat und des Ritters Ramon Montalban aus Catalonha, Großneffe Odos von Monisat, vormals Erzbischof von Narbona, gebe hiermit meinen letzten Willen kund.«
Aimar tauchte den Gänsekiel in die Tinte, beugte sich über das leere Blatt und begann, mit der Feder über das Pergament zu kritzeln. Es ging ihm gut von der Hand, bemerkte ich zufrieden. Überhaupt, trotz seiner Jugend und der vor Schmutz starrenden Kutte gestern, schien er mir recht aufgeweckt zu sein.
»Prior Jacobus hat mir erzählt, dass Euer Verwandter Erzbischof war. Dann gehört Ihr einer mächtigen Familie an, nicht wahr?« Er sah von seiner Arbeit auf.
Weiß er etwas, fragte ich mich misstrauisch. Aber Jacobus würde mir gewiss nicht vorgreifen. Trotzdem ging mir ein Ruck durchs Herz. War dies schon der Augenblick, den Jungen aufzuklären? Nein, ich würde ihn noch ein wenig beobachten, um mich zu vergewissern, dass er vertrauenswürdig war.
Heutzutage wollen sie alles ihren verdammten Pergamenten anvertrauen. Doch die können in falsche Hände geraten. Geheimes Wissen bewahrt man besser unter den strengsten Eiden der Verschwiegenheit im Kopf eines ome de fianza, eines vertrauenswürdigen Mannes. Jung genug soll er sein, damit er nicht gleich wegstirbt. Und unscheinbar, dass niemand ihn verdächtigen möge. Aber klug, um in den Jahren weise zu entscheiden, wem er das Wissen weiterzureichen hätte. Und verschwiegen vor allen Dingen.
Eine solche Bürde hatte mein Onkel Odo damals dem Mönch Jacobus auferlegt. Und die Wahl war gut gewesen. Erst mir, dem Erben der Familie öffnete er sich, so wie Odo es ihm aufgetragen hatte. Und nun, für eine ähnliche Aufgabe, hatte Jacobus mir diesen petit gartz, diesen Jungen, geschickt.
»Was hast du gesagt?«
»Ob Ihr zu einer mächtigen Familie gehört …«, wiederholte er mit einem nachsichtigen Seufzer, wie ihn nur die Jugend fertigbringt, wenn sie sich mit einem geistesabwesenden, alten Trottel herumschlagen muss.
»Nein, nein! Wir sind nicht mächtig. Mein Onkel war es einmal, als Erzbischof. Graf Guilhem hat er gedient, dem älteren der Tolosaner Grafen, bevor der von seinem Bruder verbannt wurde.« Ich kratzte mich am Kinn und sann einen Moment nach. »Schreib, dass ich als Pilger und Krieger mit der militia christi im Heiligen Land war und bei der Befreiung Jerusalems gekämpft habe.«
Da riss mein Mönch erstaunt die Augenbrauen hoch und starrte mich mit offenem Mund an. Er, der mich noch gestern mit seiner Historia Francorum hatte beeindrucken wollen. Ich versuchte, ein Lachen zu verkneifen, denn ihn schien die Maulsperre befallen zu haben. Nur mühsam fasste er sich.
»Ihr habt am Heerzug ins Heilige Land teilgenommen, Herr?«
»Willst du es bezweifeln?«
»Und habt Ihr gegen die Ungläubigen gekämpft?«
»Häufiger und heftiger, als mir lieb war!«
»Und Ihr wart in Jerusalem?«
»Natürlich. Ich war unter denen, die die Mauer bezwungen haben.«
»Jes, mon Dieu! Heilige Mutter Gottes!« Aimar bekreuzigte sich, und seine Augen glühten förmlich vor Begeisterung. Ich wurde ungeduldig. So ging das nicht voran mit dem Testament.
»Lass dich nicht vom Schreiben abhalten, mon gartz!«, sagte ich daher kurz angebunden. Hastig schrieb er weiter und sah mich dann wieder mit großen Augen erwartungsvoll an.
»Schreib, dass ich später Hauptmann und castelan der Burg Pilgersberg des Grafen Raimon Sant Gille war«, sagte ich. »Ein harter Knochen, der Alte, aber ein gerechter Kriegsherr. Herrscher der Grafschaft Tripolis in Outremer und mein Lehnsherr.«
Der Klang des Wortes Outremer gab meiner alten Abenteurerseele immer noch einen Stich. Fast sah ich mich auf ein Schiff steigen, um der Sonne entgegenzusegeln. Outremer. Land jenseits des Meeres. Das Wort beschwört Bilder herauf. Manche fremdartig schön, andere hässlich und blutig. Vierzehn Jahre lang habe ich in der Fremde verbracht. Das verändert einen Menschen. Ich gehöre hierher in meine Corbieras. Und dennoch, ein Teil von mir gehört auch nach Tripolis. Das ist verwirrend.
»Nach Raimons Tod in Tripolis durfte ich später auch seinem Sohn, Graf Bertran, dienen.« Bertran der Bastard, ein Mann so recht nach meinem Herzen, erinnerte ich mich lächelnd. Ihn hatte ich geliebt, auch wenn Gott unseren gemeinsamen Weg leider viel zu kurz bemessen hatte.
»Pilgersberg?«, fragte Aimar. »Hört sich eher nach einer Kapelle an.«
»Es ist die größte Burg in Outremer.«
»Seltsamer Name für eine Festung.«
»Sie heißt Mons Pelegrinus, das weiß doch jeder. Steht das nicht in deiner Historia Francorum?«
»Ich habe sie noch nicht zu Ende gelesen.«
»Sie wurde erst nach dem Fall Jerusalems errichtet, als Schutzburg für die Pilger.« Langsam wurde mir dies Gerede zu viel. »Was schert es dich, wie die Burg heißt. Schreib einfach, was ich dir auftrage.«
»Ja, Herr. Aber Ihr redet zu schnell.«
»Ein keckes Bürschchen bist du«, brummte ich. »Wie alt bist du eigentlich?«
»Achtzehn, Herr.«
Achtzehn. Mein Gott. Viel älter war ich damals auch nicht gewesen, als ich Papst Urbans Rede in Clermont gelauscht hatte. Wer sich aufmache, das Grab Christi zu befreien, dem seien Gottes Vergebung und das ewige Himmelreich gewiss, so hatte er gepredigt. Warum nur hatten Männer freiwillig Haus und Hof, Burg und Hütte verlassen, um in die Fremde zu ziehen? Gewiss hatten wir uns als Krieger Christi gesehen, ein beflügelnder Gedanke, denn viele waren empört über die Ungläubigen, die unsere Christenbrüder im Osten bedrängten, angeblich Kirchen und Christenfrauen schändeten. Aber was ging uns das an, so weit weg von unserem eigenen Leben hier? Und was hatte dieser Pilgerzug am Ende gebracht, außer Witwen und Waisen, Tod und Verwüstung? Mich fröstelte plötzlich. War es ein kalter Windstoß, der durchs Turmfenster drang, oder die Erinnerungen, die mich plagten? Männerstimmen drangen herauf und das harte Geklapper von Pferdehufen auf Pflastersteinen. Hunde schlugen aufgeregt an. Es klang wie der Aufbruch zur Schlacht. Rüstete sich das letzte Aufgebot?
Ein Räuspern schreckte mich aus meinen Tagträumen. Einige Herzschläge lang hatte ich mich in einer anderen Welt befunden. Mein Blick heftete sich wieder auf Aimars Gesicht, der mich immer noch fragend anstarrte.
»Achtzehn bist du?«, fragte ich geistesabwesend. »Und was lebst du bei den Einsiedlern? Sind deine Eltern tot?«
Er schüttelte verlegen den Kopf. »Das ist es nicht.«
»Ich sage dir, mein Junge, es gibt nichts Wichtigeres als die Familie. Ich weiß es aus eigener Erfahrung. Ohne sie ist ein Mann gar nichts!« Ich sah ihm streng ins Gesicht. »Also, was ist mit deiner Familie?«
Seine Augen wichen meinen aus. »Es ist meine Buße, Herr. Ich habe gesündigt.« Was konnte so ein Knabe denn schon groß gesündigt haben? Aber mehr wollte er nicht sagen. Na schön. Es ging mich nichts an. »Ihr habt es schon hinter Euch, Senher!«
»Wie meinst du das?«
»Als Pilger auf Wallfahrt zur Befreiung des Heiligen Grabes, da sind Euch doch alle Sünden vergeben. Allein für die Teilnahme ist Euch das Himmelreich gewiss«, rief er verklärt.
Einen Augenblick starrte ich ihn verdutzt an. Dann brach ich in schallendes Gelächter aus.
»Das Himmelreich für einen alten Maurenschlächter, was?«, grunzte ich.
»Hat der Papst es nicht gesagt?«, rief er entrüstet und bedachte mich mit einem wütenden Blick, als sei ich ein Ketzer.
»Das hat er. Das hat er in der Tat versprochen.«
Aber ich musste immer noch lachen. Es ist seine Unschuld, dachte ich belustigt. Hatte ich nicht auch an so etwas geglaubt? Ach, was tut man nicht für irrsinnige Dinge, wenn man jung und leichtgläubig ist und sich dennoch für schrecklich weise und unverwundbar hält. Die meisten derer, die so begeistert ausgezogen waren, hatten später ihr Blut im Staub Anatoliens, Syriens und Palästinas vergossen. Oft hatte ich ins Antlitz der Erschlagenen gestarrt. Waren ihre Züge verklärt? Hatten sie das Himmelreich erblickt? Nein, sie hatten nicht anders als tote Mauren ausgesehen, und ihre Leichen hatten nicht weniger ekelhaft gestunken.
»Du hast recht, mein Junge«, beruhigte ich ihn. »Ich habe nur noch nichts von diesem Segen verspürt.«
Er wollte alles über das große Heer der Provenzalen wissen und den entbehrungsreichen Weg durch Dalmatien und Makedonien bis zur Hauptstadt der Byzantiner unter Führung des schon über fünfzigjährigen, weißhaarigen Raimons. Fast sechs Monate waren wir unterwegs gewesen. Als ich die Namen der anderen Heere und ihrer Führer erwähnte, die wir in Konstantinopel trafen, da leuchtete sein Gesicht vor Verzückung.
»Und Jerusalem? Ist das Grab des Herrn so prachtvoll, wie man sagt?«
Prachtvoll? Nein, das war es nicht. Nur ein Loch tief in einem Felsen. »Es liegt unter der Kirche des Heiligen Grabes. Schlicht. Sehr schlicht. Gott braucht keinen Pomp. Ein schlichtes Grab, aber man spürt die göttliche Nähe.«
Das schien ihm zu gefallen. Seine Wangen glühten.
»Man sagt, die Dächer Jerusalems seien aus purem Gold.«
»Wer hat dir denn diesen Unsinn erzählt?« Ich musste mich beherrschen, um nicht wieder laut zu lachen, per Dieu! »Aber es ist eine schöne Stadt. Auf mehreren Hügeln. Sie leuchtet weiß aus der Ferne und glitzert in der Sonne wie ein Juwel. Die Häuser sind aus Stein. Hohe Mauern und viele Türme säumen die Stadt. Im Vergleich dazu sind unsere Städte klein und unbedeutend.«
Aimar hörte nicht auf, mich mit Fragen zu bewerfen. Kaum beantwortete ich eine, so hatte er schon die nächste auf den Lippen. Wider Willen brachte er mich zum Reden, bis ich immer mehr erzählte. Mit dem Testament würde es auch heute nichts mehr werden. Obwohl, insgeheim fand ich Gefallen daran, mit dem Jungen die Zeit zu verschwatzen, denn heutzutage kam es nicht mehr allzu häufig vor, dass ich einen dankbaren Zuhörer hatte. Außerdem begann ich, den aufgeweckten Burschen zu mögen.
Und so erzählte ich weiter von Jerusalem. Von Golgatha, vom Ölberg, vom Leidensweg Christi, von den schönen Kirchen. Vom Strom der Pilger aus allen Ländern, von den griechischen Patriarchen mit den langen Bärten, von den Juden und ihrem zerstörten Tempel, von Türken, Ägyptern und Arabern. Auch von Bethlehem berichtete ich und den frommen Mönchen, die dort die christlichen Pilger beherbergen. Und vom Fluss Jordan, in dessen Wasser ich mich ein zweites Mal hatte taufen lassen, obwohl ich darauf verzichtete, mir wie viele andere den Beinamen Jordanus anzueignen.
Inzwischen hatte Maria, die junge Magd, uns einen Korb in den Turm gebracht mit Wurst, Käse und geräuchertem Speck. Zur Krönung gab es für jeden eine dicke Scheibe des frisch gebackenen, noch warmen Brotes und gelbe Butter in einem irdenen Topf. Sie schenkte mir ein fröhliches Lächeln, als ich ihr dankte. Maria hat ein sanftes Gemüt und ist ein hübsches Kind, mit krausen, dunklen Locken und so gut gebaut wie ihre Mutter.
Nach und nach aßen wir alles auf. Das heißt, Aimar verschlang das meiste. Soll er sich hier nur ordentlich Speck auf die Rippen fressen. In der Einsiedelei würde er nicht so viel zu beißen kriegen.
Dann begannen wieder seine Fragen, und so beschrieb ich ihm das Land Outremer, die Basare und die vielen wunderbaren Dinge, die es dort zu kaufen gibt. Ich erzählte von süßen Kuchen, von Datteln, Feigen und anderen herrlichen Früchten, wie Orangen, Zitronen und riesigen Melonen. Von wildschönen Landschaften und reichen Städten. Von den verschleierten, parfümierten Frauen der wohlhabenden Muslime, die in Sänften durch die Gassen getragen werden, von Kamelkarawanen, von Seide und Gewürzen. Doch ich verschwieg auch nicht den Hass zwischen den Volksgruppen, das Gezänk unter den Priestern verschiedener Glaubensrichtungen, die Überfälle auf Pilger und die Raubzüge gegen die Karawanen der Kaufleute. Outremer ist wie eine berauschend süße Frucht. Aber eine mit gefährlich scharfen Stacheln, so dass jeder, der gierig nach ihr greift, sich nur verletzen wird, auf dass sein Blut sich mit dem der vielen anderen Eroberer mischt, die hier seit Tausenden von Jahren um Vorherrschaft gerungen haben.
Der Nachmittag war vergangen, ohne dass wir es gemerkt hatten, bis sich schließlich die Sonne dem Horizont näherte.
»Vielleicht unternimmst du ja eines Tages tatsächlich eine Wallfahrt bis ins Heilige Land«, sagte ich. »Doch nun ist es Zeit für dein Abendmahl. Morgen machen wir weiter.«
Versonnen lächelnd räumte er sein Schreibgerät zusammen, bot mir höflich eine gute Nacht und schickte sich an, die Turmstiege hinabzusteigen.
»Versprich mir eins, mein Sohn«, fügte ich halb im Scherz hinzu. »Solltest du wirklich eines Tages nach Outremer gelangen, so suche nach einem kleinen Dorf von Maroniten in den Hügeln über Tripolis, etwa vier Stunden entfernt.« Ich nannte ihm den Namen des Ortes. »Der Priester dort, der hieß Georgios. Er war noch jung, sprach fürchterliches Latein. Vielleicht lebt er noch. Dann grüß ihn von mir.«
»Ich will es tun, Herr.« Sein Gesicht hatte einen sehnsüchtigen Ausdruck angenommen. »Eines Tages. Bestimmt.«
»Und neben der Kirche ist ein Grab. Dort sollst du Blumen niederlegen.«
»Wer liegt dort begraben?«
»Sie hieß Noura und war einmal mein Weib.«
Erinnerungen überfielen mich und lang totgeglaubte Gefühle. Und so nahm ich kaum zur Kenntnis, wie Aimar mich erstaunt ansah und dann schweigend das Turmgemach verließ, als er merkte, dass ich in Gedanken an einem anderen Ort weilte.
Wie immer, wenn ich an diese Jahre zurückdenke, tauchten Bilder auf, die mich bewegten, ja beunruhigten. Fremdartige Landschaften wechselten mit dem gespenstischen Anblick blutender Leiber und modernder Gebeine. Ich vermeinte die Hörner zu hören, die zur Schlacht riefen, und immer wieder Gesichter, die aus dem Dunkel der Vergangenheit auftauchten und still an mir vorüberzogen. Erschlagene Feinde, trauernde Frauen, gefallene Kameraden, die ich vermisste, Menschen, die ich geliebt hatte.
Und da waren Blicke. Ich konnte mich gut an Blicke erinnern. Das spöttische Grinsen meines Freundes Pilet, als er mir Tage vor seinem Tod noch fröhlich zutrank. Oder Nouras Lächeln und ihre leuchtenden Augen, wenn sie ihr Gewand abstreifte und sich im Schein der Kerzen zu mir legte.
Noura. Mein Gott, so lange ist das her. Zwölf gute Jahre hatten wir miteinander verbracht. Umso betrüblicher, dass ich inzwischen Mühe hatte, mir Einzelheiten ihres Antlitzes ins Gedächtnis zu rufen. Ist das alles, was einem zuletzt bleibt? Nur solche schemenhafte Erinnerungen?
Sie war Armenierin gewesen, Christin wie wir. Trotzdem hatten ihr die johlenden Horden der Plünderer beim Sturm auf Antiochia alles genommen. Allein das nackte Leben hatte ich ihr retten können. Sie entstammte einer wohlhabenden Familie, sprach Griechisch und Latein, war der Schrift kundig und las mir nachts von Alexander oder den Helden Trojas vor. Dabei war ihre Stimme sanft und voller Musik. Ich lauschte oft mehr ihrer Stimme als den Geschichten und erntete einen Stoß in die Rippen, wenn ich wagte, einzuschlafen. Noura bewegte sich mit Anmut, beherrscht und würdevoll. Jedermann liebte und achtete sie, besonders meine Krieger auf der Festung Mons Pelegrinus, denn sie nahm sich für jeden Zeit, pflegte Verletzte und verband ihre Wunden. Dabei wussten nur wenige, dass sich hinter der zur Schau getragenen, heiteren Gelassenheit ein leidenschaftliches Wesen verbarg. Nouras Liebe und Treue zu einem Menschen waren ohne Fehl, aber ihr Zorn, einmal heraufbeschworen, konnte Funken sprühen, dass es eine Pracht war. Ihre innere Glut zeigte sich auch in anderer Weise, denn mit zunehmenden Jahren legte sie ihre mädchenhafte Scheu ab und wurde immer begieriger, mit mir alle Freuden der leiblichen Liebe auszukosten.
Die Wohltat täglichen Badens hatte sie mich gelehrt, wie es in den heißen Ländern üblich ist, und viele andere Dinge mehr. Ich lehnte mich zurück in meinem Stuhl, schloss die Lider und wähnte mich zusammen mit ihr im warmen, wohlriechenden Wasser, spürte ihre sanften Hände über meinen Leib gleiten und Lippen, die mich verspielt an geheimen Stellen liebkosten, bis wir nicht mehr warten konnten. Und dann ihre duftende Haut, noch viel glatter und betörender als die Seide der Kissen, schwingende Brüste über mir, ein halb geöffneter, stöhnender Mund, der vor Verzückung starre Blick und ihr heißes Fleisch, das sich mit einer fast schmerzhaften Hingabe an mir ergötzte.
Jes Maria!
Ich sprang auf und trat ans Turmfenster, um tief durchzuatmen und meine unzüchtigen Wallungen zu beherrschen. Dann musste ich grinsen. Das war zu viel für einen armen, alten Mann ohne Weib zur Hand, um seinen Hunger zu stillen. Über die abklingende Erregung legte sich nun die süße Trauer um längst vergangene Tage, wie die sanften Abendschatten dort draußen, die von den Bergen herunterkrochen und sich über die Landschaft breiteten. Manchmal kam es mir vor, als würde die Einsamkeit mit den Jahren immer erdrückender.
Wohlan, ich war entschlossen!
Aimar mochte jung sein, doch ich würde Jacobus und seiner Wahl vertrauen. Der Mönch sollte alles von Bedeutung erfahren. Auch über Noura. Damit mein Sohn Raol eines Tages verstünde, warum ich, anstatt zu ihm und seiner Mutter heimzukehren, so lange in Outremer geblieben war. Nicht, dass es wirklich eine Entschuldigung dafür gab, nur, diese Dinge hatte ich ihm damals nicht sagen können. Nun war es Zeit, reinen Tisch zu machen. Und wie soll ein Sohn seinen Vater verstehen, ohne etwas von dessen Frauen zu erfahren.
Vor allem aber galt es, dem Mönch die Einzelheiten über l’eretat tolosana, dem geheimen Erbe Tolosas, anzuvertrauen. Wie ich zuerst von dem Testament erfahren habe, von dem Macht, aber auch tödliche Gefahr ausgeht. Fast hätte es unser aller Leben, unser Dorf und unsere familia in einem Strudel der Gewalt verschlungen und zerstört. Aimar würde sich das alles gut merken müssen, um es an Raol und dessen Söhne weiterzureichen, was auch immer sie selbst später damit anfangen mochten.
Plötzlich sah ich wieder die Mörderfratze von Ricard de Peyregoux vor mir, dem Schänder und Totschläger. In Outremer war es gewesen, vor einundzwanzig Jahren, als ich ihm zuerst begegnete. Ja, der Faden der Erzählung sollte mit diesem vermaledeiten Raubzug beginnen, als wir weit in Feindes Land einer reichen Karawane nachjagten.
In Outremer
Im Monat März, einundzwanzig Jahre früher, im elften Jahr nach der Befreiung des Heiligen Grabes zu Jerusalem, Anno Domini 1110
Hinterhalt im Libanon
Maria Annunziata, die Verkündigung des Herrn
Sexta Feria, vormittags, 25. Tag des Monats März
Wir waren müde und in gedrückter Stimmung. Mehr als eine Woche hatten wir im Sattel verbracht und doch nichts vorzuweisen. Die Karawane war entkommen, die Männer darüber enttäuscht und verärgert. Vielleicht waren wir deshalb unvorsichtig und dachten weder an Feind noch Gefahr.
Selbst die Pferde bewegten sich erschöpft und lustlos auf dem steinigen Pfad von den verschneiten Höhen des Libanon hinab. Ihr Atem dampfte in der eisigen Bergluft. Außer dem Klappern der Hufe und dem leisen Klirren des Zaumzeugs war es sehr still hier oben im Gebirge. Einige der Männer trugen gefütterte Handschuhe oder hatten sich den Mantel eng um die Schultern und halb über das Gesicht gezogen. Mein junger, syrischer Knecht Alexis trug die Stiefel mit Stroh ausgestopft und blies schlecht gelaunt auf seine starren Finger.
Unser Trupp bestand aus hundert bewaffneten Reitern. Dazu ein Dutzend Reitknechte auf Ersatzpferden sowie zwanzig Maultiere mit Mundvorrat und Ausrüstung. Keine große Streitmacht, aber ausgesuchte Kerle der Besatzung von Mons Pelegrinus, der Burg unseres Herrn vor Tripolis. Wir befanden uns auf dem Rückweg, in unsicherem Gebiet, weshalb die Reiter volle Kampfausrüstung trugen. Kettenpanzer, langer Normannenschild, Helm, Schwert und Lanze.
Es war schon Ende März, und heute feierten wir Mariä Verkündigung und Beginn des Frühlings. Aus diesem Grund hatte Kyriacos, unser einheimischer Führer, vorgeschlagen, den kürzeren Weg zurück durch die Berge zu nehmen. Eine gewagte Entscheidung, denn trotz der Jahreszeit lag tiefer Schnee in den Pässen.
Nebelfetzen behinderten die Sicht. An schwierigen Stellen saßen wir ab und führten die Pferde am Zaum. Oft war die verschneite Straße schlecht zu erkennen, und einmal mussten wir uns mit Hilfe unserer Schilde den Weg durch Schneewehen graben. Später rutschte eines der Packtiere ab und riss ein zweites in einer Wolke aus Schnee und Geröll in die Tiefe. Beide Tiere lagen verletzt und jämmerlich schreiend auf den scharfkantigen Felsen, eines mit gebrochenem Rückgrat. Der Anblick verschlug uns den Atem, als sähe man sich selbst dort unten liegen.
Ich schickte Knechte mit Seilen hinunter, um das Wichtigste an Ausrüstung zu bergen. Die Schreie der Tiere dauerten uns, und so schnitten die Männer ihnen die Kehle durch. Ihr Blut spritzte in zuckenden Fontänen und hinterließ dampfende, grellrot leuchtende Flecken im Schnee. Ich musste lange gebannt darauf starren, und später, wenn ich an diesen Tag zurückdachte, war mir das Blut im Schnee immer wie ein dunkles Omen erschienen, das ich damals nicht zu deuten gewusst hatte.
Dann waren die Männer mühevoll mit ihrer Last auf dem Rücken zu uns heraufgeklettert. Halb stiegen sie, halb zerrten wir sie an den Seilen hoch. Durchgefroren und übel gelaunt setzte sich unsere Kolonne vorsichtig wieder in Bewegung.
Graf Bertran fluchte über die Kälte, doch er wies die Pferdedecke zurück, die ihm sein Schildträger umhängen wollte. Palmen und Wüsten habe er erwartet, knurrte er missmutig, während er sich die Hände gegen die Oberarme schlug, aber nicht, dass einem die Eingeweide einfrören. Sein Atem dampfte in der eisigen Luft. Dabei sah er mich an, als sei ich für das Wetter zuständig.
Bertran war erst seit Mitte letzten Jahres in Outremer. So nannten wir das für die Christenheit gewonnene Land entlang der levantinischen Küste. Nun war er Heermeister und dominus über die Eroberungen seines Vaters und bereits der dritte Kriegsherr, unter dem ich hier zu dienen hatte. Vierzehn Jahre war es her, seit ich als Grünschnabel ausgezogen war, und elf Jahre seit der Befreiung Jerusalems. Inzwischen war ich an das Leben hier gewöhnt, aber für Bertran, frisch aus der Heimat, musste alles noch sehr befremdlich wirken.
Meine Gedanken wanderten zu jenen Gegenden am anderen Ende der Welt, die wir Provenzalen Heimat nennen. Grüne Wälder, silberklare Bäche in den Wiesen. Auf den Gebirgsspitzen läge jetzt noch Schnee, aber die Bauern würden schon die Pflüge ausbessern und das Saatgut prüfen. Und ich sah die Burg meiner Familie vor mir, im Licht der untergehenden Sonne, so wie ich sie in Erinnerung hatte. Eigentlich hätte ich schon vor langer Zeit heimkehren sollen, wie andere auch. Aber Gott hatte es anders beschieden, und inzwischen hatte ich Familie in Outremer und war schon halb verwurzelt. Ich sage halb, denn als Fremder in einem feindlichen Land … Aber darüber wollte ich nicht grübeln.
Was die Seele zusammenhält, besonders in der Fremde, ist die Gemeinschaft der alten Gefährten, die Verbundenheit von Männern, auf die man sich blind verlassen kann. Unter den Reitern war mein Kriegskamerad Guilhem lo Galinier, so genannt, weil er, schlimmer als ein Gockel seinen Hühnern, jedem losem Weibsbild nachsetzte, gleichwohl ob hübsch oder hässlich. Im Schlachtgetümmel gab es keinen Besseren, um einem den Rücken zu decken, außer vielleicht Hamid, mein arabischer Freund, der sich wie immer an meiner Seite befand. Er hatte den Umhang weit über das Kinn gezogen, die Gesichtshaut war grau und nicht von seiner üblichen mattbraunen Farbe.
»Wir sehen nicht wie Ritter aus, eher wie vermummte Derwische«, lachte ich, bekam jedoch nur ein mürrisches Knurren zur Antwort.
Hamid war Muslim, schien seinen Glauben aber eher leicht zu tragen, denn ich sah ihn nur gelegentlich beten. Vielleicht weil er als entflohener Sklave keine Gnade von seinen muslimischen Brüdern zu erwarten hatte. Ursprünglich war er aus Damaskus, doch das Schicksal hatte aus dem Sohn einer reichen Kaufmannsfamilie einen gebrandmarkten Galeerensklaven gemacht, eine Geschichte, über die er nicht gerne sprach. Tiefer als alle Narben auf seinem Rücken war jedoch die Wunde in seinem Herzen. Neben den zwiespältigen Gefühlen für die ummah, die Gemeinschaft der Gläubigen, die ihn verstoßen hatte, verband Hamid noch weniger mit den seldschukischen Eroberern seiner Heimatstadt. Unsere Wege hatten sich gekreuzt, als ich vor Jahren Gelegenheit hatte, ihn vor plünderndem Pöbel zu retten. Seitdem waren wir unzertrennlich. Er hatte sich der militia christi angeschlossen und war einer ihrer besten Kämpfer geworden, was ihm Achtung und Ansehen unter den christlichen Mitstreitern eingebracht hatte.
Die dunkle Haut und die kräftigen weißen Zähne hatte er seiner nubischen Mutter zu verdanken, wie er behauptete. Die hatte sein Vater auf einem Sklavenmarkt in Ägypten erstanden, und der Alte war ihr so zugetan gewesen, dass er sie zur zweiten Frau erhoben hatte. Vom Vater stammten vermutlich die scharfe Nase, die schwarzen Augenbrauen und der durchdringende Blick, der Hamid manchmal einschüchternd wirken ließ. Er trug die gleiche Ausrüstung wie jeder unserer Reiter. Einzig ein um den Helm geschlungenes Beduinentuch und die Abwesenheit des Kreuzes auf dem Mantel unterschieden ihn von den anderen. Diese Eigenart ließ er sich nicht nehmen.
Hamid redete nicht viel. Dafür war er ein umso besserer Zuhörer und Beobachter. Nichts entging ihm, und wenn er sprach, dann konnte man sicher sein, dass er jedes Wort sorgfältig erwogen hatte. Ich schätzte seine Treue wie seinen Rat, auch wenn er manchmal den Finger tiefer in die Wunde legte, als einem lieb war.
»Ein Beutezug ohne verdammte Beute«, knurrte ich missmutig.
»Es gibt immer ein nächstes Mal.« Hamid zuckte gleichmütig mit den Schultern. »Geduld ist der Schlüssel zur Freude, wie der Prophet sagt.«
Schon vor Wochen hatte Bertran von einem Beutezug geredet, den er hatte unternehmen wollen. Gegenwärtig sah es nicht nach größeren Feindeshandlungen aus, aber Überfälle auf beiden Seiten waren an der Tagesordnung. Oft wagten sich unsere Spähtrupps bis weit ins Land der Muslime, um den Feind zu beobachten und bei Gelegenheit zu plündern, Pferde oder Vieh zu stehlen. Manchmal ging ihnen ein hochgestellter Muslim ins Netz, den man gegen gutes Gold auslösen konnte. Trotz der Gefahren solcher Streifzüge war es nicht schwer, Freiwillige zu finden.
Vor etwa zehn Tagen hatten Spione von einer großen Karawane berichtet, die angeblich von Norden her auf dem alten Handelsweg in Richtung Damaskus ziehen sollte. Von mehr als zweihundert Kamelen war die Rede gewesen, von Ballen von Seide, Säcken von Gewürzen und Truhen voller Gold, Steuereinnahmen für Toghtekin, dem türkischen Herrscher von Homs und Damaskus. Sicher hatten die Späher übertrieben, aber Bertran war immer aufgeregter geworden, je mehr er davon hörte, und entschlossen, diese fette Gans eigenhändig zu rupfen.
Als castelan der Festung Pilgersberg hatte ich den Trupp eilig zusammengestellt. Hauptsächlich hartgesottene Kriegsknechte und Glücksritter aus allen provenzalischen Grafschaften. Wir konnten nicht wählerisch sein. Wer sich in Outremer als waffenfähig und willig zeigte, den nahmen wir in unsere Reihen auf.
Mit von der Partie waren Ricard de Peyregoux, ein junger Vetter Bertrans. Der schien mir ein hochnäsiger Dummkopf zu sein, den ich am liebsten daheim gelassen hätte, und Roger d’Asterac, ein Ritter aus der Mark Provence, der sich Bertran vor kurzem angeschlossen hatte. Und natürlich Kyriacos, der einheimische Führer unserer Schar, ein griechischer Christ aus Nordsyrien, irgendwo aus Antiochia oder Tortosa, soweit ich wusste. Er war verlässlich und diente uns schon seit Jahren. Ein kleiner, älterer Mann mit flinken, klugen Augen, was ihm einen etwas verschlagenen Ausdruck verlieh. Aber nie hatte er uns Anlass gegeben, ihm nicht zu vertrauen. Schließlich betete auch er zu unserem Heiland, wenn auch nach Art der Griechen. Als Händler kannte er sich überall in der Gegend gut aus, und mit dem Gold des Grafen unterhielt er ein Netz von Spionen in Feindesland.
Als wir vor neun Tagen aufgebrochen waren, hatte Kyriacos uns veranlasst, zuerst nordöstlich in Richtung Homs zu ziehen, um uns an der alten Handelsstraße auf die Lauer zu legen. Zwei Tage lang hatten wir uns auf einem sandigen Hügel im Gestrüpp versteckt, und unser Zeitvertreib bestand darin, Hornvipern und Skorpione zu jagen. Nachts froren wir erbärmlich, denn mit einem Feuer wollten wir uns nicht verraten. Das Essen bestand aus klebrigem Hirsebrei, getrockneten Feigen und übelriechendem Ziegenkäse. Noura war zornig gewesen, als sie von unserem Raubzug erfahren hatte. Unsere verdammte Habgier würde nur wieder den Frieden gefährden, hatte sie geschrien, und ihre Augen hatten Blitze geschleudert. Nun tat es mir leid, dass wir im Zorn geschieden waren. Statt in ihren warmen Armen zu liegen, fror ich auf diesem staubigen Hügel.
Und weit und breit keine Karawane.
Dann war Kyriacos selbst nach Homs geritten, um Näheres zu erfahren. Wir hätten die Karawane knapp verfehlt, sagte er bei seiner Rückkehr. Sie sei schon in Richtung Damaskus weitergezogen, aber wir könnten sie noch einholen. Er habe auch erfahren, dass nur eine leichte Eskorte Toghtekins Gold bewache. Also waren wir die ganze Nacht und den nächsten Tag hindurch durch die Wüste geritten, bis zu den Vororten von Damaskus. Die Bauern auf den Feldern dieser riesigen Oase liefen in Schrecken davon, als sie uns gewahrten. Aber eine Karawane war auch hier nicht zu entdecken gewesen.