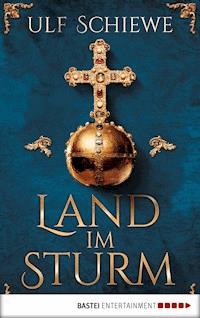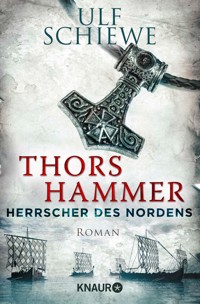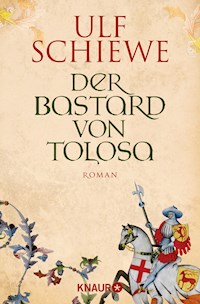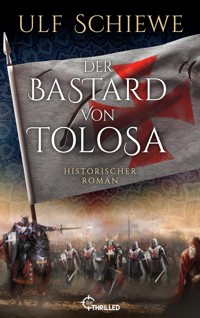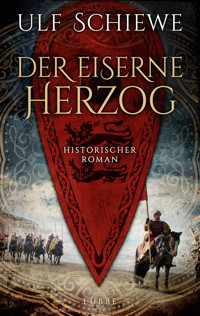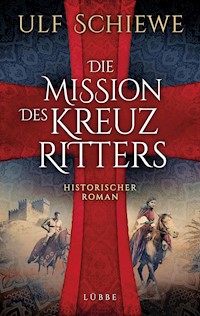6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Der mächtige Graf von Toulouse will die Erbin Ermengarda zur Ehe zwingen und so das reiche Narbonne in seine Gewalt bringen. Doch die blutjunge Waise widersetzt sich ihm und dem Ehrgeiz ihrer Stiefmutter. Fest entschlossen, ihre Freiheit und die der Grafschaft zu verteidigen, flieht sie am Tag der geplanten Hochzeit ins Unbekannte. Niemand steht ihr zur Seite – außer Arnaut und Felipe, die ihr Treue bis in den Tod geschworen haben. Die Flucht gelingt, doch ihre Verfolger lassen nicht lange auf sich warten. Trotz aller Angst und Not wächst die -Liebe zwischen Ermengarda und Arnaut, aber auch die erbitterte -Rivalität zwischen den beiden jungen Männern … Die Comtessa von Ulf Schiewe: als eBook erhältlich!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 733
Veröffentlichungsjahr: 2011
Ähnliche
Ulf Schiewe
Die Comtessa
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Der mächtige Graf von Toulouse will die Erbin Ermengarda zur Ehe zwingen und so das reiche Narbonne in seine Gewalt bringen. Doch die blutjunge Waise widersetzt sich ihm und dem Ehrgeiz ihrer Stiefmutter. Fest entschlossen, ihre Freiheit und die der Grafschaft zu verteidigen, flieht sie am Tag der geplanten Hochzeit ins Unbekannte. Niemand steht ihr zur Seite – außer Arnaut und Felipe, die ihr Treue bis in den Tod geschworen haben. Die Flucht gelingt, doch ihre Verfolger lassen nicht lange auf sich warten. Trotz aller Angst und Not wächst die Liebe zwischen Ermengarda und Arnaut, aber auch die erbitterte Rivalität zwischen den beiden jungen Männern …
Inhaltsübersicht
Für den Abdruck der [...]
Ermessenda la Bela
Aufruhr in Narbona
Die Vescomtessa
Der Sohn des Statthalters
Ränkespiele
La Belas Zorn
Stunde der Entscheidung
Arnaut
Flucht
Der dunkle Fluss
Das Kloster zur kühlen Quelle
Der Ritt nach Süden
Castel Nou dels Aspres
La Tramontanha
Die guten Frauen von Serrabona
Ermengarda
Das Zerwürfnis
Raols Plan
Sturm auf Narbona
Die Last auf jungen Schultern
Unversöhnlich
Der Rat der Fürsten
Liebe aus der Ferne
Anhang
Anmerkungen des Autors
Glossar
Personen
Historische Personen
Weitere urkundlich erwähnte Personen
Erfundene Personen
Danksagung
Für den Abdruck der Zitate aus den »Amores« von Ovid danken wir dem Philip Reclam jun. Verlag GmbH, Ditzingen
Für meine Kinder
und
für alle jungen Menschen,
die den Mut haben,
für etwas zu kämpfen.
Ermessenda la Bela
»Der Leib kann ohne Herz nicht leben, und wenn er es doch tut, so ist das ein Wunder, das noch keiner sah.«
Chrétien de Troyes (*1135, †1183)
Aufruhr in Narbona
Oktober, Anno Domini 1142
Nach dreitägiger Reise näherten sich zwei Reiter der alten Stadt Narbona. Es waren junge Männer, noch ungezeichnet vom Leben. Neugierig und voller Tatendrang waren sie gekommen, das Abenteuer zu finden.
Arnaut ritt einen Wallach und führte sein Schlachtross, einen lebhaften Hengst, an einem Seil. Auf einer langbeinigen Stute folgte Severin, sein Schildträger, der ein Packtier hinter sich herzog. Sie waren hungrig und sattelmüde, doch beim Anblick der fernen Wehrtürme und Kirchen füllten sich ihre Herzen mit erwartungsvollem Hochgefühl, und so gaben sie den Tieren noch einmal die Sporen.
Der Weg führte durch wohlbestellte Felder und bewässerte Gärten, wo Bauern sich mühten, Herbstgemüse und das letzte Obst zu ernten, denn die Ebene vor den Mauern war Narbonas Speisekammer.
Am Stadttor verstellte ihnen ein mürrischer Wachposten den Weg. Eine Speerspitze funkelte gefährlich nahe vor Arnauts Brust.
»Stehen geblieben, Knappe!«
Der Wallach scheute und tänzelte erschrocken zur Seite, so dass Arnaut sich am Sattelknauf festhalten musste. Hatte der Mann ihn Knappe genannt? Das war eine Beleidigung, auch wenn sie beide erst achtzehn Jahre zählten. Unbewusst fuhr seine Hand an den Schwertgriff. Doch sofort trat der Wachmann näher. Fast schon berührte die Speerspitze Arnauts Kettenpanzer.
»Ganz ruhig, Jungs! Keine Waffen und runter von den Gäulen! Hände, wo ich sie sehen kann.«
Mit dem Speerschaft fest in den Fäusten funkelte der Kerl ihn angriffslustig an. Auch wenn sein Bart grau war, sah er doch wie ein fähiger Fußsoldat aus, ein pezo, wie sie spöttisch im Volksmund hießen.
Als jetzt zwei weitere Söldner hinzutraten, bezwang Arnaut seinen Unmut und hob beruhigend die Hände. Sinnlos, mit der Torwache zu streiten.
Die Speerwimpel der pezos trugen nicht das Wappen der Stadt, sondern die goldenen Umrisse eines zwölfeckigen Kreuzes auf rotem Grund, das Wappen von Tolosa. Aber es war allgemein bekannt, dass seit drei Jahren Graf Alfons Jordan über das Schicksal von Narbona bestimmte.
Langsam stieg Arnaut vom Pferd. »Begrüßt man so einen Edelmann, der die Stadt besucht?«, fragte er in herablassendem Ton.
»Nichts für ungut, Cavalier«, hörte er eine Stimme hinter sich. »Die Männer tun nur ihre Pflicht.«
Die Sonne stand schon tief, und Arnaut musste die Augen mit der Hand abschirmen, um den Mann, der sich nun näherte, besser sehen zu können. Unverkennbar ein Ritter von adeliger Geburt, obwohl nicht viel älter als sie selbst. Er war gut, wenn auch etwas nachlässig gekleidet, Schwert an der Seite, auf dessen Knauf er eine Hand stützte. Mit einer flüchtigen Kopfbewegung bedeutete er den Wachen, sich zurückzuziehen.
»In letzter Zeit treibt sich hier viel Lumpenpack herum«, sagte er.
»Wir trafen eine Menge Pilgersleute.«
Der Ritter nickte. »Die meisten sind nach Compostela unterwegs. Hier verweilen sie, um am Schrein von Sant Paul zu beten. Leider versteckt sich oft Gesindel darunter. Deshalb überprüfen wir alle Fremden an den Toren.«
»Ich bin Arnaut de Montalban.« Er deutete auf Severin. »Und mich begleitet mein Schildträger. Wir stammen aus der Corbieras, und meine Familie sind Lehnsleute der Grafen von Tolosa.«
Sein Gegenüber warf einen forschenden Blick über Ausrüstung und Pferde. Er trat an Arnauts prächtigen Hengst heran.
»Großartiger Bursche. Abgerichtet für die Schlacht?«
»Natürlich«, erwiderte Arnaut nicht ohne Stolz. »Wir haben eine Zucht. Araberblut. Mein Großvater selbst hat die ersten Tiere aus dem Heiligen Land mitgebracht.«
»Araber? Ja, man sieht es.« Er strich dem Pferd anerkennend über den Hals, zog aber schnell die Hand zurück, als der Hengst die Ohren zurücklegte, den Kopf hochriss und warnend die Zähne bleckte.
»Ho ho! Lässt wohl nicht mit sich spaßen, was?« Er zog sich einen Schritt zurück.
»Er mag keine Fremden.«
»Solange er mir nicht die Finger abbeißt«, lachte der Mann. Prüfend betrachtete er das mit Lanzen und Satteltaschen beladene Maultier.
»Irgendwelche Handelswaren?«
»Sehen wir aus wie Kaufleute?«
»Nein, das gerade nicht. Und Ihr seid gut gerüstet, wie ich sehe. Was wollt Ihr in Narbona?«
»Ich hatte gehofft, Coms Alfons meine Dienste anzubieten.«
»Soso! Ein junger Heißsporn vom Lande, was?«
Sein entspanntes, selbstsicheres Auftreten beeindruckte Arnaut. Neben ihm kam er sich wie ein Bauerntölpel vor. Dass er selbst andere durch seine Körpergröße manchmal einschüchterte, war ihm nicht bewusst.
Der junge Edelmann berührte flüchtig seine Schulter. »Seid herzlich willkommen. Verstärkung können wir allemal gebrauchen, denn seit Wochen liegt ein Geruch von Krieg in der Luft.«
»Krieg?«
»Wenn Fürsten streiten, ist unsereins gefordert, oder?«
Er lachte, als sei es das Natürlichste von der Welt, sich ins Gefecht zu werfen. Arnaut mochte nicht weiter fragen, wollte er doch seine Unkenntnis der politischen Lage nicht offenbaren.
»Wo finde ich Coms Alfons?«
»Der ist zurzeit abwesend, aber meldet Euch bei seinem Heermeister. Am besten geht Ihr zum Palast des Grafen und fragt nach dem secretarius. Hier durchs Tor und immer geradeaus bis zum Marktplatz. Der liegt noch vor der Brücke über die Aude. Der Palast ist das größte Haus zu rechter Hand.«
Arnaut dankte ihm und schickte sich an, wieder aufzusitzen.
»Eine Warnung. In der Stadt wird nur im Schritt geritten, sonst setzt es eine empfindliche Buße. Am besten nehmt Ihr Eure Gäule am Zügel und geht zu Fuß.«
»Sonst noch irgendwelche Regeln?« Arnaut konnte einen gereizten Ton nicht unterdrücken.
Der Ritter zwinkerte ihm belustigt zu. »Keine Raufereien und lasst vor allem die Waffen stecken, wenn Ihr nicht im Verlies landen wollt. Hier geht es gesittet zu. Ansonsten wünsche ich viel Glück in unserem schönen Narbona. Wir sehen uns gewiss bald wieder.«
»Wie ist Euer Name?«
»Giraud de Trias, zu Diensten.« Mit einem übermütigen Grinsen verbeugte sich der junge Edelmann und wies ihnen mit schwungvoller Geste den Weg ins Herz der großen Stadt, hinein in die hundert engen und verwinkelten Gassen.
Narbona lag an der Aude, einige Meilen bevor sich der Fluss in einer ausgedehnten, lagunenartigen Meeresbucht verlor. Dieser Lage und dem Seehafen verdankte die Stadt seit jeher ihren Reichtum.
Die Aude teilte Narbona in zwei Hälften, einzig verbunden durch eine mächtige, noch aus Römerzeiten stammende Steinbrücke. Am Nordufer befand sich La Ciutat, der alte römische Stadtkern mit Forum und Capitol an seinem Nordende, in Flussnähe der Bischofssitz mit Palast und Kathedrale, gegenüber davon der palatz vescomtal, Herrschaftshaus der Vizegrafen von Narbona.
Die Südstadt war neueren Datums und nannte sich lo Borc de Sant Paul Serge, nach der Basilika, um die zuerst das Kloster und nach und nach der gesamte Stadtteil entstanden war. Hier lag der Sarkophag des Heiligen, Wallfahrtsziel der Pilger.
Beide Stadthälften waren von hohen Mauern umgeben, auf denen sich in regelmäßigen Abständen mächtige Wehrtürme erhoben, ein jeder in der Hand eines der adeligen Geschlechter, die von alters her für die Verteidigung der Stadt zu sorgen hatten. In neueren Zeiten stand ihnen auch eine von den reichen Kaufleuten unterhaltene militia urbana zur Seite, eine Tatsache, die nicht allen Stadtadeligen schmeckte, denn es erinnerte sie an den wachsenden Einfluss des lästigen Bürgertums.
Über die Brücke verlief die Via Domitia, Roms alte Heer-straße, auf ihrem langen Weg von Italien bis Spanien. Von hier aus begann auch die Via Aquitania nach Tolosa und Bordeu bis an die Küsten des westlichen Ozeans. Wenn Fluss und Straßen die Adern waren, in denen das Blut Narbonas floss, so waren Hafen und Märkte das schlagende Herz der gedeihenden Macht von Handelshäusern und Kaufmanns-familien.
Arnaut und Severin betraten lo Borc mit Staunen.
Welch ein Unterschied zu den einfachen Hütten und Katen in den Dörfern der Corbieras. Noch nie hatten sie je so viele Häuser auf einem Haufen gesehen. Dichtgedrängt, mit übereinandergetürmten Stockwerken, lehnten und klebten sie aneinander und ließen kaum mehr als eine Schulterbreite für so manche Seitengasse übrig. Umso erstaunlicher, dass es, zwischen Stadthäusern eingepfercht, immer noch den einen oder anderen Bauernhof gab, so dass sich Blöken und Grunzen unter das Stimmengewirr der Menschen mischten.
Die Pferde am Zügel führend, folgten sie der gepflasterten Via Domitia, die als einzige Straße breit genug für Ochsenkarren war. Alle paar Schritte hielten sie inne, um einen Torbogen oder die verzierte Vorderfront eines Hauses zu bewundern. Neugierig blickten sie in offene Werkstätten und konnten kaum die Augen von den Auslagen der Händler unter den Bogengängen losreißen. Hier und da eine Öffnung zwischen den Häusern, die einen Blick in dunkle Gassen gewährte oder auf einen engen Platz, um den sich Schankstuben oder Stände für Fisch oder Gemüse drängten.
»Alles im Überfluss vorhanden«, bemerkte Severin mit großen Augen. »Wie bei uns nur zu Festtagen.«
Ein paar junge Mägde kreuzten ihren Weg und warfen ihnen neugierige Blicke zu. Severin sah sich nach ihnen um und fuhr sich dabei mit einer Hand über das dunkelblonde Haar, um es zu glätten. Vergebliche Müh, denn es war nicht zu bändigen und stand wie immer sperrig in alle Richtungen ab.
Sie hielten einen Augenblick an, um den Eselskarren eines Bauern durchzulassen, der mit übelriechenden Kübeln beladen war, verfolgt von einem Schwarm grünblau glänzender Schmeißfliegen. Sorgfältig gesammelte Küchenabfälle für die Schweine und Fäkalien für das Feld, denn was des Städters Last, ist des Landmanns Nutzen.
Überhaupt waren sie unvorbereitet für all die Gerüche, die die Sinne bestürmten. Und die stammten nicht allein von Hundekot, Urin oder dem Pferdemist, über den sie stiegen. Je nach Stadtteil und dem dort ansässigen Handwerk wechselten sich der Gestank der Gerberwerkstätten mit dem Verwesungsgeruch von Schlachtabfällen und den verführerischen Düften aus Schenken und Backstuben ab.
Je mehr sie sich dem Stadtkern näherten, desto belebter wurde die Straße, wobei die meisten Leute ebenfalls dem großen Marktplatz zuzustreben schienen.
Als ein Junge sich hastig an ihnen vorbeidrängte, hielt Arnaut ihn am Arm fest. »He, mon gartz, wohin laufen alle so eilig?«
Der Kleine wollte sich losreißen, aber nach einem flinken Blick über die Ausrüstung und die wertvollen Reittiere der beiden flog ein schlaues Grinsen über sein Gesicht.
»Ihr seid nicht von hier, feiner Herr, hab ich recht?«
»Woher willst du das wissen, Bengel?«, lachte Arnaut. »Steht es mir etwa auf der Stirn geschrieben? Und wozu das Gedränge der Leute?«
»Das weiß doch alle Welt. Heute ist die Heiligenprozession, und der Erzbischof selbst trägt die Reliquien durch die Straßen.«
»Welcher Heilige?«
»Sant Paul Serge.«
»Sind deshalb so viele Pilger und Bettler in der Stadt?«
»Glaub schon.« Der Junge zuckte gleichmütig mit den Achseln.
»Wir wollen zum Palast des Grafen Alfons.«
»Der ist nicht weit, Senher. Ich kann Euch den Weg weisen …«, er setzte ein hoffnungsvolles Grinsen auf, »… wenn Ihr mir etwas dafür gebt.«
Bezahlen? Für einen Hinweis? Arnaut machte ein verdutztes Gesicht. Waren das die Sitten in der Stadt?
»Wie alt bist du?«
»Weiß nicht. Zwölf, glaube ich.«
Nicht sehr groß für zwölf, dachte Arnaut. Weiße Zähne in einem sonnengebräunten Gesicht und darüber ein zerzauster, schwarzer Haarschopf, nicht sehr sauber, wie es schien. Am besten gefielen ihm das freche Lächeln und die aufgeweckten Augen.
»Und wie heißt du?«
»Jori, Senher.«
Arnaut zwinkerte seinem Schildträger zu, als sei ihm gerade ein guter Einfall gekommen. Severin, ein junger Mann von einfachen, gradlinigen Grundsätzen, hatte ein ausgeprägtes Misstrauen gegenüber Leuten, die nicht ihren ordentlichen Platz im Leben ausfüllten. Für Bettelpack und arbeitsscheue Herumtreiber hatte er wenig Verständnis.
»Was willst du mit dem zerlumpten Burschen?«
Jori zog ein finsteres Gesicht. »Nicht jeder wird als großer Herr geboren«, erwiderte er frech.
Zerlumpt war der Junge tatsächlich, ziemlich ausgemergelt dazu, und er lief barfuß herum trotz der Jahreszeit. Die Oktobernächte waren schon empfindlich kalt, wie Arnaut wusste. Sie hatten die letzte Nacht im Freien verbracht und unter ihren Pferdedecken gefroren.
»Ich wette, du kennst dich hier überall aus.«
»Das will ich meinen.« Im Gesicht des Jungen leuchtete die Hoffnung, an den beiden Fremden doch noch etwas zu verdienen. »Ich kann Euch alles zeigen und erklären. Wollt Ihr die Kathedrale sehen?«
»Hör zu, Kleiner«, sagte Arnaut. »In den nächsten Tagen zeigst du uns die Stadt, und dafür teilen wir unser Essen mit dir. Und morgen besorgen wir dir ein paar vernünftige Schuhe. Was sagst du dazu?«
Jori runzelte die Stirn. »Ein denier wäre mir lieber.«
»Einen ganzen Silberpfennig?«, schnaubte Severin entrüstet.
Aber Arnaut achtete nicht auf ihn. »Also gut. Ein halber denier obendrein. Aber erst am Schluss und nur, wenn wir mit dir zufrieden sind.«
Jori grinste über beide Ohren. »Ihr werdet sehr zufrieden sein, mon Cavalier«, rief er strahlend. »Kommt, ich führe Euch zum Palast des Grafen.«
Auf dem Marktplatz fanden sie eine überwältigende Menschenmenge vor. Da waren Handwerker in rauhen Arbeitskleidern, Bürgerinnen mit Kindern an der Hand, Pilgersleute, die ihre ganze Habe auf dem Rücken trugen, und Bauern aus der Umgebung, die, nach den leeren Kiepen zu urteilen, ihre herbstlichen Feldfrüchte an den Mann gebracht hatten. Händler waren aus den Läden getreten, und ein paar Soldaten der städtischen militia lungerten untätig an einer Ecke. Ein Wasserträger zwängte sich durch die Leute, Verkäufer frommer Andenken priesen ihre Ware an, und am anderen Ende des Platzes bemühte sich eine Gauklertruppe, die Leute zu unterhalten.
Zum Glück hatte man die Marktstände weggeräumt, denn immer noch strömten sie aus allen Gassen hinzu. In der Mitte des Platzes, wo das Meer der Köpfe am dichtesten wogte, versuchte eine Schar Tolosaner Soldaten, etwas Platz zu schaffen. Es war so laut, dass man kaum sein eigenes Wort verstehen konnte.
An ein Durchkommen mit den Pferden war nicht zu denken. Das Gedränge und der Lärm machten die Tiere scheu. Bald waren Arnaut und Severin von der Masse so eingekeilt, dass sie weder vor- noch rückwärts konnten. Dicht an eines der Häuser gedrängt, blieb ihnen nichts weiter übrig, als die Tiere ruhig zu halten und darauf zu warten, dass die Prozession bald vorüberziehen würde.
»Das reinste Volksfest«, rief Arnaut dem Jungen ins Ohr, um sich verständlich zu machen.
»Hier wird die Andacht abgehalten, bevor sie weiter zur Basilika ziehen. Viele lassen sich hier segnen«, tönte der Kleine zurück.
»Deable. Da hätten wir erst morgen kommen sollen.«
Jori zuckte mit den Schultern. »Der Heilige bringt Euch Gottes Segen, Herr. Ein guter Anfang für Eure Tage in Narbona. Vielleicht sogar Ruhm und Ehren.« Er grinste verwegen.
Arnaut schüttelte den Kopf. Frecher Bengel!
Der hüpfte derweil von einem Bein aufs andere und versuchte, über die Köpfe der Menge hinweg etwas zu erkennen. »Sie müssten bald über die Brücke kommen.«
»He, du Wicht«, knurrte ein Handwerksmann, der noch seine Lederschürze trug. »Hör auf, herumzuhopsen. Du trittst mir auf die Zehen!«
»Hier, steig auf den Wallach.«
Arnaut half Jori in den Kampfsattel. Da saß er seitwärts auf dem Ross und verschränkte zufrieden die Arme vor der Brust. »Jetzt können sie kommen«, krähte er vergnügt. »Ich hab die beste Aussicht.«
Arnaut selbst konnte den ganzen Platz recht gut überblicken, denn wie alle Männer auf der mütterlichen Seite seiner Familie war er hochgewachsen und überragte die meisten um Haupteslänge. Auf der gegenüberliegenden Seite war der Platz durch lo Borcs Stadtmauer begrenzt. Durch ein Tor konnte man einen Blick auf die Aude erhaschen, und auf der Brücke war jetzt, die Menge sah es in freudiger Erwartung, Bewegung zu erkennen. Ein Gesang aus Mönchskehlen wehte herüber, und die Ersten begannen, das Kreuz zu schlagen, Lippen bewegten sich in stillem Gebet. Ruhe kehrte ein.
Die Soldaten, an die vierzig Mann und schwerbewaffnet mit Speer und Schild, drängten die Leute zurück, um Platz für den Umzug zu schaffen. Auch den Weg zum Tor bahnten sie frei und gingen dabei wenig zimperlich vor. Die Vordersten wichen vor ihnen zurück, rückten enger zusammen, traten anderen auf die Füße. Es hallten Flüche und wütende Proteste.
Doch gleich darauf brandete ein erwartungsvolles Raunen auf, denn unter dem Torbogen erschien nun die Spitze des feierlichen Umzugs. Zuerst ein einzelner Priester im Mess-gewand, der ein vergoldetes, hoch auf einen Stab gepflanztes Kreuz vor sich hertrug. Hinter ihm schritten zwei Ministranten einher, voran der turifer, der ein silbernes Weihrauchfass an langer Kette schwang, und der navicularius, der würdevoll das Weihrauchschiffchen trug. Ein weiterer Ministrant trug das kostbare Banner des Heiligen, und dann folgte eine schwere, auf den Schultern von vier Mönchen getragene, mit Blattgold und reichen Schnitzereien verzierte Lade, Gegenstand der Verehrung der Gläubigen. Viele in der Menge sanken auf die Knie und bekreuzigten sich.
Eine Marktfrau beugte sich zu Arnaut herüber. »Die Gebeine des Heiligen«, sagte sie laut genug, um den frommen Gesang der Mönche zu übertönen, die der Lade nachkamen. »Unser erster Bischof. Hat viele Heiden bekehrt.«
Arnaut lächelte freundlich zurück. »Warum halten hier eigentlich Tolosaner die Ordnung und nicht die Stadtmiliz?«
»Weil sie uns schon seit Jahren knebeln«, antwortete der Handwerker zu seiner Linken. »Ganz Narbona dient nur als Geisel für Alfons und seine Höllenhunde.«
»Aber herrscht nicht die Familie der Vizegrafen?«
»Seit Aimerics Tod geht es nur bergab«, knurrte der Mann. »Alles geht zum Teufel, putan. Und der Tolosaner reißt sich die Grafschaft unter den Nagel. Verdammte Weiberherrschaft!«
»Hört auf zu fluchen, Maistre Bernat!« Die Marktfrau funkelte ihn zornig an. »Die vescomtessa tut, was sie kann. Außerdem sagt der Erzbischof, dass Alfons unser oberster Lehnsherr ist. Das wisst Ihr so gut wie wir alle.«
»Der Erzbischof? Dass ich nicht lache!« Der Mann zog verächtlich die Mundwinkel nach unten. »Der stand schon immer in Tolosas Diensten.«
Als habe Gott sie gehört, ließ er in diesem Augenblick den ehrenwerten Kirchenfürsten, von dem die Rede war, in Erscheinung treten. Der Umzug war in der Mitte des Platzes zum Stehen gekommen, der Gesang der Mönche verstummt. Nun herrschte eine erwartungsvolle, nur von Flüstern oder Hüsteln unterbrochene Stille, in die Erzbischof Arnaut de Leveson wirkungsvoll durch das Stadttor trat. Unter einem von vier Ministranten getragenen, seidenen Baldachin wandelte er feierlichen Schrittes daher, Mitra auf dem Haupt und Krummstab in der Linken. An die siebzig Jahre mochte er zählen. Er war von kleiner und schmaler Gestalt. Sein faltiges, bartloses Gesicht und der leicht vornübergebeugte Gang verstärkten den Eindruck von Alter und Zerbrechlichkeit. Im Gegensatz dazu bewiesen das entschlossene Kinn und die klugen Augen, die mit schnellem Blick die Menge überflogen, dass er durchaus regen Geistes war.
Der Erzbischof erteilte dem Volk den Segen, während er sich langsam der Lade des Heiligen näherte. Arnaut bewunderte das golddurchwirkte Gewand und die kostbaren Insignien, wie der Stab mit der vergoldeten Krümme, das schwere Goldkreuz auf der Brust und der Bischofsring, dessen violetter Stein im späten Nachmittagslicht für einen Augenblick aufleuchtete. Die Gestalt des alten Bischofs strahlte so viel fromme Würde aus, dass Arnaut ebenfalls auf die Knie gefallen wäre, hätte er nicht die Pferde halten müssen. Hastig hob er das goldene Kreuz seiner Mutter an die Lippen und küsste es inbrünstig.
Während der Bischof neben der Lade seinen Platz einnahm, umringten ihn Geistliche und Mönche, darunter der weißhaarige Abt des Klosters Sant Paul, wie die Marktfrau Arnaut erklärte. Dichtauf folgten weitere Bewaffnete, diesmal die militia urbana in den Farben von Narbona, und drängten die Zuschauer weiter zurück, um Platz für eine Gruppe von erlesen gekleideten Edelleuten zu schaffen, die inzwischen durch das Tor getreten waren. Hinter dem Träger des Banners von Narbona und in Begleitung eines schlanken, ganz in Schwarz gewandeten Mannes schritt eine domna von edlem Geblüt. Das kostbare Gewand, der pelzverbrämte Mantel und ihr aufwendiger, edelsteinbesetzter Kopfschmuck, aber vor allen Dingen das stolze, hoheitsvolle Auftreten zeichneten sie als eine Dame höchsten Ranges aus.
»Ermessenda la Bela, Graf Aimerics Witwe und Herrscherin von Narbona«, beantwortete die Marktfrau Arnauts Frage, wer dies sei.
»Regentin, meine Liebe, nur Regentin«, verbesserte der Handwerker. »Obwohl jeder weiß, sie strebt nach mehr.«
Die Marktfrau warf dem Mann einen missbilligenden Blick zu, bevor sie sich wieder an Arnaut wandte. »Und die hübsche donzela an ihrer Seite ist ihre Tochter. Ebenfalls mit Namen Ermessenda.«
Das blonde Edelfräulein, eher noch ein Kind, hielt sich bei der Mutter untergehakt und betrachtete neugierig die Menge. Dass sie den Namen ihrer Mutter trug, war bei den Familien des fränkischen Hochadels nicht unüblich. Den Bischof schien die Fürstin mit keinem Blick zu würdigen, sondern unterhielt sich scherzhaft mit ihrer Tochter, als habe sie nicht viel übrig für fromme Feierlichkeiten. Auch ihr seidener Kopfschmuck in Form eines sarazenischen Turbans war wirklich zu auffällig für die Gelegenheit. Arnaut hatte gehört, dass solcher Kopfputz in letzter Zeit höfischer Brauch geworden war. Darunter war ihr üppiges rotes Haar in einer Art Netz gefangen. Sie war nicht ganz so hübsch wie ihre Tochter, dennoch verliehen die vollen, geschwungenen Lippen und hellgrünen Augen ihrem Antlitz einen eigentümlichen Reiz.
»Warum la Bela?«, fragte Arnaut.
»Weil sie eine eitle Katze ist«, sagte Maistre Bernat, bevor die Marktfrau antworten konnte. »Würde mich nicht wundern, wenn sie das Erbteil ihrer Töchter schon verprasst hat.«
Die Marktfrau fauchte wütend zurück, aber Arnaut achtete nicht auf ihren Streit, denn in diesem Augenblick traf ihn ein Blick aus strahlend blauen Augen, der aus unerfindlichen Gründen ihm zu gelten schien und dem er sich nicht entziehen konnte. Es hatte gewiss nicht länger als den Flügelschlag eines Schmetterlings gedauert, trotzdem kam es ihm wie eine halbe Ewigkeit vor, bevor die junge Frau die Augen senkte. Etwas hatte ihn im Innersten getroffen und darin ein Gefühl ausgelöst, wie er es noch nie erlebt hatte. Benommen stand er da und spürte, wie ihm die Röte in die Wangen stieg.
»Das ist Ermengarda«, sagte die Marktfrau mit einem nachsichtigen Lächeln auf den Lippen, als sie sah, wohin er starrte. »Ist sie nicht schön, junger Herr? Von ihr singen schon die trobadors.«
»Was der eitlen Stiefmutter nicht gefallen dürfte«, lachte Maistre Bernat.
»Wer ist sie?«, fragte Arnaut benommen.
»Vescoms Aimerics älteste Tochter«, antwortete die Marktfrau. »Man sieht sie nicht oft bei solchen Anlässen. Es wundert mich, dass sie heute ihre Stiefmutter begleitet.«
»Sie ist die eigentliche Erbin«, ergänzte Maistre Bernat. »Und zudem im heiratsfähigen Alter. Wundern tät es mich nicht, wenn bald die ersten Freier kämen. Von Arle bis Barcelona, welche Familie würde nicht ihren Sprössling mit der schönen Ermengarda vermählen wollen? Wer sie kriegt, wird der nächste Herrscher von Narbona.«
»Ich hoffe, sie trifft eine gute Wahl«, sagte die Marktfrau.
»Da wird sie wohl kaum gefragt werden. Der Graf von Tolosa und der Erzbischof werden es bestimmen.«
»Aber die vescomtessa wird schon ein gewichtiges Wörtchen mitzureden haben«, rief die Marktfrau und lachte kurz auf. »Den Nächstbesten wird sie gewiss nicht zum Schwiegersohn nehmen.«
»La Bela?« Maistre Bernat zog geringschätzig die Luft durch die Nase. »Die wird es eher so drehen, dass niemand herrscht, außer sie selbst. Die wird doch nicht für ihre Stieftochter abtreten.«
»Ach, was redet Ihr für dummes Zeug, Maistre Bernat. Überhaupt, Domna Ermengarda ist doch noch ein halbes Kind, mon Dieu! Kaum älter als ihre Schwester.«
Wie ein Kind kam sie Arnaut aber nicht vor, auch wenn ihr dunkles Haar noch unverhüllt und jungfräulich zu einem langen Zopf geflochten war und sie in einem eher schlichten Gewand steckte. Unbeachtet von der Menge, stand sie zwei Schritt hinter ihrer Stiefmutter. Nein, ein Kind bestimmt nicht, dennoch kam sie ihm ein wenig verloren vor, als gehöre sie nicht hierher. Auch ihr Gesichtsausdruck war ernst, fast teilnahmslos.
Arnaut hoffte, sie würde noch einmal zu ihm herüberschauen, aber stattdessen verfolgte sie die Andachtsvorbereitungen der Priester. Er war enttäuscht. Doch gleich schalt er sich einen Narren, hatte eine donzela ihres Ranges gewiss Besseres zu tun, als einen wie ihn anzustarren. Ihr Blick war gewiss nur zufällig gewesen, oder ganz und gar seiner Einbildung entsprungen.
Immer noch strömten Teilnehmer des Umzugs durch das Tor auf den Platz, reiche Kaufleute und ihre Familien, wie man an der Kleidung erkennen konnte. Die wenigen Soldaten der militia urbana bildeten einen schützenden Ring um die Fürstenfamilie und überließen es den Tolosaner Söldnern, die Menge in Schach zu halten. Trotzdem wurde es immer enger. Der Erzbischof machte schon eine ungeduldige Handbewegung in Richtung der Soldaten. Sie sollten den Priestern doch endlich mehr Raum verschaffen.
Der capitan der Söldner brüllte Befehle, und die Männer nahmen die Schilde hoch und drängten die Menschen damit rücksichtslos zurück. Die in der ersten Reihe strauchelten und stürzten auf die Dahinterstehenden. Schreie der Entrüstung füllten den Marktplatz. Einer, der seine Frau schützen wollte, warf sich gegen den Schild eines Soldaten und erhielt dafür eine gepanzerte Faust ins Gesicht. Ein alter Mann lag am Boden und versuchte, unter den Stiefeln der pezos wegzukriechen, als ihn mit Wucht das stumpfe Ende eines Speerschafts in den Rücken traf. Schreiend und die Arme zum Schutz um den Kopf geschlungen, lag er zusammengekrümmt am Boden.
Auch in Arnauts Umgebung zwängten sich die Leute enger zusammen, die Pferde wurden unruhig, warfen die Köpfe hoch und wieherten. Arnaut und Severin hatten alle Mühe, die Tiere zu beruhigen, und Jori musste sich an den Sattel klammern, um nicht unter die Hufe zu stürzen.
»Verfluchtes Tolosaner Pack!«, brüllte Maistre Bernat. »Benehmen sich, als hätten sie uns unterworfen.«
Er war nicht der Einzige, denn die Menge war plötzlich wütend geworden. Die Rücksichtslosigkeit der Soldaten hatte sie gereizt, vielleicht weil sie seit langem solch tägliche Erniedrigungen hatten schlucken müssen. Zotige Gesten und geballte Fäuste, Pfiffe und Gejohle erfüllten den Platz. Einzelne Spottrufe verdichteten sich zu skandierten Hasstiraden, die aus tausend Kehlen drangen. Arnaut erschrak, denn so etwas hatte er noch nicht erlebt. Die Menschenmasse schien sich in eine bedrohliche Bestie zu verwandeln. Gleich würden sie die Handvoll Soldaten überrennen und in Stücke reißen.
Die pezos jedoch schien dies nicht weiter zu beunruhigen. Sie richteten ihre Speere auf die Vordersten, die vor dem blanken Stahl zurückwichen. Ein Kind kreischte, als es unter die Füße der Nächststehenden geriet. Ein alter Mann, der nicht schnell genug zurückwich, bekam eine Speerspitze in die Brust. Blutend brach er in die Knie.
Nun war der Platz in Aufruhr, die Menge brüllte auf wie ein getroffener Stier, Frauen kreischten. Erzbischof Leveson zerrte den capitan am Arm, schrie ihn zornig an. Was er sagte, ließ sich im Lärm nicht verstehen. Und dann geriet die Lage völlig außer Kontrolle, denn auf einmal flogen Steine aus den hinteren Rängen. Ein Soldat wurde im Gesicht getroffen und ging zu Boden. Weitere Steine donnerten wie Hammerschläge auf die Schilde der pezos. Die Söldner wichen zurück und rückten enger zusammen.
Besorgt sah Arnaut zu Ermengarda hinüber. Als habe sie es gespürt, warf auch sie ihm einen kurzen Blick zu. Angst stand in ihren Augen. Er war drauf und dran, sich durch das Heer der Leiber zu zwängen, um sie vor der Menge zu schützen, als ein junger Edelmann an ihrer Seite sich mit gezogenem Schwert vor sie stellte. Zu Arnauts Erleichterung hatten jetzt auch die Männer der militia urbana ihre Schilde gehoben und umringten die Grafenfamilie.
Plötzlich, wie um alles nur noch schlimmer zu machen, tauchten Berittene aus einer Seitengasse auf, auch sie in den Farben Tolosas. Es waren gepanzerte Reiter mit langen Lanzen, die sie auf die Steigbügel abgestützt in den Fäusten hielten. Sie sahen müde aus, wie nach langem Ritt, und schienen völlig überrascht vom Tumult auf dem Marktplatz.
Als sie ihre Kameraden von der Menge bedrängt sahen, zögerten sie nicht und ritten ihre Schlachtrösser rücksichtslos in die Massen, stachen mit Lanzen um sich und trieben die Menschen in Furcht vor sich her. Ein gewaltiger Aufschrei hallte über den Platz, Panik griff um sich. Wer konnte, rannte in die nächsten Gassen. In Windeseile leerte sich der Platz, manche wurden von den Reitern verfolgt und niedergestochen. Eine Frau geriet unter die Hufe, ein Bauer brach mit durchstoßener Kehle zusammen, und noch viele mehr wurden Opfer der Reiter und pezos, die den Flüchtenden nachsetzten.
Langsam kehrte eine unheilschwangere Ruhe ein.
Die verbliebenen Menschen, die es nicht geschafft hatten, in eine der Gassen zu flüchten, drückten sich furchtsam an den Rand des Platzes und wagten kaum zu atmen. Frauen klammerten sich aneinander, ängstlich auf die Söldner starrend, die jetzt gleichmütig ihr Werk betrachteten oder um sich blickten, als erwarteten sie, ja hofften fast auf mehr Widerstand.
Viele Verwundete oder Tote, so genau ließ es sich nicht gleich erkennen, lagen auf dem Boden. Überall war Blut, das in die Ritzen zwischen den Pflastersteinen sickerte. Die Lade des Heiligen war von den Schultern der Mönche gestürzt und des Erzbischofs seidener Baldachin lag zwischen verfaulten Rüben und altem Pferdedreck. Mossenher Leveson trug einen Ausdruck des Entsetzens auf dem Gesicht, und auch die vescomtessa stand wie erstarrt, die Hand über dem Mund.
In die lähmende Furcht, die jetzt auf dem Marktplatz herrschte, ritt langsam ein einzelner Mann auf einem prächtigen Schlachtross.
Maistre Bernats Flüstern war voller Hass.
»Der Graf von Tolosa.«
Der unerwartete Aufruhr hatte fünf Tote und viele Verletzte gekostet. Darunter ein Kind und ein ältlicher Pilger, von dem niemand wusste, woher er gekommen war. Auch die Frau, die unter die Hufe geraten war, hatte ihr Leben verloren. Sie war schwanger gewesen.
Bange Stille senkte sich über die Stadt, nur unterbrochen vom Klang der genagelten Stiefelsohlen der Söldner, die nun verstärkt ihre Runden gingen. Kaum jemand traute sich noch in die Gassen, obwohl man überall das erregte Raunen und Flüstern ahnen konnte, das die ganze Stadt erfasst hatte.
Arnaut und Severin brauchten eine Weile, um sich von dem Erlebten zu beruhigen, denn trotz ihrer kriegerischen Ausbildung hatten sie noch keine Erfahrung im Blutvergießen. Die kalte Brutalität, mit der unbewaffnete Menschen niedergemacht worden waren, hatte sie in ihrem Innersten erzittern lassen. Der Wunsch, am Palast des Grafen vorzusprechen, war ihnen fürs Erste vergangen. Schweigend ließen sie sich von dem Gassenjungen Jori zu einer Herberge am Fluss außerhalb der Mauern führen. Dort schenkten sie ihm den Rest ihrer Reisezehrung und nahmen ihm das Versprechen ab, am nächsten Morgen wiederzukommen.
Hier am Fluss war ein Vorort namens Vila Nova entstanden. Es war, als ob die Stadt ausgeufert wäre, als müsse das Häusermeer die Mauern sprengen und sich in die Ebene entlang des Flusses ergießen. Die Hütten sahen schmuddelig und ärmlich aus, meist Behausungen von Fischern und Hafenarbeitern. Die Herberge lag an einer Stelle, wo man den Fluss vertieft und einen langen hölzernen Kai auf Pfählen errichtet hatte, der sich las Naus nannte, nach den Lastkähnen, die täglich zum Hafen von Gruissan hinausfuhren oder zu Schiffen, die in der Lagune ankerten.
Das alberc sah heruntergekommen aus, der Schankraum gefüllt mit Seeleuten und Lastenträgern. Aber zumindest fanden sie hier für wenig Geld einen Stall für die Pferde und eine bescheidene Schlafkammer, auch wenn sie den grobgezimmerten Strohkasten würden teilen müssen, der als Bett dienen sollte. Nachdem sie Sättel und Habseligkeiten in die Kammer geschleppt hatten, war kaum eine Handbreit Platz zum Stehen übrig. Sie entledigten sich ihrer Rüstungen und hockten sich später in eine Ecke des Schankraums, um das freudlose Mahl herunterzuschlingen, das die schlampig wirkende Wirtin ihnen auf den Tisch stellte.
In dieser Spelunke war man an das Kommen und Gehen von Fremden gewöhnt, niemand schenkte ihnen Beachtung. Umso besser, dachte Arnaut, immer noch fassungslos nach dem Erlebten, denn vorerst war ihm nicht nach Gesellschaft zumute. Auch Severin schien es nicht besser zu gehen, nach der düsteren Miene zu urteilen, mit der er sein Mahl verzehrt hatte.
»Einen Speer durch die Kehle«, sagte er tonlos. »Nicht älter als meine Schwester Maria, höchstens acht oder neun.« Seine Augen waren feucht geworden.
»Es ging alles so schnell.«
»Dein Onkel würde den Schuldigen am nächsten Baum aufhängen.«
Arnaut nickte. Sein Onkel Raol, der daheim seit einiger Zeit die Geschicke der familia lenkte, war in der Tat ein strenger Herr. Gerecht, aber nicht sehr geduldig mit Missetätern. Arnaut dachte an das, was sein Großvater ihm eingebleut hatte, dass ein cavalier, der dieses Titels würdig sein will, Verantwortung für die Gemeinschaft trüge, vor allem für die Kirche, für Frauen und Schwächere, dass es für das Privileg der adeligen Geburt einen Preis zu zahlen gebe, nämlich sich in den Dienst einer höheren Sache zu stellen. Beide, Großvater und Onkel, hatten im Heiligen Land gedient, eine Tatsache, auf die Arnaut ungemein stolz war. Aber was sie heute gesehen hatten, entsprach nicht diesem Bild eines cavaliers.
»Bestimmt sind die Soldaten genauso erschrocken wie wir«, sagte er. »So etwas kann niemand gewollt haben. Am wenigsten der Graf.«
»Bist du immer noch sicher, du willst Coms Alfons dienen?«
»Wem sonst? Er ist unser Lehnsherr!«
»Rocafort ist ein freies Lehen und schuldet niemandem Kriegsdienst.«
»Das ist wahr. Aber warum sind wir sonst gekommen?«
»Jedenfalls nicht, um Kinder abzustechen!«
Arnaut ließ den Kopf hängen. Ein fröhliches Leben hatte es werden sollen. Sie wollten die Welt sehen, sich als Kämpfer für die Gerechtigkeit einen Namen machen, Abenteuer erleben. Vielleicht sogar das Herz einer edlen donzela erobern. Jedenfalls ein anderes Dasein als das auf dem langweiligen Lehnssitz Rocafort, wo nie etwas Aufregendes geschah. Arnaut hatte nichts sehnlicher erhofft, als in die ehrenvolle Gemeinschaft der Ritter des Grafen von Tolosa aufgenommen zu werden, des größten und reichsten Fürsten des Landes. Doch wo war die Ehre im Töten von Kindern und schwangeren Weibern?
Er warf den Löffel auf den Tisch.
»Fürchterlicher Fraß.«
»Sie hassen ihn hier. Und jetzt werden sie ihn noch mehr hassen. Willst du einem Herrn dienen, den das Volk verachtet?«
Auch das beunruhigte Arnaut. Die Stadt war wie ein wütend aufgestacheltes Wespennest, das Wappen von Tolosa für viele ein rotes Tuch. Wie hatte es so weit kommen können?
»Du übertreibst«, versuchte er, die eigene Bestürzung darüber zu beschwichtigen. »Es war gewiss nur ein unglücklicher Zufall. Und der gute Erzbischof ist doch auf Alfons’ Seite. So schlimm, wie du es darstellst, kann es nicht sein.«
Severin zog die Schultern hoch. »Ich sage nur, was ich denke.«
Er goss sich von dem billigen Wein nach und trank ihn in einem Zug, wobei er sich schüttelte und eine Grimasse zog, als hätte er sich gerade Essig in die Kehle gegossen.
»Putan. Das saure Gesöff frisst sich durch bis zu den Schuhsohlen!«
Das Gute an Severin war sein umgängliches Gemüt und seine Unfähigkeit, lange einen Groll zu hegen oder in Trübsal zu verharren. Er versuchte erneut, sein widerspenstiges Haar zu bändigen, und begann, sich neugierig umzusehen. An einem Tresen im Hintergrund lungerten zwei bemalte Dirnen, die schon seit einer ganzen Weile, wie Raubtiere auf der Lauer, die beiden jungen Burschen beobachtet hatten. Severins fröhliches Grinsen schienen sie nun als Einladung zu verstehen, und mit glitzernden Augen und geschäftstüchtigem Lächeln lösten sie sich vom Tresen und setzten zum Angriff an.
»Zwei hübsche Jungs und so ganz alleine«, gurrte die eine und ließ sich dicht neben Severin auf der Bank nieder. Der grinste unsicher, aber sein Arm schlang sich wie von selbst um die Hüften der blonden Hure. Ihre dunkelhaarige Partnerin winkte der Wirtin nach mehr Wein und hockte sich neben Arnaut, wobei sie ihm einen tiefen Blick in den Ausschnitt gewährte. Sie hatte in der Tat prachtvolle Brüste, bemerkte er trotz seiner Verlegenheit. Er hatte oft von Huren erzählen hören, aber jetzt so plötzlich auf Tuchfühlung neben einer Dame dieses Standes zu sitzen, das verschlug ihm die Sprache.
Zwei weitere Becher und ein frischer Krug Wein erschienen auf dem Tisch. Severin entspannte sich zusehends und trank seiner neuen Freundin zu. Er hatte schon immer eine Schwäche für die Mägde gehabt, wie alle daheim wussten. Nicht so wie Arnaut, der in diesen Dingen schüchterner war. Die Schöne neben ihm zog seinen rechten Arm über ihre Schulter und schmiegte wollüstig den Busen an seine Seite. Dabei fasste sie sein Kinn und versuchte, ihn zu küssen. Gleichzeitig spürte er eine harte Hand auf seinem anschwellenden Geschlecht. Ohne zu wissen, wie ihm geschah, hatten sich seine Finger um die fette Brust der Dirne gelegt. Unerwartet wild pressten sich rot verschmierte Lippen auf seinen Mund. Doch der saure Weinatem und der ranzige Schweißgeruch des Weibes widerten ihn plötzlich an.
Er stieß die Hure von sich und sprang auf.
»Komm, Severin. Wir gehen schlafen.«
Er konnte nicht schnell genug aus der Reichweite der beiden Dirnen kommen und wartete ungeduldig an der Tür auf seinen Freund, der ihm zögerlich und maulend folgte. Verärgert streckten die Weiber ihnen die Zunge raus. Um noch eins draufzusetzen, rafften sie zum Vergnügen der anderen Gäste ihre Röcke hoch und streckten ihnen die nackten, runden Ärsche entgegen. »Wohl noch jungfräulich, was?« und »keinem rechten Weib gewachsen, die Kleinen!« und Schlimmeres hallte ihnen auf der Stiege unter gellendem Gelächter hinterher.
Während Severin wenig später, auf die Seite gedreht, tief und fest schlief, lag Arnaut noch lange wach. Die frischen Eindrücke geisterten ihm im Kopf herum. Die Majestät der Stadtmauern, die verwirrende Vielfalt der engen Gassen, die vielen Menschen. Und immer wieder Bilder des Aufruhrs auf dem Marktplatz. Schließlich, trotz seines Abscheus, wich ihm auch die aufreizende Nacktheit der Dirnen unter den geschürzten Röcken lange nicht aus dem Sinn. Wie es wohl mit einem Weib wäre? War es Sünde, sich das vorzustellen?
Er lag auf dem Rücken und beobachtete das Mondlicht, das seltsame Schatten auf die Wand warf, und lauschte dem Gegröle von Betrunkenen auf der Gasse und dem Knarren von Schiffstauen auf dem Kai gegenüber der Schenke. Was mochte Alfons für ein Mann sein? Jemand, dem man mit Ehre dienen konnte? Oder war Severins Misstrauen gerechtfertigt?
Plötzlich spürte er wieder diesen eindringlichen Blick aus klaren, blauen Augen auf sich ruhen. Wie wäre es, einer wohlgeborenen domna zu dienen, so wie es die trobadors besangen? Aber das gab es gewiss nur in ihren Liedern. Trotzdem. Der Name gefiel ihm. Ermengarda.
Die Vescomtessa
Die Dächer der Nachbarhäuser glänzten vor Nässe im trüben Licht des nebelgrauen Herbstmorgens. Fröstelnd nahm Arnaut den Kopf aus der Fensterluke und streifte sich die Beinkleider über. Severin mochte er nicht wecken, und so schlich er auf nackten Füßen die Stiege hinunter.
In der Schankstube regte sich frühes Leben. In der hinteren Hälfte lagen noch Schläfer in Decken gerollt, als könne sie der Morgenlärm der Schankweiber nicht anfechten. Wahrscheinlich noch zu betrunken, um überhaupt etwas wahrzunehmen. Im vorderen Teil des Raumes hockten Hafenarbeiter auf Bänken und verzehrten wortkarg ihr Morgenmahl. Die meisten löffelten einen dicken Brei in sich hinein, begleitet von einer Zwiebel oder einer Handvoll Oliven. Andere aßen gebratenen Speck und dunkles Brot, das sie in heißes Bratfett tunkten. Der säuerliche Geruch des Dünnbiers, das die Mägde ausschenkten, und der beißende Kochdunst aus der Küche verhießen nichts Gutes. Obwohl ihm der Magen knurrte, schwor Arnaut, für heute auf die Kochkünste der Wirtin zu verzichten.
»Über den Hof, junger Mann«, wies ihm eine alte Magd den Weg zum Abort. »Gepisst wird in den großen Bottich daneben, hörst du?« Auf seinen verständnislosen Blick fügte sie hinzu: »Bringt bares Geld bei den Gerbern.« Mit ungeduldigem Kopfschütteln über seinen Unverstand wandte sie sich ab, um einen Humpen Bier zu füllen.
Während er in den stinkenden Bottich pinkelte, überfiel ihn ein plötzliches und heftiges Heimweh. Die Fürsorge der Mutter war ihm oft lästig gewesen, aber nun wünschte er sich nichts lieber, als wie gewohnt im Kreise der Geschwister und Vertrauten seiner familia ein herzhaftes Morgenmahl einzunehmen. Und dann der Anblick der Toten gestern. Fast bereute er die Reise nach Narbona.
Das nasskalte Wetter verstärkte die düstere Stimmung, und er floh in die Wärme des dunklen Stalls, um nach den Pferden zu sehen. In einer Ecke, wo er ihn versteckt hatte, fand er den kleinen Sack Hafer für seine Lieblinge.
Der braune Wallach Basil drehte ihm als Erster den Kopf zu und bedachte ihn mit einem tiefgründigen Blick aus dunklen Augen. Er war ein ruhiges, verlässliches Tier, von kräftiger Statur und ausdauernd. Arnaut strich ihm über die Flanken und hielt ihm eine Handvoll Körner hin. Severins Stute reckte neugierig den Kopf über den Widerrist des Wallachs und blies ihm ungeduldig ins Gesicht, bis er auch ihr eine Handvoll Hafer anbot.
Die Pferde waren aus dem Gestüt des alten Hamid, Großvaters maurischem Freund. Sechs prachtvolle arabische Pferde hatten sie vor dreißig Jahren aus Outremer mitgebracht und damit den Grundstock der Zucht gelegt. Hamid gab für gewöhnlich allen Fohlen arabische Namen. Arnauts Hengst hieß Amir, was so viel wie Prinz bedeutete. Und stolz wie ein Prinz war er wirklich. Weil Arnaut ihn nicht zuerst begrüßt hatte, hielt Amir beleidigt den Kopf abgewandt und tat, als habe er ihn nicht bemerkt. Selbst den Hafer verachtete er, bis Arnaut ihn zwischen den Ohren kraulte und ihm Koseworte zuflüsterte. Dann endlich ließ er sich herab, ihm aus der Hand zu fressen.
Seit drei Jahren ritt er den Hengst täglich und liebte ihn mit all seinen Eigenarten. Und von denen hatte er wahrlich genug und konnte sich, wenn es ihm passte, wie ein bockiger Eigenbrötler benehmen. Das Maultier, zum Beispiel, mochte er gar nicht, und sie mussten es von ihm fernhalten. Dennoch konnte Arnaut sich kein besseres Schlachtross vorstellen, denn der Hengst war schnell und ausdauernd und hatte das Herz eines Löwen. Arnauts Hände spürten die starken Muskeln unter dem Fell. So niedergeschlagen er noch vor wenigen Augenblicken gewesen war, die Wärme und der vertraute Geruch der Pferde vertrieben den Trübsinn.
Er war bereit, das gestrige Erlebnis nicht so ernst zu nehmen. Hatte der Pöbel nicht zuerst mit Steinen geworfen? Die Lage war einfach außer Kontrolle geraten, niemand hatte es so gewollt, am wenigsten Alfons. Gleich nach dem Morgenmahl würde er den secretarius des Grafen aufsuchen, um sich zum Heerdienst zu melden.
Er griff nach einer Heugabel und gab den Tieren frisches Futter zu fressen, dann ging er, um Severin aus dem Bett zu werfen. Verregnet oder nicht, es war Zeit, etwas Nützliches mit dem Tag anzufangen.
Die beiden jungen Männer rüsteten sich sorgfältig, denn Arnaut wollte einen guten Eindruck machen. Über das wollene Unterhemd zog er eine saubere Leinentunika. Gepanzerte Beinlinge und die schweren, mit Sporen bewehrten Reiterstiefel. Dann wuchtete er das knielange, vorn und hinten geschlitzte gambais über den Kopf, ein dickes, gestepptes und mit Baumwolle ausgestopftes Wams, das dazu dient, die Wucht von Pfeil und Schwert abzufangen. Seines war noch neu und roch angenehm nach dem harten Rindsleder, aus dem die äußere Haut gefertigt war. Darüber kam der lange Kettenpanzer seines Großvaters, der im Gegensatz zu anderen mit der doppelten Anzahl Ringen versehen war. Ein altes und schweres Stück, dafür besonders sicher und bei Arnauts Größe und kräftiger Statur kein Nachteil. Zuletzt das leinene sobrecot in den Farben von Rocafort, dem roten Eber.
Auch Severin war in voller Kampfausrüstung. Er trug die Waffen seines Vaters, ebenfalls ein veteranus des Krieges im Heiligen Land vor vielen Jahren. Als sie mit gegürtetem Schwert und Helm unter dem Arm vor die Tür der Herberge traten, fanden sie Jori, der auf einem zusammengerollten Tau auf dem Kai hockte und auf sie gewartet hatte. Der sanfte Regen hatte aufgehört.
»Warum in Waffen, Herr?«, fragte Jori. »Es ist längst überall wieder friedlich.«
»Stell keine dummen Fragen. Führ uns lieber an einen Ort, wo man Besseres zu beißen kriegt als in der Spelunke hier.«
Dieser Ort entpuppte sich als lo Borcs beliebteste Backstube, am Marktplatz gelegen und so voller Menschen, dass eine Schlange bis auf die Straße reichte. Darunter waren Mönche, Handwerker und Kaufmannsgehilfen, aber in der Hauptsache Bürgerinnen mit Korb am Arm und Kindern an der Schürze, die verstohlen und aufgeregt flüsternd den gestrigen Vorfall in der Stadt beredeten. Als ein Tolosaner Wachmann hinzutrat, verstummten sie und beäugten ihn feindselig. Auch Arnaut und Severin in ihrer Kampfausrüstung zogen misstrauische Blicke auf sich.
Bei Joris Anblick bekam die Bäckerin einen roten Kopf und wollte ihn aus dem Laden scheuchen. Doch Arnaut legte dem Jungen die Hand auf die Schulter, was den zweifelhaften Eindruck, den sie bei den Leuten machten, noch zu verstärken schien. Sie kauften ofenfrisches Weißbrot, selbst für Arnaut keine alltägliche Speise, und eine heiße Pastete mit Hasenfleischfüllung. Damit setzten sie sich an den Brunnen mitten auf dem Platz und ließen es sich schmecken.
»Hast du die Bäckerin etwa bestohlen?«, fragte Severin den Jungen. »Oder warum ist sie so wütend auf dich.«
Der zuckte gleichmütig mit den Schultern. Zum Reden war sein Mund zu voll.
»Hast du keine Eltern?«
Kopfschütteln war die Antwort.
»Und wer kümmert sich um dich?«
»Ich komme allein zurecht«, erwiderte der Junge trotzig, nachdem er heruntergeschluckt hatte.
»Mit Stehlen, wette ich!«
»Lass ihn«, sagte Arnaut und leckte sich die Finger ab. »Wo ist der palatz des Grafen?«
Jori zeigte auf das große Haus nahe der Wehrmauer, vor dem zwei pezos mit langen Speeren standen.
Arnaut fragte sich, ob er den Grafen selbst antreffen würde. Bei dem Gedanken zog sich ihm der Magen zusammen, und das soeben verzehrte Mahl hing wie ein Klumpen Blei in seinem Bauch. Schließlich war Alfons Jordan der mächtigste Fürst des ganzen Landes. Was sollte er ihm sagen? Er fühlte sich wieder wie der kleine Junge, der vor dem bissigen Hofhund Reißaus genommen hatte. Sein Vater hatte ihn wütend einen verdammten Feigling genannt. Ein Ritter habe keine Angst zu haben. Und zu essen gebe es erst, wenn er ihm das Halsband des Köters bringen würde. Dem Gesinde wurde verboten, zu helfen. Stundenlang hatte er sich in der Scheune versteckt und seinen Vater gehasst. Ein Ritter hat keine Angst zu haben. Am Ende hatte er sich getraut, dem Untier vorsichtig einen Knochen hinzuwerfen, hatte ihn gestreichelt und ihm das Halsband abgenommen. Ein Ritter hat keine Angst zu haben.
Arnaut machte seinen Gefährten Zeichen, auf ihn zu warten. Dann schritt er betont gemächlich über den Platz.
Nachdem er den Wachen sein Anliegen genannt hatte, gewährten sie ihm Zutritt zum Innenhof, in dem sich Krieger drängten, die ausnahmslos das Tolosaner Wappen auf sobrecot oder Lederwams trugen. In der Mehrzahl Fußsoldaten, aber auch einige soudadiers, berittene Söldner, die man an ihren langen, vorn und hinten geschlitzten Waffenröcken erkennen konnte. Gespräche verstummten, und neugierige Blicke folgten ihm, als er betont gemessenen Schrittes die Treppe zur Eingangshalle emporstieg in der Hoffnung, man würde ihm sein Herzklopfen nicht anmerken. Auch vor dieser Tür standen Wachen, aber sie ließen ihn ohne weitere Prüfung eintreten.
Kaum über die Schwelle, blieb Arnaut stehen und sah sich um. Außer einem lebhaften Kaminfeuer im Hintergrund war die Halle düster, so dass man die Schnitzereien von Greifen und anderen Fabeltieren an den Deckenbalken kaum erkennen konnte. Der Raum besaß schmale Fensteröffnungen, die allesamt auf den Innenhof zeigten und nur wenig vom trüben Licht des Oktobertages hereinließen. Zwei Dutzend Söldner standen in Grüppchen beisammen und schienen auf etwas zu warten. Es roch nach Schweiß und Leder.
Linker Hand, im Schein eines mehrarmigen Kerzenhalters, saß ein Mönch an einem schweren Holztisch und schrieb in einem Folianten. Er rief den Namen eines Soldaten auf, und als dieser zu ihm trat, griff er in eine von zwei weiteren pezos bewachte Schatulle und händigte eine Handvoll sorgfältig abgezählter Silbermünzen aus. Den Erhalt musste der Mann durch sein Kreuz bestätigen. Dann war der Nächste an der Reihe.
Arnaut wollte sich gerade dem Mönch nähern, als ein Mann, der hinter ihm eingetreten war, sich mit einem gemurmelten »Perdona me!« an ihm vorbeidrängte und sich eiligen Schrittes dem Tisch des Schreibers näherte. Glaubt der Kerl, ihm gehört die Welt, dachte Arnaut entrüstet.
»Ist der Graf zu sprechen?«, hörte er den Mann sagen. Die Stimme, obwohl höflich genug, ließ keinen Zweifel darüber, dass ihr Besitzer sofortige Aufmerksamkeit als ein natürliches Recht beanspruchte. Gut gekleidet war er auch. Zweifelsohne ein Edelmann von Rang.
»Er wird jeden Augenblick erwartet, Senher de Malvesiz«, sagte der Mönch, der aufgesprungen war und sich verbeugte.
»Dann will ich warten.«
Ohne einen Blick auf die Männer in der Halle zu verschwenden, schritt er zum Kaminfeuer an der rückwärtigen Wand und rieb sich vor den Flammen die Hände, als sei ihm kalt. Er war schlank und von mittlerer Größe. Eine Erscheinung ganz in Schwarz, von dem dunklen Haar, das ihm locker auf die Schultern fiel, bis hinunter zu den Stiefeln aus weichem Leder. Arnaut erinnerte sich. Dies war der Edelmann, der gestern an der Seite von Vescomtessa Ermessenda gewesen war.
Eine rauhe Hand stieß ihn plötzlich zur Seite.
»Was stehst du im Weg, Kleiner, und hältst Maulaffen feil?«
Ein Kerl, so groß und breit wie ein Schrank, stiefelte an ihm vorbei und stellte sich, mit einer Hand in die Hüfte gestemmt, vor dem Schreiber auf. »Wann bist du endlich fertig, Mönch?«, knurrte der Kerl. »Sehe ich aus, als hätte ich den ganzen Tag Zeit?«
»Zahltag, Senher de Berzi. Da werdet Ihr Euch schon gedulden müssen«, war die spitze Antwort.
Das rüpelhafte Benehmen dieses Kolosses hatte Arnaut die Zornesröte ins Gesicht getrieben. Als Sohn eines Barons war er solche Behandlung nicht gewohnt. Besonders die Maulaffen hatten ihn geärgert. Ein rechter Mann lässt sich von niemandem erniedrigen, war ein Grundsatz seines Großvaters. Aber auch, dass man sich seinen Gegner erst gründlich anschauen sollte, bevor man ihn herausfordert. Doch daran dachte er jetzt nicht. In zwei langen Schritten schloss er auf und riss den Ritter an der Schulter herum.
»Was fällt Euch ein, mich anzurempeln?«, sagte er scharf. »Ich erwarte eine Entschuldigung!«
Schlagartig wurde es still in der Halle, während der Mann ihn aus kalten, grauen Augen musterte. »Teufel noch eins. Der Milchbart wird frech!«
»Milchbart?«, schrie Arnaut, jetzt außer sich. »Ich werd Euch Milchbart geben!« Und er verpasste dem Mann eine schallende Ohrfeige.
Die Hand des Getroffenen fuhr zur Wange. »Teufel noch mal«, entfuhr es ihm. Selbst unter dem kurzen Bart konnte man sehen, dass Arnauts Finger rote Abdrücke hinterlassen hatten.
Obwohl noch fest im Griff seines wilden Zorns, spürte Arnaut undeutlich, dass er sich zu einer Dummheit hatte hinreißen lassen. Aber nun schien ihm Flucht nach vorn das Beste, um in den Augen der umstehenden Männer nicht als Großmaul und Feigling dazustehen.
»Wir können es gleich hier austragen!«, brüllte er und zog das Schwert. Sein Gegenüber glotzte einen Augenblick lang verdutzt auf die Klinge. Dann fing er dröhnend an zu lachen.
»Du willst dich mit mir messen, mon gartz?«, spottete der Kerl, ohne Anstalten zu machen, selbst die Waffe zu ziehen. »Das hat schon mancher bereut. Selbst die feine Rüstung wird dir nichts nützen.« Geringschätzig musterte er seinen Herausforderer von oben bis unten. »Was ist das da auf deiner Brust, ein Eber?«
Die unerschütterliche Ruhe des Mannes verunsicherte Arnaut. Um sich nicht zum Gespött der Söldner zu machen, trat er einen Schritt vor und hob die Schwertspitze. »Zieht endlich das Schwert, damit wir es ausfechten«, rief er mutiger, als er sich in Wahrheit fühlte.
Der andere trat grinsend zu einer der Wachen und ließ sich dessen schweren Speer geben. »Wozu ein Schwert?«, höhnte er. »Für das Borstenvieh auf deiner Brust genügt ein Saustecher!«
Grölendes Gelächter in der Halle war die Antwort. Arnaut wurde wider Willen rot, Zorn flackerte erneut in ihm auf. Die Söldner bildeten einen Kreis, um Platz zu schaffen. Auch der Edelmann am Kamin hatte sich umgedreht und wartete mit herablassendem Lächeln auf den Verlauf der Dinge.
Arnauts Gegner packte den Speer mit beiden Fäusten. Er eröffnete mit einer kleinen Finte, dann folgte ein kurzer Speerstoß, dem Arnaut behende auswich.
»Gut, mein Junge, gut machst du das.« Der Kerl lachte ausgelassen. Er schien überhaupt ein Spaßvogel zu sein, trotz seines beeindruckenden Äußeren. »Na komm. Jetzt probier du es mal.«
Während Arnaut fieberhaft überlegte, wie er den Kampf ehrenvoll und ohne Blutvergießen beenden konnte, ließ sich eine tiefe Stimme hinter ihm vernehmen.
»Was geht hier vor, Joan?«
Eine hochgewachsene Gestalt stand im Eingang. Das Gegenlicht ließ die Gesichtszüge nur schwer erkennen, doch Arnaut war sich sicher, dies war der Graf von Tolosa. Mit Joan war wohl sein Widersacher gemeint, denn der trat sofort zurück, richtete sich respektvoll auf und legte die rechte Hand auf die Brust.
»Nur ein wenig Kurzweil, Dominus!«, sagte er mit leichter Verbeugung.
»Du weißt, ich dulde keine Zweikämpfe.«
»Wir alle wissen das, Mossenher!«, erwiderte Joan de Berzi. »Aber nicht der junge Bursche hier. Er glaubte, mich fordern zu müssen. Also war eine kleine Lektion angesagt, nicht wahr, Jungs?« Er blickte um Zustimmung heischend in die Runde. Doch die umwölkte Stirn des Fürsten ließ ahnen, dass ihn die Erklärung wenig überzeugte.
Arnaut hatte inzwischen das Schwert in die Scheide gleiten lassen und war gebeugten Hauptes auf sein Knie gefallen. Alfons wandte sich ihm zu und trat näher. Er war ein reifer Mann, aufwendig gekleidet und trug nach Normannenart die dichten, dunklen Haare kurzgeschnitten. Auf seinen glattrasierten Wangen lag ein bläulicher Schimmer. Er musste nach der spanischen Seite der Familie kommen, denn seine Mutter war Elvira von Kastilien, dritte Frau seines Vaters Raimon Sant Gille, Held des Kreuzzugs und Befreier Jerusalems.
Er heftete den Blick auf den jungen Ritter vor ihm. Dabei hielt er das Kinn leicht angehoben, die Unterlippe nachdenklich vorgeschoben, während seine dunklen, etwas hervorstehenden Augen unter den schweren Lidern betrübt auf Arnaut herabsahen.
»Ist das wahr?«, fragte er.
»Nun …« Arnaut fehlten die Worte. Dann entschloss er sich, die Gelegenheit beim Schopfe zu packen. »Ich kam, um Euch zu dienen, Mossenher.«
Der Fürst sah ihn einen Augenblick lang aufmerksam an. »Ich kann keine Raufbolde gebrauchen«, antwortete er und begann, sich abzuwenden.
»Ihr habt recht, Senher, und es tut mir leid«, stieß Arnaut schnell hervor. Und dann kamen ihm die Worte, die er sich auf dem Weg hierher zurechtgelegt hatte. »Bedenkt, Dominus, mein Großvater war castelan der Burg Eures Vaters in Tripolis, als Ihr noch ein Kind wart. Er erinnert sich gut an Euch und lässt Euch grüßen.«
Dies schien flüchtig Alfons’ Aufmerksamkeit zu erregen. Er wandte sich noch einmal um. Seine Stirn runzelte sich, als wolle er Erinnerungen zurückrufen. »Nach meines Vaters Tod?«
»So ist es. Zuvor hatte er ihn in allen Schlachten begleitet.«
»Und wie ist dein … Name, junger Mann?«
Arnaut fiel auf, dass Alfons bei einigen Worten ein wenig Schwierigkeiten mit der Zungenfertigkeit zu haben schien. Nur ein kaum merkliches Zögern, als brauche er eine winzige Atempause, bevor er sie aussprach.
»Arnaut de Montalban«, erwiderte Arnaut hoffnungsvoll. »Aus Rocafort in der Corbieras.«
Dies schien Alfons leider wenig zu sagen.
»Mein Vater ist Berenguer de Peirapertusa«, fügte er deshalb rasch hinzu.
»Ah, Peirapertusa«, sagte Alfons gedehnt und dachte nach. »Aber die stehen doch eher auf der Seite der Katalanen, oder?«
Arnaut schluckte. In der Tat. Die Familie seines Vaters hatte dem verstorbenen Aimeric von Narbona die Treue geschworen und wenig für Tolosa übriggehabt. Aimeric selbst war durch enge Blutsbande immer den Katalanen verbunden gewesen. Wie dumm, das zu vergessen!
»Es ist so, dass …«
»Genug jetzt«, unterbrach ihn Alfons. »In ein paar Jahren, wenn du gelernt hast, dich wie ein Ritter zu benehmen, werde ich mir überlegen, ob du einen Platz unter meinen Männern verdienst.«
Mit diesen Worten wandte er sich ab. Gleich darauf erkannte er den schwarzgekleideten Edelmann am Kamin und ging auf ihn zu. »Mein lieber Tibaut de Malvesiz«, rief er. »Ich schätze, Eure Herrin schickt Euch.«
Er nahm den Mann beim Arm, und beide verschwanden ohne ein weiteres Wort durch eine hintere Tür, die ins Innere des Palastes führte.
Arnaut erhob sich. Vor Enttäuschung und Scham wagte er niemandem in die Augen zu sehen, am wenigsten Joan de Berzi, der nun ohne Zweifel sein Feind war. Er drehte sich um und stürmte aus der Halle. Gelächter folgte ihm. Draußen auf dem Marktplatz ballte er wütend die Faust. Schließlich holte er tief Luft und kehrte zu seinen Gefährten zurück.
»Und?«, fragte Severin atemlos. Doch dann bemerkte er die finstere Miene seines Freundes. »Was ist geschehen?«
»Ich hab alles verdorben«, murmelte Arnaut.
Im Gegensatz zur großen aula war der Empfangssaal der vescomtessa der am kostbarsten eingerichtete und, abgesehen von ihrem eigenen Schlafgemach, auch der behaglichste Raum des Palastes.
Im Kamin vertrieb ein Feuer die feuchte Kühle des unfreundlichen Oktobertages. Der Fußboden bestand aus gewachsten, wohlriechenden Dielen, fein gearbeitete Truhen und Möbel füllten den Raum, ein kleiner Tisch für das Schachspiel stand in einer Ecke, und gepolsterte maurische Sitzbänke luden zum Verweilen ein. Die Wände bedeckten Tapisserien mit eingewirkten Motiven aus dem Leben Sant Pauls, des ersten Bischofs der Stadt, aber auch Jagdszenen, wie Aimeric sie geliebt hatte.
In einer Nische, auf einem hohen Marmorsockel, thronte Ermessendas Lieblingsstück, eine kleine römische Bronze der Göttin Diana, zum Glück nur wenig beschädigt. Die Wildheit und Unbezähmbarkeit, die aus der äußerst lebendig wirkenden Figur sprach, beeindruckte die Fürstin immer wieder. Sie glaubte, sich selbst darin zu erkennen. Und insgeheim fühlte sie sich jenem uralten und verbotenen Dianakult verbunden, bei dem es um Magie und Hexenzauber ging, verkörperte die Göttin doch das dunkle Gegenteil ihres Bruders, des Sonnengottes Apollo.
Ermessenda la Bela hauchte auf die glatte Oberfläche ihres Handspiegels und reinigte ihn vorsichtig mit einem weichen Wolltüchlein. Sie liebte dieses Kleinod aus Al-Andalus, das sich selten außerhalb ihrer Reichweite befand. Nicht allein, weil es ein Geschenk ihres verstorbenen Gemahls war, sondern weil dieser Gegenstand Schönheit mit Nützlichkeit auf eine Weise verband, die sie stets aufs Neue entzückte.
Die Innenfläche selbst war aus metallunterlegtem Glas, eine Kunstfertigkeit, die nur die Sarazenen beherrschten und sich fürstlich vergolden ließen. Mit der Echtheit und Klarheit des Bildes, das dieses Kunstwerk wiedergab, waren die üblichen Silber- oder Kupferspiegel nicht zu vergleichen. Griff und Einfassung waren aus feinstem Gold und mit winzigen Edelsteinen besetzt, die das Antlitz eines jeden, der hineinblickte, aufs angenehmste umrahmten.
Prüfend betrachtete sie ihr Spiegelbild.
Wie immer ärgerte sie sich über die Sommersprossen auf ihren Wangen, denn trotz größter Vorsicht, jedes Sonnenlicht zu vermeiden, würde sie nie so vornehm blass erscheinen, wie sie es sich wünschte. Bleiweiß, wie andere Frauen es verwandten, schadete ihrer Haut, das wusste sie aus Erfahrung. Nun, es war nicht zu ändern. Dies war der Fluch aller Rothaarigen.
Ob er heute kommen würde? Ganz bestimmt, beruhigte sie sich. Schließlich hatte sie Tibaut beauftragt, anzudeuten, dass sie unter gewissen Umständen nun doch zu Verhandlungen bereit sei.
Mit der Kuppe des kleinen Fingers nahm sie einen Hauch von der wohlriechenden, roten Wachspaste auf, um eine Winzigkeit zuerst auf den Wangen zu verreiben und dann sorgfältig auf ihre Lippen aufzutragen. Noch so eine der wundervollen Erfindungen aus dem Maurenland, ohne die das Leben nur halb so viel wert war. Sie presste die Lippen zusammen, um die hauchdünne Schicht besser zu verteilen. Zu viel davon, und sie sähe wie eine Dirne aus, aber nur ganz sparsam aufgetragen, verlieh es ihrem Antlitz jugendliche Blüte. Ja, so war es gut. Ihr Mund war das Beste an ihrem Gesicht. Vielleicht auch die hellen, graugrünen Augen.
Mit sich zufrieden legte sie den Spiegel auf den Tisch und sah nach ihren Töchtern, die sich mit der gezeichneten Vorlage einer Stickarbeit beschäftigten. Ihre dreizehnjährige Tochter blickte auf, und als sie sah, dass die Mutter das silberne Döschen der Schminkpaste verschloss, erhob sie sich und trat rasch näher.
»Darf ich auch, Mama?«
»Nina! Diese Schminke ist viel zu teuer für ein Kind«, erwiderte Ermessenda. Da beide den gleichen Namen trugen, hatten die Leute begonnen, die Tochter la nina, das Mädchen, zu nennen, und so war am Ende Nina als Rufname geblieben.
»Bitte, Mama.«
Ermessenda seufzte. Am Ende gab sie wie so oft nach. Sie verwöhnte Nina, das war ihr bewusst, aber warum sollte sie ihrem einzigen Kind so eine kleine Freude verwehren? Besonders nach dem Tod ihres Sohnes Berenguer vor einem Jahr, den sie noch nicht verwunden hatte. Er war erst sieben gewesen.
»Finger weg, filheta«, rief sie, als Nina nach der Paste griff. »Lass mich es machen. Du verschmierst dich nur.«