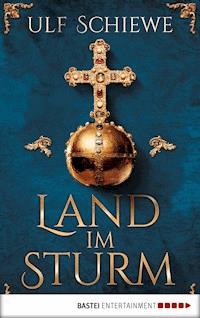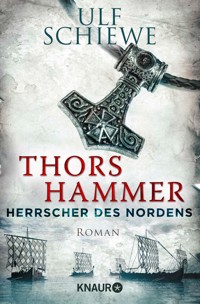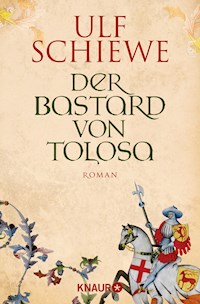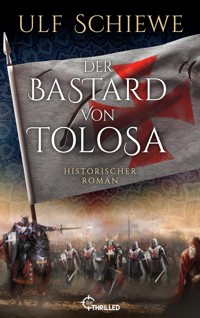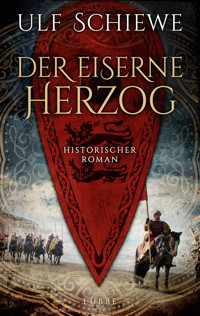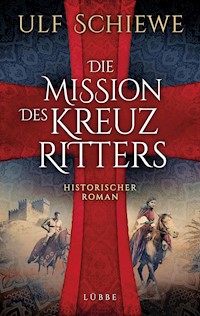6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Sie sprachen vom himmlischen Frieden – und riefen zum Kreuzzug auf. Sie mahnten zu Mäßigung und Keuschheit – und führten ein Leben in Verworfenheit. Rom war die biblische Hure Babylon … Südfrankreich im 12. Jahrhundert: Der junge Edelmann Arnaut ist verzweifelt, denn wieder hat seine heimliche Geliebte, die Vizegräfin Ermengarda von Narbonne, ihr Kind verloren – ein Fingerzeig des Himmels? Arnaut will Buße tun und sich dem Kreuzzug ins Heilige Land anschließen. Mit dem fränkischen Heer zieht er gen Osten und muss doch bald erkennen, dass es weniger um Erlösung als um Macht und Eitelkeit der Herrschenden geht, dass im Namen Gottes Verrat und unvorstellbare Greueltaten begangen werden. Gefährliche Abenteuer warten auf ihn, Kampf, Intrigen – und so manche Versuchung … Gewinner des HOMER-Literaturpreises 2014!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 748
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Ulf Schiewe
Die Hure Babylon
Roman
Knaur eBooks
Über dieses Buch
Südfrankreich im 12. Jahrhundert:
Der junge Edelmann Arnaut ist verzweifelt, denn wieder hat seine heimliche Geliebte, die Vizegräfin Ermengarda von Narbonne, ihr Kind verloren – ein Fingerzeig des Himmels? Arnaut will Buße tun und sich dem Kreuzzug ins Heilige Land anschließen. Mit dem fränkischen Heer zieht er gen Osten und muss doch bald erkennen, dass es weniger um Erlösung als um Macht und Eitelkeit der Herrschenden geht, dass im Namen Gottes Verrat und unvorstellbare Gräueltaten begangen werden. Gefährliche Abenteuer warten auf ihn, Kampf, Intrigen – und so manche Versuchung …
(725)
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Buch I
Ermengarda und der Abt
Der Leibeigene
Die kleine Madonna
Der Gesandte der Königin
Der Zorn Gottes
Joris Geheimnis
Buch II
Ermengarda und Menerba
Am Bosporus
Begegnung mit dem Feind
Ein Zeichen des Himmels
Die Schlacht am Mäander
Buch III
Ermengarda und der Ketzer
Der Schicksalsberg
Die Angst im Nacken
Wildschafe
Gestrandet
Buch IV
Ermengarda und der Trobador
Der Prinz von Antiochia
Die Rache des Templers
Nouras Grab
Das gewagte Spiel
Zerronnene Träume
Buch V
Ermengarda und der Mönch
Castel Arima
Prinz gegen Emir
Die Zitadelle
Epilog
Anhang
Anmerkungen des Autors
Glossar
Personenverzeichnis
Danksagung
Karte
Für
SANDRA
»Und er brachte mich im Geist in die Wüste. Und ich sah ein Weib sitzen auf einem scharlachfarbenen Tier, das war voll Namen der Lästerung und hatte sieben Häupter und zehn Hörner.
…
Und das Weib war bekleidet mit Purpur und Scharlach und übergoldet mit Gold und edlen Steinen und Perlen und hatte einen goldenen Becher in der Hand, voll Greuel und Unsauberkeit ihrer Hurerei, und an ihrer Stirn geschrieben einen Namen, ein Geheimnis: Die große Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Greuel auf Erden.
…
Und er sprach zu mir: Die Wasser, die du gesehen hast, da die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Heiden und Sprachen.
…
Und das Weib, das du gesehen hast, ist die große Stadt, die das Reich hat über die Könige auf Erden.«
AUS DER OFFENBARUNG DES JOHANNES, 17,3
Buch I
Januar, Anno Domini 1147
Für die Christenheit kündigen sich große Ereignisse an. Es ist ein Jahr des Triumphes für die Kirche Roms, denn gleich zwei Könige haben sich überzeugen lassen, das Kreuz zu nehmen, um mit gewaltigen Heeren gegen die Ungläubigen zu ziehen.
Ermengarda und der Abt
Sie wollen mir meinen Liebsten nehmen.
Der Gedanke hatte mich die ganze Nacht gequält. Und dies seit Wochen. Dass sie ihm den Kopf verdrehen würden, diese lärmenden Priester und Hetzer, die jetzt nach dem Schwert riefen. Dass er mich verlassen und in den Krieg ziehen könnte.
Edessa, per Dieu. Wo lag das überhaupt? Irgendwo in der Wüste, hieß es, am gottverlassenen Ende der Welt. Als ob das Glück der Menschheit von irgendeiner Stadt in Outremer abhinge. Was ging uns dieses Edessa an und ob es Türken oder Christen gehörte?
Jamila, meine Magd, betrat die Kammer und begann, mein Bett zu machen, als mich unerwartet Schwindel und Übelkeit erfassten und ich mich setzen musste.
»Schnell, die Waschschüssel!«, keuchte ich.
Ein Blick auf mein Gesicht und sie hielt mir so hastig das Gefäß unter, dass ein wenig vom Inhalt auf meinen Schoß schwappte. Nicht zu früh, denn schon ergoss sich heißer Mageninhalt ins morgendliche Waschwasser. Wieder und wieder musste ich würgen, bis nichts mehr kam.
Die Magd reichte mir einen Becher, um den Mund auszuspülen. Dann stellte sie die Schüssel weg und legte mir eine Decke um die Schultern, denn es war eisig in der Kammer, und ich saß nur im Hemd. Wäre doch nur erst der Winter vorüber. Ich bin einfach nicht für Nässe und Kälte gemacht.
Jamila nahm ein Leinentuch und tupfte mir sanft die Lippen sauber. »Ihr seid bleich, Domina. Ihr solltet in den Garten gehen. Etwas frische Luft wird Euch guttun.« Sie lächelte und küsste mich auf die Wange.
Der Gedanke an nasses Laub und braune Sträucher im winterlichen Palastgarten ließ mich schaudern. »Wann kommt endlich jemand, um das Feuer anzuzünden?«
»Schon bestellt, Domina.« Sie berührte sanft meinen Bauch. »Weiß Senher Arnaut eigentlich schon, dass Ihr …«
Ich schüttelte den Kopf. Bei all dem Gerede von Pilgerfahrt und Heiligem Krieg war es mir bisher unpassend erschienen, mein Geheimnis preiszugeben.
»Er musste fort«, sagte ich und atmete tief durch. Das Schwindelgefühl schien sich zu legen. »Seinem Großvater geht es nicht gut.«
»Ach, Domna Ermengarda. Er wird sich so freuen.«
»Vielleicht.« Ich war mir da nicht sicher. Arnaut schien in letzter Zeit so wortkarg und in sich gekehrt, als beschäftigte ihn etwas, das er nicht mit mir teilen wollte.
Eine junge Küchenmagd mit dem Arm voller Brennholz kam herein und machte sich am Kamin zu schaffen.
»Mein Haar, Jamila.«
Ich lehnte mich zurück und genoss, wie sich die Bürste in Jamilas geschickten Händen durch die langen, vom Nachtlager wirren Flechten mühte, ebenso ihr fröhliches, belangloses Geplapper, das dieses allmorgendliche Ritual stets begleitete. Sie tat mir gut, meine liebe Jamila, eine ehemalige Sklavin aus dem Land der Mauren. Seit vier Jahren war sie bei mir und inzwischen mehr als meine Magd geworden.
Freundinnen hatte ich weiß Gott nur wenige. Aber darüber sollte ich nicht klagen. Das ist das Los der Fürsten. In den Jahren, seit ich das Erbe meines Vaters antreten durfte, hatte ich schmerzhaft lernen müssen, Schmeichler und Speichellecker von aufrichtigen Freunden zu unterscheiden.
»Endlich Kinderlachen in diesen Mauern«, sagte Jamila. »Der ganze Hof wird sich um den kleinen Racker reißen, Ihr werdet sehen, Domina.«
Darüber musste ich lachen, und meine Stimmung hob sich. Ach, wie sehr ich mir Kinder wünschte. Fast konnte ich ihr fröhliches Gekreische hören, wie sie durch die düsteren Gänge des alten Gemäuers tobten und zwischen den Beinen der Leibwachen Fangen spielten.
»Alle werden das Kind verwöhnen«, spann Jamila den Gedanken weiter. »Sogar Domna Anhes.«
»Bist du sicher, unsere gute Anhes mag Kinder?«
»Warum, um Himmels willen, soll ich keine Kinder mögen?«, ließ sich die edle Domna Anhes vernehmen, die gerade in die Kammer getreten war.
Anhes war eine Frau unbestimmten Alters, mager wie eine Heuschrecke, immer tadellos gekleidet, selbst in der größten Sommerhitze. Sie war eine entfernte Verwandte meines Vaters, Gott hab ihn selig, und hatte mangels Familienvermögens keinen standesgemäßen Ehemann gefunden. Worüber ich nicht unglücklich war, denn Anhes war die Seele des Palastes und weit mehr als ein maior domus. Mit geradem Kreuz und strengem Blick herrschte sie seit Jahren über den palatz vescomtal von Narbona, so dass Wachen, Köche und Gesinde vor Eifer sprangen, wenn sie auftauchte.
»Als Kind hast du mich kaum beachtet, Anhes«, sagte ich und zwinkerte Jamila verschwörerisch zu.
»Das hatte seine Gründe«, antwortete Domna Anhes etwas spitz. »Deine Stiefmutter liebte es nicht, wenn man allzu viel Aufhebens um dich machte.«
In der Tat. Ich hatte nicht die glücklichste Kindheit verbracht. Meine Mutter war so früh verstorben, dass ich mich kaum an sie erinnern konnte, und das Leben mit la Bela, meiner Stiefmutter, hatte immer etwas von Misstrauen und gegenseitigem Belauern gehabt. Als ich sechs Jahre alt war, hatten Krieger die Waffen und Rüstung meines Vaters heimgebracht. Er war in Spanien, im Kampf gegen die Mauren, gefallen. Und einige Jahre später wurde auch mein älterer Bruder zu Grabe getragen. Diesen traurigen Umständen habe ich es zu verdanken, dass das Erbe der Vizegrafschaft Narbona auf mich gekommen ist, wenn auch erst nach langem Kampf gegen fremde Ansprüche. Nicht zuletzt gegen den mörderischen Ehrgeiz meiner Stiefmutter.
»Ich wünsche nicht, dass man hier von la Bela redet«, sagte ich. »Die hat genug Unheil angerichtet. Gebe Gott, dass wir sie niemals wiedersehen.«
Domna Anhes zuckte gleichmütig mit den Schultern: »Auch wenn es dir nicht gefällt, sie ist immer noch Ninas Mutter.«
Nina war meine jüngere Halbschwester, und ich vermisste sie sehr. Viel zu jung hatte ich sie nach Spanien vermählen müssen als Teil der Vereinbarung mit den mächtigen Katalanen. Mein Narbona war von Barcelonas Wohlwollen und dem der anderen großen Fürstentümer des Landes abhängig.
Domna Anhes sah sich in der Kammer um. Selten entging ihr etwas, und so fiel ihr Blick unweigerlich auf den säuerlich riechenden Auswurf, der auf dem Waschwasser schwamm. Mit Stirnrunzeln beugte sie sich darüber.
»Bist du schwanger?«, fragte sie misstrauisch, und der missbilligende Ton in ihrer Stimme war nicht zu überhören.
»Freu dich doch«, erwiderte ich. »Mit zwanzig sind andere längst glückliche Mütter.«
»Solange sie keine Bastarde werfen.«
Anhes konnte rücksichtslos ehrlich sein. Ihre harschen Worte trieben mir Tränen in die Augen. Aber Jamilas beruhigende Hand auf meiner Schulter milderte meine Antwort.
»Du weißt, ich kann Arnaut nicht heiraten.«
»Natürlich nicht. Du bist ja schon verheiratet. Auch wenn diese Verbindung nur zum Schein besteht und du diesen Bernard seit der Trauung nicht mehr gesehen hast …«
»Ein Unbekannter, der nie mein Bett geteilt hat.«
»Dann bitte um Aufhebung. Der Papst wird sie dir nicht verweigern.«
Ich senkte den Kopf. »Das ist unmöglich.«
Die Vermählung mit jenem Bernard d’Andusa war nur ein elendes Possenspiel gewesen. Ein Kuhhandel, um die Belange der regionalen Fürstenhäuser zu achten und den Frieden zu wahren. Angeblich konnte man einem schwachen Weib nicht trauen, und so wurde eine Scheinehe zur Gewährleistung, dass das reiche und strategisch wichtig gelegene Narbona nicht als Mitgift in falsche Hände geriet.
Der vorgetäuschte Ehemann, ein Baron aus dem Bergland der Cevenas, besaß laut Vertrag keinerlei Rechte. Meine Einwilligung war die Bedingung für meine alleinige Herrschaft über Narbona gewesen. Ungewöhnlich genug für eine Frau, ich gebe es zu. Doch der Preis war, dass ich nie ein Familienleben so wie andere würde führen dürfen. Natürlich wussten in Narbona alle, wie es um Arnaut und mich stand, aber in der Öffentlichkeit mussten wir die Formen wahren.
Domna Anhes warf mir einen strengen Blick zu. »Ein uneheliches Kind wird nur Wasser auf die Mühlen deiner Feinde gießen. Das weißt du so gut wie ich. Besonders Erzbischof Leveson …«
»Der soll mir gestohlen bleiben«, erwiderte ich trotzig. »Meine Lage ist entwürdigend genug. Ich werde nicht auch noch auf Kinder verzichten.«
Ich war von Dienern umgeben aufgewachsen. Da ist man selten allein. Und doch hatte ich als Waisenkind unter Einsamkeit gelitten, mich ständig von hundert fremden Augen beobachtet gefühlt, ohne die Geborgenheit liebender Eltern. Vielleicht wünschte ich mir deshalb nichts sehnlicher als einen Gemahl und eine lärmende Kinderschar.
»Wie du meinst«, sagte Anhes. »Und da wir vom Papst sprechen, unten ist einer, der sogar noch wichtiger als der Heilige Vater ist. Du solltest ihn nicht länger warten lassen.«
»O mein Gott«, rief ich erschrocken. »Warum hast du das nicht gleich gesagt? Ausgerechnet Abas Bernard, mon Dieu, und ich komme zu spät. Wie konnte ich ihn vergessen?«
Abt Bernard de Clairvaux, Gründer eines wahren Klosterimperiums, Kirchengelehrter, Berater von Königen, Papstmacher und, wie einige behaupten, mächtigster Mann der Christenheit, war gestern in der Stadt angekommen und hatte sich für heute Morgen ankündigen lassen. Und ich vertrödelte die Zeit mit albernem Geschwätz.
»Jamila, das einfache blaue Samtkleid mit den silbernen Borten. Schnell!«
Mit ihrer Hilfe zwängte ich mich in das Gewand. Hatte ich etwa schon zugenommen? Ich griff zum Spiegel. »Wie sehe ich aus? Bin ich immer noch zu bleich?«
»Etwas von der Paste, Herrin?«
»Um Gottes willen, keine Schminke heute. Hol mir den weißen Schleier.«
Jamila band mir in Eile das Haar zu einem losen Knoten im Nacken. Darüber der Seidenschleier, von einem schlichten, silbernen Stirnreif gehalten.
»Ich lasse wissen, dass du auf dem Weg bist«, sagte Anhes und marschierte aus dem Raum.
Auf der Treppe hinunter zum privaten Empfangssaal fing mich Peire Raimon de Narbona ab, mein Berater und engster Vertrauter. Wir nennen ihn alle nur Raimon, denn Peires gibt es zu viele, als dass man sie auseinanderhalten könnte.
»Er will auf dem Marktplatz sprechen«, raunte er mir zu, »und Erzbischof Leveson hat es ihm zugesagt. Sie bereiten schon alles vor.«
Ich blieb stehen. »Wie kann Leveson es wagen? Der Marktplatz gehört zu meiner Domäne.«
Seit vierhundert Jahren befindet sich die Vizegrafschaft in der Hand meiner Familie, aber die Macht über die Stadt selbst ist seit Urzeiten geteilt. Nördlich der Via Domitia, der alten Römerstraße, die quer durch Narbona verläuft, liegt wie ein Dorn in meinem Fleisch der Herrschaftsbereich des Erzbischofs. Leveson ist ein greiser, zäher Mann, der nicht sterben will. Er hat es nie verwunden, dass nun ein Weib die Zügel der Vizegrafschaft führt, und scheint den alleinigen Sinn seiner letzten Jahre darin zu finden, mich zu ärgern und zu quälen, wo er nur kann.
»Zweifellos will er sich bei Clairvaux einschmeicheln«, erwiderte Raimon.
»Ich dulde keine Kriegshetze in meiner Stadt.«
»König Louis hat sich für den Feldzug nach Outremer erklärt, und Clairvaux handelt im Auftrag des Papstes, vergiss das nicht. Du wirst ihm nicht verwehren können, zum Volk zu reden.«
Da war er wieder, mein Alptraum. Krieg den Ungläubigen. So rief es von der Kanzel, schallte es trunken aus Tavernen und flüsterte sogar aus jedem Winkel des alten Palastgemäuers. Und ich war zu schwach, um mich dagegenzustemmen.
»Wahrscheinlich kommen ohnehin nicht viele«, versuchte ich, mich zu beruhigen.
Das einfache Volk hatte wenig übrig für hohe Geistliche, die in Prunk lebten und wie Fürsten herrschten, die mehr Zeit für ihre Konkubinen als für die Seelen der Gläubigen hatten. Kein Wunder, dass die Menschen in letzter Zeit den Wanderpredigern zuliefen, die Armut und Besinnung auf die reine Lehre Christi forderten und vor allem mehr Verständnis für die alltäglichen Nöte hatten.
»Ich hoffe, du hast ihn nicht allein warten lassen.«
»Keine Sorge. Und sei vorsichtig, wie du dich äußerst. Er hat einen Schreiber dabei, der jedes Wort notiert. Großer Gelehrter mag er sein, aber vor allem ist er ein Mann der Politik.«
»Ich sage immer noch, was mir passt.«
»Natürlich.« Raimon öffnete die Hintertür zum Empfangssaal, und ich trat an ihm vorbei in den Raum, wo sie meiner harrten. Felipe, Fraire Aimar, Abt Imbert und natürlich Clairvaux.
Ich weiß nicht, was ich erwartet hatte. Wahrscheinlich einen bärtigen Eiferer mit stierem Blick und verkniffenen Zügen. Einer von jenen Höllenpropheten, die von der Kanzel Gottes Zorn über uns Sünder beschwören, wenn wir nicht zu sofortiger Umkehr und Buße bereit sind.
Stattdessen erhob sich freundlich lächelnd ein hochgewachsener, hagerer Mann reifen Alters in einfacher Mönchstracht, mit silbernem Haarkranz unter der Tonsur, tiefliegenden, dunklen Augen und buschigen Brauen. Seine Haltung war leicht gebeugt, wie so oft bei großen Menschen.
»Midomna Ermengarda«, hörte ich ihn sagen, als er sich mir mit offenen Armen näherte. Er nahm meine Hand, trat einen Schritt zurück, um mich wohlwollend von Kopf bis Fuß zu betrachten.
»Noch so jung«, sagte er. »Und so überirdisch schön, fast wie die leibliche Mutter Gottes.«
Er schien unsere südliche lenga romana gut zu beherrschen, und seine tiefe, etwas rauchige Stimme entfaltete trotz des nordfränkischen Tonfalls eine Wirkung, der man sich nur schwer entziehen konnte. Ich konnte nicht verhindern, dass ich vor Verlegenheit rot wurde. Mon Dieu, ein alter Mann, schalt ich mich, und ein Priester dazu. Doch was wie plumpe Schmeichelei geklungen hatte, war von einem aufrichtigen und warmherzigen Lächeln begleitet gewesen. Gewiss hatte ich ihn mit meinem Schleier über dem einfachen Gewand nur an Bildnisse der Heiligen Jungfrau erinnert, deren glühender Verehrer er bekanntlich war.
In jedem Fall beschloss ich, vorsichtig zu sein, und erinnerte mich daran, dass ich geschworen hatte, mich nie wieder von mächtigen Männern einschüchtern zu lassen.
»Dürfen wir Euch ein wenig von unserem Wein anbieten, Mossenher. Er genießt einen guten Ruf.«
Bernard hob abwehrend die Hand und schüttelte den Kopf. »Ich leide unter Magenbeschwerden, Wein tut mir gar nicht gut. Nein, auch kein Wasser. Ich danke Euch.«
»Dann nehmt doch bitte wieder Platz.«
Der Raum, in dem ich wichtige Gäste für private Gespräche empfange, ist nicht sehr groß, aber bequem ausgestattet, mit gepolsterten Stühlen und wertvollen Teppichen an den Wänden. Im Kamin verbreitete ein Feuer angenehme Wärme. Ich ließ mich auf dem geschnitzten und bemalten Thronstuhl meines Vaters nieder, der mir bei solchen Gelegenheiten ein wenig mehr Höhe und Würde gewährt. Auch die anderen setzten sich. Im Hintergrund bemerkte ich einen unscheinbaren Mönch, der Wachstablett und Stylus hervorholte. Sein secretarius.
Bernard blickte freundlich in die Runde und nickte dann dem weißhaarigen Abt Imbert zu. »Wie ich sehe, Midomna, habt Ihr die Tatkraft der Jugend wie auch die Weisheit des Alters um Euch versammelt. Aber warum findet sich nicht der gute Erzbischof in unserer Runde?«
»Mossenher Leveson besucht nur ungern meinen Palast«, erwiderte ich ohne weitere Erklärung. »Aber lasst mich zuerst meine engsten Berater vorstellen. Zu Eurer Rechten, Vescoms Felipe de Menerba, einer unserer bedeutendsten Vasallen, und neben mir, Peire Raimon de Narbona, Verwalter der vizegräflichen Besitzungen und Vermögen. Ihr habt recht, Mossenher, beide sind nicht viel älter als ich selbst, aber erprobte Gefährten. Auch Fraire Aimar hier zu Eurer Linken genießt besonderes Vertrauen und hat schon viele Fürstenhöfe in unserem Auftrag besucht.«
»Welcher Gemeinschaft gehört Ihr an, Bruder Aimar?«
»Dem Kloster Fontfreda, Herr, ganz hier in der Nähe«, erwiderte Aimar ein wenig eingeschüchtert, was sonst nicht seine Art war.
Bernard nickte und wandte sich wieder an mich. »Ist Fontfreda nicht dank Eurer Unterstützung erweitert worden?«
»Alle Gebäude konnten erneuert und wesentlich größer ausgelegt werden«, sagte ich nicht ohne Stolz. »Die Arbeiten schreiten gut voran. Und inzwischen wird an einem neuen Gotteshaus gebaut. Es wird das schönste und bedeutendste Kloster des ganzen Südens werden.«
»Ich hätte es mir gern von Euch zeigen lassen, doch ich bin in Eile. Papst Eugenius hat seinen Besuch in Clairvaux angekündigt. Ihr wisst, er war mein Schüler, und ich bin ihm persönlich sehr verbunden.«
Es war allgemein bekannt, dass dieser Bernardus Paganelli ohne Clairvaux’ Fürsprache wohl kaum als Eugenius III. den Stuhl Petri hätte besteigen können. Es hieß auch, die Bulle des Papstes, quantum praedecessores, in der vor einem Jahr zum bewaffneten Pilgerzug ins Heilige Land aufgerufen worden war, sei von Bernard selbst diktiert worden.
»Zu guter Letzt«, fuhr ich fort, »darf ich Euch meinen väterlichen Freund und Beichtvater, Mossenher Imbert, Abt des Klosters Sant Paul Serge, vorstellen.«
»Sind wir uns nicht schon mal begegnet?«, fragte Bernard.
»So ist es.« Paire Imbert war hocherfreut, dass der berühmte Clairvaux sich seiner erinnerte. »Es war im Jahre 1128, während des Konzils von Troyes, auf dem der Orden der Tempelritter von Jerusalem bestätigt wurde. Ihr selbst habt die Ordensregeln entworfen.«
Bernard lächelte ein klein wenig selbstgefällig. »Seitdem hat sich der Orden gut gemacht und der Christenheit große Dienste erwiesen.«
Er beugte sich vor, stützte ungezwungen die Ellbogen auf die Knie und verschränkte die Finger ineinander. Große, kräftige Hände, bemerkte ich.
»Nun, verehrte Domna Ermengarda, das bringt uns zum Gegenstand meines Besuches. Die vom Heiligen Vater beschlossene Pilgerfahrt braucht kampferprobte Männer, die bereit sind, für Christus zu streiten.«
Seine Worte bestärkten meine schlimmsten Befürchtungen. Schon sah ich Arnaut hoch zu Ross unter dem Banner dieses Priesters reiten, im Kampf von Feinden umringt und schließlich blutend auf der Wallstatt liegen. Plötzlich war mir, trotz des Feuers im Kamin, kalt geworden, und ein neuerlicher Anflug von Übelkeit plagte mich.
»Ihr seid bleich, Midomna«, hörte ich den Abt wie aus der Ferne sagen. »Ist Euch nicht wohl?«
»Nichts. Es ist nichts«, erwiderte ich und riss mich zusammen. Raimon, der mich besser als alle kennt, erhob sich und reichte mir zur Beruhigung einen Kelch mit verdünntem Wein.
»Wie ich also sagte«, fuhr der Abt fort. »Es werden tatkräftige Ritter gebraucht.«
»Und die glaubt Ihr hier zu finden?«, fragte ich ungebührlich scharf. »Ist das der Zweck Eurer Ansprache auf dem Marktplatz? Um Soldaten zu werben wie ein Kriegsherr?«
Bernard sah mich erstaunt an, und ich bemühte mich, den Ton zu mäßigen. »Was ist so bedeutsam an diesem Edessa und ob es von Christen oder Ungläubigen beherrscht wird?«
Der Abt lehnte sich zurück. Solche Fragen hatte er wohl nicht erwartet. Unbewusst tastete seine Hand nach dem kleinen silbernen Kreuz auf seiner Brust. Dann lächelte er.
»Wir dürfen nicht vergessen, dass Edessa schon immer von Christen bewohnt war, Armeniern in der Hauptsache. Seit ihrer Befreiung im Jahre 1097 ist diese Stadt ein wichtiges Bollwerk gegen die Ungläubigen gewesen, und daher ist es unerträglich, sie in türkischer Hand zu wissen.«
Er hielt kurz inne und blickte von einem zum anderen. Dann sprach er in einem Ton, als wollte er uns in sein Vertrauen ziehen: »Aber es geht ja nicht nur um Edessa. Die Wahrheit ist, dass alles, was unsere Väter im Heiligen Land erwirkt haben, Gefahr läuft, für immer verlorenzugehen. Täglich erreichen uns Hilferufe. Wir können Outremer zurzeit nur halten, weil die Ungläubigen untereinander uneins sind. Hauptsächlich fehlt es an Mannschaften. Einwanderer aus dem Westen sind nicht in den Scharen gekommen wie erwartet, und auf die Treue der eingeborenen Bevölkerung allein darf man sich nicht verlassen. Selbst unter den griechischen Christen finden sich Verräter.«
»Gibt es denn keinen anderen Weg als Krieg? Wie können wir als fromme Christen Krieg überhaupt gutheißen?«
Bernard ließ sich von mir nicht aus der Ruhe bringen. Er nickte wohlwollend, ganz als sei ich einer seiner Domschüler, dem eine kluge Entgegnung eingefallen war. »Diese wichtige Frage hat uns der heilige Augustinus ausführlich beantwortet. Natürlich ist Krieg an sich eine schreckliche Angelegenheit und nicht zu befürworten. Aber wenn der Satan selbst uns in Gestalt dieser Gottesleugner angreift und unsere Heiligtümer schändet, dann müssen wir uns wehren, dann ist ein Heiliger Krieg die einzige und gerechte Antwort.«
Eine gute Rede. Doch ich wollte mich von solchen Zungenfertigkeiten nicht beirren lassen. »Es ist zwar schon fast fünfzig Jahre her, Mossenher, aber wir alle wissen doch, wie viele bei der Befreiung Jerusalems elendig gestorben sind, von den heimkehrenden Krüppeln gar nicht zu reden. Eine ganze Generation junger Männer ist geopfert worden.«
»Hat nicht auch der Heiland sich für uns geopfert? Schulden wir es nicht dem Gekreuzigten, für ihn zu kämpfen?«
»Und was ist mit den Kindern, die ihre Väter verlieren werden? Denkt Ihr nicht an die guten Frauen, die ihre Männer hergeben, und die Mütter, die ihre geliebten Söhne in die Schlacht schicken sollen?«
Abt Bernard sah mich immer noch mit diesem wohlwollenden Lächeln auf den Lippen an, während er gedankenverloren das Kreuz auf seiner Brust befingerte. Die dunklen Augen unter den buschigen Brauen hielten mich mit sanfter Gewalt und schienen mir tief in die Seele zu blicken.
»Lasst Euer Herz leer werden, Domna Ermengarda«, sprach er in leisem Ton. »Macht es leer von menschlichen Sorgen und Nöten und füllt es allein mit Gott.«
Es war still im Raum. Nur das Feuer knisterte. Das Blut pochte mir in den Schläfen, aber ich konnte den Blick nicht von ihm wenden. Es war, als spürte ich eine höhere Gegenwart um uns herum.
»Hat die Jungfrau Maria nicht ebenfalls einen Sohn in Schmerzen geboren und ihn geliebt wie keinen anderen?«, hörte ich ihn sagen. »Und hat ihn dennoch hergegeben, für uns alle geopfert, auf dass wir erlöst werden von den Sünden der Welt? Wollen wir jetzt so kleinmütig sein, dies zu vergessen und uns verweigern, wenn Gott uns ruft?«
Ich sah ihn betroffen an.
Was konnte man darauf erwidern?
Entgegen meinen guten Vorsätzen hatte die Begegnung mit dem Abt von Clairvaux mich verunsichert und aufgewühlt. Noch weniger war ich auf das vorbereitet, was sich am frühen Nachmittag auf der caularia, dem Marktplatz vor dem Palast, abspielen sollte.
Hatte ich geglaubt, nur wenige würden ihr Tagewerk für einen hohen Kirchenmann unterbrechen, so wurde ich eines Besseren belehrt. Von überall her waren sie zusammengeströmt und hatten stundenlang gewartet, um den ehrwürdigen Abt zu hören. Der sonst so beschauliche Marktplatz war ein Meer von Köpfen und Leibern, schien zu beben und zu branden, das Stimmengewirr unbeschreiblich. Menschentrauben drängten sich auf den Wehrgängen der flussnahen Mauer, und sogar auf den Dächern harrten sie geduldig trotz des kalten Windes, der vom Meer her über die Stadt fegte. Von den Zinnen des erzbischöflichen Palastes gegenüber flogen und knatterten kirchliche Banner wie nur an den höchsten Festtagen, während zerrissene Wolkenmassen über den Winterhimmel segelten.
In wollene Tücher und einen Pelz gehüllt, stand ich auf der Zinne des palatz vescomtal, an meiner Seite Fraire Aimar, Raimon und Felipe de Menerba. Von hier oben konnten wir alles überblicken. Viele erkannten mich und winkten mir zu.
Eine Rednertribüne war eilig gezimmert worden. Davor schützten Soldaten des Erzbistums einen mit Seilen abgesteckten Bereich für den Stadtadel und die reiche Bürgerschaft, die sich heute in festlichen Farben und Gewändern zeigten. Gassenjungen gaben sich verstohlen Zeichen. Dies war ein großer Tag für Spitzbuben und Beutelschneider.
Am Wassertor brach eine wütende Rempelei aus, als noch mehr Menschen auf den Platz drängten. Mitten in diesem Geschiebe sah ich Mütter mit Säuglingen auf dem Arm, sogar eine Schwangere, die ohnmächtig in den Armen ihres Mannes lag, während Beistehende ihr Luft zufächelten. Unter mir, am Fuß der Palastmauer, schrie ein kleines Mädchen nach der Mutter. Ein Wachmann fischte es aus dem Gedränge, bevor es erdrückt wurde, und wischte ihm die Tränen von den Bäckchen. Am liebsten hätte ich es selbst in die Arme genommen und musste doch über meine Vernarrtheit lächeln. Hatte ich denn nur noch Augen für Kinder und schwangere Weiber?
»Da kommen sie«, rief Raimon und deutete auf den Bischofspalast, wo Wachleute mit Schild und Speer eine Schneise durch die Menge bahnten.
Ein Raunen brandete jetzt über den Platz, jeder reckte den Kopf. Von Bewaffneten umgeben und vom Jubel der Umstehenden begleitet, bewegte sich Abt Bernards hohe Gestalt langsam auf die Tribüne zu, gefolgt von Erzbischof Leveson, der vom Domdechant gestützt wurde. Trotz seiner Altersschwäche wollte Leveson es sich wohl nicht nehmen lassen, ein wenig vom Glanz seines Besuchers abzubekommen. Dabei hätte der Gegensatz zwischen beiden nicht größer sein können. Leveson unter seidenem Baldachin im prunkvollen, goldverzierten Ornat des Kirchenfürsten. Clairvaux dagegen nach wie vor in einfacher Mönchskutte.
Vielleicht liebten sie ihn deshalb, denn das Freudengeschrei toste zu einem ohrenbetäubenden Sturm auf, als er die Bühne erklomm. So hatten sie auch mich einmal geehrt, damals vor vier Jahren, als es gelungen war, im Handstreich die Stadt zu nehmen, meine Stiefmutter zu vertreiben und die verhasste Tolosaner Fremdherrschaft abzuwerfen. Ich stellte mir vor, wie Clairvaux sich fühlen musste, wie er von der Tribüne herunter die begeisterten Massen zu seinen Füßen segnete.
»Seltsam, wie die Dinge sich verkehren«, raunte Bruder Aimar mir zu. »Lange Zeit wollte niemand mehr etwas von einem Krieg gegen die Ungläubigen wissen. Outremer, das war weit. Höchstens etwas für überzählige Söhne und landlose Abenteurer. Aber seit Clairvaux seine Predigten hält, weht ein gewaltiger Sturm durch alle Lande.«
»Als hätten wir nicht genug mit anderen Dingen zu tun.«
»Nicht nur zu den Türken wollen sie den Krieg tragen, auch die Wenden, östlich des Elbflusses, sollen mit dem Schwert bekehrt werden. Und gegen die spanischen Mauren wird ebenfalls gerüstet.«
»Das ist verrückt. Es macht mir Angst.«
»Die Meute lechzt nach Blut. Am Rhein haben sie angefangen, Synagogen anzuzünden und die Juden umzubringen.«
Mon Dieu, dachte ich. In was für Zeiten leben wir?
»Raimon, sieh zu, dass das Judenviertel gesichert ist. Du bürgst mir dafür.«
Narbonas große jüdische Gemeinde leistete einen bedeutenden Beitrag zum wirtschaftlichen Wohlergehen der Stadt und genoss mein besonderes Wohlwollen.
»Die Streifengänger wurden bereits verdoppelt«, erhielt ich zur Antwort. »Im schlimmsten Fall errichten wir Absperrungen.«
Unten auf der Tribüne hob Abt Bernard die Hände zum Zeichen, dass er anfangen wollte. Doch es dauerte noch lange, bis das Getöse verebbte und Ruhe eintrat.
»Narbonenser«, hallte seine kräftige Stimme über den Platz. »Vor euch stehe ich als Gesandter des Heiligen Vaters und danke euch, dass ihr so zahlreich gekommen seid. Gott schaut auf euch herab. Seine Gnade sei mit euch!«
Dies führte zu erneutem Applaus. Dann berichtete er von den vielen Menschen landaus, landein, die sich rüsteten, Gottes Ruf zu folgen. »Wie ihr wisst, hat König Louis sein Gelübde abgelegt. Zu dieser Stunde beginnen die Heere der Franken sich zu sammeln.« Er verkündete die große Neuigkeit, dass nun auch der Alemannenkönig Konrad bei Gott geschworen habe, ins Heilige Land zu ziehen. Diese Nachricht wurde mit gewaltigem Jubelgeschrei aufgenommen, das lange nicht aufhören wollte.
Ich blickte zu Aimar hinüber. »Hast du das gewusst?«
»Konrad hat lange gezögert, hab ich mir sagen lassen. Zu Weihnachten haben sie ihn endlich überredet. Ich vermute, man hat ihm die Kaiserkrönung in Rom versprochen.«
Bernard hatte sich warmgeredet. Seine Stimme wurde eindringlicher und beschwörender, als er von den Nöten unserer Brüder und Schwestern in Outremer sprach, von der Türkenbrut, die sich erhoben habe und das Heilige Land bedrohe. Er sprach vom Verlust der Christenstadt Edessa.
»Es hat den ungläubigen Teufeln nicht genügt, die Mauern zu erstürmen«, rief er mit zornerfüllter Stimme. »Nein, sie mussten die Kirchen niederbrennen, fromme Christinnen schänden und ausnahmslos alle, Mann, Weib oder Kind, niedermetzeln und erschlagen, bis das Blut Tausender durch die Gassen rann. Die ganze Stadt haben sie entvölkert, auf dass an diesem Ort kein christliches Gebet, kein Lob des Herrn mehr erklänge. Das sind die Mächte des Satans, die Feinde Gottes. Ich sage euch, Edessa ist nur der Anfang, denn sie haben geschworen, uns ins Meer zu werfen. Und sie werden nicht ruhen, bis es ihnen gelingt, bis sämtliche Erinnerung an Jesus Christus in Outremer ausgelöscht ist.«
Diese Worte entfachten den wilden Zorn der Leute. Ein tiefes Grollen ließ sich hören. »Tod den Sarazenen!«, riefen sie. »Rache für Edessa!« Ein Tumult drohte auszubrechen. Ich bekam Angst, dass die Meute in ihrer Wut die wenigen Wachen niedertrampeln und sich ins Viertel der Juden ergießen könnte, um zu plündern und zu morden. Doch Clairvaux gelang es, sie wieder zum Schweigen zu bringen.
»Warum lässt Gott es zu?«, fragte er sie. »Ist er nicht allmächtig? Kann er nicht eine Legion Engel schicken, um die Teufelsbrut hinwegzufegen?«
Nun hatte er wieder ihre Aufmerksamkeit.
»Natürlich kann er das. Es wäre ihm ein Leichtes, diese Geisel von uns zu nehmen. Aber haben wir es denn verdient?«, brüllte er und schüttelte die Faust. »Haben wir nicht gesündigt? Gelogen, gestohlen, gehurt und gemordet? Haben wir nicht den Freund verraten, die Armen ausgeplündert und uns unrechtmäßig bereichert? Große Herren schämen sich nicht, ihre Bastarde vor aller Welt zu zeigen, und ihre Weiber beten in den Kirchen, aber im Geheimen treiben sie Unzucht und Ehebruch. Ein jeder von euch hier soll sein Herz erforschen und mir sagen, ob er frei ist von Sünde.«
Brüsk hielt er inne und blickte sich um, als würde er jedem Einzelnen in die Seele starren. Die Leute senkten beschämt die Augen. Kein Laut war zu hören. Unwillkürlich hielt auch ich den Atem an, denn trug ich nicht ein Kind der Sünde in mir?
Nach schmerzhaft langer Pause fuhr Bernard fort, diesmal wesentlich leiser, und dennoch, in dieser reuevollen Stille reichten seine Worte bis in den hintersten Winkel des Platzes. »Seht ihr? Das ist der Grund, warum Gott keine Engel schickt. Denn wir alle sind elende Sünder und haben es nicht besser verdient. Unsere Brüder und Schwestern im Osten werden gemeuchelt, weil wir Gottes Gebote missachten.«
Nach einer wirkungsvollen Pause hob er die Hände in einer fast hilflosen Geste. »Was können wir tun?«
Betretene Gesichter überall. Viele bekreuzigten sich.
»Sag es uns!«, verlangte einer. Andere nahmen den Ruf auf. »Ja, sag es uns«, schrien sie. »Sag es uns!«
Bernard reckte das Kinn in die Höhe. »In Wahrheit, meine Söhne und Töchter«, rief er nun mit breiter Brust, »solltet ihr froh sein und Gott danken. Denn seht ihr nicht, dass er statt Engel euch schickt, euch allein. In seiner Barmherzigkeit gibt er euch Gelegenheit, es wiedergutzumachen, euch von der Sünde reinzuwaschen und seiner Gnade würdig zu erweisen. Für eine bessere Welt, für Christus, für unseren Erlöser!«
»Amen«, schallte es aus der Menge. »So soll es sein.« Und: »Der Herr sei gelobt.«
»Wer ein Schwert führen kann«, donnerte Bernard, »soll sich den frommen Kriegern anschließen. Wer einen Sohn hat, der soll ihn zu Gott senden, denn auch Er hat Seinen Sohn für uns gegeben. Ein Ritter Christi tötet mit gutem Gewissen. Und noch ruhiger stirbt er selber, denn wenn er stirbt, kommt er ins Himmelreich. Wenn er tötet, nützt er Christus. Für Christus grausam zu sein ist die höchste Stufe der Seligkeit.«
Die Menge unter mir war jetzt von einer gewaltigen Unruhe erfasst. Der ganze Platz war in Bewegung. Immer mehr fingerten an ihren Rosenkränzen und begannen zu beten. Vor der Tribüne sank ein Weib ohnmächtig zu Boden.
»Ich frage euch«, brüllte Abt Bernard noch einmal aus voller Brust. »Sollen Nazareth und Bethlehem den Ungläubigen in die Hände fallen? Können wir es zulassen, dass das Heilige Grab Christi geplündert wird?«
»Nein!«, schrie die Menge zurück. »Tod den Ungläubigen! In ihrem Blut sollen sie ersaufen.«
»Dann geht fort und kämpft. Ad Dei gloriam. Kämpft für Gottes Ruhm, und alle Sünden werden euch vergeben sein.«
Und wie um seine Worte zu bekräftigen, fiel plötzlich eine heftige Bö über den Platz her, riss Mützen von den Köpfen und ließ die Banner knattern. Der Wind blähte Bernards Gewand und ließ ihn übermächtig erscheinen, während er dastand, die Arme weit ausgebreitet, wie Moses auf dem Berg Sinai.
Nun war der Tumult vollständig. Die Menge tobte. Mönche stimmten Hymnen an, viele fielen in den Gesang ein, Tränen rannen auch über harte Männergesichter. Und auf einmal schallte es: »Sant Bernard, segne uns. Sant Bernard! Sant Bernard.«
Nun wollten sie nicht mehr aufhören, ihn einen Heiligen zu nennen und sich an seinem Namen heiser zu schreien, denn jeder hatte vom Wunder der lactatio Bernardi gehört, von der Mutter Gottes, die diesen Auserwählten von der Milch ihrer Brüste genährt hatte, um ihm ewige Weisheit zu schenken. Wer Platz fand, kniete nieder. Man umarmte sich, Frauen weinten, Mütter hoben ihre Säuglinge in die Höhe und flehten um Bernards Segen. Alles lärmte und johlte durcheinander.
Und der Abt ließ es zu, dass sie ihn einen Heiligen nannten, und hörte nicht auf, die Menschen zu segnen, die nun ihre Gesichter hoffnungsvoll zu ihm aufhoben und seinen Namen riefen. »Sant Bernard, Sant Bernard!«
Das Schauspiel der tobenden Menge war überwältigend, erhebend und schaurig zugleich. Trotz meiner Furcht vor den Auswüchsen dieser Begeisterung hallten seine Worte in mir wider, so dass auch ich widerwillig mitgerissen war.
»Mon Dieu!«, entfuhr es mir. »Wenn heute bloß niemand zu Tode kommt.«
Aimar nickte mit bitterer Miene. »Im ganzen Christenreich hat dieser Mann einen Brand entfacht, der nicht mehr zu löschen ist.«
Aimars Worte lösten den Bann in mir, und ich erkannte ernüchtert den ganzen Wahnsinn dieser Rede. Ums Töten ging es ihm, nur ums Töten. Was hatte das noch mit Christus’ Botschaft der Liebe zu tun? Und ich, armes Weib, sollte ich mich etwa schämen, dass ich ein unschuldiges Kind unter dem Herzen trug, dass ich einem Menschlein das Leben schenken durfte? Ich hatte wahrlich genug, und so flohen wir in den Palast.
Dort sagte Aimar noch etwas, das mir lange zu denken gab. Man müsse sich fragen, meinte er, warum der Papst gerade jetzt von einer Bedrohung spreche und zum Kampf gegen die Ungläubigen aufriefe. Wenn sich doch seit langem niemand mehr um Outremer geschert habe.
»Das Volk ist in den letzten Jahren unruhig geworden. Immer mehr Wanderprediger und Ketzer sind unterwegs, die gegen die fetten Pfründe der Geistlichen predigen. Denen laufen viele zu, sogar Adelige. Vielleicht sucht Rom ein Feindbild in der Fremde, um abzulenken. Das würde erklären, warum Clairvaux sich so aufopfernd für diesen Krieg einsetzt.«
Der Leibeigene
Die Bluthunde hatten die Fährte aufgenommen und zerrten aufgeregt jaulend an den Leinen ihrer Führer. Vorsichtig folgten die Männer, denn der, den sie jagten, war wahrscheinlich bewaffnet.
Auch Arnaut brachte seinen Wallach in Bewegung. Der Atem des Pferdes hinterließ Dampfwolken in der kalten Luft. Die Hunde liefen mit feuchten Nasen dicht am Boden, zögerten gelegentlich, um die Witterung zu prüfen, fanden dann untrüglich zur unsichtbaren Spur zurück, die seit geraumer Zeit das Tal verlassen hatte und in dichtbewachsene Höhen führte.
»Dachte ich’s mir«, knurrte der alte Gustau, Wildhüter von Rocafort. »Hockt da oben in den Höhlen.«
Eine gleißende Wintersonne zwang ihn, die Lider zusammenzukneifen. Sein Blick wanderte über die Bergkuppe, wo kalkweiße Felsen aus den dunklen Wipfeln der immergrünen Buchsbäume und Steineichen ragten.
»Bist du sicher?«, fragte Raol, sein Herr.
»Gibt nirgendwo bessere Verstecke.«
Gustau nahm die Kappe ab und wischte den Schweiß von der Stirn. Er war wie die Hundeführer zu Fuß unterwegs. Die gewaltige Hakennase und der graue, zottelige Schnauzbart darunter waren die auffälligsten Merkmale in diesem wettergegerbten, von Falten übersäten Gesicht, das Arnaut besser kannte als sein eigenes. Wie oft hatte er nicht als Junge den Wildhüter begleitet, der mehr mit Tieren und Bäumen sprach als mit den Menschen.
»Dann lassen wir besser die Pferde hier«, sagte Arnaut. »Ab jetzt heißt es klettern.« Er ließ sich aus dem Sattel gleiten und warf Jori, seinem jungen Reitknecht, die Zügel zu. »Pass auf die Gäule auf, bis wir zurück sind.«
Sein Onkel Raol und die beiden Wachleute von der Burg stiegen ebenfalls von den Pferden. Sie ließen ihre warmen Umhänge zurück. Der Weg zur Bergkuppe würde schweißtreibend genug werden, trotz des kalten Winterwetters. Nur ein paar Wasserschläuche und die Schwerter behielten sie bei sich.
Die Hunde zogen ihre Führer über kaum erkennbare Wildpfade den Berg hinauf. An manchen Orten war es steil und unwegsam. Die Männer mussten sich durch Dornen und Gestrüpp zwängen, stolperten über loses Geröll, zogen sich an den harten Strünken der Buchsbäume empor oder nutzten zähe Wurzelstränge als Stufen. Immer bergauf, über Lichtungen voll winterbleichem Kraut und mit Rauhreif überzogenen Beerensträuchern, über steile Felshänge, wo nur Krüppelkiefern gediehen und alter Schnee in den Spalten lag.
An einer Stelle gebärdeten sich die Hunde wie toll, schnüffelten im verwelkten Gras, hoben erregt die Köpfe und schlugen an. Überlaut hallte ihr Gebell in der Stille des Berges, durchsichtige Atemwölkchen aus den Kehlen vergingen im Licht der Sonne.
»Er muss verwundet sein«, meinte einer der Hundeführer und deutete auf ein paar rote Tropfen, die an einem Grashalm hingen. Sie hatten auch zuvor schon Blutspuren gefunden.
Gustau beugte sich vor. »Noch frisch«, murmelte er.
Senher Raol atmete heftig, Schweiß perlte auf seiner Stirn. »Putan, ich werde zu alt für so was«, fluchte er.
Raol de Montalban, castelan von Rocafort und Herr über das ganze Tal, war ein hochgewachsener Mann in den frühen Fünfzigern. Silberne Strähnen zogen sich durch dunkles Haar, das ein schlankes Gesicht mit harten Zügen rahmte. Die Familienähnlichkeit zwischen ihm und Arnaut war unverkennbar, auch wenn Raols Miene meist verschlossen, ja fast grimmig wirkte, so dass er manchem, der ihn nicht näher kannte, Furcht einflößen konnte. Er zog ein wenig das Bein nach. Eine alte Wunde aus den Jahren in Outremer, einer Zeit in seinem Leben, über die er hartnäckig schwieg.
Auch Arnaut war es beim Aufstieg warm geworden, doch sein Atem ging ruhiger, denn er war nicht einmal halb so alt wie sein Oheim und durch tägliche Waffenübungen besonders gut bei Kräften.
»Da, trink«, lachte er und reichte ihm den Wasserschlauch. Raol erfrischte sich in langen Zügen und wischte dann mit dem Ärmel den Schweiß vom Gesicht.
Wegen Jaufrés Krankheit war Arnaut schon seit Wochen auf Rocafort. Er liebte seinen Großvater und wollte zur Hand sein, falls es mit ihm zu Ende gehen sollte. Obwohl der alte Herr sich in den letzten Tagen ein wenig erholt hatte, musste man in seinem Alter mit dem Schlimmsten rechnen.
Heute Vormittag, Arnaut sattelte gerade sein Pferd für den täglichen Ausritt, waren sie gekommen, ihn zu holen. Einer sei erschlagen worden, man müsse sich beeilen, den Flüchtigen zu fangen. Mehr aus Langeweile hatte er sich ihnen angeschlossen.
»Wie heißt der Mann eigentlich?«, fragte er.
»Loris.« Einer der Wachmänner, ein vierschrötiger Kerl, drehte sich zu ihm um. »Leibeigener Bauer. Trinkt gern über den Durst. Dann kann er seinen Zorn nicht beherrschen.«
»Hatte Pech in letzter Zeit«, fügte der andere Kriegsknecht hinzu. »Vor zwei Jahren hatten wir eine schlechte Ernte, und seine Felder liegen am Hang. Steiniger Boden. Ihn hatte es besonders getroffen. Und letzten Sommer hat er sich im Suff mit dem Nachbarn geprügelt. Der hat sich dann angeblich rächen wollen und ihm den Großteil seines Korns abgebrannt.«
»Du hast doch eingegriffen, Oheim, oder?«
Senher Raol zuckte mit den Schultern. »Keiner will’s gesehen haben. Du weißt, wie die sind. Wollen es unter sich ausmachen.«
»Was ihm an Korn geblieben war, brauchte er für die Wintersaat«, fuhr der Wachmann fort. »Der Frau und den Kindern zuliebe hat Senher Raol ihm die Abgabe erlassen, denn mehr als seine Viecher und etwas Kohl waren ihm nicht geblieben. Tja, und dann ist ihm auch noch die einzige Kuh verreckt. Jetzt muss die Frau im Dorf betteln gehen, damit die Kleinen etwas Milch bekommen.«
Der Mann nahm einen Schluck aus seinem Wasserschlauch, spülte den Mund aus und spuckte den Rest ins Gras. »Man kann verstehen, dass er durchgedreht ist.«
»Mord ist Mord«, knurrte Raol, und der Wachmann senkte den Blick, denn es war nicht ratsam, mit Senher Raol zu streiten. Nicht, wenn er wütend war.
»Was ist geschehen?«, fragte Arnaut.
»Die verfluchten Pfaffen von Cubaria!« Raol spie die Worte förmlich aus. »Wollten nicht auf ihren Zehnten verzichten. Auch keinen Aufschub gewähren. Statt mit mir zu reden, sind sie mit zwei Bewaffneten angerückt, um ihm auch noch das Letzte zu nehmen. Einen von denen hat er erschlagen, dann ist er weggelaufen.«
»Böse Sache.«
»Alles nur, damit der Erzbischof sich die Füße wärmen kann.«
»Erzbischof Leveson von Narbona?«
»Wer sonst? An ihn muss Cubaria abführen.«
Das Kloster Cubaria lag nicht weit von Rocafort entfernt und besaß das Zehntrecht der Kirche für das nähere Umland. Nach altem Brauch behielten die Mönche davon ein Drittel, der Rest ging an die erzbischöfliche Diözese.
»Möchte gern wissen, warum sie es noch den Zehnten nennen«, murrte Raol aufgebracht, »denn jetzt nehmen sie sich schon das Doppelte. Per decretum episcopalis. Eine Schande, sag ich dir.«
Onkel Raol, sonst wenig gesprächig, war richtig in Fahrt gekommen. »Wenn sie mit dem Geld wenigstens etwas Vernünftiges anstellen würden, den Armen helfen oder Spitäler bauen. Nichts davon. Sie selbst aber leben in Saus und Braus, die hohen geistlichen Herren. Überall schießen Kirchen und Klöster aus dem Boden. Man fragt sich, wie viele heilige Faulpelze sollen die armen Bauern noch ernähren? Rom ist eine unersättliche Hure, die nach Reichtum und Macht giert. Und ihre Priester sind wie Heuschrecken, die das Land kahlfressen.«
»Du übertreibst, Onkel. Wir nehmen doch auch unseren Ernteanteil«, sagte Arnaut.
»Aber laufen wir etwa in Gold gekleidet umher? Ich kümmere mich wenigstens um mein Landvolk. Wenn es ihnen schlechtgeht, zu wem kommen sie dann, eh?«
Arnaut nickte. Außerhalb der Städte herrschten keine Fürsten, sondern Kastellane wie Onkel Raol. Er blickte ins weite Tal hinab. Alles Land zwischen den beiden Bergrücken Nord und Süd gehörte der familia bis hinauf zu den Hängen des Bugarach, des höchsten Gipfels der Gegend, der das Tal von Westen her begrenzte. Hier war er nach dem frühen Tod seines Vaters aufgewachsen, zusammen mit seinen Geschwistern Robert und Ada, und jeder Winkel war ihm vertraut.
Unter ihnen waren die langen Rechtecke der Äcker auszumachen. Ockerfarben und grün die brachen Felder und Wiesen, braun, wo der Winterweizen schlummerte, und an den Hängen die schwarzen, knorrigen Strünke der abgeernteten Rebstöcke. Auf einem steil aufragenden Felsen über dem Flüsschen Agli thronte die Burg Rocafort, völlig unzugänglich von der Flussseite her. Auf der anderen Seite, wo das Dorf ein gutes Stück über dem Talgrund lag, war der Hang weniger abschüssig. Dort schützte eine hohe Ringmauer die Vorburg und eine zweite die höher gelegene innere Burg mit Wehrturm und Herrenhaus. Eine wahre Festung und mit genügend Wasser in den Zisternen kaum einnehmbar.
»Was kümmern dich die Mönche?«, sagte Arnaut. »Du bist doch Herr in diesem Tal.«
Raol hatte noch einmal ausgiebig getrunken. Jetzt gab er den Wasserschlauch zurück.
»Wären die Pfaffen zu mir gekommen, wäre das nicht geschehen. Aber jetzt, sosehr es mich ärgert, muss ich den armen Teufel richten, denn einen Totschlag kann ich ihm nicht durchgehen lassen.«
Er bedeutete den Hundeführern, dass es weiterging. Begierig nahmen die Tiere die Fährte wieder auf, und die Männer reihten sich hinter ihnen ein, um die letzte Strecke in Angriff zu nehmen.
Arnaut lebte seit Jahren im fernen Narbona. Seitdem schien sich auf dem Lande einiges verändert zu haben. Oder hatte er es nur vorher nicht bemerkt? Schon immer hatten Kastellane und Gutsherren über die Händler geklagt, die einen angeblich übers Ohr hauten, wenn sie kamen, um Wein, Schafswolle und Oliven anzukaufen. Aber in letzter Zeit schienen sie sich mehr über den Hochmut der Äbte und Kirchenfürsten aufzuregen. Und man hörte von frommen Männern, die barfuß und in Sacktuch gingen und das Volk beunruhigten. Rom sei die Kirche des Satans, verkündeten sie, man müsse sich von ihr lossagen. Und dennoch, wenn wie überall über den päpstlichen Aufruf zum Zug ins Heilige Land geredet wurde, waren die meisten dafür. Wie war das in Einklang zu bringen?
Die Männer mühten sich durch dichtes Gestrüpp und um einen mächtigen Felsvorsprung herum. Den Himmel konnte man kaum sehen, so hoch und dicht stand das Gesträuch. Ein frischer Fußabdruck fand sich an einer weichen Stelle, niedergetretenes Kraut und ein geknickter Zweig an einer anderen. Ein Stück weiter, auf einem moosbewachsenen Stein, entdeckten die Hunde eine weitere Blutspur. Hier musste er gesessen haben, um sich auszuruhen. Die Hunde wurden immer unruhiger und waren kaum zu halten, so sehr zerrten sie an den Leinen.
»Haltet die Kläffer still«, befahl Raol. »Weit kann er nicht sein.«
Plötzlich endete das Gestrüpp, und sie standen vor einer gewaltigen, zerklüfteten Felswand. Zwischen grauweißen, schräg übereinanderliegenden Gesteinsschichten hatten Wind und Wasser tiefe Furchen und Spalten gegraben. Dunkle Löcher ließen sich erkennen, halb überwuchert von Krüppelkiefern und zähen Sträuchern. Darauf steuerten die Hunde zu. Die Männer folgten vorsichtig, kletterten über Felsplatten und Geröll. Als sie nahe genug herangekommen waren, hob Gustau die Hand, und sie blieben stehen. Die Kriegsknechte zogen ihre Schwerter.
»Loris«, rief der Kräftigere von ihnen. Er hatte eine rauhe Bassstimme. »Besser, du kommst jetzt raus.«
Arnaut sah auf, als eine Krähe lärmend davonstob. Die Hunde achteten nicht auf den Vogel, sondern starrten mit erhobenen Köpfen und zitternden Flanken unentwegt auf die Felsspalte und fiepten dabei vor Erregung.
Doch es rührte sich nichts.
Der Wachmann legte die Hände wie einen Trichter um den Mund. »Loris!«, brüllte er so laut, dass es von den Felsen widerhallte. »Wir wissen, dass du hier bist.«
Darauf schlugen auch die Hunde wieder an, bis sie von ihren Führern beruhigt wurden.
Sie warteten. Nicht einmal ein Lufthauch war zu spüren. Arnaut fragte sich allmählich, ob sie überhaupt auf der richtigen Fährte gewesen waren. »Vielleicht sind wir einem Fuchs nachgelaufen«, sagte er halb im Scherz.
Gustau schüttelte den Kopf. »Er ist hier«, raunte er.
»Loris! Komm endlich raus, sonst müssen wir dich holen«, brüllte der Wachmann.
Da tönte eine Stimme aus der Tiefe der Spalte.
»Der Erste, der sich nähert, kriegt meinen Speer in den Wanst.«
»Hast du damit den Söldner umgebracht?«
»Was geht dich das an, Simon? Ich erkenne dich an deiner versoffenen Stimme. Komm nur her. Ich stech dich ab.«
»Mach keine Umstände, ome!«, rief der Wachmann. »Du bist verwundet.«
»Nur ein Kratzer.«
»Sieben gegen einen. Wir packen dich, gleich wie.«
»Mich kriegt ihr nur tot. Lebendig komme ich nicht mit.«
Raol und Arnaut tauschten einen Blick aus.
Nun trat Gustau ein paar Schritte vor. »Loris«, sagte er ruhig, aber gut hörbar. »Du hast genug Unsinn angestellt. Willst du noch jemanden umbringen?«
»Soll ich mich etwa vom Kastellan hängen lassen?«
»Ob du hängst, wird sich zeigen«, mischte Raol sich ein. »Leg den Speer weg und komm raus.«
»Und wenn nicht?«
»Dann legen wir Feuer und räuchern dich aus.«
Nun war es wieder eine Weile still, während Loris dies bedachte.
»Ich will nicht am Galgen hängen«, rief er dann.
»Hättest du dir früher überlegen sollen«, sagte Raol. »Aber noch sind wir nicht so weit. Erst will ich die Sache untersuchen.«
Doch Loris schien den Worten nicht zu trauen. »Wer kümmert sich um meine Kinder, wenn Ihr mich hängt, Castelan?«
»Du weißt, ich lasse keine Kinder hungern.«
»Und mein Weib? Sie ist ein gutes Weib.«
Plötzlich hörten sie ihn schluchzen.
»Ich weiß das«, sagte Raol fast sanft. »Nun sei vernünftig, Mann.«
Lange war es still. Schließlich bewegten sich die Büsche vor der Felsspalte und ein hagerer Mann mit wirrem Schopf erschien, bleich, verweint, einen alten Speer in der Hand. Unsicher trat er näher, legte die Waffe auf den Boden. Der Ärmel seines linken Arms war blutgetränkt. Er erhob sich, heftete einen trotzigen Blick auf Raol und nahm die Schultern zurück.
»Meiner Familie soll es gutgehen.« Er wischte sich mit dem Handrücken übers Gesicht. »Ihr habt es versprochen, Herr.«
Raol nickte.
»Ihr habt es versprochen«, sagte Loris noch einmal, eindringlicher als zuvor.
Simon, der Kriegsknecht, wollte ihn binden, aber Raol untersagte es, da der Mann die Hände frei für den Abstieg brauchen würde. Sie nahmen ihn in die Mitte. Er schien sich in sein Schicksal ergeben zu haben. Doch als sie den Weg ins Tal einschlagen wollten, griff er plötzlich in sein Hemd und riss ein Messer heraus.
»Ich will nicht hängen!«, schrie er wie von Sinnen.
Und bevor jemand eingreifen konnte, hatte er sich selbst mit einem Ruck von Ohr zu Ohr die Kehle durchschnitten. Die Männer standen gelähmt vor Schreck. Loris selbst starrte fast ungläubig an sich herunter, als das Blut in einem Schwall aus der schrecklichen Wunde sprudelte, im Nu den Kittel durchtränkte und über die Stiefel auf den Boden rann. Dann schwankte er, verdrehte die Augen, bis nur noch das Weiße zu sehen war, und sank langsam nieder. Eine Weile noch zuckte sein Leib, während das Blut aus ihm strömte und die Erde dunkel färbte. Dann regte er sich nicht mehr.
»Putan merda!«, entfuhr es Raol. »So ein Esel.«
Seine Lippen waren weiß, die Stirn finster vor Zorn.
Lange Zeit sagte niemand etwas. Selbst die Hunde wagten keinen Laut von sich zu geben. Dann zerrten die Männer den Leichnam in die Felsspalte und bedeckten ihn mit Steinen, um ihn vor wilden Tieren zu schützen. Raol würde Leute aus dem Dorf schicken, um die sterblichen Reste zu bergen. Auch wenn er sich selbst gerichtet hatte, sollte Loris ein christliches Begräbnis haben.
Auf dem Rückweg sprachen die Männer kein Wort, bis sie wieder bei den Pferden angekommen waren.
»Hättest du ihn gehängt?«, fragte Arnaut.
Sein Onkel blickte ihn abschätzend an. Der Mund war hart, als er antwortete. »Verdient hätte er es. Aber vielleicht hätte ich ihn auch dazu verdammt, mit dir zu ziehen.«
»Mit mir? Wohin?«
»Auf euren blödsinnigen Heerzug nach Outremer. Redet doch alle Welt davon.«
»Wer sagt, ich nehme das Kreuz?«
»Weil du aussiehst wie einer, der auf Ruhm und Ehre hält. Und zu jung, um zu wissen, wie wenig sie wert sind.«
Damit kehrte er seinem Neffen den Rücken zu und zog sich fußmüde in den Sattel.
Der Kastellan und seine Wachmänner schlugen den Weg zum Hof der Witwe ein, um ihr die Nachricht vom Tode ihres Mannes zu überbringen.
Schweigend kehrten die Übrigen zur Burg zurück. Auch Arnaut war nicht nach Reden zumute. Was Gustau betraf, der sprach ohnehin selten, und die jungen Männer aus dem Dorf, die als Hundeführer dienten, trauten sich nicht, in Arnauts Gegenwart den Mund aufzutun.
Der Tod des Bauern hatte Arnaut getroffen. Lag die Schuld allein bei den Mönchen von Cubaria? Oder hätte Onkel Raol sich anders verhalten sollen? Aber schließlich hatte dieser Loris einen Mann erschlagen. Das Recht musste gewahrt werden. Ohne Recht würde alle Ordnung zusammenbrechen.
Andererseits hatte Loris zur familia gehört, und die war gegen Außenstehende zu verteidigen. Den Mönchen stand es nicht zu, ohne Zustimmung des Burgherrn einem von Rocaforts Bauern das letzte Brot aus dem Mund zu stehlen, auch wenn dieser ihnen den Zehnten schuldete. Die Sache würde noch ein Nachspiel haben. Hatte Raol deshalb sein Urteil mildern und den Mann zum Kriegsdienst im Pilgerheer verpflichten wollen?
Die scharfen Worte über Ruhm und Ehre nahm Arnaut ihm nicht übel. Das war Raols Art und nicht bös gemeint. Auf seine Ehre als Ritter und Edelmann ließ Arnaut nichts kommen, aber Ruhm? Danach verlangte es ihm nicht.
Das Ende dieses einfachen Mannes gab ihm jedoch zu denken. Ein Tod ohne Sinn, vielleicht sogar ein Leben ohne Sinn. Bei diesem Gedanken spürte er wieder das leichte Unbehagen, eine undeutliche Unzufriedenheit mit sich selbst, die sich seit geraumer Zeit in sein Herz geschlichen hatte, ohne dass er dafür den genauen Grund hätte nennen können.
Dabei ging es ihm gut. Es war vor Jahren ein glücklicher Zufall gewesen, der ihn und seinen Freund Severin nach Narbona gebracht und in den Dienst der jungen Erbin Ermengarda geführt hatte, gerade als sie gegen ihren Willen mit dem Grafen Alfons von Tolosa hatte verheiratet werden sollen. Ein abgekartetes Spiel, das dem Grafen das reiche Narbona als Mitgift, der ehrgeizigen Stiefmutter die Regentschaft und dem Erzbischof weitere Reichtümer und Ländereien eingebracht hätte. Doch Ermengardas wilde Flucht hatte ihnen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Wie eine Verbrecherin war sie verfolgt und gejagt worden. Felipe, Raimon, Severin und er hatten sie beschützt, nicht zu vergessen Bruder Aimar. Gegen alle Schwierigkeiten und Gefahren hatten sie zusammengehalten und Ermengarda geholfen, den väterlichen Thron zu erringen.
Damals, in der Einsamkeit und Wildnis der Berge, als alles verloren schien, hatte ihre heimliche Liebe begonnen. Fast ein Wunder, dass ausgerechnet er, der Sohn eines unbedeutenden Barons aus der Corbieras, die Zuneigung dieser klugen Fürstentochter hatte erringen können. Nun war sie Herrscherin über Narbona. Er selbst gehörte zu ihren engsten Beratern, war zum Kriegsherrn der Narbonenser Soldaten und ersten Ritter ihrer Turniere aufgestiegen. Sollte er sich da nicht wie Fortunas Liebling fühlen?
Vielleicht war es die Heimlichtuerei, die ihn ärgerte. Nie würde er sich öffentlich zu ihr bekennen, niemals sie als Braut nach Rocafort führen dürfen. Und auch wenn Ermengardas Ehe nur zum Schein bestand, so nagte es an ihm, dass sie aus Sicht der Kirche Ehebruch begingen. Doch immer, wenn er darüber sprach, wollte sie nichts davon wissen.
Ländereien und schöne Pferde hatte sie ihm geschenkt, an ihrer Tafel hatte er meist den Ehrenplatz. Aber er war ein junger Mann voller Tatendrang und fühlte sich manchmal unruhig wie ein Vogel im Käfig. Nur in Ermengardas Ratsversammlung zu sitzen und alten Männern zuzuhören war ihm nicht genug. Manchmal reizte ihn der Gedanke, einfach seinen Gaul zu satteln und neuen Abenteuern entgegenzureiten. Doch wie konnte er jemals Ermengarda verlassen?
Arnaut ahnte, dass seinem Leben eine Richtung fehlte. Onkel Raol schien seinen Platz in der Welt gefunden zu haben. Hier auf Rocafort führte er zwar ein einfaches Leben, aber als Kastellan trug er die Verantwortung für die gesamte familia, für Verwandte, Gesinde, Handwerker, Bauern und Kriegsknechte. Er war sein eigener Herr und außer Gott niemandem Rechenschaft schuldig. Arnaut würde ihn zweifellos eines Tages beerben. Aber war das seine Bestimmung? Oder gab es mehr?
Im Pferdestall der Vorburg half er Jori, seinem Pferd den Sattel abzunehmen, es trockenzureiben und mit frischem Heu zu versorgen. Der Wallach hieß Basil. Ein ruhiges, verlässliches Tier, ausdauernd und von kräftiger Statur. Arnaut strich ihm liebevoll über die Flanken, während er dem Jungen erzählte, was sich auf dem Berg zugetragen hatte.
Da bemerkte er einen der Hundeführer, der sich verlegen am Torpfosten des Stalls herumdrückte. Ein junger Bursche in Joris Alter. Aber wo Jori dunkelhaarig war, hing diesem eine struppige, rothaarige Mähne in das von Sommersprossen übersäte Gesicht.
»Was willst du?«, fragte Arnaut nicht unfreundlich.
»Escusa, Senher«, kam die schüchterne Antwort. »Ich habe gehört, was der Kastellan gesagt hat. Dass Ihr ins Heilige Land ziehen wollt.«
Was faselte alle Welt vom Heiligen Land? Voller Unmut zogen sich Arnauts Brauen zusammen.
»Und?«, erwiderte er gereizt. »Was hat das mit dir zu tun?«
»Ich würde gern mitkommen«, sagte der Bursche und fügte rasch hinzu: »Ich kann mit Pferden umgehen, Herr, und meine Mutter hat mich Kochen und Flicken gelehrt. Ich will Euch ein guter Knecht sein. Außerdem habe ich Bogenschießen gelernt.«
»Du willst dein Dorf und deine Mutter im Stich lassen?«
»Sie ist gestorben. Ich habe sonst niemanden.«
»Mit Hunden scheinst du dich ja auszukennen.«
»Ja, Herr.« Hoffnung glomm in den hellen Augen auf.
Der Bursche hatte ein offenes, ehrliches Gesicht und Arnaut begann, ihn zu mögen.
»Ich muss dich enttäuschen. Ich habe keinesfalls vor, das Kreuz zu nehmen. Also schlag es dir aus dem Kopf.«
»Ach, Herr«, bettelte der Junge. »Es ist mir gleich, wohin es geht. Wenn Ihr mich nur mitnehmt.«
Arnaut musste schmunzeln. Dem Burschen schien es ganz wie ihm selbst zu gehen.
»Hast du etwas ausgefressen, dass du fortwillst?«
»Nein, ich schwör’s. Ich würd nur gern die Welt sehen.« Er warf Jori einen hilfesuchenden Blick zu.
Der sprang ihm bei. »Bei deinen vielen Pferden kann doch ein zweiter Knecht nicht schaden, Arnaut«, sagte er.
Der vertraute Umgang zwischen Herrn und Diener stammte aus jenen Tagen, als Jori ebenfalls Mitglied von Ermengardas frecher Bande gewesen war. Ein halbverhungerter Straßenlümmel, den sie durch Zufall aufgelesen hatten. Jetzt war er siebzehn und hatte sich zu einem guten Reitknecht gemausert. Mehr als das, denn seit geraumer Zeit unterwies Arnaut ihn im Kampf mit Schwert und Lanze. Erstaunlich, wie dem dünnen Bengel kräftige Schultern und Arme gewachsen waren. Nicht besonders groß, aber geschickt und zäh war er, dazu ein großartiger Reiter. Der Gedanke lag also nahe, ihn als escudier, als Knappen und Schildträger, einzusetzen.
»Du hast nur vier Gäule zu versorgen. Ist dir das etwa schon zu viel?«
»Es kommt noch einer dazu. Hast du es schon vergessen?«
Rocafort besaß ein Gestüt mit edlen Pferden, die in der Gegend gefragt waren. Großvater und sein alter Kampfgefährte Hamid hatten den Grundstock mit sechs Arabern gelegt, die sie vor vielen Jahren aus Outremer mitgebracht und mit einheimischen, größeren Rassen gekreuzt hatten. Sie bildeten sie zu Schlachtrössern aus und erzielten sündhaft teure Preise. Arnaut hatte vor, einen jungen Hengst nach Narbona mitzunehmen, um ihn für sich weiter abzurichten.
»Gut. Fünf also.«
»Und mit all den anderen Dingen, die ich zu tun habe …«
Arnaut fing einen Blick zwischen den beiden Jungs auf.
»Habt ihr euch etwa abgesprochen?«, fragte er misstrauisch. »Ah, ich verstehe. Du strebst nach Höherem und suchst dir einen, der deine Arbeit verrichtet. So läuft das hier.«
Jori senkte unterwürfig die Augen, konnte sich aber ein verschämtes Grinsen nicht verkneifen, woraufhin Arnaut den Blick gen Himmel hob, als flehe er den Herrn um Beistand an. Dann musterte er erneut den Bauernburschen, der ihn mit großen Augen erwartungsvoll anstarrte.
»Daraus wird nichts«, sagte Arnaut. »Senher Raol wird nie seine Einwilligung geben. Wo kämen wir hin, wenn ihm alle jungen Bauern wegliefen, um die Welt zu sehen.«
»Er hat schon«, wandte Jori ein.
»Hat was?«
»Zugestimmt.«
»Was?«
Beide Jungs nickten heftig und grinsten sich zu.
»Dann warst du es, der ihm die Sache mit Outremer eingeflüstert hat?«, fragte er Jori.
»Irgendeinen Grund musste ich doch nennen.«
Dazu fiel Arnaut nichts weiter ein, als den Kopf zu schütteln. Er öffnete den Mund, um Jori zurechtzuweisen, als sein jüngerer Bruder Robert atemlos in den Stall gestürzt kam.
»Großvater ist erwacht«, rief Robert. »Du sollst kommen.«
»Wie geht es ihm?«
»Schlechter, glaub ich. Sein Atem pfeift jetzt ständig.«
Arnaut erschrak. Während der letzten Tage hatten sie geglaubt, Großvater sei über den Berg. Deshalb war er heute Morgen ausgeritten, ohne nach ihm zu fragen.
»Geh schon vor. Ich komme.«
Robert machte kehrt und stürmte wieder aus dem Stall. Arnaut blickte ihm nach und bekreuzigte sich. Gebe Gott, dass es nur eine vorübergehende Verschlechterung war.
Dann sah er sich den Bauernburschen noch einmal genauer an. Eine Handbreit größer als Jori, schlank, sehnig, mit kräftigen Händen, die schon von der Feldarbeit gezeichnet waren. Ein Bad würde ihm sicher guttun. Vielleicht sollte man ihm auch den Kopf rasieren. Wegen der Läuse.
»Wie heißt du?«
»Lois Bernat, Herr.«
»Also schön, Lois Bernat. Ich werde es mir überlegen. Aber mach dir keine großen Hoffnungen, denn versprechen will ich nichts, verstanden?«
Ohne ein weiteres Wort stapfte er aus dem Stall und stieg eilig zur aula in der Hauptburg hinauf.
Verschmitzt zwinkerte Jori seinem neuen Freund zu. »Keine Sorge. Ich kenne ihn. Die Sache geht in Ordnung.«
Am Nachmittag war klamme Kälte vom Fluss heraufgestiegen. Die Dörfler hatten sich in ihren Hütten verkrochen. Ein scharfer, böiger Wind trieb sein Unwesen in den Gassen und riss ein paar vergilbte Herbstblätter bis hinauf zu den Zinnen der Burg, über der sich der Himmel grau verschleiert hatte. Hoch oben kreisten Krähen um den Wehrturm, und ihre hässlichen Schreie klangen wie Wehklagen.