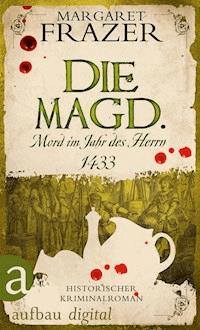8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Schwester Frevisse ermittelt
- Sprache: Deutsch
Die beste Detektivin des Mittelalters.
Als Schwester Frevisse ihren Onkel zu Grabe tragen muss, bricht Sir Clement Sharpe während der Trauerfeier plötzlich tot zusammen. War hier Gottes Hand im Spiel oder, wie Bischof Beaufort glaubt, ein mysteriöses Gift? Schwester Frevisse ist von keiner dieser beiden Varianten überzeugt ...
"Genaue historische Details, sehr schön beschriebene Charaktere, lebendige Dialoge zeichnen die Romane von Margaret Frazer aus." Publishers Weekly.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 288
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über Margaret Frazer
Margaret Frazer lebt mit ihren vier Katzen und viel zu vielen Büchern in der Nähe von Minneapolis, Minnesota. In den USA hat sie sich mit ihrer Serie um Schwester Frevisse über viele Jahre ein Millionenpublikum erschrieben.
Anke Grube hat Anglistik, Literaturwissenschaft und Geschichte studiert und ist sie seit 1989 freiberuflich als Literaturübersetzerin tätig.
Informationen zum Buch
Die beste Detektivin des Mittelalters.
Als Schwester Frevisse ihren Onkel zu Grabe tragen muss, bricht Sir Clement Sharpe während der Trauerfeier plötzlich tot zusammen. War hier Gottes Hand im Spiel oder, wie Bischof Beaufort glaubt, ein mysteriöses Gift? Schwester Frevisse ist von keiner dieser beiden Varianten überzeugt.
»Genaue historische Details, sehr schön beschriebene Charaktere, lebendige Dialoge zeichnen die Romane von Margaret Frazer aus.« Publishers Weekly.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Margaret Frazer
Der Bischof
Mord im Jahr des Herrn 1434
Historischer Kriminalroman
Aus dem Amerikanischen von Anke Grube
Inhaltsübersicht
Über Margaret Frazer
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Impressum
And whan that this was doon, thus spak that oon: »Now lat us sitte and drynke, und make uns merie, And afterward we wol his body berie.«
Da sprach der eine, als das Schurkenstück vollbracht: »Nun lass uns trinken, lustig sein, dann scharren später wir den Leichnam ein.«
Geoffrey Chaucer, Die Geschichte des Ablasskrämers
Kapitel 1
Nur die Kerzen, die am Kopfende des Bettes brannten, und ein schwacher Streifen Tageslicht, der durch die geschlossenen Fensterläden fiel, erhellten den Raum. Obwohl die Glut des Kohlebeckens in der Ecke beinahe heruntergebrannt war, blieb es im Zimmer immer noch stickig warm. Das lag vermutlich daran, dass sich so viele Menschen darin aufgehalten hatten.
Nun waren nur noch zwei Männer im Raum, und einer von ihnen lag im Sterben.
Thomas Chaucer ruhte bewegungslos in seinem breiten Bett, ein wenig auf die Kissen gestützt. Es war ein prächtiges Bett, Goldfäden glitzerten in der bestickten Überdecke, und in die Bettvorhänge waren Muster eingewebt. Und soweit es sich in dem schwachen Kerzenlicht erkennen ließ, war das ganze Schlafgemach kostbar eingerichtet. Die Möbel waren mit prächtigen Schnitzereien verziert, die Deckenbalken mit verschlungenen Weinreben und singenden Vögeln bemalt. Eine der Truhen, die an den Wänden standen, war mit einem weißen Tuch bedeckt worden, auf dem sich alles Notwendige für die Letzte Ölung befand: zwei erhaben brennende Bienenwachskerzen, ein kleines Gefäß mit geweihtem Salböl, ein anderes mit Weihwasser und das goldene Kästchen mit der Hostie. Davor stand Kardinal Beaufort, Bischof von Winchester, ein hochgewachsener Mann, der in seinem pelzbesetzten, scharlachroten Gewand in dem schwachen Licht noch größer wirkte. Gerade trat er wieder ans Bett, und seine Stimme glitt wohltönend und sicher durch die lateinischen Worte.
»Accipe, frater, Viaticum Corporis Domini nostri Jesu Christi, qui te custodiat ab hoste maligno, et perducat in vitam aeternam, amen.« Nimm, Bruder, als Wegzehrung den Leib unseres Herrn Jesus Christus, der dich vor den Heerscharen des Bösen bewahren und zum ewigen Leben leiten wird. Amen.
Behutsam legte der Bischof die Hostie auf Chaucers Zunge. Der schluckte schwach und flüsterte dann: »Mein letztes Mahl. Und das beste.«
»Es wird deine Seele nähren, nicht deinen Leib«, bestätigte Beaufort. Er kehrte zur Truhe zurück und drehte dem Bett und dem sterbenden Mann den Rücken zu.
»Hal«, sagte Chaucer.
Ohne sich umzudrehen, antwortete Beaufort mit heiserer Stimme: »Ja?«
»Bleib noch eine Weile bei mir. Es wird nicht mehr lange dauern.«
Beaufort, immer noch mit dem Rücken zum Bett, senkte den Kopf und wischte sich die Augen. Dann richtete er sich auf und drehte sich um. »Du bist wahrscheinlich der letzte Mensch, der mich noch Hal nennt«, sagte er mit bemühter Leichtigkeit. »Der letzte, der sich an die Zeit erinnert, als wir beide jung waren.«
»Bedford mag sich auch erinnern.«
»Bedford ist in Frankreich, krank von dem, was ihm angetan wurde. Ich bezweifle, dass er je wieder nach England kommen wird.«
Chaucer schwieg eine Weile. »Dann sieh es doch als etwas Gutes, dass niemand mehr da sein wird, der sich an deine anrüchige Jugend erinnert und Geschichten über dich erzählen kann.«
Beaufort lächelte, wie Chaucer es gewollt hatte, und legte die Hand auf seinen kalten, dünnen Arm. »Ich habe gelernt, mit deinen übersteigerten Erinnerungen an meine anrüchige Jugend zu leben. Aber hüte lieber deine Zunge, sonst muss ich dir noch einmal die Absolution erteilen.« Etwas verspätet nahm er seine purpurne Stola ab, küsste sie, faltete sie zusammen und legte sie zur Seite.
Beaufort und Chaucer waren Vettern. Ihre Mütter waren Schwestern gewesen, die Töchter eines flämischen Ritters im Gefolge der Königin, fünf Könige zuvor. Chaucers Mutter hatte standesgemäß einen Offizier aus dem Gefolge des Herzogs von Lancaster geheiratet, Geoffrey Chaucer. Thomas, der Spross dieser stabilen, biederen Ehe, hatte sich mit Hilfe der Beziehungen seines Vaters und seiner eigenen erheblichen Talente ein Vermögen aufgebaut.
Beauforts Mutter war weniger konventionell gewesen. Sie hatte dem zur königlichen Familie gehörenden Herzog von Lancaster vier Kinder geboren, ohne mit ihm verheiratet zu sein. Jahre später jedoch hatte der Herzog sie zu jedermanns Überraschung tatsächlich zur Frau genommen – eine Liebesheirat. Ihre Kinder waren unter dem Namen Beaufort legitimiert worden, und Henry – manchmal auch Hal genannt –, ihr zweiter Sohn, wurde ein Kirchenfürst und dreimal Lordkanzler von England. Sein privates Vermögen war so riesig, dass er der Krone eine Reihe hoher Anleihen gewährt hatte.
Trotz ihrer Verschiedenheit waren die beiden stets gute Freunde gewesen und waren es noch. Beide hegten tiefen Respekt vor dem Mann, zu dem der andere geworden war. Jetzt schwiegen sie vereint in ihrer Trauer. Eine Kerze zischte, der Docht hatte eine fehlerhafte Stelle. Beaufort fragte: »Möchtest du, dass Matilda noch einmal zu dir kommt? Oder Alice?«
Chaucers Frau und seine Tochter hatten den Raum verlassen, damit Beaufort ihm die Sterbesakramente spenden konnte, und die Dienerschaft, das Gefolge sowie Matildas gezügeltes, aber ununterbrochenes Schluchzen mitgenommen. Wenn Matilda zurückkam, würden alle zurückkommen, und das Schlafgemach wäre erneut gedrängt voll von Menschen und ihren intensiven Gefühlen. Mit geschlossenen Augen erwiderte Chaucer deshalb kaum hörbar: »Nein.« Und dann, nach längerem Schweigen, fügte er hinzu: »Ich möchte, dass du etwas für mich tust.«
»Alles, was in meiner Macht steht.« Und Beauforts Macht war erheblich.
»In dem Schrank dort …«, Chaucer bewegte leicht den Kopf, um zu zeigen, welchen Schrank er meinte, »… liegt ein Buch. In ein Tuch gewickelt. Es wird nicht in meinem Testament erwähnt. Gib es bitte meiner Nichte. Der Nonne. Schwester Frevisse.« Ein Lächeln spielte um seine Mundwinkel. »Aber sieh es dir nicht an. Lass es eingewickelt.«
»Geheimnisvolle Bücher für junge Frauen, Thomas?«, zog Beaufort ihn sanft auf. »Soll ich das etwa billigen?«
»Du müsstest es offiziell missbilligen, wenn du wüsstest, was es ist. Aber ich glaube, ich gefährde weder ihre Seele noch meine eigene damit.« Er fügte hinzu: »Und so jung ist sie nun auch wieder nicht.«
»Ja, das stimmt wohl. Sie ist schon recht lange in ihrem Kloster.« Beaufort suchte in dem angegebenen Schrank nach dem Buch und fand es. Es war klein, kaum so lang wie seine Hand, aber sehr dick, selbst wenn man die Umhüllung in Betracht zog. Er zeichnete mit den Fingern die Umrisse nach, die er durch das Tuch hindurch ertasten konnte. »Es handelt sich doch nicht um etwas, das ich gern in meiner eigenen Bibliothek hätte?« Chaucers Lächeln wurde breiter. »All meine besten Bücher habe ich dir vermacht. Nein, dies ist ein einfaches Buch, das Frevisse jedoch hochschätzte, als sie hier gelebt hat. Ich möchte gerne, dass sie es bekommt.«
»Dann soll es so sein.« Beaufort legte das Buch auf die verhüllte Truhe und kehrte an Chaucers Seite zurück. »Übrigens, wird dein Schwiegersohn nicht gegen die Ausschlachtung deiner Bibliothek zu meinen Gunsten protestieren?«
»Mein Schwiegersohn bewertet eine Handschrift nach der Zahl der Juwelen, die den Einband schmücken, und nach der Menge an Gold, die für die Illustrationen aufgewendet wurde. Ich habe ihm die protzigsten gelassen. Er wird zufrieden sein.«
»Das sollte er auch«, sagte Beaufort. »Ich bezweifle, dass er vorhat, sich deswegen mit mir auseinanderzusetzen.« Chaucers Tochter hatte William de la Pole geheiratet, den Grafen von Suffolk, ihren dritten Ehemann. Er besaß ein großes ererbtes Vermögen, ein hübsches Gesicht, bemerkenswert viel Charme, Einfluss im Kronrat und – nach Ansicht von Chaucer und Beaufort – nicht allzu viel Verstand. Und noch weniger gesunden Menschenverstand. Es bestand keinerlei Zweifel daran, dass Suffolk den Kürzeren ziehen würde, sollte es zum Streit kommen. Kaum jemand im Königreich konnte es mit Beaufort aufnehmen.
Nein, nicht wegen mangelnder Fähigkeiten war es Beaufort nicht vergönnt gewesen, das höchste Amt Englands zu übernehmen und Protektor des unmündigen Königs Heinrich VI. zu werden. Die Ursache war eine bedauerliche Fehde zwischen ihm und seinem eigenen Halbneffen väterlicherseits. Wenn schierer Hass – Gott möge ihm das vergeben – töten könnte, würde Humphrey, Herzog von Gloucester, seit langem nicht mehr unter den Lebenden weilen. So war es ihnen lediglich gelungen, sich gegenseitig mattzusetzen. Beide besaßen Macht und ein hohes Amt, aber keiner von beiden stand an der Spitze des Regentschaftsrates. Und nun, da der König langsam erwachsen wurde und bald selbst mehr Verantwortung tragen konnte, würde das wahrscheinlich auch keinem mehr gelingen. Es sei denn, man könnte seine Gunst und Unterstützung gewinnen …
Beaufort merkte, dass er ganz in Gedanken verloren war. Chaucer musterte ihn mit dem vertrauten Spott oder vielmehr mit dem blassen Schatten davon, für den seine Kraft noch reichte.
»Schön«, räumte Beaufort ein. »Ich habe ›meine Ambitionen gepflegt‹, wie du es stets auszudrücken beliebtest. Wird es dir ein Trost sein, wenn ich zugebe, dass ich langsam denke, du hattest recht, als du dich so standhaft geweigert hast, dich in diesen Morast hineinziehen zu lassen? Diesen Morast, dem ich mich all diese Jahre hindurch so bereitwillig ausgesetzt habe?«
Chaucer schüttelte schwach den Kopf. »Nein. Ich habe immer gewusst, dass ich recht damit tat, Westminster wie die Pest zu meiden. Obwohl Westminster wie auch die Pest gar nicht so leicht zu meiden sind.« Mit einem Lächeln fügte er hinzu: »Aber ich habe auch immer gewusst, dass du dort hingehörst, Hal. Deine Ambitionen waren stets ganz anders als meine. Es würde mir leid tun, zu hören, dass du ihrer müde geworden bist.«
Zögernd – denn Chaucer war wahrscheinlich der einzige Mann in ganz England, dem er sich öffnen mochte – meinte Beaufort: »Der König wird erwachsen. Die Dinge ändern sich.«
»Möglicherweise zu deinem Vorteil.«
»Möglicherweise«, bestätigte Beaufort. Wenn Bedford in Frankreich starb – der Mann, der ihn unterstützt und gezügelt hatte, der das Gleichgewicht zwischen den streitenden Parteien bei Hof aufrechterhalten hatte, egal, wie sehr es ihnen widerstreben mochte –, dann taten sich neue Möglichkeiten auf.
Chaucers Augen schlossen sich. Er schläft nicht, dachte Beaufort, er hat nur nicht mehr die Kraft, sie offenzuhalten. Der Pulsschlag der Halsschlagader flatterte und setzte aus. Beaufort beugte sich mit wehem Herzen vor. Aber Chaucers Herz schlug, wenn auch schwach, in festem Rhythmus weiter. Chaucer lag seit drei Monaten im Sterben. Seit drei Monaten wusste er mit Sicherheit, dass er sterben würde, obwohl die auszehrende Krankheit schon eine Weile länger an ihm nagte. Nichts, was er zu sich nahm, gab ihm Kraft, und obwohl alles für ihn getan wurde – Chaucer konnte sich die besten Ärzte Englands leisten –, schwand er dahin, als würde er absichtlich hungern. Mittlerweile war er völlig abgemagert, und der geschwächte Körper konnte die Seele nicht mehr halten.
Ohne die Augen zu öffnen, sagte Chaucer: »Lydgate.« Beaufort hätte sich fast umgedreht, um zu sehen, ob jemand den Raum betreten hatte.
»Wenn er ein Gedicht über mich schreibt und es herschickt«, fuhr Chaucer mit immer noch geschlossenen Augen fort, »erteile ich dir die strenge Weisung, es weder bei meinem Begräbnis noch bei einer meiner Gedenkmessen lesen zu lassen. Kein einziges Wort, keine einzige Zeile.«
»Aber …« Lydgate war Englands Meisterdichter, brillant, beliebt, fleißig. Er schrieb ausführlich über jedes große Ereignis. Sein Schmerzensschrei anlässlich Chaucers Aufbruch zu einem Aufenthalt in Frankreich war hoch gelobt worden. Und er behauptete stets, Thomas’ Vater Geoffrey Chaucer sei seine Inspiration und sein Vorbild. So war es vielleicht überraschend, dass Thomas sich stets äußerst rüde über sein Werk geäußert hatte, wenn auch nur im privaten Kreis. »Ich werde in einer besonders scheußlichen Gestalt wiederkehren und dich heimsuchen, wenn du zulässt, dass ein Werk von Lydgate in meiner Hörweite vorgelesen wird, egal, ob ich nun lebendig bin oder tot. Ich will nichts von ihm hören, nicht bei meinem Begräbnis, nicht bei meinem Monatsgedächtnis, nicht bei meinem Jahrestag und zu keiner anderen Gelegenheit.«
Beaufort konnte ein Lächeln nicht unterdrücken, aber er weinte gleichzeitig. Zwar war es in Adelskreisen durchaus üblich, Tränen zu vergießen, aber so aufrichtig hatte er nicht mehr um jemanden geweint, seit seine Mutter vor mehr als dreißig Jahren gestorben war. Es dauerte eine Weile, bis er wieder sprechen konnte. »Du hast mein Wort. Er wird dir erspart bleiben, selbst im Tod.«
Chaucer zog die Augenbrauen hoch, aber seine Augen öffneten sich nicht, und er atmete flach. Dann fragte er mit schwacher Stimme: »Meine Nichte. Die Nonne. Habe ich dich gefragt, ob du –?«
»Du hast es mir gesagt. Ich habe das Buch. Ich werde es ihr geben.«
»Sag ihr … dass sie mir fehlen wird.«
Kapitel 2
Frevisse beugte sich noch tiefer hinunter und legte die Stirn auf den kalten Stein der Altarstufe. Sie presste die gefalteten Hände gegen die Brust. Ihre Knie schmerzten. Seit dem Ende der Terz am frühen Vormittag kniete sie hier. Bald würde die Sext beginnen, und die anderen Nonnen der Priorei St. Frideswide würden zurückkehren. Frevisse würde aufstehen und ihren Platz im Chor einnehmen müssen, aber sie war sich nicht sicher, ob ihre Knie sie tragen würden, wenn die Zeit kam, sich zu erheben.
Sie seufzte, richtete sich auf und hob die Augen zu der Lampe, die über dem Altar brannte. Das Lampenöl wurde jeden Tag von treusorgenden Händen erneuert, und die kleine Flamme leuchtete tief geborgen in der Wölbung des roten Glases. Sie brannte, ohne zu flackern, schlicht und dauerhaft in den Schatten und kalten Luftzügen der Kirche.
Frevisse fröstelte. Sie war in letzter Zeit in einem kalten Luftwirbel des Lebens gefangen, dem sie nicht zu entkommen vermochte, obwohl sie betete und Buße tat. Vor einem halben Jahr hatte sie sich für bestimmte Handlungsweisen entschieden und schließlich eine Entscheidung getroffen, die nicht rückgängig zu machen war – und seit der Zeit lebte sie mit dem, was sie getan hatte, ohne Frieden zu finden. Menschen waren gestorben, die noch leben könnten, wenn sie anders entschieden hätte. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Durch meine Schuld, durch meine Schuld, durch meine übergroße Schuld.
Wie in Einklang mit ihrem Gram waren die Tage grau, feucht und kühl gewesen und der Himmel finster, beinahe solange sie zurückdenken konnte. Es war Sommer gewesen, vor langer Zeit, aber es hatte nur wenige warme Tage zwischen etlichen nassen und kalten Tagen gegeben. Dann war der regnerische Herbst gekommen, und die magere Ernte war auf den Feldern verrottet. Und nun, kurz nach dem Martinstag im späten November im Jahre des Heils 1434, gab es nichts, worauf sie sich freuen konnte. Man erwartete einen Hungerwinter, in dem viele Menschen sterben würden. Es war, als spiegelte die Welt ihren Seelenzustand wider. Bei diesen Gedanken presste Frevisse den Mund fest zusammen. Es war ihr altes Ich, das da sprach, ihr weltliches Ich, das sie all diese Monate hindurch so hart auszutreiben versucht hatte.
Die Ehrwürdige Mutter hatte die Krankheit ihres Herzens erkannt. Beim Wechsel der Ämter am Mittsommertag hatte Priorin Edith bestimmt, dass Frevisse nicht mehr die Schwester Hospitalaria sein sollte, die sich um die Gäste des Klosters kümmerte und so ständig mit der Außenwelt in Berührung kam. Frevisse wurde zur Novizenmeisterin ernannt, deren Pflicht es war, die Novizinnen zu beaufsichtigen. Da es in der Priorei zur Zeit jedoch keine einzige gab und auch keine erwartet wurde, übertrug die Ehrwürdige Mutter Frevisse stattdessen die Aufgabe, in ihrer schönen Handschrift die Bücher zu kopieren, die die Priorin jemandem versprochen oder sich für das Kloster zum Abschreiben geliehen hatte – in all den Monaten seit dem Mittsommertag war dies ein einziges gewesen.
Frevisse war dankbar für diese Verminderung ihrer Pflichten und ihrer Verantwortung. Sie verstand, dass Priorin Edith ihr die Gelegenheit gab, ihre Sünden zu bereuen und ihre inneren Verletzungen zu heilen. Und sie hatte es versucht. Aber nichts, was sie tat, bereitete ihr Freude, ja nicht einmal schlichtes Vergnügen, auch nicht das Gebet. Und das war abermals eine Sünde, die Sünde der Verzweiflung. Gott vergab alle Sünden, die wahrhaftig bereut wurden, aber das Herz musste offen und bereit sein, die Vergebung zu empfangen.
Die Klosterglocke begann dumpf zu läuten. Es war Zeit für die Sext. Müde bekreuzigte sich Frevisse und hievte sich unter Schmerzen hoch. Die sieben Gebetsstunden, die dem Tag von Mitternacht bis zum Abend seine Struktur verliehen, waren ihr Trost und ihre Zuflucht. In der komplexen Schönheit der ineinander verwobenen Psalmen und Gebete konnte sie sich fast immer selbst vergessen und die vorübergehende Hoffnung finden, dass die Dürre in ihrem Herzen und in ihrer Seele nicht ewig dauern würde.
Aber noch war sie nicht vorbei. Frevisse ging das kleine Stück vom Altar zu ihrem Platz im Chor, kniete nieder und wartete mit gesenktem Kopf.
Die Nonnen kamen auf ihren weichen Sohlen leise von den verschiedenen Pflichten, denen sie an verschiedenen Stellen des Klosters nachgegangen waren. Frevisse hörte das Rascheln ihrer Röcke. St. Frideswide war eine kleine Benediktinerinnen-Priorei, es gab nur zehn Nonnen und ihre Priorin. Frevisse konnte jede einzelne an ihren Schritten erkennen. Schwester Thomasine war die Erste, ihr leichter, hastiger Tritt spiegelte ihren Eifer wider. Seit ihrer Kindheit war es ihr einziger Wunsch gewesen, Gott als Nonne zu dienen, und nun, gerade erst der Kindheit entwachsen, ging sie von ganzem Herzen in ihrer Berufung auf. Es war ein Schock für sie gewesen, als Priorin Edith sie anstelle von Schwester Claire zur Krankenschwester ernannte. Und ein Schock für Schwester Claire, die ihren geliebten Heilkräutern, Arzneien und der Pflege der Kranken entrissen worden war, um Cellerarin zu werden und nun Bedienstete, Nutzgarten, Vorratsräume und Küche beaufsichtigen musste. Nach Thomasines leichtem Tritt waren Schwester Claires feste, gleichmäßige Schritte zu vernehmen. Dicht dahinter kamen Schwester Emma und Schwester Juliana, die sich weder beeilten noch trödelten. Sie waren einfach auf dem Weg zu einer der Pflichten einer Nonne. Hinter ihnen, mit unverwechselbar schwerem Schritt, kam Schwester Alys. Sie hatte den Verlust ihrer Autorität als Cellerarin sehr ungehalten aufgenommen und gab jetzt eine unzufriedene Sakristanin ab. Eine Weile nach ihr eilte Schwester Amicia herbei, fast zu spät, wie gewöhnlich.
Die Ehrwürdige Mutter betrat die Kirche erst, als Schwester Amicia ihren Platz eingenommen hatte. Die Würde der Priorin erforderte es, dass sie sich abseits vom Gedränge ihrer Nonnen hielt. Aber sie wartete bereits und trat ein, sobald Schwester Amicia sich atemlos in ihrem Chorstuhl niedergelassen hatte. Schwester Perpetua und Schwester Lucy waren ihr zur Seite und stützten sie auf dem Weg zu ihrem reich geschnitzten Chorstuhl. Priorin Edith war sehr alt, und die beißende Kälte des letzten Winters hatte ihr übel mitgespielt. Zwar hatte sie einen heftigen Husten überlebt, der sich in der Brust festgesetzt hatte, aber ihre frühere Kraft war dahin. Frevisse, die sich mit den anderen erhoben hatte, beobachtete besorgt, wie die Ehrwürdige Mutter langsam näher kam und sich unter Schmerzen auf ihren Sitz niedersinken ließ. Sie war Priorin geworden, als Heinrich von Lancaster sich selbst als König Heinrich IV. auf den englischen Thron gesetzt hatte. Frevisse konnte sich St. Frideswide ohne sie nicht vorstellen – und wollte es auch nicht.
Die Priorin hatte sich gerade auf ihrem Chorstuhl eingerichtet, als die Glocke im Kirchturm die Stunde der Sext einläutete.
Die Sext gehörte zu den kurzen Stundengebeten. Frevisse versenkte sich hinein, so tief sie es in der kurzen Dauer des Gottesdienstes vermochte, und am Ende betete sie mit besonderer Inbrunst: »Domine, exaudi orationem meum, et clamor meus ad te veniat.« Herr, erhöre mein Gebet, vernimm mein Flehen um Deiner Treue willen, erhöre mich um Deiner Gerechtigkeit willen.
Das Gebet verklang in der Stille der Kirche. Einen Augenblick lang gab es keine Regung und kein Flüstern, nur das Schweigen, schwer durch das heilige Gewicht der vielen Gebete, die an diesem Ort gesprochen wurden.
Dann beugte Priorin Edith sich vor, und Schwester Perpetua und Schwester Lucy eilten herbei, um ihr beim Aufstehen zu helfen. Die übrigen Nonnen erhoben sich respektvoll und blieben an ihren Plätzen, bis die Ehrwürdige Mutter die Kirche verlassen hatte. Danach gingen sie ihrer Wege, bestrebt, sich wieder ihren Pflichten zuzuwenden. Als sie fort waren, ließ sich Frevisse erneut auf die Betbank nieder und kehrte zu den Worten der Eröffnungshymne der Sext zurück. Rector potens, verax Deus … Confer salutem corporum veramque pacem cordium … Sein Heil und Gnaden, die nehmen nicht Schaden, heilen im Herzen die tödlichen Schmerzen, halten uns zeitlich und ewig gesund.
Sie bat um zeitliche Gesundheit für die Ehrwürdige Mutter. Lass sie leben, wenn es dein Wille ist. Für sich selbst aber erbat sie Heilung für ihr Herz und Seelenfrieden …
Eine Berührung an der Schulter schreckte Frevisse auf. Ein wenig benommen hob sie den Kopf und stellte fest, dass Schwester Perpetua sich über den Chorstuhl vor ihr gebeugt und ihr kurz die Hand auf die Schulter gelegt hatte.
Es war schwierig, das Alter der anderen Nonnen zu schätzen, denn sie waren von den lose fallenden Schichten des schwarzen Benediktiner-Ordensgewandes verhüllt. Nur die Gesichter konnte man erkennen, eingerahmt von weißen Kinntüchern und schwarzen Schleiern, die sehr wenig von der Stirn zeigten und alles unterhalb des Kinns verbargen. Frevisse nahm an, dass Schwester Perpetua ungefähr zehn Jahre älter war als sie, also Mitte vierzig. Sie war eine gedrungene Frau mit freundlichem Gesicht und einem festen, bestimmten Auftreten. Da sie durch das Schweigegebot gebunden war, lächelte sie Frevisse lediglich an und machte das Handzeichen für Priorin sowie jenes, das Frevisse aufforderte, mitzukommen.
Vom Wohnzimmer der Priorin konnte man durch drei hohe Fenster hinausblicken, auf den Innenhof und die beiden Gästehäuser, die das Tor zum Hof flankierten. Der Erkersitz am Fenster war mit buntbestickten Kissen behaglich gemacht worden. Zu den Aufgaben der Priorin gehörte es, hin und wieder wichtigen Besuch zu empfangen und jene Klostergeschäfte zu regeln, die nicht in der Kapitelversammlung entschieden werden konnten. Daher waren ihre Räume komfortabler eingerichtet als die übrigen des Klosters. Es gab einen langen, geschnitzten Tisch, auf dem ein gewebter spanischer Gobelin lag, zwei Stühle und einen Kamin. Prasselnde Flammen verzehrten ein Holzscheit, um die Kälte des grauen Vormittags abzuwehren.
Priorin Ediths Stuhl mit der hohen Rückenlehne war näher ans Feuer gezogen worden. Dort saß sie eingehüllt in den pelzgefütterten Umhang, den sie nur auf Drängen der Krankenschwester bis zum Kinn hochgezogen hatte. Mit jedem Monat, so schien es Frevisse, wurde die Priorin kleiner. Sie schien eingenickt zu sein, so tief war ihr Kinn in den Falten ihres Kinntuchs vergraben. Doch wenn es so war, schlief sie den leichten Schlaf der Alten. Sie hob den Kopf, als Frevisse näher trat, die verblassten Augen hellwach unter den faltigen Lidern. »Schwester Frevisse«, sagte sie, und Frevisse knickste vor ihr. »Bitte nehmt Platz.« Sie wies auf den Stuhl ihr gegenüber, der ebenfalls dicht am Feuer stand.
Frevisse setzte sich und fühlte augenblicklich die Wärme des Feuers auf den Wangen. Am liebsten hätte sie die Hände ausgestreckt, um sie ebenfalls zu wärmen, aber sie ließ sie dort, wo sie waren, in die Ärmel geschoben, außer Sicht, wie es sich schickte. Alles andere wäre Luxus.
»Es ist ein Brief für Euch gekommen.« Die Ehrwürdige Mutter wies mit dem Kopf auf Schwester Perpetua, die neben dem Tisch gewartet hatte und nun mit einem gefalteten, versiegelten Pergamentbogen in der Hand auf sie zutrat.
Frevisse war davon ausgegangen, dass Priorin Edith sie hatte sprechen wollen, weil sie die Ausübung ihrer Pflichten vernachlässigt hatte oder weil die Priorin sie davor warnen wollte, so oft allein in der Kirche zu beten. Jetzt wandte sie ihre Aufmerksamkeit dem Brief zu und nahm ihn entgegen. Die Adresse lautete: Schwester Frevisse Barrett, Priorei St. Frideswide nahe Banbury in Oxfordshire. Die Handschrift war ihr unbekannt.
»Ich fürchte, er enthält schlechte Nachrichten«, sagte Priorin Edith sanft.
Während sie das sagte, drehte Frevisse den Brief um und erkannte das Siegel ihres Onkels Thomas Chaucer. Aber wenn der Brief von ihm war, warum hatte er dann jemand anders die Anschrift schreiben lassen? Das war gar nicht seine Art. Ihre Hände begannen zu zittern, denn sie wusste, dass ihr Onkel krank gewesen war. Sie brach das Siegel, faltete den Brief auseinander und stellte erleichtert fest, dass er in der vertrauten Handschrift ihres Onkels geschrieben war. »An meine geliebte Nichte. Möge dies Dich bei guter Gesundheit erreichen. Ich grüße Dich, wünsche Dir Gottes Segen und gebe Dir meinen. Ich liege im Sterben –«
Ein keuchender Atemzug entfuhr ihr. Ihr ganzer Leib verkrampfte sich vor Schmerz, und sie musste sich anstrengen, aufrecht sitzen zu bleiben. Der Brief war kurz und sachlich gehalten, ohne eine Spur des gewohnten trockenen Witzes.
»Wir hofften, dass meine Krankheit sich bessern würde, aber sie hat sich doch als todbringend erwiesen. Wie gern würde ich Dich noch einmal sehen, so Gott will und Deine Priorin Dir die Reise gestattet…« Frevisses Tränen fielen auf das Pergament und verwischten die Tinte.
Grob fuhr sie sich über die Augen und las weiter. »Wenn es nicht so sein soll, wisse, dass Du mir teuer bist und ich im Himmel an Dich denken werde. Dein Onkel Thomas Chaucer.«
Blind vor Tränen hielt Frevisse den Brief der Ehrwürdigen Mutter hin, denn es war Recht und Pflicht einer Priorin, die Briefe zu lesen, die ihre Nonnen bekamen. Und in diesem Fall war es dringend notwendig. Frevisse wartete, die Hände vors Gesicht gepresst, bemüht, ihr Schluchzen zu unterdrücken, bis Priorin Edith gütig sagte: »Ihr werdet innerhalb der nächsten Stunden aufbrechen. Möge Gott geben, dass Ihr noch rechtzeitig kommt.«
Kapitel 3
Der kalte Tag ging zur Neige. Eine schmale Linie düsteren Rots lauerte im Westen unter der aufgewühlten, sich verdunkelnden Wolkendecke. Sehr viel heller war es den ganzen Tag über nicht gewesen, aber zumindest hatte es nicht geregnet. Und nun, auf der letzten Wegstrecke, hatten die vier Reisenden den schneidenden Wind im Rücken. Sie ritten ins Tal hinunter, wo das Dorf und Schloss Ewelme lagen, das Ziel ihrer Reise.
Sie kamen zu spät. Im letzten Dorf hatten sie erfahren, dass Chaucer bereits tot war. »Gestern war’s«, hatte ein Mann erklärt. »Ja, gestern. Wir haben die Totenglocke läuten hören. Der Wind kam aus der Richtung. Und heute haben wir gehört, dass es ganz sicher aus ist mit ihm. Gott schütze ihn.«
So beeilten sie sich jetzt nur noch, um der bitteren Kälte und dem eisigen Wind zu entkommen: nach zwei Tagesritten mitten im Winter mehr als verständlich.
Das Wasser des kleinen Teichs zwischen dem Dorf und dem Schloss war aufgewühlt. Der Wind rauschte in den hohen Ulmen, die ihn umgaben, schüttelte ihre kahlen, schwarzen Äste und warf Muster auf die dahinjagenden Wolken.
Die Tore des Schlosses waren noch geöffnet, und Fackeln brannten in den Haltern auf beiden Torpfosten. Als die Reiter in den Hof ritten, kamen Stallknechte aus den Ställen gerannt. Helfende Hände hielten die Pferde und hoben die Reiter vom Pferd.
Frevisse war steifgefroren. Sie stieg schwerfällig ab und hielt nach einem bekannten Gesicht Ausschau. Wenn sie irgendwo zuhause war, dann auf Ewelme. Die letzten acht Jahre ihrer Kindheit hatte sie zum Haushalt ihres Onkels gehört.
Aber anscheinend war sie zu lange fort gewesen. Niemand kam ihr bekannt vor, nicht einmal der kleine Herr, der plötzlich auftauchte, als die Pferde weggeführt wurden. Er schaute jedem der Reisenden ins Gesicht, um herauszufinden, wer der Anführer der Gruppe war. Selbst wenn man in Betracht zog, dass er in verschiedene Kleidungsschichten und einen Umhang gehüllt war, schien er ein eher rundlicher Mann zu sein. Er hüpfte ruckartig auf den Fußballen auf und ab wie eine mit Wasser gefüllte Schweinsblase, um zu zeigen, wie eifrig bestrebt er war, den Gästen zu Diensten zu sein.
»Ja, ja, willkommen! Es wird eine grausame Nacht werden, ja, das wird es. Daher seid Ihr sehr willkommen auf Ewelme. Selbstverständlich. Aber vielleicht wisst Ihr, dass es hier einen Trauerfall gegeben hat. Gewiss können wir Euch beherbergen, ganz gewiss, aber –«
»Ich bin Meister Chaucers Nichte«, unterbrach Frevisse ihn barsch. »Er hat nach mir geschickt. Vor seinem Tod«, fügte sie hinzu, um sich nicht noch einmal anhören zu müssen, dass sie zu spät gekommen sei.
»Oh. Oh.« Im Gesicht des kurz geratenen Mannes malte sich ehrlicher Kummer. Er war ein gutes Stück kleiner als Frevisse und verrenkte sich den Hals, um zu ihr aufzusehen. »Ihr habt es also auf dem Weg gehört! Wie grausam, wie schrecklich! Mein aufrichtiges Beileid!« Er blickte ihre Mitreisenden an. Schwester Perpetua stand neben ihr. Es wäre undenkbar gewesen, dass eine Nonne ohne die Begleitung einer anderen Nonne reiste, der Schicklichkeit wegen. Und hinter ihnen standen die beiden stämmigen Männer, die der Verwalter der Priorei unter den Dienstleuten des Klosters ausgewählt und ihnen zum Schutz mitgegeben hatte. In diesen unruhigen Zeiten und zu dieser Jahreszeit reiste niemand, der es sich irgendwie leisten konnte, ohne Geleitschutz. Der kleine Mann machte Anstalten, sich an einen der Männer zu wenden, da er offenbar damit rechnete, dass die beiden Frauen jeden Moment hysterisch vor Trauer zusammenbrechen könnten. Aber Frevisse war müde und durchgefroren, und zudem war sie sich bewusst, dass es Schwester Perpetua ebenso ging. Sie hatte nicht vor, ihre Zeit mit Zurschaustellungen von Trauer zu verschwenden. Also nahm sie die Sache in die Hand und erklärte kurz angebunden: »Sorgt dafür, dass man sich in den Ställen um meine Männer kümmert, seid so gut.« Der kleine Mann nickte und blinzelte erstaunt angesichts Frevisses Autorität. Sie gab ihm aber keine Gelegenheit, seine Zustimmung zu bekunden, sondern drehte sich zu den Dienstleuten des Kloster um und befahl: »Ihr kehrt morgen nach St. Frideswide zurück. Ich weiß nicht, wie lange wir hierbleiben werden, aber wenn es länger als vierzehn Tage dauern sollte, sende ich Nachricht. Wenn wir zurückkehren wollen, wird meine Tante uns sicherlich eine Eskorte zur Verfügung stellen.«
Sie sah den kleinen Mann an, der nachdrücklich nickte. »Oh, gewiss doch, aber gewiss«, bestätigte er.
»Dann wären Schwester Perpetua und ich sehr dankbar, wenn wir jetzt hineingehen könnten.«
»Aber gewiss, gewiss doch.«
Die beiden Dienstleute verbeugten sich linkisch und schickten sich an, einem der Stallburschen zu folgen. Schwester Perpetua sagte zu ihnen: »Gott gewähre euch eine gute Nacht und einen erholsamen Schlaf.« Beschämt darüber, dass sie diese einfache Höflichkeit vergessen hatte, fügte Frevisse hastig hinzu: »Und einen sicheren Heimweg.«
Die Männer verbeugten sich nochmals. Sie hatten es eilig, ins Warme zu kommen und eine Mahlzeit zu sich zu nehmen. Frevisse und Schwester Perpetua folgten dem kleinen Mann.
Schloss Ewelme war von einem Wallgraben umgeben. Als die Nonnen mit ihrem Führer den äußeren Hof verließen und die Zugbrücke überquerten, griff der Wind erneut nach ihnen, noch kälter als zuvor. Aber Diener standen bereit und hielten ihnen die Türen zur Vorhalle auf. Reich geschnitzte Holzparavents wehrten die Zugluft ab, die mit ihnen hereingeweht war. Hinter der Halle befand sich der große Saal, Herz und Versammlungsraum des Schlosses. Fackeln erleuchteten ihn, und weitere Diener brachten gerade die Schragen herein, kreuzweise verschränkte Untergestelle, auf die sie die Tischplatten legten. »Es ist beinahe Zeit fürs Nachtmahl«, erklärte der Mann, als wüssten sie das nicht selber. »Also …« Er zögerte. Offensichtlich hatte er auf dem Weg vom Schlosshof hierher noch nicht entschieden, was er mit ihnen anfangen sollte. Wollten sie sich zuerst aufwärmen und etwas essen? Oder sollten sie sofort zur Schlossherrin geführt werden? Oder …
Frevisse nahm an, dass ihre Tante ihn zum Haushofmeister bestimmt hatte. Ihr Onkel hatte allerdings stets Diensteifrigkeit und Würde von denen erwartet, die ihm dienten. Ungeduldig fuhr sie ihn an – und ärgerte sich sofort danach über sich selber. »Ich möchte meinen Onkel sehen. Und Schwester Perpetua sollte sich vor ein warmes Feuer setzen, bis Zeit zum Essen ist. Und sicherlich würde meine Tante Matilda gern erfahren, dass wir eingetroffen sind.«
»Ja, ja, das scheint das Beste zu sein«, stimmte der Mann zu. »Euer Onkel befindet sich in der Kapelle, Mylady. Wenn Ihr mir folgen würdet …«
»Ich kenne den Weg. Kümmert Euch um Schwester Perpetua.«
Schwester Perpetua bedachte sie mit einem dankbaren, zittrigen Lächeln und nickte. Sie war eine gute Reisegefährtin, klagte nicht und war dankbar für jede Erquickung, die ihr zukam, aber jetzt war ihre Belastungsfähigkeit erschöpft. Sie musste sich hinsetzen und sich aufwärmen. Schwester Perpetua folgte dem kleinen Mann.
In der Kapelle war es kalt, obwohl die vielen Kerzen vor dem Sarg eine Illusion von Wärme vermittelten. Frevisse blieb fröstelnd in der Tür stehen und erinnerte sich. Tante Matilda hatte sich lebhaft für den Bau eines Kamins eingesetzt … »Hier, an der Außenmauer. Es wäre überhaupt kein Problem, ihn einbauen zu lassen.« Aber Chaucer hatte erwidert: »Wir kommen hierher, um unserer Seele Gutes zu tun, nicht um es unserem Leib behaglich zu machen.« Zwar hatte er keine Bedenken, es sich zu anderen Zeiten und Orten mit dem ganzen Luxus behaglich zu machen, den sein beträchtliches Vermögen erkaufen konnte, aber bei der Kapelle war er hart geblieben. Es gab also keinen Kamin, und die Steinmauern schienen eisige Kälte auszuströmen.
Aber reich geschmückt war die Kapelle. Die Mitglieder von Chaucers Haushalt gingen normalerweise in die Dorfkirche, wo auch die Totenmesse und das Begräbnis stattfinden würden. Die Kapelle war ausschließlich für private Andachten der Familienmitglieder und die tägliche Messe des Hauspriesters gedacht. Sie war prachtvoll und schön wie der Reliquienschrein eines Heiligen. Die Decke war himmelblau getüncht und mit Sternen übersät, die prächtig geschnitzten und vergoldeten Retabel hinter dem Altar schienen sich nach ihnen auszustrecken. Der Altar war heute zwar mit schwarzem Tuch verhüllt, das die prachtvollen Stickereien des üblichen Altartuchs verdeckte, aber ein gewebter Läufer, dessen Rot-, Blau- und Grüntöne wie Juwelen leuchteten, zog sich über die Altarstufen und den Boden der Kapelle bis fast zur Tür. Die Seitenwände waren mit Heiligenfiguren bemalt, die auf einer Blumenwiese standen und gütig auf die Betenden hinablächelten, während die Altarwand vom Glanz der Jungfrau Maria erhellt wurde. Sie wurde zur Himmelskönigin gekrönt, und Heilige und Engel sahen freudig zu.