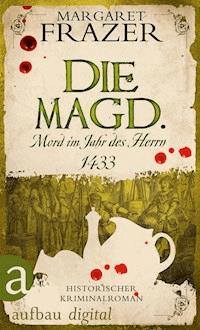8,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Schwester Frevisse ermittelt
- Sprache: Deutsch
Schwester Frevisse reist nach London, um dort ihre neue Priorin zu treffen. Unterkunft findet sie bei ihrer reichen Cousine Alice, verheiratet mit dem Grafen von Suffolk. Doch es wird kein ruhiger Besuch bei Verwandten: Alice ist verwickelt in gefährliche Machenschaften mächtiger politischer Parteien und das Haus der Suffolks wird zum Austausch mysteriöser Nachrichten genutzt. Als plötzlich ein geheimer Bote unter unerklärlichen Umständen stirbt, bittet Alice Schwester Frevisse um Hilfe. Kann sie den Mörder finden, bevor es ein weiteres Opfer gibt?
Eine unvergleichliche Detektivin - Schwester Frevisse, die Miss Marple des Mittelalters.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 462
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Über Margaret Frazer
Margaret Frazer lebt mit ihren vier Katzen und viel zu vielen Büchern in der Nähe von Minneapolis, Minnesota. In den USA hat sie sich mit ihrer Serie um Schwester Frevisse über viele Jahre ein Millionenpublikum erschrieben.
Anke Grube hat Anglistik, Literaturwissenschaft und Geschichte studiert und ist sie seit 1989 freiberuflich als Literaturübersetzerin tätig
Informationen zum Buch
Schwester Frevisse reist nach London, um dort ihre neue Priorin zu treffen. Unterkunft findet sie bei ihrer reichen Cousine Alice, verheiratet mit dem Grafen von Suffolk. Doch es wird kein ruhiger Besuch bei Verwandten: Alice ist verwickelt in gefährliche Machenschaften mächtiger politischer Parteien und das Haus der Suffolks wird zum Austausch mysteriöser Nachrichten genutzt. Als plötzlich ein geheimer Bote unter unerklärlichen Umständen stirbt, bittet Alice Schwester Frevisse um Hilfe. Kann sie den Mörder finden, bevor es ein weiteres Opfer gibt?
Eine unvergleichliche Detektivin – Schwester Frevisse, die Miss Marple des Mittelalters.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Margaret Frazer
Die Dame
Historischer Kriminalroman
Aus dem Amerikanischen von Anke Grube
Inhaltsübersicht
Über Margaret Frazer
Informationen zum Buch
Newsletter
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Anmerkung der Autorin
Impressum
But thogh this meyde tendre were of age,
Yet in the brest of hir virginitee
There was enclosed rype and sad corage …
Obwohl noch in der frühen Jugend Schranken,
Erfüllten ihren jungfräulichen Sinn
Ein reifer Geist und ernste Pflichtgedanken …
Die Erzählung des Scholaren
GeoffreyChaucer
1
Eshieß, ColdharbourHouse sei vor fast hundert Jahren von Sir John Poultney, einem viermaligen Stadtoberhaupt von London, erbaut worden, um der Stadt, die ihm zu beidem verholfen hatte, seinen Reichtum und seine Macht kundzutun. An der Hay Wharf Lane im Stadtbezirk Dowgate gelegen, zog sich sein Besitz – mit Hof, großem Saal und Garten, sozusagen allem, was für den üppigen Lebensstil eines reichen Mannes erforderlich war – am östlichen Ufer der Themse entlang. Sir John Poultney hatte sogar einen Sohn gehabt, der all seinen Reichtum und all seinen Besitz erben sollte, aber wenn dieser ihn auch überlebt hatte, war er doch kinderlos gestorben, und seitdem ging Coldharbour von einer Hand in die andere über, ohne lange in eines Herrn Besitz zu bleiben. Doch die Hände, durch die das Haus ging, waren stets von hohem Adel. Die Grafen von Hereford, Huntingdon und Cambridge hatten es besessen, König Heinrich IV. und später sein Erbe, der Prinz von Wales, und jetzt der Graf von Suffolk mit seiner Gemahlin und ihrem Gefolge, das aus mehr als hundert Personen bestand.
Jane, die gerade die Manschette an den Ärmel des Hemdes nähte, das William an ihrem Hochzeitstag tragen sollte, ließ die Arbeit sinken und hob den Kopf, um aus dem Fenster zu schauen.
William, dachte sie. Probierte seinen Namen im Geiste aus, als würde er ihr dadurch irgendwie vertrauter werden. William Chesman. Sie sagte probeweise ihren Namen, wie er lauten würde, wenn sie seinen trug: Jane Chesman. Sie fügte probeweise ihrer beider Namen zusammen: Jane und William Chesman. Sie versuchte, sich die Ehe vorzustellen, und konnte es nicht. William Chesman. Der, den der Graf von Suffolk und seine Gemahlin ihr, gütig, wie sie nun mal waren, zum Mann bestimmt hatten.
Oder, um genauer zu sein, der Mann, den sie für Jane gekauft hatten, weil sie die Nichte des Grafen von Suffolk war und daher versorgt sein musste. Und da sie sich geweigert hatte, ins Kloster einzutreten, musste eben ein Ehemann her. Und da es unwahrscheinlich war, dass sie auf andere Art zu einem kommen würde, hatten sie ihr William Chesman gekauft, und irgendwann in naher Zukunft – nach Weihnachten, aber noch vor der Fastenzeit – würde sie mit ihm verheiratet werden. Oder er mit ihr. Wie immer man es sehen wollte.
Alles in allem fand Jane es besser, die Sache nicht allzu eingehend zu betrachten. Sie senkte den Kopf, um den Stich zu beenden, einen ihrer kleinen, regelmäßigen Stiche, und zog die Nadel durch das feine weiße Leinen. Aber es blieb bei dem einen Stich, und da es ihr nicht gelang, sich auf die Arbeit zu konzentrieren, blickte sie erneut auf und schaute aus dem Fenster. Der Frauensaal von Coldharbour lag hoch oben, am Ende einer langen Wendeltreppe, die vom großen Saal hinaufführte, der selbst weit über dem Hof lag. Von dem gepolsterten Erkersitz des östlichen der beiden nach Süden hinausgehenden Fenster des Frauensaals, wo Jane saß, konnte sie entweder steil hinunter in den Hof blicken, in dem ein ständiges Kommen und Gehen herrschte – Lakaien in blauer Livree, einfache Bedienstete in Grau und Braun sowie gelegentlich jemand in kräftigem Rotbraun oder Grün –, seitlich in eine Ecke des jetzt winterlich kahlen Gartens von Coldharbour hinter dem grüngestrichenen Tor und den hohen grauen Steinmauern, oder über die Mauer hinweg auf die erhabene, glänzende, fließende Dunkelheit der Themse, die niedrigen Häuser von Southwark und den stolzen Kirchturm von St. Mary Overie am jenseitigen Ufer oder noch weiter, auf die fernen Hügel von Surrey.
Das Nonnenkloster, in dem sie für den Rest ihres Lebens geblieben wäre, wenn es nach denen gegangen wäre, lag irgendwo in diesen Hügeln.
Der Gedanke hatte sich ungebeten eingeschlichen, wie Williams Name, und so sorgsam, wie sie es vermieden hatte, über ihn und das Eheleben nachzudenken, schob sie auch den Gedanken beiseite und blickte hinaus auf die Themse. Heute lag der Fluss matt wie Stahl unter dem grauen Novemberhimmel, von dem schneebeladenen Wind zu kleinen, wütenden Wellen hochgepeitscht und vielbefahren wie immer. Eine Myriade geruderter Schiffe war unterwegs, in der Hauptsache die einfachen Boote der Fährleute, aber oft auch regsame Prahme mit kleinen Segeln. Manchmal zog rasch die buntbemalte Prunkbarke eines Edelmanns vorbei, deren doppelte Reihe von Ruderern sich tief vor- und zurückbeugte. Alle waren sie auf dem Weg irgendwohin, flussaufwärts, flussabwärts, zum anderen Ufer, während die Themse einfach weiterfloss, tief und zuverlässig und unaufhörlich. Es war jetzt eine Woche her, dass sie von Ewelme nach Coldharbour gekommen waren, und Jane hatte festgestellt, dass es weit besser war, ihre Gedanken mit der Themse fortfließen zu lassen, als ihnen den Freiraum zuzugestehen, sich anderen Dingen zuzuwenden. Sie wusste, dass das Wasser ein wenig weiter flussabwärts zu cremeweißem Schaum aufgewühlt um die Brückenpfeiler der London Bridge herumtoste, aufgehalten auf seinem Weg zum Meer. An stillen Tagen konnte sie die Wasser hier in Coldharbour rauschen hören, während des Gezeitenwechsels, wenn der Fluss gegen sich selbst ebenso ankämpfen musste wie gegen die Brücke. Aber Jane wusste auch, dass die Themse sich immer, früher oder später, sei es bei Ebbe oder Flut, durchkämpfte und brodelnd ihren Weg bahnte, weiterfloss und immer breiter wurde, bis sie die See erreichte.
Fort.
Im Schlaf und manchmal, wenn sie unvorsichtig war, auch im Wachen, träumte Jane davon, fortzugehen. Träumte davon, an einem Ort zu sein, wo weder ihr Gesicht wichtig war noch das, was sie sein sollte, sondern nur das, was sie tatsächlich war.
Es war eine nutzlose Träumerei. Wenn es ihr gelungen war, in ihren vierundzwanzig Lebensjahren etwas zu lernen, dann das: Ihr Gesicht und das, was sie war, waren die beiden Dinge, von denen sie nie frei sein würde. Das Kloster hatte die einzige Fluchtmöglichkeit dargestellt, und die hatte sie abgelehnt. Also blieb noch die Ehe. Mit William Chesman.
Auf der anderen Seite des Raumes begannen Aneys und Millicent eine weitere ihrer nicht sonderlich leidenschaftlichen Zankereien darüber, welche Farbe eine der Blumen auf dem Kissenbezug haben sollte, den sie gerade bestickten. Für die beiden gehörte Streiten ebenso zum Sticken wie die Stiche, aber für alle anderen war es ermüdend, sich das anzuhören. Und da Lady Alice ihr, eher stillschweigend als offen, eine Art Autorität über die anderen Edelfrauen in ihrem Gefolge eingeräumt hatte, wahrscheinlich weil sie mit keiner eine Freundschaft verband, die hätte beschädigt werden können, sagte Jane zu den beiden, um den Streit zu beenden: »Dieser Rosaton ist zu grell. Ein dunkleres Rosa wäre besser.«
Aneys und Millicent verstummten, überrascht darüber, unterbrochen zu werden. Dann fragte Millicent zweifelnd: »Glaubt Ihr wirklich?«
Jane unterdrückte die Bemerkung, dass sie es wohl glauben musste, wenn sie es gesagt hatte. Nach der Anzahl der gedankenlosen Äußerungen zu urteilen, die aus dem Munde der Leute kamen, war es wohl keine Binsenweisheit, dass man vor dem Reden nachdenken sollte, aber sie gab sich damit zufrieden, geduldig zu antworten: »Bei diesem Rosaton wäre der Gegensatz zu dem dunklen Grün zu stark. Wenn sie den Kissenbezug ansehen, würden alle Leute nur denken, wie rosa diese Blume doch ist.«
»Aber ich mag Rosa«, wandte Millicent ein. Dann erhellte sich ihr Gesicht. »Und sowieso wird die meiste Zeit jemand darauf sitzen, so dass es überhaupt nicht zu sehen ist!«
»Dann spielt es auch keine Rolle, wenn wir es hier versticken und nicht da«, griff Aneys prompt ihre Seite des Arguments wieder auf.
»Ja, aber …«, entgegnete Millicent, und Elizabeth erhob sich von ihrem Kissen und blickte ihnen über die Schulter, derweil die neben ihnen sitzende Katherine bemerkte: »Könntet ihr nicht …«
Am anderen Ende des Raums sah Lady Alice von der Abrechnungsrolle auf, die vor ihr auf dem Tisch lag, und der amüsierte Blick voll versteckten Lachens, den sie Jane zuwarf, besagte, sie könne die Mädchen ruhig ihren zahmen Streitereien überlassen, wenn sie sich denn unbedingt zanken wollten. Obwohl Meister Bruneau neben ihr stand und sich gerade vorbeugte, um ihr etwas auf der Pergamentrolle zu zeigen, hob Lady Alice eine Hand und winkte Jane zu sich. Er beriet die Gräfin in der Frage, wie viele Fässer Wein aus den Kellern Coldharbours mit dem Karren nach Wingfield Manor geschafft werden sollten, jetzt, wo die Straßen endlich zugefroren waren – Jane hatte dem Gespräch mit halbem Ohr zugehört, während sie ihre Gedanken schweifen ließ.
Bereitwillig legte Jane ihre Näharbeit zur Seite und ging zu ihr. Der Frauensaal war wesentlich länger als breit, demnach nicht gut proportioniert, aber wunderschön eingerichtet. Auf dem Fußboden lagen spanische Teppiche mit komplizierten Mustern, in lebhaften Schattierungen aus Granatrot und Saphirblau, Smaragdgrün und Gold gewebt, und an den Wänden hingen französische Gobelins, auf denen die Geschichte von Tristan und Isolde erzählt wurde. Tisch und Stühle, die lange Sitzbank vor dem Kamin und selbst die Hocker waren aus geschnitzter und polierter goldener Eiche, und die Deckenbalken waren mit grünblättrigen Weinranken und bunten Vögeln bemalt. Die Fensterscheiben waren aus klarem Glas, und auf den Fensterläden glänzten die Familienwappen des Grafen und der Gräfin von Suffolk. Alles in allem war der Raum ebenso kultiviert, freundlich und reich wie Lady Alice selbst, und es sagte viel über die Gräfin von Suffolk aus, dass Jane sich hier nicht nur willkommen fühlte, sondern ebenso zu Hause wie an den Orten, an denen sie jemals vorher gewesen war.
Meister Bruneau nahm ihr Näherkommen nur soweit zur Kenntnis, dass er sich aufrichtete und kurz vor ihr verbeugte, aber an Lady Alice gewandt fortfuhr: »Wenn Ihr beabsichtigt, Weihnachten in Wingfield zu verbringen, werdet Ihr mindestens so viele Fässer zusätzlich brauchen.«
»Aber könnte der Wein nicht von Ipswich nach Wingfield gebracht werden?« fragte Lady Alice. »Die Frachtkosten wären geringer, und der größte Teil der Vorräte aus Coldharbour könnte nach Ewelme gehen.«
Meister Bruneau rollte die Abrechnungsrolle zurück, um ihr einen anderen Eintrag zu zeigen. Er war Franzose und hatte den Grafen von Suffolk nach all den Jahren, die dieser in Frankreich verbracht hatte, nach England begleitet, um den Suffolks als Kämmerer zu dienen. Er war hauptsächlich für die Verwaltung ihrer französischen Besitzungen zuständig, und gegenwärtig war die wichtigste Frage, ob die französischen Weine, die im Herbst mit der Weinflotte gekommen waren, für den Bedarf des Suffolkschen Haushalts ausreichen würden oder ob welcher hinzugekauft werden musste. »Hier könnt Ihr sehen«, sagte er, »dass Ihr mehr Fässer brauchen werdet als die, die in Ipswich lagern, wenn Ihr beabsichtigt, den größten Teil Eures Gefolges nach Wingfield mitzunehmen und sie bis zum Dreikönigsabend und vielleicht sogar bis zur Fastenzeit bei Euch zu behalten.«
»Kann dann trotzdem noch etwas nach Ewelme gehen?« fragte Lady Alice.
»Ja.« Meister Bruneau war erfreut, das sagen zu können, fügte aber warnend hinzu: »Es sei denn, Ihr werdet während der Parlamentssitzungen zu viele Gäste hier in Coldharbour bewirten.«
»Das werden wir wahrscheinlich«, sagte Lady Alice.
Meister Bruneau seufzte. »Dann werden wir welchen hinzukaufen müssen.«
Mit einem versteckten Lächeln warf Lady Alice Jane einen Seitenblick zu. An Meister Bruneaus Buchführung war nie etwas auszusetzen. Er war ebenso gewissenhaft wie korrekt in allem, was er tat, aber er war auch berühmt dafür, nur mit großem Zögern wieder etwas aus seiner Obhut zu entlassen, und sei es für die Zwecke, für die es bestimmt war. Gegenwärtig war er so angespannt auf die Weinfrage konzentriert, als müsste er die Kosten aus seiner eigenen Geldbörse bestreiten – eine zugegebenermaßen wünschenswerte Haltung bei einem Kämmerer in einem adeligen Haushalt, aber Meister Bruneau trieb es manchmal allzuweit damit. Allerdings machte er seine Arbeit so gut, dass Lady Alice ihn weder ihren Verdruss merken ließ noch ihn auslachte, und sie und Jane tauschten nur ein heimliches Lächeln, als sie eine Hand hob, um das Gespräch zu unterbrechen, sich an Jane wandte und sehr beiläufig sagte: »Ich hätte gedacht, mittlerweile etwas in dieser anderen Angelegenheit zu hören. Würdest du mal feststellen, ob die Sache inzwischen erledigt ist?«
Jane knickste leicht, wie es die Höflichkeit zwischen verschwägerten Frauen erforderte, und entgegnete: »Gewiss, Mylady«, so leichthin, als wäre die Angelegenheit wirklich so unbedeutend, wie Lady Alice es klingen ließ. Als Antwort nickte Lady Alice kurz und wandte sich wieder Meister Bruneau und der Frage zu, ob in Coldharbour ausreichend Karren vorhanden waren oder ob welche dazugemietet werden mussten. Jane, die wusste, dass man ihr den leichten Aufruhr in der Magengegend nicht ansah, aber wünschte, er wäre nicht vorhanden, verließ ruhig den Raum.
Es gibt überhaupt keinen Grund für dieses Gefühl, schalt sie sich, als sie die Wendeltreppe vom Frauensaal zum großen Saal hinunterstieg. Als Lady Alice sie zum ersten Mal um ihre Hilfe in »dieser Angelegenheit« gebeten hatte, hatte sie deutlich gemacht, wie unwahrscheinlich es war, dass es Schwierigkeiten geben würde. Solange niemand davon wusste außer den wenigen, die notgedrungen eingeweiht werden mussten, war alles in bester Ordnung, und da es keine Anzeichen dafür gab, dass ihr Geheimnis bekanntgeworden war oder jemand auch nur den geringsten Verdacht hegte, war es nicht Angst, die Janes Nerven beben ließ, sondern die Erinnerung daran, dass sie diejenige war, die Lady Alice ausgewählt hatte, dass sie diejenige war, der sie vertraut hatte. Es gab so viele andere, aber Lady Alice hatte sie ausgewählt. »Das Vermögen der Familie könnte davon abhängen, wie es ausgeht, ob gut oder schlecht, und da du zur Familie gehörst, an wen Besseren könnte ich mich wenden?« hatte sie gesagt.
Sie gehörte zur Familie. Ein kleines Eingeständnis vielleicht für Lady Alice, die nie ohne Familie gewesen war, der niemals Anerkennung verwehrt worden war, nicht als Alice Chaucer in ihrer Mädchenzeit, nicht als Lady Alice Philip in ihrer ersten Ehe, nicht als Gräfin von Salisbury in ihrer zweiten und nicht als Gräfin von Suffolk in ihrer dritten Ehe. Jane war diejenige, die als einfache Jane Pole aufgewachsen war, um die sich Nonnen gekümmert hatten, die dafür bezahlt worden waren und die erwarteten, dass sie das Ordenskleid anlegen und eine der Ihren werden würde, sobald sie alt genug war. Von frühester Kindheit an hatte sie gewusst – es war kein Geheimnis, es wurde nur nie ausführlich darüber gesprochen –, dass ihr Vater der Graf von Suffolk gewesen war, dass er vor ihrer Geburt in der Schlacht von Agincourt gefallen war und dass sie noch als Säugling ins Kloster der heiligen Osburga gebracht worden war, weil ihre Mutter ihren Anblick nicht ertragen konnte. Später, als sie alt genug war, um Fragen zu stellen – und hartnäckig genug –, hatte sie erfahren, dass ihre Mutter und ihre älteren Schwestern – meine Mutter und meine Schwestern, wiederholte Jane manchmal bei sich, aber es gelang ihr nie, es für sich wirklich werden zu lassen – zugunsten des jüngeren Bruders ihres Vaters, des männlichen Erben, nun der Gemahl der Lady Alice, auf all ihre Ansprüche an der Grafschaft Suffolk verzichtet hatten und gemeinsam in ein Kloster eingetreten waren. Auch Janes Rechte waren an ihn abgetreten worden, und man hatte sie in ein Kloster gebracht, wenn auch nicht in jenes, in das ihre Mutter und ihre Schwestern gegangen waren, die sie seitdem nie wiedergesehen hatte.
Meistens gelang es Jane, sich nichts daraus zu machen. Es war vorbei, erledigt, entschieden durch die Tatsache, dass sie mit einem Mal im Gesicht geboren worden war, so wie ihre Mutter erwartet haben musste, dass ihr ganzes Leben dadurch bestimmt werden würde.
Ein Mal im Gesicht. Die Worte waren freundlicher als die Wirklichkeit.
»Jane mit dem Mal im Gesicht«, hatte man sie im Kloster genannt, um sie von Jane Cufley zu unterscheiden, einem anderen Mädchen, das im Kloster erzogen wurde, und von Schwester Jane, einer der Nonnen. »Jane mit dem Mal, komm her.« »Sagt Jane mit dem Mal, sie soll es machen.« »Es war Jane mit dem Mal, Schwester.« Selbst wenn sie die Ordensgelübde abgelegt hätte, wäre es wahrscheinlich so weitergegangen. Aus ihr wäre »Schwester Jane mit dem Mal« geworden …
Ein dunkelroter Fleck bedeckte die gesamte linke Hälfte ihres Gesichts, zog sich vom Haaransatz aus über die Stirn, am Auge vorbei die Wange hinunter, über den Mundwinkel bis unter das Kinn und über den Hals bis zur Schulter, wo er unter ihrer Kleidung verschwand. Überall sonst war ihr Fleisch weiß und glatt, unbeeinträchtigt selbst von den Blattern, die sie als Kind gehabt hatte; aber den Rest von ihr nahm nie jemand wahr. Die Menschen waren entweder unfähig, den Blick von der verunstalteten Seite ihres Gesichts abzuwenden, oder aber bemüht, sie überhaupt nicht anzusehen, was in gewisser Weise noch schlimmer war.
Nicht alle waren so, berichtigte Jane sich fairerweise. Lady Alice schien sie tatsächlich wahrzunehmen, schien tatsächlich sie zu sehen statt ihrer Missbildung. Aber die meisten …
Sie wünschte, sie wüsste, wie es für William Chesman war, sie anzusehen, aber sie konnte es sich denken. Um sie loszuwerden, hatte ihr Onkel ihr eine stattliche Mitgift mitgegeben, die jeder bekommen würde, der bereit war, Jane zu nehmen. William Chesman hatte die Mitgift genommen. Die Mitgift und das Wohlwollen des Grafen von Suffolk waren es, die er ansah, nicht sie.
»Er stammt von Freisassen ab, nicht mehr«, hatte Suffolk sie gewarnt, als er ihr mitgeteilt hatte, dass die Übereinkunft getroffen war. »Aber jemand Besseres wirst du kaum finden. Und er ist jung, falls das für dich eine Rolle spielt.«
Das tat es sehr wohl. Wichtiger war jedoch, dass er schon einmal verheiratet gewesen war, und da volle vier Jahre seit dem Tod seiner ersten Frau verstrichen waren, musste er auf eine Ehe gewartet haben, die ihm so viel einbringen würde, dass es sich für ihn lohnte. Und das hieß, dass er mit ebenso praktischen Erwägungen wie sie an diese Ehe heranging und verstand, dass es hierbei um den beiderseitigen Nutzen ging. Jane brachte ihm Geld und das Wohlwollen des Grafen von Suffolk ein und würde wahrscheinlich in der Lage sein, ihm Kinder zu schenken. Im Gegenzug gab er ihr einen Platz in der Welt und ermöglichte ihr, einen eigenen Hausstand zu haben; soweit ihr eigen, wie sie ihn dazu machen konnte.
Über diese praktischen Erwägungen hinaus war es ihr gelungen, nicht allzuviel über das Verheiratetsein oder William Chesman nachzudenken.
Nur manchmal, das gab sie sich selbst gegenüber zu, dachte sie an die Erleichterung, die es für sie bedeuten würde, Barbe und Schleier zu tragen. Ein unverheiratetes Mädchen trug ihr Haar unbedeckt. Es war das Privileg einer verheirateten Frau – der Braut eines Mannes oder einer Braut Christi –, Barbe und Schleier zu tragen. Das Gesicht wurde von der Barbe umrahmt und sogar teilweise verborgen, und die seitlich herabfallenden Falten des Schleiers taten ein übriges. Als die Nonnen noch angenommen hatten, sie könnten sie veranlassen, ins Kloster einzutreten, hatte die Priorin von St. Osburga ihr mit schonungsloser Offenheit erklärt: »Selbst wenn Ihr Euer Gelübde abgelegt habt und endlich den Schleier tragt, wird das Mal noch zu sehen sein. Barbe und Schleier werden nicht alles verdecken, aber Ihr werdet besser dran sein als jetzt. Sicher denkt Ihr doch nicht, dass Ihr Euer Glück machen könnt, wenn Ihr mit einem so deutlich sichtbaren Makel in die Welt hinausgeht?«
Und Katherine, die zu Lady Alices Gefolge gehörte, hatte einmal unbekümmert bemerkt, wohl in dem Versuch, freundlich zu sein: »Wenn Ihr verheiratet seid, wird die Barbe zumindest tagsüber den größten Teil verdecken, und wenn er nachts zu Euch kommt, braucht Ihr ja kein Licht anzuzünden.«
Sie hatte die letzte Windung der Treppe hinter sich und trat in den großen Saal. Zu dieser Tageszeit, zwischen den Mahlzeiten, wenn alle im ganzen Haus verteilt ihren morgendlichen Pflichten nachgingen, hielten sich kaum mehr als ein halbes Dutzend Bedienstete dort auf, und Jane stieg vom Podest herunter und durchquerte den Saal, ohne sich groß um sie zu kümmern. Es war die Aufgabe des Tafelmeisters, dafür zu sorgen, dass sie beschäftigt waren, und wie alle, die für längere Zeit im Dienste des Grafen und der Gräfin von Suffolk standen, machte er seine Arbeit gut, weil er wusste, dass er sonst von der Gräfin hören würde. Nachdem Jane in den Haushalt ihres Oheims aufgenommen worden war, hatte es nicht lange gedauert, bis sie merkte, dass er zwar gern alle Annehmlichkeiten und Freuden genoss, die sein Reichtum und sein hoher Rang ihm erlaubten, dass aber seine Frau Gemahlin diejenige war, die sich um die verwobenen Einzelheiten kümmerte und dafür sorgte, dass alles reibungslos lief. Ruhig hatte Jane sich darangemacht, die Feinheiten der Hausverwaltung zu erlernen, damit sie wenigstens diese Fähigkeit mit in die Ehe einbringen konnte.
Ihr Lerneifer hatte auch dazu geführt, dass Lady Alice mehr Notiz von ihr genommen hatte. Erst hatte sie Jane in der Wirtschaftsführung unterwiesen, ihr dann kleine Haushaltsangelegenheiten anvertraut, und jetzt … dies.
Der Vorraum am unteren Ende des großen Saals schützte nicht nur vor Zugluft und schirmte während der Mahlzeiten das Treiben in Speisekammer, Anrichteraum und Küche vor den Blicken der Speisenden an der erhöhten Tafel ab, sondern er diente auch als Durchgang zur Außentür zum Hof, zur Hintertreppe, die zu den Vorratsräumen hinunterführte, und zu dem Gebäudekomplex, der sich zwischen dem großen Saal und der Kapelle drüben am Tor, das in die Hay Wharf Lane hinausführte, erstreckte. Im Erdgeschoss befanden sich die Werkstätten und weitere Lagerräume, und in den höheren Stockwerken lagen die Kammern der Knappen und der Freisassen, der Gefolgsmänner des Grafen, in denen sie schliefen, wenn sie nachts nicht dem Grafen oder der Gräfin aufwarten mussten, sowie die der Bediensteten, deren Rang zu hoch war, um im großen Saal oder in der Küche zu schlafen. Manche der hochrangigen Bediensteten des Haushalts, wie Meister Bruneau, hatten ihre eigene Kammer. Andere teilten sich die Schlafstatt mit zwei, drei, vier oder mehr anderen, je nach ihrem Rang.
Hier herrschte ein ständiges Kommen und Gehen, so dass ihre Anwesenheit niemandem auffallen würde, und Jane durchquerte den Raum ganz offen, mit der Absicht, die erstbeste Person zu fragen, ob sie Eyon Chesman irgendwo gesehen hätte. Wie es sich traf, war Eyon der Vetter ihres zukünftigen Mannes und ebenso wie dieser ein Freisaß und Gefolgsmann des Grafen von Suffolk. Sie teilten sich sogar eine Schlafkammer, obwohl Jane sie ansonsten nie viel zusammen gesehen hatte, und die Verwandtschaft der beiden hatte auch nichts damit zu tun, dass sie Eyon aufsuchen musste. Gestern abend hatte sie ihm den Entwurf für ein besonders kunstvoll ausgeführtes Zierat für ein Pferdegeschirr übergeben, das er heute vormittag zu Meister Belancer, dem Silberschmied in der Silver Street, hatte bringen sollen. Lady Alice wollte es ihrem Gemahl als Neujahrspräsent überreichen und begehrte zu wissen, ob Meister Belancer die Arbeit ausführen und rechtzeitig fertigstellen konnte.
Zumindest waren Lady Alice, Eyon und Jane übereingekommen, dass sie das behaupten würden, falls es je zu einer Befragung kommen sollte. Nicht, dass dies sehr wahrscheinlich war, aber er hätte mittlerweile längst zurück sein müssen, und Jane ging die Ausrede im Kopf noch einmal durch, um sie parat zu haben, falls sie sie würde vorbringen müssen, als sie aus dem Vorraum in den Torhauskomplex trat. Der erste der Räume dort, etwas größer als die übrigen, war dazu gedacht, dass die Männer, die gerade keinen Dienst hatten, sich dort müßig Gesellschaft leisten konnten, wenn sie dies wünschten. Zu jeder Tageszeit schienen sich hier einige Männer und Jungen aufzuhalten, und Jane erwartete, wenn schon nicht Eyon, so doch jemanden anzutreffen, der ihr sagen konnte, wo er zu finden war.
Statt dessen fand sie Meister Hyndstoke vor, den Leibarzt der Suffolks, umringt von einer großen Gruppe von Männern. Er war noch jung, und da die Suffolks die Kosten für seine Ausbildung in Oxford übernommen hatten, diente er jetzt zur Entschädigung eine Zeitlang in ihrem Haushalt, meist keine schwere Aufgabe, da sowohl der Graf als auch die Gräfin sich entschlossen guter Gesundheit erfreuten und auch ihr Gefolge gesund erhielten. Momentan schüttelte er ernst den Kopf als Antwort auf die Fragen, mit der zu viele Männer auf einmal ihn bestürmten, und versuchte dabei, an ihnen vorbeizukommen. Jane blieb wie angewurzelt stehen, für einen kurzen Augenblick von Angst erfüllt. Aber es war die falsche Jahreszeit für die Pest, und die Fragen klangen eher neugierig als furchtsam. Also um was ging es dann, fragte sie sich.
Einer der Männer blickte sich um, entdeckte sie, löste sich aus der Gruppe und kam zu ihr hinüber. Von allen Anwesenden war Robyn Helas der letzte, den sie ausgewählt hätte, ihr irgend etwas mitzuteilen, aber er sagte bereits, noch bevor er bei ihr angekommen war: »Eyon Chesman. Er ist tot. Wir haben ihn gerade eben gefunden« und streckte die Hand aus, um sie zu stützen. Sie trat zur Seite, denn sie brauchte keine Hilfe, und selbst wenn sie einer stützenden Hand bedurft hätte, hätte sie seine nicht genommen.
Robyn Helas sah gut aus. Niemand hätte gezögert, das zuzugeben. Aber er war auch ausgesprochen von sich angetan, und weder sein Aussehen noch die liebenswürdige Aufmerksamkeit, die er ihr manchmal betont erwies, entzückte Jane sonderlich, denn was auch immer er zu ihr sagte, es war stets ein Hauch von Spott herauszuhören, ein lauerndes Vergnügen daran, ihr Komplimente zu machen, die er nicht ehrlich meinte, wie sie beide wussten. Daher wünschte sie auch jetzt seinen »Trost« nicht, wenn Trost denn das war, was er beabsichtigte, sondern fragte scharf: »Tot? Wie ist er gestorben?«
Robyn, den ihr Zurückschrecken nicht zu kümmern schien, antwortete: »Anscheinend trank er zuviel. Er hat sich gestern abend sinnlos betrunken und ist an den Folgen gestorben.«
»Wo war denn sein Vetter? Wieso war er nicht bei ihm?«
»Er hat letzte Nacht dem Grafen aufgewartet.« Das hieß, William Chesman hatte mit anderen Gefolgsmännern und Leibknappen im Vorraum der gräflichen Gemächer geschlafen, nachdem sie den Grafen zu Bett gebracht hatten, und heute morgen waren sie ihm zu Diensten gewesen.
»Und Eyon ist erst jetzt gefunden worden?«
»Ihr wisst ebensoviel wie ich«, entgegnete Robyn mit einem Achselzucken. Er hatte eine Art, zu nahe bei ihr zu stehen, die ihr besonders missfiel, aber im Augenblick machte sie sich eher Gedanken darüber, was sie jetzt tun sollte. Lady Alice musste von Eyons Tod erfahren, aber sie musste auch das andere Schriftstück zurückbekommen, das Eyon gestern abend übergeben worden war. Das wichtigere. Es war mit dem Entwurf für die Geschirrzierde zusammengefaltet, jedoch nicht für Meister Belancer, den Silberschmied, bestimmt.
Während sie noch zögerte und sich fragte, was sie tun sollte, befreite sich Meister Hyndstoke von dem Knäuel der Männer um ihn herum, und Jane trat ihm in den Weg und fragte: »Woran ist er gestorben, Sir? Mylady wird es wissen wollen.«
Für die Nichte des Grafen und eine von Lady Alices Edelfrauen blieb Meister Hyndstoke stehen und antwortete, ohne etwas von seinem Ernst zu verlieren: »Ich würde sagen, er hat seinen Körper gestern abend übermäßig mit Alkohol belastet und starb daran.«
»Nichts weiter?« fragte einer der Männer. »Es war nichts Ansteckendes?«
»Es war mit Sicherheit nichts Ansteckendes«, entgegnete Meister Hyndstoke in entschiedenem Ton, an Jane gewandt. »Es war keine Krankheit, es war der Alkohol. Das passiert manchmal, bei einigen Menschen. Wenn sie allzu unmäßig trinken, können die Körperfunktionen nicht mehr aufrechterhalten werden. Der Körper verschließt sich und stirbt.«
»Seid Ihr sicher, dass das alles war?« fragte eine der Küchenmägde hinter Jane. Weitere Bedienstete drängten sich jetzt in den Raum, ein sicheres Zeichen dafür, dass die Nachricht von dem unerwarteten Todesfall sich in ganz Coldharbour ausbreitete.
»Ganz sicher!« beharrte Meister Hyndstoke voller Ungeduld, weil seine Worte angezweifelt wurden.
Jane drehte sich zu Robyn um. »Ihr geht jetzt besser und teilt es der Gräfin mit. Sie wird es erfahren wollen, und es ist in ihrem Sinne, wenn sie die Fakten hört anstatt Gerüchte.«
»Ich …« Wahrscheinlich setzte Meister Hyndstoke zum Protest an, da er die Nachricht selbst hatte überbringen wollen.
»Ja«, drängte Jane, »Ihr geht besser auch.« Robyn, der, wie Jane bemerkt hatte, stets bestrebt war, Lady Alices Aufmerksamkeit zu erregen, hatte sich bereits auf den Weg gemacht. Meister Hyndstoke folgte mit einer Hast, die ihm etwas von seiner Würde raubte. Jane, die nun bestrebt war, sich irgendwie in den Besitz des Schriftstücks zu bringen, das Eyon nicht mehr hatte überreichen können, ging in die andere Richtung. Sie schob sich durch die redende Menge hindurch, die zu beschäftigt war, sich um eine Person zu kümmern, die auch nicht mehr wusste als sie und nicht gewillt war, mit ihnen zu tratschen.
Sie durchquerte mehrere kleine Kammern, von denen eine in die andere überging. Es fiel ihr nicht schwer, Eyons Kammer zu finden, und zu ihrer Erleichterung und gleichzeitig ihrem Unbehagen befand sich niemand mehr dort als William Chesman, der am Fußende des schmalen Betts seines Vetters stand und auf den mit einer Decke verhüllten Leichnam niederblickte. Jane wusste nie, was sie zu ihm sagen oder wie sie sich in seiner Gegenwart verhalten sollte, aber das war im Augenblick weniger wichtig, denn sie sah sich plötzlich mit der letztlichen Gewissheit des Todes konfrontiert. Bis dahin war Eyons Tod schlicht eine Komplikation gewesen, die sie vor das Problem stellte, die Botschaft zurückzubekommen, von der niemand etwas erfahren durfte. Jetzt war es ganz unvermittelt Wirklichkeit. Eyon war tot.
Er war einer der Zeugen bei der Verlobung seines Vetters gewesen, aber über die wenigen Worte hinaus, die Jane und er in Lady Alices Angelegenheit gelegentlich hatten wechseln müssen, hatte sie nie viel mit ihm zu tun gehabt. Für sie war Eyon einfach ein mittelalter Mann von unauffälligem Äußerem, unauffälligem Auftreten und unauffälliger Ausdrucksweise gewesen, mehr nicht. Jemand, der von Nutzen für Lady Alice war.
Aber während es vorher einen Menschen gegeben hatte, der Eyon Chesman genannt wurde, war da jetzt niemand mehr. Seine Seele hatte den Körper verlassen. Ob sie sich im Himmel, in der Hölle oder im Fegefeuer befand, konnte niemand sagen. Sicher war nur, dass nichts von ihm übrig war als dieser Leib unter der Decke, der so still und gerade lag, wie nur die Toten liegen.
Es war nun nicht so, als hätte sie nie zuvor einen Toten gesehen. Einige dieser Toten hatte sie weit besser gekannt als Eyon. Sie hatte sogar am Sterbebett von Schwester Thebaude gesessen, hatte sie sterben sehen. Aber jeder Tod war einzigartig, nur dem jeweiligen Menschen eigen, und dieser Tod war Eyons, und wie viel oder wenig er ihr auch bedeutet haben mochte, er war ein naher Verwandter von William gewesen. Und William litt, nach der Art zu urteilen, wie er mit steif gebeugtem Kopf und starrem Rücken am Fußende des Bettes stand. Jane wusste, dass sie etwas sagen musste, anstatt dazustehen und ihn zu beobachten, während er dachte, dass er allein sei, und fragte daher: »Hat jemand nach dem Priester geschickt?«
William hob den Kopf und starrte auf das Kruzifix, das über dem Bett an der Wand hing. Schließlich sagte er: »Ja.« Er schien Schwierigkeiten zu haben, seine Gedanken zu sammeln, aber nach einer Pause brachte er heraus: »Es werden mehr Messen als üblich für ihn gelesen werden müssen.«
Weil er ohne Beichte gestorben war und ohne die Letzte Wegzehr empfangen zu haben, die den Schutz seiner Seele sicherstellte.
»Mylord und Mylady werden gewiss dafür sorgen«, bemerkte Jane. Es kam ziemlich steif heraus. Über die einfachen Unterhaltungen hinaus, die unvermeidlich waren, wenn man im selben Haushalt wohnte, hatten sie und William nie auch nur ein Wort miteinander gewechselt, bis sie letzten Monat vor Zeugen gemeinsam ihrer Vermählung zugestimmt und danach das Verlobungsgelübde abgelegt hatten, das sie unwiderruflich einander band. Danach war sogar jede simple Unterhaltung unerträglich peinlich geworden, zumindest für sie, und William hatte ganz gewiss auch keine großen Anstrengungen in dieser Richtung unternommen. Aber im Augenblick musste sie das Schweigen in den Griff bekommen, und Jane brachte es fertig, die Frage herauszuzwingen: »Er war bereits tot, als Ihr ihn fandet?«
William blickte wieder auf den Leichnam seines Vetters nieder, bevor er antwortete: »Ich dachte, er würde schlafen, als ich hereinkam, aber ich konnte ihn nicht wecken. Er atmete nicht mehr. Meister Hyndstoke sagt, dass er seit Stunden tot war, dass er seit Stunden über jede Hilfe hinaus war.«
William hob die Hände und fuhr sich durchs Haar, das wie das seines Vetters mittelbraun war, aber im Gegensatz zu Eyon hatte er krause Locken, die sich nicht gut mit der glatten, gerade über den Ohren abgeschnittenen Frisur vertrugen, die augenblicklich modern war, so dass er das Haar ein wenig lang trug. Damit er besser mit den Händen hindurchfahren kann, dachte Jane. Sie riss sich zusammen und unterdrückte diesen belanglosen Gedanken, denn sie wusste, dass sie von dem abschweifte, worüber sie nicht nachdenken wollte. Sie musste dieses Schriftstück finden, und dafür blieben ihr nur wenige Augenblicke, denn bald würden weitere Leute kommen, und wie sie das anstellen sollte, wenn Eyon es am Leib trug – ihre Augen schweiften durch die Kammer, um festzustellen, wo es sonst sein könnte, aber es lagen weder abgelegte Kleidungsstücke noch ein Beutel herum. Nur Eyons Schuhe standen auf dem Boden neben dem Bett. Um Zeit zu gewinnen, fragte sie: »Er ist überhaupt nicht krank gewesen?«
»Nein«, entgegnete William. »Gestern abend haben wir noch …«
Sich nähernde Stimmen waren aus dem anliegenden Raum zu hören. Wahrscheinlich der Priester, ganz bestimmt die Neugierigen. William brach ab und sah sie einen kurzen Augenblick schweigend an – ein seltsamer Blick, der Fragen stellte, ohne Antworten zu erwarten –, dann streckte er die Hand aus und sagte leise: »Hier. Das ist es wohl, wonach Ihr sucht.«
Er hatte die zusammengefalteten Papiere. Die Kammer war klein, der Raum reichte gerade für die beiden Betten und eine Truhe, die zur Aufbewahrung der Besitztümer und als Sitzgelegenheit diente. Jane stand bereits so dicht bei William, dass sie die Papiere nur zu ergreifen brauchte, und sie riss sie ihm aus der Hand, da keine Zeit blieb vorzugeben, sie wüsste nicht, wovon er redete, auch keine Zeit zu fragen, wie er daran gekommen war. Der Priester, dessen murmelnde Stimme ihr vertraut war, stand jetzt direkt hinter ihr. Sie wich Williams prüfendem, immer noch fragendem Blick nicht aus, verweigerte ihm aber jegliche Antwort, forderte ihn heraus, mehr zu sagen, und schob derweil hastig die Papiere in den engen Ärmel ihres Kleides, wo sie sicher und nicht zu sehen waren, bevor sie sich abwandte, zur Seite trat, vor dem Priester knickste und entfloh. Im Augenblick war am dringlichsten, Lady Alice mitzuteilen, dass die Botschaft in Sicherheit war. Der Empfänger hatte sie nicht erhalten, aber sie war in Sicherheit. Die Frage, was William wusste, nicht wusste oder erraten hatte, würde sie auf später verschieben müssen. Sollte Lady Alice sich damit auseinandersetzen. Jane jedenfalls hatte es abgelehnt, Fragen zu stellen, nicht einmal bei sich selbst, seit Lady Alice ihr zum ersten Mal in dieser Sache vertraut hatte.
Aber nichtsdestotrotz stellte sie sich nun doch eine Frage, denn Eyon Chesman war kein Mann gewesen, der sich sinnlos betrank. Normalerweise nicht, schon gar nicht, wenn ihm eine Aufgabe anvertraut worden war, und ganz gewiss nicht, wenn sie so dringlich gewesen war wie diese Botschaft. Das war mit Sicherheit einer der Hauptgründe dafür, dass Lady Alice beschlossen hatte, ihn einzusetzen.
Wie kam es dann, dass er gestorben war, weil er zuviel getrunken hatte?
2
EinscharferWind, der ihnen durch Mark und Bein fuhr, trieb den Schnee durch den Kreuzgang, fegte ihn in Ecken und wieder hinaus und wirbelte ihn um ihre Röcke herum, als die Nonnen durch die Kälte und die Dunkelheit des frühen Abends vom Refektorium zur erhofften Behaglichkeit des Wärmeraums hasteten, wo sie nun eine Stunde lang vor dem Feuer sitzen durften. Danach kamen die Komplet und das fröstelnd kalte Dormitorium. Ihre schwarze Benediktinerinnentracht aus Wolle, die schwarzen Schleier und weißen Wimpel, die nur das Gesicht frei ließen, boten am heutigen Abend nur wenig Schutz vor den eisigen Klauen der Kälte. Obwohl Schwester Juliana von Rechts wegen hätte vorgehen sollen, waren sie alle zu sehr in Eile, um sich groß um Vorrechte und Rangordnung zu kümmern. Schwester Emma war es, die voranging, und während sie den Kreuzgang entlanghastete, rief sie aus: »Erbarmen, Erbarmen, Erbarmen! Wenn es jetzt schon so kalt ist, wie wird es dann erst im Winter werden?« Aber das sagte sie immer, zu Beginn jeden Winters, und niemand antwortete ihr. Sie folgten ihr auf den Fersen, bedrängten sie und einander in ihrer Hast, so dass Schwester Emma, während sie mit dem Riegel kämpfte, über die Schulter hinweg protestierend ausrief: »Nun drängelt doch nicht so!« und dann »Erbarmen!«, als die Tür aufging und gesegnete Wärme und der Schein des Feuers sie empfingen.
Im Kloster St. Frideswide gab es nur in der Amtswohnung der Priorin, der Küche und hier im Wärmeraum einen Kamin. Die Ordensregel bestimmte, dass in der Amtswohnung und dem Wärmeraum lediglich von Ende Oktober bis Anfang Mai ein Feuer angezündet werden durfte. Nach dem Willen der Priorin konnte die Regelung hin und wieder gelockert werden, was auch geschehen war, aber jetzt hatten sie November, den November im Jahr des Heils 1439. »Selbst wenn es noch nicht Zeit für ein Feuer gewesen wäre, ist es kalt genug«, meinte Schwester Johane und streckte die Hände zum Feuer hin, während sie sich mit den anderen um den Kamin scharte.
Nur Schwester Thomasine folgte langsamer. Wie gewöhnlich war sie die letzte, wie es bei allem war außer beim Gebet, und nahm sich die Zeit, die Tür mit der überlegten, bedachtsamen Sorgfalt zu schließen, mit der sie an alles heranging, was sie tat. Ruhig durchquerte sie den Raum, um sich den anderen anzuschließen, und Schwester Frevisse rückte bereitwillig ein wenig zur Seite, um ihr Platz zu machen. Sie waren mittlerweile nur noch zu neunt in dem Priorat, und vor dem Feuer war für alle Platz, wenn sie ein wenig zusammenrückten, wogegen bei dieser Kälte niemand etwas einzuwenden hatte.
St. Frideswide war niemals ein großes Kloster gewesen, aber bis vor zwei Wochen waren sie zumindest noch zu zehnt. Bis die Missetaten ihrer Priorin ans Licht gekommen waren und das Kloster der Gnade des Abtes ausgeliefert worden war. In den vergangenen Tagen hatte Abt Gilberd seine Nase in jeden erdenklichen Winkel des Klosters gesteckt, und seine Leute waren angewiesen herauszufinden, welche Misswirtschaft die Priorin betrieben, wieviel vom Klosterbesitz sie für unrechte Zwecke vergeudet und wie viele Gelder sie ausgegeben hatte, die sie zwar erwartet, aber nie bekommen hatte.
Sie selbst war fort, nachdem sie zwanzig Jahre in St. Frideswide gelebt hatte, vier davon als Priorin. Letzte Woche hatte man sie in ein anderes Frauenkloster geschickt, wo sie nichts weiter sein würde als eine einfache Nonne unter Fremden. Ihren Nonnen war nicht einmal mitgeteilt worden, wohin sie ging, ja, sie hatten ihre Priorin nicht einmal verabschieden dürfen. Eines Morgens, als alle in der Kapitelversammlung zusammensaßen, war sie einfach einigen von Abt Gilberds Leuten übergeben und fortgebracht worden. Lediglich ihre einfältige Dienerin leistete ihr Gesellschaft, und dies war ein Zugeständnis an die Dienerin, die den Verlust ihrer Herrin nicht begriffen haben würde.
Um die Wahrheit zu sagen, war es eine Erleichterung, dass Priorin Alys fort war, aber dennoch hinterließ ihr Weggang eine seltsame Leere. Eine Leere, die noch weiter zunahm. Außer der Priorin hatte sie auch deren Tante verlassen, die im Kloster in Pension gelebt hatte, mitsamt ihrer Kammerfrau, ihren Schoßhunden und ihrer ganzen Sippschaft. Und laut Beschluss von Abt Gilberd hatte auch die kleine Lady Adela zu gehen, ein Mädchen, das vor fünf Jahren von ihrem Vater Lord Warenne nach St. Frideswide gebracht worden war, um hier erzogen zu werden und eines Tages als Nonne ins Kloster einzutreten. Letzteres war nie offen versprochen worden, aber die Schwestern hatten aus ihrer diesbezüglichen Hoffnung kein Geheimnis gemacht.
»Er bezahlt sogar Pensionsgeld für sie. Zu Mariä Verkündigung und zu Michaeli«, hatte Schwester Juliana einzuwenden gewagt, als Abt Gilberd ihnen mitgeteilt hatte, dass Lady Adela gehen musste. Mittlerweile wussten sie alle, dass es wenig Sinn machte, Einwände gegen Abt Gilberds Beschlüsse zu erheben. Doch die Verzweiflung über die Verantwortung, die ihr mit dem Fall der Priorin zugefallen war, hatte Schwester Juliana, die Cellerarin und Küchenmeisterin des Klosters, ein wenig tollkühn gemacht, und sie hatte sogar gewagt hinzuzufügen, wenn auch nur mit leiser Stimme: »Wir brauchen das Geld, wisst Ihr.«
»Wer wüsste das besser als ich«, hatte der Abt entgegnet, ein wenig gereizt vielleicht, denn er hatte viele Stunden damit zugebracht, die wenig zufriedenstellenden Rechnungsbücher des Klosters durchzusehen. »Aber was St. Frideswide mindestens ebenso dringend braucht wie Geld, ist das Gebet, und um beten zu können, müsst Ihr von allen Ablenkungen befreit sein. Das Kind ist eine Ablenkung.«
»Aber nur eine kleine«, hätte Schwester Perpetua erwidern können, denn schließlich war vor allem sie für Lady Adela verantwortlich gewesen. Doch die Enthüllungen über die ernsten Schwierigkeiten, in denen das Kloster steckte, hatten sie alle so eingeschüchtert, dass sie den Willen des Abtes einfach hinnahmen.
Zumindest lag ihm ebensoviel daran, der Saumseligkeit beim Singen der Chorgebete, die unter ihrer früheren Priorin eingerissen war, ein Ende zu machen, wie an der Wiederherstellung der weltlichen Ordnung, mit der es in St. Frideswide in den letzten Monaten auch nicht allzugut bestellt gewesen war. Das zumindest schätzte sie an ihm, dachte Frevisse, als sie ihre Hände von der beglückenden Wärme zurückzog, sie in die Ärmel schob und gegen den Leib drückte. Dies und die Tatsache, dass er mit ihnen fertig war, zumindest für den Augenblick.
Das hatte er ihnen heute morgen in der Kapitelversammlung mitgeteilt, nachdem er ausführlich und peinlich genau erläutert hatte, wie schlecht das Priorat wirtschaftlich dastand und wie sparsam sie ab sofort würden leben müssen. Ihre Finanzen mussten erst in Ordnung gebracht werden, bis ihr Grundbesitz hoffentlich wieder einen Gewinn abwerfen würde, von dem sie existieren konnten. Selbst auf scheinbar so kleine Dinge wie warmen, gewürzten Apfelwein nach der Komplet, um ihnen den Weg ins Bett zu versüßen, würden sie für eine Weile verzichten müssen. »Gewürze sind teuer«, hatte Abt Gilberd erklärt, »und Euer Vorrat an Apfelwein ist begrenzt. In diesem Jahr werdet Ihr weder Apfelwein noch Gewürze mehr kaufen können. Ihr werdet mit dem auskommen müssen, was da ist.« Und das war nur eine der Einsparungen, die er ihnen auferlegt hatte. »Euer Verwalter ist bestens unterrichtet«, hatte er gesagt. »Tut, was er Euch sagt, dann solltet Ihr bestens zurechtkommen.«
Das zu hören war hart gewesen. Sie waren daran gewöhnt, das Kloster selbst zu leiten, und nun wurden sie der Kontrolle ihres Verwalters unterstellt. Aber Abt Gilberd hatte sie gleich davon abgelenkt, indem er fortfuhr: »Damit habe ich wohl alles getan, was im Augenblick möglich ist. Und selbst wenn noch mehr getan werden müsste, würde es warten müssen. Ich bin zur Parlamentseröffnung nach Westminster gerufen worden und muss morgen aufbrechen.« Seine Ellbogen ruhten auf den Armlehnen seines Lehnstuhls – des Lehnstuhls ihrer Priorin –, und er hatte die Finger verschränkt, auf ihre wartenden Gesichter geblickt und gesagt, was sie hatten hören wollen. »Damit bleibt nur noch die Frage, wer jetzt Priorin von St. Frideswide werden soll.«
Als die Worte endlich ausgesprochen waren, hatten sie die Köpfe gesenkt und auf seine Entscheidung gewartet. Üblicherweise hätten sie selbst aus den eigenen Reihen heraus ihre Priorin gewählt und anschließend um die Billigung ihres Abtes gebeten; und wahrscheinlich hätte er sie erteilt, aus der sicheren Entfernung seiner Abtei St. Bartholomäus in Northampton heraus. Aber es war eben nicht wie sonst, und Abt Gilberd hatte, wie es sein Recht war, die Angelegenheit selbst in die Hand genommen. »Wenn man alles erwägt, die vergangenen Ereignisse ebenso wie die Zukunft, kann ich nicht guten Gewissens eine von Euch für das Amt vorschlagen.«
Obwohl sie eigentlich damit gerechnet hatten, war eine Bewegung der Enttäuschung durch die jüngeren Nonnen gegangen, während sich in Frevisse eine innere Anspannung gelöst hatte, denn zu den vielen Dingen, die sie im Leben nicht wollte, gehörte die Verantwortung, die mit dem Amt der Priorin einherging. Da zumindest diese Drohung nicht länger über ihr hing, hatte sie zusammen mit den anderen schweigend gewartet, bis Abt Gilberd fortfuhr: »Ich habe gründlich über die Sache nachgedacht, und gestern erhielt ich eine Antwort auf meine Anfrage. Ich möchte Euch demnach mitteilen, dass meine Wahl auf Schwester Elisabeth vom Kloster der heiligen Helena in der Bishopsgate in London gefallen ist.«
Ohne die Köpfe zu heben, hatten die Nonnen rasche Blicke unter ihren Schleiern hervor ausgetauscht, eine stumme Frage, ob jemand schon mal von ihr gehört hatte. Keine kannte sie, aber das spielte auch keine Rolle, denn Abt Gilberd hatte hinzugefügt: »Sie ist meine weltliche Schwester, und daher kenne ich sie gut genug, um vollauf überzeugt zu sein, dass sie als Priorin sowohl Euch als auch St. Frideswide gut dienen wird.«
»Ganz zu schweigen davon, dass sie ihm alles zutragen wird, wenn wir nicht tun, was sie uns sagt«, hatte Schwester Cecely sich später beschwert, als Abt Gilberd nicht da war und sie nicht hören konnte. Schwester Claire hatte sie prompt mit zügelnder Milde belehrt: »Wir sind verpflichtet, unserer Priorin zu gehorchen, wer immer sie ist. Wir haben es geschworen.« Woraufhin Schwester Cecely erwidert hatte: »Na, dieser werden wir ganz bestimmt gehorchen müssen.«
Aber während der Ansprache hatte keine der Schwestern ein Wort gesagt, und Abt Gilberd war fortgefahren: »Sowohl Schwester Elisabeth als auch ihre Priorin haben ihre Zustimmung erteilt, und ich halte es für das beste, wenn sie ihr Amt so bald wie möglich antritt. Deshalb und um ihr das Einleben hier zu erleichtern, beabsichtige ich, Schwester Perpetua und Schwester Frevisse mitzunehmen, wenn ich morgen aufbreche, damit sie in St. Helena mit ihr zusammentreffen und sie hierher zurückbegleiten können.«
Verblüfft hatte Frevisse den Kopf gehoben und ihn angestarrt. Dann hatte sie Schwester Perpetua angesehen, die gerade den Kopf gewandt hatte, um sie anzublicken. Beide hatten einander stillschweigend gefragt: Warum ausgerechnet sie? Die Disziplin hatte sie wieder nach vorne schauen und mit gesenktem Kopf fast einstimmig murmeln lassen: »Ja, Herr Abt.«
Denn was hätten sie auch sonst sagen sollen?
Und so kam es, dass dieser Abend, der in gewisser Weise durchaus recht angenehm hätte werden können, da sie die Gewissheit hatten, dass Abt Gilberd sie verlassen würde, für Frevisse mit Besorgnis und Unruhe belastet war. Es war nun nicht so, als hätte sie das Kloster nicht mehr verlassen, seit sie ihre Gelübde abgelegt hatte. Sie hatte St. Frideswide mehr als einmal verlassen, aus den unterschiedlichsten Gründen, die alle ebenso gut gewesen waren wie dieser. Es war einfach so, dass sie nicht verstand, warum die Wahl ausgerechnet auf sie gefallen war, und Dinge, die sie nicht verstand, bereiteten ihr stets Unbehagen.
Mittlerweile war ihnen allen so warm, dass sie auch an etwas anderes denken konnten als daran, wie kalt ihnen doch war. Schwester Thomasine hatte sich bereits ein Stück entfernt auf einen der Hocker gesetzt, den Rosenkranz in die Hand genommen und die Augen geschlossen. Ihre Lippen bewegten sich lautlos, und sie lächelte während des Gebets still in sich hinein. Die Unruhe der letzten Tage schien sie nicht sehr berührt zu haben, denn das Gebet bedeutete ihr stets mehr als alles andere, mehr selbst als die Kälte. Die übrigen, deren Gedanken nicht beim Gebet waren, blieben dichter beim Feuer sitzen. Es war Schwester Juliana, die es laut aussprach: »Wir wissen doch überhaupt nichts von ihr!« Von Schwester Elisabeth, meinte sie. »Priorin Alys kannten wir zumindest.«
»Und dennoch haben wir sie gewählt«, erwiderte Schwester Claire knapp. Dass die Wahl ihrer ehemaligen Priorin ein von niemandem beabsichtigtes Missgeschick gewesen war, spielte jetzt keine Rolle mehr. Wie auch immer es dazu gekommen war, sie hatten dadurch ihr Recht verwirkt, selbst zu entscheiden, wer als nächstes als Klosterobere über ihnen stehen sollte, und Schwester Johane meinte bedauernd: »Wir hätten Abt Gilberd nach ihr fragen sollen, als wir die Gelegenheit dazu hatten, in der Kapitelversammlung.«
»Und warum hast du es nicht getan?« wollte Schwester Cecely wissen.
Schwester Johane stieß sie mit dem Ellbogen in die Rippen. Die beiden jüngsten unter den Nonnen waren Cousinen und gingen stets in freimütiger Unhöflichkeit miteinander um. Eine bessere Antwort war auch nicht notwendig, da niemand lange gebraucht hatte, um zu erkennen, wie nutzlos es war, Abt Gilberd Fragen stellen zu wollen. Er fragte und befahl, und von allen übrigen erwartete er, dass sie antworteten und gehorchten.
»Vielleicht ist sie ihm ja gar nicht ähnlich«, sagte Schwester Perpetua hoffnungsvoll. Dann fügte sie weniger hoffnungsfroh hinzu: »Es könnte natürlich sein, dass sie es doch ist.«
»Das werden wir bald genug erfahren«, stellte Schwester Claire fest. »Und Ihr und Schwester Frevisse noch eher als wir. Wie lange, glaubt Ihr, werdet Ihr fort sein? Wann werdet Ihr mit der Priorin zurückkehren?«
»Dazu hat niemand etwas gesagt«, entgegnete Frevisse. »Ich hoffe, dass wir am ersten Advent zurück sind.«
Schwester Amicia warf Schwester Perpetua einen bestürzten Blick zu. »Ihr werdet diesen Monat nicht hier sein!«
Der Ausdruck von Verwirrung in den Gesichtern der übrigen verwandelte sich mit unterschiedlicher Geschwindigkeit in eine Bestürzung, die der von Schwester Amicia gleichkam. Schwester Perpetua war derzeit Sakristantin und Vorsängerin, und damit oblag es ihr, dafür zu sorgen, dass allen Schwestern die Veränderungen der Liturgie im Verlauf des Kirchenjahres präsent waren. Es war ihre Aufgabe, die Chorgebete vorher mit ihnen durchzugehen, damit sie die Liturgie problemlos hersagen konnten, zum höheren Lobe Gottes und zum Besten ihrer Seelen. Gerade waren Allerheiligen und Allerseelen mit ihren komplexen Psalmen und Gebeten vorüber, was bedeutete, dass höchste Zeit war, an den Advent und die Weihnachtszeit zu denken, die mehr als einen Monat dauerte, vom ersten Advent bis ins neue Jahr hinein, bis Ephiphanias. Die Liturgie musste vorher eingeübt werden, und einige der Nonnen – Frevisse vermied es, Schwester Emma und Schwester Cecely anzusehen – brauchten mehr Übung als andere.
»Das kann ich übernehmen«, bot Schwester Claire an, klang aber eher unsicher. Sie war die Siechmeisterin und zuständig für die Gesundheit der Nonnen, aller Klosterbediensteten und der Bewohner der umliegenden Dörfer. Jetzt, wo der Winter begonnen hatte, würde sie ständig zu irgendwelchen Kranken gerufen werden, und irgendwann musste sie auch ihre Arzneien mischen. Und Schwester Juliana hatte genausoviel zu tun, jetzt schon mehr, als sie bewältigen konnte. Damit blieben die jüngeren Nonnen, doch Schwester Johane und Schwester Cecely waren zu neu, um von großem Nutzen zu sein, und Schwester Emma war zu einfältig …
Frevisse sah, wie Schwester Amicia sich bereits Hoffnungen machte, dass die Aufgabe ihr zufallen würde, und schlug schnell vor: »Schwester Thomasine sollte das übernehmen.«
»Schwester Thomasine?« fragte Schwester Juliana zweifelnd.
Alle sahen Schwester Thomasine an, die abseits vom Feuer und der Wärme saß, ins Gebet versunken, immer noch ein leises Lächeln auf dem Gesicht und so weit von ihnen entfernt, als befände sie sich in einem anderen Raum. Oder einer anderen Welt. »Schwester Thomasine?« wiederholte die Cellerarin mit vermehrtem Zweifel.
Aber Frevisse hatte Gelegenheit gehabt, mehr über Schwester Thomasine zu erfahren als die meisten anderen, und erwiderte entschieden: »Ja.«
Und Schwester Claire, der Schwester Thomasine im Spital geholfen hatte und die daher auch Gelegenheit gehabt hatte, ihre Fähigkeiten zu erkennen, fügte hinzu: »Übertragt die Aufgabe ruhig ihr. Sie kann es.«
»Nun …«, sagte Schwester Juliana. »Ich werde darüber nachdenken …« Und wechselte das Thema, indem sie Schwester Perpetua und Frevisse fragte: »Habt Ihr beide alles, was Ihr morgen brauchen werdet? Es wird ein kalter Ritt werden. Sind die Umhänge, die ich Euch gegeben habe, warm genug?« Und danach drehte sich das Gespräch um die praktischen Fragen der morgigen Reise.
3
EinViertagesrittbrachtesie aus dem nördlichen Oxfordshire am frühen Nachmittag des Montags aus den Hügeln von Islington hinunter. Der Weg schlängelte sich ostwärts durch die offene Landschaft, bis sie nach Süden abbogen und auf der Bishopsgate Road in Richtung London weiterreisten. Obwohl der Kirchturm von St. Paul’s sich schon seit einigen Meilen scharf gegen den Himmel und die fernen Hügelketten von Surrey abzeichnete, schloss London selbst sich erst um die Reisenden, als sie fast an den Stadtmauern angelangt waren. Sogar vom Spital St. Mary bis zum Spital von Bedlam waren nur vereinzelt Häuser zu sehen, zwischen denen Felder und Wiesen lagen. Dann passierten sie das Kloster St. Botolphs, und endlich lag nur noch die Londoner Stadtmauer und die breite Steinfläche des Bischofstors vor ihnen. Zumindest Frevisse war froh darüber, dass der Ritt fast zu Ende war.
Ihr Reisewetter war trocken, aber kalt gewesen. Der Wind hatte die Wolken und die Wärme von dem winterblassen Himmel gefegt, bis an diesem Nachmittag im Osten eine graue Wolkenbank aufgezogen war. Abt Gilberd hatte gesagt, als sie die Bishopsgate Road erreichten: »Anscheinend haben wir es gerade noch rechtzeitig geschafft. Sieht aus, als würde das Wetter umschlagen, und dann wird es wahrscheinlich Schnee geben.«
Während seines Aufenthalts in St. Frideswide war er in seinem Umgang mit den Nonnen streng und hart gewesen, aber sobald sie das Priorat mit ihren Problemen hinter sich gelassen hatten, war er gnädiger und liebenswürdiger geworden, nicht nur gegenüber der kleinen Lady Adela, deren Vater ein Lord war, sondern auch gegenüber Schwester Perpetua, deren Familie dem Ritterstand angehörte, und gegenüber Frevisse. Er behandelte sie so zuvorkommend, als seien sie besonders geschätzte Gäste, stellte sicher, dass sie in den verschiedenen Klöstern, in denen sie unterwegs übernachteten, gut untergebracht waren, und unterhielt sich während des Ritts mit ihnen. Wie Frevisse nach dem, was sie in St. Frideswide von ihm gesehen hatte, erwartet hatte, war er sehr gelehrt. Aber seine Ansichten waren meist so abgedroschen, dass sie es im großen und ganzen vorzog, das Gespräch Schwester Perpetua zu überlassen. Und Lady Adelas Eifer füllte alle Gesprächspausen, die sonst vielleicht entstanden wären. Heute, seit der Kirchturm von St. Paul’s in Sicht gekommen war, hatte Schwester Perpetua unglücklicherweise ausschließlich besorgte Kommentare über die Größe Londons, die Möglichkeit einer Pestepidemie, die Gefahren von großen Menschenansammlungen auf engem Raum und das Verbrechen abgegeben. Als sie auf die Straße ritten, die zum Stadttor Bishopsgate führte, begann sie erneut damit, so dass Abt Gilberd sie freundlich beruhigte: »Es ist gar nicht so schlimm, wie immer erzählt wird. In mehr als einer Beziehung ist London wie ein größeres Northampton, das ist alles.«
»Aber ich bin noch nie in Northampton gewesen«, murmelte Schwester Perpetua ein wenig wehleidig.