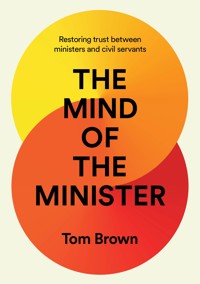Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Mit diesem Buch gibt der Arzt Dr. Tom Brown Einblick in sein bewegtes Leben als Notarzt. Seit mehr als 20 Jahren ist er hauptsächlich als freiberuflicher Notarzt tätig. In dieser Zeit hat der erfahrene Arzt mehr als 15.000 Patienten behandelt. Er berichtet in diesem als Reality-Roman verfassten Buch über schöne, lustige und skurrile Momente während seiner Dienste, aber auch über dramatische und tödliche Einsätze. Viele Krankheitsbilder wie Schlaganfall oder Herzinfarkt sind zum besseren Verständnis näher erklärt. Dadurch soll der Leser einen Eindruck bekommen, wann es sinnvoll ist, einen Notruf abzusetzen. Weiterhin sollte jeder Mensch die Scheu verlieren, anderen Menschen im Notfall Hilfe zu leisten. Alle dargestellten Einsätze haben tatsächlich stattgefunden. Persönlich belastend war der schwere Unfall seines besten Freundes während eines Notarzteinsatzes. Auch er selbst wurde Opfer eines persönlichen Übergriffes. Dr. Hans-Jürgen Brünnet beginnt sein Buch damit, wie er überhaupt zum Arztberuf und später zu seiner notärztlichen Tätigkeit kam. Mit diesem Buch tauchen Sie nun in die spannende und emotional bewegende Welt des Notarztes ein. Sie erleben diese Momente und menschlichen Schicksale hautnah.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 451
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Täglich begegnen uns im Straßenverkehr Fahrzeuge mit Blaulicht, Rettungswagen, Notarzt, Polizei oder Feuerwehr. Machen wir uns Gedanken darüber, dass in diesem Augenblick Menschen in Gefahr sind und dringend Hilfe brauchen? Denken wir an die vielen Helfer, die Tag und Nacht bereit stehen, um andere Menschen zu retten? Ohne weiter darüber nachzudenken lautet unser Kommentar vielleicht so: „Da ist wohl wieder etwas passiert. “Die Kinder schauen wahrscheinlich noch fasziniert dem Blaulicht hinterher. Und das war es dann auch schon. Im nächsten Moment befinden wir uns sofort wieder in unserem Alltag zurück.
Mit diesem Buch möchte ich einen kleinen Einblick in mein Leben als Notarzt geben. Seit mehr als 20 Jahren bin ich hauptsächlich als freiberuflicher Notarzt tätig. In dieser Zeit habe ich mehr als 15.000 Patienten behandelt. Ich berichte im Folgenden über schöne und lustige Momente während meiner Dienste, aber auch über dramatische und tödliche Einsätze. Viele Krankheitsbilder sind zum besseren Verständnis näher erklärt. Ich gehe auch auf Schwierigkeiten und Probleme in meiner täglichen Arbeit ein, unter anderem mit Gaffern oder ignoranten Autofahrern.
Dieses Buch entstand aus einem inneren Bedürfnis heraus. Über einen längeren Zeitraum spürte ich den Drang, meine Erlebnisse zu verfassen und der Bevölkerung näher zu bringen. Es dauerte Monate, bis ich mich endlich hinsetzte, um dieses Projekt zu realisieren.
Es ist gar nicht einfach, erst einmal ein Konzept zu erstellen. Im März 2015 habe ich dann die ersten Seiten geschrieben. Dies tat ich zwischen meinen Notarzteinsätzen. Nachdem ich die ersten zehn Seiten geschrieben hatte, legte ich eine Pause ein. Mein Vorhaben lag wie ein riesiger, unüberwindbarer Berg vor mir. Ich genoss den Sommer. Dabei verschwendete ich erst einmal keinen weiteren Gedanken an mein Buch. Erst im Oktober kam die Initialzündung, akribisch mit neuem Schwung weiter zu schreiben. Geholfen hat mir Jan Beckers Buch „Du kannst schaffen, was Du willst“. Ich kannte Jan bereits aus einigen Hypnosekursen, die ich bei ihm belegt hatte. In seinem Buch fand ich für mich die passende Textstelle, als hätte er sie genau für mich geschrieben. Ab diesem Zeitpunkt kannte meine Motivation, das Buch zu vollenden, keine Grenzen mehr. In jeder freien Minute hing ich am Computer. Acht Monate später konnte ich mein Werk beenden.
Tauchen Sie nun ein in die Welt des Notarztes. Ich wünsche Ihnen spannende und emotional bewegende Momente.
Dieses Buch widme ich den Menschen, die ich liebe.
Endlich hatte ich mein großes Ziel erreicht. Nach sechs Jahren intensivem Lernen saß ich nun mit meiner Familie und weiteren 150 Kommilitonen und ihren Angehörigen im großen Hörsaal der Anatomie der Medizinischen Fakultät. Zunächst spielte das Orchester der Hochschule ein Stück von Mozart. Ich war sehr berührt. Einerseits spürte ich innerlich eine große Erleichterung und Freude nach dieser langen, aber schönen Studentenzeit. Andererseits schlug mein Puls schneller und ich bemerkte eine leichte Anspannung. Der Dekan begrüßte und gratulierte uns in seiner Rede zu unserem bestandenen Examen. Danach wurde jeder Einzelne aufgerufen. Nun war ich an der Reihe. Voller Stolz stieg ich die Treppe des Hörsaales herab. Der Dekan überreichte mir meine Approbationsurkunde. Ich konnte meine Freudentränen kaum unterdrücken. Jetzt war ich Arzt. Dies war nun der schönste Tag in meinem Leben. Während die übrigen Kommilitonen ihre Urkunden erhielten, gingen mir viele Gedanken durch den Kopf.
Seit meiner Kindheit wollte ich immer Arzt werden, aber konnte es rational nicht erklären. Vielleicht lag der Grund in meinem Weihnachtsgeschenk von 1969. Ich war vier Jahre alt. Von meinen Eltern bekam ich einen roten Arztkoffer aus Plastik geschenkt. Darin befanden sich unter anderem ein Stethoskop, Spritzen, ein Arztkittel, ein Reflexhammer und vieles mehr. Von nun an war niemand mehr vor mir sicher. Auf jeder Familienfeier suchte ich Opfer, die ich untersuchen durfte. Doch irgendwann waren alle Verwandten untersucht. Da suchte ich mir neues Anschauungsmaterial für meine Studien. Mein Wissensdurst kannte keine Grenzen. Doch meine Schwester war hierüber nicht sehr erfreut. Denn meine nächsten Patienten waren ihre Puppen. Dabei reichte es mir nicht mehr diese nur äußerlich zu inspizieren, ich wollte ihr Innenleben kennenlernen. Arme und Beine wurden von mir fachgerecht amputiert. Doch der Höhepunkt meiner kindlichen Doktorspiele war eine neurochirurgische Operation, eine Trepanation. Hierfür suchte ich mir die Lieblingspuppe meiner Schwester aus. Ich bohrte ein riesiges Loch in den Schädel dieser Puppe und war ganz enttäuscht, dass der Kopf hohl war. Als meine ältere Schwester das Ergebnis meiner Operation sah, rannte sie wutentbrannt auf mich zu und schrie: „Spinnst Du jetzt total? Was hast Du mit meiner Puppe gemacht?“ Bevor sie mich verprügeln konnte, kam unsere Mutter, nahm meine weinende Schwester liebevoll in den Arm und sagte: „Jetzt weine nicht. Ich kaufe Dir eine neue, noch schönere Puppe.“
Es dauerte sehr lange, bis meine Schwester sich von diesem Schock erholte. Leider war dies auch mein letzter Eingriff an den Puppen, denn von nun an sperrte meine Schwester sie ein und ich kam nicht mehr an sie heran. Jetzt lagen meine ärztlichen Aktivitäten für längere Zeit auf Eis. Jedoch der Wunsch Arzt zu werden war weiterhin tief in meinem Innersten verankert.
Als wir in der ersten Klasse der Grundschule von unserem Lehrer nach unserem Berufswunsch gefragt wurden, antwortete ich mit sicherer Stimme: „Wenn ich groß bin, werde ich Arzt!“ Dies war für mich ganz klar. Da ich wusste, dass man zum Studieren gute Noten brauchte, war ich ein fleißiger Schüler. Meine Noten waren sehr gut, so dass ich problemlos das Gymnasium besuchen konnte. Hier wählte ich als erste Fremdsprache Latein, weil diese als Arzt ja sehr wichtig war. Meine Eltern fragten mich immer wieder, ob mein Traumberuf Arzt noch immer aktuell sei. Ich sagte ihnen, dass es für mich keine Alternative gebe. Mein Wunsch sei es, Menschen zu helfen. Doch woher kam dieser unabänderliche Wunsch?
In meiner Familie hatte bisher niemand einen medizinischen Beruf ergriffen. Mein Vater war als Ingenieur tätig und meine Mutter kümmerte sich um die Familie. Doch von meiner Mutter erfuhr ich, dass sie gerne Krankenschwester geworden wäre. Leider konnte sie sich diesen Berufswunsch nicht erfüllen. Im Kriegsjahr 1944 erlitt ihre Mutter, im achten Monat schwanger, einen Schlaganfall. Dieser wurde ausgelöst durch die schreckliche Nachricht, dass ihr Mann gefallen sei. Damals war meine Mutter acht Jahre, als dieses Schicksal ihr ganzes Leben verändern sollte. Sie musste die Mutterrolle übernehmen und für ihre Mutter und die beiden Brüder sorgen. Nach Beendigung der Schulzeit wollte sie ihre Ausbildung zur Krankenschwester beginnen, doch meine Großmutter gab ihr diese Erlaubnis nicht. Wer sollte sich dann um sie kümmern? Daher ging meine Mama wie die meisten Frauen zu dieser Zeit arbeiten, um das Geld für die Familie zu verdienen. Später mit zwanzig Jahren absolvierte meine Mutter wenigstens einen Kurs als Rot-Kreuz-Helferin. Voller Stolz zeigte sie mir Fotos von sich als Schwesternhelferin. In ihr wuchs wieder der Wunsch zur Ausbildung als Krankenschwester. Aber dann lernte sie meinen Vater kennen. Die Beiden heirateten ein Jahr später und dann kam meine Schwester zur Welt. So wurde wieder nichts aus ihrem Traumberuf. Fünf Jahre nach meiner Schwester wurde ich geboren. Als ich vier Jahre alt war, erlitt meine Großmutter ihren zweiten Schlaganfall. Mama nahm die Oma zu uns in die Wohnung. Ein Jahr später zogen wir in unser eigenes Haus. Während meiner Kindheit und Jugend erlebte ich meine Mutter als liebevolle Pflegerin ihrer gelähmten Mutter. So wurde ich geprägt durch die Fürsorge und Pflege eines hilfsbedürftigen Familienmitgliedes. Wahrscheinlich bestärkte dieser Umstand unwillkürlich meinen Kindheitswunsch Arzt zu werden.
Die Zeit auf dem Gymnasium verlief sehr gut. Immer mein Ziel vor Augen, lernte ich eifrig. Auch meine Noten blieben hervorragend. Ich war so fest vom Erreichen meines Berufswunsches überzeugt. Zwölf Jahre war ich alt, als wir Urlaub in einem kleinen Familienhotel in Österreich machten. Dort war auch ein junges Mädchen aus Hamburg zu Gast. Voller Stolz erzählte sie mir: „Du weißt schon, zur Zeit sind hier zwei Ärzte im Hotel anwesend!“ Ich entgegnete: „Wieso zwei, nein es sind drei!“ Sie darauf trotzig: „Nein, es sind zwei! Wieso sollten es drei Ärzte sein?“ Da rief ich ihr lachend zu: „Es sind zwei approbierte Ärzte da und ein angehender Arzt! Das bin ich! Also doch drei!“ Jetzt war die sonst so vorlaute Hamburger Deern absolut sprachlos! Die nächsten zwei Tage redete sie kein Wort mehr mit mir.
Ich war vierzehn Jahre alt, als meine Schwester Abitur machte. Auch sie wollte jetzt einen medizinischen Beruf ergreifen. Zunächst hatte sie sich zur Ausbildung als medizinisch technische Assistentin entschieden und bereits angemeldet. Doch plötzlich traf sie eine andere Entscheidung. Sie teilte uns mit: „Ich werde Medizin studieren!“ Wir waren alle total überrascht von ihrem Vorhaben. Sie bewarb sich und bekam ein Jahr später ihren Studienplatz. In der Zwischenzeit hatte sie auf einer Privatschule eine Ausbildung zur Arzthelferin abgeschlossen.
Nach der mittleren Reife absolvierte ich ein vierwöchiges Pflegepraktikum im Krankenhaus unserer Stadt. Meine Eltern rieten mir dazu. Sie meinten: „Bevor Du endgültig Deinen Berufswunsch erfüllen möchtest, prüfe Dich, ob Du für diesen Beruf geeignet bist. Hier wirst Du wichtige Erfahrungen mit Krankheit und Tod sammeln.“ Der Rat meiner Eltern war ausgezeichnet.
Für mein Praktikum war ich auf der Unfallchirurgie eingeteilt. Meine Aufgaben bestanden unter anderem im Verteilen von Essen, Waschen von Patienten und Abwaschen der Nachtschränke. Natürlich gehörten auch das Entleeren der Urinflaschen sowie das Setzen der bettlägerigen Patienten auf das Steckbecken dazu. Das war nicht so angenehm. Während des Praktikums machte ich auch die ersten Erfahrungen mit dem Tod. Bis zu dieser Zeit hatte ich noch keine Leiche gesehen. Es passierte in meiner Spätschicht. Das Pflegepersonal war in der Gemeinschaftsküche versammelt, als plötzlich auf dem Flur Hilfeschreie ertönten: „Hilfe, Hilfe, schnell meine Mutter stirbt!“ Wir sprangen sofort auf und rannten ins Patientenzimmer. Die Patientin war total blau im Gesicht und atmete nicht mehr. Sofort wurde die Wiederbelebung angefangen. Eine Schwester beugte sich über den Kopf, überstreckte ihn und begann mit der Mund-zu-Mund-Beatmung. Die zweite Schwester übernahm die Herz-Druck-Massage. Hektisch rief mir eine der Beiden zu: „Tom, alarmiere schnell den diensthabenden Arzt. Dann bringe den Notfallwagen herbei.“ Auf diesem Wagen befanden sich alle für eine Reanimation notwendigen medizinischen Hilfsmitteln. Kaum fuhr ich mit dem Notfallwagen ins Krankenzimmer, eilte auch schon der diensthabende Arzt mit wehendem Kittel um die Ecke. Der Arzt übernahm sofort die Beatmung der Patientin. Sie wurde umgehend intubiert. Zügig legte er noch eine Infusion, um Medikamente zu verabreichen. Ich stand am Bettende und konnte nur zusehen, wie der Arzt und die Schwestern um das Leben der älteren Frau kämpften. Vergebens. Nach einer halben Stunde wurde die Reanimation abgebrochen. Die Patientin verstarb fünf Tage nach einer Schenkelhalsoperation an einer massiven Lungenembolie. Ich war sehr betroffen. Zwei Stunden später, nachdem die Angehörigen Abschied genommen hatten, sollte ich mit einer Schwester die Leiche in die Leichenhalle im Keller bringen. Dabei verspürte ich ein sehr beklemmendes, ängstliches Gefühl. Wir fuhren gerade mit dem Bett in den Aufzug, als ich nochmals ein Seufzen von der Leiche hörte. Ich erschrak und wurde ganz blass. Die Schwester lachte und beruhigte mich. Sie erklärte mir, dass sich noch Luft in der Lunge befand und diese nun durch das Holpern im Aufzug entwich. Bis wir in der Prosektur ankamen, wich mein Blick nicht mehr von der abgedeckten Leiche. Nicht, dass sie doch wieder aufsteht, dachte ich mir. Man hatte ja schon so allerlei Schauermärchen gehört. Aber es passierte nichts mehr. Die Erfahrungen im Krankenhaus bestätigten mich weiter, an meinem eingeschlagenen Weg festzuhalten.
Nun kamen die letzten beiden Schuljahre. Ich konzentrierte mich bei der Auswahl meiner Prüfungsfächer auf die Naturwissenschaft. Biologie, Chemie und Physik sind nämlich im Medizinstudium Bestandteil der vorklinischen Ausbildung. Im Juni 1984 hatte ich dann mein Abitur sehr erfolgreich bestanden, jedoch den Numerus clausus von 1,1 hatte ich nicht geschafft. Ich bewarb mich bei der Zentralvergabestelle für Studienplätze. Meine Eltern fragten mich: „Hast Du einen Plan B, falls Du nicht sofort einen Studienplatz bekommst?“ Den hatte ich leider noch nicht. Sollte ich einen anderen Studiengang beginnen und dann versuchen, als Quereinsteiger in die Medizin zu wechseln, oder eine Ausbildung als Krankenpfleger anfangen? Ich entschied mich für die Krankenpflegeausbildung in der Hoffnung, doch noch einen Studienplatz für Medizin zu erhalten. Die Ausbildung sollte am 01. Oktober anfangen. In der Zwischenzeit jobbte ich in einer großen Firma, denn ich wollte mir ein eigenes Auto kaufen.
Jeden Tag schaute ich voller Spannung in den Briefkasten und wartete auf einen Brief von der Zentralvergabestelle. Endlich Mitte September war es soweit. Der langersehnte Brief traf ein. Ich war sehr aufgeregt, als ich mit zitternden Händen den Brief öffnete. Angespannt las ich die ersten Sätze. „Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass Sie zum Wintersemester keinen Studienplatz erhalten. Sie werden auf eine Warteliste gesetzt und können sich für das Sommersemester erneut bewerben!“ Meine Enttäuschung war riesig.
Somit musste ich also die Ausbildung beginnen. Die Theorie fiel mir sehr leicht und auch mit der Praxis gab es keine Probleme. Aber es war natürlich nicht das, was ich mir seit meiner Kindheit vorgestellt hatte. Ich kam zwar sehr gut mit dem Pflegepersonal und den Patienten zurecht, doch ich wollte mehr. Weiterhin bewarb ich mich um einen Studienplatz, aber es kamen die nächsten Absagen. Auf der Warteliste rutschte ich jedes Jahr weiter nach oben. Endlich nach zwei Jahren wurde ich zum Medizinertest eingeladen. Dieser fiel super gut aus. Sofort bekam ich meine Zusage. Meine Ausbildung brach ich daraufhin ab, um endlich meinen Traum erfüllen zu können.
Am 15. Oktober ging es an der Universität des Saarlandes in Homburg los. Die Uni war 50 Kilometer von meiner Heimatstadt entfernt. Meine Schwester absolvierte hier noch das letzte Semester vor ihrem Staatsexamen. Dort bewohnte sie ein Einzimmerapartment, welches ich mitbenutzen konnte und danach alleine übernahm.
Das erste Semester verlief problemlos, weil hier nur Fächer wie Biologie, Chemie und Physik geprüft wurden. Und diese hatte ich ja bereits in meinen Abiturprüfungen. Aber dennoch war es ganz anders als zur Schulzeit. Anfangs waren wir dreihundertfünfzig Studenten aus der gesamten Republik. Im großen Hörsaal hatte nicht jeder einen eigenen Sitzplatz. Es dauerte eine ganze Weile, bis man Freundschaften schloss. Ich hatte Glück, dass ich mich schnell mit Klaus anfreundete. Er kam aus Schwaben in der Nähe von Augsburg. Klaus wohnte in demselben Haus wie ich. Morgens gingen wir zusammen an die Uni und belegten auch die meisten Praktika zusammen.
Ab dem zweiten Semester wurde es dann interessant mit Anatomie und Physiologie. Jetzt begann für mich die Zeit des Büffelns. Mittlerweile hatten bereits die ersten Studenten das Handtuch geworfen. Die Uni war dafür bekannt, dass die Ausbildung in der Vorklinik sehr hart war und ca. 40% der Studenten aufgaben. Viel Freizeit blieb also nicht. In Studentenkreisen hieß es immer: „Was ist der Unterschied zwischen einem Medizin- bzw. einem Physikstudent?“ Die Antwort lautet: „Ein Medizinstudent lernt das Telefonbuch auswendig und ein Physikstudent lernt es anzuwenden!“ Und genau so war es auch.
Klaus und ich bestanden alle Prüfungen auf Anhieb und nach zwei Jahren kam nun die erste ganz große Hürde, das Physikum. Den ganzen Sommer waren wir mit den Vorbereitungen auf dieses Examen beschäftigt. Wir waren beide sehr nervös, weil jetzt der gesamte Stoff der Vorklinik abgefragt wurde und auch die Durchfallquoten recht hoch waren. Ende September erhielten wir dann den Bescheid von der UNI. Bestanden! Uns Beiden fiel ein großer Stein vom Herzen. Endlich war der rein theoretische Teil des Studiums beendet, nun kam die Praxis. In unseren Kursen hatten wir die ersten Patientenkontakte. Ab jetzt bereitete uns das Studium viel mehr Spaß. Die nächsten Jahre vergingen wie im Flug. Wir bestanden die folgenden drei Staatsexamina und nach sechs Jahren hatten wir das Studium erfolgreich abgeschlossen.
Nach der großen Abschlussfeier trennten sich vorerst die Wege von Klaus und mir. Klaus bekam eine Anstellung in der Chirurgie in der Nähe von Augsburg. Es war eine Kleinstadt mit ungefähr neuntausend Einwohnern. Ich begann meine Ausbildung ebenfalls in der Chirurgie, ca. zwanzig Kilometer von meiner Heimatstadt entfernt. Mein Vertrag war auf achtzehn Monate begrenzt. Im Anschluss bemühte ich mich intensiv um eine neue Assistentenstelle, doch es war schwierig. In Deutschland war gerade eine Ärzteschwemme. Klaus hingegen hatte Glück gehabt, er hatte einen langfristigen Vertrag erhalten. Wir hatten auch nach dem Studium noch einen guten Kontakt. Als wir wieder einmal miteinander telefonierten, fragte er mich: „Wie sieht es bei Dir mit einer neuen Stelle aus?“ „Jetzt habe ich bereits mehr als fünfzig Bewerbungen geschrieben, doch ich bekomme nur Absagen.“ Klaus entgegnete: „Da habe ich ja richtig Glück gehabt. Aber vielleicht habe ich eine Stelle für Dich!“ „Wie, was und wo?“ fragte ich ganz aufgeregt. „Der ehemalige Oberarzt meines Chefs übernimmt die Leitung einer Rehaklinik in der Nähe von Ingolstadt. Er sucht noch einen Assistenzarzt für die Orthopädie. Ich weiß, dass dies nicht Deinen Vorstellungen entspricht, aber besser Du hast erst mal eine neue Anstellung.“ Die erste Euphorie verschwand bei mir sehr schnell. Erstens wollte ich in ein Akutkrankenhaus und zweitens musste ich von zu Hause weg. Aber was blieb mir anderes übrig. Also bewarb ich mich als Assistenzarzt in der konservativen Orthopädie. Ich bekam die Stelle, zunächst einen Jahresvertrag. Der neue Job sollte am 01. Mai 1994 beginnen.
Als ich Klaus mitteilte, dass ich die Stelle bekommen habe und nun nach Bayern kommen werde, freute er sich sehr. Bei diesem Telefonat erzählte er mir von seiner neuen Aufgabe: „Tom, stell Dir vor, ab nächste Woche soll ich hier Notarztdienste übernehmen. “Ich war ganz überrascht und fragte ihn. „Wie geht dies denn so plötzlich?“ Klaus erklärte mir: „In unserer Kleinstadt existiert seit zwei Jahren ein Notarztstandort. Das Krankenhaus verpflichtet sich tagsüber den Notarzt zu stellen, doch leider gibt es zu wenige Kollegen, die Dienste übernehmen wollen. So kam der Chef auf mich zu und stellte mich vor vollendete Tatsachen. Er sagte zu mir, ab nächste Woche gehören Sie zu unserem Notarztteam! Wäre das nicht auch etwas für Dich?“ „Für mich?“ Über so eine Tätigkeit hatte ich mir gar keine Gedanken gemacht. „Ja klar. Bald wirst Du in Bayern sein und bist maximal achtzig Kilometer von mir entfernt. Am Wochenende könntest du dann Dienste übernehmen, denn auch da haben wir Besetzungsprobleme.“
Ich informierte mich sofort über die Voraussetzung für die Notarzttätigkeit. Man musste hierfür einige Notfallkurse in München absolvieren und zehn lebensrettende Einsätze als Praktikant mitfahren. Für die ersten Kurse fuhr ich noch vom Saarland aus nach München. Klaus bot mir an, an diesen Wochenenden in seiner Wohnung zu übernachten. Er hatte ein Zwei-Zimmer-Apartment gegenüber dem Krankenhaus. Es war schön, ihn nach unseren vielen gemeinsamen Jahren an der Uni wieder einmal persönlich zu treffen. Er erzählte mir von seinen ersten Notarzteinsätzen und machte mir diese Tätigkeit richtig schmackhaft. „Weißt Du“, sagte er zu mir, „als Assistenzarzt bist Du eigentlich der Depp vom Dienst. Du nimmst die Patienten auf, darfst viele Arztbriefe schreiben und im OP bist Du der Hakenhalter vom Chef. Nur kleine Operationen darfst du selbst durchführen. Doch als Notarzt ist das ganz anders. Du arbeitest eigenverantwortlich und musst in kurzer Zeit die richtigen Entscheidungen treffen, um das Leben der Patienten zu retten. Das ist als Anfänger meistens sehr anstrengend und teilweise psychisch sehr belastend, aber bei vielen Patienten sieht man sofort den Erfolg der Behandlung.“ Klaus war von dieser ärztlichen Tätigkeit so begeistert, dass ich kaum abwarten konnte, meine Einsätze als Notarzt-Praktikant mitzufahren. Er fragte mich: „Na Tom, wann hast Du Zeit für Dein Praktikum?“ „Dieses Jahr habe ich an Silvester dienstfrei und könnte - - .“ Klaus lachte herzhaft und unterbrach mich. „Perfekt. Da habe ich mich schon im Notarztplan eingetragen. Dann können wir gemeinsam mit Blaulicht das Neue Jahr beginnen!“
Ich konnte Silvester kaum erwarten. Endlich war es soweit. Am 30. Dezember fuhr ich nach Bayern. Klaus ging mit mir nachmittags noch an der Rettungswache vorbei, um mich beim Wachleiter vorzustellen und mir alles zu zeigen. Die Wache liegt unterhalb des Krankenhauses, etwa fünfhundert Meter von Klaus‘ Apartment entfernt. Der Wachleiter und die übrigen Mitarbeiter empfingen mich sehr freundlich. Man zeigte mir die Aufenthaltsräume und natürlich die Fahrzeughalle. Dort standen ein RTW, ein KTW und natürlich das Herzstück, das Notarzteinsatzfahrzeug. Es war ein BMW 320i mit 160 PS. Mein Herz schlug bei diesem Anblick etwas schneller als sonst. Ich konnte meine Faszination nicht verbergen. Dann wurde mir die komplette Ausstattung mit den Einsatzgeräten erklärt. Anschließend bekam ich noch eine rote Hose und eine passende Rot-Kreuz-Jacke. Die Rettungsassistenten teilten mir mit, dass sie im Durchschnitt 2-3 Notarzteinsätze in 24 Stunden hätten. Hier am Standort gäbe es das Rendezvous-System. Das bedeutet, dass der Rettungswagen und der Notarzt getrennt zum Einsatzort fahren. Der Vorteil sei, dass der Notarzt flexibel sei und bei Bedarf von einem Patienten zum anderen fahren könne, denn nicht immer sei für den Transport ins Krankenhaus die Anwesenheit des Arztes erforderlich. So komme der Notarzt mit vielen Rettungswagen unterschiedlicher Standorte zusammen. Insgesamt gebe es mehr Standorte für Rettungswagen als Notarztstandorte. Für Rettungswagen bestehe eine Hilfsfrist von zwölf Minuten, d.h. innerhalb dieser Zeit sollte der RTW beim Patienten eintreffen. Leider gebe es an einigen Standorten noch einen NAW, d.h. der Notarzt ist fest an den Rettungswagen gebunden. Im Bedarfsfall steht der Arzt für die Behandlung eines weiteren Notfallpatienten nicht zur Verfügung. Wenn ein Kranker dringend ärztliche Hilfe brauche, dann wählt er die Notrufnummer 19222. Unter dieser Nummer erreiche man die Rettungsleitstelle Augsburg, die die Einsätze für große Teile Schwabens disponiere. Diese wiederum alarmiert die nächstgelegenen freien Rettungsmittel.
Alle waren sehr nett zu mir, doch ich hatte nicht alles verstanden, was mir gesagt wurde. Und dies lag einzig und allein am bayerischschwäbischen Dialekt. Ich hatte vielleicht 60-70 Prozent verstanden. Dabei nickte ich oft mit dem Kopf und sagte „Ja, ja“ und tat so, als würde ich alles verstehen. Nach zwei Stunden verabschiedeten wir uns und gingen zurück in Klaus‘ Wohnung. Wir hatten uns so viel zu erzählen, dass der Abend schnell vorbei ging. Um Mitternacht gingen wir zu Bett, denn am nächsten Morgen mussten wir um 6:30 aufstehen. Eine Stunde später sollte der Dienst beginnen. Ich schlief sehr unruhig, da ich vor meiner ersten Notarztschicht, wenn auch nur als Praktikant, sehr aufgeregt war.
Als der Wecker um 6:30 klingelte, war ich noch nicht ausgeschlafen. Doch es nützte nichts, ich musste aufstehen und mich fertigmachen, während Klaus das Frühstück vorbereitete. Pünktlich um halb acht klingelte es an der Tür. Der Fahrer des NEF brachte den Funkmelder vorbei. Klaus hatte Glück. Da er sehr nahe an der Wache wohnte, konnte er von seiner Wohnung aus zum Einsatz fahren. Er übergab mir den Piepser. „So mein Freund, heute übernimmst Du die Verantwortung.“ Ich sah ihn ganz entsetzt an und antwortete ihm: „Ich bin doch nur als Praktikant da und weiß doch gar nicht, was ich machen soll!“ „Kein Problem, das wird schon funktionieren.“ Meine Anspannung war wohl nicht zu übersehen. Der Vormittag war schon fast vorüber und noch immer kein Einsatz. Allmählich wurde ich innerlich ruhiger. Zum Mittagessen bereiteten wir uns ein paar Spaghetti zu. Nun war es fast halb Drei und immer noch kein Einsatz für uns. Ich sagte zu Klaus: „Jetzt würde ich doch ganz gerne einmal zum Einsatz fahren. Ich bin ja hier, um Erfahrung im Rettungsdienst zu sammeln. Es dauerte noch zwanzig Minuten, bis der Melder zum ersten Mal ertönte. Das Alarmsignal war sehr penetrant, so dass ich zunächst erschrak. Mein Puls schlug schneller, doch Klaus lachte und rief: „So Tom, auf geht’s zu Deinem ersten Einsatz!“ In Windeseile zogen wir Schuhe und Jacke an und liefen zur Straße. Kaum angekommen fuhr auch schon das NEF mit Blaulicht und Martinshorn vor. Klaus fragte den Fahrer, einen Zivildienstleistenden, wo wir denn hinfahren und um was es denn ginge. Unser Fahrer Markus erklärte uns, dass wir an den Lech fahren, dort gebe es eine vermisste Person, nähere Angaben habe er nicht von der Rettungsleitstelle bekommen. Wir hatten eine Strecke von fünfzehn Kilometern vor uns. Klaus und ich unterhielten uns über das, was uns dort wohl erwarten würde, denn viele Informationen hatten wir nicht. Währenddessen fuhr Markus mit Sonderrechten an vielen Autos vorbei und natürlich über rote Ampeln. Das war schon ein sehr aufregendes Gefühl, wie die Autofahrer für uns Platz machten. Markus kannte die Einsatzstelle, somit musste Klaus ihn nicht an den Einsatzort navigieren. Nach zwölf Minuten erreichten wir den Einsatzort am Lechufer. Wir mussten weit hinten parken, da bereits viele Fahrzeuge von Polizei, Feuerwehr und Wasserwacht vor uns eintrafen. Da es an diesem Tag häufig geregnet hatte, war der Boden sehr nass und matschig. Wir kämpften uns bis zum Ufer durch und fragten einen Polizisten, ob er uns mehr Auskunft geben könne. Er teilte uns mit, dass eine ältere Frau seit dem Vormittag vermisst sei. Es bestehe der Verdacht auf einen Suizid, da seit längerem Depressionen bei der Frau bekannt seien. In diesem Augenblick hörten wir von der Wasserwacht, dass ein lebloser Körper im Wasser gefunden worden sei. Nachdem die Person geborgen worden war, wurde sie ans Ufer gebracht. Klaus untersuchte sie. Das EKG zeigte eine Nulllinie, die Leichenstarre war schon teilweise eingetreten. Für uns Lebensretter gab es nichts mehr zu tun. Wir fragten uns unterdessen, was einen Menschen wohl antreibt, sich das Leben zu nehmen? Doch wir konnten keine eindeutige Antwort darauf finden. Die Gründe für einen Suizid sind so mannigfaltig und für Außenstehende nicht immer verständlich. Ursachen sind unter anderen kaum ertragbaren, nicht mehr therapierbare Schmerzen, unheilbare, tödlich verlaufende Krankheiten wie Krebs, psychische Erkrankungen, Liebeskummer, ausweglose Lebenssituationen, Einsamkeit. Aber für die Menschen, die sich das Leben nehmen, muss es einen enormen Druck geben, nicht mehr weiterleben zu können. Am schlimmsten betroffen sind hingegen die Angehörigen, die vom Freitod ihrer Liebsten nichts ahnen und damit völlig überraschend konfrontiert werden. Viele erheben Selbstvorwürfe, dass sie nichts vom Leid Ihrer Familienmitglieder mitbekommen haben und diesen nicht helfen konnten. Beschäftigt mit diesem Thema, gingen wir durch den Matsch zurück zu unserem Fahrzeug. Wir sahen aus, als hätten wir gerade an einer Schlammschlacht teilgenommen. Wir lachten und sagten: „Hoffentlich kommt auf dem Rückweg kein Einsatz für uns, denn so lässt uns niemand mehr in sein Haus!“ Glücklicherweise kam kein weiterer Einsatz. Auf der Wache wechselten wir sofort unsere Kleider und säuberten unsere Schuhe.
Kaum waren wir damit fertig, ging der Melder erneut. Das Meldebild lautete: „Sturz vom Dach!“ Auf der Anfahrt spekulierten wir wieder, was jetzt auf uns zukommt. Klaus musste jetzt unseren Fahrer Markus anhand einer Straßenkarte zum Einsatzort lotsen. Der Rettungswagen war bereits eingetroffen und erklärte uns die Situation. Ein ca. 65-jähriger Mann stürzte bei Reparaturarbeiten aus ungefähr fünf Metern vom Dach auf die Terrasse. Klaus verschaffte sich sofort einen Überblick über die Verletzungen des Patienten. Der ältere Mann war kaum ansprechbar, er antwortete nicht mehr auf unsere Fragen, sondern stöhnte nur noch mit schmerzverzerrtem Gesicht vor sich hin. Uns fielen sofort die Blutlache am Kopf sowie der Blutaustritt aus einem Ohr auf, was auf eine sehr schwere Schädelverletzung hindeutete. Die weitere Untersuchung ergab Knochenbrüche am linken Arm und Unterschenkel sowie den Verdacht auf eine Rippenserienfraktur, weswegen der Patient auch sehr schwer atmete. Klaus ließ sofort über die Leitstelle nachfragen, ob wir einen Hubschrauber für den Transport des Patienten bekommen könnten. Das war an diesem Spätnachmittag nicht so einfach, da die Wetterbedingungen aufgrund starker Windböen und kräftigen Regens für den Helikopter recht ungünstig waren. Während unsere Anfrage lief, bemühten wir beide uns, intravenöse Zugänge zu legen, um dem Patienten schnell wirksame Schmerzmittel verabreichen zu können. Dies war gar nicht so leicht, da der Kreislauf des Patienten wegen des Blutverlustes und der kalten Außentemperatur stark zentralisiert war. Danach entschloss sich Klaus, den Patienten in ein künstliches Koma zu legen. Wir waren mit den Vorbereitungen für die Intubation beschäftigt, als wir die Nachricht erhielten, dass der Hubschrauber „Christoph 32“ von Ingolstadt zu uns unterwegs sei. Wir waren sichtlich erleichtert. Es vergingen noch zwölf Minuten, bis wir aus der Ferne schon das Motorengeräusch des Hubschraubers vernahmen. Die Intubation war abgeschlossen. Wir waren gerade dabei die Frakturen zu schienen. Als der Hubschrauberarzt bei uns eintraf, war der Patient in einem stabilen Zustand. Klaus gab dem Kollegen die wichtigsten Informationen über das Verletzungsmuster und unsere bisher durchgeführten Maßnahmen. Gemeinsam legten wir den Patienten auf unsere Trage und brachten ihn in unseren Rettungswagen. Dort wurde noch eine Drainage in den Brustkorb gelegt, um die Belüftung der Lunge zu verbessern. Nach zwanzig Minuten wurde der Verletzte zum Hubschrauber gefahren. Der Patient war mittlerweile in Augsburg zur Weiterbehandlung angemeldet. Der Helikopter benötigte für den Transport gerade einmal fünf Minuten, während wir mit unserem Rettungswagen mindestens zwanzig Minuten gebraucht hätten. Außerdem war der Lufttransport für den Verletzten viel schonender. Frierend und durchnässt räumten wir mit dem Rettungsdienstpersonal unser Equipment auf. Etwas erschöpft von diesem anstrengenden Einsatz fuhren wir zurück auf die Wache.
Wieder mussten wir uns komplett umziehen. Danach tranken wir dort zusammen mit der RTW-Besatzung, mittlerweile war die Nachtschicht anwesend, eine heiße Tasse Tee, um uns aufzuwärmen. Nach diesen beiden aufregenden Einsätzen waren wir natürlich hungrig. Der Rettungsassistent Heinrich hatte für diesen Silvesterabend Essen mitgebracht. Gemeinsam genossen wir das Abendessen in der Hoffnung, dass die Leitstelle uns in Ruhe ließ. Wir hatten Glück! Der Abend verlief dann relativ ruhig, für eine Silvesternacht ungewöhnlich. Gegen zehn Uhr in der Nacht wurden wir noch einmal alarmiert. Während wir Drei zum Auto stürmten, rief Klaus mir zu: „Tom öffne die Garagentore, während ich schon mal den Auftrag entgegennehme.“ Unser Fahrer fuhr aus der Garage, während Klaus die Adresse des Patienten von der Leitstelle notierte. Ich schloss wieder die Tore und stieg ein. „Was liegt an?“ fragte ich. „Eine bewusstlose Person!“ antwortete Klaus. Dann suchte mein Studienkollege die Einsatzadresse im Kartenatlas. Vor der Haustüre wurden wir recht entspannt von den Angehörigen empfangen. So schlimm kann es also nicht sein, dachten wir uns. Es handelte sich um einen Kollaps. Alle Vitalwerte und das EKG waren in Ordnung, so dass wir den Patienten zu Hause lassen konnten. Zurück auf der Wache schauten wir noch fern und konnten gemeinsam um Mitternacht auf das Neue Jahr anstoßen, natürlich nur mit Mineralwasser. Um ein Uhr verabschiedeten wir uns und gingen zurück in Klaus‘ Wohnung. Bis zum Dienstende um7:30 hatten wir keinen Einsatz mehr. Meine ersten 24 Stunden im Rettungsdienst waren vorüber. Ich blieb noch einen Tag bei Klaus, dann musste ich wieder zurück ins Saarland.
Bis zum Antritt meiner neuen Stelle in Bayern am 01. Mai belegte ich noch zwei Notfallkurse in München. Dabei wohnte ich jedes Mal bei Klaus. Jedoch hatte ich keine Zeit, noch weitere Einsätze als Praktikant mitzufahren. Dies bedauerte ich sehr, da meine ersten Einsätze bei mir großes Interesse an der Notfallmedizin weckten. Doch ab Mai hatte ich dann endlich die Gelegenheit, regelmäßig bei Klaus auf dem NEF mitzufahren. Darüber war ich sehr froh, denn die Arbeit in der Konservativen Orthopädie erfüllte mich nicht. Zweimal die Woche musste ich neue Patienten nach Hüft-, Knie- oder Wirbelsäulen-Operationen aufnehmen, Therapiepläne erstellen und ewig lange Arztbriefe verfassen. Es fehlte mir die ärztliche Herausforderung. Die bekam ich nur im Notarztdienst. Daher fuhr ich alle zwei Wochenenden als Praktikant bei Klaus mit. Hier lernte ich die Akutmedizin kennen und sofort Entscheidungen zu treffen zum Wohle des Patienten. Diese ärztliche Tätigkeit begeisterte mich immer mehr. Ich konnte es kaum abwarten, bis ich meine Zulassung bekam und endlich allein verantwortlich als Notarzt fahren durfte. Am 15. Juli 1994 war es endlich soweit. Ab sofort war ich als Notarzt zugelassen!
Nun stand mein erstes Dienstwochenende als allein verantwortlicher Arzt vor der Tür. Freitags nachmittags fuhr ich zu Klaus, bei dem ich während meiner Bereitschaftszeit wohnen durfte. Einerseits freute ich mich auf meine neue Aufgabe und die damit verbundene Herausforderung, andererseits verspürte ich eine innere Unruhe und Unsicherheit. Würde ich immer die richtige Entscheidung für den Patienten treffen und keinen Behandlungsfehler begehen? Klaus hatte großes Verständnis für mich, denn ihm ging es in seinen ersten Diensten genauso wie mir. In den Nächten konnte er kaum schlafen aus Angst, er könne den Melder überhören und nicht rechtzeitig einsatzbereit sein. Denn wir haben gerade einmal zwei Minuten Zeit, um an Bord unseres Einsatzfahrzeuges zu sein. Weiterhin riet mir Klaus trotz innerer Aufregung nach außen hin kompetent und sicher aufzutreten. Doch leichter gesagt als getan. Was würde passieren, wenn mir der Patient dekompensiert, d.h. die Situation vor Ort mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln entgleitet? Diese Frage konnte er mir auch nicht beantworten, da er so einen Fall bisher noch nicht hatte. Beim Patienten war es wichtig, sich möglichst schnell ein Bild über die Gesamtsituation zu machen. Dazu gehörten gezielte Fragen zum aktuellen Beschwerdebild, den Patienten genau anschauen und untersuchen. Welche Untersuchungsmöglichkeiten haben wir Ort? Wir messen Puls, Blutdruck, Temperatur und den Blutzucker sowie den Sauerstoffgehalt im Blut und schreiben ein EKG. Weiterhin hören wir Herz und Lunge ab, untersuchen den Bauch, schauen in die Augen und prüfen, ob der Patient voll orientiert ist. Dies ereignet sich alles in den ersten vier bis acht Minuten. Selbstverständlich gibt es genügend Fälle, bei denen schon ein Blick genügt und wir wissen, was zu tun ist. Manchmal müssen wir sofort intervenieren, um Leben zu retten. Theoretisch hatte ich ja alles in meinen Notfallkursen gelernt, doch in der Praxis sieht bekanntermaßen alles anders aus.
Für meine Tätigkeit hatte ich mir mittlerweile eigene Arbeitskleidung gekauft, rote Hosen und eine rote Jacke. Ich hatte mich gerade umgezogen, als es an der Tür klingelte. Mein Fahrer Johannes brachte mir pünktlich um 19:30 den Piepser, jetzt also wurde es ernst. Ich verspürte ein leicht mulmiges Gefühl in der Magengegend. Klaus berichtete mir über seine letzten Einsätze und seine Erfahrungen. So verging der Abend ziemlich schnell. Um 23:00 legte ich mich zum Schlafen auf die Couch, doch ich konnte nicht einschlafen. Die innere Anspannung vor meinem ersten Notarzteinsatz war zu groß. Gegen Morgen schlief ich endlich ein und träumte natürlich von Horrorunfällen. Davon aufgeschreckt erwachte ich schweißgebadet und merkte nach kurzer Zeit, dass es doch nur ein Traum war. Darüber war ich natürlich sehr froh. Somit endete mein erster Nachtdienst mit einer Nullschicht.
Am Vormittag kam dann der erste Einsatz. Ich war schnell draußen und Michael, ein Zivildienstleistender, holte mich ab. Zu dieser Zeit waren viele Zivis im Rettungsdienst tätig. Ihre Dienstzeit betrug zwei Jahre. Die meisten waren sehr motiviert und hatten Freude an Ihrer Arbeit. Alle mussten zuerst eine Ausbildung zum Rettungsdiensthelfer absolvieren. Jeder wurde intensiv über das Blaulichtfahren belehrt, da dies ein großes Risiko darstellt. Gegenüber einem normalen Verkehrsteilnehmer besteht im Rettungsdienst ein achtfach erhöhtes Unfallrisiko. Diese jungen Burschen waren zwischen 19 und 21 Jahre alt. Manch einer hatte gerade erst den Führerschein bestanden und kein eigenes Fahrzeug. Jetzt sollten sie ein Fahrzeug mit 160 PS fahren, welches mit unseren Einsatzgeräten fast überladen war. Hinzu kam, dass keiner Erfahrungen mit kranken und verletzten Menschen hatte. Für die meisten von ihnen bedeutete die Einsatzfahrt eine riesige Stresssituation, besonders das Überholen von Fahrzeugen an unübersichtlichen Stellen und Aufpassen auf den Gegenverkehr. Hatten die Verkehrsteilnehmer wirklich unser Blaulicht und Martinshorn wahrgenommen? Man musste immer mit Fehlern der Autofahrer rechnen, was für uns ein sehr hohes Gefährdungspotential bedeutete. Oftmals registrierten die Verkehrsteilnehmer uns erst sehr spät, dies zeigte sich in plötzlichen abrupten Lenkbewegungen nach rechts. Gottseidank passierte dabei nichts Schlimmeres. Bei einigen wenigen Zivis fühlten wir Notärzte uns sehr unwohl auf Grund ihres unsicheren Fahrstiles. Da waren wir häufig froh, wenn wir wieder heil zu Hause ankamen.
Bei meinem Fahrer Michael hatte ich heute keine Bedenken. Er war bereits seit einem Jahr dabei und fuhr sehr sicher. Auch fachlich war er sehr interessiert, er war gerade dabei, seine Ausbildung zum Rettungssanitäter zu beenden. Michael teilte mir den Einsatzort mit, damit ich ihn auf der Karte suchen konnte. Das war für mich nicht so angenehm. Ich vertrug das Autofahren eh nicht so gut, jetzt musste ich meinen Fahrer noch navigieren, d.h. ich konnte nicht wahrnehmen, wo wir hinfuhren, sondern musste nach unten auf den Plan schauen. Beim teilweise ruckartigen Überholen anderer Fahrzeuge wurde mir schlecht. Ich wurde blass, bekam Schweißausbrüche und ein flaues Gefühl in der Magengegend. Als Kind hatte ich schon große Schwierigkeiten mit meinem Gleichgewichtsorgan. Ich dachte, na super, wird mir jetzt bei jeder Einsatzfahrt schlecht werden?
Am Einsatzort kam mir der Rettungsassistent des RTW, der schon vor uns eintraf, entgegen und fragte: „Hallo Doc, geht es Dir nicht gut?“ Etwas gequält antwortete ich: „Passt schon!“ Er fuhr fort: „Wir haben hier einen Treppensturz vorliegen. Das Sprunggelenk ist gebrochen.“ Ich dachte für mich, Gottseidank ein chirurgischer Fall, da kenne ich mich auf Grund meiner chirurgisch- orthopädischen Ausbildung bestens aus. Mit der Inneren Medizin hatte ich es nicht so. Im Hauseingang saß eine Frau mittleren Alters mit schmerzverzerrtem Gesicht. Sie hatte die letzten Treppenstufen verpasst und war mit dem Sprunggelenk umgeknickt. Nachdem ich mich kurz vorgestellt hatte, untersuchte ich den verletzten Fuß. Der Fuß war im Gelenk ausgekugelt und man konnte eine kleine Wunde sehen. Hier spießte ein Stück des Wadenbeines heraus, also eine offene Fraktur. Das Gefühl im Fuß war nicht beeinträchtigt. Ich legte der Frau eine Infusion und erklärte ihr, dass ich eine kurze Narkose bei ihr durchführen würde. Sie würde schlafen, während ich den Fuß wieder in die richtige Stellung brächte und schiente. Erst im Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus würde sie aufwachen. Damit war sie sofort einverstanden. Kurz nach Gabe der Medikamente schlief die Patientin ein. Ich legte meine linke Hand um die Achillessehne, die rechte Hand umfasste die Ferse. Mit einem kräftigen Zug am Fuß reponierte ich das Sprunggelenk, verband die offene Stelle und legte eine Schiene an. Von alledem bekam die Patientin nichts mit. Im RTW wurde sie dann wach. Sie sah uns doppelt und auch das Sprechen fiel ihr zunächst sehr schwer. Ich erklärte ihr, dass die Narkose daran schuld sei. Sie fühle sich jetzt, als ob sie mehrere Wodka und Whisky auf ex getrunken habe. Aber sie hatte keine Schmerzen mehr, war total euphorisch und erzählte uns verrückte Dinge. Die Frau war von den Medikamenten so begeistert, dass sie rief: „Diese Substanzen sind ja genial, kann ich die mal wieder haben!“ So verging die Zeit im RTW wie im Flug. Ich brachte die Patientin in das Krankenhaus, im dem Klaus arbeitete. Dort wurde sie sofort operiert.
Den nächsten Alarm bekamen wir am Nachmittag. Das Meldebild lautete „Schlaganfall.“
Bei diesem Krankheitsbild gibt es ganz unterschiedliche Ursachen und daraus resultierend erheblich differierende Prognosen für die Patienten. Ca. 80% sind sogenannte unblutige Schlaganfälle und ca. 20% entstehen auf Grund von Hirnblutungen. Daneben gibt es in wenigen Fälle als Ursache Tumore oder entzündliche Gehirnerkrankungen. Die Beschwerden treten insgesamt sehr plötzlich auf, daher der Name „Schlaganfall“. Bei den „unblutigen“ Schlaganfällen kommt es zu einem akuten Stopp der Durchblutung eines Hirngefäßes. Ursache hierfür ist in der Regel ein Gerinnsel, in der Fachsprache Thrombus genannt. Es kommt zu Ausfällen in den nicht mehr mit Blut versorgten Hirnarealen. Je nachdem, welche Hirngefäße bzw. Hirnareale betroffen sind, sind die Symptome unterschiedlich. Typische Symptome sind unter anderem Sprachstörungen sowie Lähmungen von Armen und Beinen, ein hängender Mundwinkel. Die Patienten sind meistens ansprechbar. Heutzutage kann man diesen Patienten helfen, indem man die Gerinnsel im Gefäßsystem auflöst. Entscheidend hierfür aber ist der Zeitfaktor nach Beginn des Ereignisses, die Behandlung im Krankenhaus sollte innerhalb der ersten drei Stunden erfolgen. Die Prognose beim „blutigen“ Apoplex ist deutlich schlechter. Die Patienten sind meist bewusstlos durch den hohen Druck im Gehirn, den die Hirnblutung verursacht.
In unserem Fall sahen wir eine ca. 75-jährige Patientin auf der Couch liegend. Der Mundwinkel war verstrichen, die Sprache war sehr verwaschen und sie konnte den rechten Arm nicht mehr bewegen. Die Tochter erzählte uns, dass sie ihre Mutter nach dem Einkaufen so vorfand. Eine Stunde zuvor sei noch alles in Ordnung gewesen. Es sah wirklich nach einem klassischen Apoplex aus. Ich schickte sofort einen Mitarbeiter nach draußen, um die Liege für den Transport zu richten. Währenddessen untersuchten wir Blutdruck, Puls, Sauerstoffsättigung und schrieben ein EKG. Ich legte sofort einen Zugang, mein Rettungsassistent untersuchte noch der Vollständigkeit halber den Blutzucker. Als der Mitarbeiter von draußen wieder hereinkam und sagte, dass alles für den Transport vorbereitet sei, lachten wir alle. Ich sagte ihm, dass es wohl bei einer Versorgung zu Hause bleiben würde. Er sah uns ungläubig an, eine Patientin mit Schlaganfall daheim lassen. Ob wir noch bei Trost seien, fragte er uns. Ich klärte ihn umgehend auf. Die Patientin war Diabetikerin und hatte einen Blutzucker von 35mg%. Dies erklärte ihre schlaganfallähnlichen Symptome. Das Gehirn braucht für seine Tätigkeit viel Zucker. Fehlt dieser, besteht die Gefahr, dass es zu Ausfällen im Gehirn kommt. Es entsteht für die Außenstehenden der Eindruck, dass ein Schlaganfall vorliegt. Bei dieser Frau waren wir auf das „Chamäleon“ Unterzucker gestoßen. So ein Unterzucker kann auch Krampfanfälle wie bei einem Epileptiker auslösen. Ich injizierte der Frau 3 Ampullen Glukose und siehe da, die wundersame Heilung der Patientin setzte binnen weniger Minuten ein. Bei einem Unterzucker sieht man als behandelnder Notarzt sofort den Erfolg. Nach zehn Minuten waren alle Beschwerden weg und wir konnten die ältere Dame als geheilt zu Hause lassen. Der Grund für die Hypoglykämie war einfach eine zu geringe Nahrungsaufnahme nach dem Spritzen von Insulin.
Am späten Abend fuhren wir dann zu einem Patienten mit Herzschmerzen. Die Fahrer hatten erneut gewechselt, jetzt durfte Johannes endlich den ersten Einsatz mit mir fahren. Diesmal war der RTW unserer Wache mit dabei. Die Wohnung lag nur wenige Minuten von unserem Standort entfernt. Ein Mann um die 60 Jahre öffnete die Tür. Er erklärte uns, dass er seit einer Stunde einen Druck hinter dem Brustbein verspüre mit Ausstrahlung in den linken Arm. Weiterhin könne er nicht richtig durchatmen und es sei ihm nicht wohl. Solche Beschwerden habe er noch nie gehabt. Sofort schrieben wir ein EKG unter dem Verdacht eines Herzinfarktes. Glücklicherweise war das EKG unauffällig. Ich legte einen Zugang und wir verabreichten bei guten Blutdruckverhältnissen einen Hub Nitro-Spray, worauf es dem Patienten besser ging. Der Verdacht auf eine Angina pectoris verstärkte sich. Hierbei kommt es durch Verengung der Herzgefäße zu einer Minderversorgung des Herzens mit Sauerstoff. Dies führt zu den typischen Schmerzen hinter dem Brustbein. Das Nitro-Spray erweitert die Gefäße. Durch die bessere Blut- und Sauerstoffversorgung am Herz vergehen die Beschwerden relativ schnell. Nach der Gabe von blutverdünnenden Medikamenten zum Schutz des Herzens brachten wir den Mann zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus. Die genaue Abgrenzung, ob es sich nur um eine kurzfristige Minderversorgung des Herzens mit Sauerstoff handelt oder doch ein Herzinfarkt vorliegt, kann nur in der Klinik erfolgen. Dazu benötigt man die Bestimmung spezieller Blutwerte, den sogenannten Herzenzymen. Das war es auch schon für den Rest der Nacht.
Sonntags vormittags ging noch einmal mein Piepser. Diesmal handelte es sich um eine Atemnot. Bei diesem Patienten war Asthma bekannt, welches sich über Nacht verschlechterte. Er konnte kaum sprechen, so schwer musste er schnaufen. Bei einem Asthmaanfall verkrampft sich die Muskulatur in den Bronchien. Die Luft strömt ungehindert in die Lunge ein. Das Problematische aber ist, dass der Patient die Luft nicht mehr herausbekommt. Daher sieht man oft, dass sich die Patienten mit beiden Armen abstützen und die Lippen zusammenpressen. Diese unterstützenden Maßnahmen sollen helfen, den hohen Widerstand in den Bronchien zu überwinden und die Luft nach draußen zu befördern. Schon vor unserer Behandlung signalisierte uns Patient, dass er auf keinen Fall mit ins Krankenhaus gehe. Die Sauerstoffsättigung im Blut war sehr schlecht und auf der Lunge hörte man massive Nebengeräusche. Trotz Medikamentengabe verbesserte sich der Zustand des Patienten kaum. Er sah jetzt wirklich ein, dass ein stationärer Aufenthalt unumgänglich sei. Danach war Ruhe bis Dienstende. Um 19:30 wurde der Melder wieder abgeholt. Mein erstes Wochenende als Notarzt war beendet. Glücklich darüber, dass die ersten Einsätze so gut verliefen, fuhr ich wieder nach Hause.
Im Gegensatz zu meiner Notarzttätigkeit war meine Arbeit als Assistenzarzt sehr langweilig. Ich fühlte mich als Arzt absolut unterfordert. Umso mehr freute ich mich bereits auf mein nächstes Dienstwochenende. Ich war sehr froh, dass ich auch weiterhin während meiner Bereitschaft bei Klaus wohnen durfte und nicht auf die Rettungswache musste. Dies war nicht selbstverständlich, denn Klaus hatte seit kurzem eine neue Beziehung, eine Röntgenassistentin. Sabine war eine sehr sympathische Frau, mit der ich mich auch auf Anhieb sehr gut verstand. Sie arbeitete im selben Krankenhaus wie Klaus. Da sie sich fast täglich sahen, hatte sie nichts dagegen, dass ich einmal im Monat bei Klaus übernachtete. Im Gegenteil, wir verbrachten viele vergnügliche Nachmittage und Abende während meines Dienstes zusammen.
Mein zweites Dienstwochenende war im August, es war ein sehr heißes Wochenende. Bei meinem ersten Einsatz begegnete ich einem jungen Patienten, der sehr heftig auf einen Wespenstich reagierte. Als ich ihn anschaute, dachte ich zuerst bei mir, Frankensteins Monster säße vor mir. Sein Gesicht war um die Hälfte angeschwollen, er sah fast nichts mehr aus seinen Augen. Die Zunge war so riesig, dass sie nicht mehr in seinen Mund passte. Er klagte über heftigsten Juckreiz und Atemnot. Der Körper war heiß, gerötet und mit einem Ausschlag übersät. Da hatte die Wespe ganze Arbeit geleistet. Ich legte sofort eine Infusion, verabreichte Cortison und Antihistaminika, um die allergische Reaktion zu stoppen. Der junge Mann war in einem schlechten Zustand. Sein Blutdruck war im Keller, der Puls raste und auf seiner Lunge hörte man deutliche Geräusche wie bei einem starken Asthmaanfall. Das ganze Team arbeitete sehr zügig, denn wir wussten, dass sein Zustand kritisch war. Das größte Risiko bestand in eventuell auftretenden Herzrhythmusstörungen bis hin zum Herzstillstand. Mit Blaulicht fuhren wir nach Augsburg ins Krankenhaus. Über die Rettungsleitstelle wurde der junge Mann bereits dort angemeldet. Das bedeutet, dass für unseren Patienten sofort bei unserer Ankunft eine freie Behandlungskabine mit einem Team aus Ärzten und Pflegepersonal bereitsteht. Während des Transportes war ich sehr angespannt. Zu allem Überfluss war der Rettungswagen total überwärmt, da wir keine Klimaanlage im Fahrzeug hatten. An dieser Ausstattung zum Wohl der Patienten und der Rettungsdienstmitarbeiter wurde zu dieser Zeit leider noch gespart. Der Patient wurde unterwegs komplett überwacht mittels EKG und Sauerstoffmessung im Blut, Puls und Blutdruck regelmäßig kontrolliert. Auf dem Transport verbesserte sich der Zustand des Mannes auf Grund unserer Medikation etwas. Dennoch war ich glücklich, als ich ihn im verbesserten Zustand im Krankenhaus übergeben konnte. Am Klinikum trockneten wir unseren Schweiß ab, der nicht allein durch die hohen Außentemperaturen verursacht war. Bevor wir uns auf die Rückfahrt zu unserem Standort begaben, tranken wir noch einen halben Liter Wasser auf ex aus.
Nachdem wir bereits auf dem Heimweg waren, fragte uns die Leitstelle nach unserem Standort. „Auf der B2“ meldete ich über den Funk. „Perfekt“ schallte es aus dem Funkhörer, „dann geht es für Euch weiter Richtung Norden. Verkehrsunfall mit zwei PKW, eine Person vermutlich eingeklemmt!“ Na Bravo, dachte ich, das Wochenende geht schon gut los. Auf der Anfahrt gingen mir tausend Gedanken durch den Kopf, was jetzt wohl auf mich zukommt. Nach zehn Minuten erreichten wir die Einsatzstelle. Von weitem sah man schon ein Lichtermeer von Blaulicht. Mehrere Feuerwehrautos und ein RTW waren bereits eingetroffen. Ich sprang aus dem NEF und rannte zur Unfallstelle. Zwei Autos waren frontal ineinander gefahren. Ein Rettungsassistent kam mir relativ ruhig entgegen und signalisierte mir, dass es auf den ersten Blick schlimmer aussehe als es in Wirklichkeit sei. Erleichtert atmete ich tief durch. Ich verschaffte mir schnell einen Überblick über das Geschehen. Beide Fahrzeuge waren vorne komplett zerstört. Neben dem ersten Auto stand ein Mann, der sich an den Hals fasste. Er war einer der beiden Fahrer. Der Verletzte war voll orientiert, klagte über Kopf- und Nackenschmerzen sowie über Schmerzen in der Lendenwirbelsäule. Ich ordnete sofort eine Stabilisierung der Halswirbelsäule mittels Stifneck an und ließ den Patienten auf eine Vakuummatratze zum Schutz der Wirbelsäule legen. Sonst hatte der Verletze, der allein in seinem Fahrzeug saß, keine weiteren Beschwerden angegeben. Danach wendete ich mich dem anderen Fahrzeug zu. Darin saß am Steuer eine junge Frau, die ebenfalls allein unterwegs war. Sie schrie so laut, dass es einem durch Mark und Bein fuhr. Immer wieder rief sie: „Holt mich hier raus, holt mich endlich hier raus!“ Die Patientin befand sich in einem totalen emotionalen Schockzustand und ließ sich gar nicht beruhigen. Von der Feuerwehr erfuhr ich, dass sie nicht eingeklemmt sei, sondern nur eingesperrt. Sie konnte alles frei bewegen, nur die Tür war so verklemmt, dass man sie nicht öffnen konnte. Die Jungs von der Feuerwehr waren beschäftigt, die Tür mit einem Spreizer zu öffnen, was nach einigen Minuten gelang. Die junge Frau reagierte gar nicht auf meine Fragen, wo es ihr wehtue, sie schrie einfach weiter. Die ersten Untersuchungsbefunde im Auto ergaben ein Schleudertrauma und den Verdacht auf eine Fraktur des Brustbeines. Nach Legen eines intravenösen Zuganges, was durch ihre psychische Erregung erschwert war, bekam sie von mir ein Schmerzmittel und ein starkes Medikament zur Beruhigung. Ohne dieses hätten wir sie nicht aus ihrem Fahrzeug bekommen. Nachdem beide Patienten vor Ort versorgt waren, fuhren wir mit ihnen zum Krankenhaus. Nach diesen beiden Einsätzen, auch durch das warme Wetter bedingt, war ich doch etwas erschöpft. Ich freute mich auf eine Verschnaufpause, welche ich auch bekam.
Erst zehn Stunden später brauchte man wieder meine ärztliche Hilfe. Alarmiert wurde ich zur Verbrennung bei einem Kleinkind. Bei Kindernotfällen waren alle Rettungsdienstmitarbeiter angespannter als sonst. Daher fuhren wir schneller als gewöhnlich. Vor Ort stürmte ich ins Haus und fragte: „Was ist passiert?“ Die Eltern antworteten: „Unsere zweijährige Tochter hat sich an der heißen Herdplatte die Hand verbrannt.“ Julia saß weinend auf dem Schoß der Mutter. Ich sah mir die Verletzung an und konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen. „Das sieht ja gar nicht schlimm aus!“ sagte ich zu Julia. Sie hatte viel Glück gehabt, sie hatte nur drei kleine Brandblasen an den Fingerkuppen. Während wir noch die Finger kühlten, hörten wir aufgeregte Stimmen im Eingangsbereich. Eine ältere Frau lief ins Zimmer hinein, stolperte fast über den Hund, der am Boden lag, und schrie: „Was ist mit meiner Enkelin, was ist mit Julia?“ Die Oma schnaufte schwer und hatte einen hochroten Kopf. Als sie sah, dass ihrer Enkelin nicht viel passiert war, beruhigte sie sich ein wenig. Wir kontrollierten ihren Blutdruck, der durch ihre Sorge um ihre Enkelin auf 220/100 mmHg angestiegen war. Somit hatte ich gleich eine zweite Patientin, die ich behandeln durfte. Nach zwanzig Minuten hatten wir den Blutdruck im Normbereich, so dass wir ruhigen Gewissens wieder fahren konnten.
An diesem Wochenende hatte ich nur noch einen weiteren Einsatz. Schuld war die Hitze. Wir wurden an einen Badesee gerufen. Der junge Mann hatte starke Kopf- und Nackenschmerzen, war leicht benommen und hatte bereits mehrfach erbrochen. Auf die Frage, wie lange er bereits am See läge, hörten wir, dass er schon viele Stunden direkt in der prallen Sonne gelegen sei. Ich hatte sofort den dringenden Verdacht auf einen Sonnenstich. Damit war nicht zu spaßen, ein Sonnenstich kann sehr gefährlich sein. Durch die lange Sonneneinwirkung wurden die Hirnhäute sehr stark gereizt. Hätte sich der junge Mann vermehrt im Schatten aufgehalten, wäre ihm nichts passiert. Ich verabreichte ihm 1000 ml Infusionslösung. Wir meldeten den Patienten umgehend auf der Intensivstation an. Dort würde er ein bis zwei Tage bleiben müssen, bis alle Symptome wieder verschwunden wären.
Mit diesem Einsatz endete mein zweites Dienstwochenende. Ich war selbstverständlich immer noch nervös, aber mit jedem erfolgreich behandelten Patienten wuchs meine Sicherheit. Als Notarzt hat man eine sehr große Verantwortung und ich war mir dessen sehr bewusst. Wie intensiv sich mein Unterbewusstsein mit meiner Tätigkeit befasste, wurde mir bei einem Besuch bei meinen Eltern klar. Ich übernachtete in meinem alten Kinderzimmer. In der Nacht träumte ich, dass ich Notarztdienst hätte. Plötzlich ging mein Melder los. Dies war für mich so real, dass ich im Halbschlaf aufsprang, um mein Bett lief und dann gegen die Wand prallte. Ich erschrak und wusste im ersten Moment gar nicht, was überhaupt los war und wo ich bin. Ich brauchte einige Minuten, bis ich richtig wach war und realisierte, dass ich keinen Dienst hatte. Es war nur ein Traum!
Regelmäßig teilte mich Klaus einmal im Monat für ein Wochenende ein. Ich freute mich immer darauf, da ich als Notarzt im Gegensatz zu meiner Assistentenstelle sehr gefordert wurde. Mitte September nach den großen Ferien war ich wieder im Notarztdienst. Schon kurz nach Dienstbeginn ging es los. „Schwerer Verkehrsunfall mit Motorrad“, so kam die Einsatzmeldung von der Leitstelle. Nach zehn Minuten erreichten wir den Ort des Geschehens. Von unserem Fahrzeug aus sahen wir schon die Einzelteile eines Motorrads verstreut im Feld liegen, weit davon entfernt einen leblosen Körper im Acker. „Das sieht nicht gut aus“ sagte ich zu meinem Fahrer. Mit einem beklemmenden Gefühl ging ich in Richtung der leblosen Person, vorbei an einer großen Zahl Einsatzkräfte der freiwilligen Feuerwehr. Sie lachten und scherzten, was ich zunächst angesichts der Situation nicht für angebracht hielt. Als ich beim Opfer angekommen war, sah ich das Ausmaß seiner Verletzungen. Er hatte keine Chance und war wohl sofort tot. Es lief mir eiskalt den Rücken herunter, als ich in seine noch geöffneten Augen schaute. Dieser starre Blick sollte mich für längere Zeit beschäftigen. An seinem Körper war nichts mehr heil. Arme und Beine waren mehrfach frakturiert und total deformiert, das Genick war gebrochen. Der Brustkorb war ganz eingedrückt. Ich schätzte den Toten vielleicht auf Mitte Zwanzig.