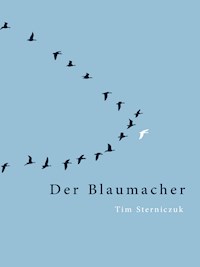
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: neobooks
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Geschichte über all die Dinge, die geschehen, all die Gedanken die gedacht und all die Gefühle, die gefühlt werden können, wenn man sich für einen Tag lang die Freiheit nimmt, frei zu sein, anstatt den Kopf in den Sand zu stecken und nur zu funktionieren. Von frankophilen Gitarristen, unvollendeten Romanen und einer schrulligen Malerin mit einer eigentümlichen Vorliebe für die Farbe Blau, über heruntergekommene Boxstudios, philosophische Debatten über die großen und vor allem kleinen Fragen des Lebens, bis hin zu Ausflügen in Peter Pans Nimmerland und die eigene Vergangenheit, entsteht zwischen zwei jungen Männern im Laufe eines Tages und zahlloser Kaltgetränke eine Verbindung, die ihresgleichen sucht, und die es am Ende vielleicht sogar schafft, beide wieder auf den Weg zu bringen, der für sie vorherbestimmt ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 499
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Tim Sterniczuk • Der Blaumacher
Tim Sterniczuk
Der Blaumacher
oder warum mutig zu sein so verdammt viel Mut erfordert
Roman
Für Jana,
mein Herz
Astronautenarmut
(einleitende Gedanken)
Wer sagt, dass er heute das macht, wovon er schon in der Kindheit geträumt hat, der lügt. Zu neunundneunzig Prozent. Dafür gibt es einfach zu wenig Astronauten. Und zu viel Adam Smith. Zu viele Lokomotiven und zu wenig Zugvögel.
Wenn Artur Schopenhauer sagt, dass der Mensch tun könne, was er wolle, nicht aber wollen könne, was er wolle, so mag er zwar recht haben. Der Mensch vermag indes sehr wohl, und stellt dies täglich tausendfach unter Beweis, nicht zu wollen, was er will.
Mit anderen Worten: es gilt für das, was eines Tages als schüchterner Gedanke eines Menschen geboren wird, zahllose Hürden zu überspringen, bevor er letzten Endes in der materiellen Welt Form annehmen kann. Diejenige Hürde, an der schließlich die meisten dieser ambitionierten Sprösslinge scheitern, ist ihr Schöpfer selbst.
Seid ihr und ich. Sind die, die sagen, dass Adam Smith nun einmal wichtiger sei als Neil Armstrong. Die wissen, dass das echte Leben hier unten, auf der Erde stattfindet. Und die damit zwar recht haben mögen. Aber die eben auch in Kauf nehmen, dass die wenigen Astronauten da draußen so verflucht einsam bleiben.
1. Kapitel
Weiß am Zug
Der Tag, an dem ich Mikey kennenlernte, begann damit, dass ich mich fragte, ob mein alter Schulleiter inzwischen nicht längst den Löffel abgegeben hatte. Todesursache: Schluckauf. Und alles bloß meinetwegen. Ausgeknipst aus der Ferne, wo meine Gedanken beständig um ihn kreisten, ohne einen Schimmer davon, woher der verdammte Schluckauf kommen mochte.
Ich starrte durch das kalte Zugfenster, an dem meine Stirn lehnte und beobachtete die Schlieren ziehende Außenwelt dabei, wie sie an mir vorbeirauschte, beinahe so als sei sie ebenso auf der Flucht vor mir, wie ich vor ihr. Der verdammte Oberpauker. Es war nicht einmal so, dass ich den Kerl besonders gemocht hätte, niemals. Und trotzdem wanderten meine Gedanken auch an diesem Freitagmorgen wieder nicht dorthin, wohin sie sollten, sondern unkontrollierbar in die Vergangenheit, wohin sie wollten und wo der Alte vergnügt auf sie wartete. In meinem Kopf bahnte sich die immer gleiche, seit Monaten bereits wie ein rachsüchtiger Poltergeist ungebeten durch meinen Verstand spukende Szene an, in der jener beharrliche Studienrat unbestritten die Hauptrolle spielte. Mittlerweile hatte ich eingesehen, dass es hoffnungslos war, mich ihr zu widersetzen. Oft genug hatte ich es versucht und dabei jedes Mal den Kürzeren gezogen. Ein weiteres Mal schloss ich erschöpft die Augen und gab mich ihr hin.
Die Szene, die sich mir in altbekannter Übung unverändert darbot, erlebte ich auch dieses Mal wieder nicht etwa als außenstehender Beobachter, sondern durch den beschränkten Blickwinkel meiner eigenen Augen, verändert nur durch den Schliff der runden Brillengläser auf meiner kindlichen Nase. Es waren die Augen über der Nase eines zwölf Jahre alten Jungen, der auf einem der unbequemen Holzstühle in der Aula des Gymnasiums Platz genommen hatte, eingekleidet in einen übergroßen und altbackenen Blazer, der ihn seit seinem Erwerb anlässlich des siebzigsten Geburtstags der Großmutter, zwei Jahre zuvor, verlässlich zu offiziellen Anlässen wie diesem hier entstellte. Meine schwitzigen Hände rieb ich unermüdlich an den Längsrippen meiner hellen Cordhose, die ganz und gar nicht zu dem dunklen Blazer passte und das modische Debakel beeindruckend vervollständigte. Ich sollte in wenigen Minuten den ersten Preis meiner Altersklasse beim alljährlichen, schulweiten Literaturwettbewerb entgegennehmen. Ein Preis, das möchte ich versichern, der bedeutend wichtiger klingt, als er war. Und das sage ich in dem Bewusstsein, dass er bereits unwichtig klingt. Nichtsdestotrotz handelte es sich um eine Aufgabe, der ich bestenfalls, jedenfalls so gut es ging, mit trockenen Händen begegnen wollte.
Die Aula mit der beeindruckenden Kuppeldecke und dem bemüht barock wirkenden Balkon war nur schwach beleuchtet, was sicherlich zur festlichen Stimmung beitragen sollte, dem Ereignis aber nach meinem Empfinden einen ziemlich sinistren Anstrich verpasste. Die Stuhlreihen waren bestenfalls zur Hälfte mit einem müden Publikum aus ambitionierten Schülern und deren pflichtbewussten, sagen wir stolzen, Eltern gefüllt. Die Anwesenden lauschten genügsam dem Unterhaltungsprogramm, das aus kurzen Darbietungen der bemühten Jazz-AG bestand, die einen bunten Strauß aus bekannten Popstücken arrangiert und in bester, freigeistiger Jazzmanier bis zu Unkenntlichkeit entstellt hatte. Ich hatte nervös von der Bühne in die zerstreute Menge hinabgeschaut, meine trotz angestrengten Reibens immer noch nassen Hände in den Taschen meiner Cordhose versunken und die Augen zusammengekniffen gegen das Licht der Scheinwerfer, mit denen die Mitglieder der Beleuchtungs-AG mir stümperhaft direkt ins Gesicht zielten, als mein Schulleiter, damals zweifellos noch quicklebendig, endlich seinen großen Auftritt hatte. Er überreichte mir den schlecht gebundenen Blumenstrauß und drückte seine Hoffnungen aus, in Zukunft noch viel von mir hören zu werden. Die „Bühnen dieses Landes“ würden mich „mit offenen Armen“ empfangen und vielleicht stünde ich ja „in einer Linie mit Theatergrößen wie Brecht oder Schiller“, das würde ihn freuen. Da er nicht zur Jury gehörte und anscheinend nur zwischen Tür und Angel gebrieft worden war, verwechselte er meine Einreichung mit derjenigen der Zweitplatzierten, einer Klassenkameradin von mir, die eine Bühnenstückvorlage geschrieben hatte und nach dieser kurzen Laudatio unseres Schulleiters nun außerhalb des gesundheitlich bedenklich grellen Scheinwerferkegels, zu ihrem Glück, wie ich fand, leise in der ersten Reihe zu weinen begann. Ein Fauxpas, der auf gewisse Weise gut zu der ganzen Veranstaltung passte. Ich verzichtete darauf, meinen Schulleiter zu korrigieren, es hätte ja doch nichts genützt. Gewonnen hatte ich, das konnte ich der Urkunde entnehmen. Darauf standen unter einer großen, goldenen Eins deutlich mein Name sowie der Name meiner Geschichte, warum also publikumswirksam auf seinem Versehen herumreiten. Ich dachte außerdem, dass durch mein Schweigen auch meine Klassenkameradin irgendwie auf der Bühne vertreten war, wo sie anscheinend ohnehin viel dringender hinwollte als ich. Letzten Endes hatte ja sie ein Bühnenstück eingereicht, nicht ich. Das fand ich charmant. Vielleicht würde mein ritterliches Verhalten ja sogar eine romantische Ader bei ihr treffen. Ich wäre darüber nicht traurig gewesen, fand ich sie doch sehr hübsch mit ihrer schimmernden Zahnspange, die ihrem ansonsten sehr blassen Gesicht ein gewisses Glitzern verlieh. Ihr ausdauerndes Schluchzen, das gerade laut genug war, dass niemand es überhören und gerade leise genug war, dass niemand ihr Vorsatz vorwerfen konnte, enttäuschte jedoch letztlich meine Hoffnung darauf, dass dieser Gedanke sie möglicherweise etwas aufmuntern würde.
Meinen missverstandenen Triumph hatte ich, wie gesagt, keinem Bühnenstück, sondern einer Kurzgeschichte zu verdanken. Einer Adaption von S.E. Hintons ‚The Outsiders‘, in der allerdings die reichen und brutalen Socs, kurz für Socials, und nicht, wie im Ausgangswerk, ihre in ärmlichen Verhältnissen lebenden Gegenspieler, die ungezähmten, lederjackentragenden Greasers um den jungen Ponyboy Curtis die Rolle der tragischen Helden einnahmen. Es handelte sich bei den Outsiders zu jener Zeit um meine unangefochtene Lieblingsgeschichte und ich damals war fest entschlossen, sie zum Mittelpunkt meines eigenen kleinen Beitrags zu machen. Ich war inspiriert, sozusagen. Meinen Twist empfand ich dabei als interessanten und in gewisser Weise fairen erzählerischen Ansatz. Den Bösewicht zum Helden zu machen, die Dualität von schwarz und weiß aufzubrechen und damit beim Publikum eine Art Paradigmenwechsel hervorzurufen. Ich befürchte heute, dass dieses Experiment, trotz Erstplatzierung, schlussendlich wohl nicht geglückt sein dürfte. Hauptsächlich, weil damals, wie mir auf meine Nachfragen hin mehrfach eingeräumt wurde, eigentlich kaum jemand die Urfassung kannte. Vielleicht aber auch, weil hinter all dem letztlich doch weniger steckte, als ich mir heute einrede. Ehrlich gesagt, mir selbst kommt es inzwischen merkwürdig vor, dass ein gerade Zwölfjähriger bereits auf diese Weise um die Ecke gedacht haben sollte. Aber vielleicht ja doch, wer kann das heute schon noch sagen.
Vor allem hatte ich mir damals vorgenommen, nichts von der Coolness einzubüßen, die die Outsiders im Original ausmachte und die am Ende des Tages, ich war nun einmal ein Teenager, dasjenige war, was mich an ihnen so faszinierte. Es muss um dieselbe Zeit gewesen sein, als ich entschied, dass ein wenig Coolness mir nicht schlecht zu Gesicht stünde und ich mich von nun an selbst wie ein Greaser kleiden würde. Ich gelte mir die Haare, die ich jetzt wachsen ließ, nass zurück und überredete meine Eltern zum Kauf meiner ersten (und einzigen) Lederjacke. Ich drückte meine Zuneigung auf jene unbeholfene Art und Weise aus, auf die man so etwas als Teenager nun einmal tat. Genauso unbeholfen, wie ich mich anstellte, wenn ich die immer noch glühenden Stummel der Mentholzigaretten auszudrücken versucht, die wir damals heimlich hinter der Schule rauchten, oder meine erste Flasche Bier aus dem Supermarkt schmuggelte. Was blieb einem auch übrig? Man wusste es einfach nicht besser und für größere Gesten reichte das Taschengeld nicht.
Wenn er so gut ausgesehen hätte, wie er sich anfühlte, hätte ich den Look vielleicht beibehalten. Die Realität kam allerdings an meine Vorstellung nie heran und so wechselte ich, wohl oder übel, schon nach kurzer Zeit zurück auf Turnschuhe und Cordhosen. Ein Look, der nach einigen weiteren Monaten auf dieselbe Weise der Kurzlebigkeit jugendlicher Modeeskapaden zum Opfer fallen würde wie die Lederjacke, was aber sicherlich besser so war. Ich legte die Lederjacke damals ab, obwohl ich mich, tief in mir, dafür schämte. Den Outsiders gegenüber, auch wenn das verrückt klingt.
Letzten Endes war es wohl unvermeidlich, dass ich irgendwann selbst zum sprichwörtlichen Stift griff und anfing, Geschichten zu schreiben. Solange ich denken und, viel wichtiger, es entziffern konnte, war das geschriebene Wort, waren Bücher mein Zufluchtsort gewesen. In jeder erdenklichen Form. Von Comicbüchern bis zu Gedichtbänden hatte mich das Lesen nie darin enttäuscht, mir eine jederzeit greifbare Möglichkeit zu bieten, mich aus dem engen Gefüge der Familie oder des erweiterten Gesellschaftskreises, in dem ich mich bewegte, herauszunehmen und eine Zeit lang für mich allein zu sein. Allein zu sein, bis ich schließlich doch wieder, unter dem energischen Klopfen elterlicher Fäuste an meine verschlossene Kinderzimmertür, gemahnt wurde, dass das echte Leben ‚hier draußen‘ spiele und ich gefälligst ‚in die Realität zurückkehren‘ möge. Damals dachte ich, dass nur Idioten das, was sie die echte Welt nannten, derjenigen Welt vorziehen könnten, die sich in meinen Büchern verbarg. Ich hatte sie selbst lang genug beobachtet und sie kam nicht ansatzweise an das heran, was ich in der Einsamkeit und Stille meiner vier Wände erleben konnte. Dort, wo ich auf Drachen ritt, bis zum Mittelpunkt der Erde vorstieß und als Pirat den Schergen der königlichen Marine unbeugsam die Stirn bot. Wo ich schließlich erkannte, dass neben der Welt des stillen Beobachtens und Bewunderns noch eine weitere Welt auf mich wartete. Eine Welt der Kreativität und des Erschaffens, laut und ungehalten, wenn ich es wollte, frei von all den Grenzen, die in der ‚echten Welt‘ so verzweifelt versuchten, für Ordnung zu sorgen. In der ich am Ende die Grundlage schaffen würde für jene überlebensgroße Erinnerung, die mich für den Rest meines Lebens nie wieder loslassen sollte. Auch nicht an diesem Freitagmorgen.
An den zahllosen Abenden im Büro, in all den schlaflosen Nächten der vergangenen Wochen, fast zwei Jahrzehnte später, war sie es gewesen, die mich, wankelmütig wie der Wind auf hoher See, immer wieder gleichzeitig auf Kurs hielt und vom Kurs abbrachte, hatte sich diese Erinnerung wieder und wieder in meine Gedanken eingeschlichen und dort ihr Unwesen getrieben. War unerwünschter Eindringling und engster Vertrauter gewesen. Zugleich treuer Freund und ärgster Feind, ein verbrecherischer Entführer meines Verstandes, dem ich letztlich doch willenlos verfallen war.
Meine Stirn weiter gegen das kalte Zugfenster gelehnt, versuchte ich noch einmal jenes Gefühl einzufangen, das mich damals auf dieser Bühne erfüllt hatte. Mit dem schlecht gebundenen Blumenstrauß in meinen nassen Händen, geblendet von der liebevollen Inkompetenz meiner Mitschüler, fragwürdig in Szene gesetzt von der liebevollen Inkompetenz meines Lehrkörpers. Jenes Gefühl, in seiner ursprünglichen und reinen Form, noch unverdünnt vom Fluss der Zeit, dessen Strom mich schließlich immer weiter, genau bis hierhin, von ihm fortgetragen hatte. Der Stolz und die Aufregung, die Zuversicht und das feste Vertrauen, dass dies nur die erste von vielen Geschichten sein sollte, die ich noch verfassen würde, dass ich die in mich gesetzten Hoffnungen nicht enttäuschen würde, selbst wenn einige Hoffnungsträger davon ausgingen, dass es mein Wunsch war, Theaterstücke zu schreiben, aber das spielte keine Rolle.
Es war eine lang, sehr lang vergessene Furchtlosigkeit gewesen, die mich damals erfüllt und dabei nicht einen Quadratzentimeter Raum für Angst oder Zweifel gelassen hatte. Ich ahnte, dass es mir seinerzeit höchstwahrscheinlich nur an der nötigen Lebenserfahrung gefehlt hatte, die es nun einmal brauchte, um an seinen eigenen Fähigkeiten zu zweifeln. Dass ich der Herdplatte nur so tapfer entgegengetreten war, weil ich mir die Hand noch nie verbrannt hatte. Ich möglicherweise nur naiv gewesen war, wie Kinder nun einmal naiv sind. Aber all diese Begründungen begrüßte ich, wenn ich ihnen gegenüber die andere, weitaus simplere Wahrheit in Betracht zog. Eine Wahrheit, die ich letzten Endes viel eher fürchtete. Dass nämlich der zwölfjährige Junge, der im Lichtkegel seines jungen Lebens seine schwitzigen Hände an einer lächerlichen Cordhose abzuwischen versuchte, mehr Schneid gehabt hatte als der dreißigjährige Mann, der seinen rastlosen Kopf an die kalte Zugscheibe lehnte, auch wenn dessen Hände dabei vergleichsweise trocken waren.
An diesem Freitagmorgen wollte es mir, anders als sonst, nicht gelingen. Es gelang mir nicht, das Gefühl von damals einzufangen. Es schien diesmal nicht bloß eine Ewigkeit in der Vergangenheit zurückzuliegen, sondern sich außerdem an einem weit entfernten Ort am anderen Ende der Welt zu befinden. Vielleicht war am Ende auch die Zeit eigentlich nichts anderes als eine Maßeinheit zur Bestimmung einer Entfernung, dachte ich in diesem Moment, genau wie Meilen oder Kilometer. Und vielleicht rechneten Astronomen deswegen auch in Lichtjahren. Denn für einen Menschen, der etwas wiederhaben, oder wieder-erleben wollte, gab es einen Unterschied zwischen „längst vergangen“ und „zu weit entfernt“ nämlich nicht. Der Abstand vergrößerte sich bloß in unterschiedliche Richtungen. An diesem Morgen kam mir der fragliche Abstand so groß vor, dass ich glaubte, ihn nie wieder überwinden zu können. Und ich dachte zum ersten Mal, dass es vielleicht sogar besser so wäre.
Prompt, nachdem ich meine Augen wieder geöffnet hatte, musste ich ausgedehnt gähnen. Wie seit einigen Monaten üblich läutete mein Gähnen jedoch keinen erholsamen Schlaf ein, sondern diente nur als konstante Erinnerung an meine vollständige Ermattung. Auch die Zeit, in der ich gut geschlafen hatte, entfernte sich langsam wie eine blasse Erinnerung von mir und wurde gegen den Horizont immer kleiner. Ich versuchte, die Müdigkeit mithilfe einiger Dehnübungen abzuschütteln und scheiterte damit, wie üblich. Ich blickte stattdessen, in der Hoffnung, meine Gedanken auf diese Weise ein wenig zerstreuen zu können, in die Gesichter der Menschen, die mit mir in dem etwa zur Hälfte besetzten Großraumabteil saßen. Einfache Menschen, ‚normale‘ Menschen, wenn man so wollte, ‚gute‘ Menschen, vielleicht, ohne Zweifel oder Sorge darüber, ob und wo sie schließlich ankommen würden, im festen Vertrauen auf den Gang der Dinge, hin und wieder einen Kaffee bestellend, bequem positioniert in ihre Arbeit versunken, bereits pflichtbewusst und fleißig, auch wenn sich draußen erst vor Kurzem die Sonne zaghaft aus ihrem Nachtlager erhoben hatte. Während ich vor der Geräuschkulisse des polternden Gleisbettes das Treiben meiner Mitreisenden beobachtete, kam mir unweigerlich der Gedanke, dass ich ihr gesamtes Leben beobachtete, sorgfältig komprimiert in jener still vor sich hin ratternden Szenerie. Ich beobachtete sie, doch ich tat es nicht als Teil von ihnen. Mich beherrschte ein Gefühl der Ausgeschlossenheit, während ich sie hier in der Gegenwart betrachtete, meine Gedanken aber gleichzeitig in der Vergangenheit umherwanderten. Auch wenn ich in ihrer Mitte saß und nichts lieber getan hätte, als zu ihnen zu gehören, arbeitend und Kaffee trinkend. Vielleicht nicht unbeschwert, aber ohne sich zu beschweren. Doch das tat ich nicht. Es war, als stünde ich hinter einer großen Scheibe, aus- und von ihnen weggesperrt, neben mir ein großes Schild mit der Aufschrift Bitte nicht füttern und Vorsicht! Spritzt Urin durchs Gitter. Ich genoss dieses Gefühl keineswegs, empfand in seinem Angesicht keine Überlegenheit, oder wenigstens trotzigen Stolz. Das Gefühl ängstigte und verwirrte mich immer noch genauso, wie es das gleichbleibend tat, seit ich es vor einigen Monaten zum ersten Mal gespürt hatte. Woher es rührte, konnte ich wohl erahnen, auch wenn mir der Gedanke nicht gefiel: Aber wer hatte schon Zeit, am echten Leben teilzunehmen, sich mit echten Menschen zu befassen, wenn er tagein, tagaus imaginäre Blumensträuße in Empfang nehmen musste?
In der Hoffnung, meine Gedankengänge zu unterbrechen, wandte ich meinen Blick von den übrigen Menschen ab und konzentrierte ihn stattdessen auf das auf Hochglanz polierte Paar Schuhe, das zu dem jungen Mann gehörte, der mir gegenübersaß. In einem beeindruckenden intellektuellen Zirkusakt ließ dieser seit einigen Stunden ununterbrochen seine Finger wie erbarmungslose Peitschen über die widerstandslose Tastatur seines Laptops knallen und ergänzte auf diese Weise das mir immer schon angenehme „Tak- Tak, Tak- Tak“ des Zuges durch ein scheußliches „Tak-Tak-Tak, Tak-Tak, Tak-Tak-Tak“ seiner Tasten, während er gleichzeitig am Telefon lauthals und gleichweg ununterbrochen über bevorstehende Immobilienprojekte philosophierte. Mir war bewusst, dass ihm kein objektives Fehlverhalten vorzuwerfen war, außer, dass er tat, was alle taten, nur noch bemühter. Trotzdem konnte ich nicht sagen, wie lange ich mir dieses Schauspiel noch mit angesehen hätte, bevor man einen Ermittler vom Format eines Hercule Poirot hätte bemühen müssen, um die näheren Umstände der so plötzlich verstummten Tastatur von Sitzplatz 28 zu untersuchen. Die maßlose Hingabe in seinen Bemühungen ließ mich vermuten, dass der junge Mann für seine Arbeit sehr wohl über Leichen gegangen wäre und mir war es in gewissen Momenten durchaus in den Sinn gekommen, hier ein wenig nachzuhelfen. Die elektronische Ansage riss mich rechtzeitig aus meinen immer konkreter werdenden Gedanken über eine derartige okzidentale Interpretation von Mord im Orient Express und kündigte unsere baldige Ankunft im nächsten Bahnhof an.
Auch wenn der Zug als Reisemittel weit eher für Menschen geeignet ist, die wissen, wo sie letztlich ankommen wollen, Menschen, die auf ihrem Weg dorthin gerade so viel Flexibilität duldeten, wie sie fest verschweißte Stahlschienen es einem nun einmal bieten konnten, und nicht für Menschen wie mich, denen die Ankunft gegenüber der Abreise, gelinde gesagt, Nachrang hatte, war mir auch diese Zugreise wieder ein Vergnügen gewesen. Natürlich war eine Zugfahrt ein Genuss, der hin und wieder gewissen Einschränkungen unterlag, die zum Beispiel von der arhythmischen Arbeitswut einzelner Mitreisender herrühren konnten. Aber wirklich stören konnte mich so etwas nie. Vielleicht war es noch immer die so unbeirrbare Kraft der Lokomotive, die mich schon seit meiner Kindheit faszinierte. Sich prustend und schnaufend durch das Land ziehend, das Ziel vor Augen, nie nach links oder rechts blickend. Vielleicht neidete ich ihr die Einfachheit und Bestimmtheit ihrer Aufgabe, die keinen Raum für Interpretationen ließ und der sie sich, wenn auch am Ende zwangsweise, voll und ganz widmen durfte. Wenn die Lokomotive nach einem langen und anstrengenden Arbeitstag in der Abstellanlage ankam, dann wälzte sie sich ganz bestimmt nicht rastlos von links nach rechts, sondern schlief den Schlaf der Gerechten. Wahrscheinlich ebenso, wie der Tastaturtriebtäter von gegenüber. Selig sind, die da auf Gleisen fahren, war es nicht so? Und dabei hin und wieder einen Kaffee bestellen.
Ich lauschte der kratzigen Ansage, einmal in passablem Deutsch und ein weiteres Mal in haarsträubendem Englisch und entschloss kurzerhand, dass es jetzt an der Zeit war, auszusteigen. ‚Köln‘, das klang gut, das kannte ich noch nicht. Weit genug weg war es auch. Ich packte die wenigen Habseligkeiten, die ich bei mir trug in meinen Rucksack und bereitete mich auf den Ausstieg vor. Ich blickte ein letztes Mal auf den Einband der zerfledderten Edition von ‚The Outsiders‘, die ich stets bei mir trug, seit ich sie vor Kurzem auf einem alten Flohmarkt wiederentdeckt hatte. Auch jetzt vermutete ich wieder, dass ich das Buch möglicherweise besser nicht hätte kaufen, vielleicht besser die Finger davon und die Vergangenheit hätte ruhen lassen sollen. So wie man es besser sein ließ, einer Ex-Freundin per SMS frohe Weihnachten zu wünschen oder nur um der alten Zeiten willen an einer Zigarette zu ziehen. Während ich auf das Konterfei des ölig-dunkelhaarigen Lederjackenträgers auf dem Buchdeckel blickte, fühlte ich mich dennoch für einen kurzen Moment nicht ganz so einsam, wie sonst in letzter Zeit. Ich schüttelte schmunzelnd den Kopf und verstaute das Buch in meiner Manteltasche. Noch vor gar nicht langer Zeit wäre ich jede Wette eingegangen, dass ich längst über solche Angewohnheiten hinweg war. Mich von meinen Büchern trösten zu lassen. Aber was ergab schon Sinn in den letzten Wochen.
Ursprünglich hatte ich auf der Reise meinen Roman fortsetzen wollen, den ich vor einigen Wochen begonnen hatte, nur kurze Zeit nachdem ich eines Nachts das erste Mal in mein zwölfjähriges Selbst zurückgekehrt war und den mit dem schlecht gebundenen Blumenstrauß einhergehenden Preis entgegengenommen hatte, von dem ich bereits berichtete. Aber darauf werde ich zu einem späteren Zeitpunkt noch näher eingehen. Mein hübsches, ledernes Notizbuch war stattdessen unberührt in dem alten Rucksack verstaut geblieben, der auf dem leeren Sitzplatz neben mir lag. Es war wohl hehres Wunschdenken gewesen, dass ausgerechnet eine nächtliche Zugfahrt zur Überwindung meiner seit Wochen anhaltenden Schreibblockade hätte führen können.
Ich wartete mit einigen anderen Passagieren schweigend auf die durch ein wiederholtes Piepen angekündigte Öffnung der automatischen Zugtüren, eine Hand an der metallenen Haltestange, die andere fest um den Träger meines Rucksacks geschlossen. Ich wäre damals wohl kaum so ruhig gewesen, wenn ich zu diesem Zeitpunkt schon gewusst hätte, was ich heute weiß. Nämlich, dass es Ereignisse im Leben eines Menschen gibt, die es von Grund auf und nachhaltig verändern können. Ereignisse, die einer Geschichte erst den entscheidenden Schliff geben, wenn man so will. Und dass mit dem lauten Kreischen der alten Magnetschienenbremsen ein solches Ereignis für mich beginnen sollte.
2.Kapitel
Knopfgelübde
Mein Zug fuhr am frühen Vormittag in den Kölner Hauptbahnhof ein. Aus dem Fenster heraus konnte ich erkennen, dass auf den Bahnsteigen längst reger Publikumsverkehr herrschte. Das morgendliche Sonnenlicht fiel bereits durch die vielen kleinen Quadrate und Rechtecke, die von der beeindruckenden Stahlkonstruktion herrührten, von der die Gleise überdacht wurden und auf den ordentlichen – beinahe reinlichen – Bahnsteigen tummelten sich bereits zahlreiche in ihre Zeitungen und Mobiltelefone versunkene Pendler, eifrige Bahnmitarbeiter und Touristen mit großen Trekkingrucksäcken. Das bunte Treiben setzte sich in der Haupthalle fort, in die ich vom Bahnsteig hinab über eine der vielen, breiten Treppen gelangt war. Die unzähligen Geschäfte vermittelten den Eindruck, als handelte es sich viel eher um eine große, jederzeit geöffnete Einkaufsmall, als um einen Bahnhof. Wieder einmal fiel mir auf, dass es hierzulande weder eine Uhrzeit, noch einen Ort zu geben schien, der für die Menschen zu unpassend wäre, um nicht wenigstens einen kurzen Abstecher in das erstbeste Bekleidungsgeschäft zu machen. Ich verwarf meine Gedanken und ärgerte mich über den Ärger, den ich hierüber empfand. Leben und leben lassen, war es nicht so? Immerhin stand ich möglicherweise selbst kurz davor, diese Gnade in Anspruch nehmen zu müssen. Ich schob meine Reaktion auf die Müdigkeit, atmete tief durch und machte mich auf in Richtung Ausgang. Die Menschen, die meinen Weg durch die Haupthalle kreuzten, schienen sich und ihr zügiges Vorankommen ernst zu nehmen, was mir damals, aber das hatte nichts mit der Müdigkeit zu tun, ebenfalls bitter aufstieß. Ein Anzugträger, der sich beim Bäcker angestellt hatte, schaute mich kurz an und dann gelangweilt in die entgegengesetzte Richtung. Ich entschied mich, seinem Vorbild zu folgen und die Blicke der übrigen Bahnhofsbesucher daraufhin ebenfalls zu meiden. Das Gefühl, nicht dazuzugehören, verfolgte mich ohnehin auch hier. In diesem Musterbeispiel moderner, westlicher Errungenschaften, wenn man so wollte, überkam es mich sogar noch heftiger als es das bereits im Zug getan hatte.
Meinen alten Rucksack hatte ich mir über die rechte Schulter geworfen, wie ich es meistens tat und über meiner ansonsten durchaus durchschnittlichen Kleidung trug ich einen Mantel aus dunkelblauem Kaschmir. Den hatte ich mir seinerzeit von meinem ersten Gehalt gekauft und im Grunde gefiel er mir gut, obwohl ich wusste, dass ich ambivalente Gefühle zu ihm haben musste. Er hatte zu viel von dem Geld gekostet, das ich für eine Arbeit bezahlt bekam, die ich, nicht zuletzt, just in diesem Moment schwänzte. Vielleicht war genau das der Grund dafür gewesen, dass ich mich entschieden hatte, ihn heute zu tragen. Vielleicht waren meine zwei anderen Jacken nur schmutzig gewesen, das kam vor.
„Na und, wo soll’s denn hingehen, junger Mann?“, fragte mich ein kleiner Herr mit strenger Hornbrille, der es selbstverständlich ebenfalls eilig hatte und dem ich den Ausgang aus der Bahnhofstür versperrte, in der ich stehen geblieben war. Ich trat aus der Tür und gab den Weg frei.
Mich begrüßte ein angenehmer Frühlingstag. Es war schon gar nicht mehr richtig kühl, aber der Himmel trug noch jenes winterliche Blau, das in meinen Augen immer etwas kälter und klarer war als sein sommerliches Pendant. Gegen die Sonne konnte ich erkennen, dass sich zu meiner Linken die Umrisse der ikonischen, gotischen Kathedrale abzeichneten, die jährlich zigtausende Besucher in die Stadt lockte. Ich kniff die Augen zusammen und bewunderte den Kölner Dom in seiner ganzen Pracht. Das wiederum war gar keine so üble Art, seine Gäste willkommen zu heißen, wie ich fand. Meine Laune steigerte sich im Angesicht dieser menschlichen Errungenschaft, die so viel mehr nach meinem Geschmack war als das Einkaufsparadies in meinem Rücken, augenblicklich. Es war vielleicht doch noch nicht alle Hoffnung verloren, dachte ich mit einem kurzen Blick über die Schulter, wo der Strom von geschäftigen Menschen, die aus dem Bahnhof eilten, nicht abreißen wollte.
Ich hatte Kopfschmerzen von der Anreise, auf der ich fast durchgehend entweder gelesen oder aus dem Zugfenster heraus in die Nacht und die anbrechende Morgendämmerung gestarrt hatte. Etwas Schlaf, der mir, wie bereits erwähnt, seit einigen Monaten ohnehin nur selten vergönnt gewesen war, hätte mir sicher gutgetan. Ich streckte mich ausführlich, atmete tief ein und wiederholte für mich selbst die Frage des kleinen Mannes mit der strengen Hornbrille. Na und, wo soll’s denn hingehen, junger Mann? Sicher hatte er keine Vorstellung davon gehabt, wie schwer seine Frage zu beantworten war, hatte sie höchstwahrscheinlich nur rhetorisch gestellt. Aus dem Weg zu gehen, das war schon die richtige Reaktion gewesen. Genau so weit hatte ich meine Route bis zu diesem Zeitpunkt geplant.
Ich erspähte von dem Bahnhofsvorplatz aus einen Kiosk und fasste einen ersten Entschluss: Es war jetzt dringend an der Zeit für ein kaltes Bier. Als eine Art ersten Schritt, auf den unweigerlich der zweite folgen musste und so weiter. Schlückchenweise, sozusagen. Mir gefiel der Gedanke, meinem kleinen Roadtrip damit eine Art Kerouacschen Anstrich zu verpassen. Ich hatte damals außerdem keine Lust mehr, die Dinge nüchtern zu betrachten, wie man hierzulande so gerne sagte. Nüchterne Gedanken hatten mich auch bislang nicht weiterbringen können. Der leidige Versuch, alles immer nüchtern zu betrachten, hatte mich eigentlich überhaupt erst in diese Misere katapultiert, wenn man so wollte. Da wollte ich von jetzt an lieber leicht einen sitzen haben, während das Unheil seinen Lauf nahm. Nicht zuletzt, auch das traf sich, hatte ich unheimlichen Durst.
Auf meinem Weg an der beeindruckenden Domtreppe vorbei erblickte ich auf halber Strecke einen jungen Gitarristen, der etwas verwildert und schmuddelig auf den Stufen saß und sein Instrument spielte. Ich konnte nicht verstehen, was er sang, aber mir gefiel der Klang seines Spiels. Für einen kurzen Moment begegneten sich unsere Blicke. Seine Gesichtszüge waren sehr fein, beinahe wollte ich sagen elegant. Ein gutaussehender Kerl. Er hatte volles, dunkelblondes Haar, was er allerdings eine erhebliche Zeit nicht mehr gewaschen haben durfte. An seinen Händen trug er Ringe in verschiedenen Größen und Farben. Seine Kleidung war zwar abgetragen und ungewaschen, aber von guter Qualität. Eine robuste helle Jeans, ein beiger Pullover und etwas durchgetretene, dunkelbraune Budapester, die ihm allerdings einige Nummern zu groß gewesen sein durften, was sie beinahe etwas ulkig aussehen ließ. Er grinste und nickte mir aufmunternd zu. Seine Augen waren hellblau und eigenartig wässrig. So wie es bei Fenstern der Fall ist, von denen das Regenwasser hinabläuft, so wurde auf diese Weise auch für sie ganz natürlich verhindert, dass man die Konturen ihres Innenlebens genauer hätte erkennen können. Ich erwiderte sein Nicken und fragte mich, ob er wohl schon die ganze Nacht auf dieser Stufe gesessen hatte, oder ob es sich bei ihm um einen gut getarnten Frühaufsteher handelte. Ich setzte meinen Weg über den Vorplatz fort und beschloss, ohne großes Aufhebens davon zu machen, ein Bier für ihn zu kaufen und vor seinen Gitarrenkoffer zu stellen.
In dem langen Spiegel hinter der Kasse des kleinen Kiosks beobachtete ich meine Reflexion, die dort zwischen Bier, Tabak und Autozeitschriften so fehl am Platz wirkte, wie ein Ministrant auf einem Bikertreffen. Es war an der Zeit für Bier gewesen, jetzt war es an der Zeit für einen neuen Look. Nachdem ich den Kiosk verlassen, das Bier in meinem Rucksack verstaut, meine Haare durchgewuschelt und das nicht genügt hatte, beschloss ich, den zweitobersten Knopf meines Hemds zu öffnen. In Ermangelung von Wechselkleidung, geschweige denn solcher, die imstande gewesen wäre, den gewünschten Effekt zu erzielen, würde sich meine akute modische Neuerfindung fürs Erste darauf beschränken, diesen bedeutungsschweren Knopf, an dessen Status Quo sich für so viele Menschen der Unterschied zwischen Schwiegersohn und Schwerenöter ausmachen ließ, von nun an offen zu tragen. Und zwar dauerhaft, sozusagen für immer, das war jetzt beschlossene Sache. Sollten sie ihn mir erst wieder schließen, wenn sie mich irgendwann hübsch machten für meine eigene Trauerfeier. Ich hatte keineswegs vor, in naher Zukunft den Club der Lebenden zu verlassen, aber mir gefiel seinerzeit die Vehemenz des Gedankens. Ganz im Stile von ‚bis dass der Tod sie scheidet‘. Falls ich mich gut anstellte, würde ich das große Finale sogar so lange hinauszögern, dass, wenn es dann schlussendlich soweit war, meine neuer Look sich derart etabliert hätte, dass einer der Organisatoren inmitten der Funeralien einschreiten und an meinem kalten Hals die zwei obersten Hemdknöpfe öffnen würde, während er leise, aber bestimmt, zu dem Priester murrte: „So hat er es immer lieber gemocht.“ Das wäre eine starke Szene.
Ich kehrte, wie ich es beschlossen hatte, zu den Bahnhofsstufen zurück und stellte eine Flasche kaltes Bier vor die Füße des Gitarrenspielers. „Hier, für dich. Spielst gut und ist ’n schöner Tag“, sagte ich und machte eine einladende Geste in Richtung Bierflasche. Der Gitarrist unterbrach sein Spiel und schaute zu mir hoch, während er seine wässrigen Augen zusammenkniff um gegen die Sonne, die sich inzwischen hemmungslos am Firmament rekelte, etwas sehen zu können.
„Ist nett von dir. Aber ich trink’ nicht“, antwortete er zu meiner Überraschung. Wie jemand, der nicht trank, sah er nun wirklich nicht aus.
„Oh, alles klar. Tut mir leid, das sollte nicht übergriffig sein, oder so. Ich dachte nur, du hättest Bock auf ’nen Schluck Bier. Aber ich nehm’ an, dass das um die Uhrzeit vielleicht nicht so normal ist, wie ich mir das gerade wünsche.“
„Pas de problème. Keine Sorge, Großer“, erwiderte der Gitarrist, wobei er die Worte nur hauchte, so als habe er lange Zeit daran gefeilt, möglichst wie Kurt Cobain oder Tom Waits zu klingen, angereichert mit ein paar Brocken holprigem Französisch. „Jeder nach seiner Façon. Ist nur so, dass ich gerade einfach nicht trinke. Hatte ’ne Art Eingebung. Ich glaub’ nämlich, dass ich mir damit irgendwie den siebten Sinn beneble.“
„Heißt das nicht sechster Sinn?“, fragte ich.
„Der hat damit nichts zu tun“, erwiderte er und tippte sich mit dem Zeigefinger gegen die Schläfe. „Geht um den siebten. Der ist total wichtig für die Kunst. Jedenfalls für meine, verstehst du?“
„Klar, Mann.“
Ich verstand nicht und bückte mich hinab, um die Bierflasche wieder an mich zu nehmen. Nicht, dass mich seine Ablehnung in besonderem Maße getroffen hätte, aber innerlich notierte ich, dass mein Tag mit einer Niederlage begonnen hatte. Macht auch nichts, nicht heute. Ein Bier mehr für mich.
„Haha, der trinkt nicht! Dass ich nicht lache! So ein Un-fug!“, ertönte es plötzlich hinter uns. Als ich mich umdrehte, da begann er zum zweiten Mal: der Tag, an dem ich Mikey kennenlernte.
Ich erblickte aus der Bahnhofshalle auf uns zukommend einen Burschen, der sich mit beiden Händen theatralisch an den Bauch fasste, während er lauthals lachte. Das war das Erste, was ich von Mikey sah, diese alberne Geste. Ich war mir bis zu diesem Zeitpunkt sicher gewesen, dass absolut niemand, außer vielleicht Donald Duck, sich beim Lachen an den Bauch fasste. Nun, so konnte man sich irren. Das sollte mir mit ihm noch öfter passieren.
Der Kerl, der da lachend und sich den Bauch haltend aus dem Bahnhof trat, hatte ziemlich genau meine Größe und ungefähr mein Alter, allerhöchstens ein bisschen älter, trug eine dunkelblaue Jeans mit zahlreichen Löchern, verlumpte braune Halbstiefel, ein T-Shirt, bei dem die Ärmel stümperhaft abgetrennt worden waren und um die Hüfte hatte er eine helle Jeansjacke gebunden, die genau wie seine Hose an etlichen Stellen durchlöchert war. Seine Oberarme zierten einige Tattoos, zwei oder drei, die ich von der Entfernung aus nicht richtig erkennen konnte. Die dunkelblonden Haare trug er halblang und wuschelig, eingebunden in ein altes, ursprünglich wohl weißes, Tennisstirnband. Seine aufgeweckten, grün funkelnden Augen, hatten uns ins Visier genommen und er hüpfte die untersten Stufen der Domtreppe mit erstaunlicher Leichtigkeit zu uns hinauf, bevor er sich schwungvoll im Schneidersitz neben dem Gitarristen niederließ. Die Leichtigkeit seiner Bewegungen neidete ich ihm schon in diesem ersten Moment. In einer Art nostalgischen Verklärung meinte ich mich damals zurückzuerinnern, dass ich fünf Jahre zuvor wohl mit der gleichen Leichtigkeit durch das Leben gesprungen war.
„Ich hör’ wohl nicht recht, Hannes! Seit wann willst du nicht mehr trinken? Seit gestern Abend?“, lachte er und schlug dem Gitarristen auf die Schulter, dass der zusammenzuckte.
„Lass mich, Mikey, ich hab’ mir das schon gut überlegt“, ranzte Hannes ihn an.
„Sind das hier etwa Eierschalen?“ Mikey deutete auf den Boden neben Hannes’ Gitarrenkoffer, wo die Überreste eines zerbrochenen Eies lagen. „Hat man dich etwa mit einem Ei beworfen? Ich denke, wir sollten unverzüglich damit beginnen, uns präzise Gedanken über dein Arbeitsleben zu machen.“
Hannes blickte beschämt auf seine Gitarre und gab vor, einige Akkorde greifen zu üben.
„Hey, mach’ dir nichts draus“, besänftigte ihn Mikey. „Das passiert den Besten, das kannst du mir glauben. Spielt ü-ber-haupt keine Rolle.“ Er klopfte Hannes auf die Schulter. „Also, seit wann willst du nicht mehr trinken?“
„Mir ist klargeworden, dass das meiner Kunst schadet, verstehst du?“, antwortete Hannes, dessen Wangen immer noch ein schüchterner Rotton zierte. „Wenn mein Geist klar ist, dann sind auch meine Stücke irgendwie klarer. Kannste das verstehen, Mikey?“
„Also das ist mit Abstand der größte Un-fug, den ich seit langem gehört habe, ei, ei, ei.“
Er griff nach dem Bier, das ich Hannes mitgebracht hatte, öffnete es kurz mit den Zähnen und gönnte sich einen großen Schluck. Den Trick hatte ich schon immer gemocht. Nur hatte mir mein Hausarzt, ein Freund der Familie, einige Jahre zuvor geraten, in Zukunft besser davon abzusehen und ich hatte auf ihn gehört. Damals war mir das nicht eigenartig vorgekommen. Ich war wohl einfach davon ausgegangen, dass er auch für meinen Zahnarzt sprach.
„Es gibt keine großen, nüchternen Künstler, hörst du? Die Kunst und der Konsum gehören zusammen wie Mann und Frau. Die kann man nicht trennen“, erklärte Mikey, während er sich mit einer großen Geste den Mund abwischte.
„Es ist nämlich so“, fuhr er fort, „dass du im nüchternen Zustand überhaupt nicht in der Lage bist, die Gefühle zu empfinden, die deine Kunst erst zum Leben erwecken. Also es werden überhaupt nicht die Synapsen bedient, die du brauchst, um die entsprechenden Emotionen verarbeiten zu können. Das ist Wissenschaft und damit wissenschaftlich belegt, glaub mir das. Ja, und deswegen muss jeder Künstler, der was auf sich hält, auch saufen. Außerdem hält man das Künstlerleben nüchtern ohnehin nicht aus, hab’ ich nicht recht?“, fragte er und wandte sich dabei zum ersten Mal mir zu.
„Ähm“, stammelte ich, überrumpelt von der plötzlichen Einbeziehung meiner Person.
„Siehst du, dein heiliger Martin ist da meiner Meinung. Das Thema ist also beendet, du trinkst wieder. Aber nicht das Bier hier, da hab’ ich jetzt schon zu sehr dran rumgenuckelt, das bring’ ich besser zu Ende“, beschloss er seinen Vortrag und streckte sich ausgiebig.
„Bist du denn Künstler?“, fragte ich ihn.
„Was, ich? Sicherlich, mein junger Freund. Ich bin sogar ein äußerst gefragter Künstler. Überall im Land wollen Sie mich haben. Und ich bin auch nicht auf eine Kunstform beschränkt, wie unser Hannes hier. Klimpert den ganzen Tag auf seiner Gitarre ’rum. Nein, nein, nicht mit mir. Ich beherrsche so gut wie alle Kunstformen, glaub mir das.“
„Das ist doch Quatsch“, erwiderte ich gelangweilt.
„Quatsch?“, entfuhr es Mikey. „Quatsch, sagt er! Na, der feine Herr muss es wissen, mit seinem schicken Mantel. Wäre ich nicht ein Mann von Welt, mit unvergleichlichem Geschmack und einem gottgegebenen Auge für das Schöne, würde ich ihn dir mit Bier besudeln, so wie du hier vor versammelter Mannschaft meinen Ruf besudelst!“
Außer uns dreien war keine Menschenseele auf der Domtreppe zu sehen. „Wirst du schon noch mitkriegen. Pass einfach auf und lerne. Du trinkst ja, wie ich sehe?“, fragte er.
„Ich versteck’ da drin keinen Kaffee.“
„Wirkt ’n bisschen früh, für ’nen Typen wie dich“, stellte Mikey fest und musterte mich von oben bis unten. „Wir haben doch nicht etwa Ärger?“
Mir gefiel nicht, wie er mich ansah und über mich sprach. Es war selbstgefällig und ich fragte mich, wann er zuletzt in den Spiegel geschaut und sich selbst auf diese Weise in Augenschein genommen hatte, mit seinem bescheuerten Stirnband, das aussah, als hätte Björn Borg damit auf Sandplatz Kopfstand geübt.
Mikey blickte mir weiter tief in die Augen, so als suchte er in ihnen Anzeichen für den Ärger, den er offensichtlich in mir vermutete.
„Spielt ja auch keine Rolle“, sagte er plötzlich und winkte ab. „Dann verrat’ uns halt erstmal deinen Namen!“
Er schaute mich an. Ich trank einen Schluck Bier und schwieg.
„Wie du heißt, mein junger Freund!“, wiederholte er seine Frage, während er seine Handgelenke in einer weiteren großen Geste kreisen ließ.
Mir stand der Sinn damals nicht danach, Mikey meinen echten Namen zu verraten. Auch wenn ich heute weiß, dass meine Instinkte mich getäuscht haben, traute ich ihm damals nicht. Eine gewisse Faszination, die, das gebe ich allerdings gern zu, in unserem eigentümlichen Triumvirat insbesondere von ihm ausging und die charmante Absurdität unserer Begegnung hinderten mich gleichwohl daran, mich noch in diesem Augenblick von den beiden zu verabschieden und meines Weges zu gehen. Heute bilde ich mir ein, dass damals vielleicht ein Hauch von Schicksal in der Luft lag, den ich glaubte, selbst durch jene dicke Haut spüren zu können, die sich Zynismus nennt und die hierzulande früher oder später alle Menschen entwickelten, nachdem sie irgendwann ihre ersten, so gefährlich dünnen Natternhemden abgeworfen hatten. Es war bloß ein schüchternes Gefühl, aber es reichte aus, um meiner antrainierten, skeptischen Zurückhaltung für einen Moment lang Schweigen zu gebieten. Immerhin war ich mehr oder weniger genauso zufällig in Köln gelandet, wie ich Mikey und Hannes am Bahnhof getroffen hatte. Geplant hatte ich das auch nicht, sondern es eben einfach geschehen lassen. Und wenn man einen der seltenen Momente erlebt, in dem man innerlich bereit ist, das Schicksal seinen Lauf nehmen zu lassen, dachte ich, musste man nun mal auch dem Zufall seinen Raum geben. Denn der Zufall ist ja bekanntlich der Erfüllungsgehilfe des Schicksals.
Ich war also bereit, weiterhin einige Zeit mit Mikey und Hannes zu verbringen und zu beobachten, wohin mich diese eigenartige Bekanntschaft führen würde. Aber trotz dieses, weiterhin zurückhaltenden, Enthusiasmus für die unbekannten Windungen des Schicksals, hatte ich damals nicht genug Vertrauen für den Austausch echter Identitäten. Ich war in der Stimmung, von dem Privileg Gebrauch zu machen, diesen Teil meines Privatlebens für mich zu behalten. Wie gesagt, ich sollte später merken, dass mein Instinkt mich getäuscht hatte. Aber vielleicht, das glaube ich heute, hatte in der Tat das Schicksal selbst diese Nebelkerze gezündet.
„Ponyboy. Nenn’ mich Ponyboy.“
Mikeys Miene veränderte sich augenblicklich. Anstelle der Skepsis, mit der er mich vorher beargwöhnt hatte, konnte ich jetzt ehrliche Überraschung in seinen Augen erkennen.
„Ponyboy? Wieso sagst du, dass du Ponyboy heißt?“, fragte er.
„Weil das nun mal mein Name ist. Jedenfalls heute und jedenfalls für dich.“
„Den hast du dir also selbst gegeben?“, hakte Mikey nach.
„Was interessiert dich das?“
Langsam begann Mikeys inquisitorische Art, mir auf die Nerven zu gehen. Er schaute mich mit großen Augen an und musterte mich erneut von der Ferse bis zum Scheitel.
„Ponyboy also.“
Nach einigen Momenten, in denen Mikey mich abwechselnd entweder akribisch begutachtet oder sich abgewendet und an der Stirn gekratzt hatte, begannen seine Augen plötzlich zu strahlen.
„Gefällt mir!“, rief er zu meiner Überraschung mit einem breiten Grinsen. „Gefällt mir sogar gut! Halleluja! Dann mal los, Ponyboy, wir machen uns unverzüglich auf den Weg. Oder sollte ich sagen: hü, hott?“ Mikey drehte sich im Kreis und ahmte einen sanften Galopp nach.
„Du kannst nur entweder ‚Hü‘ oder ‚Hott‘ sagen“, verbesserte ich ihn. „Das eine heißt links, das andere heißt rechts.“
„Das mag in deiner Welt vielleicht stimmen, Ponyboy“, gab Mikey zurück. „In meiner Welt nehmen wir es mit solchen Regeln nicht so ernst.“
Wir stießen an und Mikey zwinkerte mir zu. Ich hatte es nie leiden können, wenn Menschen mir zuzwinkerten. Es wirkte bei den meisten immer so stümperhaft aufgesetzt, oder als hätten sie etwas Sperriges ins Auge gekriegt. Aber bei Mikey war das anders, es wirkte ganz natürlich und, das musste ich ihm zugestehen, fast ein bisschen cool.
„Dann lasst uns also aufbrechen und sehen, was der Tag so bringt. Porthos, Athos und Aramis, wenn ihr versteht, was ich meine!“
Mikey sprang auf und blickte mit einem großen Grinsen erwartungsvoll auf Hannes herab. Zu Mikeys Enttäuschung machte der keine Anstalten, sich ebenfalls zu erheben.
„Das sind die DreiMus-ke-tie-re, falls das zu kryptisch für euch Banausen war. Und dafür braucht es drei Männer. Also los jetzt!“
„Lass mal.“ Hannes winkte ab. „Ich muss erst mal noch ’n bisschen Kohle machen hier, außerdem schreib’ ich gerade an ’nem neuen Song. Geht um Politik. Und Religion.“
„Das klingt nicht so, als würde es Gott gefallen”, stellte Mikey fest. „Der duldet keine Politik. Aber gut, dann schreib du mal deinen politischen Papisten-Pop. Bleibt’s wohl an uns beiden hängen, Ponyboy!“
„Sicher keine Lust?“, fragte ich Hannes.
„Ne, lasst mal. Merci, trotzdem. Aber du bist ja in guten Händen“, sagte der Gitarrist mit einem Lächeln und zusammengekniffenen Augen.
„Komm schon, Ponyboy, wir haben nicht den ganzen Tag Zeit! Und ich nehm’ dich natürlich nur unter der Bedingung mit, dass du nicht aufhörst, Freibiere zu verteilen!“
Mikey stand auf der untersten Stufe der Treppe und winkte mich zu sich. Ich verabschiedete mich bei Hannes, der mir summend zu nickte. Ich entschied mich damals dagegen, mir die Frage zu stellen, warum ich mich aufmachte, mit diesem fremden Typen eine fremde Stadt zu erobern und sprang stattdessen die Treppenstufen hinab, was mir erstaunlich leicht fiel.
3.Kapitel
Landesmeister im Debattieren
„Fragst du dich eigentlich überhaupt nicht, wo wir hingehen, Ponyboy?“, begann Mikey nach einigen Metern, auf denen er mehr gehüpft als gegangen war und ununterbrochen mit einem imaginären Degen auf entgegenkommende Passanten eingestochen hatte, die ihm verwirrt ausgewichen waren. Wirklich darüber ärgern tat sich aber keiner von ihnen, wie ich bemerkte. Die meisten lächelten im Vorbeigehen, oder schüttelten schmunzelnd den Kopf. Ein Junge von ungefähr acht Jahren erwiderte sogar für einen kurzen Augenblick die Aufforderung zum Duell, bis ihn seine Mutter an der Hand weiterzog, während sie – ebenfalls lächelnd – um Entschuldigung bat.
„Wo wir hingehen? Eigentlich nicht“, antwortete ich. „Ist mir auch nicht wichtig, glaub’ ich.“
„Was heißt, dir ist das nicht wichtig?“
„Mir spielt es ehrlich gesagt in die Karten, dass ich nicht weiß, wo wir hingehen. Ich wäre gerade eh nicht inspiriert genug, deine Pläne zu bewerten, wenn ich sie kannte. Oder zu entscheiden, ob ich mich drauf einlassen soll, oder nicht“, sagte ich. „Insofern will ich es gar nicht wissen. Solange du mich nicht in irgendein Büro schleppst, ist mir wurst, was wir machen.“
„Ist aber wichtig, zu entscheiden, was du willst und was nicht“, sagte Mikey. „Glaub mir das. Alles kann passieren und wenn es dann hart auf hart kommt, musst du bereit sein eine Entscheidung zu treffen.“
Mikeys Degen erwischte eine ahnungslos vorbeieilende Dame mittleren Alters im eleganten Kostüm.
„Im Leben geht es immer darum, Entscheidungen zu treffen.“
„Schon klar.“
„Jetzt tu das mal nicht so ab. In nichts drückt sich die persönliche Freiheit so aus, wie in den Entscheidungen, die wir treffen. Und das ist ein Fakt. Selbst im Knast, beispielsweise, hast du noch die Freiheit, dich zu entscheiden. Zum Beispiel mit den Behörden zu kooperieren, oder nicht, solche Sachen. Das ist ziemlich kraftvoll, finde ich“, sagte Mikey.
„Welche Behörde würde denn schon mit dir zusammenarbeiten wollen?“
„Na, die Polizei. Bundesbehörden, das FBI. Alle eben.“
„Und was hättest du denen zu bieten?“
„Das werd’ ich dir gerade auf die Nase binden, Ponyboy. So gut kennen wir uns noch nicht.“
„Ne, ist klar.“
„Konzentrier’ dich lieber auf die wichtigen Dinge: Wenn du Entscheidungen treffen darfst, bist du frei. Wenn du frei bist, dann hast du auch immer die Entscheidung. Die Begriffe sind sozusagen synonym.“
„Von mir aus“, sagte ich. „Aber zurzeit bin ich kein großer Freund von Entscheidungen. Ich stehe mit Entscheidungen quasi auf dem Kriegsfuß, wenn du so willst.“
„Ach ja? Und wie kommt das?“
„Nicht so wichtig“, winkte ich ab. „So gut kennen wir uns noch nicht.“
„Und Halt!“, rief Mikey plötzlich. Er blieb dabei ruckartig stehen, sodass ich auf ihn auflief.
„Uff! Sag’ doch ’nen Ton!“, raunzte ich ihn an, bevor ich ihn von mir wegschob.
„Hab’ nicht laut ‚Halt‘ gesagt? Doch, mir ist beinahe so, mein junger Freund.“
„Ja, ja, ist ja gut, wie dem auch sei. Und was rechtfertigt diese Karambolage?“
„Wir müssen mal die Spielregeln klären, Ponyboy. Hör zu: Also wenn man mit jemandem trinkt, und das haben wir ja vor, nehme ich an, dann unterhält man sich mit dieser Person. Nennt sich ‚Manieren‘, mein junger Freund. Und vielleicht hast du das nicht von mir gedacht, aber ich steh’ auf Manieren.“
„Alles klar, alles klar. Heißt aber trotzdem nicht, dass ich über alles reden muss“, wandte ich ein.
„Fein, das will ich dir zugestehen.“
„Können wir dann jetzt weiter?“, fragte ich, immer noch etwas genervt von unserem unnötigen Zusammenprall.
„Nein, wir sind nämlich da.“
„Hier? Aber hier ist doch nichts.“
Ich blickte mich skeptisch in der kleinen Straße um.
„Hier ist doch nichts?“ Mikey gab sich brüskiert. „Ich muss doch wohl sehr bitten. Du stehst vor dem bestgehüteten Geheimnis der ganzen Stadt, mein junger Freund. Du bist bei Sanjay!“
Er breitete die Arme aus und drehte sich zu dem Laden um, vor dessen Eingang wir standen und den ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht bemerkt hatte. Es war ein kleiner Lebensmittelladen, dessen Fenster mit Stickern und Werbung übersät war, die hauptsächlich indische Produkte oder Bollywood-Filme zu bewerben schienen. Neben der Tür stapelten sich Kisten und Reissäcke und vor dem Fenster befand sich ein hüfthoher Tisch, der als Obst- und Gemüsetresen diente.
„Hereinspaziert! Jetzt komm schon!“ Mikey machte eine tiefe Verbeugung und nahm sich einen imaginären Hut vom Kopf.
„Ich habe beschlossen“, sagte er, „dass es aller Wahrscheinlichkeit nach einer göttlichen Fügung zu verdanken ist, dass du mir in die Arme gelaufen bist. Und weil ich mein göttliches Mandat nun mal nicht ablehne, werde ich dich voll und ganz unter meine Fittiche nehmen. Schritt eins: Komm’ hier rein! Das findest du nur hier.“
Mikey verschwand in der Tür. Vielleicht hätte ich auch dieses Mal zögern sollen, ihm blind zu folgen, tat es aber wieder nicht. Zögern stand heute nicht auf meiner To-do-Liste.
Der kleine Laden von Sanjay hielt, was er von außen versprach. Er war in scheinbar willkürlicher Ordnung bis unter die Decke mit farbenfrohen Produkten voll gestellt, wobei es von Kokosmilch und Instant-Masalas bis hin zu Plastik-Wasserpistolen alles zu geben schien. In den engen Gängen hätten nur mit viel Mühe zwei Personen nebeneinander Platz gehabt. Wie immer fragte ich mich, ob der Handel mit diesen Plastik-Wasserpistolen jemals rentabel genug sein könnte, um ihn irgendwie zu rechtfertigen. Oder ob das aller billigste Geldwäsche war, weil doch niemand diesen Ramsch wirklich kaufte. Ich ließ meine Gedanken und Finger über die vielen hundert Produkte streifen, von denen, mit Ausnahme der Plastik-Wasserpistolen, eines exotischer und aufregender war, als das nächste. Mir gefiel der Gedanke, dass fast jedes von ihnen eine neue Erfahrung für mich bereithielt, eine Abenteuerreise in fremdartige Genusswelten, während sie für andere Menschen so normal waren, wie für mich H-Milch und Kochschinken. Natürlich konnte man bei Sanjay, nur echt im Kühlregal, auch H-Milch und Kochschinken kaufen. Zielgruppencatering, und so, aber trotzdem. Es dauerte einige Minuten, bis sich meine Nase an die verschiedenen Gerüche gewöhnt hatte. Bis heute ist es mir nicht gelungen, die Quelle dieses einzigartigen Dufts auszumachen, der einen in indischen Kaufläden übermannte und mich jedes Mal aufs Neue ohne Vorwarnung mental nach Fernost katapultierte. Ich liebte das und war auch damals wieder dankbar für diesen sinnlichen Kurzurlaub.
„Hier drüben“, rief es aus der hintersten Ecke des Ladens.
Ich schlängelte mich an einer Kundin vorbei, die plötzlich hinter einem Regal aufgetaucht war und sich nicht die Mühe machte, mir gleichermaßen auszuweichen, und erreichte schließlich Mikey, der neben einem ungefähr vierzigjährigen Mann von anscheinend indischer Herkunft stand und sich angeregt mit ihm unterhielt.
„Das ist Sanjay.“ Mikey deutete mit derselben großen Geste auf Sanjay, mit der er auch den Laden präsentiert hatte.
„Hallo.“ Ich reichte Sanjay die Hand zum Händedruck, den er schweigend und etwas schlaff erwiderte. „Es tut mir leid, dass wir hier einfach so hereinplatzen, aber der Kerl macht ein Riesengeheimnis aus Ihrem Laden. Hier soll’s etwas geben, das ich wohl unbedingt kennenlernen muss“, versuchte ich mich zu erklären. Instinktiv war mir die Situation ein wenig unangenehm. Vielleicht, weil ich Sanjay kurz zuvor gedanklich der Geldwäsche bezichtigt hatte.
„Mach’ dir keine Mühe, Ponyboy, Sanjay versteht so gut wie kein Deutsch“, unterbrach mich Mikey und zuckte mit den Schultern.
„Aber du hast dich doch gerade noch mit ihm unterhalten.“
Mikey machte eine kurze Handbewegung, die mir bedeuten sollte, das Thema auf sich beruhen zu lassen. Sanjay drehte sich um und begab sich durch einen bunten Vorhang in den hinteren Bereich des Ladens, von dem ich annahm, dass es sich um das Lager handelte.
„Jetzt ist es gleich so weit.“ Mikey rieb sich die Hände rieb. Seine Augen leuchteten und er grinste über beide Ohren.
„Weswegen sind wir denn hier?“, fragte ich und konnte mir selbst ein kleines Grinsen nicht verkneifen. Mikeys Art zu grinsen war ansteckend, das bemerkte ich in diesem Moment zum ersten Mal.
„Verrat’ ich nicht. Das Schönste ist doch die Vorfreude!“
„Ich kann mich doch nur freuen“, erwiderte ich, „wenn ich weiß, worauf.“
„Also das ist ja richtiger Un-fug!“, lachte Mikey. „Sag bloß, du hast dich, zum Beispiel, nicht auf dein erstes Mal gefreut? Na?“
„Du meinst Sex? Ich denke schon. Doch klar, wahrscheinlich schon“, antwortete ich.
Das war natürlich gelogen. Ich hatte damals einfach nur Angst. Vielleicht am ehesten zu vergleichen mit der Angst vor einem Elfmeter. Den kann man ja eigentlich auch nicht verschießen, das Tor ist riesig und der Torhüter ganz klein. Trotzdem schafft das immer wieder einer. Und manchmal sogar im WM-Finale, während die ganze Welt dabei zuschaut. Nein, an Vorfreude hätte ich mich erinnert. Und wer etwas anderes sagt, der lügt. Zu neunundneunzig Prozent.
„Na siehst du. Da wusstest du auch nicht, was dich erwartet. Und trotzdem hast du dich drauf gefreut“, triumphierte Mikey. „Vorfreude eben!“
Ich entschied, dass es noch reichlich früh in unserer kurzen Beziehung war, um in einem rumpeligen Lebensmittel- und Plastikwaffengeschäft gemeinsam meine jungfräuliche Angst vor Sex zu erörtern und nickte bloß stumm. Auch wenn ich dabei bleibe, dass jeder lügt, der etwas anderes behauptet. Zu neunundneunzig Prozent.
„Du bist aber ganz schön leicht mundtot zu machen“, sagte Mikey. „Fällt dir darauf nichts mehr ein?“
„Was soll ich dazu noch sagen?“, gab ich genervt zurück.
„Versteh’ schon, versteh’ schon. Willst nicht gleich ’nen Streit vom Zaun brechen, das respektier’ ich. Außerdem war ich, auch wenn du das nicht wissen kannst, während meiner Schulzeit mehrfacher Landesmeister im Debattieren, ist also bestimmt auch die weisere Entscheidung, wenn du dich zurückhältst. Das ist zwar schon ein paar Tage her, aber ganz ist der Lack noch nicht ab.“
„So ein Bullshit.“
„Oho! Ein Funke Widerstand“, spottete Mikey. „Kommt da etwa noch mehr?“
„Vielleicht wusste ich nicht, was mich erwartet“, begann ich, gegen meinen Willen von Mikeys Worten angestachelt, „aber die ganze Welt hat einem ja versichert, dass das ’was ist, auf das man sich freuen darf. Es gab, sozusagen, verlässliche Daten.“
„Na, na, ich bezweifele stark, dass du damals mit der ganzen Welt in Kontakt gestanden hast. Soviel zu deiner“, er ahmte mit den Fingern Anführungsstriche nach, „Datenerhebung. Und jetzt sage außerdem ich dir, dass du dich hierauf mal mindestens genauso freuen darfst. Im Moment macht das aus deiner Perspektive keinen Unterschied. In diesem Laden hier bin ich deine ganze Welt. Es gibt also auch jetzt“, wieder gestikulierte er Anführungsstriche, „verlässliche Daten.“
Ich ließ es gut sein und fragte mich, ob ich in diesem Moment, dort in dem kleinen, überfüllten Laden von Sanjay, wohl Vorfreude spürte. Damals konnte ich es nicht mit Sicherheit sagen. Heute vermute ich es schon, aber das ist natürlich mit gehörigem Abstand bewertet. Vielleicht trifft unsere Erinnerung die Unterscheidung zwischen Vorfreude und Angst, oder Sorge, in Zweifelsfällen auch nur danach, ob es im Endeffekt gut für uns ausgegangen ist. Das erscheint mir gar nicht mal so fernliegend.
In diesem Moment schob Sanjay den bunten Vorhang zur Seite und trat aus dem Hinterzimmer hervor, in das er verschwunden war. In seinen Händen hielt er zu meiner Überraschung einen Sixpack Bier.
„Aah“, rief Mikey. „Simba!“
Er nahm den Sixpack aus Sanjays Hand und packte mich an der Schulter, um mich sanft in Richtung Ausgang zu drücken.
„Hast du das bezahlt?“, fragte ich.
„Ach, genau.“
„Soll ich das übernehmen?“
„Das wäre ganz wunderbar. Gib’ ihm einfach ’nen Zehner.“
Ich drückte Sanjay eine Zehneuronote in die schlaffe Hand. Vom Ausgang aus konnte ich beobachten, wie er sich behäbig wieder hinter seinen Vorhang begab.
Wir machten nach ein paar hundert Metern in einem kleinen Park halt. Eigentlich war es nicht vielmehr als eine Grünfläche. Es gab dort eine kleine Wiese, zwei überquellende Mülleimer und drei oder vier heruntergekommene Parkbänke. Aber Parkbänke kann es ja, ganz logisch betrachtet, nur in einem Park geben, das wäre also das. Auf einer der Bänke saß ein älterer Herr mit Filzhut und fütterte Tauben, die sich in großer Zahl um seine Füße scharten. Er grinste glücklich und warf aus einer zerknitterten, braunen Gebäcktüte feine Brotkrümel vor die im Akkord pickenden Schnäbel seiner munter gurrenden Freunde.
„Das feinste indische Bier, was du auf dem Markt finden kannst. Der absolut heißeste Trend“, versicherte Mikey, während er ein Bier mit einem Feuerzeug öffnete und mir reichte. Indisches Bier und heißer Trend war keine Kombination, derer ich damals gewahr war.
„Woher kennst du das? Ich hab’ noch nie davon gehört.“
„Ich glaube, ehrlich gesagt, Simba hat mich gefunden. Das war Magie. Bier-Magie, verstehst du?“
Ich nickte und verstand nur halb.
„Das ist ja sogar kalt.“
„Na klar, aus Sanjays Privatbestand. Ich bitte dich, mein junger Freund. Ich würde doch meinen guten ersten Eindruck nicht so leichtfertig aufs Spiel setzen und warmes Bier servieren.“
„Jetzt bin ich aber schon gespannt.“
Ich begutachtete skeptisch das bunte Etikett, das einen Löwen zeigte, der eine Sonnenbrille trug. Ich verwarf meine immer stärker werdenden Zweifel und nahm einen großen Schluck. Ob es am Bier lag, und wie genau es schmeckte, erinnere ich kaum noch. Ich erinnere nur, dass es mich überwältigte. Und mir ist bewusst, wie das im Nachhinein und aus der Ferne betrachtet, klingen muss. Verrückt, aber genau so war es. Ich glaubte damals, mit diesem albernen indischen Bier auf meiner Zunge, Freiheit schmecken zu können. Eine Freiheit, die ich erst vor kurzem seit langer Zeit zum ersten Mal überhaupt wieder gespürt hatte, aber darauf kommen wir noch zu sprechen.
„Das ist ja fantastisch!“, rief ich ekstatisch und lachte Mikey an. Ich spürte, wie meine anfängliche Skepsis von einer Welle aus indischem Hopfensaft mitgerissen wurde, auf der nur noch die neugewonnene Euphorie, dafür aber kunstvoll und sicher, zu reiten verstand.
„Haha, du bist wirklich goldig! Du gefällst mir, Ponyboy! Prost! Du hast den richtigen Geist!“
Ich stieß einen Freudenschrei aus. Mit jedem Schluck stieg meine Stimmung und ich spürte, wie mit der kalten Flüssigkeit Kraft, lang vergessen geglaubte Kraft, in meinen Körper zurückzukehren schien. Ich hätte die ganze Flasche in einem Zug leeren können, so sehr genoss ich das Gefühl, das mich eroberte.
„Was für ein Tag!“
Ich schloss die Augen und begann, mich im Kreis zu drehen.
„Hau raus, Mikey, wo geht’s jetzt hin für uns? Was passiert als Nächstes?“
Mikey legte sich auf den Rücken und setzte eine etwas ältere, aber todschicke Fliegersonnenbrille auf, die er aus seiner Jeansjacke hervorgeholt hatte.
„Ich glaube, das Universum meint es heute gut mit uns. Der Herrgott, der Heilige Geist. Du und ich, mein junger Freund, sind heute die Lieblinge von dem da oben.“ Er zeigte mit angewinkeltem Arm in den Himmel.
„Oder von der da oben“, wandte ich ein.
„Keine Ahnung“, sagte Mikey. „Mag schon sein, dass das ’ne Frau ist, oder was auch immer. Aber für mich ist das ein Er. Das ist nur so ’n Gefühl. Klar, begründen kann ich das nicht. Liegt wohl daran, dass ich selbst ’n Kerl bin.“
„Ich hoffe, das nimmt sie dir später nicht übel“, zog ich ihn auf.
„Und ich hoffe, du nimmst mir nicht übel, wenn ich anmerke, dass du für mich wie jemand wirkst, der sich ziemlich viel darum sorgt, wer ihm was später mal übelnimmt. Ich mein, du hast dich bei Sanjay dafür ent-schul-digt, dass du in seinen Laden gekommen bist. Ponyboy, er bietet da Wa-ren für Kun-den an. Man könnte mit Fug und Recht behaupten, er wünscht sich, dass Leute in seinen Laden kommen, ei, ei, ei.“
Mikey lachte laut und klatschte in die Hände. Obwohl sich sein überzogener Hohn in diesem Moment gegen mich richtete, empfand ich Freude an der Art, wie Mikey mit seinen Worten spielte, ihnen meistens viel zu viel Gewicht gab und sie oft genug mehr als nur über Gebühr betonte. Es war ein Drahtseilakt und nicht selten sehr kurz davor, den Abgrund der Albernheit hinabzustürzen. Auf der anderen Seite dieses Abgrunds lag jedoch eine ganz besondere Art von Poesie darin, wie er seine Worte von der Praktikabilität und Effizienz alltäglicher Kommunikation loslöste und damit regelrecht befreite. Ja, man konnte sagen, in Mikeys befremdlicher Art zu sprechen lag etwas Erhabenes.
„Hab ich nicht recht, Ponyboy?“, fragte er und richtete sich ein wenig auf. „Du sorgst dich um deinen guten Ruf, wenn man so will.“
Ich nahm einen Schluck von meinem Simba und ertappte mich dabei, dass ich versuchte, Zeit zu gewinnen.
„Du willst es nicht sagen, ist okay“, sagte Mikey.
„Keine Ahnung, Mann. Kann sein.“
Mikey klatschte in die Hände.
„Dann dank’ mal besser all deinen Engeln, mein junger Freund! Endlich wissen wir, weshalb sich unsere Wege gekreuzt haben. Halle-fucking-luja!“
Mikey sprang auf die Beine. „Gepriesen sei der Herr, die Herrin, wasauchimmer, denn er, sie, es hat sein Schaf in meine Arme getrieben! Denn, wie du vielleicht vermutest, habe ich dieses Problem nämlich nicht. Und zu deinem Glück biete ich derzeit Kurse an. Also eigentlich nur einen, heute und für dich!“
„Du spinnst, Alter“, lachte ich. „Setz’ dich wieder hin!“
„Sag mal, wie sieht es eigentlich aus mit dir und Gott, mein junger Freund?“, fragte Mikey.
„Bevor wir das besprechen, müssen wir das mit dem ‚jungen Freund‘ mal regeln“, sagte ich. „Wie alt bist du überhaupt? Du bist doch nicht älter als ich.“
„Das spielt überhaupt keine Rolle. Weil ich ’hundert Kilometer gegen den Wind rieche, dass du jünger bist als ich.“
Mikey musterte mich in bekannter Manier theatralisch von oben bis unten, wobei er zum Teil mit seinem Daumen und Zeigefinger Abstandsmessungen an meinem Gesicht vornahm und sagte dann: „Du bist dreißig!“
Ich ging davon aus, dass er das an den Ringen um meine Augen abgelesen haben musste, so wie man das bei Bäumen machte.
„Nicht schlecht. Bin gerade dreißig geworden.“
„Das war zu einfach.“ Mikey ließ sich gelangweilt wieder auf die Wiese fallen. „Ist es dir schwergefallen?“, erkundigte er sich nach einer Weile.
„Dreißig zu werden?“
„Ja. Dreißig zu werden. The big three-o. Das ist dir doch sicher schwergefallen.“
„Nö, das ging. Was ist schon dabei?“





























