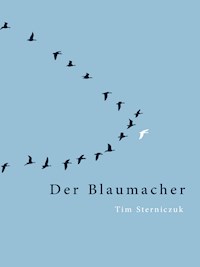Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zwischen Traum und Realität gibt es einen Ort, wo der Maskenmann geduldig auf dich wartet. Ein unmoralischer Pakt ermöglicht einem Jungen aus einfachen Verhältnissen den Aufstieg in die Berliner Oberschicht. Aber dieser Handel hat seinen Preis: Für den letzten Sprung auf der Karriereleiter wird von ihm verlangt, ebenjene Menschen zu beschützen, die einst seine Familie ruiniert haben. Und dafür sollen alle Mittel recht sein. Tiefgründig, poetisch und spannend. Eine Reise zu den Abgründen, an deren Ende unsere tiefsten Sehnsüchte im Verborgenen liegen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 157
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tim Sterniczuk • Der Maskenmann
Tim Sterniczuk
Der Maskenmann
Erzählung
Für Jana, mein Herz,
&
Papa, meinen Kompass.
»No man, for any considerable period, can wear one face to himself and another to the multitude, without finally getting bewildered as to which may be the true.«
– Nathaniel Hawthorne (»The Scarlet Letter«)
»All the world’s a stage. And all the men and women merely players.«
– William Shakespeare
»Da-dadada-daaa-da. Da-dadada-daaa-da.«
– Sido
1. Der Hof
Februarregen krachte in dicken Tropfen auf die grauen Steinplatten, die zu der Glastür mit dem großen Sprung hinaufführten. Zahllose Erzieherinnen hatten in der Vergangenheit versucht, den gefährlichen Riss stümperhaft mit kleinkindlichen Bastelarbeiten zu überkleben. Trotzdem konnte man ihn deutlich erkennen, selbst von der überlasteten Zubringerstraße aus, die direkt vor dem Eingang zu unserem Kindergarten verlief und von der es ununterbrochen an unsere jungen Ohren dröhnte und hupte. Wo Menschen einander hassten, die sich nicht kannten, gegenüber von dem U-Bahn-Eingang, neben dem die Säufer saßen und der Dönerbude, vor der es immer eine Schlange gab. Egal, wie viele Weihnachtsengel und deformierte Einhörner sie darüber klebten.
Hinter dem Sprung bereiteten die Hortkinder sich auf das alljährliche Faschingsfest vor. Auch ich bemalte voller Vorfreude mein Gesicht mit buntem Wachs und wickelte mir ein Kunstfell mit Leopardenprint als Lendenschurz um meine schmalen Hüften.
So ausgerüstet, war Tarzan bereit, seiner Pflicht nachzukommen und aufmerksam über den dichten Dschungel aus weißgekleideten Prinzessinnen und roten, vereinzelt goldenen, Power-Rangern zu seinen Füßen zu wachen.
Serkan, der die Süßigkeiten, die seine Familie ihm täglich in rauen Mengen in die Brotdose stopfte, zwar selbst nicht aß, dafür aber umso freigiebiger mit uns teilte und – das war das Wichtigste – seine Eltern nie über diesen Umstand aufklärte, hatte sich nicht als Power-Ranger, sondern als mexikanischer Feuerwehrmann verkleidet. Er trug einen falschen Schnurrbart, Poncho und den roten Feuerwehrhelm aus der Verkleidungskiste. Das fanden alle sehr komisch und er am allerkomischsten.
Ich wusste, am Abend würde ich meine Verkleidung längst wieder abgelegt haben, würde nicht mehr Herr des Dschungels, kein Beschützer und kein Held, sondern bloß wieder ein Erstklässler in einem Vierzig-Parteien-Haus sein. Auch die Prinzessin mit der rosa Sternenschleife im Haar, die gemeinsam mit ihrer Mutter und deren Freund fünf Stockwerke über uns wohnte, würde Kleid und Sternenschleife zurück in die Kiste gelegt haben, aus der ihre Mutter sie am Vortag hervorgeholt hatte. Und wobei etwas von der Asche hineingefallen war, die Mutters Mentholzigaretten so unermüdlich produzierten.
Trotzdem hatte sie damals hübsch ausgesehen, die Sternenschleifen-Prinzessin, trotz Ascheflecks auf ihrem rosa Kleid. Auf dem Faschingsfest hatte sie Tarzan einen Kuss auf die Wange gegeben und sie hatte nach Erdbeerkaugummi gerochen, während sie es tat. Dabei waren die beiden von einer anderen Prinzessin beobachtet worden, die eigentlich Tobias hieß. Prinzessin Tobias war Tarzans beste Freundin. Aber der Kuss auf die Wange hatte ihr nicht gefallen, auch wenn sich nicht feststellen ließ, wem ihre Eifersucht galt.
Prinzessin Tobias war damals noch nicht lange Teil unseres kleinen Hofstaats und wir alle erinnerten noch lebhaft die Worte, die über den Linoleumboden hallten, als sie ihn zum ersten Mal mit ihren zarten Füßlein betrat: »Kerstin, ich weiß doch. Aber er wird das schon überstehen, es ist doch nur vorübergehend. Jetzt hör aber auf. Natürlich sprechen die hier Deutsch mit den Kindern.«
Prinzessin Tobias grämte sich im Angesicht der unschuldigen Annäherung, die sie am Faschingstag aus ihrem Versteck heraus beobachtet hatte und würde Tarzan zwei Monate später ein Bein stellen, sodass der sich beim Sturz das Handgelenk brach.
Ein paar Wochen darauf war Prinzessin Tobias nur noch Geschichte, vorübergegangen, wie es vom ersten Tag an prophezeit worden war. Sicher war es ihrer Erzeugerin Kerstin und deren Überzeuger Namenlos zu laut, die Schlange vor der Dönerbude immer zu lang gewesen. Ihr gab ich jedenfalls nie die Schuld daran und mit dem gebrochenen Handgelenk hatte es auch nichts zu tun.
Glück und Unglück der eigenen Eltern richtig einzuschätzen, dazu sind wohl nur die wenigsten Kinder imstande. In unserem Wohnzimmer ging es oft laut und lustig zu und deshalb glaubte ich für meinen Teil jedenfalls, dass meine Eltern damals glücklich waren.
Es wurde gesungen, geraucht und ständig erzählte jemand schmutzige Witze auf Polnisch. Aus dem alten Schallplattenspieler krächzte Louis Armstrongs Trompete, aber auch das Saxofon von Jerzy Matuszkiewicz und das Piano von Andrzej Trzaskowski. Es roch nach Kohl und nach Schnaps, nach Zigaretten, Kartoffeln und den Kissen unseres ausrangierten Achtzigerjahresofas, auf denen meine Geschwister und ich täglich herumtollten.
An solchen Abenden würde ich stets aufs Neue den Versuch unternehmen, vom Türrahmen aus durch die dichten Rauchschwaden etwas zu erkennen, wie ein Seemann, der durch den Nebel hindurch versucht, Land auszumachen. Vielleicht das Ufer meiner eigenen Zukunft in Augenschein zu nehmen, die sich dahinter schemenhaft andeutete. Immer blieb ich jedoch erfolglos, konnte nie ihre genauen Umrisse ausmachen, weswegen womöglich am Ende auch alles ganz anders kam, als es eigentlich geplant gewesen war.
Ein lustiger Mann – »lass das, Wojtek« – wollte mir einen Schnaps eingießen, da bekam er eine Backpfeife von meinem Vater. Lass-das-Wojtek sprang auf und ballte die Fäuste, alle lachten und meine Mutter küsste ihm auf die Stirn, da lachte auch er. Einen Schnaps bekam ich nicht, aber zur Versöhnung einen Schluck Bier.
Meine Schwester war zu klein für Bier und um noch wach zu sein und schlief deswegen längst in ihrem Bett, gleich neben meinem und dem meines älteren Bruders. Der trieb sich mit den anderen Söhnen, deren Mütter und Väter der Nebel verschluckt hatte, auf dem Hof herum.
Ich blickte aus dem Fenster und wäre gern bei ihnen gewesen. Bestimmt stellten sie wieder irgendeinen glorreichen Unsinn an, mit dem sie am nächsten Tag vor den Mädchen angeben würden. Aber natürlich war mir das verboten. Nicht etwa von meinem Vater, der einen Versöhnungsschnaps mit Wojtek trank, oder meiner Mutter, die zum Ergötzen ihrer bewunderten Zuhörerschaft politisch wurde. Mein Bruder hatte es mir verboten. Er war es, der mich nicht dabei haben wollte. Und genau deswegen hatte ich auch immer noch nicht »Taxi Driver« gesehen, obwohl er pausenlos davon erzählte.
Eines Tages erfuhr ich, dass eine der Familien aus dem Erdgeschoss – ein wahnsinnig fetter Kerl mit Frau und zwei Töchtern – in der eigenen Wohnung ein Bordell betrieb. Direkt gegenüber von der Wohnung, in der mein Bruder mit seinem Kumpel Pawel der Legende nach schon vor drei Jahren zum ersten Mal »Taxi Driver« gesehen hatte.
Der fette Zuhälter war dann wenig später tot, ich bildete mir ein, den Geruch seines Leichnams im Hausflur wahrgenommen zu haben, was sicher nicht stimmte, und mein Vater sagte mir, wenn ich klug sei, würde ich besser nicht nachfragen. Am Tag der Beerdigung wechselte ich ein paar Worte mit der jüngsten Tochter, deren Zähne sich schwarz gefärbt hatten von der gefälschten Cola, die sie jeden Tag literweise in sich hineinschüttete. »Kleiner Pisser«, pfiff sie mir durch ihre weit klaffenden, schwarzen Zahnlücken zu, die wie Vorboten der Abgründe wirkten, in die sie ihr Leben noch führen sollte. Ihre Zähne waren, auf irgendeine Art und Weise, für mein weiteres Leben von Bedeutung und außerdem konnten sie nicht verhindern, dass mir ihr Lächeln gefiel.
In diesem Sommer verließen wir den Hof. Das hatte nichts mit dem Tod des Fettwansts zu tun und auch nicht damit, dass die Sternenschleifen-Prinzessin und ihre Mutter schon kurz vor Ostern weggezogen waren.
Mit nur wenigen Tagen Vorwarnung, die meine Mutter mir beiläufig vergönnt hatte, war sie damals aus meinem Leben verschwunden. Ein schwermütiges Herz würde von dem Verlust der ersten Liebe sprechen. Aber in unserem Alter konnte es noch keine Liebe sein, egal, ob man schon zwei Strohhüte, eine Handvoll Nudelaufläufe und einen Erdbeerkaugummi-Wangenkuss miteinander geteilt hatte.
Später hieß es außerdem immer, das seien »eigenartige Leute« gewesen. Und wenn meine Eltern so etwas sagten, bedeutete es auch etwas, denn alle dort waren auf ihre Art und Weise eigenartig. Das galt bestimmt auch für uns, man betonte es also üblicherweise nicht besonders.
Es gab Bier und wieder wurde laut auf Polnisch gefeixt und gelacht, während die großen Kerle die noch größeren Kisten trugen, auf denen meine Mutter mit Filzstift »Küche« oder »Büro« geschrieben hatte. Einer trug ohne jede Hilfe unseren alten, klapperigen Kühlschrank und an seinem – des Kerls und nicht des Kühlschranks – roten Hals pulsierte eine dicke, wulstige Vene.
»Kurwa mać!«, so flucht man auf Polnisch, wenn der Kühlschrank auf die Pflastersteine schmettert, auch wenn er dabei so gut wie unversehrt bleibt.
Meine Mutter atmete erleichtert auf. Damals habe auch ich erleichtert aufgeatmet und sie mich angelächelt. Heute, und genau darum geht es eigentlich, hätte ich kaum die Luft angehalten.
»Hier liegt zu viel Hundescheiße auf dem Gehweg«, antwortete mir mein Vater schließlich auf meine unermüdlichen Fragen nach dem Grund für unseren so plötzlichen Umzug. Er zündete sich eine Zigarette an, während wir mit dem großen Laster an der roten Ampel warteten und drehte das Radio auf. Nach drei Jahren war er von Zigarren, die er selten, aber mit großem Genuss geraucht hatte und die wir »als eine Art Nikotinpflaster« hatten akzeptieren sollen, wieder auf Zigaretten umgestiegen. Durch die Tabakwolke konnte ich nicht erkennen, dass er eigentlich hätte sagen wollen: »Dein Bruder wird Gangster, wenn wir hier bleiben.«
Ich kannte zwar keinen von ihnen persönlich, wusste aber, dass ein Mitglied der »Kolonie-Boys« nichts war, was meine Eltern sich in der Familie wünschten. Wahrscheinlich genauso wenig, wie Bordelle im Erdgeschoss. Und so zogen wir dorthin, wo es keine »Kolonie-Boys« und keine Bordelle mehr gab und auch kaum noch Scheißhaufen.
Meine Geschwister versuchten, ihre Hälse aus dem offenen Fenster zu recken und noch einen letzten Blick zu erhaschen auf die rot-weiße Schranke, die Grenze zu unserem Hof, und die winkenden Hände unserer Freunde, die sich von uns zurücklassen ließen. Ich blickte auf die Ampel, die auf Grün sprang.
2. Die Schwebe-Prinzessin
»Sitzt doch wie angegossen.«
»Pack das Ding weg, da kannst du dir gleich Schuhcreme ins Gesicht schmieren. Das ist nicht lustig.«
»Es ist ein Sombrero mit einem falschen Schnurrbart, der an einer Schnur hängt. Ein Schnur-Bart, wenn du so willst.«
»Es ist rassistisch und geschmacklos. Das findest du ja wohl nicht komisch?«
Ich lege Hut und falschen Schnurrbart zurück in das Regal, ohne den Poncho überhaupt anprobiert zu haben. Ich halte einen Augenblick lang inne, weil ich bemerke, dass mir gefällt, wie der Stoff sich in meinen Fingern anfühlt, obwohl es sich, das hat sie mir wiederholt erklärt, um »allerbilligstes Material« handelt.
»Ich finde schon noch ein Kostüm für die Party«, sage ich. »Mittagspause ist nur gleich rum und ich habe noch einen Haufen zu tun. Ich muss bis Ende der Woche noch diese verdammten –«
Sie gibt mir einen Kuss und lässt mich dabei tief in ihre blauen Augen blicken. Polarmeer oder Südsee, nie kann ich mich entscheiden, ignoriere bloß, dass in beiden schon Männer ertrunken sind.
»Mister Businessman. Sehen wir uns heute Abend?«
»Bei mir?«
»Heute mal wieder bei mir. Ist nur fair.«
Sie lächelt mich an und fügt hinzu: »Die Frage hat sich zum Glück eh bald erübrigt.«
Ich schaue ihr in dem Bewusstsein hinterher, dass wir auch die letzten sieben Male bei ihr übernachtet haben und widerspreche nicht. Sehe ihr stattdessen dabei zu, wie sie davonschwebt auf diesen langen Beinen, mit denen sie, gerade in letzter Zeit, so selten den Boden derjenigen Tatsachen zu berühren scheint, die an mir haften wie eine zweite Haut. Ich will nicht darüber nachdenken und stattdessen bloß ihren betörenden Abgang genießen. Eine Sache hat sie dabei nie getan, beim Davonschweben, und zwar sich noch einmal nach mir umzudrehen.
Jeder liebt meine hellblonde Schwebe-Prinzessin. Als wäre ihre Schönheit nicht genug, hat sie außerdem noch promoviert, was natürlich – vor allem im direkten Vergleich – die weitaus bemerkenswertere Errungenschaft ist. In ihren Bewerbungsunterlagen, die sie derzeit so zahlreich verschickt, heißt es, sie sei »gewitzt, willensstark und tough«. Falls sie eine Schwäche hat, das räumt sie zwar nicht in ihrer Bewerbungsmappe aber ansonsten freimütig ein, dann ihren ausgeprägten Geschmack. Es ist teuer, ihr gerecht zu werden. Und dabei geht es nicht darum, ihr Geschenke zu kaufen. Das lässt sie ohnehin nur im äußersten Notfall zu – sie, das betont sie regelmäßig, »könne man nicht kaufen«. Nein, allein mit ihr mitzuhalten, kostet eine Stange Geld.
Aber was macht das schon, denn eigentlich ist in meinem Leben mittlerweile alles teuer. Und von all den teuren Dingen ist es ihr Geschmack, der es mir wirklich wert ist. Von dem es mir manchmal so vorkommt, als sei er nicht nur der Haupt-, sondern der einzige Grund für die Dinge, die ich tue.
Ob es sich dabei um Liebe handelt, will ich den Philosophen überlassen. Feststeht, dass ich nicht genug von ihr bekomme und ich mich jedes Mal fühle, als würde ich bald in eine schwächliche Ohnmacht fallen, sobald ich mich ihr nähere. Sie schmeckt nach Champagner, nach Kaviar oder Trüffel. Sie wissen, was ich meine: Nach all den Dingen, die jeder liebt, nur in süß, als habe sie obendrein alles mit Rosenwasser oder siebzigprozentiger Schokolade überzogen. Sie riecht, als trage sie Jean-Baptiste Grenouilles letztes Meisterwerk am Hals und wie der Pöbel von Grasse bin auch ich nur noch Sklave meiner animalischen Triebe, sobald meine Sinne ihr sündhaftes Parfüm ausmachen.
Das Spiel entspricht einander bei jeder Wiederholung, nie ändern sich die Schritte unseres Pas de deux. Ich versuche, ihr Aroma in mir aufzunehmen, gehe mit der Nase, meinen Lippen, meiner Zunge ihren Hals entlang, erspüre mit meinen Fingern ihre seidigen Haare, die sich in erhabener Erregung auf ihrem Nacken aufstellen und muss doch immer leer ausgehen. Ich vermag das, was sie umgibt, nicht einzufangen. Es gehört ihr, nicht mir, wird nie mir gehören, wird mir nur von ihr geliehen, geborgt, für eine kurze Zeit vermietet, solange sie es erlaubt.
Unfähig, ihre Essenz einzufangen, nehme ich vorlieb mit ihrem Körper, den sie mir gleichsam als Ersatz anbietet. Von dem sie mir stattdessen für einen kurzen Augenblick erlaubt, über ihn zu verfügen. Ein teures Geschenk, das die meisten Männer ohne mit der Wimper zu zucken eintauschen würde gegen alles, was sie bis dahin besessen haben.
Ihre Haut ist fest, aber trotzdem weich, ihre Silhouette scharf und gleichzeitig eigenartig konturlos, wie die Musen impressionistischer Meister. Mein gesamtes Dasein, so fühlt es sich an, konzentriert sich in jenen Augenblicken, in denen wir zusammen sind, in meinen Lenden, die wie willenlose Sklaven unter dem Befehl des unnachgiebigen Hauptmanns, der über ihnen thront, versuchen, immer weiter vorzudringen, getrieben von dem Wahn, irgendwann das zu finden, was nie gefunden, sondern nur gegeben werden kann, bevor sich letztlich, unter dem unkontrollierten Grunzen meines schweißgebadeten Körpers mit meinem Samen auch mein Bewusstsein, meine Zweifel, meine Würde und gleichsam mein ganzes Wesen in ihr verliert, bis mir nur noch bleibt, davor die Augen zu verschließen.
3. Die Bar
Als ich zum ersten Mal dort war, prägte sich mir vor allem der Duft ein. Überall roch es nach Zigarren. Aber nicht, wie es üblicherweise nach Zigarren roch, sondern als habe jemand die erdrückende Rauchartigkeit entfernt, bis nur noch das süße Aroma von Vanille und Kirsche übrig blieb, meisterhaft gepaart mit herben Noten von feuchter Erde, Muskat und Zeder. Dort einzutreten schmeckte, wie von einem rauchenden Trinker umarmt zu werden. Von dem man nicht wollte, dass er einen wieder losließ, obwohl man sicher war, er würde einem eines Tages das Herz brechen.
Ich hätte nicht berichten können, wie sie von außen aussah, die Bar, in der wir uns immer trafen. Jeder Besuch, jede Erinnerung begann damit, dass ich längst an der Garderobe stand, wo eine ältere, ungemein schöne Frau mir meinen Mantel abnahm und damit in der Dunkelheit verschwand. Während ich darauf wartete, dass sie mit einem Schein, einer Marke oder dergleichen wiederkam, was nie passierte, näherte sich von rechts ein Kellner. Er trug Frack und Fliege, hatte die Haare präzise gescheitelt und aalglatt auf seinen kleinen Schädel geklebt. Er verbarg die linke Hand hinter seinem Rücken, während er in der rechten ein Tablett trug. Darauf stand ein Kristallglas, in dem sich neben zwei Eiswürfeln und einer Orangenschale eine goldene Flüssigkeit befand, die Whiskey sein musste. Neben dem Glas stand, als unübersehbares Indiz für die Richtigkeit meiner Annahme, noch eine volle Flasche davon.
»Wenn Sie mir nun folgen möchten.«
Immer drehte ich mich noch ein letztes Mal um, wo ich die ältere Dame mit meiner Marke erwartete und immer war die Garderobe verschwunden. Stattdessen befand sich dort, wo eben noch die Garderobenstangen aufgereiht gewesen waren, in der Dunkelheit nur schemenhaft auszumachen ein metallener Käfig. In dem Käfig lag ein weißer Tiger, der erkennbar betäubt worden war und die Augen nur mit Mühe offenhalten konnte. Hinter dem Tiger saßen, tief umschlungen, zwei junge Männer, die sich küssten. Bis auf die knappen Lendenschürze um ihre Hüften hatten sie nichts an, lediglich trugen beide bunte Studentenmützen auf ihren Köpfen, wie sie die Jungen aus den schlagenden Verbindungen immer aufsetzten, die ich während des Studiums kennengelernt hatte. Der Tiger brummte schläfrig.
»Folgen Sie mir bitte.«
Ich nahm meinen Drink vom Tablett und folgte dem Kellner im schwarzen Frack.
»Ich bin Frack-Kellner«, sagte er.
»Ich weiß.«
Wir schritten die wenigen Treppenstufen, die vor uns lagen, hinauf und blieben vor einer mächtigen Metalltür stehen, die man mit schwarzem Samt beklebt hatte. Nur die silberne Klinke lag offen, die er immer angestrengt hinunterdrücken musste, bevor er der Tür einen kräftigen Stoß mit der Schulter gab. »Nach Ihnen.«
Durch die offene Tür konnte ich nie etwas erkennen außer Rauch, überall Rauch, als stünde der gesamte Raum in Flammen. Es herrschte eine unerträgliche Hitze und durch die dunklen Wolken flackerten und zuckten unregelmäßig gleißend helle Lichtblitze. Laut kreischende Saxofone, schrille Flöten und jaulende Dudelsäcke schrien um die Wette, verzerrt und aggressiv, während sich dumpfe Trommelschläge im Äther verloren, außerhalb jedes von Menschen erdenklichen Takts. Ich fühlte die kleine Hand von Frack-Kellner zwischen meinen Schulterblättern. Er streichelte mir für einige Sekunden über den Rücken, dabei lächelte er milde, bevor er mir einen ruckartigen Stoß versetzte und ich durch die Wand aus Rauch stolperte.
An der Menge Qualm hätte ich wohl ersticken müssen, spürte aber nichts dergleichen. Der einzige Geschmack in meinem Mund war der von Whiskey, Zucker und Angosturabitter. Der Rauch hatte sich verzogen, die gräulichen Geräusche ebenso. Ersetzt hatte sie eine langsame, nur im Hintergrund zu vernehmende Version von Bill Evans’ »Young and Foolish«, die von einem kleinen Ensemble dargeboten wurde, das auf einem Holzpodest am Ende des Raumes im Kreis stehend und die Köpfe zusammengesteckt, leise und dem Anschein nach für sich allein spielte. Es roch nach Zigarren und am andere Ende des Raumes, an einem Tisch in der hintersten Ecke, verdeckt von den zahllosen übrigen Tischen voller im Schatten sitzender und in sich vertiefter Gestalten, wartete er schon immer auf mich.