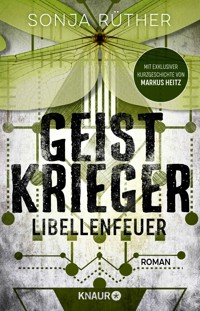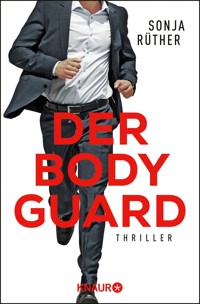
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Eine alte Schuld, ein mörderischer Racheplan und verbotene Gefühle: Der Personenschützer Maik ist neu im Sicherheitsteam der Familie des schwerreichen Industriellen Peter van Holland – sein Auftrag: er soll Lynn beschützen, die das behütete Leben einer äußerst wohlhabenden jungen Frau genießt. Was zunächst wie ein einfacher Job erscheint, bringt Maik bald in unerwartete Schwierigkeiten. Nach einem ungewöhnlichen Kennenlernen verliebt sich Maik hoffnungslos in Lynn, die seine Gefühle trotz aller Schwierigkeiten erwidert. Als die Sicherheitsstufe wegen verdächtiger Vorkommnisse erhöht wird, unterschätzt Maik die Gefahr und muss zusehen, wie die Frau, die er liebt, brutal entführt wird. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, der nur gewonnen werden kann, wenn Maik gegen alle Regeln verstößt. Geschickt verknüpft die deutsche Autorin Sonja Rüther in »Der Bodyguard« eine überzeugenden Love-Story mit einem packenden Thriller. »Sonja Rüther versteht es bestens, eine ungewöhnliche und fesselnde Story zu erzählen.« Bestseller-Autor Markus Heitz
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 504
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Sonja Rüther
Der Bodyguard
Thriller
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Der Personenschützer Maik ist neu im Sicherheitsteam der Familie des schwerreichen Industriellen Peter van Holland – sein Auftrag: er soll Lynn beschützen, die das behütete Leben einer äußerst wohlhabenden jungen Frau genießt.
Was zunächst wie ein einfacher Job erscheint, bringt Maik bald in unerwartete Schwierigkeiten. Nach einem ungewöhnlichen Kennenlernen verliebt sich Maik hoffnungslos in Lynn, die seine Gefühle trotz aller Schwierigkeiten erwidert. Als die Sicherheitsstufe wegen verdächtiger Vorkommnisse erhöht wird, unterschätzt Maik die Gefahr und muss zusehen, wie die Frau, die er liebt, brutal entführt wird. Ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt, der nur gewonnen werden kann, wenn Maik gegen alle Regeln verstößt.
Inhaltsübersicht
Widmung
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Danksagung
Für Monika und Dieter
Prolog
Oh Herr, nimm diese junge Seele in deine gütige Obhut …«
Hannah Gunthel sah auf den kleinen Sarg hinunter, den andächtige Träger in das nass geregnete Grab hinabgelassen hatten, und fühlte sich Gott ferner denn je. Der Priester redete unermüdlich weiter, pries den Herrn, dessen Wege so unergründlich waren, und stach Wörter wie Vergebung, Liebe und Gnade in Hannahs schmerzendes Herz. Nichts davon würde sie je wieder fühlen können.
Das letzte Gute in ihrem Leben war ihr Mann Kurt, der fest ihre Hand hielt. Er zitterte am ganzen Leib, zuckte, wann immer der Priester den Namen des Herrn nannte. Sie beide hatten ihren Glauben verloren. Hannah musste der Trauergemeinde nicht ins Gesicht schauen, um zu wissen, dass niemand dem Priester wirklich zuhörte. Sein Versuch, Gottes Allmacht auch in der Stunde der größten Not als etwas Tröstliches zu verkaufen, scheiterte auf ganzer Linie. Er war nur hier, um für Klara seinen Segen zu sprechen. Ihre reine Seele sollte den Weg in den Himmel finden, so wie Sofie vor ihr aufgestiegen war. Und all die anderen, die nach und nach sterben mussten.
Krebs war ein Monster. In dieser Gemeinde war es eine fahrlässig von der Kette gelassene Bestie, die um sich gebissen hatte. Die Familien wirkten zerlöchert, und beinahe jeder Hinterbliebene stand so dicht vor dem Abgrund, dass jegliche Erschütterung einen Absturz bewirken konnte.
Hannah hatte keine Angst mehr vor der Hölle, sie lebte in ihr. Jeden Tag, an dem sie aufstehen und weitermachen musste.
Endlich sprach der Priester das letzte Wort, nahm die kleine Schaufel und schippte etwas Sand auf den Sarg. Das Geräusch, mit dem die Körnchen auf den Deckel prasselten, verursachte bei ihr eine Gänsehaut. Sie wollte nicht glauben, dass ihre Tochter darin lag. Das Mädchen, das sie zwölf Jahre lang behütet und über alles geliebt hatte. Seite an Seite mit ihrer großen Schwester, die vor einem halben Jahr hatte vorgehen müssen.
Kurt lockerte seinen Griff und legte dann die Hand auf ihre Schulter. Es war so weit.
Wie betäubt ging sie zu dem Behälter mit dem Sand, schippte etwas davon auf das Holz und warf eine gelbe Rose hinterher – Klaras Lieblingsfarbe.
»Ich lasse euch nicht allein«, versprach sie flüsternd. Tränen liefen über ihr Gesicht.
»Und ich auch nicht«, sagte Kurt und warf eine Rose hinterher.
Fast alle der fünfzig Anwesenden hielten gelbe Rosen in den Händen, die sie nun nach und nach zusammen mit der Erde auf dem Sarg verteilten. Anschließend schüttelten sie Hannahs und Kurts Hände, sahen ihnen dabei in die Augen und nickten ohne ein Wort.
Der Priester stand betreten daneben. Er war immer derselbe, wahrscheinlich bemerkte er sogar, dass diese Menschen an einem Scheideweg standen. Vielleicht hielt er es für Gottes Werk, dass hier etwas seinen Anfang nahm, das nur schwer zu ignorieren war? Doch er schwieg. Wie alle geschwiegen hatten, die hätten schreien sollen. Er würde sich den Wanst beim Leichenschmaus vollstopfen, seinen Glauben schützend vor das Offensichtliche ziehen – wie einen dicken Samtvorhang vor die Sünden dieser Welt. Dann würde er dahinter stehen bleiben und durch einen Spalt zusehen. Hannah warf ihm einen wissenden Blick zu. Ohne Sünde keine Sühne, ohne Sühne keine Vergebung. Wofür wärest du dann noch gut?
Kapitel 1
Der schwarze Anzug war wahrscheinlich das teuerste Kleidungsstück, das Maik je besessen hatte. Er sah elegant aus, fühlte sich aber wie Sportkleidung an. Als er ihn ausgehändigt bekommen hatte, war seine größte Befürchtung gewesen, dass Schnitt oder Stoff ihn einschränken könnten. Reiche Leute legten meist mehr Wert auf das Aussehen einer Sache als deren Funktionalität. Dieser Anzug war jedoch der beste Beweis, dass man beides haben konnte. Egal ob er handgreiflich werden oder jemandem hinterherlaufen musste, er würde dabei gut aussehen und effektiv sein.
Maik musste grinsen, als er an die Kommentare seiner Freunde dachte, denen er ein Foto von sich geschickt hatte. Germany’s next Super-Bodyguard, lautete der Titel, den sie ihm verliehen hatten. Allerdings wurde er nicht nach seinen Fähigkeiten eingesetzt. Seit gut zwei Wochen durfte er selten mehr machen, als in der Sicherheitszentrale auf Monitore zu starren oder Botengänge zu erledigen. Bevor er bei der genannten Adresse klingelte, überprüfte er nochmals den Sitz seiner Kleidung. Er war Stunden unterwegs gewesen, um Dokumentenmappen bei drei unterschiedlichen Büros abzuholen, wo er jedes Mal warten gelassen wurde. Immerhin hatte er jedes Mal einen Kaffee bekommen, den er jetzt allerdings auf andere Weise merkte. Beim letzten Stopp hätte ich eine Pinkelpause machen sollen.
Er hoffte, dass sich hier eine Gelegenheit bot, wenn er die Mappen endlich überreicht hatte. Er klingelte und nahm sofort Haltung an, als die Tür geöffnet wurde und Benno Reichert ihn hereinwinkte.
»Herr van Holland telefoniert gerade«, sagte er und legte dabei einen Finger an die Lippen als Zeichen, dass Maik still sein sollte.
Reichert koordinierte das fünfzehnköpfige Sicherheitsteam, das Peter van Hollands Anwesen und dessen Bewohner schützte. Außerdem war Reichert der persönliche Bodyguard von Peter van Holland. Er war ein ganzes Stück älter als Maik, vielleicht Ende vierzig, aber mit seinem militärischen Aussehen hätten sie glatt Brüder sein können. Genau genommen sahen alle im Team gleich aus, was vornehmlich an den kurz geschorenen Haaren und den durchtrainierten Körpern lag. Maik passte perfekt ins Bild. Die anderen waren jedoch alle Ex-Soldaten, aber da die Grippewelle das Team stark geschwächt hatte, hatten sie bei Maik eine Ausnahme gemacht. Er war lediglich ausgebildeter Personenschützer und mehrfacher Ju-Jutsu- und Kickbox-Europameister. Reichert hatte keinen Hehl daraus gemacht, dass Maiks fehlende militärische Ausbildung ein Makel war. Deswegen sollte er nur als Springer fungieren. Chauffeurdienste, Unterstützung des Personenschutzes bei Veranstaltungen und Wachverstärkung bei Bedarf. Jeder Einsatz wurde gut bezahlt. Wenn es zu einer Festanstellung käme, würde er genug sparen können, um sich in ein paar Jahren mit einer Kampfschule selbstständig zu machen. Das war alles, was er wollte. Es sollte nicht so eine kleine Klitsche werden, sondern ein Sportzentrum, das für jeden offen sein würde und Sieger hervorbrachte. Dafür hielt er es schon aus, mit Typen zu arbeiten, die neben der Arbeit kaum Interessen zu haben schienen. Zumindest scheiterte jeglicher Small Talk über Fußball oder das Hamburger Nachtleben an der Wortkargheit seiner Kollegen.
Reichert nahm ihm die Mappen ab und wies ihn mit einer knappen Handbewegung an, neben der Tür abzuwarten. Eine von Maiks leichtesten Übungen. Als Bodyguard musste man mit unendlicher Geduld gesegnet sein, weil zu neunundneunzig Prozent nichts passierte, was seine Anwesenheit überhaupt notwendig machte.
Van Holland stand vor dem Garderobenspiegel und richtete seine Krawatte, während er über ein Headset telefonierte. Er war ein freundlicher, älterer Mann mit einem Wohlstandsbauch, lichtem Haar und einer runden, kleinen Brille, die ihn wie einen Bruder von Norbert Blüm aussehen ließ. Maik hatte ihn nur einmal zuvor gesehen, als er dessen Tochter einen Morgen zur Schule gefahren hatte. Sie war erst neun, wahrscheinlich hielt jeder van Holland für ihren Opa. Für Maik käme so eine späte Vaterschaft nicht infrage: entweder Frau und Kinder bis Anfang vierzig oder gar nicht. Peter van Holland war irgend so ein Konzernmogul, der nicht mehr wusste, wohin mit seinen Millionen. Vielleicht hatte er deshalb so spät ein Kind bekommen. Es gab kaum kostspieligere Lebensveränderungen für wohlhabende Leute, die ihre Nachkommen dann von Kindermädchen und Golf-, Reit- oder Ballettkoryphäen erziehen ließen.
»Ich muss Sie nicht daran erinnern, dass Sie niemals über das reden, was Sie hören oder sehen, richtig?«, flüsterte Reichert und brach damit in Maiks Gedanken ein.
Maik nickte. »Mit niemandem«, bestätigte er. »Es werden nur relevante Fakten an Sie oder andere Mitglieder des Teams kommuniziert. Keine Gespräche über die Familienmitglieder, deren Gäste oder das Tagesgeschehen.«
Reichert sah zufrieden aus. Dort, wo Maik zuvor gearbeitet hatte, redeten die Angestellten immer untereinander über die Schutzbefohlenen. Es wurde dabei auch viel gelacht, weil reiche Leute die seltsamsten Angewohnheiten hatten, aber in diesem Team blieben alle bis zum Hals zugeknöpft.
»Haben Sie den Tracker aktiviert?« Reichert deutete auf das uhrenähnliche Gerät an Maiks Handgelenk.
Maik zog den Ärmel zurück und drückte zwei Sekunden auf den kleinen grünen Knopf. »Jetzt ja.«
»Sie dürfen das nicht vergessen. Zum einen, damit wir in der Zentrale wissen, wo Sie mit Ihrer Schutzbefohlenen sind. Zum anderen wird damit Ihre Arbeitszeit aufgezeichnet. Wenn Sie bezahlt werden wollen, aktivieren Sie ihn.«
Es fiel Maik schwer, sich an das Gerät zu gewöhnen. Zudem mochte er den Gedanken nicht, auf Schritt und Tritt beobachtet zu werden.
»Benötigen Sie mich denn jetzt noch?« Maik deutete auf die Mappen, mit deren Übergabe er seinen Auftrag erledigt hatte.
Van Holland beendete das Gespräch, nahm das Headset ab und warf einen letzten kritischen Blick in den Spiegel. Maik wusste noch nicht viel über die Familie, weil Reichert ein Fünf-Schritte-Programm für seine Einarbeitung aufgestellt hatte, das ihn langsam an die Aufgaben heranführen sollte. Am schlimmsten war es, mit Karl Hansen in der Zentrale die Monitore im Blick zu behalten – so wenig hatte er noch nie mit jemandem gesprochen, der stundenlang neben ihm gesessen hatte. Privat verbrachte er kaum Zeit am Computer oder an seinem Smartphone. Arbeit war Arbeit und Privatleben das, wofür man jeden Tag zur Arbeit ging. Da setzte er sich in seiner Freizeit nicht stundenlang hin, um seine Arbeitgeber zu googeln.
»Da sind Sie ja«, sagte van Holland, nahm beim Umdrehen seinen Mantel von der Garderobe und musterte Maik einen Augenblick. »Sie warten hier. Wenn sie fertig ist, fahren Sie sie nach Hause und bringen sie bis zur Haustür. Danach können Sie Feierabend machen.«
Sie?
»In Ordnung.« Gerne hätte Maik nachgefragt, wer mit sie gemeint war, aber Reichert hatte ihm mehrfach eingeschärft, nur dann Fragen zu stellen, wenn sie für den Schutz relevant waren. Diese Frage war es nicht, weil jede Person, die er bewachen sollte, mit vollem Einsatz geschützt werden musste. Maik hätte einfach seine Hausaufgaben machen müssen, um zu wissen, wer alles zur Familie gehörte, aber für ihn war das hier nur ein Job. Er bekam eine Aufgabe und erledigte sie.
Reichert öffnete die Tür und verließ mit van Holland die Wohnung. Sein Vorgesetzter lebte wahrscheinlich für seine Arbeit. Zumindest sah er nicht aus wie ein Mann, der ein Privatleben hatte. Niemand war unersetzlich. Für Maik war es undenkbar, sich für andere so sehr aufzureiben, nur um dann irgendwann festzustellen, dass sie einen nicht mehr brauchten und man absolut nichts von Wert besaß – nur Dinge, keine Freunde oder Familie.
Maik entspannte sich, als er alleine war und sich in Ruhe im Flur umschauen konnte. Der Eingangsbereich wirkte wie aus einem Einrichtungskatalog. Teuer, geschmackvoll und unpersönlich. Seit fünf Jahren war er bereits Personenschützer und hatte seiner Meinung nach so ziemlich alles gesehen. Was nützte Geld, wenn es die Reichen zu ignoranten Arschlöchern machte? Wenn man Fremde anheuerte, die aus einer Wohnung ein Ausstellungsobjekt machten, das so heimelig wie ein Hotelzimmer war?
Zeig mir, wie du wohnst, und ich sag dir, wer du bist.
Unruhig machte Maik ein paar Schritte, weil es langsam dringend wurde. Wenn er gewusst hätte, dass sein Einsatz noch länger dauerte, wäre er lieber bei einer Tankstelle aufs Klo gegangen, statt sich nun zu fragen, ob es ihm zustand, hier das Örtchen aufzusuchen.
»Hallo?« Er hoffte, dass die Klientin bald kam und der Auftrag schnell erledigt wäre, aber er hörte kein Geräusch, und es antwortete auch niemand.
Na super. Sie könnten wenigstens einen Stuhl hierhin dekorieren.
Nach zehn Minuten fing er an, im Kreis zu gehen.
Das Warten an sich störte ihn nicht, aber je mehr er versuchte, den Druck in der Blase zu ignorieren, desto deutlicher wurde er. Nach weiteren zehn Minuten ging er schließlich los und suchte das Badezimmer. Dabei horchte er aufmerksam, ob er die Frau irgendwo hören konnte. In der Regel beeilten sich die Kunden nicht, nur weil er wartete, da sie ihn dafür bezahlten, unaufdringlich rumzustehen und abrufbereit zu sein.
Die Wohnung war groß, vielleicht hundert Quadratmeter, allerdings nicht besonders geistreich geschnitten. Vom langen Flur gingen links und rechts Türen ab, geradeaus war das Wohnzimmer zu sehen. Wahrscheinlich befand sich auf einer Seite eine hippe offene Küche, in der die Reichen Weißwein tranken, während sie sich überteuertes Essen liefern ließen. Wenn der Job nicht so gut bezahlt werden würde, wäre Maik sicher nicht hier. Dies war nicht seine Welt. Er war in einer Sozialwohnung in Nettelnburg groß geworden, hatte die Gesamtschule besucht und seine halbe Jugend im Jugendzentrum oder beim Sport verbracht.
Hinter einer Tür entdeckte er ein Schlafzimmer. Das Licht war eingeschaltet, und ein Geldbündel lag neben dem zerwühlten Bett auf dem Nachtschrank.
Jetzt ist alles klar. Er zog die Tür wieder zu. Van Holland war nicht der erste reiche Sack, der sich teure Escort-Damen bestellte. Wahrscheinlich befand sie sich im angrenzenden Bad, das erklärte auch, warum er sie bislang weder gesehen noch gehört hatte. Was Peter van Holland hier getrieben hatte, ging ihn nichts an, er wollte nur wieder auf seinem Posten stehen, wenn sie fertig war.
Er horchte an der nächsten Tür, hinter der alles ruhig war, öffnete sie und betätigte den Lichtschalter an der Wand. Erleichtert, das Bad gefunden zu haben, trat er schnell ein und verschloss die Tür hinter sich.
Es roch nach Kräutern, und die Luft war feucht. Wahrscheinlich hatte van Holland vor Kurzem hier geduscht. Die milchige Glaswand der Badewanne war zugezogen, und dahinter brannte warmes Licht, das wahrscheinlich Kerzenschein imitieren sollte. Überhaupt war das Lichtkonzept sehr raffiniert: Die hochwertigen weißen Fliesen waren mit einem warmen Glanz überzogen. Er fragte sich, ob Leute wie van Holland diesen Luxus tatsächlich noch zu schätzen wussten. Maiks Wohnzimmer war kaum größer als dieser Raum, und sein Bad war ein Rechteck mit der Dusche hinter der Toilette. Platzsparend und zweckdienlich.
Er zog die Hose runter und setzte sich auf die Toilette. Als er es endlich fließen lassen konnte, erklang eine weibliche Stimme: »Sie tun dort doch wohl nicht gerade das, was ich denke, das Sie tun, oder?«
Erschrocken wollte er aufspringen und die Hose hochziehen, aber er konnte nicht mal eben aufhören. »Oh mein Gott, das tut mir leid, ich dachte …«
Er hörte sie lachen, sah eine Bewegung hinter dem Milchglas, das im nächsten Moment ein kleines Stück zur Seite geschoben wurde.
Maik nahm sich schnell ein Handtuch und legte es sich über den Schritt.
»Sehr löblich, Sie pinkeln im Sitzen«, sagte die Frau, die ihn durch den Spalt anblickte. Sie war vielleicht fünfundzwanzig Jahre alt. Ihre dunkelbraunen Haare umrahmten nass ihr Gesicht, und Schaum tropfte von ihrem Arm hinab.
»Ich habe lange in einer WG mit drei Frauen gelebt«, sagte er und senkte den Blick. »Tut mir wirklich unendlich leid. Wenn Sie mir eine Sekunde geben, versuche ich, möglichst würdevoll aus der Nummer wieder rauszukommen.«
Das, was er für eine Lampe gehalten hatte, waren tatsächlich Kerzen, die am Wannenrand brannten. Deswegen war das Licht ausgeschaltet gewesen.
»Sie sind also der Neue«, stellte sie fest. »Wissen Sie, wer ich bin?«
Sie machte keine Anstalten, wegzusehen, damit er sich anziehen konnte, also verharrte er. »Das wurde mir nicht mitgeteilt. Ich soll Sie nach Hause bringen.«
Mit einem Grinsen wedelte sie mit einer Hand in seine Richtung und lehnte sich hinter dem Sichtschutz zurück.
»Für so einen gut aussehenden Kerl sind Sie ganz schön schüchtern.«
Dankbar stand er auf und schloss schnell seine Hose wieder. »Privat nicht, aber im Job gelten andere Regeln. Ich bin nur froh, dass mir das nicht bei einem der van Hollands passiert ist. Sie werden mich doch nicht verraten, oder?«
Er betätigte die Spülung, wusch sich schnell die Hände und wollte zügig wieder gehen.
»Woher wissen Sie, dass ich keine van Holland bin?«
Es plätscherte, und dann sah sie ihn wieder mit einem frechen Grinsen an.
Maik versuchte, sie nicht direkt anzusehen, aber sie hatte etwas an sich, das es ihm schwer machte. Es schien fast so, als würde sich etwas miteinander verbinden, wann immer er ihrem Blick begegnete. »Ich habe das Geld auf dem Nachtschrank gesehen.«
Sie zog die Brauen empor, sodass feine Linien auf ihrer Stirn entstanden. »Die gute Beobachtungsgabe gehört wohl zum Job?«
Maik zuckte mit einer Schulter und drehte sich zur Tür. »Tut mir leid, ich wollte nicht indiskret sein.« Er musste schnell gehen, bevor er noch mehr sagte, was er nicht mal denken sollte.
»Na los, setzen Sie sich auf den Klodeckel. Es spielt keine Rolle mehr, ob Sie jetzt flüchten, also können Sie auch ebenso gut bleiben und sich mit mir unterhalten.«
Lass es, Alter, du weißt, dass das Ärger gibt.
»Nur ein paar Minuten, ein gutes Gespräch ist tatsächlich alles, was mir gerade fehlt«, setzte sie nach und lächelte gewinnend.
Zögerlich kam er ihrer Bitte nach. Das war wohl das seltsamste Kennenlernen, das er je erlebt hatte, aber er mochte diese verschwörerische Nähe, die schon bei diesem kurzen Wortwechsel zwischen ihnen entstand.
»Finden Sie es verwerflich, was ich tue?«, fragte sie herausfordernd.
»Absolut nicht«, sagte er ehrlich. »Ich verstehe nur nicht, warum Sie das tun. Ich meine, Sie scheinen sehr clever zu sein.«
»Warum tun Sie, was Sie tun? Riskieren Ihr Leben für fremde Leute. Genauer betrachtet erscheint mir das auch nicht sehr erstrebenswert.« Sie verschränkte ihre Arme auf dem Wannenrand und stützte ihr Kinn darauf.
»Nun, es ist das, was ich am besten kann.«
Seine Erwiderung brachte sie zum Lachen. »Sehen Sie. Da haben Sie Ihre Antwort.«
Maik rümpfte die Nase, bevor er die Reaktion verhindern konnte.
»Es ist sehr schade, dass Sie sich mich nicht leisten können, sonst würden Sie sehen, wovon ich spreche.«
Ein Zwinkern und ein breites Grinsen kennzeichneten ihre Worte als Scherz, aber die Bilder, die dadurch in seinem Kopf entstanden, gingen in eine Richtung, die er nicht mal in der Fantasie einschlagen durfte. Auch wenn sie eine Professionelle war, gebot es sein Job, sie wie jede andere Klientin zu behandeln.
Raus hier, bevor du es noch schlimmer machst!
»Tut mir leid.« Er stand auf und ging entschlossen zur Tür. »Ich warte vorn auf Sie«, sagte er schnell, rüttelte am Griff, drehte den Schlüssel und konnte endlich in den Flur hinaustreten.
Tolle Leistung, du Anfänger. Er ärgerte sich über sich selbst. Wenn sie ihre Dienste regelmäßig anbot, gehörte sie wahrscheinlich zum inneren Kreis der Angestellten. Wenn sie van Holland verriet, wie offen er mit ihr geredet hatte, gab es sicher einen Anschiss.
Aufm Klo zum Trottel gemacht.
Für diese Frau war das Flirten mit einem Angestellten sicher eine lustige Abwechslung, aber ihn konnte das den Job kosten. Und trotzdem musste er grinsen, als er neben der Wohnungstür wieder Position bezog.
Es dauerte noch eine halbe Stunde, bis er schließlich Schritte hörte und sie mit trockenen Haaren in einem schwarzen Kleid auf ihn zukam. Sie war gerade mal eins sechzig groß, schlank und so hellhäutig und makellos, als wäre sie aus Porzellan.
»Tut mir leid, dass Sie so lange warten mussten. Ich bade gern – nach meiner Arbeit.«
Maik senkte den Blick und legte eine Hand auf den Türgriff. »Wo darf ich Sie hinbringen?«
Sie nannte ihm eine Straße in Hamburgs Nobelgegend Harvestehude. Maik ging voraus, überprüfte den Flur und behielt auf dem Weg zur Garage alles im Blick.
»Oh, ganz im Beschützermodus, ja?« Ein leises Seufzen kam über ihre Lippen, als sie ihm folgte.
»Bitte entschuldigen Sie, was ich im Bad zu Ihnen gesagt habe. Das war unangebracht, es tut mir wirklich leid.« Über die Fernbedienung entriegelte er die Fahrzeugtüren eines schwarzen Mercedes S Guard. »Ich verspreche Ihnen, dass das nicht wieder vorkommen wird.«
»Ernsthaft?« Eine Spur Enttäuschung schwang in ihrer Stimme mit. »Es wird also nicht wieder vorkommen, dass Sie mich wie einen Menschen behandeln? Bin ich jetzt also die Prostituierte für Sie, die besser so behandelt wird, als wäre sie nicht da?«
Er öffnete ihr die Tür. »Nein, so sehe ich Sie gewiss nicht. Ich bin hier zu Ihrem Schutz, Sie sind meine Klientin.«
»Danke sehr«, sagte sie kühl und setzte sich auf die Rückbank. Jede ihrer Bewegungen war elegant und präzise. Maik musste aufpassen, sie nicht zu lange anzusehen. In all den Jahren war es ihm nicht ein einziges Mal passiert, dass ihn eine Klientin durcheinanderbrachte, aber sie war gefährlich nah dran. Er schlug die Tür zu und umrundete das Fahrzeug.
»Ich dachte, Sie wären anders«, sagte sie enttäuscht, als er sich auf den Fahrersitz setze.
»Würden Sie sich bitte anschnallen?«, überging er ihre Worte.
Sie legte ihre Tasche neben sich und verschränkte die Arme vor der Brust. »Ist das Ihr Ernst? Holen Sie gleich noch einen Kindersitz für mich hervor?«
Er drehte sich zu ihr um. »Ich bin für Ihre Sicherheit zuständig. Es muss ja einen Grund geben, warum Herr van Holland Sie nicht einfach mit einem Taxi nach Hause fahren lässt. Aber im Zweifelsfall kann ich Sie nicht beschützen, wenn Sie bei einem Unfall haltlos durch das Wageninnere geschleudert werden. Das ist pure Physik, dagegen bin ich machtlos. Also wären Sie bitte so freundlich und würden sich anschnallen?«
Diese kleine Rede zauberte ihr wieder ein Lächeln ins Gesicht. »Gut, ich schnalle mich an, wenn Sie sich weiter mit mir unterhalten.«
In Maik schrie alles, er solle sich bloß nicht auf den Deal einlassen. Er würde wieder etwas Unbedachtes sagen und sich letzten Endes noch mehr in Schwierigkeiten bringen. »Ist gut«, willigte er trotzdem ein. Er konnte nicht anders, weil es guttat, sich mit ihr zu unterhalten. Zwei Angestellte, die nicht so taten, als wäre Reden eine Todsünde.
Sie griff hinter sich, und Maik startete den Wagen. Als er das Einrasten des Gurtschlosses hörte, fuhr er los. Ginge es nach ihm, könnte man diese Luxusschlitten nicht ohne nervige Signaltöne bei Nicht-Anschnallen kaufen. Es war schizophren, dass so viel Geld für teure Autos und Sicherheitsmitarbeiter ausgegeben wurde, aber das simple Anlegen eines Sicherheitsgurtes zu viel verlangt war. Er hatte noch niemanden aussteigen sehen und dabei gedacht: Wow, der Anzug ist aber vom Gurt zerknautscht.
»Sind Sie Soldat gewesen?«
Sie war nicht die Erste, die ihn das fragte. Ihm wurde eine abgeklärte Ausstrahlung nachgesagt, obwohl in seinem neunundzwanzigjährigen Leben Schlägereien die einzigen Erlebnisse von echter Gewalt gewesen waren.
»Nein, ich bin Pazifist.«
»Pazifist und Bodyguard, das funktioniert?«
Maik grinste. »Sicher. Ich werde alles Notwendige tun, um Sie zu schützen, aber ich würde mir niemals befehlen lassen, irgendwo einzumarschieren.«
»Ach, wirklich?« Ihre Blicke trafen sich im Rückspiegel. »Auch dann nicht, wenn Sie damit Leben retten könnten?«
Er musste den Blick nach vorn richten, weil er ihr sonst zu lange in die Augen schauen würde. »Kommt auf die Verhältnismäßigkeit an. Wie viele Leben es kosten würde, ein Leben zu retten. Wer bestimmt denn, wessen Existenz wertvoller ist als die anderer?«
Mit einem Grinsen zog sie so lange am Gurt, bis sie sich weiter nach vorn setzen und die Arme auf die Lehne des Beifahrersitzes stützen konnte. »Und wenn es Terroristen sind, die Geiseln in ihrer Gewalt haben?«
Ein ähnliches Gespräch hatte er zuletzt mit Freunden im Irish Pub geführt. Es war in einem Streit ausgeartet, aber er konnte seine Meinung einfach nicht zurückhalten. Weder bei einem Bier noch jetzt vor seiner Klientin. »Dann wäre es aus unserer Sicht vielleicht gerechtfertigt, gewaltsam einzudringen, aber wie sieht es aus deren Sicht aus? Was, wenn sie das tun, weil sie keine andere Wahl haben? Weil mit unseren Waffen deren Familien getötet wurden, wir sie wirtschaftlich in den Ruin getrieben haben oder ihre Lebensgrundlagen zerstört worden sind? Ich meine, sollten wir nicht in einem Zeitalter leben, in dem Lösungen angebrachter sind als Gewalt?« Er mochte die Gewissensfrage nicht. Ginge es danach, müsste sich jeder Mensch jeden Tag fragen, ob er ein einwandfreies Leben führte. Ob den Lebensmitteln, die er im Supermarkt kaufte, keine Umweltsünden, Massentierhaltung oder Ausbeutung zugrunde lagen. »Ich denke, dass niemand, dem es gut geht und der einen gewissen Luxus genießt, nachempfinden kann, wie es jenen geht, die keine Perspektive mehr haben.«
»Das klingt stark vereinfacht«, sagte sie ernst.
»Im Grunde ist alles einfach, aber wir verkomplizieren es. Ich meine, weil die meisten von uns gute Menschen sein wollen, bewerten sie lieber die Symptome als die Ursachen.«
»Ach, und was ist Ihrer Meinung nach eine der Ursachen? Dass wir uns zu wenig um die Nöte anderer kümmern?«, fragte sie provokant.
»Dass es keinen Wohlstand ohne Not geben kann. Das Leben ist nicht fair. Derzeit sind wir die Gewinner, weil wir für wenig Geld sehr viel kaufen können. Aber um uns darüber keine Gedanken machen zu müssen, jammern wir rum und lassen uns durch die Medien die Themen diktieren, die uns zu beschäftigen haben.«
Sie lehnte sich wieder zurück und sah durch die getönte Scheibe nach draußen. »Na ja, aber Peter van Holland tut zum Beispiel viel Gutes mit seinem Vermögen. Ist das dann hilfreicher Luxus?«
»Soweit ich weiß, werden in seinen Fabriken Pestizide und Munition hergestellt. Klingt für mich eher nach …« Maik biss sich auf die Lippen. Sie hatte es tatsächlich geschafft, ihn aus der Reserve zu locken. Deswegen waren Frauen die besseren Spione. Gegen deren empathische Fähigkeiten war er einfach nicht gewappnet. Sie musste jetzt nur noch zum Alten gehen und petzen, damit Maik sich einen neuen Job suchen musste.
»Schadensbegrenzung?«, half sie aus. »Oder Beruhigung des Gewissens?«
»Nein«, wollte er es schnell herunterspielen, aber das war an diesem Punkt nicht mehr so einfach. »So meinte ich das nicht.«
»Schade, das wäre wenigstens ehrlich gewesen. Wenn ich seine Möglichkeiten hätte, würde ich das Geschäftsfeld wechseln.«
Maik sah sie durch den Spiegel an und glaubte ihr jedes Wort. »Ich denke, jeder kann etwas Gutes bewirken, wenn er es nur will.«
»Wirklich?« Mit einem Grinsen stützte sie sich wieder auf der Lehne ab, was sich wie eine Belohnung anfühlte, weil sie wieder näher kam. »Was tun Sie denn Gutes, außer die Gewinner des Weltmachtspiels zu beschützen?« In ihrer Stimme schwang ein amüsiertes Zwinkern mit.
»Ich werde eine Schule für Kampfsport eröffnen. Eine mit Förderprogrammen für sozial benachteiligte Kids und Talente. Ich wäre heute nicht der Mensch, der ich bin, wenn mich damals niemand gefördert hätte.« An dem Konzept für seine Kampfsportschule feilte er schon seit elf Jahren.
»Klingt nach einem Vorhaben mit viel Finanzierungsbedarf. Dafür werden Sie Sponsoren brauchen.«
»Sponsoren bedeuten immer Erfolgsdruck und Einmischung. Ich will das Ganze etwas größer aufziehen, weswegen ich erst loslegen werde, wenn ich das nötige Kapital zusammenhabe. Für diese Schule benötige ich Mitarbeiter, die den Unterricht mit übernehmen, und ein Segment soll nur für die Ausbildung von professionellen Personenschützern oder Mitarbeitern von Sicherheitsdienstleistern sein. Wenn das anläuft, finanziert es die sozialen Projekte, verstehen Sie?«
Im Spiegel sah er ihr Nicken. »Wenn Sie das richtig angehen, könnte es was werden. Wie lange müssen Sie dafür noch Ihren Kopf für Leute wie mich hinhalten?«
Diese Frage machte aus seinen enthusiastischen Plänen eine realitätsgebeutelte Idee. »So wie es derzeit aussieht, vielleicht acht bis zehn Jahre.«
Er fühlte ihre Hand auf seiner Schulter, was ihm einen unerwarteten, angenehmen Schauer über den Rücken jagte. »Sie sollten vielleicht doch an Sponsoren denken«, sagte sie und lehnte sich dann wieder zurück. »Wie alt sind Sie? Mitte zwanzig?«
»Neunundzwanzig. Ich mag einen schlechten ersten Eindruck hinterlassen haben, aber ich weiß genau, was ich tu, sonst dürfte ich Sie jetzt nicht nach Hause fahren. Herr Reichert scheint sehr wählerisch bei der Auswahl seiner Mitarbeiter zu sein.«
Sie verdrehte die Augen und sah aus dem Fenster. »Ja, ich weiß. Und trotzdem nervt dieser ganze Zirkus.«
Maik atmete tief durch, aber er konnte nicht aus seiner Haut. Er redete gern mit Menschen, mochte es, sie kennenzulernen, und vertraute lieber auf sein Bauchgefühl als auf seine Vernunft. »Herr van Holland ist ein sehr wohlhabender Mann. Ich bin mir sicher, dass die Presse großes Vergnügen daran hätte, eine Verbindung zwischen Ihnen und ihm herzustellen. Die warten nur auf solche Skandale. Indem er Sie davor beschützt, belästigt zu werden, schützt er auch sich selbst.«
»Finden Sie, dass es ein Skandal ist, was er mit mir macht?«
Maik umfasste das Lenkrad fester und suchte nach einer Möglichkeit, seine Meinung positiv zu verpacken. »Ich denke, man sollte kein Urteil fällen, wenn man die Hintergründe nicht kennt«, antwortete er schließlich so diplomatisch wie möglich, was wieder eine Brücke zum vorigen Thema schlug.
Diese Antwort schien ihr zu gefallen. Mit einem Lächeln zog sie ihr Telefon aus der Tasche und wählte eine Nummer. Das gab Maik etwas Zeit, sich auf den Verkehr zu konzentrieren und über die Konsequenzen dieser Unterhaltung nachzudenken. Er musste damit rechnen, dass sie ihn testete, was bedeutete, dass er bereits durchgefallen sein konnte.
»Hier ist Lynn«, sagte sie nach einer Weile. »Solange Gerrit krank ist, möchte ich, dass …« Sie hielt kurz den Hörer zu. »Wie heißen Sie?«
Maik sah im Spiegel, dass sie ihn meinte. »Maik Thomer.«
»Ich möchte, dass der Neue, Maik Thomer, Gerrit so lange vertritt … Nein, das ist mir egal. Sie wissen, dass ich ein Mitspracherecht habe, und davon mache ich jetzt Gebrauch. … Wollen Sie wirklich, dass ich das mit ihm ausdiskutiere? … Fein. … Ich habe Ihren Einwand zur Kenntnis genommen.« Sie legte ohne Verabschiedung auf. Anscheinend bedeutete sie Peter van Holland mehr als eine gewöhnliche Escort-Dame, wenn sie so mit Reichert sprechen durfte. Maik hatte keinen Zweifel daran, wer am anderen Ende gewesen war, weil die Leitung der Sicherheitsabteilung in dessen Zuständigkeit lag.
Es beunruhigte Maik, wie sehr ihm die Aussicht gefiel, Lynn weiterhin zu chauffieren. Alles war tausendmal besser, als in der Zentrale des Schweigens sein Dasein zu fristen, aber die Vorstellung, die nächsten Tage mit ihr zu verbringen, fühlte sich an, als habe er eine Packung Streichhölzer in einer Feuerwerksfabrik geschenkt bekommen.
»Nun machen Sie sich bitte wieder locker. Wenn ich Ihnen vertrauen soll, dann dürfen Sie nicht so zugeknöpft sein. Ich weiß, Reichert ist in diesem Punkt sehr streng mit seinen Leuten, aber Sie sind noch nicht so lange dabei, vielleicht habe ich Sie ja rechtzeitig da rausgeholt? Sie sagen, was Sie denken, das gefällt mir.«
Einen Herzschlag zu lange erwiderte er Lynns Blick und musste sich dann irritiert abwenden.
Ist das gerade tatsächlich passiert? Es fühlte sich an, als habe ihn ein leichter Stromschlag getroffen, obwohl sie einander nur in die Augen geschaut hatten. Maik war kein Mann, dem Gefühle schnell in die Quere kamen, vor allem nicht auf diese Weise – und schon gar nicht, wenn sie Ärger bedeuten konnten. Doch dieses Kribbeln hallte nach und kroch in Winkel seiner Brust, die er noch nie gespürt hatte.
»Sie kennen Reichert und seine Leute wohl sehr gut«, sagte er, damit die Pause nicht zu lang wurde.
»Ich mag ihn und seine Hunde nicht. Man weiß nie, was in deren Köpfen vor sich geht. Mir sind unbedachte Kommentare lieber als eine unausgesprochene Wertung.«
Genauso sah er das auch. »Wie lange kennen Sie Herrn van Holland schon?«
Sie winkte ab. »Schon eine Ewigkeit.« Dann deutete sie auf eine Einfahrt. »Fahren Sie bitte in die Tiefgarage. Sie müssen den rechten Schalter betätigen, der linke ist für das Anwesen.«
Maik drückte oberhalb des Rückspiegels auf den rechten Knopf, und das Tor öffnete sich.
Der Bau passte nicht ganz zu den herrschaftlichen Häusern der Nachbarschaft, aber zweifelsohne musste man gut verdienen, um hier zu leben. Allein die Gegend war nahezu unbezahlbar, und dieses Gebäude hätte mit all den Sicherheitsvorkehrungen ebenso gut aus Gold sein können. Ein Wachmann saß neben dem Garagentor in einem Anbau mit großen Fenstern. Überall waren Kameras angebracht, die nach Maiks Einschätzung keinen toten Winkel übrig ließen.
»Hier wohnen Sie?«, fragte er.
Sie schnallte sich ab und rutschte nach vorn, um ihre Arme wieder auf den Beifahrersitz zu stützen und das Kinn auf einen Unterarm zu lehnen. »Nun, ich bin jeden Cent wert.«
Bei dieser Anspielung kribbelte es wieder in seiner Körpermitte, wobei es weniger um die Vorstellung ging, wie sie wohl im Bett war, sondern eher der Wunsch aufkam, mehr von ihrer Nähe zu spüren. Das Verlangen war da und ließ sich nicht mehr wegschieben.
Maik parkte den Wagen direkt neben dem Fahrstuhl, schaltete den Motor aus und drehte sich zu ihr um. Nur wenige Zentimeter trennten sie voneinander. Sie sah ihm in die Augen, und für einige Herzschläge sagte niemand etwas. Zumindest nicht mit Worten. Es lag eine Mischung aus Wahrheit, unverhohlener Zuneigung und Bedauern in diesem Blick. Als wäre die Essenz dieses Moments das Wissen, dass zu einer anderen Zeit an einem anderen Ort diese Begegnung der Beginn von etwas hätte sein können. Maiks Herz schlug schneller, was die Situation nicht besser machte.
»Wie genau läuft das jetzt? Stehe ich auf Abruf bereit, wenn Sie Herrn van Holland treffen? Oder fahre ich Sie auch zu Ihren anderen Terminen?«
Maik fand es verachtenswert, wie verschwenderisch Reiche mit Geld umgingen, wenn es um ihren persönlichen Luxus ging. Mit dem, was Lynn anscheinend für einen Abend bekam, hätte er ganz andere Dinge tun können. Bessere Dinge, die nicht nur im eigenen Interesse gewesen wären. Und je mehr er sie mochte, desto schwerer fiel es ihm, ihrem Beruf neutral gegenüberzustehen. Jemand wie sie sollte sich nicht für Geld hergeben, aber sie schien es tatsächlich gern zu tun. Das unterschied sie wohl am meisten voneinander. Er war ein guter Personenschützer, aber er tat es nicht, weil er so gern sein Leben aufs Spiel setzte.
»Wann immer ich meine Wohnung verlasse, werden Sie mich begleiten. Ich versuche, meine Termine so zu planen, dass Sie noch so etwas wie ein Privatleben pflegen können, aber Ihnen wurde sicher mitgeteilt, dass es keine festen Arbeitszeiten geben wird, oder?«
Maik nickte bestätigend. Seine Freunde kannten das schon von seinen anderen Einsätzen. Es gefiel ihnen nicht, aber sie akzeptierten, dass es zu seinem Job gehörte. Es war seltsam, in diesem Augenblick an seine Freunde zu denken – besonders Lisa würde ihm sicher eine Standpauke wegen seines Verhaltens halten. Die Gedanken waren wie ein Rettungsring, der ihm zugeworfen wurde, damit er nicht in Lynns Welt zu ertrinken drohte.
»Darf ich fragen, zu wie vielen Kund… äh, Terminen Sie in der Woche so fahren?«
Lynn stieg aus und nahm ihre Tasche vom Sitz. »Das ist ganz unterschiedlich.«
Er wollte gerade ebenfalls aussteigen und sie begleiten, aber Lynn schüttelte den Kopf. »Ich bestimme, wann Sie mich nach oben begleiten dürfen. Dieses Haus ist gesichert wie Fort Knox. Sollte ich Sie je mit raufbitten, dann sicher nicht als mein Bodyguard.« Sie zwinkerte ihm vielsagend zu und ging.
Trotzdem stieg er aus und folgte ihr. »Herr van Holland sagte, ich solle Sie bis zur Wohnungstür bringen.«
Sie drückte auf den Fahrstuhlknopf und lächelte ihn bezaubernd an. »Sie werden sehr schnell merken, dass bei mir nicht alles so läuft, wie Peter van Holland es haben will. Ich bin nicht sein Eigentum, und dies ist mein Reich, nicht seines.«
Maik blieb stehen, während sie in den Fahrstuhl stieg und sich die Türen hinter ihr schlossen.
Junge, wenn du aus diesem Job heil wieder rauskommen willst, solltest du dich gut unter Kontrolle haben.
Kapitel 2
Im Shamrock war donnerstags um diese Zeit nicht mehr viel los, aber Lisa und Jonas warteten noch auf ihn. Sie hatten schon ein paar Guinness Vorsprung, aber laut Vertrag durfte Maik während der Bereitschaft sowieso nichts trinken, und die ging noch bis zwei Uhr nachts. Den Wagen hatte er in der Garage von Lynns Wohnhaus gelassen und den Schlüssel beim Sicherheitsmann hinterlegt. Es reichte ihm, dieses teure Geschoss beruflich zu fahren, ins Schanzenviertel würde er sich mit der Bonzenkiste nicht wagen. Er wohnte nur wenige Meter vom Irish Pub entfernt. Wenn er gerufen wurde, war er mit seinem Motorrad eh schneller überall dort, wo er gebraucht wurde.
»Na, heute wieder überbezahlte Langeweile ausgehalten?«, begrüßte ihn Lisa und schwankte leicht, als sie aufstand, um ihn zu umarmen. Maik begrüßte Jonas ebenfalls mit einer knappen Umarmung und setzte sich an den Tisch. »Ihr werdet nicht glauben, was meine neue Aufgabe ist.«
»Du musst jetzt mit dem Familienpudel Gassi gehen?«, mutmaßte Jonas und gab mit einer Hand dem Wirt ein Zeichen für eine weitere Runde.
»Für mich eine Cola, bitte«, rief Maik.
»Cola?« Lisa schüttelte den Kopf. »Das sind ja ganz neue Sitten.«
»Ich habe Bereitschaftsdienst. Also …«
Die Tür ging lautstark auf, und ein Paar setzte sich an einen der anderen Tische, weshalb Maik lieber kurz verstummte. Es war eine Sache, mit Lisa und Jonas über seinen Job zu reden, aber eine ganz andere, wenn Außenstehende das mitbekamen. Maik beobachtete das Paar ein paar Herzschläge lang. Der Mann machte einen alkoholisierten und die Frau einen eingeschüchterten Eindruck.
»Oh Mann, ich werde nie verstehen, warum hübsche Frauen mit solchen Typen zusammen sind«, kommentierte Lisa, die ebenfalls hinsah.
Maik nickte nur. Die Frau war blond, vielleicht Mitte zwanzig und sah in ihrer Jeans und der roten Bluse sportlich und locker aus. Wie eine, die eigentlich ganz selbstbewusst war, aber ihre Körpersprache besagte eher das Gegenteil. Während ihr Begleiter lautstark zwei Guinness bestellte, machte sie sich auf der gegenüberliegenden Seite des Tisches ganz klein.
»Lass gut sein«, sagte Lisa und legte Maik eine Hand auf den Arm. Wahrscheinlich hatte sie seine Fäuste bemerkt, bevor er selbst überhaupt mitbekommen hatte, dass er die Hände anspannte.
»Du kannst sie nicht alle retten«, setzte sie nach. »Erzähl jetzt endlich, was deine neue Aufgabe ist.«
Maik drehte sich wieder zu seinen Freunden um, auch wenn die laute Stimme dieses Kerls einen Teil seiner Aufmerksamkeit weiterhin beanspruchte. Er konnte es nicht abstellen, ständig alles im Auge behalten zu müssen, selbst wenn es ihn nichts anging. Damit er leise sprechen konnte, lehnte er sich vor und stützte sich mit beiden Unterarmen auf dem Tisch ab. Lisa und Jonas taten es ihm gleich. Sie waren ein eingeschworenes Team, was Maiks Leben eine gewisse Stabilität verlieh. Allein die Tatsache, dass er mit ihnen über alles reden konnte, half ihm, bessere Entscheidungen zu treffen. »Stellt euch vor, ich bin jetzt offiziell der Bodyguard von Peter van Hollands Mätresse.«
Lisa schlug amüsiert eine Hand vor den Mund. »Ist das dein Ernst? Der hat eine Mätresse?«
Maik legte einen Finger über die Lippen und grinste. »Ihr wisst ja, dass ich euch das nicht erzählen darf.«
Kopfschüttelnd winkte sie ab. »Als wenn wir je irgendwas ausplaudern würden. Wie ist sie so? Ich wette, sie ist eine ganze Ecke jünger, oder?«
Maik musste an Lynn denken. Sie war so wunderschön und besonders, er mochte sich gar nicht vorstellen, dass der alte van Holland sie anfasste. »So alt wie wir, würde ich sagen. Und sie spielt in einer Liga, die wir uns niemals leisten könnten. Einer wie ihr bin ich noch nie begegnet.«
»Wow, wenn sie keine Professionelle wäre, würde ich glatt sagen, du hast dich verknallt. Sollen wir für dich zusammenlegen?« Der Scherz gefiel ihm nicht. Vielleicht deshalb nicht, weil sie das Körnchen Wahrheit gefunden hatte, das er so gern verbergen wollte, oder es lag daran, dass er sich nicht vorstellen mochte, dass sie für Geld mit ihm schlafen würde. Maik könnte niemals für Sex bezahlen. So ein klar definiertes Arrangement war sicher für manche Menschen sehr zweckdienlich, aber er mochte es, wenn sich Intimität entwickelte. Dieses gewisse Knistern vor dem ersten Kuss, das Kribbeln in den Fingern bei den ersten Berührungen, die Erlebnisse, die zu gemeinsamen Erinnerungen wurden. Zwar sprach seine Beziehungsbilanz nicht gerade für seine Romantikkompetenz, aber sie war dennoch ausgeprägt genug, um aus Zwischenmenschlichkeit keine Transaktion zu machen.
»So viel würdet ihr nicht zusammenbekommen«, ging er trotzdem auf ihren Scherz ein, um nicht zu zeigen, wie sehr Lynn ihn durcheinanderbrachte.
In Jonas’ Kopf schien die Kostenfrage eine mathematische Gleichung nach sich zu ziehen. Wahrscheinlich steckte er gerade die finanzielle Obergrenze für leistbare Liebesdienste ab, ohne sich bewusst zu machen, dass es dabei um Sex ging.
»So teuer, ja?« Lisa trank von ihrem Guinness und zuckte mit einer Schulter. »Dann muss sie ja richtig gut sein.«
Maik rief sich das Kennenlernen in Erinnerung. Das war mit Sicherheit der peinlichste und gleichzeitig reizvollste Augenblick seines Lebens gewesen. Jede andere hätte ihn angeschrien und sofort aus dem Bad geworfen, aber Lynn war so anders als jede Frau, die er bislang kennengelernt hatte.
»Sie ist besonders«, sagte er und wich ihrem Blick aus.
»Oh Mann, du hast dich wirklich verknallt, oder?« Lisa konnte er nichts vormachen, auch wenn er es immer wieder versuchte.
»Nein, sie hat mich mit ihrer Art nur überrascht, das ist alles. Ich fange doch nichts mit einer Klientin an, das bringt nur Ärger.« Das Geschehen am anderen Tisch lenkte ihn erneut ab. Der Kerl hatte den Platz gewechselt, saß nun neben der Frau auf der Bank und stritt mit ihr, ohne dass Maik verstehen konnte, worum es ging. Sie rutschte zur Wand und drückte ihn wenig wehrhaft von sich. Was den Mann dazu brachte, sich noch größer zu machen und bedrohlich eine Hand zu heben.
»Tut mir leid, ich kann das nicht«, sagte Maik zu Lisa und stand auf.
Bis zu dem Tisch waren es nur wenige Meter. »Hey, belästigt Sie der Kerl?«, fragte Maik und blieb zwei Schritte entfernt stehen.
Sie sah ihn verschreckt an, was ein deutliches Ja signalisierte, aber mit ihrer Stimme sagte sie Nein.
»Verpiss dich«, ranzte der Mann trunken.
Aus dem Augenwinkel sah Maik, dass der Wirt einen Baseballschläger unterm Tresen hervorzog. Wer John länger kannte, wusste, dass dieser nicht mehr als eine Drohung darstellte. John war zwar ein alter Hund, aber Handgreiflichkeiten überließ er, wenn möglich, der Polizei. Maik hatte keine Lust, den Abend mit einer Fahrt in einem Streifenwagen ausklingen zu lassen. »Ich mach das schon«, rief er John zu. Dann sah er dem Kerl fest in die Augen. »Ich denke, es ist besser, wenn du jetzt gehst und deinen Rausch ausschläfst.«
»Lass uns verschwinden«, drängte die Frau, vielleicht kannte sie ähnliche Situationen bereits. Ihre Hände zitterten, als sie ihren Begleiter vorsichtig am Arm berührte, aber er schüttelte sie mürrisch ab. »Sag mir nicht, was ich zu tun habe, klar?«
»Das ist Ihre Gelegenheit, nicht mit ihm mitzugehen.« Maik ließ ihn nicht aus den Augen.
Der Kerl griff in ihre Haare und zog sie an sich. »Was soll das werden? Willst du meine Kleine ficken? Ist es das?«
»Nicht, Ruven, du tust mir weh.« Sie umfasste seine Hand und wirkte noch ängstlicher als vorher.
Unschlüssig wartete Maik ab. Er wollte nichts Unbedachtes tun. Nicht selten standen solche Frauen zu ihren tyrannischen Männern. Als wäre die Gewalt in der Beziehung ein zu akzeptierender Makel eines unverstandenen Liebenden. Frauen hatten ihn schon mehrfach angebrüllt, weil er ihnen geholfen und ihre Macker niedergeschlagen hatte. Auch auf so eine Szene hatte er definitiv keine Lust, er konnte nur nicht untätig danebensitzen, wenn jemand so offensichtlich genötigt wurde. Wenn er ihr seine Hilfe nicht angeboten hätte, hätte ihn die ganze Nacht die Frage wach gehalten, ob es falsch gewesen war, nichts gesagt zu haben.
Dieser Ruven schien ganz eigene Gedanken durchzukauen. Er taxierte Maik, hielt dabei seine Freundin fest und erweckte den Eindruck, jeden Augenblick die Kontrolle über sich zu verlieren.
»Gehst du jetzt freiwillig, oder muss ich dir Beine machen?«, setzte Maik nach.
Der Kerl stieß seine Freundin weg, sprang von der Bank auf und zielte mit einem Schwinger direkt auf Maiks Kopf. Dank seines Trainings konnte Maik gerade noch ausweichen. Dafür, dass der Mann getrunken hatte, wirkten seine Bewegungen ziemlich kraftvoll und präzise.
»Ich mach dich fertig, du Arsch!«, kündigte er an und ging weiter auf Maik los.
Maik wich erneut aus, nutzte die Bewegung seines Angreifers, versetzte ihm einen Stoß und sah zu, wie er gegen die Theke stolperte. Wütend nahm der Kerl ein Glas von der Arbeitsfläche dahinter und warf es nach Maik, traf jedoch den Tisch. Das Glas zerbrach, und einige Scherben trafen die Frau.
»Ich rufe jetzt die Polizei«, rief John und griff zum Telefon.
»Nein, schon gut«, sagte Maik. »Wir klären das vor der Tür!« Er ging vor und war froh, dass der Kerl folgte.
Kampfbereit drehte er sich direkt hinter der Tür um. Männer wie Ruven besaßen keine Ehre, keinen Kodex oder Anstand, weshalb Maik ihm nicht länger als nötig den Rücken zudrehte. Rückwärts ging er von ihm und den Fenstern weg. Die Frau und seine Freunde sollten bei dem Kommenden nicht zusehen.
»Du hast es so gewollt«, sagte der Kerl und ließ die Tür hinter sich zufallen.
Lisa und Jonas würden drinnen warten, das zählte zu den Grundregeln ihrer Freundschaft: Egal was passierte, sie mussten ihm versprechen, in brenzligen Situationen immer im Hintergrund zu bleiben. Maik konnte sich nicht auf einen Kampf konzentrieren, wenn Menschen in der Nähe waren, die er liebte und die verletzt werden konnten.
»Noch kannst du einfach nach Hause gehen und ausnüchtern«, bot Maik an. »Ich will dir nicht wehtun.«
Nun lachte der Kerl. »Du mir? In deinem feinen Anzug? Ich werde mit dir den Boden aufwischen!«
Maulheld. »Dann komm, wenn du dich traust.« Es war wichtig, dass der andere anfing. Solange Maik der Frau half oder sich selbst verteidigte, käme er nicht in Schwierigkeiten.
Mit einem wütenden Aufschrei stürzte der Kerl auf Maik los, schwang die Fäuste, denen Maik spielend leicht ausweichen konnte. Rückwärtsgehend ließ er ihn ein paar wilde Schwinger ausführen, manche blockte er ab, andere trafen ihn gar nicht erst, weil er ihnen ausweichen konnte. Offensichtlich war der Typ kein geübter Schläger, aber ein Treffer konnte durchaus sehr schmerzhaft sein.
Dann packte Maik den anderen am Kragen, wuchtete ihn gegen die Wand und schlug ihm so ansatzlos ins Gesicht, dass der Kerl nicht mal mehr die Fäuste heben konnte. Einmal, zweimal, so oft, bis Blut aus der Nase lief und sein Gegner keine Anstalten mehr machte, diesen Kampf fortzuführen.
»Du gehst jetzt nach Hause«, sagte Maik beherrscht. »Du wirst diese Frau nie wieder anfassen und am besten auch nie wieder ansprechen. Wenn ich dich hier nochmals sehen sollte, werde ich nicht so zimperlich mit dir umgehen, ist das klar?«
Er schubste ihn von sich und beobachtete, wie der Kerl stolperte und sich an der Wand abstützen musste. Aber immerhin: Er torkelte davon.
Maik sah an sich hinab. Der Anzug schien nichts abbekommen zu haben, lediglich seine Hand war von den Schlägen etwas wund. Bevor er wieder in den Pub ging, atmete er mehrfach durch, rieb sich übers Gesicht und vergewisserte sich mit einem schnellen Blick, dass dieser Ruven nicht wieder umdrehte.
In ihm war alles ruhig. Es bescherte ihm keinen Kick, sich zu prügeln, in dieser Form baute er auch keinen Stress ab, wie es beim Training der Fall war. Er war gut darin, zu tun, was getan werden musste, deswegen war er Personenschützer geworden, aber Gewalt machte etwas mit ihm, das er nicht mochte. Als würde er jedes Mal seinem alten Ich ins Gesicht schauen, sobald er auch nur die Fäuste ballte. Nach Handgreiflichkeiten fühlte er sich wie ein Schwindler, der versuchte, zu leugnen, wer er tatsächlich war. Er gehörte nicht in Lisas oder Jonas’ Kreise, auch wenn sie nicht müde wurden, ihm das Gegenteil zu beweisen. Die Unterschicht war wie eine zweite Haut, die unter diesem teuren Anzug verborgen seine Persönlichkeit umspannte.
Er öffnete die Tür und ging wieder hinein. John nickte ihm dankbar zu, Lisa hatte die Fremde zu ihnen an den Tisch geholt und drückte ihr ein Taschentuch auf eine kleine Wunde an der Wange.
»Ein Splitter hat sie getroffen«, erklärte sie und sah auf Maiks Hand, die von den Schlägen deutlich gerötet war. »Hast du …«
Sie unterbrach sich, aber Maik wusste genau, was sie fragen wollte.
»Es geht ihm gut, er kommt sicher nicht wieder. Wahrscheinlich wird er ein paar Tage etwas lädiert aussehen, aber ich bin ruhig geblieben.« Maik hatte nicht mitgezählt, wie oft Lisa und Jonas in den vergangenen Jahren mit ihm in der Notaufnahme gesessen hatten oder ihn von einem Polizeirevier abholen mussten. Seine Kampfsport- und Personenschutzausbildung wurde bei Auseinandersetzungen anders gewertet. Da er genau wusste, was er tat, musste er sich zwingend im Rahmen der Verhältnismäßigkeit bewegen. Er konnte es sich nicht leisten, aus Eifersucht einen Rivalen zu verprügeln oder auf Provokationen mit Gewalt zu antworten. Was in seiner Jugend zum Alltag gehört hatte, konnte ihn nun mit Leichtigkeit in den Knast bringen. Lisa und Jonas kannten seine Vergangenheit. Sie wussten, was für ein Mensch er mal gewesen war und wie hart er dafür arbeitete, ein anständiges Leben zu führen. Sie wussten nur nicht, wie wenig er selbst seine Vergangenheit abschütteln konnte. »Der Spaziergang in der Kälte wird ihm guttun.«
Erleichtert schenkte ihm Lisa ein Lächeln. »Was wäre die Welt nur ohne dich?«
»Vielen Dank«, sagte die Fremde. »So was hat noch nie jemand für mich getan.«
Sie hielt ihm eine Hand entgegen. »Ich bin Andrea.«
»Maik.« Er schüttelte ihre Hand, die sich kalt und zittrig anfühlte. »Wie geht es bei dir jetzt weiter?« Dass sie sich mit Vornamen vorgestellt hatte, verstand Maik als Einladung zum Du.
»Wir sind nicht zusammen gewesen«, sagte sie und nahm Lisas Taschentuch an sich, das sie weiterhin auf die kleine Wunde drückte. »Wir gehen seit ein paar Wochen miteinander aus, seit wir uns über eine App kennengelernt haben. Er war eigentlich ganz nett, etwas aufdringlich vielleicht, aber es war trotzdem lustig gewesen … bis er heute anfing zu trinken.«
Maik war froh, dass sie keine von jenen war, die darauf standen, erniedrigt zu werden. »Wird er dich in Ruhe lassen?«
»Keine Ahnung. Er weiß, wo ich wohne. Das ist nicht weit von hier, gut möglich, dass er vor meiner Tür auf mich wartet.«
Lisa sah Maik mit ihrem »Na los, spiel den Helden«-Blick an. Wahrscheinlich war für sie der positive Aspekt dieses Vorfalls die Begegnung mit einer schönen Frau. Ihr Faible für schicksalhafte Augenblicke lehnte jeglichen Glauben an Zufälle ab. Dass Maik ihr trotzdem zustimmte, hatte andere Gründe. Das Schicksal hatte in Gestalt einer Escort-Dame auf dem Rücksitz der Limousine gesessen und ihn angelächelt. Sein Bedarf an Fortunas Einmischung war also längst gedeckt.
Alberner Aberglaube.
»Sag, wenn du gehen möchtest, ich bringe dich dann nach Hause«, sagte er zu Andrea. »Sollte er vor der Tür sitzen, regle ich das schon.«
Mit einem glücklichen Lächeln sah sie ihm in die Augen. Er kannte diesen Blick. Frauen mochten es, von ihm beschützt zu werden. Viel zu schnell verliebten sie sich in die Vorstellung, einen Ritter in schimmernder Rüstung an ihrer Seite zu wissen, was immer in Enttäuschungen endete, weil er eben Maik war. Nicht »Sir Maik« oder »Drachentöter Maik«, sondern der Maik, der unregelmäßige Arbeitszeiten hatte, der sich feste Ziele setzte, für die er sich ins Zeug legte, und der keinen Sinn für große Gesten besaß. Lynn hatte ihn nicht so angesehen, und er hoffte, dass sich daran nichts ändern würde, müsste er sie je aus einer bedrohlichen Situation freikämpfen.
»Bei welcher App hast du den Typen denn kennengelernt?«, fragte Lisa und lenkte Andrea von ihm ab.
»CityLove. Die Beschreibung klang ganz gut, aber ich fürchte, ich bin für solche Sachen nicht geschaffen. Wie soll man nach so kurzer Zeit sagen können, ob jemand zu einem passt oder nicht?« Verschämt sah sie zu Maik. »Ruven ist vorher ganz anders gewesen, vielleicht hat er heute gemerkt, dass ich ihm einen Korb geben wollte. Als wir uns heute wiedergesehen haben, nannte er mich gleich sein Mädchen und tat so, als wären wir fest zusammen. Und dann lief es nicht so, wie er sich das vorgestellt hatte …«
»Jetzt bist du ihn los«, sagte Lisa auf ihre freundschaftliche Art. Das war eine ihrer besonderen Stärken, sie konnte Fremden das Gefühl geben, einer alten Freundin zu begegnen. So hatte sie damals auch Maik in den Bann geschlagen. Vom ersten Moment an waren sie befreundet gewesen, und ehe er sichs versehen hatte, wusste sie alles über ihn und vermittelte ihm erstmals das Gefühl, akzeptiert zu werden, so wie er war.
»Jedenfalls hättest du in keiner besseren Bar landen können. Maik ist Personenschützer, er weiß, was er tut.« Der Stolz, mit dem sie das betonte, ehrte ihn, aber wenn Lisa anfing, ihn einer Dating-Willigen anzupreisen, musste er das schnell unterbinden.
»Das habe ich gesehen«, sagte Andrea und lächelte ihn wieder an. »Ich mag mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn wir woanders hingegangen wären.«
Maik konnte es sich vorstellen. Wahrscheinlich hätte sie den Sex lieber über sich ergehen lassen, damit er ihn nicht gewaltsam erzwang. Schon deshalb musste Maik genügend Geld verdienen, um seinen Traum von einer Kampfschule zu verwirklichen. Er würde Frauen beibringen, sich effektiv gegen solche Schweine zu wehren.
»Wohnt ihr in der Nähe?« Selbst wenn Andrea Jonas und Lisa ansah, galt die Frage eigentlich Maik.
»Bis zu uns ist es noch ein ganzes Stück, aber Maik wohnt hier in der Marktstraße. Und du?«
»In der Lippmannstraße.«
Maik kannte die Straße, im Grunde kannte er in dieser Gegend fast jede Straße. Wenn er sie nach Hause brachte, würde ihn der Weg hin und zurück maximal zwanzig Minuten kosten.
»Ich bin gerade erst hergezogen«, fügte sie an. »Ich habe vorher in Bergedorf gelebt.«
»Lustig, da kommst du doch auch her«, lenkte Lisa das Gespräch in eine Richtung, die Maik nicht behagte. Er schob die Ärmel hoch. Dabei fiel sein Blick auf das Gerät an seinem Handgelenk. Das kleine Kontrolllämpchen zeigte an, dass der Tracker noch immer aktiv war. Verdammt. Er drückte zwei Sekunden auf das Knöpfchen, und das Lämpchen erlosch. »Fast, ich bin in Nettelnburg groß geworden. Aber das müssen wir jetzt wirklich nicht vertiefen.«
Er sah Lisa eindringlich an, woraufhin sie unauffällig nickte und das Thema wechselte. »Du solltest lieber ausgehen, statt diese Apps zu nutzen. Soweit ich weiß, wird CityLove eher für Sexdates verwendet. Wer sich da anmeldet, hat gar kein Interesse an einer Beziehung.«
Andrea senkte den Kopf und musste grinsen. »Ja, das habe ich inzwischen auch gemerkt. Ich bekomme da sehr schräge Nachrichten.« Sie wagte einen kurzen Blick zu Maik. »Ich habe gerade eine schwierige Trennung hinter mir, ich weiß nicht mal, warum ich mich überhaupt angemeldet habe. Im Grunde lande ich immer wieder bei demselben Typ Mann, der anfänglich charmant ist und dann Besitzansprüche stellt, sobald wir zusammen sind. Warum muss das immer so sein? Ich meine, wir sind doch keine Teenager mehr. Was ist so schlimm daran, sich ein paar Freiräume zu gönnen?«
Diese Aussage brachte Lisa wieder dazu, Maik unauffällig nonverbale Botschaften zu schicken. Einzig mit ihrem Grinsen und einer leichten Kopfbewegung in Andreas Richtung schrie sie förmlich: Los, Maik, die ist doch super!
»Vielleicht solltest du dich mal auf jemanden einlassen, der das Gegenteil davon ist?«
Maik hoffte sehr, dass Lisa damit nicht ihn meinte, denn das Gegenteil bedeutete: erst ein Arsch und dann charmant.
Andrea lächelte ihn scheu an und strich sich eine blonde Strähne hinters Ohr. »Ich bin gleich wieder da.« Sie stand auf und ging zu den Toiletten. Sie war noch nicht ganz verschwunden, da lehnte sich Lisa zu ihm über den Tisch.
»Du bist doch sonst nicht so zurückhaltend, was ist los? Sag mir nicht, dass sie nicht voll und ganz in dein Beuteschema passt.« In ihrer direkten Art kam sie selbst bei komplexen Themen sofort auf den Punkt. »Ich finde sie super. Anfangs dachte ich, sie sei so ein Mäuschen, aber sie ist witzig, interessiert und kein Jammerlappen. Ist sie etwa nicht psycho genug für dich? Man kann auch Frauen kennenlernen, die keine Macke haben.«
Jonas legte ihr eine Hand auf den Rücken und hörte nur wortlos zu.
»Du kennst sie gerade mal fünf Minuten länger als ich, woher willst du wissen, dass sie noch alle Nadeln am Christbaum hat?« Maik tippte mit einer Hand gegen sein Glas und mied ihren Blick.
»Lass es doch drauf ankommen. Du sollst sie ja nicht gleich heiraten, aber du kannst sie wenigstens nach ihrer Nummer fragen.« Das mochte Maik an seiner besten Freundin. Ihre Begeisterungsfähigkeit war spontan und impulsiv. Wenn sie jemanden mochte, dann vom ersten Moment an, und wer keinen guten Einstieg bei ihr hatte, tat sich schwer, überhaupt je von ihr gemocht zu werden. Und sie behielt fast immer recht mit ihrem ersten Eindruck.
»Sie ist nett«, sagte Maik ausweichend.
»Nett ist die kleine Nervensäge von Scheiße. Was stimmt nicht mit dir?« Dann schlug sie sich mit der Hand vor die Stirn. »Verdammt, es ist wegen dieser Prostituierten, oder? Bist du bescheuert?«
»Escort-Dame«, korrigierte Maik. »Ich würde wirklich gerne eine Frau wie sie hier im Shamrock treffen. Eine, bei der es sofort knistert, die mit uns trinkt und Feuer im Arsch hat. Eben eine wie dich, die für mich aber nicht wie eine Schwester ist – ihr wisst schon, was ich meine.«
Andrea ließ sich Zeit; wahrscheinlich stand sie noch vor dem Spiegel, um die Wunde zu begutachten und einen Augenblick das Erlebte zu verarbeiten.
»Du hast recht, Andrea ist eigentlich genau mein Typ, und unter anderen Umständen wäre diese Begegnung wie der Augenblick, von dem man später gemeinsam auf Partys erzählt, aber ich bin nicht interessiert, okay?«
Lisa seufzte und gab sich geschlagen. »Du weißt, dass du zu Fehlentscheidungen neigst, wenn es um Frauen geht, aber es klingt ganz so, als hättest du mir in Bezug auf Gefühlsdinge tatsächlich mal zugehört.« Mit einem Grinsen stieß sie Jonas an. »Erinnert mich an das letzte Gespräch über Maiks Liebesleben. Wie hieß die eine noch? Du weißt schon, die, die Maik bei Starbucks kennengelernt hatte. Mit der er noch am selben Tag zusammengekommen war, weil er dachte, es sei eine gute Entscheidung?«
Jonas legte einen Arm um sie und dachte kurz nach. Er musste für Lisa keine großen Reden schwingen, kein Ritter sein oder teure Dinge kaufen, die beiden gehörten einfach zusammen. Gesehen, verliebt, zusammengezogen. Maik wusste gar nicht mehr, wie es ohne Jonas gewesen war; dabei hatte Lisa ihn vor nicht mal einem Jahr kennengelernt. Sie taten einander gut, lachten über dieselben Dinge und gingen wie selbstverständlich auf die gleichen Ziele zu. Das war es, was er auch wollte. Er wusste, auf wen sie anspielte, aber er sprach den Namen nicht laut aus. Wie sie schon sagte: Er hatte kein gutes Händchen für Frauen.
Seit Lisa mit Jonas so glücklich war, schien ihr Wunsch stärker zu werden, das gleiche Glück für Maik zu finden. Wahrscheinlich stellte sie sich gemeinsame Spieleabende, Kneipentouren und Disconächte vor. Eben all das Zeug, das befreundete Pärchen unternahmen, ohne dass ein Singlefreund unvollständig danebensaß.
»Heike?«, überlegte Jonas laut und lag damit komplett falsch.
»Ist doch egal«, versuchte Maik, das Thema zu beenden, bevor sie sich wieder lustig über ihn machten. »Als ich dir von meiner Klientin erzählt habe, bist du im ersten Moment ganz begeistert gewesen.«
»Ja, weil du immer sagst, dass es so was wie Liebe auf den ersten Blick nicht gibt. Es hat mich amüsiert, dich verknallt zu sehen, aber wenn du dich deswegen zum Idioten machst, hört der Spaß auf.«
Maik wusste, wie sie es meinte. Immerhin hatte sie ihm in all den Jahren ihrer Freundschaft schon oft geholfen, die Scherben zusammenzukehren, die seine kurzen Partnerschaften hinterlassen hatten.
»Habe ich nicht vor. Ich komme auch als Single gut zurecht«, wehrte er sich gegen ihren Vorwurf.
Lisa nahm lieber einen großen Schluck Guinness, bevor sie etwas dazu sagte.
»Mandy«, fiel Jonas der Name wieder ein. »Die schnüffelnde Mandy, um genau zu sein.«
Beide machten nach, wie Mandy unentwegt um sich geschnüffelt hatte, weil sie eine Aversion gegen aufdringliche Gerüche gehabt hatte. Mit nur einer Woche war das die kürzeste Bindung gewesen, die er bislang eingegangen war.