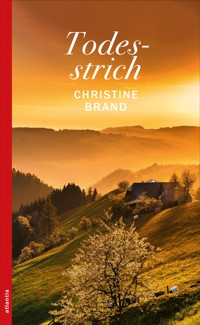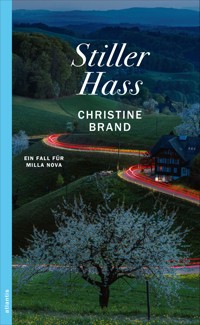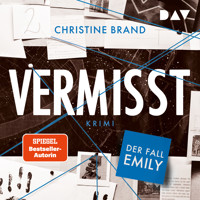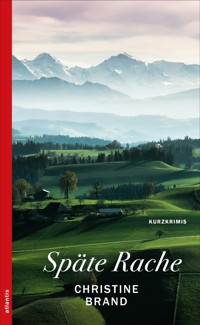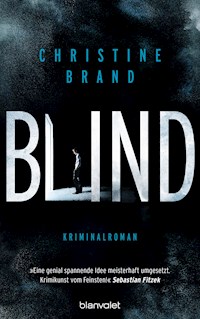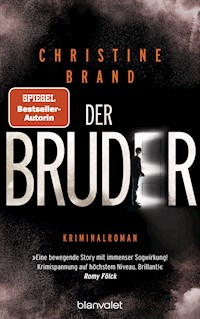
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Milla Nova ermittelt
- Sprache: Deutsch
»Eine bewegende Story mit immenser Sogwirkung! Krimispannung auf höchstem Niveau. Brillant!« Romy Fölck
Irena Jundts Vater ist tot. Um das Elternhaus zu räumen, muss die Rechtsmedizinerin der Berner Kripo zurück in das abgelegene Bergdorf ihrer Kindheit. Eine Kindheit, die mit dem Verschwinden ihres Bruders abrupt endete. Damals wurde ein brutaler Kindermörder für Benis Tod verurteilt. Doch bei ihrer Rückkehr erkennt Irena, dass irgendetwas an der Geschichte nicht stimmt, und die Dorfbewohner etwas verbergen. Wenig später wird in Bern ein kleiner Junge vermisst gemeldet – Sandro Bandini, Chef der Abteilung Leib und Leben bei der Berner Polizei, beginnt mit Hochdruck zu ermitteln und auch seine Freundin, Journalistin Milla, versucht mit gewohnt unkonventionellen Mitteln die Spur des Kindes zu verfolgen. Noch ahnt niemand, welche Kreise der Fall ziehen wird – und dass die Vergangenheit noch immer dunkle Schatten in die Gegenwart wirft …
Die unabhängig voneinander lesbaren Krimis um Milla Nova und Sandro Bandini bei Blanvalet:
1. Blind
2. Die Patientin
3. Der Bruder
4. Der Unbekannte
5. Der Feind
Lesen Sie auch »Wahre Verbrechen»: Christine Brand schreibt über ihre dramatischsten Fälle als Gerichtsreporterin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Irena Jundts Vater ist tot. Um das Elternhaus zu räumen, muss die Rechtsmedizinerin der Berner Kripo zurück in das abgelegene Bergdorf ihrer Kindheit. Eine Kindheit, die mit dem Verschwinden ihres Bruders abrupt endete. Damals wurde ein brutaler Kindermörder für Benis Tod verurteilt. Doch bei ihrer Rückkehr erkennt Irena, dass irgendetwas an der Geschichte nicht stimmt und die Dorfbewohner etwas verbergen. Wenig später wird in Bern ein kleiner Junge vermisst gemeldet – Sandro Bandini, Chef der Abteilung Leib und Leben bei der Berner Polizei, beginnt mit Hochdruck zu ermitteln, und auch seine Freundin, Journalistin Milla, versucht mit gewohnt unkonventionellen Mitteln die Spur des Kindes zu verfolgen. Noch ahnt niemand, welche Kreise der Fall ziehen wird – und dass die Vergangenheit noch immer dunkle Schatten in die Gegenwart wirft …
Die Autorin
Christine Brand, geboren und aufgewachsen im Schweizer Emmental, arbeitete als Redakteurin bei der »Neuen Zürcher Zeitung«, als Reporterin beim Schweizer Fernsehen und als Gerichtsreporterin. Im Gerichtssaal und durch Recherchen und Reportagen über die Polizeiarbeit erhielt sie Einblick in die Welt der Justiz und der Kriminologie. Sie hat bereits Romane und Kurzgeschichten bei Schweizer Verlagen veröffentlicht. Nach »Blind« und »Die Patientin« erscheint mit »Der Bruder« nun der dritte Fall für das Ermittlerduo Milla Nova und Sandro Bandini. Christine Brand lebt in Zürich, reist aber die meiste Zeit des Jahres um die Welt.
Die unabhängig voneinander lesbaren Krimis um Milla Nova und Sandro Bandini bei Blanvalet:
1. Blind
2. Die Patientin
3. Der Bruder
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet undwww.instagram.com/blanvalet.verlag
CHRISTINE BRAND
DER
BRUDER
ROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright der Originalausgabe © 2021 bei Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München Redaktion: René Stein Umschlaggestaltung: www.buerosued.de Umschlagmotiv: Edward George/Alamy Stock Foto; www.buerosued.deJB· Herstellung: sam Satz und E-Book: GGP Media GmbH, Pößneck ISBN: 978-3-641-26366-9V002 www.blanvalet.de
Gegen das Vergessen
Claudia S., 10 Jahre alt, getötet am 15. April 1981, Täter unbekannt
Annika H., 18 Jahre alt, entführt am 11. Juli 1981, bis heute vermisst
Peter P., 14 Jahre alt, entführt am 22. September 1981, bis heute vermisst
Rebecca B., 8 Jahre alt, entführt am 20. März 1982, tot aufgefunden am 15. August 1982, Täter unbekannt
Karin G., 15 Jahre alt, getötet am 31. Juli 1982, Täter unbekannt
Brigitte M., 17 Jahre alt, getötet am 31. Juli 1982, Täter unbekannt
Karen S., 16 Jahre alt, verschwunden am 16. August 1982, bis heute vermisst
Loredana M., 6 Jahre alt, getötet am 14. April 1983, Täter unbekannt
Peter R., 7 Jahre alt, entführt am 12. Mai 1984, bis heute vermisst
Sylvie B., 12 Jahre alt, verschwunden am 23. Mai 1985, bis heute vermisst
Sarah O., 5 Jahre alt, entführt am 28. September 1985, bis heute vermisst
Edith T., 7 Jahre alt, entführt am 3. Mai 1986, bis heute vermisst
Prolog
»Bist du so weit?«
»Ich bin so weit.«
Die beiden Männer schauen sich in die Augen, ihre Blicke bleiben ein paar Sekunden zu lange aneinander haften. Ein Räuspern, sie reißen sich los und steigen aus dem Wagen. Der Schrei eines Kauzes zerschneidet die Stille der Nacht. Der Mond ist halbvoll, der Wind treibt die Wolken vor sich her und spielt mit ihm Verstecken. Die Schatten der Bäume kommen und gehen, ihre Äste ragen in den Himmel wie die knochigen Finger längst verstorbener Seelen. Schon bald werden sie wieder Blätter tragen.
Die Männer treten hinter das Auto. Schwarze Gestalten ohne Gesicht. Nur schemenhaft heben sie sich vom Dunkel ab. Sobald eine Wolke den Mond verdeckt, verschmelzen sie mit der Nacht.
»Ich werde es alleine tun«, sagt der eine, während er den Kofferraum öffnet. Ein Flüstern nur. Er beugt sich hinab, hebt das Kind behutsam hoch.
Wie leicht es ist.
»Bist du sicher?«
»Ganz sicher.«
»Findest du die Stelle?«
Der Mann nickt. Dann geht er, das Kind auf den Armen, in den Wald hinein. Er kennt den Weg, kennt fast jeden Baum hier, weiß auch, wo der Wald am einsamsten liegt, wo nie jemand hinkommt. Dort will er hin.
Nach fünfzehn Minuten erkennt er den Spaten, der wie eine Art makabres Grabkreuz aus dem Boden ragt. Ein richtiges wird es für dieses Kind nie geben. Daneben die Grube, die er zuvor ausgehoben hat. Er legt das Kind behutsam darin ab, bettet den Kopf auf feuchtes Laub, streicht ihm mit der rauen Hand über die Stirn. Ein letztes Mal. Der Mann richtet sich auf, ein Schluchzer drängt seine Kehle hoch. Er schluckt seinen Schrei hinunter. Keine Tränen mehr.
Der Brief.
Er zieht ihn aus seiner Jackentasche. Klaubt die Zündhölzer hervor, weiß, was zu tun ist. Doch er zögert.
Es geht nicht.
Langsam steckt er die Zündhölzer wieder weg, tastet seine Taschen nach etwas Nützlichem ab und stößt auf die metallene Box mit den Hustenpastillen. Öffnet sie, schüttet die Pastillen auf den Boden, faltet den Brief so oft, bis er in die Metalldose passt, und legt sie dem Kind in die Hand. Dann beginnt er, mit dem Spaten die Grube zuzuschaufeln. Die Erde, die auf den toten Körper fällt, verursacht ein unangenehmes Geräusch.
Eine halbe Stunde später macht er sich auf den Rückweg. Schon von Weitem sieht er die Zigarette glimmen. Ein kleiner roter Punkt, wenn der Rauch in die Lunge gezogen wird. Zurück beim Wagen, schweigen sie beide, denn für das Geschehene lassen sich keine Worte finden. Dann steigen die Männer ins Auto und fahren zurück ins Dorf.
Keiner der beiden wird diese Nacht je wieder erwähnen.
1
Die beiden Leichen liegen nackt auf den zwei Obduktionstischen, exakt gleich ausgerichtet. Mann und Frau, im Tod vereint. Wie einst Romeo und Julia. Doch mit Romantik ist es in dieser Geschichte nicht weit her. Vorsichtig setzt Irena Jundt die Nadel an und vernäht die Hautlappen, um den Torso des Mannes zu schließen. Zuvor hat sie ihn aufgeschnitten, den Brustkorb aufgesägt, die Organe herausgenommen, gewogen, untersucht, hat von ihnen Proben entnommen, um sie danach wieder zurück in den Körper zu legen, wo sie ihre Funktion ein Leben lang erfüllt haben. Bis eine Pistolenkugel alles zum Stillstand brachte.
Irena Jundt summt leise die Melodie mit, die im Hintergrund aus den Boxen klingt. Ein Chor besingt die beiden Toten mit dem Dies irae aus Mozarts Requiem. An der Decke sirrt eine der Neonröhren, die den Saal in kaltweißes Licht tunken. In unregelmäßigen Abständen flackert sie kurz. Das tut sie seit Jahren schon.
Die Toten hüten kein kompliziertes Rätsel, das Irena entschlüsseln muss. Nicht dieses Mal. Nach dem letzten Stich kappt sie den Faden und tritt einen Schritt zurück. Blickt auf den Mann, der seine Frau hat retten wollen, um einen zu hohen Preis, und sie am Schluss getötet hat. Irena ist zufrieden, die Naht sieht gut aus, das ist ihr wichtig, auch wenn niemand ihre Arbeit begutachten wird. Sie wendet sich ab, holt den Hubwagen mit der darauf liegenden Leichenschale und stellt ihn längs neben den Obduktionstisch. Mit einem Pedal pumpt sie ihn hoch, bis die Schale nur wenig tiefer liegt als der Tisch. Mit einem Schwamm befeuchtet sie die beiden Chromstahlflächen und zieht dann den toten Mann an einem Arm und an einem Bein vom Obduktionstisch auf die Leichenschale. Noch immer vor sich hin summend – Lacrimosa jetzt –, fährt sie den Hubwagen vor die Kühlzellen, bringt die Schale auf die richtige Höhe, und schiebt sie und mit ihr den Toten auf den quer verlaufenden Metallrollen in das Fach. Sie wiederholt das Prozedere, bei der Frau fällt es ihr leichter, sie wiegt nur etwa halb so viel wie ihr Mann. Mit dem wohlvertrauten Klacksen schließt Irena die Tür der Kühlzellen und damit auch den Fall. Es wird kein Gerichtsverfahren geben. Nicht nur das Opfer, auch der Täter ist tot.
Im Ankleideraum streift Irena Einweghandschuhe sowie Schutzkittel ab und steckt alles in den Entsorgungsbehälter. Sie löst die Haube, öffnet die Haarklammer und schüttelt den Kopf, sodass ihr das pechfarbene Haar über die Schultern fällt. Am Becken spült sie sich lange mit lauwarmem Wasser die Hände, seift sie vorsichtig ein und reinigt sie anschließend mit Desinfektionsmittel. Jede Bewegung, jeder Griff, Hunderte Male getan. Ein Ritual, als würde sie dadurch von der einen in die andere Haut schlüpfen. Irena wechselt von ihren Arbeits- zu ihren Alltagsschuhen und begibt sich in ihr Büro, ihre nicht einmal fünf Quadratmeter große Tiny-Box wie sie es nennt. Doch das kümmert Irena nicht. Sie braucht nicht mehr als einen Stuhl, einen Tisch, einen Laptop. Und Musik. Sie stoppt das Requiem und tippt auf der Playlist das neueste Album der Band Muse an. Mozart eignet sich als Hintergrundmusik, um Menschen zu obduzieren, nicht um Berichte zu schreiben. Auch wenn in diesem Fall der Abschlussbericht nicht viel Arbeit macht. Sieben Songs, nach Thought Contagion ist die Pflicht erledigt. Doch der Schlusspunkt bringt keine Erleichterung, im Gegenteil.
Irena schließt die Augen, fährt sich mit Daumen und Zeigefinger über die Nasenwurzel und spürt, dass sich alles in ihr zusammenzieht, eng wird, der Brustkorb, der Hals, sie saugt Luft in ihre Lunge, als drohe sie zu ersticken, weil es jetzt kein Hinauszögern mehr gibt. Sie öffnet ihr Mailprogramm und tippt den Namen des Kripochefs Sandro Bandini ins Adressfeld.
Lieber Sandro, anbei die beiden Obduktionsberichte. Ich melde mich damit ab. Familiäre Gründe … – Irena hält inne, löscht den angefangenen Satz und beginnt neu – Aus privaten Gründen nehme ich ein paar Tage frei. Ich werde spätestens ab Donnerstag wieder im Dienst sein. Bis dahin übernimmt Peter Lang die Leitung des Rechtsmedizinischen Instituts.
Herzlich, Irena.
Senden.
Sie klappt den Laptop zu und schaltet die Musik aus. Muse verstummt. Irena bleibt sitzen. Sie müsste nach Hause fahren, ihren Koffer packen, die letzten Vorbereitungen treffen, sich wappnen für das, was auf sie zukommt. Doch alles in ihr sträubt sich dagegen. Sie will nicht, noch nicht jetzt.
Irena steckt das Handy in die Tasche, räumt den Schreibtisch auf, indem sie die drei Stifte auf die rechte Seite schiebt und sie parallel zur Tischkante ausrichtet, die Maus auf die Mitte des Mauspads legt und den Stapel mit den Klarsichtmäppchen richtet, indem sie ihn in die Hände nimmt, ihn erst längsseitig, dann hochkant je zweimal auf die Tischfläche klopft und ihn dann exakt auf dem linken Eck drapiert. Sie wirft sich die Tasche über die Schulter und löscht das Licht ihrer Tiny-Box. Die Absätze klacksen, als sie über den Plattenboden Richtung Ausgang geht.
Draußen lässt ein kalter Wind sie zusammenfahren. Warum nur erscheint es ihr, dass der Winter jedes Jahr länger dauert und die Warterei auf den Frühling unerträglich wird? Irena geht nicht in Richtung Bushaltestelle, sondern macht sich über die Lorrainebrücke auf den Weg in die Altstadt. Sie hält kurz inne und blickt hinab auf den Fluss. Die Aare schmiegt sich wie eine Schlange um die Berner Altstadt und strahlt eine tiefe Ruhe aus. Schwarz das Wasser, das unbeeindruckt Richtung Meer fließt, ganz egal was auf der Welt gerade passiert, welche Viren wüten und welche Despoten wo auch immer in den Regierungen sitzen und ihre kranken Ideen ausbrüten. Hier herrscht ein beständiges Fließen, ohne Anfang, ohne Ende, während Menschenleben kommen und gehen.
Er war immerhin dein Vater.
Irena schiebt den Gedanken weg. Sie braucht einen Drink, oder auch zwei, vielleicht gar einen Mann. Für eine Nacht. Nur kurz bei jemandem in den Armen liegen. Mit schnellen Schritten geht sie weiter, Kreissaal oder Lounge-Bar im Schweizerhof? Sie entscheidet sich für ihre Lieblingsbar, den Kreissaal, auch wenn die Chance auf einen raschen, schmerzfreien Flirt in der Hotelbar weit größer wäre; ein verheirateter Mann auf Geschäftsreise, keine Komplikationen. Nicht heute.
Als sie den Kreissaal betritt und über die Treppe zur Bar im Untergeschoss hinabsteigt, scannt sie mit geübtem Blick die Menschen, die an der Theke sitzen. Sie erkennt auf Anhieb, dass sie später allein nach Hause gehen wird.
»Das Übliche?«, fragt Theneyan, als sie sich an die Bar setzt. An seinem Eckzahn blitzt ein aufgeklebter Schmuckstein, an seinen Fingern trägt er drei goldene Ringe. Theneyan kommt aus dem Oman, er versteht es, jederzeit gute Laune zu verbreiten – oder aber ein guter Zuhörer zu sein, wenn es nötig ist.
Manchmal denkt Irena, dass Theneyan ihr einziger wirklicher Freund ist – keiner kennt sie besser als ihr Lieblingsbarkeeper. Ein Umstand, den manch einer wohl als trist bezeichnen würde – sie empfindet es als beruhigend. Mehr Nähe braucht sie nicht. Irena nickt. »Mit Pfeffer und Gurke.«
»Ein übler Fall?«
Irena studiert Theneyans Hände, die in einer eleganten Choreografie ihren Gin Tonic zubereiten.
»Ja.« Eine Lüge. »Die Welt da draußen ist böse.« Nichts als die Wahrheit.
Irena blickt auf, schaut Theneyan in die Augen. Er stellt das Glas vor ihr ab. Kurz überlegt sie, ob sie ihm ihre Geschichte erzählen soll, die sie noch nie jemandem erzählt hat. Doch sie verwirft den Gedanken. Über Privates spricht sie nicht, das hat sie sich zum Prinzip gemacht. Seit sie vor über zwanzig Jahren den unglückseligen Ort verlassen hat, an den sie morgen zurückkehren muss. Sie greift zu ihrem Gin Tonic, nimmt einen großen Schluck und spürt, wie der Alkohol sich langsam in ihrem Magen ausbreitet. Dann schließt sie die Augen. Irena wünschte sich, sie wäre an einem anderen Ort in einem anderen Leben in einem anderen Körper. Auf einmal sieht sie das Mädchen vor sich, das sie mal gewesen ist. Nein, sie will nicht in diese Vergangenheit zurück. Sie leert das Glas in einem Zug.
»Dasselbe noch einmal«, sagt sie zu Theneyan, der ihr ernst zunickt und zur Gin-Flasche greift. Bombay Sapphire.
2
Im Saal Nummer 7 des Basler Strafgerichts stehen ein Bus, eine Tram, ein Lieferwagen und mehrere Personenwagen – alle im Spielzeugformat – sorgfältig drapiert und der Größe nach sortiert auf einem Regal. Davor sitzt Richter Sven Rabenburg, der, anders als sein Name vermuten ließe, äußerlich nicht das Geringste mit dem schwarzgefiederten Vogel gemein hat. Von seinem Haar ist nur ein halbrunder Kranz übriggeblieben, der einmal dunkel gewesen sein mag, aber längst ergraut ist. Sein Gesicht ist rund und voll, seine blauen Augen blicken schlau und wissend. Gerade wirkt er ein bisschen wie ein nachsichtiger Dorfpolizist, der einen Schüler dabei ertappt hat, wie er auf dem Gehsteig Fahrrad gefahren ist.
»Aber Sie wussten schon, dass man das nicht tut?«, fragt er die Frau vor ihm, die die ganze Zeit schon den linken Zeigefinger in eine ihrer dunklen Locken einwickelt und wieder auswickelt und wieder einwickelt und wieder auswickelt. Sie sitzt sehr aufrecht, als habe eine Physiotherapeutin sie in der für den Rücken schonendsten Haltung auf dem Stuhl platziert. »Dass das verboten ist?«
Erst jetzt blickt sie Rabenburg direkt an, nachdem ihre auffallend grünen Augen zuvor immer wieder nach rechts schweiften, als säße ein Zwerg auf seiner Schulter, der ihre Aufmerksamkeit auf sich zieht, was Rabenburg nachhaltig irritiert.
Milla Nova ist tatsächlich abgelenkt. Sie fragt sich die ganze Zeit schon, was zum Teufel es mit den Matchboxautos auf sich hat, die hinter dem Richter auf dem Regal stehen. Vermutlich hat er einen Sammeltick. Oder ein unverarbeitetes Kindheitstrauma. Milla räuspert sich, überlegt kurz, was sie antworten soll, und entscheidet sich für die Wahrheit, weil Ausreden hier nichts bringen.
»Herr Rabenburg, glauben Sie mir, ich kenne das Gesetz, aber meine Arbeit zwingt mich manchmal, es großzügig auszulegen, um Fakten ans Licht zu bringen und versteckte Wahrheiten aufzuspüren. In dem Fall ging es sogar darum, ein Verbrechen aufzudecken. Menschenleben standen auf dem Spiel! Daher ist es völlig unverhältnismäßig, aus der kleinen Lappalie eine so große Geschichte zu machen.«
»Kleine Lappalie – das sagen Sie … Denken Sie wirklich, es ist Sache der Journalisten zu entscheiden, wie ein Paragraf auszulegen ist? Ist das nicht eher Aufgabe der Justiz?«
Wieder zwirbelt Milla an ihrer Locke herum. Zum ersten Mal an diesem Morgen fragt sie sich, ob sie nicht besser auf ihren Chef Wolfgang und auf den Hausjuristen des Schweizer Fernsehens gehört hätte: Strafbefehl akzeptieren und die Geldstrafe bezahlen, haben sie ihr geraten. Sie hätte nicht einmal selbst dafür aufkommen müssen, Wolfgang hätte ihr den Betrag über die Spesenrechnung abgeglichen. So hätte sie sich den Auftritt hier sparen können. Doch ihr Stolz ist ihr in die Quere gekommen. Sie wollte wenigstens angehört werden in dieser mühseligen Angelegenheit, bevor sie mit einem Eintrag ins Strafregister mit dem Makel leben muss, zukünftig als vorbestraft zu gelten. Denn sie ist nicht kriminell, im Gegenteil. Viel eher ist sie eine ausgezeichnete Journalistin, die sich bei investigativen Recherchen nicht gleich in die Hose macht, wenn es brenzlig wird. Die auch mal was riskiert, wenn es darum geht, eine Ungerechtigkeit aus der Welt zu schaffen oder einen Skandal aufzudecken. So sieht Milla das. Schon klar, dass ihr Freund Sandro diese Aussage nicht widerspruchslos stehen lassen würde, dafür ist er zu sehr Polizist. Er ist von ihren Aktionen – inklusive ihrer letzten Kellerinspektion mit dramatischem Ausgang – meist alles andere als begeistert.
»Natürlich ist es die Aufgabe der Justiz.« Milla zwirbelt ihren Zeigefinger in eine Locke, nicht ohne ihren Blick von Rabenburg abzuwenden. »Aber es ist auch Aufgabe der Richter, jeden einzelnen Fall sorgfältig abzuwägen und zu prüfen, unter welchen Umständen eine Handlung begangen wurde – und ob es sich unter diesen Umständen tatsächlich um eine Straftat handelte und nicht viel eher um eine Notwendigkeit, um Zivilcourage!« Milla nickt zufrieden, sie hat sich diesen Satz zu Hause zurechtgelegt und ist froh, dass sie ihn nun auch hat einbringen können. Nur scheint er nicht die erhoffte Wirkung zu zeigen.
»Sie wollen also behaupten, es war im Rahmen Ihrer Recherche unabdingbar, unerlaubterweise in einen fremden Keller zu klettern und bei der Aktion das Fenster zu beschädigen, obwohl Ihnen das Ganze für Ihre Reportage rein gar nichts gebracht hat? Und dass Sie das sogar wieder tun würden?«, fragt Rabenburg. Der freundliche Tonfall ist verschwunden.
»Ich werde das Gleiche nicht wieder tun«, sagt Milla, was nicht einmal gelogen ist: Sie wird sich hüten, ein zweites Mal durch ein Fenster in einen Keller zu steigen, aus dem sie alleine nicht mehr hinauskommt. »Aber das Fenster ist ganz von allein zugefallen und hat sich verkeilt, dafür trage ich keine Schuld.« Sie hört sich an wie ein trotziges Kind.
Das Plädoyer ihres Anwalts dauert nur etwa zehn Minuten. Während er über die »eindeutige Pflicht der Medien über Themen von allgemeinem Interesse zu informieren« referiert und darüber, dass »Frau Novas Recherche unter dem Aspekt der Wahrung berechtigter Interessen nicht als unrechtmäßige Handlung« klassifiziert werden darf, weil es sich dabei um einen von der Justiz anerkannten übergesetzlichen Rechtfertigungsgrund handelt, wandern Millas Augen erneut zu den kleinen Matchboxautos. Auf einmal ist ihr klar, warum sie dort stehen: Um Unfälle oder Verkehrssituationen nachzustellen, wenn der in einer Anklageschrift beschriebene Sachverhalt mehr verwirrt als zur Klärung beiträgt. Am liebsten würde sie die Hand hochhalten und den Richter fragen, ob sie mit ihrer Vermutung richtigliegt. In dem Moment erteilt Rabenburg Milla das letzte Wort.
Sie widersteht der Versuchung, die Spielzeugautos anzusprechen, und sagt stattdessen mit ernster Miene: »Ich bitte Sie, im Sinne der Medien- und Pressefreiheit zu urteilen und von einem Schuldspruch abzusehen.«
Rabenburg sieht Milla mit seinen schlauen Augen an, ein Blick, den sie nicht deuten kann, und teilt mit, dass sich das Gericht für zehn Minuten zurückzieht.
Zehn Minuten!
Milla ist klar, dass sich der Richter sein Urteil längst gemacht hat und die Pause nicht zum gewissenhaften Nachdenken, sondern zum Kaffeetrinken nutzen wird. Oder um eine Zigarette zu rauchen.
Als Milla eine halbe Stunde später das Gerichtsgebäude verlässt, ist sie wegen Hausfriedensbruch schuldig gesprochen und zu einer Geldstrafe auf Bewährung verurteilt. Auch den Eintrag ins Strafregister konnte sie nicht vermeiden, was Milla besonders ärgert. Aber sie hat nicht groß Zeit, darüber nachzudenken. Sie ist knapp dran, zum Glück hat Sandro versprochen, sie abzuholen – obwohl sie ihm verboten hat, den Gerichtsprozess mitzuverfolgen. Sein Beisein hätte sich wie eine doppelte Schmach angefühlt.
Als sie nach draußen tritt, sieht sie den rosaroten Fiat 500 schon von Weitem auf dem Parkplatz stehen. Sandro ist es stets peinlich, den Wagen seiner Mutter auszuleihen, der aussieht wie Barbies »Glamcar« persönlich. Doch er selbst besitzt einzig ein Fahrrad, und sich für private Zwecke am Fuhrpark der Kantonspolizei Bern zu bedienen kommt für ihn nicht infrage. Also quetscht sich Milla in den Kleinwagen, lässt sich auf den Sitz fallen und schmettert die Tür mit einem Knall hinter sich zu.
»Es ist nicht gut gelaufen«, stellt Sandro fest.
»Müssen wir darüber sprechen?«, fragt Milla.
Sandro lehnt sich zu ihr hinüber und küsst sie kurz auf den Mund. »Nein, müssen wir nicht. Aber wir können, wenn du möchtest.«
»Liebst du mich noch, auch wenn ich eine verurteilte Kleinkriminelle bin?«
»Ich liebe dich wie die Lasagne meiner Großmutter, und sogar noch ein bisschen mehr.«
»Dann ist ja gut.« Milla grinst. »Lass uns losfahren. Heute ist ein großer Tag, wir dürfen auf keinen Fall zu spät kommen.«
3
Das Gesicht, das Irena Jundt an diesem verspäteten Morgen aus dem Spiegel entgegenblickt, ist noch blasser als sonst und kommt ihr seltsam fremd vor. Ihr schwarzes Haar fällt offen über ihre Schultern und bildet einen so starken Kontrast zu ihrem Teint, dass ihr Spiegelbild aussieht wie eine überbelichtete Schwarz-Weiß-Fotografie. Irena weiß um den Spitznamen, den man ihr auf dem Polizeipräsidium bereits in ihrer ersten Woche als Rechtsmedizinerin verpasst hat: Morticia, nach der Mutter aus der Serie The Addams Family, dieser makaber-grotesken Chaotentruppe. Wegen ihres Aussehens, aber wohl auch, weil Irena deren Faszination für die Toten teilt.
Es ist spät geworden gestern. Irena ist bis zur Sperrstunde geblieben. Sie hat zu viel getrunken und zu wenig geschlafen, doch das konnte ihr noch nie etwas anhaben. Dass sie sich heute miserabel fühlt, hat andere Gründe. Der Koffer ist gepackt, sie hat alles erledigt, was vor der Abreise erledigt sein musste, doch sie selbst ist nicht bereit. Sie wird es nie sein. Irena geht in die Küche, öffnet den Kühlschrank, ohne die Bilder wahrzunehmen, die mit Magneten an dessen Tür befestigt sind: ihre ganz persönliche Leichengalerie. Es sind Aufnahmen der spektakulärsten und schwierigsten Fälle, die in den letzten zehn Jahren auf ihrem Obduktionstisch gelandet sind. Zum Beispiel das Bild jenes Mannes, der kopfüber aufgehängt wurde und daran verstarb – eine echte Herausforderung, die Todesursache zu ergründen. Auch das Foto einer erhängten Katze klebt an ihrem Kühlschrank. Millas Katze. Die Bilder sind für jeden Besucher ein Härtetest, vor allem für ihre männlichen Kurzbekanntschaften. Kaum einer bleibt über Nacht, nachdem er die morbide Galerie gesehen hat. Irena ist dies meistens gerade recht.
Sie räumt den Brokkoli, zwei Joghurts und einen Salatkopf aus dem Kühlschrank und steckt alles in eine Einkaufstasche, die sie ihrer Nachbarin vor die Tür stellen wird, damit die Lebensmittel während ihrer Abwesenheit nicht verderben. Obwohl es keinen Grund zur Annahme gibt, dass die ganze Sache mehr als drei Tage beanspruchen wird, hat sie doch das ungute Gefühl, dass sie länger weg sein wird als geplant. Ein letzter Blick in die Küche, alle Herdplatten sind ausgeschaltet, die Kabel von Toaster, Mixer und Wasserkocher ausgesteckt. Es gibt keinen Grund mehr, die Abreise länger hinauszuzögern.
Wenig später fährt Irena mit ihrem pflaumenfarbigen Peugeot 404 aus der Tiefgarage ihrer Wohnsiedlung. Das alte Cabriolet ist kein wintertaugliches Auto, und der Wind stiehlt sich durch alle Ritzen und pfeift ihr um die Ohren. In weiser Voraussicht hat sich Irena für die Fahrt Mütze und Handschuhe angezogen. Sie wird etwa neunzig Minuten unterwegs sein, um in das Dorf zu gelangen, und sie will nicht steifgefroren ankommen. Die Kälte, die sie dort empfangen wird, wird auch so kaum erträglich sein.
Das Dorf.
Der Ort, an den sie niemals zurückkehren wollte. In den sie nicht hat zurückkehren können, seit sie mit fünfzehn weggegangen ist. Weil das Dorf zu sehr mit den Erinnerungen verbunden ist.
Beni.
Wie er wohl aussehen würde, heute? Fast zweiundvierzig wäre er jetzt. Was wohl aus ihm geworden wäre?
Was wohl aus mir geworden wäre, wenn es ihn noch gäbe? Zweifelsohne wäre sie ein anderer Mensch, wenn er noch lebte.
»Beni.« Irena zuckt zusammen, als sie den Namen laut ausspricht. »Beni«, sagt sie noch einmal, mit fester Stimme jetzt. Dann stellt sie die Musik an, dreht die Lautstärke auf, als ob sie damit ihre Gedanken übertönen könnte. Sie wählt ein Album von Portishead an, entscheidet sich dann aber anders, Queens of the Stone Age soll es sein. Make It Wit Chu, sie summt den Song mit.
Doch Erinnerungen lassen sich nicht wegsingen. Sie halten sich an keine Regeln und überfluten einen ohne Vorwarnung und ohne Rücksicht, selbst wenn man nichts von ihnen wissen will. Die Autofahrt. Im Sommer 1989. Zum ersten Mal das Meer sehen. Irena erinnert sich, wie die Eltern im alten Kombi zwei Campingmatratzen ausgelegt hatten, damit sie, die Kinder, während der Fahrt schlafen konnten. Dabei waren sie überhaupt nicht müde. Was für eine Aufregung: um zwei Uhr in der Früh geweckt zu werden und mitten in der Nacht loszufahren, auf leeren Straßen durch schlafende Dörfer der Welt entgegen. Sie hatten zwischen den Matratzen Kissen aufgeschichtet, einen Grenzwall gebaut, um ihre Territorien zu markieren. Deins und Meins. Meins und Deins. Reni-Beni, so nannten sie es, wenn etwas ihnen beiden gehörte. Beni war aufgeregt gewesen, hatte ohne Unterlass geplappert. Irena, grün im Gesicht, hatte sich an das Plastikbecken auf ihrem Schoß geklammert, höchst konzentriert, um sich nicht übergeben zu müssen.
Die Erinnerung ist mehr als ein Gedanke. Irena spürt sie körperlich. Die Übelkeit breitet sich in ihrem Magen aus wie damals. Sie lehnt sich nach vorn, nicht kotzen jetzt, und klammert sich an das Lenkrad wie ein Rudergänger im Sturm. Ein lautes Hupen lässt sie zusammenfahren und das Steuer herumreißen. Ihr Puls rast. Sie schnappt nach Luft.
Irgendwann, sie hatten gefühlt den ganzen Planeten umfahren, stoppte Vater den Wagen. Und da lag sie vor ihnen, die blaue Masse Wasser, die sich am Horizont auflöste im Nichts, weil die Grenze zwischen Himmel und Erde verschwunden war. Das Meer war mehr, als Irena fassen konnte, und sie spürte zum ersten Mal tief in sich ein Gefühl, an dem sie sich später ein Leben lang festklammern sollte: frei sein. Es war schon hell, obwohl die Sonne sich noch hinter dem Horizont versteckt hielt. »Na los«, hat ihre Mutter gerufen. »Ab ins Wasser mit euch!«
Mutter.
Sie haben die Türen aufgerissen und sind losgerannt, hineingerannt in die Unendlichkeit, ins kühle Nass, trotz ihrer Kleidung. Sie haben das Wasser aufspritzen und sich von den Wellen umwerfen lassen. Beni hat sie umarmt, laut gelacht, hat sie hochgehoben und hineingeworfen in das Meer, das wie eine versalzene, kalt gewordene Suppe schmeckte.
Wie seltsam, dass sie sich so genau daran erinnert, obwohl sie erst sieben Jahre alt war, während sie nicht mal mit Gewissheit sagen könnte, was sie vor drei Tagen zu Abend gegessen hat. Die Mauer beginnt zu bröckeln, die sie so sorgsam aufgebaut hat, um das Früher wegzuschließen und für immer zu vergessen. Je näher Irena dem Dorf kommt, desto mehr Erinnerungen stürzen auf sie ein.
Später haben sie auf dem Campingplatz das Zelt aufgebaut, auf zwei staubigen Flecken mit wenig Schatten: einen für ihr Zelt, einen für jenes der Familie ihres Onkels, die am nächsten Tag folgen sollte. Irena hat den Geruch in der Nase, als wäre sie wieder dort, eine Mischung aus aufgeheizter Luft, Sand, Kiefernnadeln, dem grünen Plastikteppich und dem grobgenähten Stoff des Zeltes. Ein oranges Familienzelt. Sie erinnert sich genau, wie sich der Reißverschluss anhörte, wenn die Eltern nachts hereinschlichen, weil sie meinten, die Kinder schliefen schon. Dabei hat Irena mit Beni unter dem Schlafsack gesteckt, sie leuchtete mit der Taschenlampe, während er flüsternd aus einem Buch vorlas. Die Kinder auf der Insel, von Lisa Tetzner. Irena hat sich vorgestellt, dass auch Beni und sie auf einer einsamen Insel verschollen wären. Sie hatte keine Angst. Sie wusste, dass Beni sie beschützen würde. Für immer.
Danach war nichts mehr wie zuvor.
Der Gedanke trifft Irena unvermittelt. Er ist noch niemals da gewesen. Doch jetzt, all die Jahre später, erkennt sie es auf einmal in einer unangenehmen Deutlichkeit: Die Leichtigkeit war weg nach diesen ersten Ferien am Meer. Die Vertrautheit zwischen ihr und Beni, die keine Worte brauchte – plötzlich war sie nicht mehr da. Als hätten sie auf dem staubigen Campingplatz im Süden Frankreichs die Unschuld ihrer Kindheit verloren. Und irgendwie auch das Glück.
4
»Sitzt auch alles richtig?«
»Ja-haaaa!«, sagt Silas, ohne von seinem Dominik-Dachs-Büchlein aufzublicken. Nathaniel hat die Frage bestimmt schon sechs Mal gestellt. Zwei Mal hat Silas gewissenhaft geprüft, ob Nathaniels Hemd korrekt zugeknöpft ist, ob es überall und regelmäßig in der Hose steckt, ob deren Reißverschluss ganz zu ist. Doch beim dritten Mal hat Silas beschlossen, dass man sich entscheiden muss im Leben, weil man nicht zwei Dinge gleichzeitig tun kann. Er hat sich für Dominik Dachs entschieden. Nathaniels immergleiche Frage ist langweilig. Nicht nur Nathaniel führt sich heute eigenartig auf, auch Alisha streift in der Wohnung herum, als würde sie ein gut verstecktes Wursträdchen suchen, und die Mama hat sich seit etwa einer Stunde im Badezimmer eingeschlossen. Erwachsene sind komisch. Und Hunde ebenso.
»Du musst nicht nervös sein«, sagt Nathaniel zu Silas.
»Mmh.«
»Es ist eigentlich keine große Angelegenheit.«
»Mmh.«
»In fünfzehn Minuten wird alles vorbei sein.«
Enttäuscht klappt Silas das Büchlein zu. Dominik Dachs muss warten, Nathaniel will reden.
»Ich bin nicht nervös«, sagt Silas. »Was macht Mama so lange?«
»Sie macht sich schön.«
»Ist Mama nervös?«
»Ich glaube schon.«
»Bist du nervös?«
»Vielleicht ein bisschen.« Schon wieder tastet Nathaniel seinen Hemdkragen ab, um sicherzugehen, dass er gerade sitzt.
»Warum bist du nervös, wenn es in fünfzehn Minuten vorbei ist?«
Ja, warum eigentlich?, fragt sich Nathaniel selbst. Zumal es reine Formsache ist, dass er sich heute trauen lässt. Mit einer Frau, die der beste Mensch ist, der ihm jemals begegnet ist, die er aber nicht liebt, weil er sie nicht lieben darf, weil er weiß, dass sie ihn niemals lieben wird. Es ist kompliziert, wie so oft im Leben, vor allem wenn es um die Liebe geht. Aber wäre das Leben wirklich besser, wenn es weniger kompliziert wäre? Nathaniel glaubt nicht, dass er die Welt mögen würde, in der alles einfach wäre, in der sich keine neuen Herausforderungen stellten und alles immer beim Alten bliebe. Der Mensch ist geschaffen dafür, sich mit Schwierigkeiten auseinandersetzen zu müssen – und wenn es gerade mal keine gibt, schafft er sie sich selbst.
Es ist, wie es ist, denkt Nathaniel. Und manche Dinge lassen sich nicht ändern. Wie zum Beispiel die sexuelle Ausrichtung eines Menschen. Carole steht nun mal nicht auf Männer, auch wenn sich Nathaniel wünschte, dass es anders wäre. Gleichzeitig ist er sich sicher, dass – wenn sie auf Männer stehen würde – Carole sich kaum für einen Mann wie ihn entschieden hätte. Einen Blinden.
Die Umstände machen es erforderlich, dass er sie trotzdem heiratet. Weil Carole als alleinstehende, arbeitende Frau, noch dazu Lesbe, sonst nahezu keine Chance gehabt hätte, das Sorgerecht für ihren Sohn Silas zurückzuerhalten. Die Pflegeeltern des Kleinen, bei denen er seine ersten vier Lebensjahre verbracht hat, haben mit allen Mitteln darum gekämpft, den Jungen behalten zu können, obwohl Silas sich für seine leibliche Mutter entschieden hat. Nur werden Kinder in diesem Alter noch nicht nach ihrer Meinung gefragt. Wenn es um das angebliche Wohl eines Kindes geht, sprechen die Behörden eine eigene Sprache, beeinflusst durch ein starres Paragrafenwerk und gut bezahlte Advokaten.
Darum müssen Carole und Silas und Nathaniel auch auf dem Papier eine richtige Familie werden, obwohl sie genau das in gewisser Weise längst sind. Vor Kurzem sind sie in eine gemeinsame Wohnung gezogen, weil alle drei davon profitieren. Wenn Carole in ihrem Grafikatelier arbeitet, ist es Nathaniel, der auf sein Patenkind Silas aufpasst, den fünfjährigen kleinen Knopf, der immer so direkte Fragen stellt.
»Ich bin nervös, weil man das wahrscheinlich nur einmal im Leben macht«, antwortet Nathaniel und tastet nach seinem Blindenstock.
»Was macht man nur einmal im Leben?«
»Heiraten.«
»Wenn du Mama heiratest, bist du danach mein Papa. Weil Mamas immer mit Papas verheiratet sind.«
»Ich werde immer dein Papa sein. Auch wenn ich nicht dein leiblicher Papa bin.«
»Was ist ein leiblicher Papa?«
Nathaniel schluckt. Er streckt die Hand aus, um durch Silas’ Haare zu wuscheln, doch er greift ins Leere.
»Nicht meine Frisur kaputt machen!«
In dem Moment hört Nathaniel, wie sich die Badezimmertür öffnet. Danke, Carole, perfektes Timing. Er hofft, dass Silas die Frage von vorhin schon vergessen hat.
»Na, wie sieht Mama aus?«, fragt Nathaniel.
»Wie die Prinzessin aus dem Märchen mit den sieben Zwergen. Nur ihre Nase ist größer«, erklärt Silas mit ernsthafter Stimme.
Ein Lächeln umspielt Nathaniels Lippen, das halb belustigt, halb traurig ist. Weil er Carole, seine Braut, noch nie gesehen hat und auch niemals sehen wird.
»Und Nathaniel sieht aus wie der tapfere Ritter, der mit der Prinzessin in den unsicheren Hafen der Scheinehe reiten wird«, sagt Carole lachend.
»Nathaniel ist kein Ritter. Ritter tragen Kleider aus Blech«, stellt Silas fest.
Nathaniel tippt auf seine Uhr. »Es ist dreizehn Uhr dreiunddreißig«, sagt eine Frauenstimme.
»Himmel, wir werden noch zu spät zu unserer Hochzeit kommen!«, ruft Carole laut.
Auf einmal bricht Hektik aus. Nathaniel lässt Alisha in ihr Blindenhund-Geschirr schlüpfen, Carole steckt Silas in die wärmste Winterjacke und stülpt ihm eine Mütze über. Als sie kurz darauf die Tür öffnen, erinnert das ungewöhnliche Vierergespann an aufgeschreckte Rennpferde, die aus der Startmaschine stürmen. Allen voran Alisha, die an ihrem Geschirr zerrt, als gelte es, als Erste über die Ziellinie zu kommen.
Es scheint ein ungeschriebenes, aber unumstößliches Gesetz zu sein, dass man immer die Rückansicht eines wegfahrenden Busses zu sehen bekommt, wenn man sowieso schon knapp dran ist. Ganz selten jedoch erweist sich das vermeintliche Pech im Nachhinein als wahres Glück. Caroles Schimpftirade über den verpassten Bus ist noch nicht verklungen, als Silas plötzlich zu winken beginnt. Caroles Blick folgt jenem ihres Sohnes und wandert auf die andere Straßenseite, wo eine betagte Dame heftig mit den Händen wedelt. Veronika.
»Was macht Veronika dort drüben?«, fragt Carole Nathaniel, obwohl er nicht einmal erahnen kann, dass Veronika in der Nähe ist.
»Veronika? Wo ist sie, was macht sie hier, sie wollte doch zum Standesamt kommen?«
»Sie will, dass wir hinübergehen«, sagt Silas.
Schlagartig dämmert es Carole, dass sie an der Haltestelle für den Bus in die entgegengesetzte Richtung stehen und um ein Haar den falschen genommen hätten. Sie blickt nach rechts und sieht, dass sich der andere Bus schon nähert, ruft laut »Avanti!«, und nicht nur Alisha gehorcht ihr aufs Wort, sondern auch der kleine und der große Mann, die mit ihr über die Straße eilen.
»Carole, dein Orientierungssinn ist so schlecht, dass sogar ein Blinder eher ans Ziel findet«, sagt Nathaniel, als er sich kurze Zeit darauf auf den Sitz im Bus sinken lässt. »Zum Glück haben wir Veronika!«
Exakt zwei Minuten und fünfundvierzig Sekunden bevor die Trauungszeremonie beginnt, trifft das Brautpaar mit seiner Entourage auf dem Standesamt ein. Milla atmet erleichtert aus. Sie hat in den letzten drei Minuten etwa alle zehn Sekunden auf die Uhr geschaut. Sie ist nervöser, als würde sie selbst vor den Altar treten.
»Wir haben schon befürchtet, ihr hättet es euch anders überlegt!«, ruft sie laut, als sie die Hündin Alisha die Treppe des Standesamts hochtraben sieht, dicht gefolgt von Nathaniel, Silas und Carole, und etwas später auch von Veronika, die mit dem Tempo der jüngeren Generationen nicht ganz mithalten kann. Milla und Veronika werden die Trauzeuginnen sein, Sandro, Silas und Alisha bilden die übrigen Hochzeitsgäste. Und obwohl alle wissen, dass diese Trauung nur stattfindet, damit den Behörden ein amtliches Papier vorgelegt werden kann, das ihnen vorgaukelt, Nathaniel und Carole seien ein Paar, sind sie doch alle aufgeregt, als würde hier eine große Liebe besiegelt. Tatsächlich geht es in dieser Geschichte um Liebe, allerdings um die Liebe zu diesem kleinen Jungen, für den die Anwesenden nur das Beste wollen.
Kaum haben sich alle begrüßt, öffnet sich die Tür zum Trauungszimmer. Der Mann, der sein Gesicht hinausstreckt, zieht die Nase kraus, als er die seltsam zusammengewürfelte Truppe im Warteraum erblickt. Dann tritt er zur Seite und bittet sie einzutreten.
Müsste man für eine TV-Komödie die Rolle eines überzeichneten Standesbeamten besetzen – dann wäre Beat Zwicker dafür gesetzt. Er sieht aus wie die menschgewordene Verkörperung seines Berufstandes. Zwicker ist etwas zu klein geraten, seine Nase ist spitz, das gelbliche Haar sorgfältig von rechts nach links über die Glatze gekämmt, und sein Teint sieht aus, als habe er die Sonne vor zehn Jahren das letzte Mal gesehen. Er wirkt überaus korrekt, ordentlich und langweilig.
Das Trauungszimmer hingegen sieht ganz anders aus, als man es erwarten würde. Der an sich schöne Raum mit Parkett, Wandtäfelung und Stuckverzierungen an der Decke ist verunstaltet mit einem runden Teppich mit Blumenmuster in einer nicht mehr definierbaren Farbe, die an abgestandenes Spülwasser erinnert. Darauf steht ein Tisch mit drei abgerundeten Ecken, der an Hässlichkeit kaum zu überbieten ist. Die Lampen, die darüber hängen, sehen aus wie zwei unterschiedlich große fliegende Untertassen. Und die Chromstahlstühle mit knallroten Polstern, die der Form einer Lippe nachempfunden sind, erinnern an das Filmset eines Pornostudios aus den Achtzigerjahren. Milla schaudert kurz, als sie den Raum betritt: Allein die Einrichtung wäre für sie ein Grund, ein Leben lang darauf zu verzichten, das Jawort zu geben.
Carole führt Nathaniels Hand an die Stuhllehne, er lässt sich ahnungslos auf das Lippenpolster sinken. Beat Zwicker weist Milla und Veronika an, rechts von ihm Platz zu nehmen.
Carole und Nathaniel haben die kürzere Version der Trauung gewählt, fünfzehn statt fünfundzwanzig Minuten, zum Glück. Der Standesbeamte wirkt zwar bemüht, seine wohl schon tausend Mal erzählte Geschichte über Rechte und Pflichten, die das Eheleben so mit sich bringt, auf unterhaltsame Weise von sich zu geben. Allerdings ist er der Einzige, der über die eingestreuten Witzchen lacht. Als er seine Rede beendet hat, richtet er das Wort zuerst an Nathaniel.
»Wollen Sie, Herr Nathaniel Brenner, mit der hier anwesenden Carole Marie-Claire Stein die Ehe eingehen, dann antworten Sie bitte mit Ja.«
Nathaniel schnappt zuerst nach Luft, wie ein Langstreckentaucher, der zu lange unter Wasser war, dann bringt er ein »Ja, ich möchte« zustande.
»Wollen Sie, Frau Carole Marie-Claire Stein, mit dem hier anwesenden Nathaniel Brenner die Ehe eingehen, dann antworten Sie mit Ja.«
Caroles »Ja, ich will« wird von einem schrillen Läuten übertönt. Sandros Handy. Milla schnellt herum, um ihm einen missbilligenden Blick zuzuwerfen, und sieht, wie er hastig versucht, den Ton auszuschalten.
»Ja, ich will«, wiederholt Carole, als wieder Stille herrscht.
»Und dieser Moment«, sagt Bruno Zwicker in verschwörerischem Tonfall, »gehört nun ganz allein … Ihnen beiden.« Dann dreht er sich diskret um, sodass er gar nicht mitbekommt, wie Carole und Nathaniel auf den Kuss verzichten.
Nachdem die Unterschriften an der richtigen Stelle unter die Papiere gesetzt sind, ist die Ehe zwischen der lesbischen Frau und dem blinden Mann besiegelt. Ein Raunen der Erleichterung geht durch die versammelte Runde, dass es vollbracht ist. Als Milla aufsteht, spürt sie Sandros Hand auf ihrer Schulter.
»Es tut mir leid, ich muss los.«
Milla kann nicht mehr zählen, wie oft sie diesen Satz schon gehört hat. »Was ist passiert?«
»Ein Kind ist verschwunden.«
5
Je näher Irena dem Dorf Innertkirchen kommt, desto hügeliger wird die Gegend und desto höher liegt der Schnee. Wie lieblich die Landschaft ist, denkt sie.
Wie trügerisch.
Die Hügel liegen wie erstarrte Wellen unter dem Blau des Himmels. Doch bald zieht sich die Landschaft zusammen, und die Hänge werden steiler. Die Häuser sind weiß-braune Würfel mit Ziegeldächern, unten Beton, oben dunkelgegerbtes Holz. Sogar die Bauernhöfe sehen aus wie Ferienchalets. Bilderbuchschweiz. Die Zeit scheint stehen geblieben zu sein.
Meine Zeit läuft rückwärts.
Für Irena fühlt sich die Fahrt an wie eine Reise in die Vergangenheit. Obwohl sie seit über zwanzig Jahren nicht mehr hier war, findet sie den Weg sofort. Viel hat sich nicht verändert. Die Bank ist keine Bank mehr, die Post nicht mehr die Post, beides wurde vor Jahren geschlossen. Das Restaurant Zum Goldenen Falken, einst ein stolzer Gasthof, ist jetzt eine Unterkunft für Asylsuchende. Doch die Häuser, die Straßen … So wie immer, als wäre Irena nur kurz weg gewesen, rasch in die Stadt gefahren, um Einkäufe zu erledigen. Doch zwischen dem Damals und dem Jetzt liegt ein halbes Leben. Es fühlt sich an, als sei es mehr als nur eine Ewigkeit.
Bevor Irena zu ihrem Elternhaus im Ortsteil Gadmen fährt, stoppt sie vor der Gemeindeverwaltung. Sie hat schon lange keinen Schlüssel mehr zum Haus, in dem sie aufgewachsen ist. Den hat sie in einer einsamen Nacht durch den Schlitz eines Abwasserschachts fallen lassen. Ein kaum vernehmbares Platschen weit unten. So hört sich Freiheit an, hat sie gedacht. Fünfzehn ist sie damals gewesen.
Noch ein Kind. Und doch schon zu erwachsen.
Der Wohnungsschlüssel ist bei der Gemeindeverwaltung deponiert, hat es in dem Schreiben geheißen, das sie vor wenigen Tagen erhalten hat und in dem sie aufgefordert wird, sich um das leerstehende Haus ihres verstorbenen Vaters zu kümmern. Der Tonfall ist nicht gerade freundlich gehalten und lässt durchblicken, dass es nicht unbemerkt blieb, wie sie selbst bei seiner Beerdigung gefehlt hat. Man macht sich in diesem Dorf keine Freunde, wenn man als einzige Tochter dem letzten Geleit fernbleibt. Ihr Cousin hat das Begräbnis schließlich organisiert und ihr die Rechnung zugestellt. Welch ein Schlusspunkt.
Und jetzt steht sie hier. Zunächst hatte sie beabsichtigt, eine Firma mit der Räumung und dem Verkauf des Hauses zu beauftragen. Doch dann … Sie weiß selbst nicht warum, aber auf einmal spürte sie, dass sie noch einmal in das Haus zurückmuss. Ein letztes Mal. Sie hat damals nicht viel mitgenommen, als sie fluchtartig ihr Heim verließ. Ein einziges Foto von Beni, das mittlerweile so abgegriffen ist, dass er darauf kaum mehr zu erkennen ist. Sie hat es als Jugendliche immer mit sich herumgetragen.
Obwohl sie im Augenblick, als sie ging, schon ahnte, dass eine Rückkehr ausgeschlossen sein würde, hat sie nicht mehr mitgenommen als diese eine Fotografie, dazu ein paar Klamotten, ihren Walkman, ihre liebsten Musikkassetten und drei Bücher. Irena weiß, dass sie auch dieses Mal nicht viel mitnehmen wird, ein Foto vielleicht oder zwei. Vielleicht eine kleine Erinnerung an sich selbst, an sich, als sie ein Kind war, aus der Zeit, als sie eine normale Familie waren. Falls noch etwas da ist. Gut möglich, dass ihr Vater alles weggeschmissen hat. Wahrscheinlich, denkt Irena, muss man sich der Vergangenheit stellen, um wirklich mit ihr abzuschließen.
Hoffentlich mache ich keinen Fehler.
Irena hat sich nicht angemeldet. Auf dem Schild neben dem Eingang liest sie, dass die Verwaltung nur noch vormittags geöffnet ist und in zehn Minuten schließt. Das Treppenhaus riecht nach altem Schulhaus, die Tür zum Büro des Gemeindeschreibers ist nur angelehnt, hier kann jeder ein und aus gehen, weil jeder jeden kennt.
Auch Irena kennt Gemeindeschreiber Müller, sie ist mit ihm auf dieselbe Schule gegangen. Manche gehen weg, manche bleiben für immer, doch kaum einer, der dem Dorf einmal den Rücken gekehrt hat, findet den Weg wieder zurück. Irena schaudert, als sie Simon Müller hinter dem Tresen an einem Schreibtisch sitzen sieht. Sein vorderer Schädel ist kahl, dafür hat er ein Doppelkinn, und auch um den Bauch herum hat er das Doppelte an Gewicht zugelegt. Irena betrachtet den gealterten Mann vor sich und überlegt, ob es ihm wohl genauso ergeht und er in ihr eine alte Frau sieht.
»Guten Tag, kann ich Ihnen helfen?«, fragt er förmlich, sichtlich überrascht, ein fremdes Gesicht zu sehen.
»Simon, ich bin’s, Irena. Irena Jundt. Schildknecht, früher.«
»Meine Güte, die Rena! Entschuldige, dass ich dich nicht gleich erkannt habe.« Er erhebt sich von seinem Stuhl und starrt sie an, als würde er zum ersten Mal im Leben eine Frau sehen.
Krieg dich wieder ein, denkt Irena, spricht es aber nicht laut aus. Sie setzt ein Lächeln auf. »Ich bin hier, um den Schlüssel zu meinem Elternhaus abzuholen.«
»Natürlich, natürlich. Willkommen zu Hause. Wir haben nicht damit gerechnet, dass du wirklich herkommst. Ist lange her. Lange her.« Noch immer steht er da wie ein Ölgötze und blickt sie an. »Sieh an, die Rena. Die Rena. Sieh an, sieh an.« Simon Müller streift sich die Hände an der Hose trocken und streckt ihr die Rechte hin.
»Kannst du mir den Schlüssel geben?«
Ein Ruck durchfährt Simon Müller, als habe ihn jemand aus einem Traum geschüttelt. »Natürlich, der Schlüssel.« Er geht hinüber zu einer Kommode, die aus Napoleons Zeit stammen muss, wühlt kurz in einer der Schubladen, dann streckt er ihr einen Schlüsselbund hin. Irena erstarrt.
Der Anhänger.
Der Schlüsselanhänger ist eine grellbunte Blume aus gebrannter Knetmasse. Sie selbst hat ihn gemacht und ihrer Mutter zum Muttertag geschenkt, zu ihrem letzten, den sie erlebt hat.
Energisch greift Irena nach dem Schlüssel und wendet sich ab.
»Rena!«, ruft Simon Müller, als sie schon in der Tür ist.
Irena hält inne und blickt sich noch einmal um.
»Melde dich, falls du Hilfe brauchst.«
Dankend nickt sie ihm zu. Dann ist sie draußen, nimmt zwei Stufen auf einmal. Sie will nicht, dass jemand ihre Tränen sieht.
Irena bleibt lange im Wagen sitzen. Er steht auf dem Parkplatz vor dem Haus, da, wo der alte Volvo Kombi des Vaters immer gestanden hat. Aus den Boxen dröhnt Iron Maiden. Als müsse sie sich mit hartem Sound aufputschen, bevor sie in den Ring steigt.
Benis Musik.
Sie hat Heavy Metal nie gemocht. Hat Iron Maiden erst angefangen zu hören, als Beni weg war. Nachdem die letzten Töne von Only The Good Die Young ausgeklungen sind, öffnet Irena die Autotür und steigt aus.
Das Geklimper des Schlüssels im Schloss ist trotz allem ein vertrautes Geräusch. Als sie in den Flur tritt, stellt sie fest, dass es anders riecht als früher. Ein fremder Geruch, der nichts mit ihr und ihren Erinnerungen zu tun hat. Doch alles andere ist genauso, wie sie es im Gedächtnis abgespeichert hat. Die Garderobe. Der Spiegel. Der Schirm im Schirmständer, es ist immer noch der gleiche. Vaters Jacke, die da hängt, als würde er nebenan in der Stube auf dem Sofa sitzen. Irena ringt auf einmal um das Gleichgewicht, sie muss sich setzen, in der Küche, ein Stuhl. Sie greift danach und lässt sich darauf fallen. Ein Druck auf ihrem Herzen, als hätte eine Faust es umschlossen. Ihr ist schlecht. Am liebsten würde sie hinausrennen, die Tür hinter sich zuschlagen und nie mehr zurückkehren. Doch das geht nicht.
Der alte Küchentisch. Irena fährt mit der Hand über die Kante, fühlt die Kerbe, die sie mit dem Messer hineingeschnitzt hat. Der Vater hat ihr auf die Finger gehauen und gedroht, sie müsse fortan mit den Händen essen, wenn sie das noch einmal mache. Dieselben ausgeblichenen Kissen auf den Stühlen. An den gelben Platten an der Wand kleben Blumensticker, die es gratis zu jeder Spülmittelflasche gegeben hat. Irena erinnert sich, dass Beni und sie sich darüber gestritten haben, wer sie ankleben darf.
Sie steht auf, nimmt ein Glas aus dem Schrank, füllt es mit Wasser und trinkt es in einem Zug leer. Unsicheren Schrittes geht sie hinüber ins Wohnzimmer. Das alte Sofa, auf dem sie bereits als Kind gesessen hat. Ein riesiger, neuer Fernseher. Der orange Teppich ist verschwunden und durch einen beigen ersetzt worden, der bereits ausgetreten ist. Dieselben Vorhänge. In der hinteren Ecke der alte Sekretär, ein Erbstück der Großmutter. Die aufgestellten Bilderrahmen sind noch da. Irena kennt jede Fotografie, auch wenn die Aufnahmen verblasst sind. Beni als kleiner Bub im Planschbecken, das der Vater im Garten aufgestellt hatte. Beni an seinem ersten Schultag. Das Hochzeitsfoto ihrer Eltern. Beni auf seinem neuen Fahrrad, kurz bevor er verschwand.
Kein Bild von mir.
Das Fahrrad hat man später gefunden, in einem Graben neben der Straße, die Richtung Stadt führt.
Aber von Beni fehlt bis heute jede Spur.
6
»Ein Junge ist verschwunden.« Florence Chatelat hält ihrem Chef Sandro Bandini die Tür auf, sie sind genau gleichzeitig im Polizeipräsidium eingetroffen. »Er ist erst sechs.«
»Wie lange ist er schon weg?«
»Seit heut Morgen um halb acht.«
Automatisch blickt Sandro auf die Uhr. Es ist kurz vor drei. Das kann alles bedeuten: dass der Bub gleich wieder auftaucht oder dass er schon tot ist.
»Ist mittags nicht nach Hause gekommen, und als die Mutter den Kindergarten anrief, erfuhr sie, dass er gar nicht dort war«, fährt Florence fort.
Sechsjährige laufen manchmal weg, packen das Stofftier ein oder das Spielzeugauto und steigen in den erstbesten Zug, weil sie sich über die Mutter geärgert haben, vielleicht weil sie verlangt hat, dass das Zimmer aufgeräumt wird. Und dann finden sie nicht wieder nach Hause zurück. Oder sie verunfallen bei einem kleinen Abenteuer, das auf einmal zu einem ganz großen wird. Und manchmal, denkt Sandro, werden sechsjährige Buben entführt, sexuell missbraucht und ermordet. Gilt ein Kind als vermisst, tritt für ihn immer der Ernstfall ein, und zwar ab dem ersten Augenblick.
»Wissen wir schon was über die Familie?«, fragt er Florence, als er neben ihr die Stufen hoch eilt.
»Wir fahren gleich zu ihr«, antwortet Felix Winter an ihrer Stelle, der ihnen im Treppenhaus entgegenkommt. Florence und Sandro machen kehrt, wenig später sitzen sie zu dritt im Polizeiwagen.
»Der Junge heißt Fabio Della Fortuna, seine Eltern haben italienische Wurzeln, sind aber beide hier zur Welt gekommen. Nichts bekannt über häusliche Gewalt oder Streitereien in der Familie, keine polizeilichen Vorkommnisse.« Felix Winter bringt seinen Chef und seine Kollegin auf den aktuellen Stand, während er das Auto durch den Verkehr steuert. Er ist der Älteste im Team der Abteilung Leib und Leben der Kantonspolizei Bern, und er hat alles gesehen, was man in einer langen Karriere als Ermittler zu Gesicht bekommen kann. Oder zu Gesicht bekommen muss. Doch wenn es um Kinder geht, ist es vorbei mit seiner Abgeklärtheit. Kinder als Opfer erschüttern ihn noch immer wie am ersten Tag. Und verschwundene Kinder rufen ungute Erinnerungen wach.
»Ist er schon einmal weggelaufen?«, fragt Sandro.
»Nicht dass ich wüsste, aber ich hatte den Vater nur kurz am Telefon, er war völlig aufgelöst. Ich habe ihm versprochen, dass wir gleich vorbeikommen.«
»Was denkst du?« Sandro ist zwar der Chef des Teams, doch Felix ist derjenige mit dem schärfsten Instinkt. Man mag es Erfahrung nennen oder Bauchgefühl – seine Intuition hat ihn noch selten getäuscht.
»Ich weiß es nicht.« Felix zögert. »Was mich beunruhigt: Der Junge ist ausnehmend hübsch.«
Augenblicklich hat Sandro ein anderes Bild im Kopf – ein Bild aus seiner eigenen Kinderzeit. Die Fotografie eines Jungen: wilde schwarze Locken, dunkle Augen, strahlendes Lachen. Ausnehmend hübsch. Die Vermisstenmeldung hing in jedem Schaufenster, im Supermarkt an der Kasse, beim Metzger am Tresen, als Sandro selbst gerade erst um die zehn Jahre alt war. Er weiß noch, wie er die Fotografie immer wieder angeschaut hat, dem etwa gleichaltrigen Jungen in die Augen geblickt hat, und sich nicht hat vorstellen können, dass er einfach verschwunden und womöglich tot war. Und daneben hingen weitere Kinderbilder. Innerhalb weniger Jahre waren damals in der Schweiz mehrere Mädchen und Jungen entführt worden. Sandro erinnert sich noch heute an jedes einzelne Gesicht, an jeden Namen. Einige der Kinder wurden Tage oder Wochen später ermordet aufgefunden, andere gelten bis heute als vermisst. Seit dreißig Jahren fehlt von ihnen jede Spur.
Die schrecklichen Verbrechen in den Neunzigerjahren haben eine ganze Generation geprägt. Sandros Eltern reagierten schon panisch, wenn er mal eine Viertelstunde zu spät vom Spielen nach Hause kam. Sie hatten ihm eingebläut, dass er laut losbrüllen und weglaufen müsse, falls er von einem Fremden angesprochen würde. Jeder hatte Angst, auch Sandro. Doch gleichzeitig spürte er eine unheimliche Faszination darüber, dass etwas so Unfassbares passieren konnte: dass ein Kind, wie er eines war, plötzlich weg war – und nie mehr gefunden wurde.
Gut möglich, dass es mit ein Grund war, warum er heute das ist, was er ist: Ein Polizist, für den der Beruf viel mehr bedeutet als bloß bezahlte Arbeit. Und der gerade jetzt unterwegs ist zu einer Familie, deren Kind verschwunden ist. Sandro wird alles daran setzen, den Kleinen zu finden.
Die Familie Della Fortuna wohnt im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses in Toffen, einem Dorf, das etwa zwanzig Kilometer vor Bern liegt. Als Sandro auf die Klingel drückt, hofft er, dass der Name ein gutes Omen ist; dass den Della Fortunas das Glück nicht abhandengekommen ist.
Die Augen des Mannes, der ihnen die Tür öffnet, sind gerötet. Er bemüht sich, Haltung zu wahren.
»Haben Sie schon etwas gehört?« fragt er, ohne eine Begrüßung abzuwarten.
»Herr Della Fortuna? Mein Name ist Sandro Bandini, ich bin der Leiter der Abteilung Leib und Leben der Kantonspolizei Bern. Wir sind hier, weil wir Informationen brauchen, um sofort mit der Suche zu beginnen.«
»Leib und Leben? Das ist doch die Mordkommission? Sie denken, dass unser Fabio schon tot ist?« Luigi Della Fortuna wird von einem tiefen Schluchzen geschüttelt. Noch bevor Sandro antworten kann, tritt er einen Schritt zurück und lässt sie hinein. Im Wohnzimmer kommt ihnen eine Frau entgegen, die wesentlich gefasster wirkt als ihr Mann. Ein kleines Mädchen klammert sich an ihrem Bein fest und versucht, sich dahinter zu verstecken.
»Wir werden Ihnen alle Informationen geben, die Sie brauchen. Fragen Sie!«, fordert sie die Polizisten auf.
»Wir glauben nicht, dass Fabio schon tot ist«, sagt Sandro. »Und wir werden alle Hebel in Bewegung setzen, ihn lebend zu finden. Wir haben Fabio sofort polizeilich ausgeschrieben und das Bild, das Sie uns geschickt haben, an alle Streifen ausgegeben.« Sandro spricht bewusst langsam und ruhig, er weiß, dass sich die Eltern in einem absoluten Ausnahmezustand befinden. »Damit wir gezielt suchen können, müssen wir Ihren Sohn ein wenig kennenlernen.«
»Ich würde mich gerne in Fabios Zimmer umsehen, während Sie mit meinen Kollegen sprechen, darf ich?«, fragt Felix Winter.
»Natürlich. Es ist die zweite Tür links.« Angela Della Fortuna weist in den hinteren Teil der Wohnung, bevor sie Sandro und Florence bittet, am Tisch Platz zu nehmen.
»Ist Fabio schon einmal zu lange weggeblieben oder nicht in den Kindergarten gegangen?« Sandro hat sein altmodisches schwarzes Notizbuch und den silberfarbenen Kugelschreiber aus der Tasche gezogen. Vor Florence liegt ein Tablet.
»Nein, er war ein lieber Junge, er hat uns nie Sorgen bereitet. Fabio würde nicht freiwillig den Kindergarten schwänzen. Er ist im letzten Jahr und geht seit sechs Monaten alleine hin, er ist noch nie zu spät gekommen.« Es ist die Mutter, die das Reden übernommen hat. Der Vater hat das Gesicht in seine Hände gelegt. Sein Schluchzen ist in ein lautloses Weinen übergegangen.
»Um wie viel Uhr hat er das Haus verlassen?«
»Um halb acht, wie jeden Morgen.«
»Hat ihn jemand beim Kindergarten gesehen?«
»Ich glaube nicht.«
»Wir brauchen die Telefonnummern seiner Erzieherin, der Eltern der anderen Kinder und von allen anderen Freunden, mit denen er manchmal spielte. Und ich möchte, dass Sie mir den Weg zeigen, den Fabio normalerweise nimmt. Hatten Sie in den letzten Tagen oder heute Morgen Streit mit Fabio? Hat ihn etwas geärgert?«
»Nein. Er war wie immer.«
Sandro versucht, sich nicht anmerken zu lassen, dass seine Sorgen mit jedem Satz, den die Mutter spricht, größer werden. Er wirft Florence einen Blick zu und nickt kaum wahrnehmbar in Richtung Fabios Vater, der zusammengesunken auf dem Stuhl sitzt, nur noch ein Schatten seiner selbst. Florence versteht den Wink und greift zum Telefon, um den psychiatrischen Dienst zu verständigen.
»Hatte Fabio ein Handy dabei?«
»Nein, er hat kein Handy. Wir dachten, er sei noch zu jung.«
Angela Della Fortuna senkt den Blick, als ob sie sich schuldig fühlte. Weil sie denkt, dass das alles nicht passiert wäre, wenn sie ihm ein Handy gekauft hätte.
»Spielt Fabio Computer?«
»Nein. Er macht sich nicht viel aus solchen Dingen. Er spielt lieber Fußball. Er träumt davon, Profifußballer zu werden. Ich weiß, davon träumt wohl jeder Junge. Aber er ist wirklich begabt.«
»Ist er zu Fuß zum Kindergarten gegangen? Allein oder mit einem Freund?«
»Er hat ein Skateboard, und er ist immer alleine gegangen.«
Wieder schaut sie beschämt zu Boden. Sandro ahnt, was ihr durch den Kopf geht. Und das ist erst der Anfang. Die Selbstvorwürfe, so unberechtigt sie auch sein mögen – sie wird sie nie mehr loswerden, wenn Fabio nicht unversehrt wieder auftaucht.
»Können Sie uns so genau wie möglich beschreiben, welche Kleidung Fabio heute trägt?«, führt Sandro die Befragung fort.
»Blaue Jeans, einen weißen Pullover mit Snoopy drauf. Seine Winterjacke ist rot, und er trägt eine bunte Strickmütze mit einem großen Bommel dran, die Nonnina hat sie ihm gestrickt. Regenbogenfarben.«
Sandro schreibt alles in sein kleines schwarzes Buch. Dank seiner italienischen Wurzeln weiß er, dass Nonnina das italienische Kosewort für Großmutter ist. »Und die Schuhe?«
»Hohe schwarze Moonboots. Steht sogar drauf, Moonboots, in weißer Schrift. Mit Schnürsenkel rund um den Stiefel.«
Nur eine Mutter, die sich wirklich um ihr Kind kümmert, kann so genau beschreiben, was es trägt, wenn es am Morgen das Haus verlässt, denkt Sandro. Beim Blick auf die Wohnung drängt sich ihm ein zweiter Gedanke auf: Hier ist kein Geld zu holen. Der Entführer – wenn es einen gibt – ist kein Erpresser, der reich werden will. Sein einziges Interesse gilt dem Kind. In dem Moment tritt Felix Winter ins Wohnzimmer und wechselt mit Sandro einen Blick.
Sandro wendet sich wieder Angela Della Fortuna zu. »Wir werden die Kollegen vom kriminaltechnischen Dienst vorbeischicken, um Fingerabdrücke und DNA von Fabio sicherzustellen. Und können Sie mir die Adresse seines Arztes und seines Zahnarztes geben?«
»Sie denken, Fabio ist tot.«
»Nein. Wir gehen davon aus, dass er lebt. Aber wir müssen alle Maßnahmen treffen. Wir werden jetzt gleich mehrere Teams losschicken, um die nähere Umgebung abzusuchen, auch die Nachbarhäuser, die Keller, vielleicht ist er irgendwo reingeklettert und kommt nicht mehr heraus. Und wir werden mit allen Erziehern sowie Kindern aus dem Kindergarten sprechen und den Weg absuchen sowie die Anwohner befragen.«
»Sie müssen ihn finden.« Die Stimme des Vaters droht zu versagen. Seine Augen sind nass und geschwollen.
»Wir werden alles tun, was möglich ist.« Sandro macht in seinem Job keine Versprechungen mehr. Er hat früh gelernt, dass er sie nicht immer halten kann. Auch wenn er sich nichts mehr wünschte als das.
7
Die Tage sind zu kurz im Februar. Die letzten Sonnenstrahlen haben das Tal bereits verlassen, und die Dunkelheit bettet sich träge auf die Hügel. Eiskristalle nehmen die Fensterscheiben in Beschlag. Irena schaut hinaus auf das Dorf, das ihr so vertraut und doch so fremd geworden ist. Sie zieht die Vorhänge zu. Mitten in der Bewegung hält sie inne, sie meint, im Garten etwas wahrgenommen zu haben, oder jemanden, einen Schatten, auf jeden Fall eine Bewegung. Sie kneift die Augen zusammen. Da ist nichts. Vielleicht war da auch nichts. Doch es bleibt ein ungutes Gefühl. Sie fühlt sich nicht wohl in diesem Haus.
Im Haus des Todes.
Irena erschrickt ob ihres Gedankens und wischt ihn weg. Sie macht das Licht an und steigt die Treppe hoch in den ersten Stock. Drei Zimmer. Das Elternschlafzimmer, die beiden Kinderzimmer. Das Bett ihres Vaters, das einst das Ehebett war, ist gemacht. Sie klopft mit der Hand auf die Tagesdecke, Staub wirbelt auf. Die letzten vier Monate seines Lebens hat ihr Vater im Altersheim verbracht, seither hat niemand mehr das Haus betreten. Auf dem Nachttisch steht eingerahmt eine alte Fotografie ihrer Mutter, eine junge Frau, wohl etwas über zwanzig, also etwa halb so alt wie Irena heute.
Sie setzt sich auf das Bett, nimmt das Bild in die Hand.
Wie schön sie war.
Vielleicht hat Vater Mutter tatsächlich geliebt. Auf jeden Fall hat er ihr Bild nie weggestellt.
Sie hat es nicht verkraftet. Nach Beni ist auch Irenas Mutter langsam verschwunden. Die Trauer hat sie aufgefressen. Als sie die Hoffnung verlor, dass Beni noch leben könnte, hat sie sich mehr und mehr zurückgezogen. Sie war nicht mehr präsent, nahm Irena nicht mehr wahr, fast so, als wäre ihre Tochter für sie unsichtbar geworden. Für sie gab es nur noch Beni, den es nicht mehr gab. Zuletzt kam ihre Mutter nicht einmal mehr zum Essen aus dem Zimmer, sodass Irena ihr die Teller ans Bett bringen musste. Doch irgendwann hörte sie auch auf zu essen. Und eines Morgens war sie tot. Tabletten, hat der Arzt gesagt. Niemand weiß, wann und wo sie sich die Medikamente besorgt hat.
Sie sei zu Beni gegangen, haben die Leute an der Beerdigung zu Irena gesagt.
Sie hat mich alleine zurückgelassen, hat Irena gedacht.