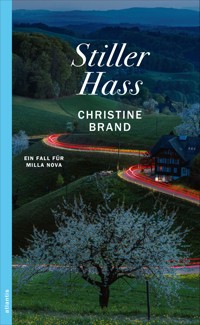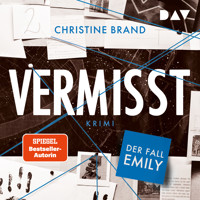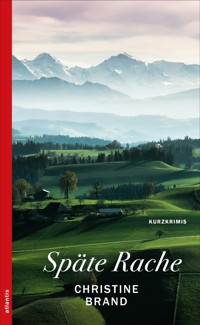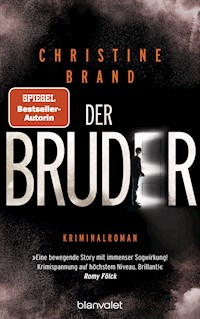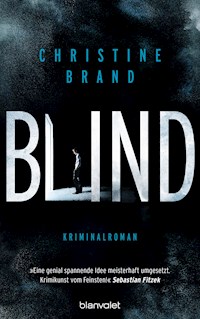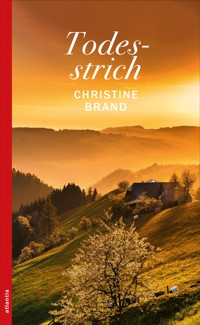
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- E-Book-Herausgeber: Atlantis VerlagHörbuch-Herausgeber: AUDIOBUCH
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Drei Menschen, drei Welten: Lisa Kunz ist die neue Leiterin des Dezernats Leib und Leben der Kantonspolizei Bern, jener Abteilung, die sich mit den schlimmsten aller Verbrechen befasst: mit Totschlag und Vergewaltigung, mit vorsätzlicher Tötung und kaltblütigem Mord. Schon als Kind hat sie lieber Detektivin als mit Puppen gespielt und wähnt sich am Ziel ihrer Träume. Renate Berger hat geglaubt, dass sie es vielleicht doch noch schaffen kann, dass mit der Geburt ihrer Tochter ein neues Leben beginnt, ein Leben ohne Drogen. Aber die Sucht ist stärker. Bruno Bärtschi ist ein Mann vom Land, klein gewachsen, grob kariertes Hemd, schwere Schuhe, Hände wie Pranken. Er ist das mittlere von neun Kindern und der Einzige, der bei seiner Mutter auf dem elterlichen Hof geblieben ist und in dem Zimmer schläft, in dem er sein ganzes Leben geschlafen hat. Drei Geschichten, die unaufhaltsam aufeinander zusteuern und unwiederbringlich miteinander verwoben werden, als eine Prostituierte vom Berner Drogenstrich spurlos verschwindet.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 406
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Christine Brand
Todesstrich
Kriminalroman
atlantis
1
Der Regen prasselte gegen die Frontscheibe. Alle dreiSekunden gab der linke Scheibenwischer ein widerliches, klagendes Geräusch von sich. Sie fragte sich, warum er ihn nicht einfach ausschaltete. Draußen war die Nacht tiefschwarz, einzig die Autoscheinwerfer bohrten zwei helle Streifen in die Finsternis. In den beiden Lichtkegeln, die auf den Feldweg fielen, sah der Regen aus wie viele Bindfäden. Im Wagen brannte die schwache Innenbeleuchtung. Der Motor war ausgeschaltet. Aus den Lautsprechern trällerte eine dünne Frauenstimme eine farblose Melodie. Er hatte sie an den Stadtrand gefahren, weiter hinaus, als ihr lieb war. Er war ihr fünfter Freier. Danach würde sie Schluss machen für heute Nacht. Feierabend. Das Geld sollte ausreichen, um sie für zwei Tage mit genügend Stoff zu versorgen. Ihre langen braunen Haare waren noch immer nass vom Regen. Auch die dünnen Strümpfe, die ihr bis zur Mitte der Oberschenkel reichten und die sie mit Strumpfhaltern befestigt hatte, waren feucht und klebten unangenehm an ihren Beinen. Sie trug ihren sehr kurzen roten Rock, für den es längst zu kalt war. Über ihr ärmelloses Top hatte sie sich den tief ausgeschnittenen schwarzen Strickpullover gezogen. Trotzdem war sie völlig durchgefroren und froh, dass sie bald fertig sein würde.
Sie kannte den Freier. Er war schon einige Male ihr Kunde gewesen. Bislang hatte er immer anstandslos gezahlt und sich einigermaßen anständig aufgeführt. Etwas grob, manchmal. Aber dafür würde die Sache schnell erledigt sein. Dachte sie. Doch sie täuschte sich. Noch bevor sie sich über die Abwicklung des Geschäfts unterhalten hatten, packte er sie unvermittelt mit eisernem Griff am Handgelenk. Sie starrte ihn erschrocken an, suchte in seinen Augen nach etwas, das ihr zeigte, dass er bloß einen üblen Scherz mit ihr spielte. Sie fand nichts. Panik durchfuhr sie. Doch bevor sie reagieren konnte, wälzte er sich blitzschnell auf sie, legte ihr einen Draht um den Hals und zog zu. Sie versuchte, sich zu wehren, bäumte sich auf, trat um sich, wollte kämpfen, für sich und ihr verpfuschtes Leben – und stellte fest, dass ihre Kraft rasch schwand. Er keuchte ihr seinen warmen Atem ins Ohr. Sie rang vergebens nach Luft und war erstaunt, wie schnell es ging. Sie hörte sich röcheln, hörte die unmenschlichen Laute, die von ihr selbst stammen mussten. Sie schmeckte Metall und Blut. Das Letzte, das sie spürte, war dieser brennende Schmerz im Hals. Ein unwirklicher Schmerz. Dann war alles nur noch schwarz.
Nach wenigen Minuten war Karin Wälti tot.
2
»Das Büromaterial befindet sich draußen im Gang im grauen Korpus. Dort finden Sie alles, was Sie brauchen: Kugelschreiber, Filzstifte, Kuverts in allen Größen, Briefpapier et cetera et cetera. Locher, Schnellhefter oder Hängeregister können Sie direkt bei mir bestellen.«
Die kleine rundliche Frau aus dem Chefsekretariat redete ohne Unterlass. Ihre Stimme klang unangenehm hoch, schrill fast. Ihre Haare waren rot gefärbt und dünn, genau wie ihre Lippen. Die Augenbrauen hatte sie sich ausgezupft und durch einen dick aufgemalten Strich ersetzt. Ihr Alter? Schwierig zu schätzen. Aber es war gut vorstellbar, dass sie dieselbe Einführung schon einige Male in einem Ton von solch militärischer Schärfe zum Besten gegeben hatte.
»Den Eingangs-Badge haben Sie bereits erhalten, die Visitenkarten werden nächste Woche da sein. Die Blumen auf dem Pult sind vom Regierungsrat; Sie sollten sich bei ihm bedanken.«
Lisa Kunz nickte artig und ließ den Wortschwall widerstandslos über sich ergehen. Doch als sich die kleine Frau, die Mathys oder Marti hieß – Lisa Kunz hatte leider ein miserables Namensgedächtnis –, kurz abwandte, verdrehte sie hinter ihrem Rücken die Augen. Schlimmer als Mutter, dachte sie.
»Wenn Sie irgendetwas brauchen oder ein Problem haben, rufen Sie mich unverzüglich an. Ich habe Ihnen meine direkte Durchwahl auf einem Post-it auf das Pult geklebt.«
»Vielen Dank für Ihre Bemühungen, Frau …«
»Mathys, mein Name ist Mathys«, sagte die Sekretärin beleidigt. Sie schob sich ihre goldgerahmte Brille auf der Nase zurecht, marschierte Richtung Tür und blickte noch einmal zurück. »Und vergessen Sie nie, die Fenster zu schließen, wenn Sie nach Hause gehen. Abends frischt ein Wind auf, der Ihnen sonst alles durcheinanderbringt.«
Wiederum ein artiges Nicken. Sie meinte es ja nur gut. Lisa Kunz erntete einen letzten strengen Blick der Sekretärin, als hätte sie ihre Gedanken gelesen. Dann schloss Frau Mathys energisch die Tür hinter sich. Lisa Kunz atmete laut auf. Endlich Ruhe. Endlich hatte sie ein paar Minuten für sich.
Sie stand in einem riesigen Büro mit überhoher Decke und blickte aus dem Fenster. Unter ihr schlang sich das grüne Band der Aare um die Stadt. Der Fluss strahlte eine Ruhe aus, die trügerisch war. Sie wandte sich ab, blickte zum Schreibtisch, zum neuen schwarzen Bürostuhl; aus Leder, auf Rädern, mit einer hohen Lehne. Ein richtiger Chefsessel. Ein Lächeln streifte ihr Gesicht, sie konnte es noch immer kaum glauben. Unauffällig ballte sie die Hand zur Faust.
»Jawohl! Ich habe es geschafft!«, sagte sie laut zu sich selbst.
Sie war einen langen Weg gegangen, der kurvig, steinig, nicht immer einfach gewesen war. Doch sie hatte sich nicht bremsen lassen durch die vielen Hindernisse, die ihr, teils mit Absicht, immer wieder vor die Füße geworfen worden waren. Jetzt spürte sie eine tiefe Befriedigung. »Ich bin der Chef. Weil ich gut bin. Weil ich es allen bewiesen habe!« Am liebsten hätte sie es laut in die Welt hinausgeschrien, doch sie begnügte sich mit dem leisen Selbstgespräch. Es hörte sich auch so gut an.
Lisa Kunz war eine groß gewachsene, athletisch gebaute Frau mit dunklen Augen und einem frech und kurz geschnittenen blonden Haarschopf. Sie hatte eine kleine Nase, die nach ihrem Geschmack eher zu klein war, und hohe Wangenknochen, die sie härter erscheinen ließ, als sie in Wirklichkeit war. Aber sie hatte ein hübsches, symmetrisches Gesicht, mit einem reinen, hellen Teint. »Ein Gesicht für die Werbung«, hatte ihr ein Freund einmal gesagt, der in der Grafikbranche arbeitete. Am besten hätte sie wohl in einen Werbespot für modische Outdoorkleidung gepasst. Doch das Modeln überließ sie lieber anderen. Überhaupt war sie dafür viel zu alt. Lisa Kunz war gerade einundvierzig geworden, und die Vergänglichkeit hatte soeben damit begonnen, sich mit kleinen Hinweisen immer wieder in ihr Bewusstsein zu drängen. Die ersten Falten, die ersten grauen Haare. Ein Alter, in dem nahezu alle ihre Freundinnen verzweifelt und zuweilen mit unnatürlichen Mitteln doch noch versuchten, eigenen Nachwuchs in die Welt zu setzen.
Sie selbst verfolgte zurzeit ein ganz anderes Projekt. Seit heute stand sie dem Dezernat Leib und Leben der Kantonspolizei Bern vor, jener Abteilung, die sich mit den schlimmsten aller Verbrechen befasste: mit Totschlag und Vergewaltigung, mit vorsätzlicher Tötung und kaltblütigem Mord. Das »Gräueldezernat«, wie ihr Mann Marc zu sagen pflegte. Sie konnte ihm in diesem Punkt nicht widersprechen. Manchmal schien es ihr, als behielte er immer recht. Ab sofort war sie also Chefin dieses Gräueldezernats, Chefin von einer Handvoll Frauen – und fast dreißig Männern. Und sie wollte jedem und jeder einzelnen von ihnen beweisen, dass der Entscheid des Polizeikommandanten Martin Schürch, sie auf den Chefsessel zu hieven, richtig gewesen war.
Denn Lisa Kunz fand, sie sei eine gute Polizistin. Und sie war sich ziemlich sicher, dass sie auch hier, so weit oben auf der Leiter, eine gute Chefin sein würde.
Schon als kleines Kind war ihr klar gewesen, dass sie zur Polizei gehen musste. Das war weder Wunsch noch Wahl gewesen, sondern eine Erkenntnis, ein Auftrag, der einzig mögliche, der vorgezeichnete Weg. Während andere Mädchen noch mit ihren Puppen spielten, hatte sie als »Detektivin« bereits fiktive Verbrechen aufgeklärt. Sie hatte sich einen Detektivausweis gebastelt, war heimlich durch das Dorf geschlichen, hatte dessen Bewohner beobachtet und ausspioniert, und alles und jeder waren ihr verdächtig erschienen. In jedem zweiten Quartierbewohner hatte sie einen potenziellen Mörder erkannt. Am liebsten hätte sie sie alle verhaftet und hinter Gitter gebracht – was sich allerdings als ein nicht ganz so einfaches Unterfangen herausgestellt hatte, für das kleine Mädchen, das sie damals war. Später dann hatte sie in einem Anwaltsbüro eine kaufmännische Lehre absolviert, weil die nicht zu lange dauerte, und unmittelbar danach, als sie das verlangte Mindestalter endlich erreicht hatte, war sie zur Polizei gegangen. In der Polizeischule war sie eine der ersten Frauen gewesen und hatte davon profitiert, dass die Polizei zwar noch immer eine Männerdomäne war, aber gleichzeitig eine gewisse Sensibilisierung in Sachen Geschlechterfrage stattgefunden hatte. So war zum Beispiel die Erkenntnis, dass eine vergewaltigte Frau sinnvollerweise von einer Frau und nicht von einem Mann befragt werden sollte, nach und nach auch in das überaus männliche Bewusstsein der Polizeibeamten gedrungen. Da es im Polizeidienst damals noch nicht viele Frauen gab, kam Lisa Kunz schon früh und oft zu solchen Einsätzen, und einem Karrieresprung direkt in die Abteilung für schwere Straftaten stand nichts im Wege. Nicht unbedingt zur Freude ihrer männlichen Kollegen, die manchmal jahrelang auf einem weniger spektakulären Außenposten sitzen blieben. Aber Lisa Kunz war selbstbewusst genug, um ihren beachtlichen Werdegang nicht bloß der sogenannten Frauenförderung zuzuschreiben. Sie wusste, dass sie nicht nur eine gute Polizistin war, sondern auch in allen Situationen die Übersicht behielt, sich nie auf nur einen einzigen Lösungsweg einschoss – und vor allem, dass sie über ein untrügliches Bauchgefühl verfügte. Letzteres würde sie zwar nie so kommunizieren. Es würde zu ihrem Nachteil ausgelegt, nähme sie das Wort Bauchgefühl auch nur in den Mund. Ihre Kollegen würden die Aussage überheblich als Weibersache abtun und sie selbst als unglaubwürdig darstellen. Doch ihr Instinkt, mochte er auch noch so weiblich sein, hatte sie bislang noch nie im Stich gelassen. In den allermeisten Fällen war auf ihren Bauch Verlass. So sehr, dass es ihr manchmal selbst fast unheimlich war.
Ein energisches Klopfen unterbrach abrupt ihre Gedankengänge, und die Tür öffnete sich, ehe Lisa Kunz reagieren konnte. Günther Schwarz, der oberste Staatsanwalt des Kantons Bern, trat schwungvoll in ihr Büro und kam mit ausgestrecktem Arm auf sie zu, um ihre Hand so fest zu drücken, dass es fast schmerzte.
»Ich gratuliere dir von Herzen!«, rief er fröhlich in den Raum.
Sie hatte das Gefühl, dass er es ehrlich meinte.
Günther Schwarz sah ganz und gar nicht so aus, wie man sich einen leitenden Staatsanwalt vorstellte: Mitten in seinem Gesicht prangte unübersehbar ein Zwirbelschnauz, dessen beide Enden in sorgsam gepflegte Spitzen ausliefen. Er war sein ganzer Stolz – und das einzige Haarbüschel an seinem Kopf. Sein Schädel war kahl, was sich mit seinem Alter von dreiundsechzig Jahren begründen ließ; sein Bauch war rund, was er gerne demselben Umstand zuzuschreiben pflegte. Seiner fülligen Statur hatte er es wohl auch zu verdanken, dass sein Gesicht noch immer nahezu faltenfrei war und rund und weich wirkte, was ihm einen außerordentlich zufriedenen und freundlichen Ausdruck verlieh – was allerdings trügerisch war. Einzig seine listigen Augen und sein wacher, scharfer Blick ließen vermuten, dass man es bei ihm nicht mit dem netten Großvater von nebenan zu tun hatte. Obwohl Schwarz, wenn es denn sein musste, durchaus fähig war, in ebendiese Rolle zu schlüpfen. Lisa Kunz kannte Schwarz seit einigen Jahren und schätzte ihn und seine Art.
»Eine Sekunde, ich bin gleich wieder da«, sagte Günther Schwarz und verschwand draußen im Gang, um sogleich wieder in der Tür aufzutauchen. Er zog einen kleinen Transportwagen hinter sich herein. Aktenordner türmten sich darauf, prall gefüllt mit Dokumenten über Abgründe und Schicksale.
»Ich hoffe, die Sammlung ist vollständig.« Schwarz deutete auf die vielen Ordner. »Es war gar nicht so einfach, an die Akten heranzukommen. Ich habe Frau Mathys bei jedem einzelnen deiner Mitarbeiter vorbeigeschickt – und offenbar musste sie dem einen oder anderen etwas Druck machen.«
»Dann richte Frau Mathys meinen Dank aus«, erwiderte Lisa Kunz lachend. Sie konnte sich nur zu gut ausmalen, wie die kleine, zackige Frau den Polizisten Feuer unter dem Hintern gemacht haben mochte.
»Ich werde es weitergeben«, versprach Schwarz. »Die Ordner sollten alle Fälle enthalten, die dich ab heute beschäftigen könnten. Aber natürlich kommen wöchentlich neue hinzu. Ach, was sag ich, wöchentlich … täglich, beinahe! Es sind düstere Zeiten, stell dich darauf ein, nichts ist mehr wie früher. Es gibt viel zu tun.«
Lisa Kunz nickte. »Ich weiß nur zu gut, wovon du sprichst.«
Sie hatte darum gebeten, über alle anhängigen und ungelösten Fälle informiert zu werden, damit sie sich ein Bild von der anstehenden Arbeit machen konnte. Sie wollte Einblick in sämtliche Ermittlungen haben, die noch nicht abgeschlossen waren. Eine geordnete Amtsübergabe hatte es nämlich nicht gegeben – hatte es nicht geben können, da ihr Vorgänger Markus Röthlisberger verstorben war. Der Tod hatte ihn nicht etwa bei einem heldenhaften Einsatz geholt, sondern bei seiner liebsten Freizeitbeschäftigung: Röthlisberger hatte auf der Tribüne im Stade de Suisse bei einem Fußballspiel der Berner Young Boys einen Herzstillstand erlitten. Am Spiel – ein trostloses, torloses Unentschieden – konnte es kaum gelegen haben; Röthlisberger war sofort tot gewesen.
Zweifelsohne war sein vorschnelles Ableben ein herber Verlust – es riss bei der Kantonspolizei Bern eine Lücke, die Lisa Kunz wohl nur langsam und mit viel Anstrengung zu füllen vermögen würde. Ein Monat war seit seinem Tod vergangen. Markus Röthlisbergers Angehörige hatten die persönlichen Gegenstände vor einigen Tagen aus seinem Büro geräumt. Trotzdem hatte Lisa Kunz das Gefühl, ein Eindringling in seinem Reich zu sein. Sobald sie die Zeit dafür finden würde, wollte sie sich einige Bilder bestellen, um das Chefbüro wirklich zu ihrem eigenen zu machen. Auch ein paar Pflanzen mussten her. Sie wollte sich wohlfühlen hier, schließlich würde sie in diesem Raum viel Zeit verbringen.
Mit einem Räuspern machte sich Günther Schwarz bemerkbar. »Markus Röthlisberger würde sich freuen, dass du seinen Job geerbt hast«, sagte er und hinterließ bei Lisa Kunz bereits zum zweiten Mal an diesem Morgen den Eindruck, jemand hätte direkt in ihren Kopf geblickt und ihre Gedanken gelesen.
»Ich hoffe, ich werde ihm eine würdige Nachfolgerin sein.«
»Das wirst du«, versicherte Schwarz mit ernster Stimme. Dann schob er den kleinen Transportwagen mit einer großen Geste zu Lisa Kunz hinüber und machte damit die Übergabe zu einem symbolischen Akt. Sie fasste den Griff und zog den Rollwagen neben ihren Schreibtisch. Die Ordner hatten ein beachtliches Gewicht.
Günther Schwarz verabredete sich mit Lisa Kunz für den übernächsten Tag um neun Uhr morgens in seinem Büro, um die offenen Fälle gemeinsam durchzugehen und das weitere Vorgehen wie auch ihre zukünftige Zusammenarbeit zu besprechen.
»Wir beide werden miteinander auskommen«, sagte er in einem fast väterlichen Ton zu der um über zwanzig Jahre jüngeren Frau.
»Wir kommen gar nicht darum herum!«, antwortete Lisa Kunz scherzhaft.
Er lachte, wünschte ihr noch einmal einen guten Start und ließ sie schließlich mit den Aktendossiers allein.
Lisa Kunz verpflanzte die Bundesordner vom Rollwagen auf ihren Schreibtisch, wo sie sie nach Fallnummern sortierte. Dann setzte sie sich an ihren Schreibtisch. Auf ihren neuen Bürosessel. Sie drehte darauf eine Runde um die eigene Achse. Es fühlte sich gut an, hier zu sitzen. Und es fühlte sich nach viel Arbeit an: Die Bundesordner, die aufgereiht auf ihrem Schreibtisch standen, waren derart zahlreich, dass sie die gesamte Arbeitsfläche einnahmen. Dabei handelte es sich nur um Zusammenfassungen. Dreiundzwanzig Dossiers hatte Schwarz ihr übergeben. Sie wollte die wichtigsten Fakten jedes Falles kennen, bevor sie sich mit dem Staatsanwalt zur Besprechung traf. Das würde eine spannende Nachtlektüre geben. Sie konnte sich den Protest ihres Mannes schon vorstellen, wenn sie wieder mal eine Nacht in ihrem Büro statt im gemeinsamen Bett verbrachte.
3
Sie saß im Badezimmer auf dem Boden, den Rücken an die Wand gelehnt, die Arme um die Beine geschlungen. Renate Berger fühlte die kalten Platten auf der nackten Haut, spürte jede einzelne Rille, die die Keramikscheiben voneinander trennten. Die Rillen schienen sich in ihre überempfindliche Haut einzubrennen wie ein Brandmal, das Kälbern zur Kennzeichnung aufs Fell gedrückt wurde. Ihr ganzer Körper fühlte sich an, als wäre er in gelbes, juckendes Isoliermaterial gepackt, durch das hin und wieder glühend heiße, dicke, aber spitze Nadeln gesteckt wurden. Die Kleidung hatte sie sich bis auf die Unterwäsche vom Leib gerissen, weil sie sie nicht mehr tragen, nicht mehr ertragen konnte. Zu stark hatten die Stoffe auf ihrer Haut gerieben, gescheuert, ein unangenehmes Prickeln verursacht. Sie hatte sich fast wund gekratzt. Jetzt schwitzte und fror sie zugleich. Die glatten, langen Haare, deren einst kräftiges Braun schon vor langer Zeit einem stumpfen gelblichen Beige gewichen war, klebten feucht an ihrer Stirn. Und an ihrem Nacken. Ihre Wangen waren eingefallen. Jeder Knochen ihres Gesichts stach kantig hervor. Unter ihren grauen Augen, deren Pupillen verloren zu gehen schienen, lagen dunkle Schatten, seit Jahren schon. Spindeldürr war sie. Dabei hatten ihr früher, als sie noch ein hübsches kleines Mädchen war, alle vorhergesagt, was für eine schöne Frau sie dereinst werden würde. Nun bedeckte kalter Schweiß ihren blassen Körper, der zerstört worden war, bevor er die Gelegenheit hatte, schön zu werden. Es schüttelte sie. Gänsehaut.
Vor einer halben Stunde, die ihr ewig schien, war Renate Berger erwacht, mitten aus einem Traum heraus, in dem sie in einer verwahrlosten Wohnung in der unteren Berner Altstadt Stoff bezogen hatte. Sie hatte geträumt, wie sie das Heroin in Wasser und Zitronensaft auf einem Teelöffel aufkochte, sich die Lösung direkt in eine Vene am linken Unterarm spritzte. Doch dann war der ersehnte Flash ausgeblieben, und sie hatte sofort erkannt, dass sie sich irgendetwas, aber mit Sicherheit nicht Heroin in den Blutkreislauf gepumpt hatte. Sie hatte laut aufgeschrien – im Traum und auch in Wirklichkeit, der eigene Schrei hatte sie aus dem Schlaf gerissen. Und das Zittern war schon da gewesen. Ihre Füße hatten sich schmerzhaft zusammengekrampft. Und da wusste sie, sie hatte ihn wieder, oder eher, er hatte sie: der Affe.
Ihr Bauch zog sich zusammen, als stieße jemand ein Messer in sie hinein. Ihr Magen explodierte und schien sich zu drehen. Sie musste sich übergeben, hielt den kühlen Rand der Kloschüssel umarmt, die Haare klebten teils an ihrer Wange, teils hingen sie in die Schüssel hinab. Der Gestank war unerträglich, doch sie nahm ihn kaum wahr.
Zum Glück hatte sie die Kinder nicht geweckt. Yanis und Hannah, zwei und vier Jahre alt, lagen gleich nebenan im Kinderzimmer und hielten ihren Mittagsschlaf. Beide hatten blonde Locken, obwohl sonst niemand in der Familie helle Haare hatte. Manchmal schien es Renate Berger, als hätte ihr jemand zwei Engel geschickt – die durchaus manchmal Teufelchen sein konnten. Ihre beiden Kinder bedeuteten ihr alles. Sie hatte von Anfang an versucht, die Verantwortung für sie zu übernehmen. Als sie mit Hannah schwanger geworden war, hatte sie sich geschworen, nie mehr Heroin zu spritzen. Sie hatte Hilfe gesucht und angenommen, war in ein staatliches Methadonprogramm aufgenommen worden. Ihre Tochter hatte ihr die Kraft gegeben, die Finger von dem Gift zu lassen. Auch Mathias, der Vater der Kinder, hatte sich bemüht und einen Job gefunden. Er rauchte aber noch immer seine Joints, täglich und in großen Mengen, während sie ihr Methadon schluckte. Jeden Tag war sie zur Abgabestelle gefahren, hatte das Mittel getrunken, das sie müde machte und manchmal auch traurig. Ein Schluck aus dem kleinen Plastikbecher, damit sie ihre Gier auf das Heroin im Zaum hielt und sich die Entzugserscheinungen nicht mehr einstellten. Das Methadon war ein kläglicher Ersatz, aber es hatte funktioniert. Und als sie kurz darauf schon wieder schwanger gewesen war und Yanis sich spürbar angekündigt hatte, hatte sie die tägliche Dosis Methadon bereits von anfänglich zweihundert auf hundertzwanzig Milligramm senken können. Fast hatte es so ausgesehen, als ob sie es doch noch schaffen würden, als ob sie zumindest eine einigermaßen funktionierende Familie werden könnten.
Doch als Yanis kam, war alles wieder anders. Er war unruhig, schrie oft und lange, ließ ihnen keine Ruhe. Es schien ihr, als hätte sich die Zahl ihrer Kinder nicht verdoppelt, sondern auf einen Schlag vervielfacht, und es wurde ihr alles zu viel. Weil das Methadon sie müde machte und ihre Glieder schwer, begann sie, nebenbei Kokain zu schnupfen. Um halbwegs wach zu bleiben. Vor fünf Wochen dann, sie konnte eigentlich gar nicht sagen, warum, war sie wieder dort gewesen, auf der Gasse, auf der Kleinen Schanze in Bern, wo sie ihr halbes Leben verbracht hatte. Wo einst ihre einzigen Freunde waren, die nicht wirkliche Freunde sein konnten. Nach über vier Jahren hatte sie dort einige alte Bekannte wieder getroffen, die offensichtlich überlebt hatten. Im Nu war sie wieder mittendrin gewesen, hatte die Nadel wieder in ihrem Unterarm gesteckt, das Heroin ihren Körper durchflutet. Der Flash war zwar nur wenige Sekunden kurz, aber hammergeil gewesen. Das Gefühl hatte sie vermisst. Das Abheben, die Schwerelosigkeit. Den Kick. Den konnte ihr das Methadon nicht bieten. Und dann war plötzlich alles wieder gut gewesen; die Probleme waren aus der Welt geschafft. Sie hatte sich frei gefühlt, als ob sie einen großen, schweren Rucksack mit viel Ballast abgelegt, weit weggeworfen hätte. Friedlich hatte sich alles angefühlt, ein wenig wie in Watte gepackt, einfach und leicht. Und so war sie am Tag darauf erneut hingefahren. Schon nach kurzer Zeit schien es ihr, als wäre sie gar nie weg gewesen, nie aus der Szene raus. Wenn sie high war, mochte sie das Leben – tief im Innern wissend, dass sie gerade dabei war, es zu zerstören. Was ihr in diesen Momenten aber völlig egal war.
Mathias, ihr Freund, hatte erst letzte Woche gemerkt, dass mit ihr etwas nicht stimmte. Zunächst war ihm aufgefallen, dass sie zufriedener, weniger müde, weniger gestresst und ausgebrannt wirkte. Dann hatte er die Einstichpunkte entdeckt. Sie hatten miteinander gestritten, sich angeschrien. Mathias hatte geweint. Sie hasste das. Dann hatte er plötzlich einfach geschwiegen, sich umgedreht und war weggegangen. Seither hatten sie nicht mehr richtig miteinander geredet. Er hatte sie nur ständig traurig angesehen, sie konnte es fast nicht ertragen.
Renate Berger zog sich am Waschbecken hoch, die Glieder tonnenschwer. Der kalte Schweiß rann ihr tröpfchenweise der Wirbelsäule entlang den Rücken hinunter. Sie schlüpfte in ihre Jeans, die auf einem Kleiderhaufen neben der Badewanne lagen, und zog sich ein Sweatshirt über. Sie hielt inne, ihr Magen krampfte sich erneut zusammen. Doch der Krampf ging vorbei. Sie musste die Kinder allein lassen. Musste los, brauchte Stoff. Jetzt. Dringendst. Sie konnte nicht anders. Es war kurz vor drei Uhr nachmittags, und spätestens um halb sechs würde Mathias zurück sein. Renate Berger hetzte durch ihre einfache Blockwohnung, suchte verzweifelt nach dem Handy. In der Stube, in der kleinen Küche. Dort war der Tisch völlig zugestellt. Das schmutzige Geschirr stapelte sich, jemand hatte Zucker ausgeschüttet, der an einzelnen Stellen zuerst nass und dann klebrig geworden war. Endlich fand sie das Telefon, es lag hinter drei schmutzigen Tellern unter der leeren Schachtel einer Fertigpizza.
Ihre Hände zitterten. Die Sucht hatte sie wieder im Griff. In ihrem Kopf hatte nur noch ein einziger Gedanke Platz: Heroin. Im schmalen Gang kehrte sie noch einmal um, drehte den Schlüssel im Schloss der Tür zum Kinderzimmer, zur Sicherheit. Ein Stich ins Herz. Das schlechte Gewissen drängte sich in ihr Bewusstsein, nur kurz. Dann verließ sie die Wohnung, trat hinaus aus dem grauen Wohnblock in Bümpliz in einen milden blauen Frühlingstag. Ein ganz normaler Donnerstagnachmittag im April. Vom Spielplatz her drangen fröhliche Kinderstimmen zu ihr herüber. Sie nahm sie nicht wahr. Bis zur Haltestelle waren es nur wenige Schritte. Sie stieg in den nächsten Bus und fuhr Richtung Hauptbahnhof, ins Zentrum von Bern. Renate Berger setzte sich ganz zuhinterst hin, damit sie nicht von allen angestarrt wurde. Sie hatte Mühe, die Augen offen zu halten. Ihr Bauch schmerzte. Immer wieder diese Krämpfe. Nicht mehr lange, bald war sie da.
Unter dem großzügig geschwungenen Glasbaldachin auf dem Bahnhofplatz stieg sie aus dem Bus. Sie drängte sich zwischen den vielen Leuten durch, die mit vollgepackten Einkaufstaschen aus den Läden quollen, und ging die Straße hinunter Richtung Kleine Schanze, einer weitläufigen Terrasse, von der man hinunter auf die Aare und hinüber zu den Alpen blicken konnte. Die Kleine Schanze lag gleich neben dem Bundeshaus, wo der Bundesrat und die Parlamentarier tagten und meinten, das Land zu regieren.
Sie traf Heinz unten an der Treppe, die neben dem Restaurant Milchbar zum steilen Weg hinabführte, den man einschlug, wenn man von der Altstadt an die Aare gelangen wollte. Der Weg verlief parallel zu den Gleisen der Marzilibahn, der kürzesten Standseilbahn Europas. Vor allem die Kabinen, die bergauf fuhren, waren gut frequentiert, denn die Steigung war zu Fuß kaum zu bewältigen, ohne dabei ins Schwitzen zu geraten. Im Sommer herrschte hier reger Betrieb; an den heißen Tagen zog es ganze Schwärme von Menschen über Mittag oder nach Feierabend hinunter zum kühlen Fluss, um sich darin treiben zu lassen. Doch noch war es dafür zu früh. Nur die ganz Hartgesottenen wagten sich im April bereits in die Aare, deren Temperatur in dieser Jahreszeit selten mehr als zwölf Grad betrug. Jetzt war kaum jemand unterwegs. Wer sich heute hierherbegab, dem war anzusehen, dass er entweder Drogen verkaufen oder kaufen wollte.
»Hast du was?« Ihre Frage, das wusste Renate Berger, war rein rhetorisch. Heinz hatte immer etwas. Er war schon früher ihr liebster Dealer gewesen. Sein Stoff war gut und der Preis fair.
»Fünfundvierzig das Gramm.«
Renate Berger kaufte für zwei Zwanziger drei Quarter des weißen Pulvers. Heroin. Noch genügte ihr knapp ein Gramm als Tagesration, das sie auf drei Injektionen verteilte. Sie setzte sich auf eine Stufe der Treppe und suchte in ihrer Handtasche nach dem Säckchen mit dem Besteck. Dann kochte sie das Gift auf, zog ihre Spritze auf, setzte die Nadel an, drückte ab. Und flog davon.
4
»Es gibt Wurst und Rösti.«
Sie hätte es nicht zu sagen brauchen. Der Duft der Bratwurst, die in der Pfanne brutzelte, hatte sich schon in der ganzen Küche ausgebreitet und seine Magensäfte munter werden lassen. Sie hörte das Rumoren seines Bauches sogar bis hinüber zum Herd, an dem sie hantierte.
»Du scheinst Hunger zu haben.«
Noch immer keine Antwort.
»Die Wurst ist vom Messerli Peter.«
Wieder reagierte einzig sein Bauch mit einem lauten Rumpeln.
»Kartoffeln hat es nicht mehr viele.«
Schweigen.
Die alte Frau war es gewohnt, Monologe zu führen. Es gab Tage, da bekam ihr Sohn einfach seinen Mund nicht auf.
Bruno Bärtschi saß am Küchentisch auf der Eckbank, gleich neben der Eingangstür des Bauernhofs. Über ihm baumelten gelbe Streifen von der tiefen Decke, Fliegenfallen, an denen tote und halb tote Insekten klebten. Neben ihm auf der Bank lagen mit Bibelsprüchen bestickte Kissen, beiges Garn auf braunem Stoff. An der Wand hinter ihm hingen drei kleine Albert-Anker-Bilder, billige Farbkopien, wahrscheinlich aus einer Zeitschrift herausgeschnitten und auf die Holzplatte unter dem schmalen Holzrahmen geleimt. Szenen in der Schulstube, Szenen auf dem Bauernhof, schön gezeichnet.
Bruno Bärtschi sah man an, dass er ein Mann vom Land war. Er war klein gewachsen, trug ein grob kariertes Hemd in den Farben Rot und Braun, dazu die dunkelblaue Arbeiterhose und die schweren Schuhe. Seine dicken schwarzen Haare klebten ihm an diesem Abend platt am Schädel, eine Helmfrisur. Seine Haut glänzte stets ein wenig, wirkte fettig. Die Wangen waren von einzelnen roten Äderchen überzogen, die unterhalb der Fältchen um seine Augen endeten. Seine Augen waren zu klein geraten, wie Schweinsäuglein. Dafür war seine Nase groß und etwas knollig. Darunter trug Bärtschi einen Schnurbart, praktisch seit ihm der erste Flaum gewachsen war. Der Schnauz wirkte im Gegensatz zu seinem schwarzen Kopfhaar seltsam rötlich. Bärtschis Nacken war dick wie ein Baumstamm, die Schultern waren breit wie die eines Schwingers; eine Folge der stets schweren Arbeit. Hände hatte er wie Pranken. Bruno Bärtschi war arbeitsam. Tüchtig. Noch war er nicht ganz fünfzig. Geboren worden war er als das mittlere von neun Kindern, und er war der Einzige, der auf dem elterlichen Hof geblieben war. Der Vater war seit Jahren tot, die Mutter über achtzig Jahre alt. Seine Geschwister hatten alle ihren Weg gemacht und lebten ihr eigenes Leben in ihren neuen Familien. Er wohnte noch immer bei seiner Mutter, schlief im Zimmer, in dem er sein Leben lang geschlafen, im Bett, das er schon als Kind benutzt hatte.
Der Bauernhof der Bärtschis war ein stattlicher Hof. Das Dach zog sich seitlich fast bis auf den Boden hinab, rote und rosafarbene Geranien zierten die Fenster an der hölzernen Hausfront, fast wie im Bilderbuch. Gleich nebenan ragten zwei Silos wie strammstehende Zwillinge in die Höhe. Ein kleines Stöckli lag wie ein Jungtier bei der Mutter neben dem Hauptgebäude mit den Ställen. Es war unbewohnt, diente nur als Abstellkammer. Das Gehöft lag hoch oben über Heimiswil, einem kleinen Bauerndorf eingangs des Emmentals, eingebettet zwischen zwei der vielen runden grünen Hügel. Richtung Westen bot sich fast die gesamte Gebirgskette des Juras dar, die bei Föhn zum Greifen nah lag. Am Abend schluckte sie die Sonne, die den Himmel darüber wie eine Leinwand in kitschig-pralle Farben tunkte. Es war ein schöner Flecken Erde.
»Ich bin gleich so weit«, sagte seine Mutter, während sie die Teller aus dem Schrank nahm und sie auf die bestickten Tischsets stellte. Robustes braunes Geschirr aus der Vorkriegszeit.
Bruno Bärtschi wartete, bis seine Mutter serviert hatte und ihm den Teller randvoll mit Rösti füllte. Er war ein guter Esser.
Die Mutter faltete die Hände, senkte den Kopf. Schloss die Augen.
»Danke für die Gaben, die du uns jeden Tag bescherst. Danke für deine Güte. In Gottes Namen, Amen.«
Sie wünschte ihrem Sohn einen guten Appetit und brachte ihn damit doch noch zum Reden.
»Danke.«
Dann aßen sie, ohne ein weiteres Wort zu wechseln. Die Stille hüllte die Küche ein wie eine dicke, schwere Decke. Nur das Kratzen der Gabeln und Messer auf den Tellern war zu hören, wie immer am Esstisch der Bärtschis.
Es war nicht so, dass Bruno Bärtschi nie weggewollt hätte. Es hatte sich einfach nie ergeben. Eine Lehre hatte er nicht gemacht, obwohl er nicht dumm war; der Dorflehrer hatte ihn sogar in die Stadt auf die Sekundarschule schicken wollen. Zu weit weg, befand man zu Hause. Also war er seinem Vater zur Hand gegangen, und dann, als dieser alt und krank geworden und bald darauf gestorben war, hatte er den Hof ganz übernommen. Seine Mutter hatte indes nie einer Jüngeren Platz machen und ins Stöckli nebenan ziehen müssen. Denn Bruno Bärtschi konnte es nicht so gut mit den Frauen. Es hatte zwar schon einige in seinem Leben gegeben, kurze Bekanntschaften mit Bauernmädchen, in der Schulzeit, damals, als man noch Händchen hielt. Später dann, als er mehr als nur Hände halten wollte, hatte es nicht mehr so richtig geklappt; sobald er eine Frau besser kennenlernte, sobald er ihr näherkommen und sie seine Ansprüche nicht erfüllen wollte, wurde es ihm zu mühsam. Er verstand sie nicht, und sie wollten ihn einfach nicht verstehen. Alle hatten ihn innert kürzester Zeit abblitzen lassen. Noch bevor es begann, ernst zu werden. Jedes Mal fühlte er sich gedemütigt und wütend, jedes Mal schwor er sich, künftig die Hände von den Weibern zu lassen. Sie waren zu kompliziert, zu undankbar. Sie hatten alle einen schlechten Charakter.
Die Mutter stand auf, um den Tisch abzuräumen.
»Hast du dich eigentlich nicht mehr mit dieser Charlotte getroffen? Wie heißt sie doch gleich, Charlotte Kiener?«, fragte sie beiläufig.
Sie konnte es einfach nicht lassen.
»Keller«, sagte er mürrisch. »Keller heißt die.«
In Heimiswil machte alles schnell die Runde. Selbst seiner alten, zurückgezogen lebenden Mutter kam jedes Gerücht zu Ohren – weil in einem kleinen Dorf wie diesem die Wände nicht nur zu lauschen, sondern mitunter gar zu tratschen schienen. Mit Charlotte hatte er vor fünf Tagen am Stammtisch im Landgasthof Löwen gesessen; sie kannten sich schon lange, aber so Seite an Seite hatten sie noch nie miteinander diskutiert. Er hatte das Gefühl gehabt, dass sie ihn interessant fand, und hatte es so einrichten können, dass sie gleichzeitig die Gaststube verließen. Als sie sich dann aber draußen einfach weggedreht und ihm einen schönen Abend gewünscht hatte, da hatte er sie an der Schulter festgehalten, sie wieder zu sich herumgedreht und am Handgelenk gepackt, härter als beabsichtigt. Sie hatte sich jedoch nicht überzeugen lassen, mit ihm mitzugehen. Stattdessen hatte sie sich losgerissen und ihn angeschrien, und zwar in einer Lautstärke, die ihn hatte befürchten lassen, man könne sie drinnen in der Gaststube hören. Von diesem unschönen und demütigenden Abgang hatte die Mutter wohl nichts mitgekriegt. Bruno Bärtschi ließ die Frage der Mutter unbeantwortet im Raum stehen und wechselte Thema.
»Der Lastwagen ist schon halb voll.«
Seine Mutter wusste, wovon er sprach. Bruno Bärtschi unterstützte ein kirchliches Hilfswerk, das sich für rumänische Waisenkinder einsetzte. Einmal im Jahr fuhr er persönlich einen Lastwagen voller Kleidung und Spielsachen, die er auch eigenhändig sammeln half, hinüber nach Rumänien. Es war seine gute Tat.
»Schön«, sagte die Mutter. Und damit war die Konversation, die diesen Namen nicht verdiente, auch schon wieder beendet.
Nach dem Essen griff sich Bruno Bärtschi seinen Kittel, um in die Beiz zu fahren, hinab ins Dorf, nach Heimiswil. Die Sonne hing schon tief über den bewaldeten Hügeln, als er mit seinem grünen Subaru Kombi die kurvenreiche Straße zunächst ein Stück weit hinauf- und dann hinter dem Hügel wieder hinabfuhr. Von Westen her zogen Wolken auf, die auf dem rot gefärbten Himmel aussahen wie aufgeklebt. Für einen Moment verschwand die Sonne hinter den Wolkenstreifen, um kurz darauf noch röter als vorher wieder zum Vorschein zu kommen. Ein Schwarm schwarzer Krähen flog der glühenden Kugel lärmend entgegen.
Der Kegelverein hatte heute Abend zu einem Treffen geladen, was bedeutete, dass man vor allem gemeinsam etwas trinken wollte. Bärtschi war der Kassenwart, er durfte also nicht fehlen. Aber auch sonst traf Bärtschi an jedem Abend einige Bekannte am Stammtisch. Man kannte sich in einem Dorf wie diesem: Tausendsechshundert Einwohner zählte Heimiswil, etwas mehr Männer als Frauen. Drei Landgasthöfe, Klara Käsers Dorfladen, die Metzgerei Messerli, drei Schreinereien. Und eine Kirche, sie stand mitten im Dorf. Viele Heimiswiler waren Landwirte und Handwerker. In der Gemeinde gab es eine einzige politische Partei – die rechtsbürgerliche SVP – und siebzehn Vereine, darunter der Männerchor und der Frauenchor, eine christliche freikirchliche Gemeinschaft und drei Hornusser-Gesellschaften.
Bärtschi war Mitglied in vier Vereinen und machte wie die meisten Männer aus dem Dorf und der umliegenden Weiler bei der Freiwilligen Feuerwehr mit. Unter seinen Freunden, die er sich nicht ausgesucht hatte, sondern Freunde waren, weil sie einfach da waren, gab er sich nicht so wortkarg wie zu Hause. Seine Bekannten würden ihn als freundlich beschreiben, als einer, der immer mit anpackte, wenn jemand Hilfe brauchte. Einer, der sich einsetzte für die Anliegen anderer. Der Bärtschi, würden die Leute hier sagen, der Bärtschi sei schon recht.
Bruno stellte seinen Wagen auf dem Parkplatz vor dem Landgasthof ab. Als er die Gaststube betrat, überschritt er die Grenze zu einer anderen Welt. Ihm schlug eine heitere Stimmung entgegen. Es ging wieder einmal gesellig zu und her im Löwen von Heimiswil. Die Gaststube zählte zwölf Tische, sie war gut besucht. Auf jedem Tisch stand ein Strauß mit Blumen von der Wiese. Krokusse, gelbe und blaue, die ein kleines Stück Frühling in die Stube trugen. Die Wände waren aus hellem Holz, ebenso die niedrige Decke. Links von der Eingangstür stand ein Kachelofen in der Ecke, rechts befand sich das Buffet, über dem die Gläser blitzten, und davor protzte der große ovale Stammtisch mit einem überdimensionierten Aschenbecher in der Mitte. Hier saßen wie immer seine Kegelfreunde. Bruno Bärtschi setzte sich dazu, warf einen Gruß in die Runde, er kam fünffach zurück. Rosa, die voluminöse Wirtin, deren gewaltiger Busen die Gäste fast zu erschlagen drohte, wenn sie ihnen die Getränke reichte, brachte gerade ein Tablett voller gefüllter Gläser.
»Prosit miteinander«, sagte sie mit ihrer tiefen Stimme, die klang, als würde sie ihre Stimmbänder täglich vor dem Frühstück mit Whisky schmieren.
Bald hatte jeder eine Stange Bier vor sich und eine Zigarre schräg im Mundwinkel. Bald würde das Rauchen in den Beizen im Kanton Bern verboten sein. Nur noch in abgesonderten, gut belüfteten Fumoirs durften die Raucher künftig ihrem Genuss frönen. Die Verbannung einer geächteten Minderheit, so verlangte es ein neues Gesetz. Aber hier in Heimiswil wollte man sich von denen dort oben in Bern nichts vorschreiben und schon gar nichts verbieten lassen. Das Rauchen erst recht nicht. Es kam ihnen manchmal vor, als ob die Herren von Bern den Männern vom Land auch noch die letzten Freuden nehmen wollten.
Bärtschi sah, dass am Nachbartisch ein Jass geklopft wurde. Ein grüner, quadratischer Teppich lag auf dem Tisch, daneben eine Schiefertafel. Drei Männer und eine Frau waren in ihr Spiel vertieft, nur ab und an brummte einer einen Kommentar in seine Karten. Am Stammtisch hingegen wurde laut gepoltert und politisiert und geschäftet. Gesprächsthema war der Viehmarkt, der tags zuvor in der Burgdorfer Markthalle stattgefunden hatte. Burgdorf war die nächstgelegene Stadt, nur wenige Kilometer entfernt, talabwärts. Eine Kleinstadt, die sich zuvorderst im Emmental breitgemacht hatte und von der Kirche auf dem einen und dem stattlichen Schloss auf dem anderen Hügel bewacht wurde. Dort fand einmal im Monat der große Viehmarkt statt, an dem sich alle Landwirte aus dem unteren Emmental zum Kuhhandel trafen – und der jeweils noch Tage später ihr liebstes Thema war. Im Löwen in Heimiswil diskutierten die Bauern gerade über die begutachteten Tiere, über Schüpbachs Bertha und über Minders Tulpe, die das schönste Euter hatte.
»Und habt ihr den Muni vom Binggeli gesehen?«, fragte Ruedi König in die Runde. »Ein Prachtstier, so einen würde ich auch gerne in meinem Stall stehen haben.«
»Du hättest ihn kaufen können, der Binggeli hat ihn nun doch noch weggegeben, etwa beim zehnten Anlauf konnte er sich überwinden. Wird wohl das Geld nötig gehabt haben.« Damit gab Peter Messerli, der Metzgermeister im Dorf, das Stichwort. Denn beim Thema Geld vermochten immer alle mitzureden.
»Es ist unglaublich, die Preise sind im Keller, so etwas habe ich in den letzten vierzig Jahren nicht erlebt«, jammerte Remo Rinderknecht. »Für das Geld, das heute für eine gute Kuh geboten wird, würde ich nicht mal ein Schaf verkaufen.«
»Ja, aber wenn du darauf angewiesen bist? Eine Schande ist’s.«
»Und wem haben wir’s zu verdanken: den Amerikanern«, tönte es von der gegenüberliegenden Seite des Tisches. »Es ist nicht zu glauben, dass sich die Finanzkrise auch auf unseren Kuhhandel ausgewirkt hat, und das hier, bei uns im Emmental.«
Die Gemüter der Männer erhitzten sich. Auch in der Gaststube war es warm geworden. Die Schwaden aus Zigarrenrauch hüllten den Stammtisch ein und blieben schwer in der Luft hängen.
Jetzt schaltete sich Bruno Bärtschi ein. »Dabei können wir Bauern am wenigsten dafür. Wir sind nicht daran schuld, dass die Amerikaner dumm genug sind, um sich massenhaft beim Kauf ihrer lottrigen Einfamilienhäuschen zu verspekulieren, die nicht mal einem Windstoß standhalten. Aber wir sind diejenigen, die jetzt dafür den Kopf hinhalten müssen.«
Von allen Seiten erntete Bärtschi zustimmendes Brummeln.
Fredi Kobler wurde laut und schimpfte: »Ja, jetzt müssen wir auch noch die Probleme dieser überheblichen Amis auf unserem Buckel austragen, als ob uns nicht schon längst von unseren eigenen Herren Politiker viel zu viel aufgebürdet würde.«
Er ließ eine Salve Schimpfworte folgen, begleitet von feinen Speicheltropfen.
»Genau so ist es.«
»Recht hat er.«
»Und jetzt haben diese Amis doch tatsächlich auch noch einen schwarzen Präsidenten gewählt – Neger darf ich ja nicht mehr sagen –, als ob so einer das könnte, ein Land so groß wie Amerika regieren.« Fredi Kobler hatte schon mehr als einen über den Durst getrunken. Die Zunge lag ihm schwer im Gaumen.
Rosa brachte die nächste Runde. »Genau das hat doch aber der Bush auch nicht gekonnt«, streute sie ein, doch die Männer pflegten sie wie so oft zu überhören.
Es wurde weiter ausführlich über die Amerikaner hergezogen, in der heimeligen Gaststube des Löwen in Heimiswil, hinter den Hügeln des Emmentals, während sich draußen der Mond an den Himmel stahl. Bewegungslose Schäfchenwolken bewachten ihn, als fürchteten sie, er könne plötzlich das Weite suchen. Die Männer an dem runden Tisch mit dem schweren Aschenbecher in der Mitte waren sich einig, dass die Erde ihrem Ende entgegenging, ja dass sie regelrecht zugrunde gerichtet wurde, dass alle anderen und allen voran die Amerikaner an diesem Elend schuld waren und dass es ihnen, den Bauern, am übelsten erging. Ohne etwas dafür zu können. Fredi Kobler und Peter Messerli bestellten sich noch einmal ein Bier. Immerhin lohnte es sich, auf den Niedergang anzustoßen, wenn man sonst schon nichts zu lachen hatte. Einzig Bruno Bärtschi passte. Sein Glas war leer, er wollte los.
»Ich habe noch etwas zu erledigen.« Sagte es und stand geräuschvoll von seinem Stuhl auf. Rasch suchte er Peter Messerlis Blick, dieser nickte ihm unmerklich zu. Bärtschi verabschiedete sich mit einem lauten »Gute Nacht!« von den Leuten in der Gaststube. Es ging im Stimmenmeer unter. Bärtschi schloss die Tür, schnitt damit die Stimmen und das Lachen und den Zigarrenrauch und die Wärme hinter sich ab. Er trat hinaus in den milden Frühlingsabend, stieg in seinen grünen Subaru Kombi und fuhr nicht hinauf zu seinem Hof, sondern bergab in Richtung Stadt.
5
Am Ende ihres ersten Arbeitstages als Chefin des Dezernats Leib und Leben der Kantonspolizei Bern verstieß Lisa Kunz gegen die hausinternen Regeln: Sie nahm einen Stapel Bundesordner mit einigen anhängigen Fällen nach Hause – obwohl diese das Polizeigebäude eigentlich nicht verlassen durften. Was soll’s, dachte sie sich, ich bin jetzt schließlich die Chefin. Sie würde wohl kaum ausgerechnet heute auf ihrem Heimweg nach Krauchthal ausgeraubt, einem Dorf nordöstlich von Bern, etwa zwanzig Autominuten von der Stadt entfernt. Lisa Kunz wohnte dort mit ihrem Mann in einem ehemaligen Bauernhaus am Dorfrand, einem alten Riegelbau, den sie großzügig umgebaut hatten. Jetzt waren die Zimmer geräumig und dank der neuen Glasfassade hell. Altes Holz kombiniert mit neuen Materialien ergab die richtige Mischung: Die Wohnung war heimelig und modern zugleich.
»Ich bin da!«, rief Lisa Kunz, als sie die Haustür öffnete. Sie hängte ihre Jacke an einen Bügel im eingebauten Garderobenschrank und streifte die Schuhe von den Füßen.
»Hallo, Joya!«, begrüßte sie die alte Schäferhündin, die in ihrem Korb eingangs des Wohnzimmers lag, kurz den Kopf hob und dreimal mit ihrem Schwanz auf den Korbboden klopfte. Lisa Kunz kraulte sie flüchtig hinter dem rechten Ohr. Die Hündin grunzte wohlig.
»Guten Abend, Frau Chefin!«, kam es aus der Küche. »Na, wie war dein erster Tag?« Marc Kunz kam seiner Frau entgegen und drückte ihr einen Kuss auf den Mund. Sie schmeckte Petersilie oder etwas Ähnliches.
»Eigentlich ganz in Ordnung. Es ist ein etwas komisches Gefühl, plötzlich in dieser Position zu sein. Aber gleichzeitig fühlt es sich gut an.« Dann zeigte sie auf die zwei Tragetaschen, in denen sie die Ordner mit nach Hause geschleppt hatte. »Und es gibt schon viel zu tun.«
Marc verdrehte die Augen und begab sich wieder in die Küche, in sein Refugium. Lisa Kunz hielt sich von diesem Raum möglichst fern, sie war darin bloß ein Störfaktor: Sämtliche Fähigkeiten, die im Haushalt und in der Küche von Nutzen sein konnten, gingen ihr völlig ab. Sie war sozusagen haushaltsuntauglich. Ganz im Gegensatz zu Marc.
Sie kannten sich seit vierzehn Jahren, und er hatte ihr während ihres steilen Aufstiegs von der Streifenpolizistin bis zur Dezernatschefin stets zur Seite gestanden – obwohl er dabei etliches ertragen musste: nicht nur ihre langen, manchmal nächtelangen Abwesenheiten, sondern mitunter auch Tatortfotos von grausig verstümmelten Leichen auf dem Mittagstisch und eine mittlerweile pensionierte und altersschwache Polizeihündin als Haustier, derentwegen er am Mittag immer extra nach Hause fuhr, um mit ihr Gassi zu gehen.
Jetzt steuerte Lisa Kunz ihr Büro an, das einen Stock höher lag. Sie schleppte die Taschen mit den Ordnern ächzend die Holztreppe hinauf, wollte sich gleich hineinknien in die Arbeit.
Als Marc sich unten nach einer Dreiviertelstunde wieder bemerkbar machte, war sie bereits völlig in einen Fall versunken. Sie war in Gedanken auf der Zeitachse zurückgereist, befand sich zur Tatzeit am Tatort des Verbrechens, versetzte sich erst in das Opfer, dann in den Täter.
»Lisa, Essen ist fertig!«, rief Marc zu ihr hinauf.
Im ersten Stock blieb alles still. Unten erhob sich Joya, die alte Hündin, schwerfällig aus ihrem Korb und watschelte Richtung Küche.
»Lisa, essen!« Marc klang, als riefe er nicht seine Frau, sondern störrische Kinder an den Tisch, auf dem das Essen schon angerichtet stand. Ihm war anzuhören, dass er es nicht ausstehen konnte, wenn sie es kalt werden ließ.
Er hatte ein Schweinsfilet bei niedriger Temperatur im Ofen gegart. Dazu gab es ein sämiges Risotto, das zweifelsohne vorzüglich schmecken würde. Zumindest er freute sich aufs Essen.
»Lisa!«, rief er noch einmal, diesmal leicht genervt.
Lisa Kunz erschien oben an der Treppe und blickte zu ihm hinunter.
»Schatz, es tut mir leid, ich habe weder Appetit noch Hunger. Beides hat sich irgendwie verflüchtigt.« Es war nicht so, dass ihr die Straftaten dermaßen auf den Magen schlugen. Aber wenn sie in die Welt der Verbrechen eintauchte, war sie derart darin gefangen, dass sie schlicht nicht ans Essen denken mochte. »Es tut mir wirklich leid.«
»Jede andere Frau würde sich wünschen, von einem begnadeten Koch wie mir zu Tisch gebeten zu werden!« Marc verdrehte die Augen. »Ich muss mir wohl doch langsam überlegen, ob ich mir nicht eine andere suchen sollte, statt meine Kochkünste an dich zu verschwenden!«
Da er diesen Spruch in Variationen seit vierzehn Jahren mit unerschütterlicher Regelmäßigkeit immer wieder zum Besten gab, ließ sich Lisa Kunz davon nicht beeindrucken. Aber sie stieg die Treppe hinab und drückte Marc, der bereits auf seinem Stuhl vor dem Schweinsfilet saß, kurz an sich.
»Entschuldigung«, sagte sie und küsste ihn sanft auf die Stirn. Doch sie drehte sich sogleich wieder um, um sich nach oben zu begeben und sich ihren Akten zuzuwenden – während ihr Mann unten am Esstisch saß und schmollend sein Filet ass.
Am nächsten Morgen würde alles vergessen sein, da war sie sich sicher. Lisa Kunz war ihm schon im Voraus dafür dankbar. Marc kannte sie nach vierzehn Jahren Liebe und sieben Jahren Ehe besser als alle anderen. Er wusste, dass sie nie halbe Sachen machte. Dass sie sich immer hineinstürzte in die Arbeit, als wenn es kein Morgen gäbe. Damit hatte er sich abgefunden, wie auch mit den vielen Überstunden. Das Leben an der Seite einer Frau, die bei der Polizei arbeitete, hielt sich nicht an einen Stundenplan. Man konnte darauf wetten, dass immer exakt in dem Moment, in dem man meinte, man könne tatsächlich einmal etwas gemeinsam unternehmen, vielleicht sogar einen richtigen Tagesausflug machen, bestimmt irgendwo eine Leiche auftauchte. Und zwar der Leichnam eines Menschen, der nicht freiwillig und vor allem nicht ohne fremdes Zutun aus dem Leben geschieden war. Auch wenn er sich darüber ärgerte, dass seine Frau ihn hin und wieder sitzen und ein gemeinsames Abendessen ausfallen ließ, würde er, sobald er fertig war, ihre Portion schön angerichtet und mikrowellenofenfertig in den Kühlschrank stellen – es wäre nicht das erste Mal, dass es am nächsten Morgen spurlos verschwunden sein würde. Weil Lisa Kunz meistens irgendwann mitten in der Nacht doch noch von einer Heißhungerattacke heimgesucht wurde.
Draußen war es dunkel geworden. Im Büro von Lisa Kunz brannte einzig die Schreibtischlampe. Ihr heller Schein fiel auf die eine Hälfte ihres Gesichts. Ihre Stirnfransen warfen schmale, lange Schatten auf ihre Stirn. Wie Spinnenbeine. Die blonde Frau hatte den Kopf auf eine Hand gestützt und war in ein Dossier vertieft. Etliche Fälle kannte sie bereits; die Taten hatten sich ereignet, als sie selbst noch Mitglied der Abteilung Leib und Leben gewesen war, hier bei der Kantonspolizei Bern. Bevor sie vorübergehend zu den Zürcher Kollegen gewechselt und dort eine Gruppenleiterfunktion übernommen hatte. Weil sie im Berner Team ab einem gewissen Zeitpunkt – oder eher ab einem gewissen Dienstgrad – nicht mehr vorwärtsgekommen war, als einzige Frau unter den alteingesessenen Männern. Weil erst der Umweg über Zürich ihr die jetzige Chefposition ermöglicht hatte. Hier in Bern, das war sie sich bewusst, teilten nicht alle ihre Freude daran, dass sie den Job erhalten hatte. Aber einfach war es ja noch nie gewesen. Und wenn, dann wäre es ihr langweilig geworden.
Lisa Kunz gähnte herzhaft und laut und schlug den nächsten Ordner auf. Der Fall Alex Hürlimann. Erinnerungen kamen hoch. Der Junge vom Land, der in der Stadt sein Glück gesucht hatte und nur falsche Freunde fand. Die aus purer Langeweile mit ihm in den Wald hinausfuhren und ihn dort töteten. Mit einem Kopfschuss. Wie bei einer Hinrichtung. Sie hatten die selbst noch jugendlichen Täter zwar allesamt innerhalb kurzer Zeit gefasst, doch der Fall war im juristischen Sinne noch immer nicht abgeschlossen. Weil die Täter bis vor das Obergericht gezogen waren und mit allen Mitteln gegen die psychiatrischen Gutachten kämpften, die sie alle als völlig normal eingestuft hatten. Die jungen Täter wünschten sich jedoch, dass die Gutachter ihnen einen psychischen Schaden attestierten – weil eine verminderte Zurechnungsfähigkeit das Strafmaß senken würde. Das Erschreckende an diesem Delikt war, wie banal das Böse manchmal sein konnte. Der neue Prozess stand in zwei Wochen an, ihr Vorgänger hätte als Zeuge erscheinen sollen. Sie musste abklären, ob jemand aus ihrem Team die Aussage vor Gericht übernehmen konnte oder ob sie selbst einspringen musste.
Der nächste Ordner: ein Beziehungsdelikt. Der Ex-Freund war geständig, »sein Mädchen« in einem »Wutanfall« mit dem Baseballschläger zu Tode geprügelt zu haben. Was genau ihn so wütend gemacht hatte, daran konnte er sich nicht erinnern. Das Gerichtsverfahren stand in wenigen Wochen an, auch diese Akte dürfte bald geschlossen werden.
Dann der dubiose syrische Geschäftsmann, dessen Leiche im Wohlensee versenkt und in einem unappetitlichen Zustand von einer Gruppe junger Pfadfinder entdeckt worden war. Der Blitz