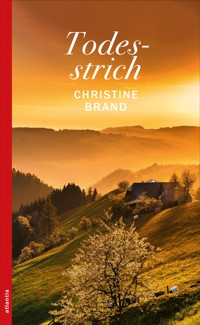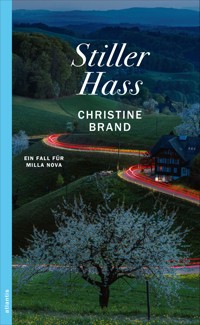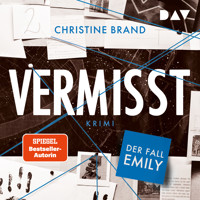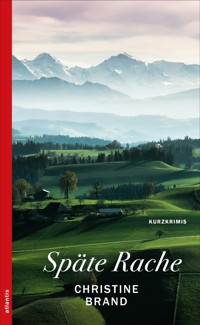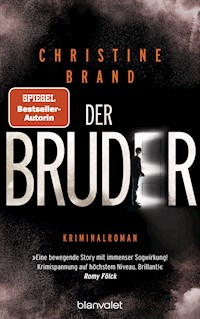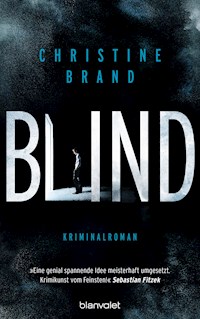10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Milla Nova ermittelt
- Sprache: Deutsch
Ein bizarre Mordserie an Männern sowie Schüsse während einer Frauendisko – in Band 5 der Erfolgsserie halten gleich zwei Fälle Milla Nova und das Team um Sandro Bandini auf Trab.
Ein bizarrer Mord sorgt für Aufsehen: Ein Mann wurde an sein Bett gefesselt und hingerichtet. An den Füßen trägt er rote Stöckelschuhe. Schnell stellt sich heraus, dass er zuvor eine Drohung erhielt: ein Foto von sich selbst – mit dem Absatz eines Stöckelschuhs im Gesicht. Er ist nicht der Einzige, der solch eine Nachricht bekam. Sind auch die anderen Bedrohten in Gefahr? Gleichzeitig jagt das Team um Polizeichef Sandro Bandini einen Mann, der in einer Frauendisko in einem linken Kulturzentrum um sich schoss. Die Vermutung eines rechtsextremen Hintergrunds liegt nahe, doch TV-Reporterin Milla Nova vermutet ein anderes Motiv: Frauenhass. Gemeinsam mit ihrem blinden Freund Nathaniel taucht sie in die dunkle Welt der Incels ein. Zwei Fälle, bei denen der Hass auf das andere Geschlecht eine vitale Rolle spielt. Ist es Zufall oder besteht ein Zusammenhang?
Die unabhängig voneinander lesbaren Krimis um Milla Nova und Sandro Bandini:
1. Blind
2. Die Patientin
3. Der Bruder
4. Der Unbekannte
5. Der Feind
Lesen Sie auch »Wahre Verbrechen»: Christine Brand schreibt über ihre dramatischsten Fälle als Gerichtsreporterin.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 655
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Ein bizarrer Mord sorgt für Aufsehen: Ein Mann wurde an sein Bett gefesselt und hingerichtet. An den Füßen trägt er rote Stöckelschuhe. Schnell stellt sich heraus, dass er zuvor eine Drohung erhielt: ein Foto von sich selbst – mit dem Absatz eines Stöckelschuhs im Gesicht. Er ist nicht der Einzige, der solch eine Nachricht bekam. Sind auch die anderen Bedrohten in Gefahr? Gleichzeitig jagt das Team um Polizeichef Sandro Bandini einen Mann, der in einer Frauendisco in einem linken Kulturzentrum um sich schoss. Die Vermutung eines rechtsextremen Hintergrunds liegt nahe, doch TV-Reporterin Milla Nova vermutet ein anderes Motiv: Frauenhass. Gemeinsam mit ihrem blinden Freund Nathaniel taucht sie in die dunkle Welt der Incels ein. Zwei Fälle, bei denen der Hass auf das andere Geschlecht eine vitale Rolle spielt. Ist es Zufall oder besteht ein Zusammenhang?
Die Autorin
Christine Brand, geboren und aufgewachsen im Schweizer Emmental, arbeitete als Redakteurin bei der »Neuen Zürcher Zeitung«, als Reporterin beim Schweizer Fernsehen und als Gerichtsreporterin. Im Gerichtssaal und durch Recherchen und Reportagen über die Polizeiarbeit erhielt sie Einblick in die Welt der Justiz und der Kriminologie. »Wahre Verbrechen« ist der erster True-Crime-Titel der Bestsellerautorin bei Blanvalet über Kriminalfälle, die sie als Gerichtsreporterin begleitete. Nach »Blind«, »Die Patientin«, »Der Bruder« und »Der Unbekannte«, erscheint mit »Der Feind« der fünfte Fall für das Ermittlerduo Milla Nova und Sandro Bandini. Christine Brand lebt in Zürich, reist aber die meiste Zeit des Jahres um die Welt.
Von Christine Brand bereits erschienen
Blind · Die Patientin · Der Bruder · Der Unbekannte · Der Feind · Wahre Verbrechen: Die dramatischsten Fälle einer Gerichtsreporterin
Besuchen Sie uns auch auf www.instagram.com/blanvalet.verlag und www.facebook.com/blanvalet.
Christine Brand
Der Feind
Kriminalroman
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2023 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: René Stein
Covergestaltung: www.buerosued.de
Covermotive: Stephen Mulcahey / Arcangel
JA · Herstellung: sam / eR
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-27576-1V002
www.blanvalet.de
Prolog
Sie glaubt ihr.
Sie erkennt es in ihren Augen: Die Frau glaubt ihr, obwohl sie eine miserable Zeugin in eigener Sache ist.
Ihre Schilderung ist lückenhaft, Erinnerungsfetzen wie verstreute Bruchstücke, die nicht zusammenpassen. Sie weiß nicht mehr, was zuerst war und was danach und was dazwischen. Sie weiß nur noch, dass sie sich wegdachte, als es unerträglich wurde. Sich abspaltete von ihrem Körper. Plötzlich passierte es nicht mehr ihr, sondern einer anderen, mit der sie nichts zu tun hatte. Er konnte ihr nicht mehr wehtun, weil sie weit weg war von ihrem Körper oder vielleicht auch ganz tief in ihm drin, damit er nicht an ihre Seele rankam. Sie hörte die Schreie dieser anderen Frau, ihr Ringen nach Luft, und obwohl etwas in ihr ahnte, dass sie selbst diese unmenschlichen Geräusche ausstieß, ging es sie doch nichts an. Weil es nicht sein durfte. Weil es zu schrecklich war. Ihr Kopf ließ nicht zu, dass ihr das hier und jetzt passierte. Dass jemand ihr das antat.
Doch dann kam der Moment, in dem sie begriff, dass es aus war. Dass sie im nächsten Augenblick sterben würde, obwohl sie ihr Leben erst noch leben wollte. Wie konnte es vorbei sein, wo es doch gerade erst richtig begonnen hatte? Auf einen Schlag war sie wieder da, sie war wieder sie selbst, steckte in ihrem Körper und spürte den brennenden Schmerz im Hals, schmeckte Eisen und Blut und bekam keine Luft. Luft, bitte! Sie brauchte Luft, Luft zum Atmen! Es kam nichts. Alles zu. Zu stark der Druck. Und diese Schmerzen; ein furchtbares Blitzgewitter in den grässlichsten Farben.
So sieht also mein Sterben aus, dachte sie in einer nüchternen Klarheit. Nur das, nur dieser eine Gedanke: So sieht also mein Sterben aus. Das ist mein Tod.
Die Blitze hinter ihren Augenlidern verblassten. In einer unerträglichen Langsamkeit tauchte sie ab in einen unendlich tiefen, dunklen Schlund.
Die Ohnmacht war eine Erlösung und vielleicht auch ihre Rettung. Mehr weiß sie nicht. Nur, dass das Erwachen danach schrecklich war.
Das alles berichtet sie der Frau, sie sieht das Entsetzen in ihren Augen. Schweigend hat sie ihr zugehört, und schweigen tut sie auch jetzt noch, als sie nichts mehr zu erzählen weiß. Die Stille legt sich schwer und zäh zwischen die beiden Frauen. Sie würde weinen, hätte sie noch Tränen übrig. Sie spürt Mitleid, obwohl die fremde Frau versucht, die professionelle Distanz zu wahren.
Einen Moment lang stellt sie sich vor, sie sei nicht die junge Frau mit dem zerschlagenen Gesicht und dem geschändeten Körper, hier auf diesem Stuhl – sondern die kleine Spinne in der oberen Zimmerecke in ihrem Netz, die auf sie beide herunterstarrt. Wie sie sich hier gegenübersitzen, sie und die Polizistin, am grauen Bürotisch mit der spiegelglatten Fläche, in diesem kargen Zimmer. Zwischen ihnen das Aufnahmegerät, das die Sekunden zählt, auch wenn keine Worte fallen. Der Kugelschreiber in der rechten Hand, mit dem sich die Polizistin Notizen macht, innehält, ihn weglegt, ihn wieder zur Hand nimmt. Ein kariertes Heft. Die Polizistin ist nicht viel älter als sie selbst, fünf oder zehn Jahre vielleicht. Womöglich denkt sie, sie habe Glück gehabt, dass er nicht sie erwischt hat.
»Sie sagen, er hat Sie gewürgt, während er Sie vergewaltigte?«
»Ja.« Ihre Stimme zittert noch immer.
»Wie stark hat er Sie gewürgt?«
»Ich weiß nicht, was soll ich sagen?«
»Brannte es in Ihrem Hals, wurde Ihnen schwarz vor Augen?«
»Ja. Ich meine, ich bin ohnmächtig geworden. Ich dachte, ich sterbe. Ich bin erst wieder aufgewacht, als er weg war.«
Noch nie hat sie sich so allein und klein gefühlt wie in jenem Augenblick, als sie merkte, dass ihr Körper zwar noch am Leben, ihre Seele aber zerstört war.
»Es ist gut, dass Sie zu uns gekommen sind. Ich weiß, wie schwierig das für Sie sein muss.«
Einen Scheiß weiß sie.
»Es ist wichtig, dass Sie eine Personenbeschreibung machen können.«
Sie denkt nach. Er hatte kein Gesicht, nur diese schwarze Maske. Die Augen, sie sah die Augen, aber sie erinnert sich nicht.
»Er war groß, kräftig, hatte Haare an den Armen.«
»Dunkle?«
»Ja, nein, ich weiß nicht. Es war dunkel.«
»Sie sagen, er sei in Ihre Wohnung eingedrungen, stand plötzlich vor Ihrem Bett, hat Sie sofort überwältigt.«
»Ja.«
»Das Fenster stand offen?«
»Ja.«
»Sind Sie sicher, dass es ein Fremder war? Könnte es jemand gewesen sein, den Sie kannten?«
Jemand, den sie kannte? Sie kennt keine Menschen, die so etwas tun würden. Niemals.
»Nein.«
»Es tut mir sehr leid, dass Ihnen das zugestoßen ist.«
»Werden Sie ihn kriegen?«
»Wir werden alles versuchen.«
Sie hört den Zweifel in der Stimme der Polizistin. Sie ahnt, dass sie ihn nie fassen werden. Und falls sie ihn doch fassen sollten, dass man es ihm nicht wird nachweisen können.
Es war falsch hierherzukommen. Die ärztliche Untersuchung; beschämend. Die vielen Fragen; eine Tortur. Das Ganze wieder und wieder zu durchleben … sie kann nicht mehr.
Sie will nie mehr an die Sache denken, nichts mehr damit zu tun haben, es ist nie passiert. Es ist nicht ihr passiert. Nicht ihr. Wenn sie sich nur stark genug einbildet, dass es jemand anderes war, der durch diese Hölle musste, dann wird es sein, als ob es nie geschehen wäre.
Die Polizistin sagt, sie könne gehen. Endlich. Sie verlässt das Gebäude, das wie ein altes Schulhaus riecht. Die Frau am Empfang lässt sie raus, die Glasschiebetür schließt sich lautlos hinter ihr, so wie sie dieses Kapitel in ihrem Leben schließt und gleichzeitig streicht. Gelöscht. Für immer. Es geht sie nichts mehr an. Es ist nicht ihr passiert.
Als sie draußen auf die Straße tritt, blendet sie die Sonne, viel zu hell, als wolle sie die Menschen glauben machen, es sei ein guter Tag. Was für eine Lügnerin. Und doch: In diesem Moment denkt sie, es ist vorbei. Aufstehen, Krone richten, weitergehen. Sie lässt es hinter sich, und es bleibt nichts zurück.
Sie ahnt nicht, wie sehr sie sich irrt. Es werden Wochen vergehen, bis sie realisiert, dass er mehr hinterlassen hat als die körperlichen und seelischen Verletzungen. Etwas, das für immer da sein und sie stets an ihn erinnern wird.
Sein Kind.
Ihr Kind.
Das Kind ihres Vergewaltigers.
1.
Rote, blaue und gelbe Lichtpunkte sprenkeln den Raum. Hoch oben im Gebälk dreht sich glitzernd die Discokugel, der wummernde Bass bringt den Dachstock zum Vibrieren, der Holzboden bebt unter den vielen Füßen. DJane Valeria hat Elektro House aufgelegt; Musik wie eine Droge, die die Tanzenden in Trance versetzt. Bettina hält die Augen geschlossen, den Kopf leicht in den Nacken gelegt, die Arme ausgestreckt. Ihr Oberkörper nimmt den Rhythmus auf und lässt sich von ihm tragen. Winzige Schweißperlen blitzen auf ihrer Stirn. Sie ist keine gute Tänzerin, das war sie noch nie, doch das spielt keine Rolle; hier wird keine schräg angeschaut, unabhängig davon, wie sie sich bewegt oder wie sie sich kleidet. Als der Song nahtlos ins nächste Stück übergeht, spürt Bettina, dass jemand sie von hinten umarmt. Petra legt ihr einen kleinen Kuss auf den Nacken, dort, wo die Schulter endet und in den Hals übergeht. Sofort richten sich Bettinas Härchen auf. Sie schaudert wohlig, dreht sich um, streicht Petra mit einer vertrauten Geste eine Strähne aus dem Gesicht.
»Noch einen Drink?«
»Gerne.«
»Das Gleiche?«
Petra nickt. Bettina löst sich von ihr, hält noch einen Moment lang ihre Hand fest, lässt sie los, ihre Fingerspitzen streifen und verlieren sich, dann taucht sie in die Menschenmenge ein und bahnt sich einen Weg zur Bar. Die Stimmung dampft, das Klima erinnert an eine Sauna, oder eher an ein Dampfbad. Bettina berührt nassgeschwitzte Haut, als sie sich zwischen den tanzenden Frauen durchzwängt. Plötzlich hält eine Hand ihren Arm fest, sie wendet sich um. Sonja. Bettina begrüßt sie mit einer flüchtigen Umarmung, neben Sonja winkt Nicole.
»Ihr seid in der Stadt?«, fragt Bettina.
»Noch bis Samstag.«
»Sehen wir uns auf einen Drink?«
»Klar, ich melde mich!«
Sie müssen schreien, um die Musik zu übertönen.
Als sich Bettina wieder umdreht, steht Regine vor ihr, sie lachen sich an, weisen auf die Ohren, zucken mit den Schultern, man versteht nicht mal sein eigenes Wort. Bettina wirft einen Blick Richtung Klo in der hinteren Ecke, doch sie unterdrückt das Bedürfnis gleich wieder; die Schlange ist zu lang. Neben den Wartenden kuschelt ein Paar auf einem alten Ledersofa. Hinter ihnen auf der weißen Mauer steht in blauen Buchstaben geschrieben: Kein Rassismus, kein Sexismus, keine physischen, psychischen, sexuellen Übergriffe, keine Homophobie! Bettina wendet sich ab und stellt sich an die Bar. Über der Theke hängt ein von Hand geschriebenes Schild: Frauendisco. Jeden Donnerstag steigt unter dem Dach des alternativen Kulturzentrums Reitschule eine Frauenparty, ein Treffpunkt der familiären Lesbenszene, aber auch für Hetero-Frauen, die keinen Bock auf männliche Anmache haben.
»Zwei Gin Tonic mit Pfeffer und Gurke!«, brüllt Bettina der Barkeeperin die Bestellung zu. Die Frau mit pinken Zöpfen streckt den Daumen hoch und greift zum Hendricks Gin. Bettina lehnt sich an die Theke.
»Bist du nicht die Polizistin?«
Die fremde Stimme ist ganz nah an ihrem Ohr. Bettina schnellt herum. Die Frau, die neben ihr auf einem Barhocker sitzt, schaut sie fragend an. Bettina kennt sie nicht. Das Gesicht kommt ihr nicht einmal bekannt vor. Sie wüsste, wenn es ihr schon mal begegnet wäre.
»Du musst mich verwechseln.«
Die Fremde legt die Hand auf Bettinas Arm, die Geste wirkt zu vertraut, zu nah, Bettina schüttelt sie ab.
»Nein, echt, ich bin kein Bulle.« Sie legt einen Zwanziger auf die Bartheke, greift nach den Gläsern und dreht sich weg.
Bettina wundert sich, wie leicht ihr die Lüge über die Lippen ging. Sie will nicht, dass sich in der Szene rumspricht, wo sie arbeitet. Je weniger darüber Bescheid wissen, desto besser. Überdies ist das alternative Kulturzentrum der denkbar schlechteste Ort, um sich als Polizistin zu outen. Das Verhältnis der Betreiber zur Polizei ist … man könnte wohlwollend sagen: ambivalent. Auf jeden Fall ist man hier gut beraten, sich nicht als Bulle zu erkennen zu geben, wenn es nicht unbedingt sein muss.
Bettina schlägt die Richtung ein, in der sie gerade eben noch mit Petra getanzt hat. Der Sound ist krachender als zuvor. DJane Valeria hat ein Stück mit schwerem Bass und schnellen Trommelwirbeln aufgelegt. Bettina schiebt sich seitwärts an zwei tanzenden Frauen vorbei, als sie im rechten Augenwinkel eine Bewegung wahrnimmt, die sie herumfahren lässt. Da ist nichts, sie muss sich getäuscht haben. Sie will sich schon wieder abwenden, da fällt ihr auf, dass da doch etwas ist, etwas, das vorher nicht da war. Die Mauer mit dem blauen Schriftzug ist auf einmal vollgekleckert, als hätte jemand einen Farbbeutel dagegen geschmissen.
Bettina denkt im ersten Moment an Blut. Déformation professionelle. Sie schüttelt über sich selbst den Kopf und schiebt den Gedanken weg. Da hört sie das Knallen. Obwohl die laute Musik die Salven dämpft, erkennt sie sofort, worum es sich handelt: um Schüsse, aus einem Maschinengewehr.
Sie lässt die Gläser fallen, nimmt wahr, wie sie in Zeitlupentempo auf dem Boden aufprallen und in Scherben zerspringen.
»Petra!«
Bettina brüllt den Namen ihrer Freundin und stürzt los. Sie denkt nicht nach, sie folgt einzig dem Instinkt. Die Frauen um sie herum reklamieren verärgert, sie verstehen nicht, warum Bettina sie wegstößt, sie meinen, das Rattern gehöre zum Sound. Doch dann übertönt ein hysterisches Kreischen die Musik. Bettina sieht zwischen den Beinen der tanzenden Frauen hindurch einen Körper zu Boden sinken.
In jenem Bruchteil der Sekunde, in dem die Menge begreift, was passiert, scheint die Zeit kurz innezuhalten. Als sich die Welt einen Wimpernschlag später wieder in Bewegung setzt, kreischen und schreien alle auf einmal los. Eine Woge des Entsetzens überschwemmt die Frauen, jede beginnt zu rennen und zu stürzen und zu drängeln und zu weinen. Wer fällt, versucht sich wieder hochzurappeln, wird aber von den anderen einfach übertrampelt. Panik verzerrt die Gesichter der Fliehenden. Alle wollen weg vom Rattern der Schüsse, nur raus hier, doch die Tür, über der ein grünes Leuchtschild den Notausgang anzeigt und die direkt nach draußen führt, ist rasch verstopft, es gibt kein Durchkommen mehr. Auch über die steile Treppe hinab zum Haupteingang ist der Weg von zu vielen verängstigt drängelnden Frauen versperrt. Noch immer knallen Schüsse.
Bettina drängt dem Lärm entgegen, ohne Vernunft, alles ignorierend, was sie als Polizistin gelernt, geübt, verinnerlicht hat. Sie ist unbewaffnet. Sie müsste in Deckung gehen. Doch irgendwo da vorne ist Petra, dort, wo der Attentäter um sich schießt. Sie muss dahin, doch sie schafft es nicht gegen den Strom der flüchtenden Menschen an.
»Petra!« Bettinas Herz verkrampft sich, ihre Kehle ist auf einmal viel zu eng, der Mund so trocken, dass sie zu ersticken meint. »Petra, wo bist du? Petra!«
Auf einen Schlag geht die Musik aus. Auch die Schüsse sind verstummt. Ein schrecklicher Klangteppich breitet sich aus: Schmerzenslaute, Weinen, Klagen, ein Wimmern, das klingt, als käme es von einem Tier. Frauenkörper liegen neben- und übereinander auf der Tanzfläche verstreut, über der sich die Discokugel unaufhaltsam weiterdreht. Bettina schaut sich um, erfasst das Ausmaß des Verbrechens mit analytischem Blick: Mehrere Todesopfer, circa zehn bis fünfzehn Personen liegen reglos am Boden. Noch einmal etwa so viele sind verletzt. Bettina sieht Schusswunden und Blut, überall Blut, sie kann es auch riechen. Wo ist der Schütze?, fragt sie sich. Doch dann drängt erneut die viel wichtigere Frage in ihren Kopf: Wo ist Petra? Bettina weiß, sie muss den Rettungsdienst verständigen, die Kollegen rufen, sie brauchen hier ein Großaufgebot, Triage … doch sie kann nicht. Sie muss erst ihre Freundin finden.
»Petra! Petra!«
Als Erstes sieht sie ihren Schuh. Lass sie nicht tot sein, denkt Bettina, als sie zu dem Bein hinrennt, das unter einem anderen Körper hervorschaut. Petra liegt unter einer Frau, deren Augen entsetzt und tot ins Leere starren. Bettina zerrt sie weg, um Petra zu befreien, doch auch Petra rührt sich nicht. Bettina fasst sie am Kopf, küsst sie auf die Stirn, flüstert verzweifelt ihren Namen. Sie fühlt sich warm an, aber da ist viel zu viel Blut. Bettina schiebt Petras blutgetränkte Bluse hoch. Ein Bauchschuss. Sie reißt sich das Shirt vom Leib, knüllt es zusammen und presst es auf die offene Wunde. Mit der anderen Hand tastet sie verzweifelt nach einem Puls.
Sie spürt ihn.
Das Herz schlägt.
Petra lebt.
»Ein Arzt! Jemand muss den Notruf wählen! Ein Arzt! Den Notruf!« Bettina schreit und schreit und schreit, und obwohl sie weiß, dass sie sich mitten unter vielen anderen schockierten Menschen befindet, fühlt sie sich doch, als gäbe es auf dieser Erde jetzt in dem Moment kein einziges anderes Wesen mehr, nur noch sie und Petra, die unter ihren Händen stirbt.
Verzweifelt presst sie das Shirt auf Petras Bauch. Bunte Lichtpunkte regnen auf ihre Geliebte. Auf einmal beginnt sich alles um sie herum zu drehen. Bettina verliert den Sinn für Zeit und Ort. Da hört sie draußen die Sirenen der ersten Einsatzwagen heulen.
»Es kommt Hilfe, Hilfe kommt«, flüstert sie Petra zu. »Alles wird gut, du schaffst das, alles wird gut.« Ein Schluchzen erschüttert Bettina, doch sie reißt sich sofort wieder zusammen. »Stirb mir hier jetzt nicht weg. Wir sind noch nicht fertig, wir zwei, wir haben noch vieles vor, so schnell kommst du mir nicht davon, du musst leben, du darfst nicht sterben, tu mir das jetzt nicht an, du musst leben!« Ihre Worte klingen wie ein Mantra oder wie ein Gebet. Vielleicht ist es das auch, ein Gebet, obwohl Bettina schon lange an keinen Gott mehr glaubt.
2.
»Auf dich!«
»Auf dich!«
Millas Lachen übertönt das Klingen der Weingläser. Es passiert ihr und Sandro immer öfter, dass sie zeitgleich exakt dasselbe sagen. Womöglich eine Begleiterscheinung des Alters – oder wohl eher ein Zeichen dafür, dass sie schon sehr lange zusammen sind.
»Also auf uns!« Sie prostet Sandro ein zweites Mal zu. »Obwohl ich finde, dass wir heute ein bisschen mehr auf dich anstoßen, es ist schließlich dein Geburtstag.«
»Einverstanden. Ausnahmsweise.« Auch Sandro lacht jetzt.
Sie sitzen im kleinen Sommerpark des Berner Restaurants Ringgenberg. Der Wind spielt mit den Blättern in den Ästen über ihren Köpfen. Gelächter und fröhliche Stimmen dringen vom Kornhausplatz herüber. Das Geräuschpotpourri klingt nach Ferienlaune und nach einer kollektiven Erleichterung, weil man endlich wieder draußen sitzen, weil man wieder sorgenfrei zusammen unterwegs sein kann.
Milla blickt in Sandros dunkle Augen. Selbst nach all den Jahren kann sie noch immer darin versinken. Jahre, in denen sie Höhen und Tiefen und beinahe tödliche Dramen miteinander erlebt haben. Es grenzt an ein Wunder, dass sie immer noch zusammen sind: Milla, die TV-Reporterin, und Sandro, der Polizeichef. Es ist eine berufliche Konstellation, die der harmonischen Zweisamkeit nicht gerade förderlich ist. Tatsächlich fühlt sich Milla aber seit ihrer letzten Versöhnung sogar wieder ein bisschen wie frisch verliebt. Ein Glück, dass auch das noch immer möglich ist; sich von Neuem in den Mann zu verlieben, den man seit Jahren liebt.
»Ich fühle mich …«
Patti Smiths Break It Up dringt aus Millas Handy und unterbricht sie, bevor sie zu ihrer Liebeserklärung ansetzen kann. Wie passend, denkt Milla sarkastisch. Sie hat sich den Song noch vor der Versöhnung mit Sandro als Klingelton hochgeladen, als sie dachte, dass es dieses Mal endgültig aus sei. Milla weiß, dass sie den Anruf ignorieren sollte; sie hat Feierabend, es ist Sandros Geburtstag, niemand soll sie stören. Dennoch schafft sie es nicht. Nur rasch schauen, wer es ist, denkt sie, bloß einen kurzen Blick aufs Display werfen. Sie sucht nach dem Gerät, und als sie es endlich zuunterst in dem tiefen Schlund ihrer Handtasche findet, schweigt Patti Smith bereits wieder. Es zeigt Milla einen unbeantworteten Anruf an.
»Wolfgang«, liest sie laut, während sie sich eine ihrer schwarzen Locken um den Zeigefinger kringelt.
»Ach, dabei ist es gerade so schön gewesen.« Sandro verdreht die Augen. Es wäre nicht das erste Mal, dass ihnen Millas Chef den Abend verdirbt.
»Ich hab ihn verpasst. Zum Glück!« Milla will das Handy wegstecken, da beginnt Patti Smiths Song wieder von vorne. Sie hält inne, schaut auf das Gerät in ihrer Hand. »Ich hör nur rasch, was er will …«
Sandro nickt wissend. Wenn abends um halb neun der Redaktionsleiter von Millas Sendung Wochenthemen anruft und sie nurrasch hören will, was er wünscht – dann bedeutet das in der Regel, dass sie innerhalb der nächsten zwei Minuten aufspringt, weil sie wirklich dringend losmuss, und dass sie Sandro alleine vor zwei vollen Tellern sitzen lässt.
»Keine Sorge, ich werde nicht ausrücken, es ist schließlich dein Geburtstag«, versichert Milla, während sie den Anruf entgegennimmt.
»Milla, du musst sofort los!«, hört sie ihren Chef Wolfgang rufen, bevor sie zu Wort kommt. »Ein Amoklauf!«
»Ein Amoklauf?«
»Oder ein Terroranschlag!«
In dem Moment schrillen Sandros Pager und sein Handy los. Milla und Sandro schießen gleichzeitig von den Stühlen hoch. Noch am Telefon winkt Milla der Kellnerin und hält ihr einige Geldscheine hin, um zu bezahlen, was sie bestellt, aber noch nicht gegessen haben. Mit dem einen Ohr hört sie Sandro Fragen und Befehle in sein Telefon rufen, mit dem anderen hört sie Wolfgang zu. Im Kulturzentrum Reitschule habe es eine Schießerei gegeben, sagt er, einen Terroranschlag, wie in Paris, es gebe Tote, sie müsse sofort da hin.
Sandro nickt Milla zu und rennt los. Milla verabschiedet sich von der Kellnerin und setzt ebenfalls zu einem Ausdauerlauf quer durch die Stadt an. Sie ist die Läuferin der beiden, im Nu hat sie Sandro eingeholt, überholt und abgehängt. Er ruft ihr etwas hinterher, doch sie hört weg, weil sie auch so weiß, was er ihr sagen will. Dass sie sich fernhalten soll. Dass es zu gefährlich ist. Aber nicht nur er, auch sie hat einen Job zu erledigen.
Milla braucht knapp fünf Minuten, bis sie das autonome Kulturzentrum erreicht, das unweit des Bahnhofs Bern in einer ehemaligen Reithalle einquartiert ist. Der historische Bau mit seinen Erkern und Türmchen liegt hinter einem großen Parkplatz unter einer Eisenbahnbrücke. Auf dem Vorplatz brennen zwei Feuer in schwarzen Tonnen. Sie lassen gespenstische Schatten über die Graffiti an der Hausfassade tanzen. Schon von Weitem hört Milla Schreie. Sie wünschte, Ivan wäre hier, ihr Kameramann, den sie bei ihren krassesten Einsätzen an der Seite hatte. Jetzt aber ist sie auf sich allein gestellt. Sie blickt sich um und versucht, sich eine Übersicht zu verschaffen; drei Streifenwagen sind bereits vor Ort, Sirenen nähern sich, sie sieht Menschen, fast ausnahmslos Frauen, die auf den Vorplatz strömen, manche rennen, hetzen, einige begeben sich ruhig nach draußen. Viele weinen, andere schweigen, allen ist der Schrecken anzusehen; blasse Gesichter, Panik in den Augen. Milla greift zum Handy und beginnt zu filmen. Wie auf Knopfdruck ist sie wieder ganz Journalistin: Sie muss all die Bilder einfangen, weil sie eine Zeugin ist, die berichten wird, was hier passiert. Sie wird das Geschehen zur besten Sendezeit in die Wohnzimmer der Nation tragen, wo die Menschen gemütlich in ihren Fernsehsesseln sitzen und ihre Kommentare zum Drama abgeben werden.
Obwohl die Situation chaotisch ist, hat Milla keine Angst; sobald ihr Kopf und ihr Körper in den Journalistenmodus schalten, scheinen ihr Furcht und mitunter auch die Vernunft abhandenzukommen. Was aber nicht bedeutet, dass sie unvorsichtig wird: Ihr Instinkt ist hellwach. Aber ihr Kameramann fehlt. Trotz aller Routine fühlt sich Milla unwohl, filmend auf die Menschen zuzugehen, die sich in einem krassen Ausnahmezustand befinden. Milla muss auf sie wie eine Schaulustige wirken, die ein Handyfilmchen dreht. Sie vermisst Ivan auch als verlässlichen Partner, der bislang immer bei ihr war, wenn es brenzlig wurde. Und brenzlig ist nur der Vorname dessen, was hier gerade abgeht.
»Was ist passiert? Sind Sie verletzt?«, fragt Milla eine Frau mit kurzem schwarzem Haar, die etwas abseits auf dem Boden sitzt und heftig atmet. »Ich bin vom Fernsehen, ich filme mit«, schiebt Milla nach.
»Ich bin okay, ich bin okay, ich bin okay, aber die anderen, es ist schrecklich.«
»Was ist passiert?«
»Ich glaube, es wurde geschossen. Sie sind einfach zusammengebrochen. Sie sind tot!« Die Frau stößt die Worte aus sich heraus, als würde ihr jedes einzelne Schmerzen bereiten.
»Wo wurde geschossen?«, hakt Milla nach.
»In der Frauendisco. Aber es war laut, die Musik, ich weiß nicht, ich glaube sie sind tot.«
»Haben Sie gesehen, wer geschossen hat?«
»Nein. Meine Freundin ist noch da drin. Ich habe sie im Getümmel verloren.«
Die Frau beginnt zu weinen. Milla legt ihr die Hand auf die Schulter, blickt sich um. Gerade fährt der erste Rettungswagen vor, noch ist kein Care-Team der Notfallpsychiater vor Ort. Aus dem Augenwinkel erkennt Milla, dass auch eine Spezialeinheit der Polizei eintrifft, bewaffnete Männer in Schutzwesten, Helmen und Schilden stürzen aus zwei Kastenwagen. Eine andere Gruppe von Polizisten beginnt, das Gebiet um die Reithalle abzusperren. Milla zögert, blickt noch einmal auf die Frau.
»Es tut mir leid, ich muss los, sonst komm ich nicht mehr rein.«
»Nicht dort rein! Nicht!«
Milla ignoriert die Warnung. Hastig eilt sie auf das Gebäude zu, das Handy hält sie vor sich, fängt Bilder der Menschen ein, die aus der Halle fliehen.
»Wird noch immer geschossen?«, fragt sie eine Jugendliche, die ihr entgegenstolpert. Die junge Frau reagiert nicht. Ihr Gesicht ist ausdruckslos, die Augen leer, sie steht unter Schock. Milla geht zögerlich weiter. »Wird noch geschossen? Sind die Täter noch drin?«, fragt sie immer wieder. Doch klare Antworten kriegt sie nicht.
»Wir müssen weg!«, ruft ein Mann.
»Die schießen«, sagt eine Frau leise, als wage sie es kaum laut auszusprechen.
»So viele sind tot!«, schreit eine andere.
Alles ist hier Chaos. Milla hat keine Ahnung, ob die Gefahr gebannt ist oder ob sie dem Attentäter direkt vor die Waffe laufen wird. Sie hält inne, horcht – es sind keine Schüsse zu hören. Was aber nichts bedeuten muss. Milla gibt sich einen Ruck und setzt sich wieder in Bewegung. Doch sie kommt nicht weit. Jemand packt sie am Arm. Milla schnellt erschrocken herum. Ein Polizist des Sonderkommandos hält sie fest.
»Kommen Sie, ich bringe Sie raus. Sie sind in Sicherheit.«
»Ich bin Journalistin, ich muss da rein!« Milla versucht, sich zu lösen. Doch in der gleichen Sekunde wird der Griff eine Spur stärker, auch die Freundlichkeit ist weg.
»Raus mit Ihnen, Sie haben hier nichts zu suchen. Hier herrscht höchste Gefahr!«, brüllt der Polizist sie an.
Als ob ich das nicht selbst sehen könnte, denkt Milla. »Ich habe einen Presseausweis, lassen Sie mich los!«
Das grunzende Geräusch des Polizisten klingt nicht nach Zustimmung. Flugs dreht er ihr den Arm auf den Rücken und schubst sie unsanft vor sich her, um sie schließlich an einen Kollegen hinter der inzwischen aufgebauten Absperrung zu übergeben.
»Presse.« Er spuckt das Wort aus wie ein lästiges Insekt und wendet sich wieder ab, um seine Arbeit zu erledigen.
»Ist er noch drin?«, fragt Milla den anderen Beamten.
»Wir wissen es nicht. Dahinten wird gerade ein Presseposten eingerichtet. Wenden Sie sich bitte an unseren Kommunikationschef.«
»In Ordnung.« Milla schlägt die Richtung ein, die der Mann ihr angezeigt hat, wendet sich aber nach wenigen Metern um. Der Polizist beachtet sie nicht mehr, also begibt sich Milla auf den Parkplatz. Sie filmt die Reitschule in der Totalen. Filmt die Polizisten in Schutzausrüstung, die das Gebäude sichern. Filmt die Sanitäter, die hineinrennen und mit Menschen auf Tragen zurückkehren. Sie geht so nah ran wie möglich, versucht alles aufzunehmen. Als sie sich einem Rettungswagen nähert, sieht sie, wie eine verletzte Frau herangetragen wird. Milla zoomt sie heran. Die Verwundete regt sich nicht. Es ist nicht auszumachen, ob sie bewusstlos ist oder tot.
»Nicht filmen!«
Milla blickt auf. Sie kennt die Frau, die die Hand vor ihr Handy hält, auch wenn sie ganz anders aussieht als sonst. Obenrum trägt sie nichts als einen BH, ihre Hände und Arme sind blutverschmiert. Es ist Bettina, die Polizistin. Sandros Kollegin.
3.
Bruno schnuppert seit gefühlten fünf Minuten an der Hausecke.
»Können wir mal weiter?«, fragt Jeremias Schildknecht seinen Rauhaardackel, der in Hundejahren etwa gleich alt ist wie er selbst. Der Dackel ist elf, Jeremias Schildknecht ist siebenundsiebzig. Bruno ist einzig um die Schnauze herum ergraut, Jeremias’ Haar ist schlohweiß, überall dort, wo es noch vorhanden ist. Sie haben nur noch sich beide und pflegen einen höflichen Umgang miteinander. Jetzt aber zuckt Jeremias Schildknecht doch mal sanft an der Leine.
Bruno blickt auf, hebt im Zeitlupentempo sein Bein und setzt mit fünf spärlichen Tropfen seine Markierung. Dann setzt er sich endlich in Bewegung.
Jeremias Schildknecht vernimmt in der Ferne Sirenengeheul.
»Sirenen«, informiert er Bruno. Seine Ohren sind noch besser als die seines Hundes. »Viele Sirenen. Vermutlich ein Unfall auf der Autobahn. Hoffentlich nichts allzu Schlimmes.«
Jeremias Schildknecht und Bruno trotten langsam um den nächsten Häuserblock, so schnell, wie es Jeremias Hüfte und Brunos kurze Beine zulassen. Es ist ruhig in der Straße, hier kommt selten ein Auto vorbei. Sie biegen um die Ecke, um von der Rückseite her in ihr Wohnhaus zu gelangen. In der Parterrewohnung ihres Nachbarn brennt Licht. Es brannte schon gestern und vorgestern Abend, als sie von ihrem Spaziergang nach Hause kamen. Das ist ungewöhnlich, weil Jürgen Bräutigam, so heißt er wirklich, abends eigentlich nie zu Hause ist. Er legt als DJ auf, hat er Schildknecht mal erzählt, was immer das wohl heißen mag, auf jeden Fall ist er sonst nie da, und jetzt brennt seit Tagen Licht.
»Eigenartig«, sagt Jeremias Schildknecht zu Bruno. »Vielleicht ist er krank.«
Der alte Mann will gerade die Tür aufschließen, da hält er inne und wendet sich den Briefkästen zu, die in die Mauer eingelassen sind. Er schließt den seinen auf: leer. Seit er den Aufkleber Keine Werbung angebracht hat, erhält er gar keine Post mehr.
»Vielleicht sollte ich eine Zeitung abonnieren«, murmelt er, wie jedes Mal, wenn er vor seinem leeren Briefkasten steht.
Nicht, weil er neugierig ist, sondern aus nachbarschaftlicher Fürsorge sucht er nach dem Schildchen, auf dem der Name Bräutigam steht. Der Briefkasten ist direkt neben seinem. Er schaut sich um, dann hebt er vorsichtig die Klappe des Schlitzes hoch und späht hinein: voll. Er öffnet das Paketfach; auch darin liegen Briefe und Tageszeitungen, wohl weil sie oben keinen Platz mehr fanden.
»Das ist jetzt aber doch sehr eigenartig. Sehr eigenartig.«
Bruno setzt sich hin, schaut zu Jeremias Schildknecht hoch, stellt den Kopf schräg und spitzt die Ohren. Sein Herrchen blickt zu ihm hinab.
»Ich glaube, wir sollten etwas tun. Vielleicht liegt er wirklich krank im Bett, so krank, dass er unsere Hilfe braucht.«
Bruno wedelt drei Mal mit dem Schwanz, was Jeremias Schildknecht als Zustimmung auffasst. Er blickt auf die Uhr: Es ist zwanzig vor neun, seiner Ansicht nach etwas spät, um beim Nachbarn unangemeldet an der Tür zu klingeln, aber Bräutigam ist noch jung, und die jungen Leute ticken anders, die haben es nicht so mit der Etikette. Schildknecht öffnet die Haustür, sieben Stufen führen ihn hinauf ins Hochparterre. Doch statt links in seine Wohnung zu gehen, stellt er sich vor die rechte Tür und versucht, durch den Türspion hineinzugucken. Er erkennt einzig einen winzigen hellen Punkt, weil drinnen Licht brennt, mehr nicht. Also drückt er auf die Klingel und fährt erschrocken zusammen, als sie losschrillt. Sie klingt viel lauter als tagsüber, Schildknecht fürchtet, dass er gerade das ganze Haus geweckt hat.
Er wartet.
Eine Minute, zwei Minuten.
Drinnen regt sich nichts. Erneut drückt er auf die Klingel, etwas länger und kräftiger jetzt. Wieder zuckt er zusammen. Doch niemand öffnet.
Bruno hat es sich mittlerweile auf der Fußmatte bequem gemacht und den Kopf auf die Vorderpfoten gelegt.
»Was machen wir jetzt?«, fragt ihn Jeremias Schildknecht.
Bruno zieht die Augenbrauen in die Höhe.
»Du bist mir heute wahrlich keine große Hilfe.«
Zum zweiten Mal innerhalb von wenigen Minuten blickt Schildknecht auf die Uhr. Zwanzig Uhr fünfundvierzig. Vorsichtig klopft er an die Tür, er beugt sich vor, drückt sein Ohr an das Holz. Er hört nichts.
Jeremias Schildknecht kratzt sich an einer kahlen Stelle an seinem Schädel. Er ist zu weit gegangen, um jetzt einfach umzudrehen, seine Wohnungstür aufzuschließen, zu Bett zu gehen und das Ganze zu vergessen.
»Bruno, du wartest hier.« Schildknecht legt die Leine sorgfältig neben seinen Hund auf die Fußmatte, atmet zweimal tief durch und macht sich dann daran, die Treppe hochzusteigen. Seine Lunge funktioniert nicht mehr so gut. Er muss nur zwei Stockwerke hoch, aber ihm kommt es wie der Kilimandscharo vor; doch er weiß, dass er es schaffen kann, wenn er sich zur Langsamkeit zwingt. Im zweiten Stock wohnt der Hauswart Walter Meister, er wird wissen, was zu tun ist.
Als Jeremias Schildknecht an Meisters Tür klingelt, muss er nicht lange warten. Der Hauswart öffnet so schnell, dass sich Schildknecht fragt, ob er direkt hinter der Tür gestanden hat, in der Hoffnung, dass endlich mal Besuch kommt. Schildknecht entschuldigt sich für die späte Störung, doch der Hauswart zeigt ihm mit einer abwehrenden Geste, dass er gleich zur Sache kommen kann. Also schildert er ihm, was er beobachtet hat; dass bei Bräutigam seit Tagen Licht brennt, dass sein Briefkasten überquillt und dass er die Tür nicht öffnet. Walter Meister hört Jeremias Schildknecht aufmerksam zu.
»Dann schauen wir doch mal, was los ist.«
Meister klingt wie ein Bär, der das Sprechen erlernt hat; seine Worte sind ein tiefes, dunkles Brummen. Er ist ein Mann der Tat, und Schildknecht ist dankbar, dass er die Verantwortung abgeben kann. Als die beiden Männer wenig später vor Jürgen Bräutigams Tür stehen, scheint Meisters Tatendrang plötzlich doch etwas gebremst zu sein.
»Ich hoffe, ich handle mir keinen Ärger ein«, brummelt er, als er nach dem Generalschlüssel sucht. »Plötzlich verklagt der mich wegen Hausfriedensbruch. Alles schon passiert. Bloß, weil man sich um seine Mieter kümmert.«
»Aber vielleicht liegt er mit gebrochenem Becken im Badezimmer und kann nicht mehr aufstehen …« Schildknecht bemüht sich um einen mutmachenden Tonfall.
»Schon gut, schon gut, ich schließe gleich auf.«
Noch einmal drückt Meister auf den Klingelknopf. Als sich nichts rührt, klopft er an die Tür und ruft laut: »Herr Bräutigam, sind Sie da drin? Wir kommen jetzt rein.«
Schildknecht denkt, das könnte auch eine Dialogzeile aus einem Vorabendkrimi sein. Walter Meister wirft ihm einen Blick zu, greift zum Schlüssel, steckt ihn ins Schloss, versucht aufzuschließen und stellt fest, dass gar nicht abgeschlossen ist. Er drückt die Klinke hinunter.
In der gleichen Sekunde, in der er die Tür aufstößt, springt Bruno auf, als wäre er keine elf Jahre, sondern erst elf Monate alt, und trabt zielstrebig in die Wohnung hinein, während er die Leine hinter sich herschleift.
»Bruno, warte!«, ruft Schildknecht. Doch sein Hund stellt sich wieder mal taub. Schnurstracks begibt er sich zum Schlafzimmer. Auf der Schwelle bleibt er stocksteif stehen, stellt die Nackenhaare auf und verfällt in ein hysterisches Kläffen.
»Bruno!« Jeremias Schildknecht will zu ihm eilen, doch Walter Meister streckt den Arm aus und hält ihn zurück.
»Warten Sie! Riechen Sie das? Lassen Sie mich vorangehen.«
Vorsichtig tastet sich Walter Meister durch den Flur in Richtung Schlafzimmer. Vor der Tür stoppt er, er reckt den Kopf vor und erstarrt mitten in der Bewegung.
»Gütiger Gott!«
Jeremias Schildknecht ahnt, dass er nicht sehen will, was sein Hauswart gerade erblickt hat. Aber er kann nicht anders; als würde er von unsichtbaren Fäden nach vorne gezogen, begibt er sich zur Tür, schaut hinein, sieht das Bett und was darauf liegt – und wünschte sich, er hätte nie an dieser Tür geklingelt.
4.
Sandro Bandini sitzt in der mobilen Einsatzzentrale im Innern eines Polizeilastwagens, einen Steinwurf von der Berner Reitschule entfernt. Kleine Schweißperlen glänzen auf seiner Stirn, sein Körper ist angespannt, die Augen sind konzentriert auf die Bildschirme vor ihm gerichtet; einer zeigt einen Übersichtsplan des Areals, auf dem er sich befindet, andere übertragen Livebilder der winzigen Bodycams, die die Männer des Sondereinsatzkommandos auf sich tragen. Neben Sandro sitzt deren Chef Christian Tschabold, der seine Leute über Funk mit knappen Befehlen durch die Reitschule dirigiert. Die Liegenschaft besteht aus vielen verschachtelten Räumen, es ist schwierig, sich in der unübersichtlichen Situation ein klares Bild zu verschaffen; nebst der großen Reithalle gibt es ein Restaurant, ein Kino, einen Konzertsaal, mehrere Dachstöcke, die Discothek sowie etliche Nebenräume. Tschabold hat alles in Zonen eingeteilt, und nun wird eine Zone nach der anderen von den bewaffneten Polizisten in Schutzmontur gesichert. Nach den vorliegenden Informationen wurde im hinteren Gebäudeteil geschossen, aber der Täter kann überall sein. Die Mitglieder des Spezialkommandos dringen immer weiter ins Gebäude vor, gerade kommt ein neuer Funkspruch rein, dass der nächste Raum ebenfalls sauber ist. Was gleichsam bedeutet: Vom Täter fehlt nach wie vor jede Spur.
Es ist möglich, dass er sich unter die Flüchtenden gemischt hat; das wäre die Schlechteste aller schlechten Varianten, denkt Sandro. Oder aber er hat sich irgendwo verkrochen und sich selbst gerichtet – das wäre eines der besseren Szenarien; dann wäre zumindest die Gefahr gebannt. Wenigstens haben die Rettungssanitäter nun Zugang zum Tatort. Der Täter scheint ausschließlich im zweiten Dachstock um sich geschossen zu haben, dort wo heute die Frauendisco stattgefunden hat. Die Sanitäter korrigieren die Zahl der Opfer laufend nach oben, im Moment liegt sie bei sieben Toten und zehn Verletzten, einige in kritischem Zustand. Ob sich der Täter noch auf dem Areal befindet oder längst auf der Flucht ist, ist völlig offen.
»Wir geben eine Großfahndung raus«, informiert Sandro seine Kollegen. »Wir brauchen alle Einsatzkräfte, die verfügbar sind. Wir werden die ganze Stadt, wenn es sein muss, den gesamten Kanton durchkämmen, wir werden in jeden verfluchten Keller steigen, um den Täter oder die Täter aufzuspüren, die das hier angerichtet haben.« Der oder die – nicht einmal das ist klar; Sandro hat keine Ahnung, mit wie vielen Schützen sie es hier zu tun haben. Die Aussagen der Zeuginnen und Zeugen ergeben kein einheitliches Bild. Die einen wollen nicht einmal gemerkt haben, dass geschossen worden ist, und hielten das Ganze für eine Massenpanik. Andere berichteten von einem Mann, der mit einem Maschinengewehr in die Frauendisco eingedrungen sei und sofort losgeballert habe. Einige behaupteten, die Schüsse seien aus verschiedenen Richtungen gekommen, es müssten mindestens drei Personen geschossen haben. Dass Zeugenaussagen so weit auseinanderdriften, ist nichts Ungewöhnliches, es ist vielmehr menschlich – aber hilfreich ist es nicht.
»Verdammte Scheiße!«, sagt Sandro laut. Um ihn herum ertönt zustimmendes Gemurmel. Sie wissen nichts, außer, dass da eine oder mehrere Personen frei herumlaufen, die gerade ein blutiges Massaker angerichtet haben.
»Hat jemand der Zeugen den Schützen erkannt?«, fragt Sandro in die Runde.
»Negativ«, antwortet Malou Löwenberg. Sie sitzt in einem engen roten Kleid im Einsatzwagen; offensichtlich hat auch sie heute Abend nicht mit einem Notfall gerechnet.
»Hat ihn jemand gesehen, der ihn beschreiben kann? Seine Erscheinung? War es ein Neonazi?«
»Nein. Niemand hat etwas in der Richtung gesagt.«
Dass Sandro auf Anhieb einen Täter aus der rechtsextremen Szene in Betracht zieht, hat mit der Geschichte der Reitschule zu tun: Für Neonazis und Ultrarechte ist sie ein rotes Tuch, eine Trutzburg ihrer größten Feinde. Selbst bürgerliche Politiker bezeichnen den linksautonomen Kulturtempel seit Jahrzehnten als Schandfleck der Stadt: Alle paar Jahre fordern sie in politischen Vorstößen dessen Schließung – nicht zuletzt, weil sich die Antifaschisten nach ihren nicht selten in Zerstörungsorgien ausartenden Demonstrationszügen durch die Stadt oftmals in die Reithalle zurückziehen, sich unter die Gäste mischen und dort Schutz vor der Polizei finden. Dass auf dem Vorplatz der Reitschule mit Drogen gehandelt wird, ist ebenfalls kein Geheimnis und dem Ruf des Kulturzentrums nicht gerade förderlich.
Falls sie es hier also mit einem politisch motivierten Angriff zu tun haben, wäre es für Sandro keine Überraschung, wenn der Täter aus der rechtsextremen Szene stammen würde. Oder aber es war ein islamistischer Terroranschlag, der sich generell gegen die westliche Lebensweise richtet. Denkbar auch, dass es sich um einen Anschlag auf die Schwulen- und Lesbenszene handelt; allerdings sind bei LGBT-feindlichen Taten meist Männer die Opfer. Sandro schließt auch eine weitere Option nicht aus: Dass der Massenmord von einem fanatischen Einzeltäter ohne politischen Hintergrund begangen worden sein könnte – einzig, weil er Amokläufe geil findet und selbst mal einen lancieren wollte. Es wäre nicht das erste Mal, dass aus derart nichtigem Grund gemordet wurde.
Aber das Motiv des Täters hat derzeit nicht höchste Priorität. Die wichtigste Frage, die sich Sandro stellt, lautet viel mehr: Wo steckt der Täter? Oder wo stecken die Täter, falls es mehrere sind.
»Die Täterschaft ist weg«, stellt Christian Tschabold in dem Moment fest.
»Bist du sicher? Ihr habt nichts übersehen? Das Areal ist riesig …«, hakt Sandro nach.
»Meine Leute haben den hintersten Winkel durchsucht. Es ist keiner mehr drin.«
»Scheiße.«
Sandro denkt sofort an den Terroranschlag von Paris, als Islamisten unter anderem im Konzertlokal Bataclan fast neunzig Menschen töteten. Einer der Attentäter hatte seinen Sprengstoffgürtel nicht gezündet und befand sich tagelang auf der Flucht. In seiner Heimatstadt Brüssel wurde die höchste Terroralarmstufe ausgerufen, alle Läden im Zentrum wurden geschlossen, alle Restaurants und Kulturlokale dichtgemacht.
Ist es das, was er jetzt tun muss?, fragt sich Sandro. Die höchste Terroralarmstufe auslösen und die Stadt Bern in eine Art sofortigen Lockdown versetzen? Ist das die adäquate Reaktion auf den Anschlag – oder wäre es eine krasse Überreaktion?
»Was machen wir?«, fragt Tschabold.
Sandro räuspert sich, blickt auf die Uhr.
»Terroralarm?« Tschabold klingt drängender jetzt.
Sandro hebt abwehrend die Hand. Er muss nachdenken. Es ist Donnerstagabend, fast halb zehn. Heute ist Abendverkauf, die Läden schließen erst in einer halben Stunde. Obwohl schon fast Sommer ist, wird es abends immer noch kühl. Trotzdem sitzen etliche Menschen draußen in den Gassen an den Tischen. Sandro sieht die Bilder aus Paris vor sich; die zerschossenen Scheiben, die Gläser, die halb voll stehen geblieben waren, die Blutlachen unter den Tischen. Die vielen Toten.
»Wir … haben … keine … Zeit!« Tschabold spricht überlaut und setzt eine kleine Pause zwischen jedes Wort.
Sandro schaudert innerlich. Wenn der Täter weitermordet und noch mehr Menschen zu Tode kommen, nur weil er nicht gehandelt hat – er würde sich das nie verzeihen. »Wir können kein Risiko eingehen.« Sandro hört Christian Tschabold erleichtert ausatmen. »Gleichzeitig müssen wir jede Panik verhindern.«
»Das heißt konkret?«, hakt Tschabold nach.
»Höchste Terroralarmstufe. Die Läden, Bars, Restaurants, Kinos, Theater et cetera in der Stadt müssen sofort schließen. Die Bereitschaftspolizei muss raus, wir lancieren Aufrufe in Radio und Fernsehen und auf unseren Social-Media-Kanälen.« Sandro nimmt wahr, wie der Medienverantwortliche Emilio Livingstone aufspringt, zum Telefon greift und hinauseilt. »Wir informieren die Behörden, die Berufsverbände, jeden, den wir erreichen können; sie sollen dafür sorgen, dass alle Gaststätten und Kulturbetriebe geschlossen und die Gäste heimgeschickt werden. Die Streifenwagen sollen Patrouille fahren und die Leute mit Lautsprecherdurchsagen auffordern, nach Hause zu gehen.«
»Und da kommt keine Panik auf?« Malou Löwenberg klingt skeptisch.
»Wenn wir ruhig und sachlich bleiben, werden auch die Menschen ruhig bleiben.« Hoffentlich, schiebt Sandro in Gedanken nach.
»Und das Fußballspiel?«, wirft Christian Tschabold ein.
»Heute läuft ein Match?«
»Heimspiel gegen den FC Basel.«
»Verfluchter Mist!« Die Young Boys hatte Sandro völlig vergessen. »Wie lange dauert das Spiel noch?«
»Wohl noch etwa eine Viertelstunde.«
Sandro Bandini und Christian Tschabold schauen sich in die Augen und denken exakt dasselbe: Ein ausverkauftes Fußballstadion ist das perfekte Ziel für einen Terroranschlag – insbesondere nach dem Schlusspfiff, wenn alle nach draußen strömen und versuchen, sich in das erstbeste Tram zu quetschen.
»Das Match lassen wir laufen, das Risiko einer Massenpanik nach einem Spielabbruch ist zu groß. Aber wir instruieren sofort die Kollegen, die vor Ort im Einsatz sind, sie sollen insbesondere die Ausgänge und die Tramstation überwachen. Wir müssen Verstärkung hinschicken.«
»Wir haben nicht genug Leute, wenn wir gleichzeitig die Stadt sichern wollen«, wendet Tschabold ein.
»Wir bitten die Polizeikorps der Nachbarkantone um Hilfe.«
Tschabolds rechte Augenbraue schnellt in die Höhe, doch er nickt.
»Wie steht es um die Helikopter für die Suche nach dem Täter?«, fragt Sandro.
»Sind unterwegs.«
»Gut.«
Sandros Telefon klingelt. Er blickt auf das Display, sieht, dass es ein Anruf aus der Notrufzentrale ist, und geht ran. Einen kurzen Augenblick lang hofft er, dass ihm gleich mitgeteilt wird, der Täter habe sich gestellt. Doch das wahre Leben kennt in seinen Dramen selten solch glückliche Fügungen.
»Wir haben eine Leiche«, sagt der Kollege aus der Zentrale ohne Umschweife. »In der Militärstrasse, sieht nach einem Tötungsdelikt aus.«
Sandro schließt die Augen. Er fragt sich, warum in seinem Job immer alles gleichzeitig passieren muss.
5.
Bettina starrt auf den Boden und studiert die Fuge zu ihren Füßen. Die hellgraue Füllung zwischen den dunkelgrauen Platten ist an der einen Stelle breiter als an der anderen. Dort, wo sie zu schmal ist, hat sich Schmutz angesammelt. Brauner Schmutz im Zwischenraum. Zwischen dunkelgrauen Platten.
Warum ist sie die Drinks holen gegangen? Die Frage dreht Runden in ihrem Kopf. Hätte Petra die Drinks geholt, wäre sie nicht getroffen worden.
Brauner Schmutz im Zwischenraum. Auch die anderen Fugen sind nicht regelmäßig verarbeitet.
Warum nur ist sie die Drinks holen gegangen?
Die Linien verschwimmen vor Bettinas Augen. Weit weg hört sie das Geräusch von Schritten. Gummisohlen. Turnschuhe auf Plattenboden. Dunkelgraue Platten mit Schmutz in den Fugen.
Wäre sie die Drinks nicht ausgerechnet in dem Moment holen gegangen, wäre sie bei Petra gewesen und hätte reagieren können.
Die Schritte nähern sich, an der Ecke des Flurs biegen sie ab und werden wieder leiser.
Wenn sie sich nicht kurz mit Sonja unterhalten hätte, wäre sie rechtzeitig zurück gewesen. Wäre sie früher zurück gewesen, hätte sie sich auf Petra gestürzt, hätte sie mit sich zu Boden reißen und sich über sie legen können. Hätte sie schützen können. Sie retten können.
Wie kommt es, dass die Fugen schmutzig sind? In einem Spital, in dem es klinisch rein sein sollte.
Warum ist sie genau in dem Moment zur Bar gegangen? Warum hat sie so lange gebraucht? Warum?
Die Tür zur Notfallstation öffnet sich mit einem schleifenden Geräusch. Bettina schnellt herum, sieht einen Mann in grünem Kittel, eine knallbunte Operationsmütze auf dem Kopf, Brille auf der Nase. Sie sucht hinter den dicken Gläsern nach Augenkontakt und steht hastig auf.
»Petra, Petra Schmitz, wird sie es schaffen?«
Den Blick des Arztes kann Bettina nicht lesen. Mitleid?
»Es tut mir leid, ich kann Ihnen keine Auskunft geben. Ich behandle eine andere Patientin. Der zuständige Arzt wird sich bei Ihnen melden.«
Er wendet sich ab und lässt Bettina mit ihrer Verzweiflung allein zurück. Noch nie hat sie sich so hilflos gefühlt. Sie kann nichts Weiteres tun, als auf diesem Stuhl zu sitzen, den Boden anzustarren und damit zu hadern, dass sie nicht da war, als ihre Freundin, ihre Partnerin, ihre Liebe im falschen Moment am falschen Ort stand.
Petra darf nicht sterben.
Bettina hat vor Kurzem schon einmal einen Partner verloren, im Job. Ramon. Auch er starb im Kugelhagel. Auch damals war sie unmittelbar dabei gewesen.
Doch dieses Mal ist alles anders. Dieses Mal geht es um Petra. Bettina würde alles dafür geben, wenn sie mit ihr tauschen könnte, wenn jetzt sie da drinnen im Operationssaal liegen und ums Leben kämpfen würde, statt hier zu sitzen, unverletzt, ohne die kleinste Schramme. Wie ungerecht das Leben ist. Der Tod holt sich immer die Falschen.
Ein schriller Ton lässt Bettina zusammenfahren. Wie in Trance greift sie nach ihrem Telefon. Es ist Sandro, ihr Chef. Sie steckt das Handy weg. Auch ihr Pager vibriert. Sie beachtet ihn nicht. Schon klar, dass sie jetzt gebraucht wird. Doch sie geht hier nicht weg, nicht bis sie weiß, ob Petra leben wird. Bettina fühlt sich auf einmal schrecklich einsam. Wenn es ums Existenzielle geht, ist man am Ende immer allein.
Während Bettina im graugekachelten Flur des Universitätsspitals sitzt und zum ersten Mal in ihrem Erwachsenendasein ein Gebet spricht, in dem sie um das Leben ihrer Geliebten bittet, flucht Milla leise vor sich hin. Warum muss sie hier alles allein machen? Wo bleibt das Kamerateam? Ist sie tatsächlich die einzige Journalistin des Schweizer Fernsehens, die ausgerückt und vor Ort ist? Sie hat mit der Handykamera einige gute Bilder einfangen können, hat mit ein paar Frauen gesprochen, die dem Anschlag völlig geschockt entkommen sind, dennoch ist fraglich, ob sich ihr Material zu einem stimmigen Beitrag zusammenschneiden lässt. Auch zu zweit, mit einem Kameramann an ihrer Seite, wäre die Arbeit hier schwierig. Allein ist sie kaum zu bewältigen. Milla will gerade die gedrehten Clips auf ihrem Handy durchgehen, da beginnt Patti Smith zu singen. Ein Anruf. Wolfgang.
»Milla, bist du dort? Es soll Tote gegeben haben!«, ruft ihr Chef aufgeregt ins Telefon.
»Ich weiß. Ich bin vor Ort. Aber ich bin allein hier, ich kann nur mit dem Handy filmen. Ich schicke dir gleich alle Aufnahmen, die ich habe. Ich brauche aber noch ein offizielles Statement der Polizei, das werde ich nachliefern.«
»Wann?«
Milla verdreht die Augen. »Sobald ich es habe.«
»Wir müssen sofort damit raus.«
»Ich schicke es ja gleich.«
Milla beendet das Gespräch ohne ein weiteres Wort. Manchmal kann ihr Chef ein gefühlskalter Mistkerl sein. Klebt im geheizten Büro mit seinem Arsch an seinem Stuhl fest und schert sich keinen Deut darum, mit was für einer Situation sie draußen konfrontiert ist und was sie gerade durchmacht. Hauptsache, die Bilder kommen rein, und zwar pronto, alles andere scheint ihm egal zu sein. Milla schiebt den Ärger weg, sie hat jetzt weder Zeit noch Energie dafür, und begibt sich zum improvisierten Medienzentrum, das aus dem Pressesprecher Emilio Livingstone besteht. Er versucht unter einem aufgestellten Zeltdach, die Journalisten mit Informationen zu versorgen, obwohl es kaum welche gibt. Als sich Milla zu ihm stellt, hält ihm bereits eine Reporterin des Lokalradios das Mikrofon unter die Nase, und einige Zeitungsjournalisten notieren das Gesagte mit. Milla hört zu, realisiert, dass er in etwa so viel weiß wie sie selbst; dass geschossen worden ist, dass es Tote gegeben hat, dass völlig unklar ist, wer dafür verantwortlich ist. Während er spricht, erkennt er Milla, nickt ihr zu, was bedeutet, dass er sich gleich für sie Zeit nehmen wird. Das ist der Vorteil, wenn man fürs Schweizer Fernsehen arbeitet; man wird sofort als wichtig erachtet – aber nur, weil sich jeder selbst wichtig nimmt, wenn sein Gesicht im landesweiten Fernsehen erscheint.
»Mehr kann ich im Moment noch nicht sagen«, schließt Livingstone. »Bitte entschuldigen Sie mich, das Schweizer Fernsehen wartet auf eine Aufnahme.« Damit wendet er sich von den anderen Journalisten ab.
»Frau Nova, Sie brauchen ein Statement?« Es ist eine rhetorische Frage, Milla hält ihre Handykamera bereits auf den Pressesprecher gerichtet. »Ohne Kameramann?«
»Es ist noch keiner da.« Milla zuckt mit den Schultern. »Und das hier muss schnell raus, online und dann in die Tagesschau Nacht. Es wird eine Sondersendung geben. Sind Sie bereit?«
Livingstone nickt.
»Herr Livingstone, was ist hier heute passiert?«
Milla fragt, Livingstone gibt einige vage Antworten, doch viel holt sie nicht aus ihm heraus, um nicht zu sagen: gar nichts Neues. Dennoch hat sie, was sie braucht: Ein offizielles Statement, ganz egal, wie mager es ausgefallen ist.
Milla setzt sich auf eine Mauer, um ihrem Chef Wolfgang alle Clips zu senden, da tippt ihr jemand auf die Schulter. Sie dreht sich um.
Ivan Ivanovic. Ihr Lieblings-Kameramann, den alle Ivan nennen, obwohl er gar nicht Ivan heißt.
»Jetzt kommst du …« Milla rollt mit den Augen, doch die Erleichterung ist ihr anzusehen.
»Ging nicht schneller, ich war in Zürich, fangen wir an?«
Obwohl Milla genug gesehen hat, genug gehört hat, nur noch wegmöchte von diesem Ort des Schreckens, lässt sie sich von Ivan ein Mikrofon in die Hand drücken, während er die Kamera schultert. Diese Geschichte wird groß werden. Milla weiß, dass sie noch viel mehr Material brauchen, als sie bis jetzt zusammen hat; für die Sondersendung und all die Hintergrundbeiträge, die noch folgen werden. Sie klickt auf dem Handy rasch die letzten Clips an und drückt auf Senden. Dann gibt sie sich einen Ruck und macht sich auf, um gemeinsam mit Ivan möglichst viele Bilder und Stimmen einzuholen zu dem Unfassbaren, das sich diesen Abend zugetragen hat und die Stadt für immer verändern wird.
Zur gleichen Zeit sitzt Sandro Bandini nur wenige Meter von Milla und Ivan entfernt im Polizeilastwagen und versucht, den Großeinsatz zu koordinieren – und gleichzeitig jemanden auf den anderen Fall anzusetzen; die Leiche an der Militärstraße im Breitenrainquartier.
»Verflucht!«
Ein Klicken kündigt Sandro an, dass er erneut nur mit der Mailbox von Bettina verbunden ist statt mit ihr selbst. Ausgerechnet jetzt kriegt er sie nicht an die Strippe, Bettina, die sonst immer als Erste am Einsatzort ist. Sandro kann sich nicht erinnern, dass Bettina auch nur ein einziges Mal nicht erreichbar gewesen ist, in all den Jahren, in denen sie zusammenarbeiten. Wo steckt sie bloß? Sie ist doch nicht etwa …?
Der Gedanke trifft Sandro wie ein Blitz: Ist es denkbar, dass Bettina da drin war? Dass sie sich unter den Opfern befindet? Bettina, die aus ihrer Beziehung zu einer Frau nie ein Geheimnis gemacht hat. Hielt sie sich während des Attentats in der Frauendisco auf? Nein, unmöglich. Sandro schüttelt den Gedanken ab. Bettina in der Reitschule, als Polizistin, das passt nicht zusammen. Da ginge sie nicht hin.
»Malou?«
»Ja?«
»Ich kann Bettina nicht erreichen – könntest du …«
»Der Tote im Breitenrain?«
»Ja.«
»Ich fahre hin.«
»Danke.«
Hinter Sandro öffnet jemand die Wagentür. Die Geräusche, die vorher nur dumpf bis zu ihm vorgedrungen sind, die Sirenen, die Befehle, die gerufen werden, das Klagen und das Weinen, sind auf einen Schlag wieder laut und verstörend. Die kleine Distanz, die sich Sandro schaffen konnte, um einen Schritt zurückzutreten und aus der Einsatzzentrale heraus alles zu koordinieren, ist weg. Sofort ist er wieder mittendrin.
»Wir können rein«, ruft Christian Tschabold.
»In Ordnung.«
Sandro steht vom Stuhl auf. Er muss sich überwinden. Sein ganzer Körper fühlt sich auf einmal erschöpft an. Selbst mit normalen Tatorten tut Sandro sich schwer, auch nach all den Jahren noch. Aber das hier? Das ist eine andere Liga. Das hier will er nicht sehen. Doch er hat keine Wahl.
Unbewusst geht er zwei Schritte hinter Christian Tschabold her, als sie dicht der Mauer entlang zum hinteren Teil des Gebäudes vordringen. Über die Treppe gelangen sie in die Räumlichkeiten der Discothek. Sandro tritt in den hohen Raum unter dem Dachgiebel und weicht unwillkürlich wieder einen Schritt zurück. Der Anblick ist furchtbar.
Die mit weißen Planen zugedeckten Toten liegen durcheinander, elf oder zwölf müssen es sein, alle befinden sich nahe der Notausgangstür, die in den Hof hinausführt und durch die der Täter eingetreten sein muss. Auf bizarre Weise erinnern die Körper unter den Planen, die mal schräg, mal quer zur Tür und auch mal fast aufeinanderliegen, an eine groteske Kunstinstallation. Nichts wirkt echt in diesem Raum. Es ist die makabre Inszenierung eines Täters, von dem sie nicht wissen, wer er ist.
»Wie viele sind es?«, fragt Sandro.
»Dreizehn Tote, zwölf Frauen, ein Mann«, antwortet Christian Tschabold. »Zwei Schwerverletzte in kritischem Zustand. Achtzehn weitere Verletzte.«
Hinten im Raum erblickt Sandro Irena Jundt, die Rechtsmedizinerin, die sich in Schutzkleidung über einen der toten Körper beugt. Sie richtet sich wieder auf, diskutiert mit zwei Männern, die Sandro nicht kennt, das müssen die forensischen Ärzte vom DVI-Team sein. Es ist das erste Mal in seiner Karriere, dass Sandro das Disaster Victim Identification Team hat aufbieten müssen, und er hofft inständig, dass es auch das letzte Mal gewesen ist. Irena schaut zu ihm her, er winkt sie zu sich.
»Wir lassen die große Leichenhalle herrichten«, sagt Irena anstelle einer Begrüßung. »In einer Stunde sollten wir so weit sein, dann können wir die Opfer dorthin bringen.«
Erst jetzt fällt Sandro wieder ein, dass die Parkgarage unter dem Rechtsmedizinischen Institut im Notfall zu einer Obduktionshalle umfunktioniert werden kann, falls die zwei Obduktionstische im Haus nicht ausreichen. Irena will sich gerade wieder der Arbeit zuwenden, als Sandro sie zurückhält.
»Irena, wir haben noch einen weiteren Fall …«
»Das darf nicht wahr sein!«
»Ein Toter, sieht nicht gut aus, so wie der gefunden wurde …«
»Ich kümmere mich darum.«
»Kannst du denn hier weg?«
»Ja, das DVI-Team ist gut aufgestellt. Die Aufgaben sind verteilt. Im Moment steht die Identifikation der Opfer im Vordergrund – die Todesursache ist hier ja offensichtlich. Ich kann an den neuen Tatort fahren, mir den Toten ansehen und danach hierher zurückkehren.«
»Danke.«
Sandro leitet Irena die Nachricht mit der Adresse des Opfers und den Angaben zu dessen Fundsituation weiter. Er schrickt zusammen, als just in dem Moment unter einem weißen Tuch ein Handy zu läuten beginnt. Neben einer anderen Leiche setzt ein weiterer Klingelton ein. Als das erste Handy verstummt, beginnen ein drittes und ein viertes zu klingeln. Schon ist auch der erste Klingelton wieder zu hören. Es sind die Anrufe von Angehörigen, die vom Attentat erfahren haben, die fürchten, dass ihre Freundin, ihre Schwester, ihre Tochter sich in der Reitschule aufhielt, die hoffen, dass nicht ihre Lieben getroffen worden sind. Eine Hoffnung, die mit jedem unbeantworteten Anruf kleiner wird und irgendwann, spätestens wenn ein Polizist vor der Tür steht, der traurigen Gewissheit weicht. Weitere Telefone beginnen zu klingeln, jedes Mal zuckt Sandro zusammen.
Vielleicht wird er den Anblick der vielen Toten irgendwann aus seinem Kopf verdrängen können. Doch Sandro ahnt, dass der Klang der Handys und ihre Kakofonie des Todes für immer in seiner Erinnerung haften bleiben werden.
6.
Malou Löwenberg, die eigentlich Marie-Louise heißt, was aber kaum jemand weiß, schimpft innerlich mit sich selbst, weil sie keine Hose in ihre Handtasche gestopft hat. Das wird ihr eine Lehre sein. Sie ist noch nicht sehr lange im Team der Abteilung Leib und Leben mit dabei, und nie zuvor ist sie als erste und einzige Mordermittlerin an einem Tatort gewesen. Natürlich muss das erste Mal ausgerechnet heute sein – an jenem Abend, an dem sie sich für ein vielversprechendes Blind-Date in ihr kleines Rotes gequetscht hat, das genau zu ihrer Haarfarbe passt. Den Mann kann sie abschreiben, so viel ist klar; keine zehn Minuten nach dem Kennenlernen schrillte ihr Pager los. Als sie einen letzten Blick zurückwarf, sah sie ihn allein am Tisch sitzen, mit offenem Mund, wie ein Fisch, der dümmlich darauf wartet, dass ihm ein Wurm ins Maul schwimmt. Statt wie geplant ihre Flirtfähigkeiten an den Mann zu bringen, müht sie sich jetzt damit ab, mit ihrem eng anliegenden Kleid in den Schutzanzug zu steigen. Kurz entschlossen krempelt sie den Rock bis über die Hüfte hoch, damit sie in den Hosenanzug passt. Zum Glück ist keiner da, der ihr dabei zuschaut.
»Ich würde da nicht reingehen, wenn ich Sie wäre.«
Malou schnellt erschrocken herum, als sie hinter sich eine dünne Stimme vernimmt. Sie muss zweimal hinsehen, bis sie im Dunkeln neben einem Baum einen alten Mann ausmacht. Er sitzt auf einer Gartenmauer, neben ihm liegt ein kleiner Hund. Der Mann streichelt ihm unablässig über den Kopf.
»Sie wissen, was passiert ist?«, fragt sie den Alten.
»Mein Name ist Schildknecht. Ich wohne hier. Bräutigam ist mein Nachbar. Ich meine, er war mein Nachbar.« Schildknecht fährt sich mit der freien Hand über die Augen, fasst sich aber gleich wieder. »Und das ist Bruno.«
Es dauert einen Moment, bis Malou in den unzusammenhängenden Sätzen einen Sinn erkennt.
»Ihr Nachbar ist das Opfer?«
»Bräutigam.«
»Sie haben ihn gefunden?«
»Nicht ich, Bruno. Ich glaube, er ist traumatisiert.«
Malou betrachtet den Hund, der fröhlich mit dem Schwanz wedelt. Dann blickt sie dem Alten in die müden Augen. Sein Gesicht ist aschfahl, als sei er gerade dem eigenen Tod begegnet. Sie wird ihn befragen müssen, später. Malou schaut sich um; neben dem Kastenwagen der Spurensicherung, aus dem sie sich den Schutzanzug und die Gummihandschuhe geholt hat, steht einzig ein Streifenwagen vor dem Mehrfamilienhaus. Malou greift zum Handy, hält inne, steckt es wieder weg.
»Bitte warten Sie hier, Herr Schildknecht, ich möchte Ihnen später gerne ein paar Fragen stellen.«
»Sie sind Polizistin?« Jeremias Schildknechts Blick wandert von Malous knallroten Haaren zu ihrem Mund, in dem er zuvor ein Zungenpiercing hat aufblitzen sehen. Kaum merklich schüttelt er den Kopf.
»Ich bin von der Mordkommission.« Malous Tonfall ist schärfer jetzt. »Bitte warten Sie hier und halten Sie sich zur Verfügung.«
»Sind Sie wirklich sicher, dass Sie da reinwollen?«
Ohne ein weiteres Wort wendet sich Malou ab und begibt sich ins Treppenhaus. Bereits beim Betreten der Wohnung muss sie sich wegen des Geruchs die Hand vor die Nase halten. Sie stellt sich bei den beiden Kollegen der Streife kurz vor und nickt Florian von der Spurensicherung zu.
»Im Schlafzimmer, du kannst reingehen«, sagt er anstelle einer Begrüßung.
Als Malou ins Schlafzimmer von Jürgen Bräutigam tritt, wünschte sie sich, Sandro hätte sie nie hierhergeschickt. Fuck, denkt sie, wie krank ist das denn?