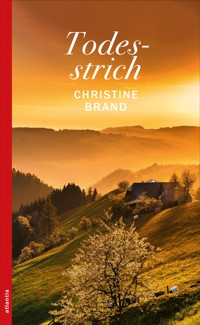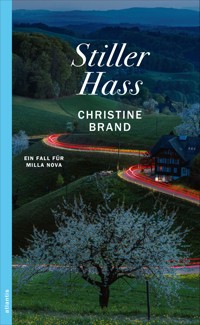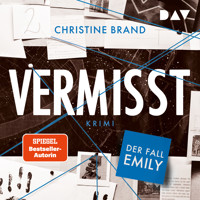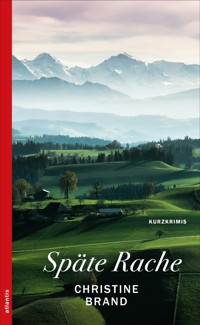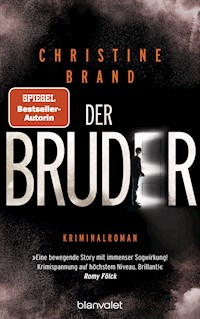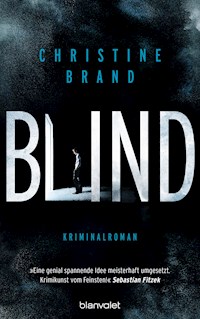9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Gerichtsreporterin und Bestsellerautorin Christine Brand erzählt wahre Verbrechen, begangen von Menschen die unser aller Nachbarn sein könnten.
Ein unauffälliges Ehepaar wird zum tödlichen Duo – mit einem absurden Motiv. Ein Mann gesteht den Mord an seiner Frau und wird doch freigesprochen. Ein kleines Dorf wird von einer unvorstellbaren Tat erschüttert. Christine Brand, Autorin des Bestsellers »Blind« und weiterer Kriminalromane um ein Schweizer Ermittlerduo, war als Gerichtsreporterin bei den Prozessen zu diesen und anderen Fällen hautnah dabei und hat Einblicke in die Geschichten von Tätern, Opfern und Publikum wie kaum jemand sonst. Sie erzählt von den Verbrechen, spannender und oft unglaublicher als jeder Krimi, und davon, wie es ist, im Gerichtssaal zu sitzen und in die tiefsten Abgründe der Menschen zu blicken.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 372
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Buch
Ein unauffälliges Ehepaar wird zum tödlichen Duo – mit einem absurden Motiv. Ein Mann gesteht den Mord an seiner Frau und wird doch freigesprochen. Ein kleines Dorf wird von einer unvorstellbaren Tat erschüttert. Christine Brand, Autorin des Bestsellers »Blind« und weiterer Kriminalromane um ein Schweizer Ermittlerduo, war als Gerichtsreporterin bei den Prozessen zu diesen und weiteren Fällen hautnah dabei und hat Einblicke in in die Geschichten von Tätern, Opfern und Publikum wie kaum jemand sonst. Sie erzählt von den Verbrechen, spannender und oft unglaublicher als jeder Krimi, und davon, wie es ist, im Gerichtssaal zu sitzen, wenn die tiefsten Abgründe der Menschen verhandelt werden.
Die Autorin
Christine Brand, geboren und aufgewachsen im Schweizer Emmental, arbeitete als Redakteurin bei der »Neuen Zürcher Zeitung«, als Reporterin beim Schweizer Fernsehen und als Gerichtsreporterin. Im Gerichtssaal und durch Recherchen und Reportagen über die Polizeiarbeit erhielt sie Einblick in die Welt der Justiz und der Kriminologie. Sie hat bereits Romane und Kurzgeschichten bei Schweizer Verlagen veröffentlicht. Nach »Blind« und »Die Patientin« ist mit »Der Bruder« der dritte Fall für das Ermittlerduo Milla Nova und Sandro Bandini erschienen. »Wahre Verbrechen« ist ihr erster True-Crime-Titel bei Blanvalet über Kriminalfälle, die sie als Gerichtsreporterin begleitete. Christine Brand lebt in Zürich, reist aber die meiste Zeit des Jahres um die Welt.
Besuchen Sie uns auch aufwww.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag.
CHRISTINE BRAND
WAHRE VERBRECHEN
Die dramatischsten Fälle
Vorwort
Ich war zwanzig Jahre alt, als ich zum ersten Mal in einem Gerichtssaal saß und einen Mordprozess mitverfolgte. Der Fall war aufsehenerregend, die Berichterstattung seitenfüllend, die öffentliche Meinung gespalten: Die einen glaubten an die Schuld des Angeklagten, die anderen waren von seiner Unschuld überzeugt. Der Mann hatte seine Frau als vermisst gemeldet – Tage später hat der Schwiegervater seine Tochter in deren Haus in der Tiefkühltruhe gefunden. Sie war erschlagen worden.
Der Fall hat mich, so glaube ich heute, »kriminalisiert«. Ich schwänzte die Schule, um die Verhandlung im Gerichtssaal mitzuerleben, und war fasziniert von dem Geschehen vor Gericht – ich bin es auch heute noch, selbst wenn ich die Totschläger und Mörder, denen ich in den Gerichtssälen begegnet bin, kaum mehr zählen kann.
Im Gerichtssaal prallen Welten aufeinander. Hier kreuzen sich die Lebenswege unterschiedlichster Menschen. Im Publikum sitzen Angehörige von Opfern neben Angehörigen von Tätern. Vorne nehmen die Angeklagten Platz, schräg hinter ihnen sitzen ihre Opfer, falls sie überlebt haben, oder die Hinterbliebenen mit ihren Anwälten. Täter, Opfer, Angehörige – Menschen in Ausnahmesituationen. Schwere Delikte, tragische Schicksale haben sie in diesem Moment an diesem Ort zusammengeführt, um das Geschehene zu rekapitulieren und das Unfassbare zumindest juristisch fassbar zu machen. Verteidiger und Staatsanwälte werfen sich Paragrafen um die Ohren, sie schildern das Delikt mal aus der einen, mal aus der anderen Perspektive, wobei sich die Geschichten selten gleichen. Es ist die Aufgabe des Richters, nach der Wahrheit zu suchen – obwohl es in den meisten Fällen die eine absolute Wahrheit gar nicht gibt.
Fast dreißig Jahre lang saß ich als Journalistin in Gerichtssälen, um über Recht und Unrecht, über Schuld und Unschuld zu berichten. Dabei ging es mir immer um mehr als die juristische Beurteilung eines Deliktes – es ging mir um die Geschichten hinter den Menschen, die sie hier und jetzt in diesem Saal vor dem Richter zusammengeführt haben.
Sechs Fälle habe ich für dieses Buch neu und umfassend aufgearbeitet und niedergeschrieben. Alle Erzählungen basieren auf Aussagen von Tätern, Opfern, Zeugen, Anwälten, Staatsanwälten und Richtern, sowie auf Gesprächen mit mittelbar und unmittelbar Betroffenen. Sechs Fälle, die alle etwas gemeinsam haben: Die Täter sind keine Fremden, keine Psychopathen, die wahllos morden, keine radikalisierten Terroristen, die um sich schießen. Das Böse ist viel näher, als man denkt, manchmal wohnt es gleich nebenan; der Täter ist der nette Mann aus der Nachbarschaft, der jeden Tag am Haus der Opfer vorbeispaziert, oder das Pärchen mit den kleinen Kindern, das immer freundlich grüßt; es ist der Pfleger, der einem das Leben retten und nicht nehmen soll, der Musiklehrer, von dem die Schüler begeistert sind, oder der Freund, mit dem man einst studiert hat und mit dem man nur ein bisschen feiern wollte.
Es sind dramatische, tragische, schockierende Geschichten – Geschichten über Taten und Untaten, über Hass und Liebe, über Triebe und Habgier, über Sterben und Tod. Geschichten mitten aus dem Leben.
Verbrechen unserer Zeit halten uns einen Spiegel vor und offenbaren schonungslos die Schattenseiten unserer Gesellschaft. Es stellt sich die Frage: Was machen die Menschen aus dem, was die Gesellschaft aus ihnen macht?
Sitze ich als Journalistin im Gerichtssaal, übernimmt mein Schreibblock oder mein Laptop die Aufgabe eines professionellen Schutzwalls, der verhindert, dass mir das Verbrechen zu nahe geht. Ich nehme als neutrale Beobachterin an dem Verfahren teil, um darüber zu berichten, das ist mein Job, ich bin hochkonzentriert und ganz Journalistin.
Jetzt aber, da ich mich ein zweites Mal und noch intensiver mit den sechs vorliegenden Fällen beschäftigt habe, da ich mich durch all meine Notizen, Artikel und Unterlagen gearbeitet habe, hat dieser Schutzmechanismus nicht mehr funktioniert. Die Geschichten und die Schicksale berühren mich und machen mich betroffen.
Ich wünschte, ich könnte schreiben, es sei tröstlich, dass in weiten Teilen unserer westlichen Welt das Justizsystem funktioniert und Täter zur Rechenschaft gezogen werden. Zwar sind Gerichtsverfahren tatsächlich auch kollektive Verarbeitungsprozesse. Sie sind ein Versuch, das Unverständliche zu verstehen, eine Art Schlussstrich zu ziehen und die gesellschaftliche Ordnung wiederherzustellen, die aus dem Lot geraten ist. Doch Wiedergutmachung bringen sie nicht. Es ist ein Irrtum zu glauben, dass es im Strafprozess um Rache oder Vergeltung geht, die der Staat für den Einzelnen ausübt. Ein Strafverfahren wird nicht geführt, um dem Opfer Genugtuung zu verschaffen, sondern weil der Täter Gesetze gebrochen hat.
Ein Gericht kann zwar Recht sprechen, Gerechtigkeit herstellen kann es nicht. Straftaten sind nur selten wiedergutzumachen, Tötungsdelikte allerdings niemals. Kein Urteil bringt Menschenleben zurück.
Christine Brand
Das Böse wohnt gleich nebenan
Dies ist eine Geschichte, von der ich wünschte, dass ich sie nie hätte schreiben müssen. Sie dreht sich um eine Tat, die in ihrer Abscheulichkeit kaum zu überbieten ist. Um eine Familie, die auf einen Schlag ausgelöscht wurde und mit der ich mich verbunden fühlte, obwohl ich sie nie gekannt habe. Um monatelange Ermittlungen, die viele Beteiligte an ihre Grenzen brachten. Und um einen Täter, mit dem niemand gerechnet hatte. Es ist die Geschichte über jenes Verbrechen, das mich als Gerichtsreporterin am längsten beschäftigte und das mir persönlich am meisten naheging. Das mich noch immer berührt. Vielleicht, weil das Böse nicht nur mitten in eine heile Welt eingedrungen ist – sondern auch aus ebendieser kam.
Die heile Welt heißt Rupperswil, ein Dorf im Schweizer Mittelland, 5500 Einwohner. Das einstige Bauerndorf hat sich im letzten Jahrzehnt zum Vorort gewandelt, hierher ziehen Familien, die sich den Traum vom Häuschen mit Garten erfüllen wollen, die Autobahn in die Stadt liegt gleich nebenan. Drei Begriffe gingen mir durch den Kopf, als ich das erste Mal in Rupperswil aus dem Zug stieg: Durchschnitt, Mittelstand, Beschaulichkeit. Und dann war da noch ein weiterer Gedanke: In einem Dorf wie Rupperswil wohnen jene, die in Ruhe und Frieden leben wollen.
Vor dem Dorfladen halten die Einwohner einen Schwatz, mitten im Ort liegen Bauernhöfe, Pferde weiden neben der Straße, in einigen Gärten picken Hühner Körner. Die Menschen grüßen sich freundlich, wenn sie sich auf dem Gehsteig begegnen, auch mich, obwohl ich eine Fremde bin. Es gibt hier einen Kaninchen- und Geflügelzüchterverein, einen Landfrauenverein, einen Fußball- und einen Petanqueclub. Und die Freiwillige Feuerwehr.
*
Der Feueralarm geht um 11.20 Uhr ein. Nichts Alltägliches, aber auch nichts Außergewöhnliches in Rupperswil. Der Feuerwehrkommandant denkt im ersten Moment an eine Bratpfanne, die in Flammen aufgegangen ist, oder an eine vergessene Kerze. Es ist der Morgen des 21. Dezembers 2015, kurz vor Weihnachten. »Nr. 54 – 11:20 Brand/Mittel, in Rupperswil, Lenzhardstraße«, wird später im Protokoll der Freiwilligen Feuerwehr stehen. Die Nachbarin der Familie S. hat das Feuer gemeldet, im ersten Stock des Doppelhauses würde Rauch aus dem Fenster dringen.
Zur gleichen Zeit, als sie Alarm schlägt, fahren die Eltern von Carla S. auf den Vorplatz des Hauses und stellen ihren Wagen ab. Sie bringen alles für das Weihnachtsessen vorbei, am nächsten Tag wollen sie gemeinsam mit der Tochter und den Enkeln feiern. Carlas Vater stürzt sofort ins Haus, als er den Qualm aus dem Fenster dringen sieht, die Nachbarin folgt ihm. Wie meistens ist die Tür nicht abgeschlossen, weil in einem beschaulichen Dorf wie diesem kaum einer die Haustür abschließt. Carlas Vater ruft laut nach seiner Tochter, brüllt ihren Namen, ruft nach Dion und nach Davin, seinen Enkeln, er will die Treppe hoch in den ersten Stock, wo das Feuer lodert, doch er kommt nicht durch, da ist zu viel Rauch.
Das Warten auf die Feuerwehr ist unerträglich. Qualvolle Minuten scheinen sich zu Stunden zu dehnen. Noch klammern sich die Eltern und die Nachbarin an die Hoffnung, dass niemand zu Hause ist.
Doch es ist jemand im Haus. Und es ist alles noch viel schlimmer, als man es sich in diesem Moment vorstellen kann.
Die Feuerwehr ist nach wenigen Minuten mit einem vierzigköpfigen Trupp vor Ort. Acht Männer der Atemschutzgruppe dringen als Erste ins Haus ein, um das Feuer zu löschen. Durch den dichten Qualm steigen sie die Treppe hoch in den ersten Stock.
Was sie dort finden, schockiert sie zutiefst. Die Feuerwehrmänner werden mit Bildern konfrontiert, die sie nie mehr aus ihren Köpfen kriegen werden.
Im Elternschlafzimmer im ersten Stock liegt Carla S. auf dem Doppelbett. Ihren jüngsten Sohn Davin finden sie in seinem Zimmer, ebenfalls auf dem Bett, er ist zwischen Kuscheltiere gebettet. Im Dachgeschoss, wo der Qualm am schlimmsten ist und die Flammen am stärksten wüten, stoßen die Männer des Atemschutztrupps auf den ältesten Sohn Dion und dessen Freundin Simona, auch sie liegen reglos auf dem Bett. Carla, Davin, Dion und Simona sind tot. Carla wurde achtundvierzig Jahre alt, Davin war erst dreizehn, Dions Leben endete mit neunzehn, Simonas mit einundzwanzig Jahren.
Nicht das Feuer hat sie umgebracht, auch nicht der Rauch. Sie sind mit Kabelbinder und Klebeband gefesselt und geknebelt, ihre Kehlen durchgeschnitten.
*
Am gleichen Tag, fünf Stunden früher, als die Welt in Rupperswil noch eine andere ist. Draußen hat sich die Nacht noch nicht vertreiben lassen, das Quartier mit dem lieblichen Namen Spitzbirrli liegt im Dunkeln. Es ist ein kalter Montagmorgen, hier und da gehen die ersten Lichter an. Das Haus der Familie S. ist weihnachtlich geschmückt. In der Küche brennt schon Licht, als ein Spaziergänger mit seinen beiden Hunden daran vorbei Richtung Felder und Wald geht. Georg M. ist bereits aufgestanden, er ist Filialleiter einer lokalen Bank und muss zur Arbeit. Doch bevor er aufbricht, bereitet er Kaffee zu, steigt die Treppe hoch und bringt Carla S. eine Tasse ans Bett.
Georg kennt Carla seit der Schulzeit, seit sechs Jahren sind sie ein Paar. Seine Söhne sind im gleichen Alter wie Carlas Söhne Davin und Dion, sie sind längst Freunde geworden. Am Abend zuvor hat die Patchwork-Familie gemeinsam gegessen – Raclette, geschmolzener Käse mit Kartoffeln –, es war ein gemütlicher, fröhlicher Abend voller unbeschwerter Ahnungslosigkeit.
Es ist gleich sieben Uhr früh, als Georg Carla den heißen Kaffee reicht. Carlas Söhne schlafen noch. Davin, der jüngste, im Kinderzimmer nebenan.
Davin, der jede Kinderrolle in einem Film erhalten würde, mit seinem blonden Haarschopf, den aufgeweckten blauen Augen, mit seiner offenen, quirligen Art. Doch der Dreizehnjährige hat einen anderen Traum: Davin will Fußballprofi werden und hat das Talent dazu; er spielt für die U14-Mannschaft des FC Aarau, einem mehrfachen Schweizer Meister. Er trainiert sechs bis sieben Mal pro Woche, und seit dem Sommer besucht er die Sportschule im nächstgrößeren Ort.
Auch sein Bruder Dion schläft noch, eine Etage über ihm, im ausgebauten Dachstock. Dion hat ausnahmsweise frei, weil er tags zuvor im Sonntagsverkauf gearbeitet hat. Er ist Verkäufer bei derselben Modekette, bei der seine Mutter als Filialleiterin angestellt ist. Sein blondes Haar trägt er auf der Seite kurz, oben etwas länger, trendig hochgekämmt.
Dion ist nicht allein, am Abend ist Simona vorbeigekommen, sie schläft bei ihm, wie so oft, sie fühlt sich wohl in seiner Familie, sie passt so gut dazu. Simona arbeitet bei der Bergsportkette Mammut, trägt am liebsten Sneaker und engagiert sich als Leiterin des christlichen Jugendvereins Jungschar. Für die Waldweihnacht haben die Jugendlichen ein Krippenspiel einstudiert. Vor drei Tagen haben sie es aufgeführt, Simona mimte die Maria. Doch ihre Leidenschaft ist das Tanzen. Sie ist angemeldet für eine Tanzausbildung in New York, Dion will sie dort besuchen. Simona und Dion sind ein schönes Paar, seit einem Jahr schon. Sie haben sich gefunden.
Als Carla ihren Kaffee trinkt und zum Handy greift, zeigt ihr Facebook an, dass sie an diesem Tag seit exakt fünf Jahren mit ihrem Sohn Dion auf der Social-Media-Plattform befreundet ist. Es ist 7.01 Uhr. Carla teilt die Erinnerung an den Jahrestag, kommentiert sie mit »My Family« und einem Smiley-Herz-Kuss.
Vierundzwanzig Minuten nach ihrem letzten Facebook-Eintrag verlässt Carlas Freund Georg das Haus. Als er Carla küsst, weiß er nicht, dass es ein Abschied für immer ist. Er tritt aus der Tür, der Eingang ist mit Windlichtern und Laternen geschmückt, steigt in seinen Wagen und fährt weg. Noch im Quartier kommt ihm ein Spaziergänger entgegen, dem er keine Beachtung schenkt.
Wenig später schrillt bei der Familie S. die Klingel. Carla öffnet dem Bösen mit dem freundlichen Gesicht die Tür.
*
Ich befinde mich auf der anderen Seite der Welt im Schreiburlaub, als die Tat geschieht und die ersten Meldungen über das Feuer in Rupperswil in den Medien erscheinen.
»Grausiger Fund nach einem Brand in einem Doppeleinfamilienhaus am Montag in Rupperswil im Aargau: Nachdem die Feuerwehr die Flammen gelöscht hatte, stieß ein Atemschutztrupp im Inneren des Gebäudes auf vier Tote«, schreibt die Neue Zürcher Zeitung. »Die Identität der Opfer war am Abend laut der Kantonspolizei Aargau noch nicht bekannt. Brandursache und Verlauf waren gleichfalls noch nicht geklärt«, heißt es weiter. Und am Schluss der kurzen Meldung: »Die Polizei schließt ein Verbrechen nicht aus. Laut verschiedenen News-Plattformen soll in dem betroffenen Hausteil eine von ihrem Mann getrenntlebende Frau mit ihren zwei Söhnen gewohnt haben.«
Schnell wird im Dorf wie auch in den Medien über ein Familiendrama spekuliert.
»War es ein erweiterter Suizid? Drehte der Lebenspartner durch? Die Frau? Einer der Söhne? Oder doch der Exmann?«, fragt die Boulevard-Zeitung Blick am gleichen Tag.
Noch schenke ich den Meldungen keine große Aufmerksamkeit. Auch ich denke aufgrund der ersten Informationen zunächst an ein Beziehungsdelikt. Das erscheint mir naheliegend; bei den allermeisten Tötungsdelikten hat das Opfer den Täter gekannt. In der Schweiz ereignen sich zwei Drittel aller Tötungsdelikte im Rahmen von häuslicher Gewalt. Alle vier Wochen wird hierzulande eine Frau von ihrem Partner oder Expartner getötet. Manchmal zählen auch Kinder zu den Opfern.
Doch schon am nächsten Tag zeichnet sich ab, dass im Fall Rupperswil die Umstände anders liegen dürften. Das Ausmaß des Schreckens sickert tröpfchenweise in das Bewusstsein der Öffentlichkeit und wird von Stunde zu Stunde unfassbarer. Obwohl die Leichen teilweise verbrannt sind, hat die Rechtsmedizin die Todesursache feststellen können. Als die Polizei bekannt gibt, dass die vier Opfer mit einem Messer umgebracht worden sind, dass ihnen die Kehle durchgeschnitten wurde, beginne ich an der These des Beziehungsdelikts zu zweifeln; das spricht nicht für eine Verzweiflungstat aus dem Affekt, das ist ein sadistisches, intimes, unmittelbares Töten. Man kommt dem Opfer dabei sehr nahe, was für eine besondere Skrupellosigkeit spricht. So tötet niemand, der keine Erfahrung darin hat, denke ich. So mordet jemand, der die totale Kontrolle über Leben und Tod spüren will.
Spätestens als die ermittelnde Staatsanwaltschaft am Abend des 22. Dezembers vor die Medien tritt, bin ich überzeugt, dass es hierbei um ein überaus außerordentliches Verbrechen geht. Die Staatsanwaltschaft veröffentlicht zwei Bilder, die sich in das kollektive Gedächtnis des Landes einprägen.
Die erste Fotografie wurde von der Kamera eines Geldautomaten aufgenommen. Sie zeigt Carla S. in einem schwarzen Wollkragenpullover, die langen, blonden Haare streng zu einem Pferdeschwanz zurückgebunden, ihr Gesichtsausdruck lässt sie gestresst und gehetzt wirken. Die Aufnahme stammt vom 21. Dezember, dem Tag der Tat, um 9.50 Uhr. Carla versucht am Geldautomaten an der Poststrasse in Rupperswil Schweizer Franken abzuheben, aber es sind nur Euro erhältlich, also entscheidet sie sich für 1 000 Euro.
Die zweite Aufnahme stammt von einer Überwachungskamera, gleicher Tag, 10.10 Uhr. Sie zeigt Carla S., wie sie an einem Schalter der Aargauischen Kantonalbank Wildegg die seltsam ungerade Summe von 9850 Franken abhebt. Auch hier wirkt Carla angespannt, den Blick hat sie nach unten gerichtet. Es ist das letzte Bild von Carla. Obwohl sie die Person am Schalter kannte, schlug sie nicht Alarm.
Die Aufnahmen nähren einen schrecklichen Verdacht: Carla wurde gezwungen, das Geld zu holen. Sie tut, was man ihr aufgetragen hat, weil sie hofft, dass das Geld ihre Kinder retten wird, die im Haus als Geiseln festgehalten werden. Doch das tut es nicht.
*
Als es am 21. Dezember kurz nach halb acht bei der Familie S. klingelt, öffnet Carla einem fremden Mann die Tür. Er ist großgewachsen, um die dreißig, dichtes schwarzes Haar, gepflegtes Auftreten, wahrscheinlich kommt er ihr bekannt vor, sie hat ihn bestimmt schon mal gesehen, aber kennen tut sie ihn nicht.
Der Mann reicht Carla seine Visitenkarte, auf der ein Name steht, der nicht der seine ist, und ein Beruf, den er nicht ausübt: »Dr. Sebastian Meier, Schulpsychologe«. Er sagt Carla, er arbeite an der Schule, die ihr jüngster Sohn Davin besucht, und er müsse ihr schreckliche Nachrichten überbringen. Der falsche Herr Meier händigt Carla ein Schreiben der Kreisschule Buchs-Rohr aus, das – obwohl mit dem original Briefkopf versehen – eine Fälschung ist. Darin steht, dass sich ein Mädchen an der Schule nach Mobbing-Vorfällen das Leben genommen hat. Ein tragischer Vorfall, der nun aufgeklärt werden soll. Der Mann sagt, das Mädchen sei mit Davin in dieselbe Klasse gegangen. Es bestehe der Verdacht, dass Davin am Mobbing beteiligt gewesen sein könnte, er müsse darum mit ihm sprechen.
Carla ist fassungslos. Sie bittet den Mann herein und bietet ihm Kaffee an. Der falsche Schulpsychologe setzt sich mit ihr in die Küche. In seinem Rucksack befinden sich sechs Flaschen Fackelöl, Kabelbinder, ein Messer, ein elektrischer Anzünder, Klebeband, Handschuhe, ein Mundschutz und Sexspielzeug.
Er ist ein extremer Perfektionist. Alles ist genau durchdacht. So viel Raffinesse, so viel Hinterhältigkeit und Verschlagenheit.
Er will zuerst mit ihr, dann mit Davin, und anschließend mit beiden zusammen reden. Zwanzig Minuten lang unterhält er sich mit Carla über den erfundenen Vorfall an Davins Schule. So zumindest beschreibt später die Anklageschrift die letzten Stunden vor dem Tod der ganzen Familie, sie stützt sich auf die Aussagen des einzigen Überlebenden – des Täters.
Nach dem Gespräch mit Carla fragt er nach dem Jungen, er will sich mit ihm unterhalten, allein. Carla steigt in den ersten Stock hoch, weckt Davin und bringt ihn in die Küche. Sie selbst begibt sich wieder nach oben, um sich zurechtzumachen.
Während der Fremde mit Davin spricht, greift er zum Rucksack, der am Boden steht, nimmt das Messer heraus, ohne dass der Junge etwas merkt, und hält es ihm blitzschnell an die Kehle. Er befiehlt ihm, keinen Mucks zu machen, und fesselt seine Hände mit einem Kabelbindern auf den Rücken. Bereits zu Hause hat er dafür zwei Kabelbinder mit einem dritten zu Handschellen zusammengebunden.
Er fragt Davin, wo die Mutter und der Bruder sind. Dann treibt er den Jungen vor sich her hinauf in den ersten Stock – mit der rechten Hand hält er das Messer auf Davins Brust.
*
Wenige Stunden nach dem schrecklichen Verbrechen setzt sich die Ermittlungsmaschinerie in Gang. Das Team der Spurensicherung findet in dem ausgebrannten Haus eine heiße Spur, die vom Feuer hätte vernichtet werden sollen: Die Kriminalisten können Fremd-DNA und fremde Fingerabdrücke sichern. Doch die Freude über den Erfolg währt nur kurz: Weder die Fingerabdrücke noch das DNA-Profil sind in einer Datenbank verzeichnet. Die Person, die sie hinterlassen hat, ist bis zu diesem Zeitpunkt nicht registriert und wurde demnach noch nicht erkennungsdienstlich behandelt.
Die vierzigköpfige Sonderkommission arbeitet rund um die Uhr, fast das ganze Korps wird zur Unterstützung beigezogen. Polizisten verteilen Flugblätter, die Carla am Bankschalter zeigen. Sie hoffen, dass jemand etwas weiß, das sie auf die richtige Spur bringt. Die Ermittler befragen in den kommenden Tagen und Wochen mehr als dreihundertfünfzig Personen, darunter auch die Angehörigen, die unter Polizeischutz gestellt werden, weil man nicht weiß, ob der Täter nicht doch jemand anderen im Visier hatte, vielleicht Georg M., der eine Bankfiliale leitet. Die Ermittler sichten Dutzende Aufnahmen von Überwachungskameras, hundert Polizisten durchsuchen an Heiligabend den gesamten Müll von Rupperswil, Profiler aus dem In- und Ausland werden hinzugezogen. Die Exfrau von Carlas Lebenspartner wie auch Carlas Exmann werden festgenommen und wieder laufen gelassen. Über drei Dutzend Frauen und Männer melden sich bei der Polizei und behaupten, über übersinnliche Kräfte zu verfügen. Doch letztlich gibt es keine Spur, keinen Treffer. Nichts. Niemand weiß, was genau passiert ist im Haus der Familie S. Niemand ahnt, warum Carla, Davin, Dion und Simona sterben mussten. Und wie sehr sie vorher gelitten haben.
Fast drei Wochen sind seit der Tat vergangen. Es regnet, es ist kalt, das neue Jahr ist gerade erst ein paar Tage alt, als Rupperswil Abschied nimmt. Die Feuerwehrleute, die den schrecklichen Fund in dem brennenden Haus gemacht haben und die aus ermittlungstaktischen Gründen noch immer nicht über das Erlebte und Gesehene sprechen dürfen, weisen die vielen Autos ein. Die Straße vor der reformierten Kirche Rupperswil ist nicht groß genug für all die Wagen. Siebenhundert Menschen wollen an der Trauerfeier für Carla und ihre Söhne Davin und Dion teilnehmen, noch einmal fast ebenso viele werden es am nächsten Tag sein, wenn Simona im Nachbarort Hunzenschwil beerdigt wird.
In Rupperswil ist die Kirche schon eine halbe Stunde vor Beginn voll besetzt. Die Feier wird ins Kirchgemeindehaus nebenan übertragen. Viele Trauergäste finden keinen Sitzplatz, stehen links und rechts an den Wänden, einige gar draußen in der Kälte. Im Chor der Kirche sitzen die Kameraden von Davin, dem Dreizehnjährigen, der Fußballer werden wollte. Sie tragen rote Shirts mit seinem Namen.
»Und jetzt sind wir hier, weil wir traurig sind, weil wir erschüttert sind, weil wir nicht wissen, wohin mit unserem Schmerz«, sagt der Dorfpfarrer Christian Bühler, der eine seiner schwierigsten Predigten hält, der um Worte ringt, die Trost spenden sollen, obwohl er weiß, dass es Trost kaum geben kann. Glauben und Vertrauen sind erschüttert. Die Tat kann nicht verstanden werden und lässt einen fassungslos zurück.
Und zutiefst traurig. In der Kirche weinen viele, halten sich gegenseitig fest.
Davins Lehrerin sagt: »Nach den Ferien ist in unserem Klassenzimmer ein Platz leer geblieben. Und doch ist es manchmal so, als würden wir Davins Lachen hören.«
Die Schüler legen herzförmige Steine nieder. Auch die Politik ist vertreten. Ein Regierungsrat ist da, alle Gemeinderäte des Dorfes.
Gemeindeammann Ruedi Hediger sagt: »Schreckliches ist passiert. Unglaubliches ist passiert. Wir alle sind erschüttert über die Gräueltat.«
Als Carlas Lieblingslied gespielt wird – Hello der britischen Sängerin Adele –, fließen die Tränen. Carla hatte Tickets für sich und ihre Söhne und ihren Freund gekauft, sie wollten Adele im Mai live im Hallenstadion in Zürich sehen.
Pfarrer Bühler sagt: »Am Ende des Gebets kommt von Gott keine Antwort, sondern eine Umarmung.«
Zuvorderst in der Kirche bleibt während der Trauerfeier ein Stuhl leer, symbolisch für die engsten Angehörigen der Opfer. Sie haben sich die öffentliche Feier nicht zumuten wollen und im engsten Familienkreis Abschied genommen. Dafür ist die Polizei vor Ort, nicht nur, um Sicherheit zu gewährleisten. Sie beobachtet die Menschen. Sie sucht noch immer nach dem Täter, der den Opfern das Leben genommen hat.
*
Es ist kurz nach neun Uhr früh am 21. Dezember. Der Mann, der nicht Sebastian Meier heißt und der nicht der Psychologe an Davins Schule ist, hält den Jungen mit dem Messer in Schach und befiehlt Carla, auch ihren älteren Sohn und dessen Freundin im Dachstock zu wecken. Sie muss ihnen die Hände mit den Kabelbindern auf den Rücken fesseln und die Beine mit Klebeband zusammenkleben. Am Schluss befiehlt ihr der Mann, Dion und Simona auch den Mund zuzukleben. Er lässt die beiden gefesselt und geknebelt auf dem Bett liegen.
Es gehe ihm, sagt der Fremde zu Carla, einzig um Geld. Wenn sie kooperiere, werde er sie alle gehen lassen. Er zwingt sie, die Mobiltelefone einzusammeln und ihm ihre Bankunterlagen zu zeigen. Um 9.22 Uhr loggt sich Carla über den Onlinebanking-Zugang bei ihrer Bank ein, damit der Mann ihren Kontostand prüfen kann. Er verlangt 9500 Franken. Doch das ist ihm nicht genug.
Erneut steigt er mit Carla in den Dachstock hoch, sie löst die Klebebänder, damit Simona und Dion ihr die Pincodes von ihren Bankkarten geben können. Carla notiert sich die Zahlencodes und klaubt Dions und Simonas Karten aus den Brieftaschen, dann verklebt sie ihnen wieder den Mund. Der Fremde fordert Carla auf, sie müsse zur Bank fahren und das Geld beschaffen, sie solle sich bereit machen.
In dem Moment klingelt es unten an der Tür.
Carla weiß, wer es ist, ihre Freundin kommt vorbei, um Chilli abzuholen, Carlas weiße Malteser-Hündin, auf die sie heute aufpassen wird. Unten öffnet sich die Tür, die Freundin kommt wie üblich unaufgefordert herein.
Der Fremde presst das Messer an Davins Hals und warnt Carla eindringlich, sie dürfe nichts verraten. Sie steigt die Treppe hinab, übergibt ihrer Freundin den Hund und – schweigt.
Kein Wort über die Gefahr, das Drama bleibt verborgen.
Carla tut alles, was der Mann ihr sagt. Sie will ihre Kinder auf keinen Fall gefährden. Darum lässt sie sich nichts anmerken, als sich die erste von zwei Gelegenheiten ergibt, bei denen sie Alarm schlagen könnte. Das Messer an der Kehle ihres jüngsten Sohnes macht es ihr unmöglich.
Der Freundin fällt zwar auf, dass Carla ungeschminkt ist, kurz angebunden. Aber sie merkt nicht, dass etwas nicht stimmt. Sie schließt die Tür hinter sich und geht mit dem kleinen Hund davon.
Und der Täter setzt sein makabres Spiel kaltblütig fort. Er sagt Carla, sie solle durchatmen, sich beruhigen. Um 9.34 Uhr macht er mit seinem Handy ein Bild von ihr, gibt vor, dieses an einen Komplizen zu schicken, der sie auf dem Weg zur Bank beobachten werde.
Tatsächlich gibt es keinen Komplizen.
Statt das Bild zu versenden, löscht der Täter es wieder, tut aber so, als schriebe er dem Komplizen eine Nachricht mit dem Namen der Bank. Nach fünf Minuten schickt er Carla los. Wenn sie mit dem Geld zurückkehre, werde sie zu Hause einen Zettel vorfinden, auf welchem der Übergabeort notiert sei. Dort werde er mit Davin auf sie warten.
Carla fährt los. Erst zum Geldautomaten, wo sie mit Simonas Karte 1 000 Euro abhebt. Mit der Karte von Dion erhält sie kein Geld, wahrscheinlich ist der Saldo zu klein. Dann steigt sie erneut in den Wagen, fährt zur Bank, sie schlägt nicht Alarm, sie lässt sich nichts anmerken, obwohl sie den Mann am Schalter kennt, sie tut genau, was ihr befohlen wurde. Zu groß die Angst um ihre Kinder – oder groß genug die Hoffnung, dass gleich alles vorbei sein wird.
Während Carla unter größter psychischer Anspannung das Geld beschafft, sitzt der Fremde mit ihrem jüngsten Sohn Davin auf dem Bett und unterhält sich mit ihm über Fußball. Er fragt auch den Dreizehnjährigen nach Geld. Davin steht auf, holt sein Sparschwein und gibt es dem Mann.
Nach knapp einer halben Stunde ist Carla zurück. Sie hofft, dass der Albtraum gleich zu Ende ist. Doch sie findet zu Hause nicht wie angekündigt einen Zettel vor. Der Mann ist noch da, er hat Davin in seiner Gewalt. Carla übergibt ihm die 1 000 Euro und die 9850 Franken.
Er bricht sein Versprechen.
Er geht nicht.
Stattdessen fesselt er Carla erneut.
*
Es ist Tag zweiundvierzig nach der Tat, als ich ein weiteres Mal nach Rupperswil fahre. Die Tage werden wieder länger. Der Frühling lässt sich bereits erahnen. Noch immer laufen die Ermittlungen der Polizei auf Hochtouren, noch immer haben sie nicht zum Täter geführt, noch immer weiß niemand, wer er ist.
Darum bin ich hier.
Meine Redaktion hat mich mit einer Reportage beauftragt, ein Portrait über jenes Dorf, in dessen Mitte vor sechs Wochen vier ungeklärte Morde begangen wurden.
Als ich in Rupperswil aus dem Zug steige, gehen mir die vielen Fragen durch den Kopf, die sich auch hier alle stellen. Wurden Carla, Davin, Dion und Simona zufällige Opfer einer Einbrecherbande? War die Tötung der Geiseln im Voraus geplant, oder geriet die Situation außer Kontrolle? Ist es Zufall, dass Carlas Freund eine Bank leitet, oder wurde die Familie deshalb zum Ziel? Ging es womöglich gar nicht um Geld, sondern allein um die Tötung der Opfer? Kannten sich Opfer und Täter? Und was macht ein solches Verbrechen mit einem Dorf wie Rupperswil?
Die Angehörigen der Opfer haben von der Polizei ein Redeverbot erhalten, sie dürfen mit niemandem über die Tat sprechen, aus ermittlungstaktischen Gründen, was es für sie nicht einfacher macht. Überhaupt halten sich Staatsanwaltschaft und Polizei in diesen Wochen nach der Tat mit Informationen zurück. Es ist daher ruhiger geworden im Dorf – Ruhe eingekehrt ist dennoch nicht.
»Viele Menschen hier sind verunsichert«, sagt mir der Dorfpfarrer Christian Bühler. »Wenn man gar nichts weiß und keine Idee davon hat, in welchem Zusammenhang diese Tat steht, ist das nicht einfach auszuhalten.«
Die Haustüren werden neuerdings abgeschlossen in Rupperswil, immer. Die Angst, dass das Böse zurückkehren könnte, sie ist unterschwellig spürbar. Ruedi Hediger, der Gemeindeammann, räumt indes ein, dass trotz allem die Normalität langsam wieder Einzug halte.
»Die Leute beginnen, auch wieder über andere Themen zu reden«, erzählt er mir bei meinem Besuch.
Im Spitzbirrli-Quartier ist die Tat sechs Wochen nach dem verhängnisvollen 21. Dezember noch immer präsent. Das Haus der Familie S. an der Lenzhardstrasse ist versiegelt und wird es noch eine Zeitlang bleiben, die Spurensicherung war mehrmals da. Die Nachbarn wollen ihre Liegenschaft verkaufen und wegziehen. Zu schlimm die Erinnerungen, zu traurig der Ort. Vor dem Haus, das zu einem makabren Grab geworden ist, erinnern Kerzen, Fotos und Engelsfiguren an die Opfer.
Ich stehe davor und frage mich erneut: Warum sie? Warum Carla, Davin, Dion und Simona? Warum dieses Haus? Es steht am äußeren Rand des Dorfes, dahinter liegen Wiesen, die in einen Wald übergehen. Die Straße ist eine Sackgasse, der Eingang zur Wohnung ist nicht einfach zugänglich; man muss um die angebaute Haushälfte herumgehen, die Tür der Nachbarn liegt gleich gegenüber. Wer hier eindringt, geht ein großes Risiko ein, gesehen zu werden. Niemand im Quartier versteht, warum es ausgerechnet hier geschah, warum keiner etwas gemerkt hat.
Die Staatsanwaltschaft lanciert erneut einen Zeugenaufruf, er wird in viele verschiedene Sprachen übersetzt, und jetzt wird eine Belohnung ausgeschrieben: Wer den entscheidenden Hinweis liefert, erhält 100 000 Franken. Es ist die höchste Summe, die in der Schweiz je zur Aufklärung eines Verbrechens ausgesetzt worden ist.
»Der Betrag entspricht unseres Erachtens der Bedeutung dieses Verbrechens«, sagt Oberstaatsanwalt Philipp Umbricht. Jeder Hinweis könne ein entscheidender Puzzle-Teil für die Lösung des Falles sein. »Wir sind sicher, dass irgendwo, irgendwann irgendjemand die Beobachtung gemacht hat, die uns entscheidend weiterbringen wird.«
Auch der Aargauer Regierungsrat Urs Hofmann verbreitet Optimismus: »Ich bin überzeugt, dass die gute Arbeit, die unsere Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft leisten, am Schluss zum Erfolg führen wird.«
Ein heikles Versprechen. Zumal die Ermittler nach über vierzig Tagen rein gar nichts haben, das sie dem Täter näherbringt.
»Wir schließen zurzeit keine Option aus, auch nicht, dass Personen aus dem Umfeld der Opfer an der Tat beteiligt waren, beispielsweise als Anstifter«, sagt Umbricht. »Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Personen in die eigentliche Tatbegehung involviert waren, ist allerdings gering.«
Trotzdem und vielleicht auch mangels anderer Spuren eröffnet die Staatsanwaltschaft gegen Carlas Lebenspartner Georg M. ein Strafverfahren wegen mehrfacher vorsätzlicher Tötung, und das, obwohl er für den Tatzeitpunkt ein Alibi hat. Georg M. wird erst Monate nach der Tat herausfinden, dass er im Fokus der Ermittler stand und was das für ihn und sein Umfeld bedeutete.
»Ich erfahre, dass man mich monatelang observiert hat«, schreibt Georg Metger später in seinem Buch »für immer – Die unfassbare Tat von Rupperswil« über seinen Verlust. »Schwarz auf weiß steht da, was ich nicht 1 Sekunde lang geahnt habe.«
Seine Handy-, Mail- und Internetdaten sowie sein Festnetzanschluss werden nach der Tat rund um die Uhr überwacht, SMS und Mails gelesen – auch rückwirkend, bis sechs Monate vor der Tat. Telefongespräche werden ausnahmslos abgehört und transkribiert. Die Polizei versieht sein Auto mit einem Peilsender und weiß immer, wo er ist. Dasselbe tun sie bei seinem ältesten Sohn, bei dem er seit dem Verbrechen wohnt. Mittels eines sogenannten IMSI-Catchers peilt die Polizei Georg M. an, um herauszufinden, ob er über mehr als ein Mobiltelefon verfügt. Der Leiter der Rechtsabteilung und ein IT-Mann seines Arbeitsgebers, der Bank, werden von der Polizei als Gehilfen eingesetzt, ohne dass sie ein Wort darüber sagen dürfen. Insbesondere Georgs Geldtransaktionen interessieren die Polizei. Der Verdacht: Er könnte den Mord an seiner Partnerin und ihren Kindern in Auftrag gegeben haben. Die Ermittler scheuen keinen Aufwand, die Überwachung ist lückenlos, das Ergebnis füllt am Schluss vier Bundesordner. Nähere und fernere Bekannte von Georg M. werden zu seiner Person befragt, sogar sein einstiger Segellehrer muss Auskunft geben. Die Begründung all der Überwachungsmaßnahmen: »Dringender Tatverdacht in Sachen Vierfachmord.«
Polizeiarbeit, die wohl getan werden muss. Auch wenn sich schließlich herausstellt, dass die Spur ins Nichts führt. In diesem Mordfall geht es nicht um häusliche Gewalt oder um ein Familiendrama. Wer hier getötet hat, hatte ein ganz anderes Motiv.
*
Es gibt Verbrechen, die sind so schlimm, dass die Details der Öffentlichkeit nicht zugemutet werden können. Weil sie die Grenzen des Vorstellbaren sprengen.
Was genau im Haus der Familie S. passiert, nachdem der Fremde das Geld entgegengenommen und Carla erneut gefesselt hat, steht über ein Jahr nach der Tat in der Anklageschrift. Sie ist inklusive Anhang achtundzwanzig Seiten lang und liest sich wie ein Protokoll des Schreckens.
Es ist meine Aufgabe, als Journalistin über die Tat zu berichten – zu erzählen, was passiert ist, aufzuzeigen, wie die Justiz mit einem Fall wie diesem umgeht, und schließlich auch, wie das Gericht versucht, das Strafmaß für eine unfassbare Tat zu finden und ein Stückchen Gerechtigkeit wiederherzustellen. Nur: Wie groß ist der Anspruch der Öffentlichkeit auf Information? Wie detailliert muss das Grauen wiedergegeben werden? Und inwieweit ist es meine Aufgabe, die Öffentlichkeit vor den schrecklichen Details zu bewahren, weil sie kaum zu ertragen sind? Wie viel Zurückhaltung ist Pflicht? Wie viel Wahrheit ist zumutbar? Für die Leser, aber vor allem auch für die Angehörigen der Opfer, deren privatestes Leid erneut an die Öffentlichkeit gezerrt wird?
»Aus Gründen des Schutzes der Beteiligten und der übrigen Angehörigen sowie auch unter dem Aspekt der Würde der verstorbenen Personen ersuchen wir Sie um ganz besondere Zurückhaltung in der Wiedergabe der Anklage sowie der näheren Tatumstände, wie sie sich auch in der Verhandlung ergeben werden«, schreibt das Gericht in der Begleitmail zur Anklageschrift. »Bei den Angehörigen handelt es sich um Trauernde, die sich in einer äußerst schwierigen Situation befinden und durch die Schilderung der Details zusätzlich aufs Schwerste belastet werden.«
Es ist ein Appell des Gerichts, gleichzeitig eine Bitte. Aber es bleibt im Ermessen von uns Journalisten, wie detailgetreu, wie vorsichtig, wie zurückhaltend oder wie sensationslüstern wir in unserer Berichterstattung sein werden. Wir müssen abwägen, wie weit es dabei um die Informationspflicht geht und ab wann es nur noch darum geht, die Sensationslust zu stillen.
Darum lasse ich auch hier die genauen Details aus. Dennoch erzähle ich in groben Zügen, was passiert, als Carla zurück im Haus ist. Denn mit seinem Handeln verrät der Täter sein wahres Motiv.
*
Davin ist ihm schon früher aufgefallen. Davin ist außerordentlich hübsch. Der Fremde fühlte sich von ihm angezogen, er verspürte stets einen »Kick« und erlebte ein »Glücksgefühl«, wenn er ihm im Dorf begegnet ist. In seiner Fantasie begann er, sich auszumalen, wie es wäre, wenn … Zuerst dachte er an eine Entführung. Dann kam ihm die Idee mit der Geiselnahme. Er war auch knapp bei Kasse, konnte Geld grad gut gebrauchen. Immer wieder ging er seinen Plan im Kopf durch – bis er beschloss, ihn umzusetzen.
Jetzt, wo alles so weit ist, wo alles so gut aufgegangen ist, genau nach Plan, jetzt, wo er das Geld eingesteckt hat – jetzt setzt er um, wovon er monatelang geträumt hat. Carla, Dion und Simona sind außer Gefecht gesetzt, sie liegen gefesselt und geknebelt auf ihren Betten. Der Fremde begibt sich mit Davin in dessen Zimmer. Er fesselt auch ihn, dann zieht er ihn aus, packt das mitgebrachte Sexspielzeug aus und macht zahlreiche Aufnahmen mit seinem Handy, Fotografien, Videos – von seiner Lust und von Davins Qual. Anschließend zieht er Davin das Fußballtrikot und die Stutzen an, bevor er sich erneut sexuell an dem dreizehnjährigen Buben vergeht. Fast eine halbe Stunde lang dauert der schreckliche Missbrauch. Der Fremde hält alles in Bildern und auf Videos fest, die er in den nächsten Wochen wieder und wieder anschauen will. Acht Videos und neunundvierzig Fotos.
In der Anklageschrift steht: »All die vorgenannten Handlungen ließ Davin angesichts der Bedrohung durch den Beschuldigten über sich ergehen, beziehungsweise er leistete den Anweisungen des Beschuldigten Folge, wobei offensichtlich war, dass er mit den Handlungen nicht einverstanden war und nur wegen der im Raum stehenden Gewaltanwendung durch den Beschuldigten mitmachte (der Beschuldigte war nicht nur deutlich älter, größer und kräftiger als Davin, sondern war überdies mit einem Messer bewaffnet und hatte sowohl Carla als auch Dion und Simona in seiner Gewalt, was Davin wusste).«
Als der Mann fertig ist, geht er nicht einfach weg. Er vollendet seinen Plan. Er fesselt Davin erneut, packt seinen Rucksack, bis auf das Messer, das braucht er noch. Er steigt hinauf in den Dachstock, wo ihm Dion entgegenkommt, der sich befreien konnte, aber in der Auseinandersetzung mit dem Bewaffneten unterliegt. Der Mann befiehlt Dion, sich erneut bäuchlings auf das Bett zu legen. Er tritt ebenfalls zum Bett, drückt sein rechtes Knie auf Dions Rücken – und schneidet ihm die Kehle durch.
Simona muss den Mord mitansehen, es ist das reine Entsetzen, bevor der Fremde auch sie auf dieselbe Weise tötet. Dion und Simona liegen nebeneinander auf dem Bett, als sie gemeinsam sterben. Das jugendliche Paar verblutet.
Der Fremde steigt wieder hinunter, begibt sich in Carlas Zimmer und bringt auch sie um. Am Schluss schneidet er dem Jüngsten, Davin, die Kehle durch.
Danach begibt sich der Fremde ins Badezimmer, reinigt das Messer mit Wasser und trocknet es mit einem hellgrünen Frottiertuch ab. Auch seine graue Strickjacke, die Plastikverpackung des Messers, seine Schuhe und der Rucksack haben Blutspritzer abbekommen. Die Flecken von Davins Blut auf seinem Rucksack wird er später mit schwarzem Filzstift übermalen.
Aus diesem Rucksack nimmt er nun das mitgebrachte Fackelöl. Er steigt erneut hoch in den Dachstock, gießt das Öl über das Sofa, reißt Kleider aus dem Schrank und legt sie über Dion und Simona, übergießt auch die. In Carlas Zimmer wiederholt er die Prozedur, er legt Kleider über ihren Körper, schüttet das Fackelöl über alles, was ihm brennbar erscheint. In Davins Zimmer übergießt er zudem den Schreibtisch und den Teppich, im Erdgeschoss schüttet er das Öl auf Sofa, Salontisch, Esstisch und Fußboden, auch die Küchenkombination und die Wände werden vollgespritzt. Dann packt er seinen Rucksack, geht ein letztes Mal hinauf in den Dachstock, steckt mit dem Stabfeuerzeug das Sofa und das Bett in Brand, auf dem die Leichen von Simona und Dion liegen; im ersten Stock zündet er die Möbel und die Kleider an, die er auf die Leichen seiner Opfer gelegt hat, im Erdgeschoss die Polstergruppe und die Lampe.
Das Haus soll brennen.
Der Mann will keine Spuren hinterlassen.
Doch das Fackelöl war nicht seine beste Wahl. Das Feuer breitet sich nicht so gut aus wie mit anderen Brandbeschleunigern. Sein akribisch ausgearbeiteter Plan geht ganz am Schluss doch nicht auf, denn es werden nicht alle seine Spuren vernichtet. Das ist das einzige Glück in diesem schrecklichen Drama. Hätte das Feuer ganze Arbeit geleistet, wären wohl noch mehr Menschen gestorben.
*
Es wird Februar, März, April. Die Ermittler sind dem Täter kein bisschen nähergekommen. Und doch tragen sie langsam Stück für Stück des Puzzlespiels zusammen, von dem sie hoffen, dass daraus ein Gesamtbild entstehen wird, das ihnen zeigt, was passiert ist an jenem 21. Dezember im Haus der Familie S. an der Lenzhardstrasse in Rupperswil.
Die Zeit arbeitet gegen die Polizei – je mehr Tage, Wochen, Monate verstreichen, desto kleiner die Wahrscheinlichkeit, dass der Täter doch noch gefasst werden kann. Doch die Ermittlungen brauchen Zeit, in diesem Fall erinnern sie an eine Sisyphusarbeit.
Die Staatsanwaltschaft hat beim Dienst Überwachung Post- und Fernmeldeverkehr des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements die Daten aller Handynutzer beantragt, die am 21. Dezember von den Antennen in der Nähe des Tatorts erfasst worden sind. Das sind etliche, denn die stark befahrene Bahnlinie Zürich-Bern und die Autobahn liegen im selben Bereich. Die verschiedenen Mobilfunk-Anbieter liefern die Daten von dreißigtausend Nutzern in unterschiedlichen Formaten. Diese auszuwerten ist zeitraubend und personalintensiv. Nummern von Personen, die sich nur kurz im Bereich des Tatorts aufhielten, müssen aussortiert werden: Zugpendler, Autofahrer, Passanten. Zudem ist unklar, ob sich der Aufwand lohnen wird: Womöglich hatte der Täter sein Mobiltelefon ausgeschaltet, dann wäre er nicht erfasst worden.
Seit dem Zeugenaufruf mit der Belohnung gingen bei der Polizei gegen sechshundertfünfzig Hinweise aus der Bevölkerung ein. Sie alle müssen geprüft werden. Ebenso die über fünf Terabyte Videodateien, die der Polizei zugestellt worden sind, Aufzeichnungen von Autofahrern, die am Tag der Tat in der Gegend unterwegs waren, Bilder von Tankstellenshops, Überwachungskameras, Verkehrskameras. Fünf Terabyte entsprechen einer Million heruntergeladener Songs.
Die seit Monaten andauernde Ermittlung, die noch immer keinen Erfolg gebracht hat, lässt vielen Theorien, Mutmaßungen und falschen Verdächtigungen Raum. Fast alle – auch die meisten Experten – sprechen von mehreren Tätern, weil es kaum möglich erscheint, dass einer alleine die vier Menschen in Schach gehalten hat. Kriminalisten wie auch forensische Psychiater sind sich sicher, dass hier jemand am Werk war, der sich mit dem Töten auskannte. Ein Wiederholungstäter. In einem Punkt sind sie sich einig: Sie alle sprechen von einer »extremen Ausnahmetat«.
Etliche vermuten hinter den Morden ausländische Profis, die sich über die Grenze abgesetzt haben und darum nicht gefasst werden können. Das ist auch die Theorie der Bewohner von Rupperswil: Fremde müssen das Böse ins Dorf gebracht haben. Jemand von hier würde so etwas nicht tun. Undenkbar.
Ich führe in der Zeit der Ratlosigkeit und der vagen Vermutungen ein Interview mit Frank Urbaniok, er ist der bekannteste forensische Psychiater der Schweiz. »Auffallend ist«, sagt er mir, »dass die Täter nicht mit Schusswaffen töteten.« Er hat dazu zwei Thesen: Entweder hatten sie keinen Zugang zu Schusswaffen, was eher für jüngere Täter sprechen würde – oder sie wollten geräuschlos töten. Auch Frank Urbaniok glaubt aufgrund des äußerst brutalen Vorgehens, dass die Täter von Rupperswil schon früher in irgendeiner Weise auffällig geworden sind. »Es ist unwahrscheinlich, dass jemand, der so kaltblütig tötet, keine kriminelle Vorgeschichte hat.«
Auf der Suche nach Antworten auf die vielen Fragen unterhalte ich mich auch mit der Rechtsanwältin und Kriminologin Nora Markwalder, die für ihre Doktorarbeit Raubmorde analysiert hat. Zwar werden die meisten Tötungsdelikte mit Schneid- oder Stichwaffen verübt. Bei Raubmorden aber sieht es anders aus: »Hier sind in den meisten Fällen Schusswaffen im Spiel«, erzählt Nora Markwalder. Auch sie geht davon aus, dass mindestens zwei Täter an der Tat beteiligt waren. Raubmorde seien ein typisches Gruppendelikt mit mehreren Tätern. Als ungewöhnlich nennt sie die hohe Zahl der Toten: »In der Regel gibt es ein, höchstens zwei Opfer bei Raubüberfällen.«
*
Doch dieser Fall steht jenseits jeder Regel. Nichts ist gewöhnlich an diesem Verbrechen. Auch nicht das Verhalten des Fremden, nachdem er Carla, Dion, Davin und Simona umgebracht und das Haus angezündet hat.
Das Feuer brennt, er hört die Flammen lodern. Es ist etwa elf Uhr, als er die Tür hinter sich schließt. Er scheint es nicht eilig zu haben. Der Fremde macht sich auf den Nachhauseweg und stellt sich danach erst mal unter die Dusche, während die Feuerwehr ausrückt, während der Atemschutztrupp gegen die Flammen kämpft und die Männer den schrecklichen Fund machen. Etwas später, im Laufe des Nachmittags, geht er gemeinsam mit seiner Mutter mit seinen zwei Hunden spazieren. Zwei Huskys. Als wäre nichts gewesen. Als wäre er nicht innerhalb von vier Stunden vom unbescholtenen Bürger zum kaltblütigen Mörder geworden.
Niemand merkt ihm etwas an.