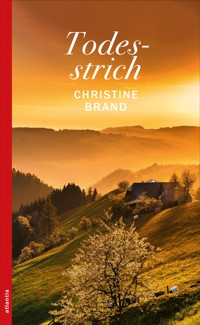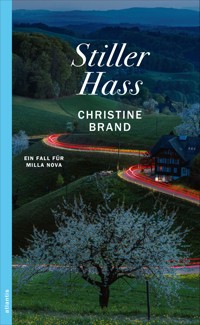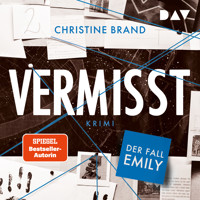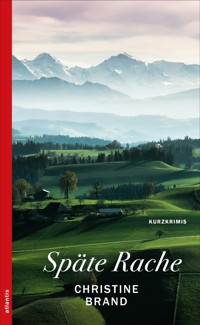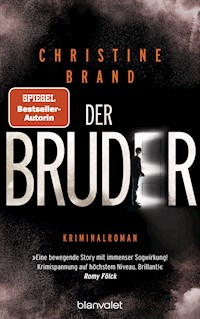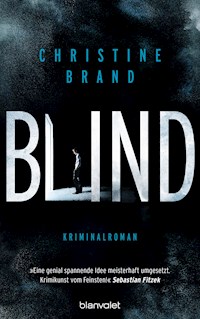10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Krimi
- Serie: Milla Nova ermittelt
- Sprache: Deutsch
Er löschte seine ganze Familie aus, nur sein Sohn überlebte – doch ist das die ganze Wahrheit?
Vor dreißig Jahren löschte sein Vater die gesamte Familie aus – nur Nathaniel überlebte, ist seitdem aber blind. Er beschließt, sich endlich seiner traumatischen Vergangenheit zu stellen, und verlangt Einsicht in die Fallakten von damals. Doch in diesen finden sich Ungereimtheiten, und Nathaniel muss sich fragen, ob sein Vater unschuldig sein könnte. Ist der wahre Mörder seiner Familie noch immer auf freiem Fuß? Auf der Suche nach Antworten kann Nathaniel diesmal nicht auf die Hilfe seiner guten Freundin, der TV-Reporterin Milla Nova zählen. Es scheint, als sei deren Freund – der Polizist Sandro Bandini – in die Vertuschung der Wahrheit über den Mord an Nathaniels Familie verwickelt …
Ihnen gefallen die Milla-Nova-Krimis? Dann lesen Sie auch »Vermisst - Der Fall Anna«, Auftakt der neuen packenden Cold-Case-Reihe – inspiriert von wahren Begebenheiten, abgründig und nervenzerreißend spannend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 591
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Buch
Nathaniel ist seit seinem elften Lebensjahr blind, als sein Vater die gesamte Familie tötete und nur Nathaniel verletzt überlebte. So hat es ihm die Polizei erzählt, an die Geschichte glaubt Nathaniel seit nun drei Jahrzehnten. Er beschließt, sich endlich seiner traumatischen Vergangenheit zu stellen, und verlangt Einsicht in die Fallakten. Doch die Unterlagen offenbaren Ungereimtheiten. Es scheint, als ob die Polizei etwas, was damals geschah, unter Verschluss halten möchte. Nathaniel realisiert, dass der wahre Mörder seiner Familie womöglich noch immer auf freiem Fuß ist – und sein Vater unschuldig sein könnte. Doch seine gute Freundin, die TV-Reporterin Milla, scheint ihm dieses Mal nicht helfen zu können, noch dazu da deren Freund Sandro Bandini als Polizist in die Vertuschung der Wahrheit über Nathaniels Familie verwickelt sein könnte. Es scheint, als sei Nathaniel auf sich allein gestellt …
Die Autorin
Christine Brand, geboren und aufgewachsen im Schweizer Emmental, arbeitete als Redakteurin bei der »Neuen Zürcher Zeitung«, als Reporterin beim Schweizer Fernsehen und als Gerichtsreporterin. Im Gerichtssaal und durch Recherchen und Reportagen über die Polizeiarbeit erhielt sie Einblick in die Welt der Justiz und der Kriminologie. »Wahre Verbrechen« ist ihr erster True-Crime-Titel bei Blanvalet über Kriminalfälle, die sie als Gerichtsreporterin begleitete. Nach »Blind«, »Die Patientin« und »Der Bruder«, mit dem sie Platz 1 der Schweizer Bestsellerliste erreichte, erscheint mit »Der Unbekannte« der vierte Fall für das Ermittlerduo Milla Nova und Sandro Bandini. Christine Brand lebt in Zürich, reist aber die meiste Zeit des Jahres um die Welt.
Von Christine Brand bereits erschienen
Blind · Die Patientin · Der Bruder · Wahre Verbrechen
Besuchen Sie uns auch aufwww.facebook.com/blanvalet und www.twitter.com/BlanvaletVerlag.
CHRISTINE BRAND
DER UNBEKANNTE
KRIMINALROMAN
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2022 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: René Stein
Covergestaltung: www.buerosued.de
Covermotiv: Sten Knudtoft / EyeEm / Getty Images;www.buerosued.de
JA · Herstellung: sam / eR
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN978-3-641-27575-4V002
www.blanvalet.de
Prolog
Er hat Angst. Ein Gefühl, das er so nicht kennt. Er hat die schwierigsten Aufträge ausgeführt und die brenzligsten Situationen überstanden. Dreimal ist auf ihn geschossen worden, einmal wurde er getroffen, ein Streifschuss. Sein Körper wurde zahllose Male vom Adrenalin geflutet. Aber Angst? Nie. Aufregung, das schon, Anspannung, Konzentration, der Kick. Das hat er gesucht, das hat ihn ausgemacht. Das war sein Leben. Immer ist er davongekommen. Bis jetzt.
Aber das hier? Das fühlt sich an wie das Ende von allem. Damit kann er nicht umgehen. Die Angst vor dem Danach flutet seinen Körper, der sich schwer und traurig und kraftlos anfühlt. Er blickt auf seine Hände. Sie zittern.
»Deine Hände zittern.«
Hastig nimmt er sie vom Tisch, legt sie auf die Knie, wo niemand sie sieht. »Es geht schon.«
»Mach dir keine Sorgen. Es wird alles gut.«
Gut? Gut soll es werden? Er spricht seine Zweifel nicht laut aus, es würde doch nichts ändern. Er hat keine Wahl. Es fällt ihm schwer, das zu akzeptieren.
»Es ist alles vorbereitet. Du kennst die Daten?«
»Ich habe alles auswendig gelernt«, antwortet er. »Aber es fühlt sich so anders an, dieses Mal.«
»Stell dir einfach vor, es gehe um einen weiteren Job.«
»Das ist einfacher gesagt als getan.«
»Ich weiß. Wir werden dich auch vermissen.«
Die beiden Männer schweigen. Sie sind es nicht gewohnt, über Gefühle zu sprechen, Emotionen haben in ihrem Business keinen Platz. Gleichzeitig wissen sie: Was jetzt nicht gesagt wird, wird niemals gesagt werden. Doch die Worte des einen schaffen es nicht bis zum anderen. Sie bleiben unausgesprochen.
»Geburtstag?«
»18. Dezember 1950.«
»Name der Mutter?«
»Katharina.«
»Vater?«
»Ernst.«
»Aufgewachsen in?«
»Uster, Kanton Zürich.«
»Ausbildung?«
»Abgebrochenes Jura-Studium, dann Ausbildung zum Justizvollzugsbeamten.«
»Korrekt ist: Fachmann für Justizvollzug. Das musst du wissen.«
»Fachmann für Justizvollzug.«
»Grund für den Umzug in den Kanton Bern?«
»Der Job, eine Stelle in der Strafanstalt Thorberg.«
»Und dein Beruf heute?«
»Bademeister! Himmel, wie seid ihr bloß darauf gekommen? Bademeister!«
»Es gab keine andere Möglichkeit. Du kannst dir nach Saisonschluss was anderes suchen, kein Problem.«
»Kein Problem? Was soll ich denn finden?«
»Kannst dich ja als Privatdetektiv selbstständig machen.«
Obwohl es nicht so gemeint ist, klingt der Satz in seinen Ohren wie Hohn. Doch er schweigt, hört weiter zu, wie über ihn bestimmt wird.
»Du wirst dich morgen von deinen Eltern verabschieden können, bevor du losfährst. Wir haben dir ein Auto organisiert. Läuft alles schon auf den neuen Namen.«
Allein beim Gedanken an den Abschied wird ihm schlecht. Natürlich haben seine Eltern Verständnis gezeigt für die Situation. Sie wollen nur das Beste für ihn. Auch ließen sie sich den Schmerz nicht anmerken. Aber er weiß, wie schrecklich es für sie sein muss; als würde ihr Sohn sterben, obwohl er es tatsächlich nicht tut, aber verlieren werden sie ihn doch. Sein Leben wird ohne sie stattfinden. Sie werden ihre künftige Schwiegertochter niemals kennenlernen, auch nicht ihre Enkel. Falls er sich an die Abmachung hält.
»Es ist Zeit. Bist du so weit?«
Noch nicht, denkt er. Er ist noch nicht so weit. Er wird es nie sein. Doch er nickt.
Sein Gegenüber schiebt einen Briefumschlag über den Tisch. Er greift danach, öffnet ihn, zieht ein rotes Büchlein und verschiedene Papiere heraus.
»Dein Pass, dein Führerschein, die übrigen Urkunden. Ich wünsche dir ein gutes Leben.«
Er stöhnt leise auf.
»Ist das wirklich nötig? Das alles? Ist es nicht übertrieben?« Ein letzter Versuch, seine letzte Hoffnung, dass das hier nicht geschehen wird.
»Wir übertreiben nicht. Wenn du einen Fehler machst oder dich nicht an die Regeln hältst, bist du ein toter Mann.«
Sein Gegenüber erhebt sich, auch er steht auf, schiebt den Stuhl zurück, der ein zu lautes Geräusch verursacht. Er zuckt erschrocken zusammen.
Zum Abschied geben sich die beiden Männer die Hand.
1
Es klopft. Dreimal kurz, zweimal lang, dreimal kurz, so leise, dass sie es nicht gehört hätte, würde sie nicht seit einer Viertelstunde darauf warten. Er hat einen Schlüssel, trotzdem kommt er nicht einfach herein. Auch klingelt er nie; er klopft, kaum hörbar.
Margret öffnet die Tür, späht über seine Schulter ins Treppenhaus, lässt ihn eintreten, schließt hinter ihm gleich wieder ab. Erst jetzt küssen sie sich kurz auf den Mund.
»Hat dich jemand gesehen?«
»Nein, ich bin ein Chamäleon.«
Es ist immer die gleiche Begrüßungsformel, seit fast einem Jahr schon, seit das Unfassbare geschehen ist und sich Ronnie und Margret ineinander verliebt haben. Es hat sie beide überrascht, und doch haben sie es zugelassen, was keine Selbstverständlichkeit ist – aus verschiedenen Gründen.
Ronnie folgt Margret in die Küche, stellt seine Aktentasche neben die Tür, legt sein Veston über die Stuhllehne. Die Lamellen der heruntergelassenen Jalousie schneiden den Sonnenschein in Streifen. Kleinste Staubkörner tanzen im gebrochenen Licht.
Ronnie umarmt Margret und flüstert ihr etwas ins Ohr.
Sie lacht laut auf und klatscht ihm mit der Hand auf den Hintern.
»Du alter Schmeichler, du!«
Draußen verkünden die Glocken des Kirchturms die volle Stunde; acht Schläge. Eigentlich müsste Ronnie jetzt mit der Arbeit beginnen, wahrscheinlich hat er einen Sitzungstermin in die Agenda eingetragen, einen, bei dem er auf keinen Fall gestört werden darf. So macht er es jedes Mal, wenn sie sich zu einem Schäferstündchen treffen.
»Hast du schlecht geschlafen?« Margret studiert Ronnies Gesicht. Blass sieht er aus, er kommt ihr auf einmal seltsam grau vor. Ein grauer, alter Mann. Sie schiebt den Gedanken weg, fährt Ronnie mit der Hand über den Rücken. »Du siehst müde aus.«
»Ich fühl mich nicht besonders.«
»Was ist los?«
»Ich weiß nicht. Der Magen. Ich habe bestimmt bloß etwas Falsches gegessen. Das Frühstück, die Eier, keine Ahnung, ich krieg heut auch irgendwie schlecht Luft, vielleicht ist eine Erkältung im Anmarsch, aber kein Grund zur Sorge.«
»Willst du dennoch Kaffee?«
»Nein, danke, lieber nicht.«
Margret kann sich nicht erinnern, wann es anfing, wann sie jenes Alter erreicht hatte, in dem sich jede Unterhaltung nach wenigen Minuten zwangsläufig um die Gesundheit zu drehen schien. Es muss irgendwann um ihren Sechzigsten herum gewesen sein, schon eine Weile her. Obwohl Margret sich stets vornimmt, nicht über die eigenen Beschwerden zu klagen, landet sie beim Plaudern mit ihren Freundinnen und Freunden früher oder später doch jedes Mal beim Austausch der persönlichen Gesundheitsbulletins. Es ist der Fluch des Alters.
»Du siehst bezaubernd aus.« Ronnie reißt sie mit seinem Kompliment aus ihren Gedanken. Margret lächelt.
»Du Schwindler. Ich bin alt und runzlig, alles hängt. Der Zauber ist längst vergangen.«
»Unsinn. Du bist wunderschön, ich liebe dich in der Seniorin-Version.« Ronnie gibt ihr einen Kuss auf die Stirn, löst seinen Krawattenknopf und beginnt, sich aus seinem Hemd zu schälen. »Lass uns etwas ruhen gehen.«
»Ruhen …« Margret lacht. Doch sie folgt Ronnie ins Schlafzimmer, knüpft sich unterwegs die Bluse auf. Sie spürt die Aufregung, die ihr die Röte ins Gesicht treibt, und muss über sich selbst schmunzeln, über sich und über Ronnie, sie sind so alt und doch so unvernünftig.
Seit sie zusammen sind, spielt sich ein großer Teil ihrer Beziehung im Bett ab, obwohl sie das Kapitel Sexualität für sich selbst bereits abgeschlossen hatte. Wie man sich täuschen kann. Margret fragt sich, wie lange sie diese unerwartete Lust aufeinander noch verspüren werden. Zunächst hatte sie gedacht, die Sache würde nach ein paar Wochen vorbei sein. Doch daraus wurden Monate. Und noch immer führen sie sich auf wie verliebte Teenager, wenn auch nicht mehr ganz so ungestüm und wild wie in jungen Jahren, sie würden sich sonst wohl die Knochen brechen. Oder sich zumindest etwas ausrenken.
»Komm, komm«, flüstert Ronnie zärtlich, als er Margret an der Hand nimmt und mit sich aufs Bett zieht.
Er küsst ihren Nacken, ihren Hals, ihr Ohr, ihre Schläfe, die Stirn. Wie gut er riecht, denkt Margret. Darauf legt er Wert, zum Glück.
»Lass uns zusammen sein. Ich meine: richtig. Nicht so wie jetzt. Wie Mann und Frau.«
»Ronnie …«
»Ich meine es ernst.«
Er küsst sie auf die Wange, kurz auf den Mund. Sie weiß, er befürchtet, er habe Mundgeruch. Darum ist er kein großer Küsser, leider.
»Du weißt, dass das nicht geht.« Margret liegt auf der Seite, sie hat sich auf den Ellenbogen gestützt und blickt Ronnie in die Augen.
»Warum nicht? Wir leben schließlich im einundzwanzigsten Jahrhundert.«
Er legt seine Hand auf ihren Rücken und öffnet mit noch immer geschickten Fingern ihren Büstenhalter.
»Das ändert nichts daran.«
»Auch jemand wie ich kann sich scheiden lassen. Es ist mir egal, was die anderen denken.«
»Ach Ronnie. Es ist nicht so einfach. Das weißt du doch genau.«
»Du machst dir zu viele Sorgen. Ich verspreche dir, ich werde frei sein, wir werden zusammen sein.«
Margret legt ihre Lippen auf die seinen, mehr um ihn zum Schweigen zu bringen, als um ihn zu küssen, sie will nicht streiten, sie mag nicht darüber reden, nicht schon wieder und nicht jetzt. Zu kostbar erscheint ihr die wenige Zeit, die sie zusammen haben.
Sie streichelt seinen faltigen, nackten Bauch, lässt ihre Hand in seine Hose gleiten, er stöhnt auf. Sie spürt, dass er schon hart ist. Sie weiß, dass er Viagra schluckt, bevor er an ihre Tür klopft. Sie hat nichts dagegen einzuwenden. Margret öffnet seinen Gürtel, streift mit seiner Hilfe seine Hose ab, schlüpft aus ihrem Rock. Er streichelt sie zärtlich, sie liebt seine Hände auf ihrer Haut. Was für ein Glück, wieder und immer wieder von jemandem berührt zu werden, denkt sie, als sie die Augen schließt. Er wälzt sich etwas unbeholfen auf sie, große Akrobatik ist für sie beide nicht mehr drin, und gleitet in sie hinein, keucht plötzlich laut, als ob er schon außer Atem wäre und ächzt klagend auf. Kommt er etwa schon? Doch er klingt ganz anders als sonst. Er ringt nach Luft, röchelt, sein Körper verkrampft sich. Margret schlägt die Augen auf, erkennt seinen panischen Blick, sieht, wie er sich aufrichtet und sich ans Herz greift. Im nächsten Moment lässt er sich schwer auf sie fallen und bleibt liegen.
»Ronnie?«
Er macht keinen Mucks.
»Ronnie!« Margret schreit seinen Namen.
Nichts.
Die Angst greift nach ihr. Einen Moment lang bleibt sie reglos unter seinem Körper liegen, unfähig sich zu rühren, als befände sie sich in einer Schockstarre. Doch dann reißt sie sich zusammen, kämpft sich unter Ronnies Körper hervor, ein Kraftakt, sie dreht ihn auf den Rücken, schlägt ihm mit der Faust aufs Herz, immer wieder, dann versucht sie, ihn zu beatmen, legt ihren Mund auf seinen und stößt Luft in ihn hinein, so wie sie es vor vielen Jahren gelernt hat.
Er atmet nicht.
Sie lässt von seinem Mund ab, wendet sich wieder dem Herzen zu, massiert es mit aller Kraft, die in ihr steckt. Sie versucht, Ronnie zurückzuholen von da, wo immer er sich befindet, zurück in diesen Körper, er darf nicht gehen, nicht Ronnie, nicht jetzt, so darf sein Leben nicht enden.
Doch es nützt nichts. Margret erkennt, dass es zu spät ist. Da ist kein Leben mehr. Dennoch springt sie auf, greift sich ohne darüber nachzudenken Rock und Bluse und stürzt zum Telefon. Sie muss den Notruf wählen. Den Ambulanz-Notruf! Die Nummer fällt ihr nicht ein, nur die 118 für die Feuerwehr hat sie präsent. Also tippt sie die ein. Kaum hat sie die Nummer gewählt, hält sie inne. Rasch hängt sie den Hörer wieder auf.
»Und was soll ich denen sagen?«, fragt sie laut in die Stille hinein, als würde sie eine Antwort aus dem Schlafzimmer erwarten.
Doch Ronnie schweigt.
2
»Schläfst du noch?«
»Mmmmh.«
Nathaniel tastet nach Gundulas Kopf, der an seiner Schulter liegt, fährt ihr mit dem Finger über die Wange, hält auf ihren Lippen inne, lehnt sich vor und küsst sie sanft.
»Ich muss los.« Er versucht, sich aufzusetzen, doch die kurzen Arme, die ihn umschließen, ziehen ihn sanft ins Kissen zurück.
»Bleib doch noch ein bisschen.«
Im gleichen Moment hört Nathaniel das vertraute Tapsen von vier Pfoten auf dem Parkettboden, Sekunden später streift etwas Nasses seine Hand. Alisha, seine Blindenhündin, scheint nur auf das Wörtchen los gewartet zu haben. Sie ist nicht mehr die Jüngste, ihre Blase war auch schon strapazierbarer, spätestens um neun Uhr morgens muss er mit ihr Gassi gehen, länger lässt sich der Morgenspaziergang kaum mehr hinauszögern.
»Alisha muss auch raus. Wir sind nicht solche Langschläfer wie du.«
Gundula ignoriert Nathaniels Worte und schmiegt ihren kleinen Körper an ihn.
Wie vertraut sie sich schon sind, denkt Nathaniel, als er den Arm um sie legt und sie an sich drückt. Fast sein ganzes Leben lang war er alleine. Das mit der Liebe war kompliziert; es ließ sich einfach keine Partnerin finden für ihn, einen Blinden. Irgendwie war das auch okay, er hatte sich damit abgefunden, nur selten plagte ihn eine kleine Sehnsucht nach der Zweisamkeit, die er bis vor Kurzem noch niemals in seinem Leben erfahren durfte. Doch just als er – aus formalen Gründen – seine lesbische Freundin Carole zum Schein geheiratet hatte, lief ihm Gundula über den Weg, eine kleinwüchsige Frau aus dem Tierwarengeschäft, die ihn mit ihrer forschen und direkten Art vom ersten Moment an verzaubert hat. Das Timing hätte zwar kaum schlechter sein können, trotzdem hat er sich auf Anhieb in sie verliebt. Er küsst Gundula erneut, dann löst er sich aus ihrer Umarmung.
»Ich sollte wirklich gehen, leider, aber heute ist ein großer Tag, ich muss eine Geburtstagsparty für einen Haufen unbändiger Sechsjähriger mitorganisieren.«
»Silas’ Geburtstag.« Gundula sagt es mit einem Unterton in der Stimme, der niemandem sonst auffallen würde, doch Nathaniel spürt sofort, dass noch etwas folgen wird.
»Ich wünschte, ich hätte auch ein Kind.«
Der Satz versetzt Nathaniel einen Stich ins Herz. Er setzt sich auf die Bettkante und möchte etwas erwidern, aber die richtigen Worte fallen ihm nicht ein. Heikles Terrain. Er hört, dass sich auch Gundula aufsetzt.
»Also ich könnte mir gut vorstellen, mit dir Kinder zu haben.«
Obwohl es keine Frage ist, klingt es, als würde sie eine Antwort erwarten. Eine Antwort, die Nathaniel nicht geben kann. Er erstarrt innerlich und versucht, sich nichts anmerken zu lassen; gleichzeitig drückt er Gundula unbeholfen an sich, sodass sie nach Luft ringen muss.
»Soll ich das als ein ›Ja, ich auch‹ verstehen?«, fragt sie halb scherzend, halb verunsichert.
Nathaniel schweigt noch immer, er fühlt sich überfordert und weiß nicht, wie er adäquat reagieren kann, ohne Gundula zu verletzen. Er weiß nur eines mit Bestimmtheit: Er will kein Kind, kein eigenes Kind, es geht nicht.
»Du scheinst von der Idee nicht ganz so begeistert zu sein«, hakt Gundula nach.
»Lass uns ein andermal darüber reden.«
»Es ist medizinisch möglich, du musst dir keine Sorgen machen. Nur, weil ich kleinwüchsig bin, heißt das nicht, dass ich auch ein kleinwüchsiges Kind gebären werde. Mein Kind kann normal groß werden, so wie du.«
Nathaniel drückt Gundula noch einmal an sich, dann steht er auf. »Darum geht es nicht. Es ist eine große Frage, und es ist noch so früh, wir kennen uns doch kaum. Und überhaupt, wie gesagt, ich muss los.«
Nathaniel tastet nach dem Stuhl, der links neben dem Nachttisch steht und auf den er am Abend zuvor seine Kleidung abgelegt hat. Zuunterst die Jeans, darauf liegen der Pullover und das T-Shirt, zuoberst die Unterhosen und die Socken, alles korrekt gefaltet. Seine Mutter würde vor Freude im Grab in die Hände klatschen, wenn sie ihm dabei zusehen könnte; ausgerechnet er, der als kleiner Junge immer alles irgendwo in eine Ecke gepfeffert hatte. Doch unordentlich zu sein, verträgt sich schlecht mit Blindheit. Heute ist er ein richtiggehender Pedant.
»Nathaniel …«
»Gundula, entschuldige, lass uns wirklich besser ein andermal darüber reden.«
Er schlüpft in seine Hose, sucht mit den Fingern die Etikette des Pullovers, damit er ihn korrekt herum hält, und zieht ihn über, er dreht sich noch einmal zurück zum Bett und tastet nach Gundula. Er gibt ihr einen Kuss, wünscht ihr einen schönen Tag und verlässt ihr Schlafzimmer. Sie bleibt schweigend zurück. Im Flur neben der Tür hört Nathaniel Alishas Schwanz auf den Boden klopfen. Er nimmt das Hundegeschirr vom Haken an der Garderobe, lässt sie hineinschlüpfen und schließt die Tür auf.
Als er kurz darauf unten aus dem Haus tritt, atmet er erleichtert aus. Er will kein Kind. Niemals. Er hat schon Silas, er ist ihm nahe, sehr nahe, zu nahe fast, Silas ist ihm beinah ein Sohn, allein das ist schwierig genug. Zu gut erinnert sich Nathaniel an die Panik, die ihn vor ein paar Monaten ergriffen hat, als er Silas plötzlich nirgends mehr finden konnte. Er war wegen eines Unfalls zu spät beim Kinderhort erschienen, wo er ihn abholen wollte. Die Erzieherin hatte nicht richtig aufgepasst, und Silas war einfach weg gewesen. Nathaniels Angst um den kleinen Jungen war so mächtig, dass er glaubte, daran zu sterben. Das und diese Hilflosigkeit will er nie mehr erleben.
Ein eigenes Kind – das schafft er erst recht nicht. Zu groß ist seine Furcht, ein zweites Mal seine Familie zu verlieren. All das hätte er Gundula gerne erklärt. Doch wie sagt man das zu seiner Geliebten, die sich ein Kind wünscht – ohne zu riskieren, dass sie einen verlässt?
Gedankenversunken lässt sich Nathaniel von Alisha zur Bushaltestelle führen. Kurz darauf fährt er durch die Berner Altstadt, rechts und links die Laubengänge, die er noch nie gesehen hat und deren Klang er so gut kennt, weil seine Schritte in ihnen widerhallen, wenn er zu Fuß unterwegs ist.
Als er an seiner Haltestelle aussteigt, zieht ihn Alisha ungeduldig nach rechts statt nach links, wo ihr zu Hause liegt. Erst da fällt Nathaniel ein, dass sie ihr Morgengeschäft noch immer nicht verrichten konnte.
»Entschuldige Alisha«, murmelt er.
Zur Antwort erhält er ein ungeduldiges Japsen. Als er beim Bremgartenwald ankommt, befreit er Alisha aus dem Geschirr und entlässt sie mit einem »Libera!« Er bleibt stehen, während er sie im Gehölz verschwinden hört, legt den Kopf in den Nacken und spürt Sonnenstrahlen auf seinem Gesicht. Er fühlt einen leichten Wind, lauscht, wie er mit den Ästen spielt. Nathaniel atmet den Wald ein, der nach feuchter Erde und jungen Blättern riecht.
Nein, kein Kind, sagt eine Stimme in seinem Kopf. Es hört sich an wie eine Drohung. Auf einmal umgibt ihn ein düsteres Gefühl wie eine dunkle Regenwolke, eine Stimmung, von der er meinte, sie ein für alle Mal erfolgreich aus seinem Leben vertrieben zu haben. Doch er hat sich offensichtlich geirrt. Schatten verschwinden nicht.
»Nathaaaaaaaniel – endlich!«
Silas rennt Nathaniel beinahe um, als er zu Hause ankommt. Der kleine Junge übertönt mit seinem Freudengeschrei sogar das Jaulen von Alisha, mit dem sie ihrerseits Silas und Carole begrüßt, als hätte sie sie seit Wochen nicht mehr gesehen, obwohl sie gerade erst gestern noch zu Hause gewesen sind. Zu Hause heißt für Nathaniel: bei Silas, seinem Patenkind, und dessen Mutter Carole, seiner lesbischen Freundin, mit der er eine Scheinehe eingegangen ist, die sich aber manchmal beinahe wie eine richtige Ehe anfühlt, trotz allem.
»Alles Gute zum Geburtstag, kleiner großer Mann!«, ruft Nathaniel, während er nach Silas greift, der sich fangen und in die Luft stemmen lässt. Doch kaum hat er wieder Boden unter den Füßen, wird Silas ernst.
»Ich bin jetzt zu groß, um getragen zu werden, ich bin jetzt nämlich erwachsen. Seit heute bin ich sechs Jahre alt.«
»Das werden wir richtig feiern, dass du ab sofort erwachsen bist.«
Nathaniel hört Carole aus der Küche treten.
»Zum Glück bist du hier, mir wächst schon jetzt alles über den Kopf!«
Carole sagt es lachend, aber Nathaniel hört ihrer Stimme die Erschöpfung an, obwohl noch nicht mal Mittag ist. Ein buttrig-süßer, warmer Schokoladengeruch streift seine Nase. Es ist ein Kuchen im Ofen. Dass Carole backt, kommt genau einmal im Jahr vor, nämlich wenn Silas Geburtstag hat. Es gibt auch jedes Mal den gleichen Kuchen, stets dieselbe Fertigbackmischung, denn Carole ist eine miserable Köchin. Was die Kulinarik anbelangt, ist sie alles andere als eine perfekte Mutter, was ihr aber niemand übel nimmt, am wenigsten Silas selbst; er liebt es, dass ständig Pommes oder Fischstäbchen auf dem Tisch stehen.
Carole begrüßt Nathaniel mit einer kurzen Umarmung, das ist zu ihrem scheinehelichen Ritual geworden.
»Ich habe Girlanden und Luftballons gekauft, die man noch aufblasen muss, ich dachte, du könntest mir vielleicht dabei helfen.«
»Stets zu deinen Diensten.«
»Ich will auch Luftballons aufblasen!«, reklamiert Silas.
»Wir werden es gemeinsam tun. Auch beim Aufhängen der Girlanden brauch ich deine Hilfe.« Nathaniel streckt den Arm aus, um Silas durch die Haare zu wuscheln, doch der bückt sich schnell weg. Das lässt er sich seit einem halben Jahr schon nicht mehr gefallen, doch Nathaniel kann sich einfach nicht daran gewöhnen.
»Ich hol sie.«
Nathaniel hört Silas in die Küche rennen, kaum ist er weg, ist er auch schon wieder da, er fasst Nathaniels Hand und zieht ihn zum Sofa. Längst ist es für den kleinen Jungen eine Selbstverständlichkeit, dass er für Nathaniel das Sehen übernimmt. Kaum hat Nathaniel Platz genommen, hört er das Knistern von Plastik, dann fühlt er ein Säckchen in seiner Hand.
»Das musst du aufreißen.«
Nathaniel gehorcht aufs Wort, er zerreißt das Plastiksäckchen kraftvoll, sodass alle Luftballons auf einmal herausfallen.
»Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn und noch ein paar«, zählt Silas, während er sie am Boden einsammelt. Einen drückt er Nathaniel in die Hand. Er fühlt sich kalt und unangenehm an.
Nathaniel hört Silas neben sich verzweifelt pusten. Er tastet das schlabbrige Gummiding in seiner Hand nach einer Öffnung ab, erfühlt den verstärkten Rand. Himmel, denkt er, wie lange ist es her, dass er das zum letzten Mal gemacht hat? Er war noch ein Kind.
»Rate, welche Farbe dein Ballon hat!«, fordert Silas ihn auf.
»Blau?«
»Falsch! Rot! Du hast verloren.« Silas beginnt wieder zu pusten.
Nathaniel nimmt das offene Ende des Ballons in den Mund und bläst kräftig hinein, der Luftballon füllt sich, der Gummi fühlt sich gleich ganz anders an.
Da fällt es ihm ein, wann genau er zum letzten Mal einen Luftballon aufgeblasen hat. Er war nicht viel älter als Silas jetzt ist. Es war damals, in der anderen Zeit, als er noch sehen konnte. In seinem anderen Leben. Als seine Schwester Geburtstag hatte.
Auf einmal dreht sich alles. Nathaniel wird schwindlig, er fühlt einen Druck auf der Brust, als hätte sich jemand auf ihn draufgesetzt. Er keucht, ringt nach Atem, weiß nicht mehr, was oben und was unten ist, und kippt zur Seite. Ganz weit weg hört er eine Kinderstimme rufen. Dann, vielleicht Sekunden, vielleicht Minuten später, wird er heftig geschüttelt.
»Nathaniel! Nathaniel!«, ruft Carole, die ihn an den Schultern gepackt hat.
Nathaniel richtet sich auf und hält sich benommen den Kopf.
»Nathaniel, bist du in Ordnung?«
»Mir wurde schwindlig.«
»Weil du einen Luftballon aufgeblasen hast? Bist du krank?«
»Nein. Es ist nichts. Es ist nur … Es sind die Erinnerungen. Die Luftballons. Das Geburtstagsfest. Meine Schwester ist zwei Tage nach ihrem Geburtstag gestorben.«
3
»Das Kind!«
»Welches Kind?«
»Das Kind! Es stirbt!«
Milla Nova lässt das Mikrofon fallen, krümmt sich und verfällt in ein leises Wimmern.
Ihr Kameramann Ivan reagiert sekundenschnell. Er stellt die Kamera auf den Boden und rennt auf Milla zu, hält sie fest, stützt sie. Begreift.
»Bist du schwanger?«
Milla nickt und presst die Lippen zusammen. Es fühlt sich an, als hätte ihr jemand ein Messer in den Unterleib gerammt. Sie spürt genau, dass dieser Schmerz nicht gut ist. Dass gar nichts gut ist. Dass sie ärztliche Versorgung braucht, und zwar schnell.
Im Nu sind Milla und Ivan von mehreren Parlamentariern umringt, die besorgt auf die Journalistin hinabblicken. Milla kauert mitten in der Wandelhalle im Bundeshaus auf dem Boden, jenem Ort im Parlamentsgebäude, in der die Politiker ihr weiteres Vorgehen besprechen und Lobbyisten Versprechungen machen. Gerade hat sie ihr Interview mit Nationalrat Martin Ischer beendet, ein ehemaliger TV-Moderator, der einst ihr Arbeitskollege war und jetzt auf einmal in ganz anderer Funktion vor der Kamera steht. Sie hat ihn über die bevorstehende Abstimmung zum neuen Anti-Terrorgesetz befragt, das er vehement bekämpft. Da war noch alles in Ordnung gewesen. Jetzt ist nichts mehr in Ordnung. Milla spürt, dass ihr etwas Feuchtes innen am Bein herunterläuft. Hoffentlich ist es nicht zu viel Blut, denkt sie, es darf nicht zu viel Blut sein. Nicht das Kind.
Milla zittert am ganzen Körper und nimmt die Menschen um sich herum nur schemenhaft wahr, die Worte kommen von sehr weit her. Bis jemand sie am Ellenbogen packt.
»Ich bin Arzt«, hört sie eine Stimme sagen, die sie kennt. Sie blickt auf. Es ist Nationalrat Claudio Izzo, der in seinem Leben vor der Politik eine Hausarztpraxis betrieben hat. Er geht vor Milla in die Knie, sucht ihren Blick.
»Frau Nova. Wissen Sie, wo Sie sind?«
»Im Bundeshaus. Ich bin schwanger. Ich blute.«
»Sie müssen ins Spital.«
Darauf ist Milla schon selbst gekommen. Ivan hilft ihr, sich wieder aufzurichten, der Schmerz ist etwas erträglicher geworden, aber er ist nicht ganz weg, er lauert irgendwo, um gleich wieder anzuschwellen.
»Ich fahre dich ins Krankenhaus«, sagt Ivan. »Kannst du gehen?«
»Ja«, meint Milla. Sie wirkt ruhig, doch in ihrem Kopf herrscht Chaos und Panik.
Nicht das Kind. Nicht mein Kind. Das darf nicht sein.
Milla hört das Klingeln der Glocke im Nationalratssaal, das Zeichen dafür, dass gleich die nächste Abstimmung stattfinden wird. Claudio Izzo nickt ihr aufmunternd zu, bevor er hinter den anderen in den Saal eilt, um noch rechtzeitig auf den Abstimmungsknopf zu drücken. Plötzlich sind alle weg, und es ist unnatürlich still in der Wandelhalle.
Ivan hebt das Mikrofon mit dem Signet des Schweizer Fernsehens vom Boden auf, schnappt sich die Kamera und Millas Tasche, klemmt sich das Stativ unter den Arm, als ob es keine elf Kilo wiegen würde, und hält Milla den Oberarm hin, damit sie sich daran festhalten kann, aber das ist nicht nötig.
»Es geht schon.«
»Ich fahre dich ins Inselspital.«
»Ich möchte lieber zu meiner Frauenärztin. Sie ist hier, in Bern.«
»In Ordnung. Willst du Sandro anrufen?«
Sandro. Milla wünschte sich, dass er bei ihr wäre, gleichzeitig ist sie froh, dass er nicht hier ist. Er würde durchdrehen vor Sorge, er, der sich dieses Kind so sehr wünscht.
Milla schüttelt den Kopf. »Vielleicht ist es ja nichts Schlimmes. Ich will ihn nicht unnötig beunruhigen, lass uns zuerst zu meiner Ärztin fahren.«
Zwanzig Minuten später sitzt Milla auf dem Gynäkologenstuhl und wagt kaum zu atmen. Die Ungewissheit ist unerträglich, das Schweigen der Ärztin ebenso, doch Milla wagt nicht zu fragen.
»Es lebt.«
Milla möchte erleichtert sein, doch sie hört der Stimme ihrer Ärztin an, dass etwas nicht stimmt.
»Ich sehe den Herzschlag. Hier, sehen Sie?« Chantal Tischler zeigt auf den Monitor, der Millas Innenleben in Echtzeit zeigt. Doch Milla kann beim besten Willen nichts erkennen außer ein dunkles, verwirrendes Durcheinander. Doch dann sieht sie plötzlich ein klitzekleines Etwas, das geräuschlos pulsiert. Das Herz ihres Kindes.
»Aber ich will ganz ehrlich zu Ihnen sein.« Als sich die Ärztin vom Monitor ab- und Milla zuwendet, zerfurchen Sorgenfalten ihre Stirn.
»Ich werde es verlieren, oder?«
»Der Blutverlust, die Krämpfe, das sind keine guten Anzeichen. Sie könnten auf einen drohenden Abort hinweisen. Ich verordne Ihnen drei Tage Bettruhe. Sie müssen still liegen. Zudem verschreibe ich Ihnen Bryophyllum und Progesteron. Ich meine es ernst: Sie müssen stillhalten. Keine Arbeit mehr. Kein Sex. Keine Lasten heben. Vermeiden Sie jede Art von Stress! Dann schauen wir weiter.«
Milla will es nicht hören, am liebsten würde sie sich die Ohren zuhalten. Sie ist erst in der neunten Woche schwanger. Sie wusste, dass die Gefahr eines Abortes in den ersten zwölf Wochen groß ist, insbesondere weil sie selbst mit fast vierzig Jahren nicht mehr die Jüngste ist, um Mutter zu werden. Aber dass es sie nun wirklich treffen könnte – das ist etwas ganz anderes als abstrakte Prozentzahlen und Wahrscheinlichkeiten.
»Sind Sie alleine hergekommen, oder wartet Ihr Partner im Wartezimmer?«
»Nein. Und nein. Ich bin mit meinem Kameramann hier. Ich meine, mit meinem Arbeitskollegen.«
»Wie gesagt, arbeiten ist ab sofort strikt verboten.«
Milla nickt. »Ich werde mich nach Hause bringen lassen.«
»Gut. Ich gebe Ihnen Damenbinden mit.«
Chantal Tischler steht auf, öffnet einen Schrank, sucht ein paar überdimensionierte Damenbinden heraus und reicht sie ihr.
Milla zieht sich hinter den Paravent zurück, klebt eine Binde in die blutverschmierte Unterhose und schlüpft in die Jeans, die auf der Innenseite ebenfalls einen kleinen, dunklen Fleck aufweist, der von außen aber nicht zu sehen ist. Sie lässt sich von Chantal Tischler das Rezept für die Medikamente geben plus Krankmeldung, wonach sie gleich für eine ganze Woche krankgeschrieben ist.
»Danke«, sagt Milla leise. Sie mag sich gar nicht vorstellen, was ihr Chef Wolfgang dazu sagen wird, dass sie für eine Woche ausfallen wird, oder wer weiß, vielleicht für länger. Sie hat es noch nicht einmal geschafft, ihm zu erzählen, dass sie schwanger ist. Dabei hätte er längst damit beginnen müssen, nach einer Stellvertreterin für ihren Mutterschaftsurlaub zu suchen. Sofern es den Mutterschaftsurlaub überhaupt noch braucht. Der Gedanke nimmt Milla den Atem; ein schwerer Stein auf ihrer Brust.
»Gehen Sie nach Hause und legen Sie sich hin. Keine Arbeit, kein Stress. Schaffen Sie das?« In Chantal Tischlers Stimme schwingt Skepsis mit.
Milla nickt zögernd.
»Gönnen Sie sich Ruhe, sich und Ihrem Kind.«
Bevor Milla Ivan im Wartezimmer abholt, zieht sie sich für einen Moment auf die Toilette zurück. Vogelgezwitscher ertönt aus einem Lautsprecher und erfüllt den Raum. Es riecht wie in einer Wellness-Zone. Über Millas Kopf dreht eine kleine, geflügelte Kuh an einem Faden gemächlich ihre Runden. Milla mustert sich im Spiegel. Blickt sich in die Augen. Wie blass sie ist.
Sie muss Sandro anrufen, muss ihm sagen, was passiert ist. Muss ihren Chef informieren. Jemand muss ihren Beitrag zum Anti-Terrorgesetz fertigstellen. Auf einmal erscheint ihr das alles zu viel.
Noch einmal schaut sie sich im Spiegel an.
»Reiß dich zusammen«, sagt sie laut zu ihrem Spiegelbild. »Du hast schon ganz andere Situationen überstanden.«
Milla muss ihre Gedanken sortieren.
Bis vor exakt eineinhalb Stunden war sie nicht mal sicher gewesen, ob sie tatsächlich ein Kind haben wollte. Sie konnte sich noch immer nicht wirklich vorstellen, Mutter zu werden. Natürlich, sie und Sandro haben sich gemeinsam dafür entschieden, das Kind zu behalten, nachdem sie überraschend schwanger geworden war. Sandro hatte sich immer Kinder gewünscht, am liebsten hätte er eine ganze Rasselbande. Das muss an seinen italienischen Wurzeln liegen. Milla hingegen hatte sich früher immer ein Leben ohne Kinder vorgestellt. Doch sie hat schließlich nachgegeben, hat gedacht, dass sich das Schicksal nun mal anders entschieden hat und dass sich ihre Einstellung von selbst ändert, sobald ihr Körper durch die Schwangerschaftshormone geflutet wird. Doch tief in ihrem Innern ist sie unschlüssig geblieben, bis zu dem Moment in der Wandelhalle des Bundeshauses, als der Schmerz ihr den Verstand nehmen wollte und das Blut aus ihr herausfloss. Jetzt, wo sie das Kind verlieren könnte, möchte sie es plötzlich unbedingt, nichts wünscht sie sich in diesem Augenblick mehr, als dass das Kind bei ihr bleibt, dass es lebt, dass es geboren wird und aufwächst und ein Leben führen kann.
Und plötzlich ist da noch ein anderes Gefühl: Schuld. Sie hat sich nicht genug auf das Kind gefreut, darum droht sie es jetzt zu verlieren. Sie ist zu unvorsichtig gewesen. Sie ist schuld, wenn das Kind stirbt.
Milla schiebt die Gedanken weg. Ihr Verstand weiß, dass sie nichts dafür kann. Dass die Natur entscheidet, wer überlebensfähig ist und wer nicht. Trotzdem.
Sie muss Sandro anrufen. Sie muss es ihm sagen. Allein bei dem Gedanken hat sie einen zentnerschweren Brocken im Hals.
»Bist du okay?«, fragt Ivan, als Milla das Wartezimmer betritt.
»Danke. Ich bin okay. Das Kind lebt.«
»Gott sei Dank.«
Instinktiv will Ivan Milla an sich drücken, gleichzeitig schreckt er davor zurück, als wäre sie auf einmal aus Porzellan und drohe bei der kleinsten Berührung zu zerbrechen.
»Kannst du mich zu Sandro nach Hause bringen? Ich fahre nicht nach Zürich. Ich werde bei ihm bleiben. Die Ärztin hat mir Bettruhe verschrieben. Bettruhe … ich!«
Ivan kommt nicht umhin, ein Lächeln zu unterdrücken. Es ist für ihn schlicht nicht vorstellbar, dass sich Milla auch nur eine halbe Stunde stillhalten kann. Seit vielen Jahren arbeitet er mit ihr zusammen. Sie nennt ihn stets ihren Lieblingskameramann – tatsächlich ist sie auch seine Lieblingsreporterin. Sie haben einiges miteinander durchgemacht, etliche heikle Situationen überstanden – ihr Hang zum Chaos hat die Dreharbeiten oft nicht gerade erleichtert, im Gegenteil. Doch mit niemandem sonst hat er so viele spannende Reportagen realisiert. Mit Milla an der Seite wird es einem zumindest nie langweilig.
Als sie nebeneinander im weißen Kastenwagen sitzen, auf dessen Seite das rote Logo des Schweizer Fernsehens prangt, wirft Ivan einen Blick zu ihr hinüber. Das, denkt er, wird jetzt womöglich vorbei sein. Ein Kind verändert alles. Falls es jemals das Licht der Welt erblickt.
»Ich muss Sandro informieren«, sagt Milla zum wiederholten Mal.
»Ruf ihn einfach an«, entgegnet Ivan, weil ihm nichts anderes einfällt. Den Anruf kann Milla niemand abnehmen, das muss sie schon selbst tun.
Sie seufzt, greift nach der Tasche und wühlt lange darin herum, bis sie ihr Handy findet. Milla gibt sich einen Ruck und stellt Sandros Nummer ein. Ein Summton, ein zweiter, ein dritter, dann das vertraute Klicken, wenn die Mailbox anspringt. Milla wartet auf den Piepston nach der Ansage.
»Sandro, Milla hier. Ich bin auf dem Rückweg von meiner Ärztin und fahre … Ivan bringt mich jetzt zu dir. Es ist … ich habe geblutet … aber es ist alles in Ordnung, du musst dir keine Sorgen machen, es ist nur, ich muss die Füße stillhalten. Die Ärztin hat mir Bettruhe verordnet. Es könnte … bitte ruf mich so schnell wie möglich zurück.«
Sie klickt den Anruf weg.
»Er ist nicht rangegangen?«
»Er ist bei der Arbeit.«
»Ich bring dich zu seiner Wohnung und kann bei dir warten, bis er nach Hause kommt.«
»Danke, das ist lieb, aber nicht nötig. Setz mich einfach bei ihm ab.«
»Bist du sicher?«
»Ganz sicher.«
»Und du hältst wirklich die Füße still? Legst dich sofort hin?«
»Mach ich. Mach ich.«
»Und keine Arbeit vom Bett aus?«
»Du hörst dich an wie meine Mutter.«
Ivan muss lachen.
In dem Moment spielt Millas Telefon den uralten Song Mama von Heintje, den sie zum Scherz für die Rufnummer ihrer Mutter als Klingelton eingestellt hat.
»Wenn man vom Teufel spricht … jetzt ruft sie tatsächlich gerade an.«
Milla lässt das Lied laufen, weil sie gerade jetzt in diesem Augenblick nicht mit ihr reden will. Sie muss sich zuerst selbst beruhigen, damit sie ihre Mutter nicht zu sehr beunruhigt. Sie würde ihr sofort anmerken, wie aufgewühlt sie ist. Milla wird sie später zurückrufen.
»Du gehst nicht ran?«
»Nicht jetzt.«
Das Telefon verstummt, nur um gleich wieder von Neuem Mama abzuspielen.
»Scheint dringend zu sein«, kommentiert Ivan.
Milla zögert. Ihre Mutter ruft nie zweimal hintereinander an. Es wird wichtig sein. Sie muss ihr ja nichts von dem Zwischenfall erzählen. Sie wird sich zusammenreißen. Milla räuspert sich und geht ran.
»Milla, zum Glück erreiche ich dich!«, ruft ihre Mutter aufgeregt. »Du musst sofort herkommen. Jetzt. Es ist dringend.«
Milla verdreht die Augen. Ihre Mutter hat einen Hang zum Drama. Selbst wenn sie höchst alarmiert klingt, heißt das noch lange nicht, dass auch wirklich höchste Alarmstufe herrscht.
»Mama, ich kann jetzt nicht. Ich rufe dich zurück, okay?«
»Nein, nicht okay. Du musst kommen. Jetzt!«
So sehr Milla ihre Mutter auch liebt … sie erträgt es schlecht, wenn sie einen Kommandoton anschlägt, als wäre Milla noch immer ein Kind, über das sie einfach so bestimmen kann.
»Mama, nein, ich kann jetzt nicht.« Millas Stimme klingt schärfer als beabsichtigt.
»Es ist etwas passiert.«
Hier auch, denkt Milla, mir ist auch etwas passiert.
»Ich bin gerade wirklich nicht imstande, zu dir zu kommen«, sagt sie, jetzt mit brüchiger Stimme, sie merkt, dass sie die Fassung zu verlieren droht.
»Es ist aber eine Katastrophe passiert!«
»Mama, bist du gesund und in Ordnung?«
»Ja, ja, ich bin gesund. Aber nichts ist in Ordnung. Ich brauche deine Hilfe. Es ist wirklich ganz, ganz dringend. Der absolute Notfall.«
»Was ist passiert?«
»Ich weiß nicht, ob ich das am Telefon sagen kann.«
»Mama!« Von wegen kein Stress, denkt Milla genervt. Nicht einmal die eigene Mutter lässt sie in Ruhe. »Jetzt rück schon damit raus!«
»Es ist … In meinem Bett liegt ein toter Mann.«
4
Der große Zeiger der Wanduhr springt auf zwölf. Es ist Punkt zehn, als Felix Winter die Tür hinter sich schließt. Sandro Bandini räuspert sich. Er weiß: Wenn Felix hier ist, sein ältester Mann im Team, dann sind alle da. Er könnte die Uhr nach ihm richten. Sandro tippt auf das Display seines Handys, das er vor sich auf den Tisch gelegt hat, eine Angewohnheit, um die Zeit zu prüfen, obwohl er sie ja gerade an der Wanduhr abgelesen hat. Er sieht, dass Milla versucht hat, ihn zu erreichen. Schlechtes Timing. Kurz nur streift ihn die Sorge, dass etwas nicht in Ordnung sein könnte. Seit sie schwanger ist, malt er sich auf einmal die schlimmsten Dinge aus, die seiner Freundin und dem ungeborenen Kind zustoßen könnten. Wahrscheinlich erwächst so etwas wie Vaterinstinkt in ihm. Oder aber es liegt an seiner Erfahrung, weil er Milla nach all den Jahren zu gut kennt; in ihrer manchmal ungestümen Art lotet sie oft Grenzen aus oder schießt darüber hinaus, dabei lässt sie sich zu seinem Leidwesen auch durch ihre Schwangerschaft nicht bremsen. Er müsste sie schon in die Arrestzelle einsperren, um sie im Zaum zu halten. Sandro muss über seinen absurden Gedanken schmunzeln. Er wird Milla später zurückrufen.
In dem Moment öffnet sich die Tür erneut. Malou Löwenberg streckt den Kopf herein, schlüpft durch die Tür, murmelt »Sorry« und setzt sich auf einen Stuhl ganz links außen. Sandro hat sich geirrt, sein Team war doch noch nicht komplett. Er hat einen Moment lang nicht mehr daran gedacht, dass Malou ab sofort mit dazugehört. Nach ihrem Sondereinsatz beim letzten großen Fall tritt sie heute ihre neue feste Stelle in der Abteilung Leib und Leben der Kantonspolizei Bern an. Fortan wird sich Sandro nicht mehr darauf verlassen können, dass Felix stets der Letzte ist. Malou scheint ihm den Rang abzulaufen.
Sandro blickt in die Runde.
»Guten Morgen, ich begrüße euch zur Teamsitzung. Insbesondere Malou heiße ich herzlich bei uns willkommen.«
Sandro stellt fest, dass seine Kolleginnen und Kollegen noch immer einen Platz unangetastet lassen: Ramons Stuhl. Eine schmerzende Lücke, das wird sich so schnell nicht ändern.
Links von Ramons ehemaligem Stuhl sitzt Bettina. Bettina, die sich die Schuld an Ramons Tod gibt, obwohl sie überhaupt nichts dafür kann. Um ein Haar hätte Sandro nach dem tragischen Vorfall auch Bettina als Mitarbeiterin verloren; nach dem gewaltsamen Tod ihres Partners wollte sie ihren Job aufgeben und die Karriere beenden. Zum Glück hat sie sich letztlich doch anders entschieden. Sandro möchte nicht auf sie verzichten müssen. Bettina hat nicht zu Unrecht den Spitznamen the brain verpasst bekommen; es gibt kaum etwas, das sie nicht weiß. Sie ist das wandelnde Lexikon im Team.
Zur rechten Seite des leeren Stuhls sitzt Felix Winter, der Dienstälteste, ein solider Ermittler, dessen Erfahrung wertvoller ist als eine Schatzkiste voller Gold. Ein paar Jahre sind es noch bis zu seiner Pension. Mit seiner ruhigen, fast väterlichen Art ist er Sandro, der vom Alter her sein Sohn sein könnte, immer wieder eine wichtige Stütze.
Neben Winter hat Florence Chatelat Platz genommen, die IT-Spürnase des Teams. Es gibt keine digitalen Spuren, die sie nicht findet, und keine Tricks, um sich Zugang in fremde Netzwerke zu verschaffen, die sie nicht kennt. Als Hackerin wäre sie längst Millionärin geworden. Ein Glück, dass sie sich für die andere Seite entschieden hat.
Sandro blickt nach links und nickt Malou zu. Sie sieht so gar nicht aus wie eine Polizistin; mit ihrem Zungenpiercing und dem knallrot gefärbten, wild gestylten Kurzhaarschopf könnte sie problemlos als Undercover-Ermittlerin in der linksautonomen Szene eingesetzt werden. Sie hat zuvor in der Drogenfahndung gearbeitet, hat es dort länger ausgehalten als andere, obwohl das Elend der Süchtigen niemanden kaltlässt. Nebenbei hat sie sich in Sachen Gewaltdelikte weiterbilden lassen und sich bei der Klärung des letzten Mordes, bei der sie kurzfristig Ramon ersetzt hatte, bewährt.
»Ich freue mich, Malou, dass du definitiv zu unserer Abteilung wechselst, ich hoffe, dass du dich bei uns wohlfühlen wirst und wir gemeinsam gute Arbeit leisten werden.«
Sandro hat beschlossen, die Zweier-Teams neu zu formieren. Er wird Malou nicht zur Partnerin von Bettina machen, sondern von Felix. Dafür arbeitet Florence neu mit Bettina zusammen. Felix wird Malou ein guter Mentor sein – und bei Florence und Bettina weiß Sandro, dass die Chemie stimmt.
Die Aufgabenliste der heutigen Sitzung ist schnell abgetragen; Sandro informiert seine Leute über den letzten Stand der Dinge in dem kürzlich abgeschlossenen Fall um die vermissten Kinder, bei dem noch einige Rechtshilfegesuche an die französischen Behörden ausstehen. Dann zeigt er auf die leere Magnetwand hinter sich und zuckt mit den Schultern: Derzeit gibt es keine laufenden Ermittlungen für das Dezernat Leib und Leben, die Abteilung, die sich um die schlimmsten Verbrechen kümmert, um Mord und Totschlag, um Sexualdelikte und schwere Körperverletzung. Sandro ist sich bewusst, dass es sich dabei bloß um die Ruhe vor dem nächsten Sturm handelt. Es scheint ein ungeschriebenes Gesetz zu sein, dass alle Verbrechen stets gleichzeitig geschehen und Sandro und sein Team an die Grenzen der Belastbarkeit bringen – oder aber dass Flaute herrscht, weil gerade gar nichts passiert.
Doch im Moment ist Sandro froh, dass er und seine Leute etwas durchatmen können. Das gibt ihnen etwas Zeit, um Liegengebliebenes aufzuarbeiten, Rapporte abzuschließen – und letztlich auch den Verlust von Ramon zu verarbeiten.
»Im Augenblick herrscht Ruhe«, sagt Sandro in die Runde. »Nutzt die Gelegenheit, um all das zu erledigen, wofür ihr sonst nie Zeit findet. Ich bin sicher, dass es bald wieder losgehen wird.«
In dem Moment klopft es an der Tür. Und obwohl es nie ein gutes Zeichen ist, wenn es während der Sitzung an der Tür klopft, müssen alle fünf über das perfekte Timing lachen.
Kollege Schmid steckt den Kopf herein und wedelt mit einem Papier.
»Das ist bei mir auf dem Pult gelandet, aber ich denke, es ist eher etwas für euch.«
Sandro greift nach der Notiz, bedankt sich und überfliegt das Schreiben, während sich die Tür hinter Schmid wieder schließt. Vier Augenpaare beobachten ihn dabei, wie er langsam nickt.
»Ich kümmere mich darum«, sagt er. »Keine große Sache. Ihr könnt euch an die Arbeit machen. Felix, zeigst du Malou ihren neuen Arbeitsplatz? Ihr hört von mir, sobald es etwas Neues gibt.«
Ihre Schritte klackern auf den steinernen Stufen und hallen durch die angrenzenden Flure, als Felix Malou nach der Sitzung durch das Treppenhaus in den zweiten Stock hinaufführt. Das Gebäude der Kantonspolizei Bern stammt aus den Siebzigerjahren. Nicht nur die Architektur erinnert an ein altes Schulhaus, es riecht hier auch so: Nach Putzmittel, Papier, verstaubten Holzschränken und kaltem Stein.
Zwei Stockwerke über dem Sitzungszimmer liegt das Großraumbüro der Abteilung Leib und Leben. Malou kennt sich hier schon aus; als sie in der Soko Fortuna ausgeholfen hatte, arbeitete sie bereits im Büro ihrer neuen Kollegen. Zu ihrer Überraschung sieht es noch genau gleich aus wie damals: Als wäre Ramon nie weg gewesen und komme gleich mit einem heißen Automatenkaffee um die Ecke.
»Wir haben dir sein Pult zugewiesen.« Felix zeigt in Ramons Ecke. »Die Männer von der IT waren schon da, der Computer sollte für dich eingerichtet sein. Behalte, was du brauchen kannst, alles andere kannst du in die Kiste legen.«
Malou schaut auf eine große Schachtel, die neben dem Schreibtisch auf dem Boden steht. Dann fällt ihr Blick auf eine gerahmte Fotografie neben dem Computer-Bildschirm. Eine lachende Frau, die den Kopf in den Nacken wirft und die Hand in Richtung des Fotografen ausstreckt. Es muss Ramon gewesen sein, der die Aufnahme gemacht hat, in einem Moment der Ausgelassenheit und des Glücks. Ein festgehaltener Augenblick aus einer anderen Zeit, den es so nie mehr geben wird.
»Seine Freundin?«, fragt Malou.
Felix Winter nickt. »Entschuldige, wir haben … Irgendwie hat niemand daran gedacht, den Schreibtisch aufzuräumen.«
Oder niemand hat ihn aufräumen wollen, denkt Malou. Laut sagt sie: »Ist schon in Ordnung.«
Obwohl sie es nicht in Ordnung findet. Es ist nicht ihre Aufgabe, in den persönlichen Gegenständen ihres verstorbenen Vorgängers zu wühlen, den sie nicht mal gut gekannt hat. Doch Malou schweigt und setzt sich auf den Stuhl. Sie stellt ihn zwei Stufen tiefer. Hält inne. Spürt, wie er sich anfühlt, ihr neuer Arbeitsplatz.
Danach zieht sie die oberste Schublade heraus, ein Kistchen voller Stifte, ein Kistchen mit Korrespondenz. Malou hebt beide heraus und legt sie in die größere Schachtel. Die Korrespondenz geht sie nichts an, auch will sie nichts behalten von ihrem Vorgänger, nicht die Schreibstifte, nicht die Post-it-Kleber, nicht das Lineal und auch nicht den Locher. Selbst das Mouse-Pad legt sie in die Kiste. In der unteren Schublade stößt Malou auf altmodische Hängeregister voller Dokumente. Sie überlegt, auch diese ungelesen in die Kiste zu legen, zögert aber; vielleicht befinden sich Notizen zu ungelösten Fällen darunter. Jemand wird das Material sichten müssen. Aber sie ist nicht die richtige Person. Sie wird es Sandro sagen, später. Malou begibt sich in den Pausenraum, in dem eine winzige Küche eingerichtet ist, und kehrt mit Putzmittel und Waschlappen zurück.
Während Malou den Staub der Zeit und die Erinnerung an den Tod beseitigt, die Ramons Schreibtisch anhaften, liest Sandro nebenan in seinem Chefbüro erneut die Meldung durch, die ihm Schmid übergeben hat. Eine Drohung ist eingegangen. Das Opfer ist niemand, den man kennt, kein Politiker, kein Name aus der Schweizer Cervelat-Prominenz, sondern ein einfacher Gemeindeangestellter, der sich gelegentlich als DJ versucht. Er heißt Jürgen Bräutigam und hat an diesem Morgen im Paketfach seines Briefkastens eine Fotografie von sich selbst gefunden, auf der er bei seinem Nebenjob als DJ zu sehen ist. Respektive eben nicht mehr zu sehen ist – denn an der Stelle seines Kopfes klafft ein Loch, in dem der Absatz eines abgetragenen Stöckelschuhs steckte. Kein Text, kein Absender, nur das Bild und der Schuh. Bräutigam hat sich ob des unerwünschten Geschenks jedoch sehr erschrocken und glaubt, dass es sich um eine Morddrohung handle, darum ist die Angelegenheit nun auf Sandros Tisch gelandet. Einen Verdacht, von wem sie stammen könnte, hat Bräutigam allerdings nicht. Sandro tippt auf eine verschmähte Geliebte oder auf eine Betrogene, bestimmt ist irgendeine Liebes- oder Sexgeschichte im Spiel. Er seufzt und beschließt, die Angelegenheit vorerst dem psychiatrischen Dienst weiterzureichen; er braucht dessen Einschätzung, ob es sich hier tatsächlich um eine Morddrohung handeln könnte und ob sie ernst genommen werden muss.
Sandro greift zum Handy und hört die Nachrichten auf seiner Sprachbox ab. Die letzte stammt von Milla. Während Sandro zuhört, erstarren seine Gesichtszüge. Ihm wird augenblicklich eiskalt.
Sie hat geblutet. Sie muss still liegen. Das Kind ist in Gefahr. Sein Kind!
Sandro hört Millas Stimme an, dass es ernst ist, obwohl sie mit ihren Worten gleichzeitig versucht, ihn zu beruhigen. Sie ist kein Mensch, der übertreibt und aus allem ein Drama macht, im Gegenteil.
Mit zitternden Händen stellt er Millas Nummer ein. Das Telefon klingelt ewig, dann geht der automatische Beantworter ran. Sandro ringt nach Luft.
»Um Himmels willen Milla, geh ran, bitte!«, sagt er laut.
Aus dem Hörer klingt Millas vertrauter Spruch: »Ich bin gerade weg. Aber Sie können, wie immer, nach dem Piepston eine Nachricht hinterlassen.«
»Milla, wo bist du?«, ruft Sandro. »Verflucht, wo steckst du? Ich komme sofort nach Hause, bitte melde dich, wenn du das hier hörst.«
Noch während er Milla aufs Band spricht, greift er zur Jacke und hastet los.
5
Nathaniel hat Carole und Silas gesagt, er brauche frische Luft. Das war nicht mal gelogen. Vor allem aber braucht er Abstand – zu Silas und dessen Party, zu den Kindern, die ausgelassen Geburtstag feiern wollen. Die Erinnerung an den letzten Kindergeburtstag, den er miterlebt hat – den letzten Geburtstag, den seine Schwester erlebt hat –, ist zu schwer, zu überwältigend. Dabei hatte er gedacht, das Trauma überwunden zu haben. So kann man sich täuschen. Auf einmal ist alles wieder da, er fühlt sich um Jahre zurückgeworfen.
Es gibt nur einen Menschen, dem er die ganze Geschichte anvertraut hat und mit dem er darüber reden kann. Alisha weiß genau, wohin sie unterwegs sind. Der Name Veronika genügte, um die Blindenhündin auf den richtigen Weg zu schicken. Etliche Jahre hat er im gleichen Haus gewohnt, nur eine Etage über Veronika, der Seniorin, die ihm weit mehr war als eine Nachbarin. Sie ist seine Freundin, auch wenn sie vom Alter her eher seine Großmutter sein könnte. Und irgendwie ist sie das auch, seine Ersatzgroßmutter, ihm, der keine Familie mehr hat.
Seine leibliche Familie ist gestorben, als sein Vater in einem psychotischen Wahn sie alle hat auslöschen wollen, auf die Mutter geschossen hat und auf seine Schwester, auch auf ihn geschossen hat, als er als elfjähriger Bub versucht hatte, sie alle zu schützen. Er hat seinen Vater in Notwehr mit dem Messer angegriffen und so schwer verletzt, dass am Schluss alle tot waren – außer Nathaniel selbst. Er hatte trotz eines Kopfschusses überlebt und war nach Monaten aus dem Koma erwacht, des Augenlichts beraubt und ohne Erinnerung an die Tat. Nur in seinen Träumen hat er sie wieder und wieder durchlebt, schemenhaft, traumatisch.
Eine automatisch generierte Frauenstimme verkündet Nathaniel, dass er bei der nächsten Station am Ziel ist. Der Bus stoppt, die Tür öffnet sich mit einem schmatzenden Geräusch, und als Nathaniel gemeinsam mit Alisha aussteigt, ist ihm sofort jeder Geruch wieder vertraut. Er riecht die Bäckerei an der Ecke, Teig und frisches Brot, die Velowerkstatt neben der Haltestelle, Gummi und Kettenöl, und die vier Glascontainer, die auf dem Gehsteig in den Boden eingelassen sind; abgestandener Alkohol. Hier riecht es wie in einer unaufgeräumten Dorfkneipe, wenn am Morgen nach einer durchzechten Nacht aufgeschlossen wird.
Alisha bellt einmal leise, als sie an der Tür des Mehrfamilienhauses angekommen sind, das einst ihr Zuhause war und in dem Veronika noch immer wohnt. Aus lauter Gewohnheit greift Nathaniel in seine Hosentasche, um den Schlüssel hervorzuklauben, bis ihm einfällt, dass er für diese Tür gar keinen Schlüssel mehr hat. Er tastet nach der Klingel, zählt von oben drei Knöpfe ab und drückt auf den vierten.
Er muss sich eine Weile gedulden, bis der Türsummer erklingt. Alisha beginnt so heftig zu wedeln, dass ihr ganzer Hintern wackelt und ihr Schwanz energisch gegen Nathaniels Beine klopft. Sie schafft es nicht stillzustehen, sondern will sich immer wieder um sich selbst drehen, was wegen des Geschirrs nicht gelingt. Alisha japst nervös, und kaum öffnet Nathaniel die Eingangstür, versucht die Hündin die Treppe hochzustürmen, sodass sie Nathaniel beinahe zu Fall bringt.
»Piano!«, ruft Nathaniel genervt, er kann sich heute nicht mit seinem Tier mitfreuen. Doch im selben Moment besinnt er sich; er muss sich zusammenreißen, er will nicht in einer solch üblen Laune über Veronika herfallen. Auch wenn sie am Telefon gesagt hat, er solle herkommen, als sie hörte, dass es ihm nicht gutgeht. Nathaniel ließ sich nicht zweimal bitten. Veronika ist die beste Zuhörerin der Welt, und das ist genau das, was Nathaniel jetzt braucht: jemand, mit dem er seine Sorgen teilen kann.
Nathaniel hört das Rascheln von Schlüsseln, gefolgt vom Öffnen der Wohnungstür. Als Alisha Veronika erblickt, bricht sie in ein Freudengeheul aus, das es mit jedem Katastrophenalarm aufnehmen kann. Veronika und Nathaniel versuchen, die Hündin zu beruhigen, erst als sie sich wieder einigermaßen gefasst hat, können auch sie sich richtig begrüßen.
Nathaniel will seine Nachbarin in die Arme schließen und verfehlt sie beinahe, weil sie so winzig ist und er ein Stück zu weit rechts steht. Sie tritt einen Schritt zurück, Nathaniel fühlt, dass sie ihn mustert.
»Nathaniel, du siehst schrecklich aus.«
Er hat ihre direkte Art immer gemocht.
»So fühle ich mich auch.«
»Sind die Träume zurück?«
Niemand kennt ihn so gut wie seine alte Freundin.
»Nein. Ich hatte einen Zusammenbruch. Ich habe das Bewusstsein verloren. Es war ein Flashback, schlimmer als der schlimme Traum.«
»Ach, Nathaniel.« Veronika umarmt ihn gleich noch einmal.
Als Nathaniel in die Wohnung tritt, riecht er den frischen Kräutertee und die Schokoladenkekse, die Trostkekse, wie Veronika sie nennt; auch die kann er jetzt gebrauchen. Ohne Stock und ohne Alishas Hilfe macht Nathaniel drei Schritte vorwärts ins Wohnzimmer, er kennt den Grundriss der Wohnung in- und auswendig, weil er jenem seines alten Zuhauses entspricht, und von den vielen Besuchen weiß er auch, wo Veronikas Möbel stehen. Er tastet nach der Lehne des Sofas und setzt sich.
Nathaniel vernimmt, dass sich auch Veronika hinsetzt, hört den Tee, der vom Krug in die Tassen plätschert.
»Er ist noch heiß«, warnt sie Nathaniel, als sie wie selbstverständlich seine Hand nimmt und ihm zeigt, wo seine Tasse steht, sie dann weiterführt zu der Schüssel mit den Keksen. Würde jemand die alte Frau und den nicht mehr ganz jungen Mann durch das Fenster beobachten, wäre er von dieser vertrauten Geste berührt.
»Was war der Auslöser?«
»Silas’ Geburtstag. Respektive die Feier, die wir für ihn und seine Freunde organisiert haben.«
»Warum?«
»Ich habe mit ihm Luftballons aufgeblasen. Und plötzlich zerfiel die Zeit zwischen den Zeiten, plötzlich war Silas nicht mehr Silas, sondern meine Schwester, und auch ich war wieder ein Kind, wir bliesen Luftballons für ihr Geburtstagsfest auf, wir waren aufgeregt und fröhlich und vergnügt. Zwei Tage später waren sie alle tot.«
Nathaniel fühlt Veronikas Hand, sie umschließt die seine.
»Du solltest die Geschichte endlich aufarbeiten, ich meine richtig, mit therapeutischer Begleitung, sie wird dich sonst immer wieder von Neuem einholen.«
»Ich habe ja darüber gesprochen. Mit dir, mit dem Polizisten Felix Winter, der mir genau geschildert hat, was in der Nacht passiert ist. Ich habe mich damit auseinandergesetzt.«
»Vielleicht genügt das nicht. Das, was du erlebt hast, ist das größte Trauma, das ein Kind erleben kann. Dein Gedächtnis hat das schreckliche Ereignis zwar gelöscht, aber in deinem Unterbewusstsein ist die Erinnerung noch immer vorhanden. Ich glaube, du brauchst professionelle Hilfe, um damit abschließen zu können. Auch Gundula zuliebe.«
Gundula.
Nathaniel will gerade einen Schluck Tee nehmen, doch mitten in der Bewegung hält er inne. »Vielleicht lag es auch an Gundula.«
»Was lag an Gundula?«
»Der Zusammenbruch. Dass ich den Kindergeburtstag nicht ertragen habe, dass alles wieder hochkam.«
»Warum?«
»Sie hat mir heute Morgen gesagt, dass sie sich ein Kind von mir wünscht. Aber das geht nicht. Ich will kein Kind. Das ist zu viel, zu eng, zu nah. Ihr Wunsch hat mich gestresst.«
Wieder drückt Veronika Nathaniels Hand. »Der Gedanke macht dir Angst.«
»Ja. Was, wenn ich krank werde wie mein Vater? Was, wenn ich meiner Familie etwas antun würde? Oder wenn ich das Kind auf eine andere Art und Weise verlieren sollte? Noch einmal meine Familie zu verlieren, das könnte ich nicht ertragen. Das würde mich zerstören.«
»Hast du dir die Akten eigentlich damals von jemandem vorlesen lassen?«
»Die Akten zum Fall?«
»Ja.«
»Nein.«
»Warum nicht?«
»Felix Winter hat mir ja alles erzählt, er hat mir genau geschildert, was geschehen ist. Dass mein Vater unter paranoider Schizophrenie gelitten und Stimmen gehört hatte, die ihm befahlen, uns alle umzubringen. Dass er meine Mutter angegriffen hat, dass er auf sie und meine Schwester geschossen hat, dass ich mir das Messer gegriffen habe und auf ihn losgegangen bin, dass er danach auch auf mich schoss. Dass er verblutet ist und dass sie mich haben retten können. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn auch ich gestorben wäre.«
»Sag das nicht. Ich bin froh, dass du nicht gestorben bist. Du hast so viel schon geschafft. Und du bist ein wunderbarer Mensch.«
»Danke.«
Nathaniel weiß, dass Veronika es gut mit ihm meint. Aber es hilft nichts. Er kennt die Stimmung, in die er abzugleiten droht, kennt sie zu gut aus seiner Vergangenheit, diese zentnerschwere Traurigkeit, die alles umschließt und das Leben dumpf macht, die alles leer und sinnlos erscheinen lässt.
»Ich finde, du solltest dir die Akten ansehen. Ich kann mitkommen und sie dir vorlesen.«
»Was soll das bringen?«
»Du hast dich bis jetzt mit oberflächlichen Erklärungen zufriedengegeben. Ich denke, du müsstest dich eingehend mit der Tat auseinandersetzen. Damit du deine Ängste ablegen kannst, ein für alle Mal.«
Nathaniel nickt, obwohl er nicht sicher ist, ob die Akteneinsicht ihm hilft. Und obwohl er ganz sicher ist, dass er keine Therapeutin aufsuchen wird. Zu viele Therapieversuche hat es in seiner Kindheit und in seiner Jugendzeit gegeben, alle haben nichts gebracht – weil er nicht über etwas reden konnte, an das er sich nicht erinnerte.
»Soll ich für uns einen Termin bei der Polizei vereinbaren, damit sie uns Akteneinsicht geben?«, fragt Veronika nun.
»Danke, schon gut, ich kann Felix Winter fragen.«
»Nein, nicht Winter.« Nathaniel erkennt in Veronikas Stimme eine Schärfe, die ihn überrascht und ihn ahnen lässt, dass Widerspruch zwecklos ist.
»Warum nicht Felix Winter?«
»Wegen meinem Bauchgefühl.«
»Deinem Bauchgefühl?«
»Ich habe in meinem langen Leben gelernt, dass man auf die Stimme im Bauch hören muss, nicht auf jene im Kopf, denn die erzählt einem manchmal den größten Mist. Zu oft fällt man auf sie herein. Die Stimme im Bauch hingegen ist eine miserable Lügnerin, darum hält sie sich an die Wahrheit. Leider ist die Stimme im Bauch viel leiser als jene im Kopf, die mitten zwischen den Ohren sitzt. Darum muss man immer gut hinhören.«
»Und was sagt deine Stimme im Bauch genau?«
»Dass etwas an der Geschichte, die Felix Winter dir erzählt hat, nicht stimmt.«
6
Milla muss dreimal lange auf den Klingelknopf drücken, bis sie aus der Wohnung ein vertrautes Geräusch vernimmt. Es ist das leise Schaben der kleinen Metallklappe hinter dem Türspion, das sie hört. Sie guckt mit einem Auge hinein und sieht nur schwarz. Wohl weil sie direkt in das Auge ihrer Mutter blickt.
Da hört sie hinter der Tür jemanden ihren Namen flüstern.
»Milla?«
»Ja, ich bin’s, lass mich rein.«
Die Tür öffnet sich einen Spaltbreit, Millas Mutter packt sie am Arm, zerrt sie hinein und schließt die Tür sofort wieder.