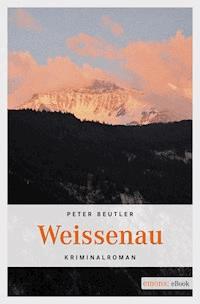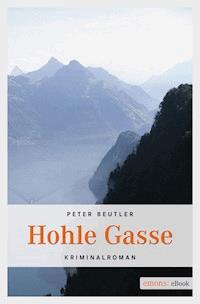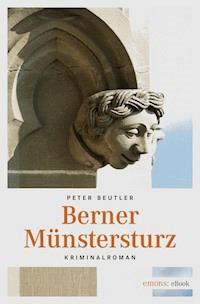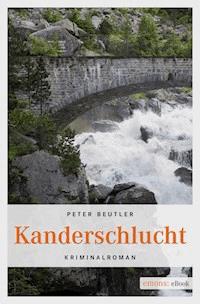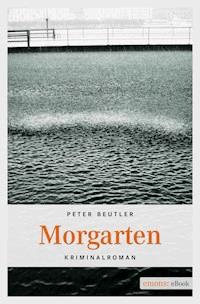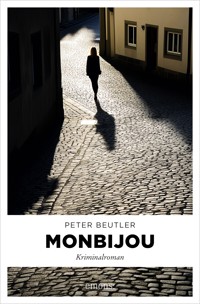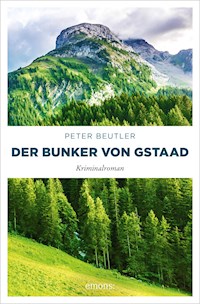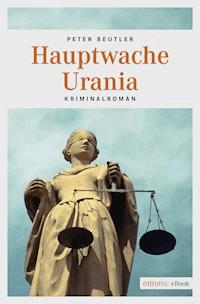12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Emons Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Roman, der die Schweizer Geschichtsschreibung in Frage stellt. Glänzend recherchiert und hochexplosiv. Restaurator Benjamin Am Bach wird in seinem Haus am Brienzersee erschossen aufgefunden. Motive und Verdächtige für den Mord gibt es zuhauf, denn er war als kritischer Bürger nicht von allen geliebt. Bewundert wurde hingegen sein künstlerisches Geschick: Er konnte malen wie kein Zweiter – und täuschend echte Fälschungen anfertigen, wie die polizeilichen Ermittlungen ergeben. Ein Talent, das bereits sein Vorfahr aus jener Zeit besass, als der Schweizer Bundesbrief erstellt wurde ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Dieses Buch ist ein Roman. Dennoch sind einige Personen nicht frei erfunden, sondern existierten wirklich. Ihre Handlungen beruhen auf einem historischen Hintergrund. Im Anhang befinden sich ein Personenverzeichnis und ein Glossar.
© 2022 Emons Verlag GmbH
© 2022 Peter Beutler
Alle Rechte vorbehalten
Umschlagmotiv: mauritius images/Patrick Frischknecht/imageBROKER, shutterstock.com/Jaro68
Umschlaggestaltung: Nina Schäfer, nach einem Konzept
von Leonardo Magrelli und Nina Schäfer
Umsetzung: Tobias Doetsch
E-Book-Produktion: CPI books GmbH, Leck
ISBN 978-3-7408-1616-2
Originalausgabe
Unser Newsletter informiert Sie
regelmässig über Neues von emons:
Kostenlos bestellen unter
www.emons-verlag.de
Dieser Roman wurde vermittelt durch die Agentur Altas, Bern.
Die handgreifliche Geschichtslüge
Es ward gedacht eines neuen Astrologi, der wollte beweisen, dass die Erde bewegt würde und umginge, nicht der Himmel oder das Firmament, Sonne und Monde; gleich als wenn einer auf einem Wagen oder einem Schiffe sitzt und bewegt wird, meinete, er sässe still und ruhet das Erdreich aber und die Bäume gingen um und bewegten sich. Aber es gehet jtzt also: wer da will klug seyn, der soll ihm nichts lassen gefallen, was Andere machen, er muss ihm etwas Eigens machen, das muss das Allerbeste seyn, wie ers machet. Der Narr will die ganze Kunst Astronomiae umkehren. Aber wie die Heilige Schrift anzeiget, so hiess Josua die Sonne still stehen, und nicht das Erdreich.
Martin Luther
1
Benjamin Am Bach sass am Küchentisch und blätterte in der Zeitung. Draussen war es bitterkalt, ein leichter Nebel lag über Ringgenberg, dem grossen Dorf am unteren Ende des Brienzersees, dessen nördlichste Häuser am Steilhang der Roteflue bis fast zweihundert Meter über dem Wasser reichen. Jemand klopfte ans Fenster. Das war ungewöhnlich. Benjamin sah erstaunt auf. Warum ging der Besucher nicht zur Haustür und betätigte die Glocke? Das Licht der starken Lampe, die unter dem Dach angebracht war, erhellte dessen Gesicht. Es war ein nicht mehr junger Mann, ungefähr im Alter wie er. «Den kenne ich doch. Aber warum taucht er zu dieser Unzeit auf und klopft ans Fenster?», brummte Benjamin. Er machte mit seiner Rechten eine Bewegung, um den Mann aufzufordern, an der Stelle um Einlass zu bitten, die dafür vorgesehen war. Doch der Mann schien das nicht zu verstehen. Als Benjamin aufsah, schaute er unvermittelt in den Lauf einer Pistole, der genau zwischen seine Augenbrauen gerichtet war.
***
Die Polizisten vom Posten Interlaken trafen ein, nachdem ein Nachbar gemeldet hatte, vier Schüsse aus der Richtung des Hauses Am Bachs gehört zu haben. Kurz vorher war eine Rauchmeldung eingegangen, darum kümmerte sich ein Kollege, der morgen in die Skiferien wollte, und derweil die Feuerwehr.
Die Polizisten stellten an der Leiche drei Einschusslöcher fest. Eines an der Stirn, zwei an der Schädeldecke. «Plausibel», sagte der Streifenpolizist gegenüber Pressevertretern zwei Stunden später. Die erste Kugel sei in die Stirn eingedrungen und wahrscheinlich bereits tödlich gewesen. «Der Kopf ist danach auf die Tischplatte gefallen. Um sicherzugehen, dass das Opfer nicht mehr lebt, hat der Täter zwei weitere Schüsse abgefeuert, die sich vom mittigen Scheitel in sein Gehirn bohrten. Über die Todesursache besteht also kein Zweifel. Vom Täter fehlt derzeit noch jede Spur. Weitere Zeugen, die etwas vom Vorfall mitbekommen haben, gibt es offenbar nicht. Man hat die Umgebung weiträumig abgesucht und alle Anwohner der Gartenstrasse, an der das Opfer wohnte, befragt. Gehört habe man die Schüsse schon, gaben mehrere an, doch etwas gesehen haben wollte niemand.»
Wie es nun weitergehe, wollte eine Journalistin der Lokalzeitung wissen. «Der Fall wird an die Kriminalpolizei in Bern weitergereicht und dort dem Dezernat ‹Leib und Leben› zugeteilt. Die Spurensicherung wird ausgewertet, eine Mordkommission zusammengestellt und Weiteres.»
Ein anderer Journalist gab sich noch nicht zufrieden. Er fragte, ob die Mithilfe der Bevölkerung erwünscht sei.
«Natürlich dürfen sich Leute, die etwas beobachtet haben oder Informationen über das Umfeld des Opfers geben können, auf der Polizeiwache Interlaken melden.»
Am nächsten Morgen erschien in den Medien folgende Meldung:
Die Kriminalpolizei des Kantons Bern teilt mit: Am Donnerstagabend, 8. Februar 2018, wurde kurz vor neunzehn Uhr in Ringgenberg ein Mann in seiner Wohnung erschossen. Am 9. Februar, 11:00 Uhr, findet im Schloss Interlaken eine Medienkonferenz über dieses Verbrechen statt.
Etwas ausführlicher wurde in der lokalen Presse über diesen Mord berichtet. Dass der Täter, von dem vorläufig noch jede Spur fehle, vom Garten aus Schüsse auf einen älteren Mann abgefeuert habe. Der Streifenpolizist, der als Erster am Tatort eintraf, wurde zitiert. Den Namen des Opfers nannte er nicht, erklärte aber, seine Identität sei bekannt.
Ab halb zwölf am Mittag wurde in den Onlinemedien Näheres über das Tötungsdelikt veröffentlicht.
«Beim Opfer handelt es sich um den 74-jährigen Benjamin Am Bach, gelernter Holzbildhauer, Kunstrestaurator, Schauspieler, ehemaliger Radioredaktor und Fernsehmoderator. Die Suche nach dem Täter hat noch keine brauchbaren Ergebnisse geliefert», gab der Sprecher der Berner Kantonspolizei bekannt.
***
Im Dezernat «Leib und Leben» liefen bereits am Freitag die Ermittlungen auf Hochtouren. Ein Mordbüro mit dem Namen «Benjamin Am Bach» wurde eröffnet. Mit der Leitung wurde Luca Bassi betraut. Er war bereits fünfundzwanzig Jahre bei der Kriminalpolizei Bern.
Bassi standen zehn Fahnder aus dem Berner Oberland zur Seite.
Die erste Sitzung fand um vier Uhr nachmittags in der Staatsanwaltschaft Berner Oberland, an der Scheibenstrasse 11 in Thun, statt. Zugegen war auch Staatsanwältin Rosa Baer. Es war unfreundliches Wetter, der Himmel war wolkenverhangen, eine Bise fegte durch die Gassen der Stadt.
Bassi begrüsste mit knappen Worten die Anwesenden. «Meine Damen und Herren, ich habe euch bereits heute Mittag in einer Mail das, was wir über diesen Mord wissen, mitgeteilt. Neues ist seither nicht dazugekommen. Das Wesentliche kurz zusammengefasst: Wir haben noch keine Ahnung, wer der Täter ist. Die Vermutung liegt auf der Hand, dass er und das Opfer sich gekannt haben. Benjamin Am Bach war eine bekannte Persönlichkeit, die eine Ausstrahlung weit über das Oberland hinaus hatte.»
Die Fahnder bekamen ihre Aufgaben. Zwei wurden mit der Auswertung der gesicherten Spuren betraut. Eine andere Gruppe, bestehend aus Polizisten der näheren Umgebung von Ringgenberg, wurde beauftragt, Leute aus der Nachbarschaft des Opfers zu befragen. Ortskundige Polizisten mussten sich mit dem persönlichen Umfeld Benjamin Am Bachs befassen und mit seiner Biografie vertraut machen. «Liebe Leute, beginnt gleich heute mit eurer Arbeit. Wir treffen uns am kommenden Donnerstag zur gleichen Zeit wieder hier.»
Nicht nur in Ringgenberg, auch um den ganzen Brienzersee samt den Bödeligemeinden Interlaken, Unterseen, Matten, Bönigen und Wilderswil war der Mord an Benjamin Am Bach das dominierende Gesprächsthema. Dadurch erfuhren die Stammtische eine vorübergehende Aufwertung. Fahnder besuchten sie: einer in Ringgenberg, einer in Oberried, zwei an Treffpunkten in Brienz und je einer in Iseltwald und in Bönigen.
Im «Bären» in Ringgenberg wurde enorm viel erzählt. Sozusagen alle wollten Benjamin Am Bach gekannt haben. Einige mochten ihn und gaben an, mit ihm befreundet gewesen zu sein.
Eigentlich sonderbar, dachte Polizist Krenger, denn Benjamin Am Bach war kein geselliger Typ. Im Gegenteil. Er sass ganz sicher nie am Stammtisch, in Ringgenberg nicht, auch in den Nachbargemeinden nicht.
Es gab auch welche, die an Benjamin Am Bach keinen guten Faden liessen. Ein arroganter, abweisender, von sich eingenommener Kerl sei er gewesen, der die einfachen Leute verachtete und eine tiefe Abneigung hatte, sich unters Volk zu mischen, der gegen Publikumsmagnete wie das Greenfield- oder Trucker-Festival wetterte, sich nicht zu schade war, die Schweizer Luftwaffe mit dem Militärflugplatz Meiringen in den Dreck zu ziehen. «So einer muss sich nicht wundern, wenn einem aufrechten und patriotischen Schweizer einmal der Kragen platzt und er zur Waffe greift», lallte ein ziemlich betrunkener Gewerbler und Vorstandsmitglied des örtlichen Schützenvereins.
Sein Nebenmann zupfte ihn am Ärmel und zeigte auf Krenger. Doch der Wutbürger liess sich von seinen Hasstiraden nicht abbringen. «Was macht plötzlich dieser Schafseckel hier? Verpiss dich, Krenger, du Sauhund!»
Das kam nicht bei allen gut an. Einige wehrten sich für den Polizisten und zählten von da an den Oberschützen zum Kreis der Verdächtigen.
Krenger zweifelte, dass der Schützenvereinsvorstand zu einer solchen Tat fähig wäre. Um sicherzugehen, liess er den Wirt rufen. Der tauchte sofort auf, bot Krenger an, den Stammtischsäufer aus dem Lokal zu weisen. «In den letzten Tagen sass er jeden Abend hier und liess sich volllaufen.»
«Auch am Donnerstag, den 8. Februar?», erkundigte sich Krenger.
«Ja, vom späten Nachmittag bis zur Polizeistunde um halb eins.»
Damit war für Krenger klar: Der Oberschütze konnte nicht der Mörder sein. Krenger ging mit leeren Händen nach Hause. Keiner am Stammtisch im «Bären» hatte die geringste Ahnung, wer Benjamin Am Bach erschossen hatte.
So ähnlich lief es an den anderen Stammtischen – mit einer Ausnahme: dem im «Rössli» von Oberried. In Oberried war Benjamin Am Bach aufgewachsen. Seine Eltern betrieben dort einen kleinen Bergbauernhof. In der Gemeinde kannten alle eingesessenen Familien die Am Bachs und Benjamin, auf den viele immer noch stolz waren.
Adrian Brawand, Leiter der Fahndung im Fall Benjamin Am Bach, kannte sich in Oberried gut aus. Er war ebenfalls dort aufgewachsen. Und wenn es sich machen liess, besuchte er seine Heimatgemeinde, traf sich mit alten Freunden und Bekannten im «Rössli». Das tat er auch am 14. Februar 2018, einem Mittwoch. An diesem Tag besuchten viele Einheimische die Gaststube, denn Montag und Dienstag war das Restaurant geschlossen.
Aus unerfindlichen Gründen für Brawand schnitt kein Stammtischteilnehmer das Thema Mord an Benjamin Am Bach an. Brawand musste ein wenig nachhelfen. Er sah Arnold Krummen mit zusammengekniffenen Augen an. «Du, Dachdecker, bist du nicht froh, dass dein Intimfeind von uns gegangen ist?»
Fast schien es Brawand, Krummen sei bleicher geworden. «Halt doch deinen Latz, Tschugger. Diese Geschichte interessiert mich nicht.»
«Wo warst du am Donnerstagabend um neunzehn Uhr?»
«Das geht dich gar nichts an. Dieses Zimmer hier ist kein Vernehmungsraum der Schmier.»
«Stimmt. Aber –»
«Du scheinst nicht zu verstehen. Ich will von der ganzen Sache nichts hören. Lass mich in Ruhe damit.» Krummen stand auf und verliess schwankend das Lokal. Als er die Tür hinter sich zugeschmettert hatte, meldete sich ein anderer, der auch schon zünftig über den Durst getrunken hatte. «Das scheint unser Kripomann noch nicht zu wissen. Krummen sass am Donnerstagabend von fünf bis sechs hier. Er kam so gegen acht zurück.»
«Tatsächlich?», fragte Brawand.
Zwei weitere Stammtischler bestätigten diese Aussage.
«Danke, wir werden der Sache nachgehen», versprach Brawand. Dann blickte er auf die Uhr. «Das hätte ich fast vergessen. Ich habe in einer halben Stunde noch einen Termin auf dem Bödeli und muss mich deshalb verabschieden.»
«Mit einer Runde kannst du das wiedergutmachen», erwiderte, die hohle Hand machend, einer der Tischgenossen und erntete Beifall.
Brawand legte dreissig Franken darauf und bemerkte: «Das dürfte gerade knapp reichen.»
Brawand rief Bassi an, und dieser gab Rosa Baer Bescheid. Die Staatsanwältin fand, die Meldung aus Oberried sei es wert, sofort zu handeln. Eine Stunde später waren Bassi und Brawand an der Scheibenstrasse in Thun, wo Baer sie erwartete. Sie stellte einen Haftbefehl gegen Krummen aus, der gleich zu vollziehen sei.
Um zehn Uhr abends wurde Krummen in seiner Wohnung in Oberried festgenommen. Die beiden Polizisten, die mit dieser Aufgabe betraut wurden, mussten den stark Alkoholisierten zwischen sich nehmen und ihn stützend zum Streifenwagen schleppen. Als sie ihn eine Dreiviertelstunde später im Regionalgefängnis Thun ablieferten – Bassi, Baer und Brawand waren auch zugegen –, war allen klar, dass man mit einer Vernehmung bis frühestens am kommenden Morgen warten musste.
Eine Woche nach der Tat, um acht Uhr, begann das Verhör im Regionalgefängnis Thun. Bassi leitete es. Zunächst machte er Krummen darauf aufmerksam, dass er Anrecht auf einen Anwalt habe. Ob er einen Vorschlag habe. Krummen zuckte mit den Achseln, dann schüttelte er den Kopf.
«Kein Problem, wir werden Ihnen einen Anwalt zur Verfügung stellen. Das kostet Sie nichts.»
«Muss das sein?»
Bassi sah zu Baer hinüber. Diese nickte.
«Ja, Herr Krummen, seit dem 1. Januar 2011 haben Beschuldigte das Recht auf einen ‹Anwalt der ersten Stunde›, Sie sollten darum ersuchen. Das ist zu Ihrem Schutz. Üblicherweise wird von diesem Recht nicht Gebrauch gemacht. Der Anwalt darf mich darauf hinweisen, wenn ich Fragen stelle, die Sie einschüchtern könnten, oder solche, die man als Vernehmer nicht stellen darf. Wir sind angehalten, uns fair gegenüber den Verhafteten zu benehmen.»
Krummen sah Bassi nur hilflos an. Dann kamen ihm die Tränen. «Ich gebe es zu. Ich habe den Schopf angezündet. Ich war sternhagelvoll.»
«Wie bitte?», fragte Bassi.
«Es stimmt, ich habe das Häuschen abgefackelt. Es war wertlos, hätte ohnehin abgerissen werden sollen.»
«Wo?»
«An der Hagenstrasse in Ringgenberg, ganz in der Nähe des Parkplatzes.»
Bassi warf Brawand einen Blick zu. «Kannst du mir da helfen?»
Brawand begann zu lachen. «Es gibt dort ein Gartenhäuschen. Ein ziemlich neues. Am besten ist es, wenn ich gleich bei der Polizeiwache Interlaken nachfrage. Die können mir genau sagen, wann sie am Donnerstag, 8. Februar, nach Ringgenberg ausgerückt sind. Brandmeldungen gehen immer auch an die Polizei.»
Er ging in einen Nebenraum und kam nach knapp zwei Minuten zurück. «Der Brand wurde um achtzehn Uhr neunundvierzig gemeldet, um neunzehn Uhr elf war die Polizei vor Ort, Momente danach die Feuerwehr. Das kleine Gebäude stand im Vollbrand. Man entschloss sich, es abbrennen zu lassen. Die Asche wegzuschaffen sei einfacher, als eine verkohlte Hütte zu entsorgen.»
Baer grinste zufrieden. Sie sah Krummen an. «Wie viel kostet ein Bahnbillet von Thun nach Ringgenberg?»
Krummen wusste es nicht.
Baer fuhr ihren Laptop hoch. Tippte etwas ein. «Haben Sie ein Halbtags-Abo?»
Krummen fragte zurück: «Warum sollte ich so etwas haben?»
Baer griff wieder in die Tasten.
Dreiundzwanzig Franken kostete dieser Spass. Baer zog ihr Portemonnaie aus der Gesässtasche, öffnete es, zog daraus eine Zwanzigernote und drei Einfränkler, legte das Geld neben ihren Laptop. Sie schrieb in Blockschrift auf ein A4-Blatt eine Quittung und reichte sie Krummen zur Unterschrift.
Krummen unterschrieb mit zittrigen Händen.
Baer sah Krummen abschätzig an. «Das kommt vom Saufen. Nehmen Sie das Geld und verlassen Sie den Raum.»
«Danke», brummte Krummen und machte sich schnell davon.
Bassi und Brawand sahen mit erstaunten Mienen zu. «Sind Sie sicher, Frau Staatsanwältin, dass Krummens Unschuld schon feststeht?»
«Es ist überhaupt nicht sicher. Aber ich kann die Untersuchungshaft nur anordnen, wenn der Verdacht, dass Arnold Krummen Benjamin Am Bach erschossen hat, genügend erhärtet ist. Das ist keineswegs der Fall. Wenn Sie mir den nächsten Kunden anliefern, überprüfen Sie ihn bitte vorher sorgfältiger.»
Baer erhob sich ächzend, schritt zur Tür, riss sie auf und schmetterte sie hinter sich zu.
Brawand und Bassi sahen einander verdutzt an.
«Warum ist sie so eingeschnappt? Sie hat doch ohne Rückfrage den Haftbefehl ausgestellt», fragte Bassi.
«Baer weiss eben nicht alles. Sie traut Krummen nicht zu, dass er kurz nacheinander einen Schopf anzündet und dann Benjamin Am Bach erschiesst. Aber Krummen wäre dazu durchaus imstande.»
«Wirklich?»
«Ja, Krummen ist nicht dumm. Er ist ausgebildeter Primarlehrer, Bergführer, Skilehrer …»
«Und Dachdecker …»
«Dass er nicht mehr unterrichtet, ist auf einen Vorfall, der schon vor mehreren Jahrzehnten stattfand, zurückzuführen. Was damals geschehen ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Er hat überraschend gekündigt, und von da an hat er jede Schulstube gemieden.»
«Dachdecker ist sicher nicht seine Lieblingsbeschäftigung. Nachdem er den Lehrerberuf an den Nagel gehängt hatte, wollte er Schauspieler werden. Er wurde in der Schauspielschule Zürich aufgenommen, doch nach anderthalb Jahren verliess er sie wieder – ohne Abschluss.»
«Und seine Alkoholsucht?»
«Er hatte schon immer eine Schwäche dafür. Aber zum Alkoholiker ist er erst geworden, als er Dachdecker zu seinem Hauptberuf machte.»
«Was sollen wir jetzt tun?», fragte Bassi.
«Wir müssen ihn weiter im Auge behalten.»
«Genau. Aber das ist von nun an deine Aufgabe.»
Die Büros von Bassi und Brawand waren an der Allmendstrasse 18 in Thun. Sie arbeiteten fast jeden Tag dort, waren allerdings oft auf Achse. Hielten sich bisweilen in Bern bei der Kantonspolizei am Waisenhausplatz oder auf dem Posten Interlaken, direkt gegenüber dem Bahnhof Ost, auf.
Heute waren sie beide in Thun. Brawand trat in Bassis Büro. «Du hast mich zu dir gerufen. Steht etwas Dringendes an?»
«Nichts Besonderes, das Übliche.»
Auf Bassis Schreibtisch schrillte das Telefon. Seufzend hob er ab. «Guten Tag, Frau Staatsanwältin, danke, dass Sie anrufen …»
Telefonate mit der Staatsanwaltschaft waren nie kurz. So ging Brawand zum Büchergestell. Ihm fiel ein grosses, dickes Buch mit einem alten Einband auf.
VIKTOR GUGGISBERG
DIE GESCHICHTE DER AM BACHS
MARKTGASSE-VERLAG
Bern, 1910
Brawand zog den alten Schmöker heraus. Er war grossformatig und schwer. Brawand blätterte darin. Das Buch war reich bebildert mit Zeichnungen und Schwarz-Weiss-Fotos, umfasste etwa fünfhundert Seiten.
Endlich war Bassi mit dem Gespräch zu Ende. «Tut mir leid, Adrian, nun hast du fünf Minuten warten müssen …»
«Es waren fünfzehn. Aber das Warten war keines. In dieser Zeit habe ich unendlich viel erfahren.»
«Aus diesem verstaubten Wälzer? Ich habe noch gar nicht hineingeschaut.»
«Hättest aber sollen. Wie bist du eigentlich zu ihm gekommen?»
«Das fragst du? Ich dachte, du hättest ihn mir zugehalten. Ein Spurensucher brachte ihn mir am Tag nach dem Mord.»
«Das war eine Abkürzung des Dienstwegs. Gut, dass ich dieses Buch nun in Händen halte. Die Geschichte der Am Bachs. Der umgebrachte Benjamin war der Letzte dieser Dynastie. Dynastie ist vielleicht hoch gegriffen. Aber immerhin, der Stammvater lebte in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts.» Brawand ging zum Schreibtisch und legte das Buch vor Bassi.
Bassi las den Umschlag. «Viktor Guggisberg? Sagt dir dieser Name etwas?»
«Nein. Doch ich habe dem Nachwort entnommen, dass der Autor, ein Dr. phil.-hist., Privatdozent an der Universität war.»
«Und der Marktgasse-Verlag?»
«Davon habe ich nie etwas gehört.»
«Wenn du möchtest, nimm diesen Band mit.»
«Das werde ich liebend gerne tun.»
«Glaubst du, diese Lektüre könnte zur Aufklärung des Mordfalles Am Bach beitragen?»
«Ich weiss es nicht, aber zum Vornherein möchte ich das nicht ausschliessen.»
Brawand nahm das Buch mit nach Hause und las die halbe Nacht darin. So spannend fand er es.
2
Der Stammvater der Familie Am Bach wurde im Sommer 1250 geboren.
Jeremias wuchs in Trub auf. Trub war wegen des um 1100 eröffneten Klosters der bedeutendste Ort im oberen Emmental. Jeremias fiel dort dem Abt als aufgeweckter und intelligenter Junge auf. Er verschaffte ihm einen Platz in der Klosterschule Disentis, wo er Griechisch und Latein erlernte. Er sollte Geistlicher werden, was sich zerschlug, da er ein Mädchen schwängerte. Der Konvent des Klosters Disentis liess den jungen Jeremias nicht fallen. Sein Wissen und seine Talente sollten weiterhin einer kirchennahen Institution dienen. Kirchennah war Werner II. von Attinghausen-Schweinsberg, der viele Ländereien besass und sowohl zum Kloster Disentis wie zu dem von Trub enge Beziehungen pflegte. So bekam Jeremias die begehrte Stelle des Kammerschreibers des Freiherrn im Turm zu Attinghausen im Kanton Uri.
Jeremias stürzte sich in die ihm zugeteilte Arbeit und erlangte damit viel Einfluss und Macht. Das Verfassen von Texten war nur ein Teil seiner Tätigkeit. Der andere: Die Fäden der Verwaltung der Landgüter Attinghausens liefen in seinen Händen zusammen. Die Landgüter befanden sich im Oberwallis, im westlichen Teil Rätiens, in Uri und im Emmental. Ganze Familien standen als Leibeigene im Dienste Attinghausens. Jeremias lehnte zwar das Halten von Leibeigenen ab, doch in den ersten Jahren seiner Tätigkeit als Kammerschreiber wagte er es noch nicht, seinem Herrn diese Bedenken vorzutragen.
Das Schreiben war sowohl geistig wie körperlich anspruchsvoll. Das Handwerk hatten ihm die Mönche und die Patres in Disentis beigebracht. So gut, dass er darin ein Geschick entwickelte, das das seiner Lehrer übertraf. Er schrieb an einem steil geneigten Stehpult. Die Hand bewegte er frei, allenfalls an der Tischfläche auf den kleinen Finger gestützt. Er hielt die Feder zwischen Mittel-, Zeigefinger und Daumen. Der ganze Arm bewegte sich bei starr gehaltenem Handgelenk.
Seine Familie wuchs stetig. 1280 bestand der zehnjährige Hausstand aus den Eltern und sechs Kindern. Dann starb Ehefrau Irmgard am Kindbettfieber.
Ein halbes Jahr später vermählte sich Jeremias erneut. Die Mädchen und Buben brauchten schliesslich eine Mutter. Und eine Frau fand sich schnell, denn Jeremias lebte in guten Verhältnissen, in einem grossen, noblen Haus, und sein Amt als Kammerschreiber des mächtigsten Herrn im Lande Uri war ehrenvoll und gut entlohnt. Die neue Angetraute, Hedwig, entstammte einer einflussreichen Grossbauernfamilie. Äusserlich reichte sie nicht an ihre Vorgängerin, aber sie brachte eine beachtliche Mitgift mit. Weitere Kinder wurden geboren, jedes Jahr eines. Bei ihrer fünften Geburt ereilte Hedwig das gleiche Schicksal wie Irmgard.
1286 heiratete Jeremias seine dritte Frau, ebenfalls aus gutem Haus. Die Kinderschar wuchs auf dreizehn an. Doch Jeremias hatte längst keine Zeit mehr, sich um seinen Nachwuchs zu kümmern. Die Arbeitsbelastung steigerte sich stetig, doch nicht sein Einfluss. Immer mehr hinterfragte er den Sinn seines Lebens. Trotz seiner angesehenen Stellung blieb er der Diener des mächtigen Werner von Attinghausen.
Ein Jahr nach seiner dritten Heirat, im Wonnemonat Mai, zitierte der Freiherr Jeremias in sein Gemach, im Wohnturm zu Attinghausen. Vor knapp fünfzig Jahren hatte sich Freiherr Ulrich von Schweinsberg, der Vater Werner von Attinghausen-Schweinsbergs, hier niedergelassen. Der war ein Spross einer adeligen Familie aus dem oberen Emmental, das zum Einflussbereich der Zähringerstadt Bern zählte. Und weil dem Zuzüger von Schweinsberg aus dem Bernbiet der Name Attinghausen gut gefiel, nannte er sich nach dem Domizilwechsel selbst von Attinghausen.
Die Besitzungen im Oberwallis drohte Werner von Attinghausen-Schweinsberg zu verlieren, da die Bischöfe von Sitten sich daranmachten, ihre Hand darauf zu legen. Sie stammten alle aus Adelshäusern, hatten eine eigene Truppe und führten auch Kriege innerhalb des Reichs, das intern heillos zerstritten war. Um seine Ansprüche in Erinnerung zu rufen, entschied sich Attinghausen, mit einer Hundertschaft Landsknechte seinen Ländereien westlich der Furka einen «Besuch» abzustatten, auch um den Zehnten einzutreiben, der im vergangenen Jahr nicht eingegangen war. Die Truppe anführen musste einer, der unter Umständen mit dem Bischof verhandeln konnte, einer, der der deutschen und lateinischen Sprache mächtig war – in Wort und Schrift. Attinghausen konnte nicht schreiben, lateinische Texte verstand er auch nicht. Es gab in Uri nur eine Person, die in der Lage war, einen solchen Zwergfeldzug anzuführen, war Attinghausen überzeugt: Jeremias Am Bach.
Anfang Juli 1287 verliess der Tross unter Jeremias Am Bach Attinghausen in Richtung Gotthardpass. Mehrere Dutzend Reiter, eine Handvoll einachsiger Wagen, ein halbes Hundert Landsknechte, insgesamt an die hundertfünfzig Mann. Bewaffnet mit Hellebarden, Morgensternen, Wurfspeeren, Dolchen und Armbrüsten. Zu überwinden war zuerst die Schöllenenschlucht. Das war gemäss mehreren Überlieferungen der Walser, die das obere Wallis besiedelten, möglich. Diese hatten in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts zwei wichtige Reussübergänge geschaffen. Die Twärrenbrücke und die Teufelsbrücke.
Jeremias brauchte mehrere Tage, bis er die Passhöhe der Furka erreichte, ohne nennenswerte Zwischenfälle. Es folgte der Abstieg entlang des Rhonegletschers nach der kleinen Häusergruppe Gletsch. Man kam nun ins Einzugsgebiet der Ländereien Attinghausens. Weiter unten im Tal der Rhone, die in ihrem obersten Teil Rotte heisst, stiess der Tross auf die Siedlung Superiori Waldt.
Jeremias erschrak, als er die ersten Bewohner erblickte. Die Nacht brach an, vor den Häusern brannten Holzfeuer. Die Menschen erwärmten sich daran, denn es herrschte für die Jahreszeit eine ungewöhnliche Kälte. Die meisten von ihnen, vor allem die Kinder, waren abgemagert. Sie hatten offensichtlich Hunger. Mit müden, fast teilnahmslosen Blicken betrachteten die Einheimischen die Landsknechte und die Reiter.
Jeremias fragte: «Wo ist der Dorfälteste?»
Sie wiesen auf eine Hütte, etwa hundert Meter weiter unten im Tal.
Ein betagter Mann stand davor. Jeremias begrüsste ihn freundlich und erklärte, wer er sei.
«Herr, seid gegrüsst.» Der Alte deutete einen Bückling an. «Sie kommen wohl wegen dem Zehnten. Doch wir haben nichts.»
Jeremias sah den Dorfältesten unschlüssig an. Überlegte einige Augenblicke. «Wo ist das Gotteshaus, ich möchte mit dem Priester dort sprechen.»
«Herr, da müsst Ihr weiter das Tal hinunterreiten, erst in Musterium findet ihr eine Pfarrkirche. Der Geistliche reitet wöchentlich einmal zu uns herauf, um die Toten auf dem Gottesacker zu segnen, damit sie begraben werden können. Es sterben derzeit viele Menschen. Das vergangene Jahr war schlecht, auch das vorangegangene. Wir konnten keine Vorräte anlegen. Jetzt verhungern wir. Fast alle Kühe und Geissen sind geschlachtet. Sie gaben keine Milch mehr.»
«Wer hat das Schlachten angeordnet?»
«Ich», antwortete der Alte.
Jeremias biss sich auf die Lippen. Fast kleinlaut stellte er die nächste Frage. «Wer hat euch das erlaubt?»
«Niemand. Ich sehe es als meine Aufgabe an, zu verhindern, dass hier alle Menschen sterben. Und übrigens: Wen hätte ich fragen sollen?»
«Den Geistlichen natürlich, er ist der Einzige, dessen Leib nicht dem Herrn von Attinghausen gehört.»
Ein Lächeln überzog das Gesicht des Alten. «Hätte ich das getan, wäre der Priester in eine unangenehme Lage gekommen. Hätte er Nein gesagt, wäre er wohl von der darbenden Bevölkerung Superiori Waldts gelyncht worden. Hätte er meinem Vorschlag zugestimmt, wäre er mit Sicherheit von den Schergen Attinghausens in Ketten gelegt worden.»
«Betrachtet Ihr mich als Schergen Attinghausens?»
Der Alte streckte sein Kinn nach vorn. Sein böser Blick durchbohrte Jeremias. «Unsere Vorfahren vor hundert Jahren waren noch dem König direkt unterstellt. Wir hatten ihm zu gehorchen. Doch der tauchte nie auf. Wir fühlten uns frei. Dann kamen die von Schweinsberg, rissen sich unser Land unter den Nagel und haben uns versklavt. Sklaven halten ist ein Verbrechen. Doch von Attinghausen wird dereinst auch seinen Richter finden.»
«Alter, Ihr redet gefährlich. Von Attinghausen ist ein Herr von Gottes Gnaden.»
Angewidert schüttelte der Alte den Kopf. «Da ist weder etwas von Gott noch von Gnade vorhanden. Ihr habt, Herr Jeremias Am Bach, die Macht, mich zu fesseln, mich zu foltern und zu töten. Ich werde sowieso nicht mehr lange leben. Aber ich möchte in Würde, nicht als Leibeigener sterben.»
Jeremias stieg auf das Pferd und ritt davon. Das Tal hinab. Die Truppe folgte ihm. Vor einer flachen Wiese hielt er. «Hier errichten wir ein Lager, stellt die Zelte auf und bereitet das Mahl zu.»
«Gut, wir werden Vieh aus den Ställen treiben und es schlachten, die Häuser nach Essbarem durchsuchen und es beschlagnahmen.»
«So nicht, Hauptmann. Die Truppe wird aus den mitgebrachten Vorräten verpflegt. Diese reichen noch für viele Tage. Das ist ein Befehl.»
Der Hauptmann fluchte leise, drehte sich auf dem Absatz um.
Jeremias wies ihn an zu warten. «Der Hauptmann sorgt dafür, dass die Landsknechte nicht auf die Idee kommen, Frauen und Mädchen zu vergewaltigen. Keiner Menschenseele hier wird ein Härchen gekrümmt.»
Hämisch grinste der Hauptmann. «Warum denn? Das sind doch Leibeigene. Und überhaupt, warum habt Ihr den Dorfvorsteher nicht umgebracht? Der Freiherr würde diese Milde niemals gutheissen.»
«Will mir der Hauptmann etwa Verhaltensregeln erteilen? Er gehe jetzt zur Truppe und führe meine Befehle aus.»
Als Führer der Truppe stand Jeremias ein eigenes Zelt zu. Es wurde für einige Tage eingerichtet. Eine schwere Kiste mit Kleidern, Seife, Nachttopf, ein grosses Becken für Wasser, Tücher, Schreibzeug, Pergament, ein grosser, mit Stroh vollgestopfter Sack, als Nachtlager bestimmt, und ein Tisch mit einem Sessel wurden hineingetragen.
Vor dem Eingang schichteten die Knechte einen Holzstoss auf und entzündeten ihn. Jeremias kniete davor, um seine vor Kälte erstarrten Hände zu wärmen. Danach schrieb er einen Brief an den Bischof in Sitten. Darin bat er um ein Gespräch. Zwei Meldereiter bekamen den Auftrag, ihn dem Kirchenfürsten zu überreichen. Sie brachen am späten Abend auf, hoffend, im Laufe des kommenden Tages den Bischofssitz zu erreichen. Um die ganze Nacht durchreiten zu können, wechselten sie im Marktflecken Briga die Pferde.
Im Laufe des Vormittags erreichten die Meldereiter den Bischofspalast. Sie wurden sogleich zu Pierre d’Oron, einem würdigen Herrn im fortgeschrittenen Alter, vorgelassen. Er schlug ein Treffen für den übernächsten Tag um die Mittagszeit in der Kirche Glis, einen Kilometer südwestlich von Briga, vor. Im Morgengrauen des kommenden Tages waren die Reiter im Lager unterhalb von Superiori Waldt zurück.
Jeremias machte sich auf den Weg und traf zum vereinbarten Zeitpunkt in Glis ein. Der Bischof erwartete ihn bereits.
Jeremias überreichte d’Oron ein Schreiben mit der Unterschrift Werner von Attinghausens. Jeremias war über den Inhalt informiert, hatte er ihn doch im Auftrag des Freiherrn zu Pergament gebracht. Er machte darin das Angebot, dem Gottesmann seine Leibeigenen aus Superiori Waldt für Frondienste zur Verfügung zu stellen. D’Oron war das zu wenig, womit Attinghausen und Jeremias auch gerechnet hatten. Er brauche die Leute in Sitten, in Goms nützten sie ihm wenig.
Das könne er gut nachvollziehen, meinte Jeremias und machte den zuvor mit Attinghausen abgesprochenen Vorschlag, dem Bischof zwanzig Leibeigene zu schenken. Unter der Bedingung allerdings, dass Attinghausen alle Ländereien im Oberwallis weiterhin unbehelligt bewirtschaften könne.
Das gefiel d’Oron schon besser, doch auch er knüpfte eine Bedingung daran. «Ich mag die Habsburger nicht. Das dürfte ebenso für meine Nachfolger gelten. Und ich weiss aus zuverlässigen Quellen, dass auch der Freiherr nichts von ihnen hält. Bald wird König Rudolf, der habsburgische Herrscher des Heiligen Römischen Reiches, das Zeitliche segnen. Er ist in meinem Alter. Richtet Attinghausen aus, bei der nächsten Königswahl soll er seine Beziehungen spielen lassen. Es muss vermieden werden, dass der nächste König wieder ein Habsburger sein wird.»
Jeremias nickte und lächelte. D’Oron erfasste Jeremias’ Rechte und bestätigte, es solle gelten.
Aufgeräumt ritt Jeremias mit seiner Entourage ins Lager von Superiori Waldt zurück, blieb dort noch einige Tage, bis sich das Wetter besserte, und machte sich mit seinem Tross auf den Weg nach Attinghausen zurück.
In Attinghausen berichtete Jeremias dem Freiherr vom Treffen mit dem Bischof und musste eingestehen, dass er keinen Zehnten der Gomser Güter heimbringe. Mit dem ersten Bescheid war der Freiherr höchst zufrieden, das mit dem Zehnten ärgerte ihn, doch er liess es durchgehen, da er den erfolgreichen Handel mit dem Bischof als weit wichtiger einstufte.
Die Eindrücke seiner Reise ins Wallis liessen Jeremias nicht los. Die Leibeigenschaft seines Herrn machte ihm zu schaffen. Es war nicht nur die in Goms, auch die im Gebiet um Disentis. Dessen Reichsfürst war der Abt des Klosters. Dieser liess allerdings den Besitzern von Ländereien grosse Freiheiten. Von Attinghausen unterhielt auch in Uri zahlreiche Leibeigene. Für Jeremias bestand kein Zweifel, dass er sie schamlos ausbeutete. Für den Freiherrn waren diese menschlichen Wesen auf der Stufe von Haustieren. Als besonders bedauerlich empfand er, dass es im Lande mehrere Gutsbesitzer gab, einheimische, nicht adeligen Ursprungs, die ihre Knechte und Mägde zu Sklaven machten. Sie nahmen offensichtlich den Freiherrn als Vorbild und stellten vor ihren Namen oft ein «von».
Jeremias war auf dem besten Weg, selber Gutsbesitzer zu werden. Er hatte ein Beziehungsnetz aufgebaut, das ihm mit der Mitgift seiner verstorbenen Frauen und der noch lebenden erlaubte, grosse Landstücke zu erwerben. So würde auch er zu Leibeigenen kommen. Doch das ging ihm wider den Strich. Er erinnerte sich an seine Kindheit als Spross eines grossen Bauern in Trub. Auch dort im Emmental gab es Gutsbetriebe, deren Eigner Leibeigene hielten. Sein Vater hatte von seinen Knechten und Mägden allerdings nie verlangt, dass sie ihn um Erlaubnis baten, um heiraten zu dürfen. Er gestattete ihnen auch, von seinem Hof wegzuziehen und bei einem anderen Bauern anzuheuern. Es wäre ihm zudem nie in den Sinn gekommen, seine Bediensteten für Frondienste einzuspannen oder sie körperlich zu züchtigen. Jeremias hatte den Eindruck, die Knechte und Mägde arbeiteten gerne auf dem Hof seines Vaters.
Anders auf dem Gut Attinghausens. Die grimmigen Mienen der Dienstboten verrieten, dass sie nicht aus freien Stücken hier waren, dass sie in ständiger Angst vor Schlägen der Aufseher lebten. Was nach Beobachtungen von Jeremias zur Folge hatte, dass sie weniger gut arbeiteten. Er brachte diesen Missstand in einer der wöchentlichen Zusammenkünfte mit von Attinghausen zur Sprache.
Von Attinghausen sprach: «Jeremias Am Bach, nehme er sich in Acht. Es steht ihm nicht zu, solche aufrührerischen Vorschläge zu machen. Er ist von mir, dem Freiherrn von Gottes Gnaden, eingesetzt, um meine Güter zu verwalten. Er soll sich um diese Angelegenheiten kümmern.»
Von Attinghausen beäugte Jeremias mit stechendem Blick. «Ich will doch hoffen, der Jeremias Am Bach hat verstanden, was ich meine.»
Von Attinghausen hielt inne, den Blick nicht von Jeremias abgewandt. «Wir in Uri sind frei. Das Land Uri wie die anderen Waldstätte sind Teil des Heiligen Römischen Reichs. Wir anerkennen den König. Das fällt uns leicht. Er lässt uns walten und schalten. Es muss ja nicht immer ein Habsburger sein. Das Sagen in Uri hat der Landammann. Gewählt von der Landsgemeinde. Die Landsgemeinde besteht aus den Grundbesitzern. Wir, von Attinghausen, besitzen die grössten Ländereien und haben den grössten Einfluss in der Landsgemeinde. Aber kein Grundeigentümer schreibt dem anderen vor, wie er seine Untergebenen zu behandeln hat. Und erst recht geht das einen Verwalter einen Dreck an.»
Niedergeschlagen ging Jeremias in sein Haus, unweit vom Turm zu Attinghausen. Er besprach das Anliegen, das er von Attinghausen vorgebracht hatte, mit seiner Frau. Sie antwortete: «Schreib doch ein Buch, in dem du deine Erkenntnisse und Anliegen festhältst. Dies überlässt du dem Kloster Einsiedeln als Leihgabe. Das Kloster Einsiedeln steht im Gegensatz zum Freiherrn von Attinghausen auf gutem Fuss mit König Rudolf von Habsburg, was bedeutet, dass von Attinghausen keinen Zugriff auf dieses Buch haben wird.»
Jeremias fand diesen Vorschlag gut und begann zu schreiben. In zwei Exemplaren. Im Dezember 1290 war er damit zu Ende. Ein Buch bewahrte er an einem sicheren Ort zu Hause auf, das andere übergab er dem Fürstabt von Einsiedeln.
Dass Jeremias ein Buch schrieb, hängte er nicht an die grosse Glocke. Doch dieses Unterfangen blieb auch nicht geheim. Einige Bedienstete im Haus Am Bach hatten Kontakt zu Bediensteten im Turm zu Attinghausen. Und so erhielt von Attinghausen davon Kenntnis.
Von Attinghausen erfuhr schliesslich, dass ein Exemplar des Buches von Jeremias in den Beständen der Bibliothek des Klosters Einsiedeln war. Jedem Geistlichen aus den Waldstätten war es erlaubt, den Lesesaal des Klosters Einsiedeln zu besuchen, um dort ein Buch aus der Bibliothek zu lesen.
Von Attinghausen liess den Priester der Pfarrkirche von Altdorf zu sich kommen, der ihm freundschaftlich verbunden war. Er bat ihn, einen schreib- und lesekundigen Geistlichen zu engagieren, dieses Buch zu lesen und davon Notizen zu machen.
Im März hielt Attinghausen eine Abschrift des lateinisch geschriebenen Buches in Händen. Die Abschrift war eine alemannische Übersetzung, sodass von Attinghausen sie verstehen konnte. Nach der Lektüre war er empört. «Ein umstürzlerisches Manifest», schimpfte er. «Ich will noch in diesem Jahr Jeremias Am Bach am Galgen hängen sehen.» Danach schickte er einen Boten zum Präsidenten des Landgerichts, Doctor iuris von Reding. Dieser bat um ein Treffen am Sitz des Gerichts in Altdorf und legte das in Leder eingebundene Buch unsanft auf den Besuchertisch in Redings Suite.
Reding vertiefte sich in das gut hundertseitige Dokument. Es war mit winzigen Buchstaben, aber gestochen scharf geschrieben. Dann hatte er sich ein Urteil darüber gebildet und liess von Attinghausen zu sich kommen.
Das Treffen kam Anfang April 1291 zustande. Von Attinghausen wurde in das Gästezimmer geleitet, wo ihm Wein, Wurst, Käse und Brot aufgetischt wurden, um eine kleinere Wartezeit zu überbrücken.
Als Attinghausen hereingebeten wurde und im Türrahmen auftauchte, schüttelte Reding sein Haupt. «Ein heller Kopf, dieser Jeremias Am Bach. In seinem Innersten ein Rebell. Wir müssen ihm Einhalt gebieten.»
Attinghausen stierte Reding an. «Einhalt gebieten? Nur Einhalt gebieten?»
Reding schmunzelte. «Es wäre nicht ratsam, Jeremias Am Bach wegen dieses Pamphlets in Ketten zu legen. Gäbe es einen Prozess deswegen, würden sich die unfreie Bauernschaft und sämtliche Leibeigenen hinter ihn stellen. Das könnte zu einem Aufstand führen. Wir müssen einen anderen Weg finden.»
«Einen anderen Weg? Welchen denn?», fragte Attinghausen gereizt.
«Mein lieber von Attinghausen, das Schriftstück Jeremias Am Bachs ist durchaus interessant. Natürlich ist es gefährlich, und ich möchte so wenig wie Sie, dass es irgendwann umgesetzt wird. Aber das kann es auch, sollte Jeremias Am Bach mit dem Tod bestraft werden, denn die im Kloster Einsiedeln werden Ihnen ganz sicher nicht den Gefallen tun, Ihnen das lateinische Original auszuhändigen. Nein, als Freunde der Habsburger haben die Klosterbrüder von Einsiedeln ihre helle Freude daran, dass es in Uri Leute gibt, die Ihnen, von Attinghausen, Probleme machen könnten. Kommt dazu, dass einige vom Schlage König Rudolfs durchaus nicht daran interessiert sind, wenn Lokalfürsten Leibeigene halten. Sie mögen es nicht, wenn der niedere Adel zu fest im Sattel sitzt. Das bedeutet einen Machtverlust der Herzöge und des Königs.»
Attinghausen wurde zunehmend ungeduldiger. «Das kann ich ja alles nachvollziehen. Aber was raten Sie mir?»
«Eigentlich wäre es an Ihnen, diesen Vorschlag zu machen.»
Attinghausen zuckte mit den Schultern.
«Gut, ich hätte eine Lösung, Jeremias Am Bach stillzulegen.» Von Reding zog ein Stück beschriebenes Pergament aus seiner Rocktasche und reichte es Attinghausen. «Lesen Sie es zu Hause, in aller Ruhe. Ich fasse Ihnen den Vorschlag in gesprochenen Worten zusammen: Erstens. Ich werde vorläufig keinen Haftbefehl gegen Jeremias Am Bach ausstellen. Zweitens. Ich schicke Ihnen einen Doctor des Handels und der Geldwirtschaft. Er wird die von Jeremias Am Bach geführten Bücher unter die Lupe nehmen. Auch der beste Gutsverwalter kann kein Buch ohne Gesetzesübertretung führen. Er wird zwangsläufig gegen das kirchliche Recht verstossen. Die christliche Lehre verbietet zum Beispiel, Zinsen einzufordern. Das ist nur bei Juden toleriert. Klar doch, von Attinghausen, auf Ihren Gutsbetrieben werden Pachtzinsen erhoben. Damit der Doctor ungestört seinen Ermittlungen nachgehen kann, müssen Sie Jeremias Am Bach auf eines Ihrer Güter ausserhalb Uris schicken. Am besten nach Disentis.»
Attinghausens Miene wurde immer zufriedener. Plötzlich verfiel er in ein lautes Gelächter. «Von Reding, wer hätte das gedacht? Sie sind ein abgebrühter Halunke. So etwas wäre mir nie eingefallen. Ich bin Ihnen zu grossem Dank verpflichtet.»
«Drittens. Ich werde aufgrund des Berichts des Doctors eine Anklage gegen Jeremias Am Bach erheben. Wegen Betrugs oder Wucher zulasten der unfreien Pächter. Das wird gelingen und erlaubt, ihn dem Volkszorn auszusetzen. Kein Bauer wird wegen des Todesurteils gegen Am Bach auch nur den Mund verziehen.»
Noch am selben Tag kehrte von Attinghausen auf seinen Wohnturm zurück.
Am folgenden Morgen liess Attinghausen Jeremias Am Bach zu sich kommen und erkundigte sich in freundlichem Ton nach den Geschäften.
«Da müsste ich Ihnen die Bücher bringen. Ich habe nicht alle Zahlen im Kopf.»
So genau wolle er das gar nicht wissen. Eine ungefähre Übersicht genüge ihm. Jeremias unterbreitete ihm diese mündlich. Attinghausen gab sich hochzufrieden.
«Wenn es die Wetterverhältnisse zulassen, wäre eine Inspektion des Gebiets von Disentis fällig.»
«Gerne», antwortete Jeremias. «Ich werde Ihnen Bescheid sagen, wenn es so weit ist.»
Anfang Mai brach Jeremias in Begleitung von mehreren Dutzend Landsknechten nach Disentis auf und erstattete nach der Rückkehr Attinghausen in dessen Turm Bericht.
Als er wieder zurück in seinem Arbeitszimmer war, erwarteten ihn zwei bewaffnete Gerichtsdiener. «Jeremias Am Bach, Sie sind verhaftet.»
Jeremias wurde kreidebleich. «Wie bitte? Was soll ich denn verbrochen haben?»
Der eine reichte ihm ein beschriebenes Pergament. «Sehen Sie es sich selbst an. Ich bin des Lesens unkundig.»
Jeremias wurde in Handfesseln gelegt, auf ein Pferd gesetzt, dort festgebunden und mit einem Trupp von berittenen Soldaten nach Altdorf gebracht. Seiner Bitte, sich noch von seinen Angehörigen verabschieden zu dürfen, wurde nicht entsprochen.
Wie ein Lauffeuer verbreitete sich in Attinghausen die Kunde von der Festnahme des Kammerschreibers Jeremias Am Bach. Dass eine wichtige Persönlichkeit, wie er es war, in die Mühlen der Justiz geriet, war nicht alltäglich. Eine Flut von Gerüchten folgte, die sich über allen Waldstätten ausbreitete.
Der Prozess gegen Jeremias Am Bach wurde auf Mitte Juli 1291 festgesetzt. Er war nicht öffentlich. Jeremias erhielt keinen Verteidiger. Er wurde vom Landgericht unter dem Vorsitz von Redings schuldig gesprochen und zum Tode durch den Strang verurteilt. Die Anklagepunkte: Verstoss gegen die kirchliche Strafbestimmung und Selbstbereicherung zulasten des Freiherrn von Attinghausen. Die Hinrichtung wurde für den 1. August 1291 auf der Rütliwiese angesetzt.
Der Vollzug des Todesurteils war öffentlich. Eine Ansammlung von gut tausend Menschen, Alte, Junge und Kinder, wohnten dem Spektakel bei. Vor der Exekution wurde der Verurteilte am Rad, einem Folterinstrument, festgebunden. Mit einer Kurbel drehte der Scharfrichter das Rad auf eine hohe Geschwindigkeit. Man hörte dabei, wie die Knochen brachen. Danach wurde das sich vor Schmerzen windende und stöhnende Opfer zum Galgen gezerrt und nach allen Regeln der Kunst aufgeknüpft. Wie lange der Gehängte noch lebte, interessierte niemanden.
Die Festgemeinde wurde zu einem Gelage eingeladen und tat sich an Würsten, Brot und Wein gütlich und war des Lobes voll über den Landammann, das Landgericht und die Noblen Uris.
Die wenigsten hatten ihn bemerkt. Ein Mönch aus dem Orden der Benediktiner in einer schwarzen Kutte. Er kniete vor einer Steinplatte, die er als Schreibunterlage benutzte. Neben sich ein Tintenfass, einen Gänsekiel und ein grosses rechteckiges Stück Pergament, auf das er Skizzen und Notizen machte.
Einer der Wache haltenden Landsknechte mit einem umgehängten Schwert trat auf ihn zu und klatschte mit gereizter Miene in die Hände. Der Benediktiner runzelte die Stirn und schüttelte den Kopf.
«Wir mögen die Leute aus dem Kloster Einsiedeln nicht», raunzte der Aufseher.
«Gott vergebe Euch und Euren Freunden», offenbarte der Benediktiner. Sein Gesichtsausdruck verriet beissenden Spott.
«Ich möchte sehen, was Ihr da auf das Pergament hingeschmiert habt.»
«Das ist Euch unbenommen. Tretet hinzu und seht es Euch an.»
Der Wächter tat das und wollte das Pergament an sich nehmen. Doch der Mönch war schneller, er schob das Schriftstück behände unter seine Kutte. «Wäscht er sich zuerst die Hände. Aus ihnen tropft immer noch Blut, das Jeremias Am Bach vergossen hat, als er ihn an den Galgen zerrte.»
Zornig drehte sich der Landsknecht auf dem Absatz um und entfernte sich raschen Schrittes. Die Augen des Ordensmanns folgten ihm. Der Landsknecht eilte zu Landammann Arnold von Silenen, der sich gerade mit dem Freiherrn von Attinghausen unterhielt.
Dann kicherte der Mönch. Nicht sehr laut, aber gut vernehmbar für von Attinghausen und seinen Gesprächspartner.
Der Wächter berichtete den beiden Herren wortreich vom Frevel des Benediktiners. Danach berieten sich Attinghausen und Silenen. Silenen befahl: «Landsknecht, lege den Benediktiner in Ketten und schlepp ihn zu uns.»
Es dauerte eine Weile, bis der Wächter sich zurückmeldete, mit leeren Händen. Die angeordnete Suche nach dem Mönch blieb erfolglos.
Drei Stunden später trafen sich von Attinghausen, der Landammann von Silenen und Gerichtspräsident von Reding in der nobelsten Schenke von Altdorf. Nicht in der Gaststube, sondern in einem separaten Zimmer.
«Ich bin Euch beiden verpflichtet, Herr Landammann und Herr Präsident des Landgerichts. Alles geht heute auf meine Kosten.»
«Wir nehmen das gerne an, Freiherr von Attinghausen. Aber ein gespendetes Essen genügt uns noch nicht. Was sind Eure Pläne bezüglich der Unabhängigkeit der Waldstätte von den Habsburgern?»
«Ich wünsche die Habsburger zum Teufel. Aber noch sind wir nicht so weit. Die Waldstätte sind nach wie vor Hoheitsgebiet der Habsburger. Und diese Hochadeligen scheuen sich nicht, zu perfiden Machenschaften zu greifen, um ihre Macht über Uri, Schwyz und Unterwalden zu erhalten und allenfalls sogar noch auszubauen. Sie machen sich daran, die Leibeigenen und die unfreien Bauern gegen uns aufzuhetzen. Leibeigene und Unfreie garantieren Wohlstand und innere Stabilität.»
Von Silenen und von Reding nickten heftig.
«Doch wie wollt Ihr den Habsburgern die Stirn bieten?», warf Reding ein.
«Die Feinde unserer Feinde sind unsere Freunde. Die aufkommenden Städte Bern, Luzern, Zürich und die Savoyer stehen auf Kriegsfuss mit den Habsburgern. Wir schliessen Allianzen mit den Städten und den Savoyern. Doch das reicht nicht. Wir in den Waldstätten müssen die Anzahl der Gutsbesitzer vergrössern, ihnen Adelsrechte verleihen. Eine neue Elite heranziehen. Deren Repräsentanten wählen den Landammann. Wenn wir stark genug sind, brauchen wir keinen König mehr.»
Silenen lachte spitzbübisch und stellte eine Frage in den Raum. «Brauchen wir vielleicht auch noch Untertanengebiete?»
Attinghausens Augen wurden glänzend. «Klar doch. Ich sage Euch, in absehbarer Zeit werden die Waldstätte Untertanengebiete haben, die das Mehrfache ihrer derzeitigen Fläche ausmachen.»
«Mein lieber von Attinghausen», warf Silenen ein. «Mir scheint, Ihr seid vom Grössenwahn befallen.»
Attinghausen streckte den Finger in die Höhe. «Das braucht natürlich Zeit. Doch ich sage Euch voraus, in einigen Jahrzehnten wird Uri die Leventina erobern. Schwyz und Unterwalden werden uns folgen und weiter nach Süden vorstossen, so lange, bis die Waldstätte sich das gesamte Tessin unter den Nagel gerissen haben.»
Da kam ein Meldeläufer und überreichte dem Landammann ein Schreiben. Dieser las es, was ihm offensichtlich Mühe bereitete. Nach einigen Minuten reichte er es Attinghausen. Der hatte den Inhalt wesentlich schneller erfasst und gab es Reding weiter. Dieser las das in Alemannisch verfasste Dokument laut vor.
Die Kreuzritterstadt Akkon im Heiligen Land ist am 18. Mai 1291 gefallen. Akkon war die noch letzte verbleibende Bastion des Königreichs Jerusalem …
Der Text ging noch zwanzig Zeilen weiter. Doch damit konnten die Zuhörer kaum etwas anfangen.
***
Der erste Sohn von Jeremias Am Bach, Jeremias der Jüngere, liess sich von der erlittenen Unbill nicht kleinkriegen. Er zog sich in seine angestammte Heimat, nach Trub, zurück. Er übernahm das grosse Bauerngut seines Grossvaters, gründete eine Familie und war ein geachteter Mann. Das Emmental war habsburgisches Hoheitsgebiet unter den Grafen von Neu-Kyburg. Werner von Attinghausens Verwandte, die Herren von Schweinsberg, hatten kaum mehr Einfluss im Emmental und mussten Jeremias Am Bach junior unbehelligt lassen.
Jeremias der Jüngere war bei der Hinrichtung seines Vaters anwesend gewesen. Dabei war ihm das Tun des Einsiedlermönches nicht entgangen. Er sah in ihm einen Verbündeten gegen die Feudalherren von Uri. Jeremias der Jüngere wusste, dass das Buch seines Vaters in den Beständen der Stiftsbibliothek des Klosters Einsiedeln sicher verwahrt war. So begab er sich im Sommer 1295 dorthin, sprach beim Abt vor und fand Gehör. Das Buch könne er ihm nicht ausleihen, aber er dürfe es abschreiben. Ein Unterfangen, das gut und gerne ein Jahr beanspruchen würde. Dabei wäre es von Vorteil, meinte der Abt, wenn der Kopist des Lateinischen mächtig sei. Jeremias der Jüngere beherrschte Latein, allerdings fehlte ihm die Zeit, ihm oblag die Aufgabe, das Gut zu bewirtschaften. Die beiden Brüder seines Vaters lebten nicht mehr und hatten keine männlichen Nachkommen, sein Grossvater war gebrechlich geworden und ausserstande, das Landgut zu führen. Angepflanzt wurden Weizen, Hafer, Gerste, Hirse, Bohnen, Kraut, Rüben und Hanf. Doch in höheren Lagen, das waren in den Waldstätten, dem Oberwallis, dem Emmental die meisten Gebiete, gab es nur spärlich Getreide und Gemüse.
Im Emmental hatten sich zunehmend Landadelige und freie Bauern gegen die Habsburger erhoben. Die Am Bachs standen im Ruf, den Habsburgern treu zu sein.
Der Abt, ein Verbündeter der Habsburger, hatte Verständnis für Jeremias und anerbot ihm, das Buch durch einen schreibkundigen Mönch seines Klosters gegen ein Entgelt kopieren zu lassen. Jeremias der Jüngere stimmte zu. Überglücklich kehrte er nach Trub zurück. Ein Jahr später brachte ihm ein Bote die Abschrift. Jeremias übersetzte sie mit seiner sauberen Handschrift in den altalemannischen Dialekt. Das Buch wurde neben der Kopie des lateinischen Originals zum Herzstück der Familienchronik der Am Bachs.
Jeremias der Jüngere hatte viele Bekannte und Freunde in Uri. Sie informierten ihn über das Geschehen in den Drei Waldstätten. Ihre Schilderungen widersprachen teilweise den Nachrichten der örtlichen Adeligen, der Herren von Signau, Sumiswald und Lützelflüh. Sie standen auf keinem guten Fuss mit den Grafen von Neu-Kyburg, die mit den Habsburgern verwandt und von ihnen abhängig waren. Die von Neu-Kyburg waren die offiziellen Herrscher des Emmentals und schützten im Grossen und Ganzen diese Region gegen die Angriffe ihrer Widersacher.
1315 fand die «Schlacht am Morgarten» statt. Nach den örtlichen Adligen endete sie mit einem grossen Sieg der Schwyzer. Jeremias der Jüngere wurde anders unterrichtet. In Wirklichkeit sei es ein Hinterhalt einer Gruppe von Söldnern gewesen, bei dem der habsburgische Herzog Leopold I. hätte getötet werden sollen. Dieser entkam unverletzt. Ein Teil seines Gefolges, zwei-, dreihundert Mann, wurde allerdings hingemetzelt. Die Angreifer am Morgarten handelten aber nicht im Auftrag des Landammanns von Schwyz und auch nicht in dem der anderen Waldstätte, Uri und Unterwalden. Von einem Krieg der Eidgenossen gegen die Habsburger konnte also keine Rede sein. Die Oberhoheit der Habsburger über Schwyz, Uri und Unterwalden blieb unangetastet. Jeremias der Jüngere konnte sich sicher fühlen.
1294 hatte Werner von Attinghausen Arnold von Silenen, gegen dessen Willen, im Amt des Landammanns abgelöst. Werner von Attinghausen übte dieses Amt einunddreissig Jahre lang aus. Ihm folgte sein Sohn, Johannes von Attinghausen, der bis 1357 regierte, zweiunddreissig Jahre lang. Beide wirkten als Feudalherren unter ihren verhassten habsburgischen Fürsten. Danach gab es keine männliche Linie mit dem Namen Attinghausen mehr. Die Pest, die von 1247 bis 1253 in der Innerschweiz wütete, raffte alle Nachkommen noch während der Amtszeit des Freiherren dahin.
3
Am Mittwoch, 21. Februar 2018, erhielt Brawand von Bassi den Auftrag, die in Am Bachs Wohnung sichergestellten Unterlagen zu durchforsten.
Gleich zu Beginn dieser Recherchen fiel Brawand ein vor nahezu fünfzig Jahren verfasster Brief des Gerichtspräsidenten des Amtsbezirks Thun in die Hände. Er war datiert auf den 27. Juni 1968 und betraf einen Vorfall im Justistal vom 26. Mai desselben Jahres, der Benjamin Am Bach beinahe das Leben gekostet hätte. An den Brief angeheftet waren handschriftliche Notizen Am Bachs, die seine Sicht der Dinge festhielten.
Brawand zog aus diesen Papieren seine Schlüsse. Ein veritabler Mordanschlag auf Benjamin Am Bach, gar keine Frage.
Brawand fielen die Initialen des mutmasslichen Täters auf. A.K. – Arnold Krummen? Brawand entschied sich, dem nachzugehen. Im Archiv des Amtsgerichts wurde er fündig. Sein Verdacht bestätigte sich. Es war tatsächlich Krummen. Warum hatte die Justiz damals den Täter geschützt? Brawand fand nach weiterem Suchen die Antwort. Krummens Vater amtete als Vizegemeindepräsident von Oberhofen am Thunersee und war Jurist, Notar oder Fürsprecher oder beides. Er gehörte der dominierenden Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei an. Und der Richter, der über die strafbare Handlung seines Sohnes zu urteilen hatte, ebenfalls.
Arnold Krummen musste ein Motiv gehabt haben. Doch es ging aus den Gerichtsakten nicht hervor. Ohne dieses war es unmöglich, einen Zusammenhang zwischen ihm und der Ermordung Benjamin Am Bachs herzustellen. So machte sich Brawand auf die Suche danach.
Es war später Nachmittag. Er begab sich ins «Rössli» von Oberried, an den Stammtisch. Zu seiner Erleichterung war Krummen nicht dort. Krummen, der Quartalssäufer, der zwischendurch seine abstinenten Wochen hatte.
Brawand setzte sich zwischen zwei alte Männer. Immer wenn Brawand dort erschien, hingen ihm die meisten Anwesenden an den Lippen. Denn er kam nie ohne besonderen Grund.
«Krummen», sagte Brawand fast flüsternd, «seit wann hasste Arnold Krummen Benjamin Am Bach so sehr?»
Der Alte zu seiner Rechten überlegte. «Ich vermute, es war schlicht Neid.»
Der Weisshaarige zu seiner Linken schien es besser zu wissen. «Neid? Das kam wohl noch dazu. Doch sein Groll gegen Am Bach hatte eine andere Ursache. Es war eine Frau.»
Brawand horchte auf. «Wie bitte? Was für eine Frau? Wann?»
«So genau kann ich das nicht mehr sagen. Das ist nun», er rechnete nach, «tatsächlich schon fünfzig Jahre her. Ich glaub es nicht.»
Brawand nickte verständnisvoll. «Alles muss ich ja nicht wissen. Sehr geholfen wäre mir, wenn du mir den Namen der Frau sagen könntest.»
Der Weisshaarige scherzte. «Eine so Hübsche hat früher ihren Mädchennamen nicht lange getragen. Ich kann mich nur an ihren Vornamen erinnern. Christine, glaube ich, hiess sie. Sie stammte aus einem gut betuchten Haus. Der Vater war, da bin ich fast sicher, etwas Höheres in einer Seegemeinde – Oberhofen oder Hilterfingen.»
Brawand zog ein kleinformatiges Heft aus seiner Westentasche und notierte etwas darin.
«Ist das denn so wichtig, dass du das jetzt aufschreibst? Ich habe seit jeher ein komisches Gefühl, wenn jemand meine unausgegorenen Worte zu Papier bringt.»
Brawand sah den Weisshaarigen vielsagend an. «Unausgegoren, sagst du. Da stellst du dich schlechter dar, als du bist. Nein, was du soeben gesagt hast, tönt glaubwürdig. Und denk daran: Ich bin Polizist. Das, was mir Zeugen anvertrauen, hänge ich nicht an die grosse Glocke. Die Personen, denen ich das sage, sind – wie übrigens auch ich – verpflichtet, diesen Hinweis vertraulich zu behandeln. Dabei wird die Identität des Informanten – also deine – nicht gelüftet. Niemand erfährt etwas, ohne dass ich dir zuvor dessen Namen nenne.»
«Mit wem sprichst du als Nächstem darüber.»
«Mit meinem Chef, Luca Bassi.»
Der Weisshaarige war beruhigt. Brawand spendierte ihm ein Bier, danach verzog er sich diskret. Als er in seinem Wagen sass, konnte er es sich nicht verkneifen, gleich Bassi anzurufen. Dieser nahm die Nachricht dankbar auf. Er habe diesem Krummen schon vom ersten Moment an, als er ihn zu Gesicht bekommen habe, nicht getraut. «Nun beeil dich und mache diese Dame ausfindig, sofern sie noch lebt – die Jüngste kann sie nicht mehr sein.»
Brawand hatte nichts anderes erwartet. Als er nach Hause, ins Stedtli Unterseen, fuhr, war er nicht so ganz zuversichtlich, dass der Mordfall Benjamin Am Bach rasch aufgeklärt werden könnte. Dass aber der Weg dazu, den er jetzt einschlug, wohl verheissungsvoll war, davon ging er aus. Der Schlüssel zur Lösung des Falls musste irgendwo in der Vergangenheit liegen – vielleicht viele Jahrzehnte zurück.
Adrian Brawand genoss das Abendessen mit Silvia. Obwohl ans Amtsgeheimnis gebunden, besprach er den Fall, der ihn gerade beschäftigte, mit ihr.
«Glaubst du wirklich, dass Krummen einer alten Flamme wegen einen Mord begeht?», fragte sie.
Brawand zuckte ein bisschen gekränkt mit den Schultern.
«Das war nicht als Tadel gemeint. Du bist ja der Fahnder. Ich habe nur –»
«Schon gut. Ganz unrecht hast du wohl nicht. Doch wenn ich möglichst viel aus Benjamin Am Bachs Lebenslauf herausholen kann, gelingt es mir vielleicht, etwas zu finden, das hilft, den Mord aufzuklären.»
«Das kann ich gut nachvollziehen. Doch ist das nicht wie die Suche nach der Stecknadel im Heuhaufen?»
«So knifflig ist es hoffentlich nicht. Doch wir bei der Polizei machen uns keine Illusionen. Wollen wir Erfolg haben, müssen wir unsere Arbeit auf viele Leute verteilen. Es gibt anders als bei den Fernsehkrimis nicht die Kommissarin oder den Kommissar, die ihrer Intuition folgend Geistesblitze haben und gleichsam im Alleingang das Verbrechen aufklären.»
Silvia schmunzelte. «Bist du belehrend. Das weiss ich doch, schliesslich bin ich schon lange deine Frau. Das wäre dann das Mordbüro?»
«So ist es.»
«Können alle mithalten?»
Brawand lachte. «Jede und jeder möchte erfolgreicher als der andere sein.»
«Gibt es auch Frauen darin?»
«Sicher. Zwei, drei Polizistinnen und zehn, zwölf Polizisten, die Staatsanwältin und die Psychologin, so weit der derzeitige Stand.»