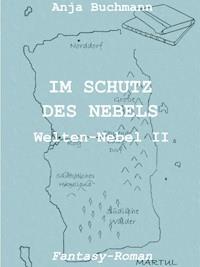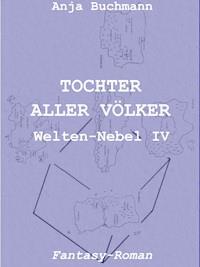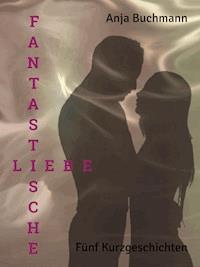Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: OHNEOHREN
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Kartoffelgeschosse, Lachsdiplomatie, Klopsekanonen, Unterwassergurken und royales Federvieh. Wenn Steampunkgeschichten auf leckeres Essen treffen, wird es spannend und abwechslungsreich. Von Flugschiffen bis zu unterseeischem Treiben entführen 16 AutorInnen auf eine spannende Reise quer durch viele Spielarten der Steampunkliteratur. Dazu begleiten leckere Gaumenfreuden, die zentrale Rollen in den jeweiligen Geschichten spielen. Ein Fest für alle Sinne – für die steampunkige und jede andere Küche. Guten Appetit!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 284
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der Dampfkochtopf
Geschichten und Rezepte aus der Steampunkküche
Die Deutsche Bibliothek und die Österreichische Nationalbibliothek verzeichnen diese Publikation in der jeweiligen Nationalbibliografie. Bibliografische Daten:
http://dnb.ddp.de
http://www.onb.ac.at
© 2015 Verlag ohneohren, Ingrid Pointecker, Wien
www.ohneohren.com
ISBN: 978-3-903006-63-8
1. Auflage
Covergestaltung: Ingrid Pointecker
Cover - und Rezeptfotos: Michael Sterzer
Cover- und Trennblattgrafiken: Bukhavets Mikhail | shutterstock.com, freepik.com
Lektorat, Korrektorat: Verlag ohneohren
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und/oder des entsprechenden Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Alle Personen und Namen in diesem E-Book sind frei erfunden.
Inhaltsverzeichnis
Vorwort der Herausgeberin
Suppe & Beilagen
Anja Buchmann
Freiheitsbrei
Foto
Rezept
Marion Bach
Tante Eufemia
Foto
Rezept
Susanne Halbeisen
200,00 Gurken unter dem Meer
Foto
Rezept
Kai Gläser
Schraubenschlüssel
Foto
Rezept
Hauptgerichte
Anja Kraus
Kannibalische Gastfreundschaft
Foto
Rezept
Daniel Schlegel
Karas Kabelsalat für junge Erfinder und Entdecker
Foto
Rezept
Laura Dümpelfeld
Ferdinand Fichtelbergs famoser Fabrikator
Foto
Rezept
Luzia Pfyl
Die Pilaw-Affäre
Foto
Rezept
Markus Cremer
Archibald Leach und die gelbe Pute aus Neuguinea
Foto
Rezept
Tina Skupin
Die Winde von Vineta
Foto
Rezept
Cathrin Kühl
Käthes Königsberger Klopse-Kanone
Foto
Rezept
Julianna Dalisch
Fliegerallerlei
Foto
Rezept
Süßes
Bianca M. Riescher
Tödliches Tiramisu
Foto
Rezept
Meara Finnegan
Vorwort der Herausgeberin
Wien, am 18. Mai 2016
Liebe Leserinnen und Leser,
„Kochbuch?“, lautete die kryptische Notiz an mich selbst vor knapp zwei Jahren, die zu dem Projekt geworden ist, dessen Endergebnis Sie nun in Händen halten. Die ursprüngliche Idee dazu entstammte einen Kochblog, den ich zugunsten meiner Tätigkeiten als Verlegerin und Herausgeberin vor einigen Jahren aufgeben musste. Kombiniert mit dem Umstand, dass es zwar einige englische Bücher zu den Themen Kulinarik und Steampunk gibt, aber wenig Vergleichbares aus dem deutschsprachigen Raum, entstand schließlich auf Basis einer Ausschreibung „Der Dampfkochtopf“.
Keine Angst, unsere wunderbaren Autorinnen und Autoren haben darauf geachtet, dass Sie das gleichnamige Kochgerät nicht unbedingt brauchen. Die Rezepte sind einfach gehalten, wurden vom Essensfotografen und mir testgekocht (und natürlich auch gegessen), es gibt auch feine Dinge für VegetarierInnen und VerganerInnen sowie Gerichte für jedes Budget.
Aber das Wichtigste: Wunderbare Geschichten stecken in diesem Buch. Sie werden Ausflüge in die Luft miterleben, unterseeisches Leben erkunden, mechanische Gerätschaften kennenlernen und einige der vielen Varianten des Subgenres Steampunk entdecken. Dazu gehören sich in ballistischer Flugbahn fortbewegende Kartoffeln genauso wie ein vergifteter Nachtisch.
Auf dem Cover haben Sie bestimmt schon das Gericht von Autorin Cathrin Kühl entdeckt, und auch im Inneren finden Sie zahlreiche Bilder, die ohne meinen Fotografen und Lebensgefährten Michael Sterzer nicht möglich gewesen wären.
Eine besondere Erwähnung darf hier ebenfalls nicht fehlen: Manchmal haben es Kleinverlage und Anthologien derselbigen nicht einfach. Möglich gemacht wurden die hübschen Bilder auch durch meine Eltern Anna und Oskar, die uns für manche der Fotos ihr liebevoll restauriertes Herzensprojekt, ein kleines Häuschen in Oberösterreich, zur Verfügung gestellt haben.
So anstrengend diese ausufernden Danksagungen klingen mögen, so sehr hat dieses Projekt aber auch Spaß gemacht. Der größte Dank gilt dabei den AutorInnen, die Geduld mit ihrer Verlegerin und Herausgeberin bewiesen, immer schnell mit konstruktivem Feedback (zum Beispiel bei der Fotoauswahl) reagiert haben und vor allem immer wieder den Mut beweisen, sich auf neue Schnapsideen von mir einzulassen.
Nun liegt „Der Dampfkochtopf“ in Ihren Händen und freut sich darauf, gelesen und gekostet zu werden. Wir freuen uns auf Ihr Feedback (das man dank des Internets auch wunderbar mit vollem Mund loswerden kann). Haben Sie Spaß und lassen Sie es sich schmecken!
Freiheitsbrei
Anja Buchmann
Ihre ausladenden Röcke bauschten, während sie aus der dampfgetriebenen Kutsche stieg. Als Phoebe den rechten Fuß auf den sandigen, von der Mittagssonne erhitzten Boden setzte, stolperte sie beinahe. Die Fessel, welche ihr Gelenk umschloss, hatte sich in ihrem Unterrock verfangen. Sie bückte sich, nestelte an dem Stoff, bemüht, den metallenen Fremdkörper nicht zu berühren.
„Los, vorwärts. Wir haben nicht ewig Zeit!“ Der große, in feinen Zwirn gekleidete Mann, der hinter ihr aus der Kutsche gestiegen war, griff nach ihrem Arm und zog sie mit sich.
„Halt, meine Koffer!“ Das Gepäck war das Einzige, was ihr, abgesehen von den Kleidern am Leib, noch geblieben war. Unmöglich konnte sie zulassen, dass er ihr dies auch noch nahm.
Mit einer herrischen Geste bedeutete ihr Begleiter dem Führer des Dampfgefährts, den großen Koffer und die beiden kleinen Taschen auszuladen. Während er den Bediensteten mit den stetigen Blicken seiner umschatteten eisblauen Augen zur Eile mahnte, hielt er ihren Arm weiterhin fest umklammert.
Als ob sie noch die Willenskraft besäße, sich gegen ihn zur Wehr zu setzen. Die Stunden in der Enge der Kutsche hatten jeden Gedanken daran nachhaltig erstickt. Alles an ihrem Entführer war dazu angetan, Phoebe in Angst und Schrecken zu versetzen. Obwohl er nach außen hin der perfekte Gentleman war, korrekt bis in die Spitzen seines akkurat geschnittenen Haarschopfes, hatte er in der Abgeschiedenheit des Vehikels nicht mehr versucht, seine finstere und bedrohliche Seite vor ihr zu verbergen.
Bei ihrem Kennenlernen im literarischen Salon ihrer Freundin Mary – erst am Vorabend war es gewesen, obgleich es ihr vorkam wie in einem anderen Leben – war Phoebe fasziniert von der stattlichen Erscheinung des Herrn gewesen, der sich ihr als Alec Rice vorgestellt hatte. Inzwischen bezweifelte sie, dass dies sein richtiger Name war. Doch am Abend war sie geblendet worden von seinem guten Aussehen, dem schlanken Körper, der keine Spuren der in ihren Kreisen üblichen Völlerei und des Müßiggangs aufwies. Allzu gerne hatte sie sich von Rice in ein Gespräch verwickeln und zu mehr als nur einem Glas Wein verleiten lassen.
Als er sie später nach Hause begleitet hatte, war sie zu betrunken gewesen, um sich gegen sein Eindringen in das kleine Appartement zu wehren, welches sie in ihrem Elternhaus bewohnte. Erst als Rice die Tür hinter ihnen abgeschlossen und den Schlüssel abgezogen hatte, war ihr der schreckliche Fehler aufgefallen.
Er kam sofort zur Sache. „Es gibt etwas, was du für mich tun kannst.“ Die zuvor so sanfte und einschmeichelnde Stimme war plötzlich kalt und berechnend. Während sie vor Angst zitterte, erklärte er ihr, dass er sie für eine besondere Aufgabe ausersehen hätte. Worum es sich dabei handelte, wusste Phoebe auch jetzt, nach ihrer gemeinsamen Reise, nicht. An einer Sache jedoch hatte Rice, die Pistole in der Hand, keine Zweifel gelassen: Wenn sie nicht tat, was er von ihr verlangte, würde sie es bitter bereuen. Es war weniger die Bedrohung für ihr Leben, welche ihr Gehorsam abforderte, vielmehr drohte Rice damit, ihre ganze Familie in den Ruin zu stürzen. Er hatte angeblich Beweise dafür, dass Phoebes Vater, ein angesehener Politiker, in üble Machenschaften verstrickt war. Kämen diese an Licht, drohte ihm mindestens Kerkerhaft. Was das für ihre Mutter und die drei jüngeren Schwestern bedeutete, wollte Phoebe sich nicht einmal vorstellen. Auch wenn sie sich einredete, dass die Beweise gefälscht waren, änderte sich nichts an der Gefahr, die von ihnen ausging. Rice zumindest schien sich seiner Sache sicher zu sein.
Er hatte sie in der Hand! Das wurde ihr erneut schmerzlich bewusst, als er sie anwies, ihre Habseligkeiten aufzunehmen und ihm zu folgen. Sie ächzte unter dem Gewicht, Schweiß stand ihr auf der Stirn. So sehr sie sich anstrengte, entlang des staubigen Pfades – zu schmal für die Dampfkutsche –, den sie entlangschritten, konnte sie kein Ziel ausmachen, auf das sie zusteuerten. Danach zu fragen war sinnlos. In der Kutsche hatte sie es unzählige Male getan und keine Antwort erhalten. Stattdessen hatte Rice ihr mit Freuden auseinandergesetzt, welche Folgen Ungehorsam haben konnte. Auch über die Funktionsweise der Fessel, die ihr Bein beschwerte, hatte er sie umfassend informiert. Es war ein Wunderwerk der Ingenieurskunst, ein überaus tödliches. In einem kleinen Kasten, der untrennbar mit dem metallenen Band verbunden war, befand sich genug Sprengstoff, um sie auf der Stelle in Stücke zu reißen. Und dies würde geschehen, sobald der Kontakt zu dem Sender unterbrochen wurde, den Rice in der Tasche trug. Wenn sie es richtig verstanden hatte, basierte die Höllenmaschine auf den gleichen Grundlagen wie das Marconiphon. Wie weit die lebenserhaltenden Wellen des Senders reichten, wusste Phoebe nicht und sie verspürte auch nicht den Wunsch, es herauszufinden.
Ganz auf ihre von der Last schmerzenden Arme und Schultern konzentriert, schritt sie schweigend den Weg entlang, der sich immer weiter verengte. Links und rechts lagen Wiesen voller saftiger Gräser und Sommerblumen, die sich sanft im Wind wiegten. Gerne hätte sie gerastet, um diesen wundervollen Anblick tief in sich aufzunehmen. Rice aber schritt hastig voran, warf ihr über die Schulter immer wieder Blicke zu, die sie zur Eile mahnten.
Unvermittelt standen sie vor einem niedrigen hölzernen Zaun, der ein verwildertes Grundstück umschloss, in dessen Mitte sich ein nicht minder heruntergekommenes Haus befand. War das ihr Ziel? Die Bestimmtheit, mit der Rice das quietschende Tor aufstieß, ließ die Vermutung zur Gewissheit wachsen.
Sie bahnten sich einen Weg durch das Gewirr an Unkraut, Gebüsch und Nutzpflanzen. Als sie das Haus fast erreicht hatten, schwang dessen Tür auf und ein Mann trat ihnen entgegen, kahlköpfig und vom Alter gebeugt. Da er Rice erblickte, verfinsterte sich das faltige Gesicht. Offener Hass lag in seinen Zügen.
Rice schien das wenig zu bekümmern. „Wie geht es Ihnen, Professor? Schauen Sie, ich bringe Ihnen eine neue Haushälterin.“
Ein Schnauben war die Antwort. In Phoebe arbeitete es. Endlich wusste sie, warum Rice sie hergebracht hatte. Sie sollte die Mamsell dieses Alten werden. Doch das konnte einfach nicht alles sein. Sonst hätte er sie nicht entführt. Erpressung war ein viel zu aufwendiger Weg, um an Hauspersonal zu kommen. Außerdem musste sie sich fragen, was mit ihrer Vorgängerin geschehen war. War sie tot? Sie drängte den Gedanken mit aller Macht beiseite.
„Geht ins Haus!“ Rices Befehl galt sowohl dem Alten als auch ihr.
Der Professor drehte sich um und schlurfte ins Haus zurück. Täuschte sie sich oder beulte sein Hosenbein über dem rechten Knöchel? Konnte es sein, dass auch der Alte eine dieser teuflischen Fußfesseln trug? War er ebenso ein Gefangener wie sie? Phoebe vermutete, dass sie es noch früh genug herausfinden würde.
Rice trat nach ihnen ins Haus und verschloss die Tür. Drinnen war es dämmrig, fast dunkel. Die Fensterscheiben waren so dreckig, dass sie kaum noch Licht hereinließen. Dieses Haus hatte dringend jemanden nötig, der sich darum kümmerte.
„Name?“, fragte der Professor barsch.
„Phoebe“, antwortete sie und streckte ihm die Hand entgegen. Er ignorierte dies und schien es auch nicht für nötig zu erachten, ihr seinen Namen zu nennen.
„Also Phoebe, der Professor wird dir alles zeigen, was du wissen musst. Ich werde in unregelmäßigen Abständen nach euch sehen. Den hier“, er zog den Sender zu ihrer Fußfessel aus der Tasche, „werde ich in den Tresor im Keller einschließen. Keine Angst, die Wellen durchdringen das Material des Safes. Sie reichen bis zum Rand des Grundstücks. Solange du dich innerhalb des Zaunes aufhältst, ist alles gut.“
Nichts war gut! Sie war eine Gefangene. Am liebsten hätte sie ihm ihren Frust ins Gesicht gebrüllt. Aber das konnte sie nicht tun. Er hielt den Sender in der Hand. Zerbrach er ihn in einem Anfall von Wut, würde sie sterben. Rice hatte ihr gesagt, was er im Falle ihres Ablebens tun würde: sich eine ihrer Schwestern holen. Um deren Sicherheit willen durfte sie nichts riskieren.
Rice verschwand im Untergeschoss und der Professor wandte sich einem riesigen Arbeitstisch zu, der fast vollständig mit einem wüsten Sammelsurium an Kleinteilen und Werkzeugen bedeckt war. Unschlüssig, was sie tun sollte, stand Phoebe inmitten des Raumes, der wohl ursprünglich die Küche des Hauses gewesen war. Zumindest deutete ein vollkommen verdreckter Herd in der Ecke darauf hin. Nach einigem Suchen konnte sie auch die Spüle ausmachen, begraben unter schmutzigem Geschirr. Fliegen umsurrten das Chaos. Sie fragte sich, wie lange der Professor hier schon allein hauste. Zumindest würde ihr in diesem Gefängnis nicht langweilig werden. Aufgewachsen mit zahlreichen Bediensteten hatte Phoebe zwar nicht allzu viel Ahnung von Haushaltsführung, aber besser als das hier würde sie es schon auf die Reihe kriegen.
Rice kam zurück.
„Dein Schlafzimmer ist unterm Dach“, informierte er sie. Sie griff sich ihre Koffer und stieg die Treppe in den ersten Stock hinauf. Drei Zimmer gingen vom Flur ab. Sie warf einen Blick in jedes. Alle waren sie angefüllt mit technischen Gerätschaften. Im letzten Zimmer gab es unter all dem Chaos auch ein Bett, dessen Laken offensichtlich seit Urzeiten nicht mehr gewechselt worden waren. Das war wohl das Schlafzimmer des Professors.
Am Ende des Ganges führte eine schmale Stiege weiter nach oben. Mit Mühe wuchtete sie ihren Koffer durch die enge Öffnung. Das ganze Geschoss bestand nur aus einem niedrigen Raum, in dessen Mitte sie gerade so aufrecht stehen konnte, nachdem sie ihren Hut abgenommen hatte. Neben einem Bett gab es einige kleine Schränke und Kommoden aus solidem Holz. Obwohl alles verstaubt war, machte diese Zimmer einen deutlich besseren Eindruck als der Rest des Hauses. Sie mutmaßte, dass der Professor seine alten Knochen nicht die Stiege nach oben quälte und das Dachgeschoss so von dem allgegenwärtigen Chaos verschont blieb.
Als sie die Treppe hinabstieg, um auch ihre beiden Taschen hinaufzuholen, hörte Phoebe eine Tür zuschlagen. Rice war gegangen. Sofort atmete sie freier.
Allmählich ging der Sommer in den Herbst über. Phoebe begrüßte die Kühle, die mit den kürzeren Tagen Einzug hielt. Fast drei Monate lebte sie nun schon bei dem Professor. Sie hatte kräftig angepackt und das Haus war nicht wiederzuerkennen. Auch wenn sie, der Arbeit des Wissenschaftlers geschuldet, einige Zugeständnisse in Sachen Ordnung machen musste, war es kein Vergleich zum vorherigen Zustand. Sie kam besser mit der Hausarbeit zurecht, als sie vermutet hätte. Einzig mit dem Kochen hatte sie so ihre Schwierigkeiten. Glücklicherweise war der Professor wenig anspruchsvoll und begnügte sich mit den Dosenmahlzeiten, die Rice brachte, wann immer er zu einem seiner Kontrollbesuche vorbeikam. Phoebe jedoch hatte so ihre Probleme damit, sich tagein, tagaus davon zu ernähren. Sogar die Milch kam aus der Dose. Wie gerne wäre sie auf den Markt gegangen, um frische Lebensmittel zu kaufen. Doch ihr Leben war auf dieses Grundstück mitten im Nirgendwo begrenzt. Außerdem schaffte sie es nicht einmal, aus dem Gemüse und Obst, welches völlig ohne ihr Zutun im Garten spross, eine Mahlzeit zu machen. Einige Male hatte sie es versucht, war dann aber dazu übergegangen, Möhren, Kräuter und Obst, wenn überhaupt dann roh zu verzehren.
Etwas anderes aber bereitete ihr weitaus mehr Sorgen: der Professor. Von Anfang an war der alte Mann ihr gegenüber sehr distanziert gewesen. Wann immer sie ihn nach seiner Forschung fragte, sogar offen feindselig. Er gab ihr das Gefühl, ihre Anwesenheit bestenfalls zu dulden. Dabei wünschte sie sich, offen mit ihm reden zu können. Schließlich hatten sie nur einander. Außerdem war er ihre einzige Chance herauszufinden, was hier vor sich ging. Aber ebenso gut hätte sie Rice bitten können, ihr alles zu erklären.
Phoebe war gerade dabei, das Bett des alten Mannes frisch zu beziehen. Morgen war Waschtag. Plötzlich ertönte ein Knall. Sie rannte aus dem Zimmer hinab in die Küche, während weitere polternde Geräusche folgten. Die Küche war ein einziges Schlachtfeld. Der Professor mittendrin, die Hände in den Taschen seines mit irgendeiner glibberigen Substanz bedeckten Kittels, die Stirn gerunzelt. Jetzt erkannte sie, worum es sich bei den herumliegenden Stücken handelte: die Überreste eines Riesenkürbisses. Es sah aus, als sei er explodiert.
Ohne eine Erklärung vom Professor einzufordern, griff sie sich einen Eimer und begann, die Stücke einzusammeln.
„Scheiße!“
Phoebe blickte auf. Noch nie hatte sie den alten Wissenschaftler fluchen hören. „Was ist los?“
„Rice kommt.“
„Woher wissen Sie das?“ Erst jetzt fiel ihr auf, dass er es bisher immer gewusst hatte, wenn der Entführer kurze Zeit später durch die Tür gekommen war. Jedes Mal hatte er mit seinen Forschungen innegehalten und Rice in der Küche oder gar vor der Tür empfangen.
„Ein unauffälliges Alarmsystem am Tor.“ Ein Lächeln umspielte den Mund des alten Mannes. Der kurze Moment verstrich und hektisch begann er, ein seltsam aussehendes Gerät in eine Holzkiste zu stopfen. „Er darf es nicht finden“, murmelte er dabei. „Aber diese Schweinerei. Wie soll ich das erklären?“
„Lassen Sie mich das machen. Bringen Sie Ihre Erfindung in Sicherheit“, flüsterte sie, als sich die Tür öffnete.
Rice stand im Türrahmen. Sein Blick scannte den Raum, blieb an ihr hängen.
„Entschuldigen Sie das Chaos. Ich war wohl etwas zu rabiat.“
„Was hattest du mit dem Kürbis vor?“
„Kochen.“ Ihr Gehirn arbeitete auf Hochtouren. Rice schaute sie nach wie vor fragend an, skeptisch. „Ich koche … äh … Kürbis-Kartoffelpüree. Es wäre doch schade, wenn die Kürbisse aus dem Garten umkommen würden.“ Phoebe fuhr fort, die Stücke des Kürbisses in den Eimer zu packen. Zu ihrer Erleichterung wandte Rice seine Aufmerksamkeit dem Professor zu. Ein verstohlener Blick in dessen Richtung verriet ihr, dass dieser die Holzkiste verschlossen hatte und seine Aufmerksamkeit auf etwas anderes richtete. Sie wusste zwar nicht, was er da vor Rice verbarg, doch sie hoffte, dass es ihm gelang.
Die beiden Männer gingen in das angrenzende Wohnzimmer. Phoebe hatte den Eindruck, dass es eine längere Besprechung werden würde. Mist, das bedeutete, sie würde tun müssen, was sie angekündigt hatte: Kürbis-Kartoffelpüree kochen. Sie stellte den Eimer ab, um im Garten ein paar Kartoffeln auszugraben. Sie sammelte die dunklen erdigen Knollen in ihrer Schürze, die seit ihrem ersten Tag hier Bestandteil ihrer Garderobe war, während Hüte, Korsagen und Handschuhe im hintersten Winkel des Schrankes verstaubten.
Sie würde die Kartoffeln säubern und schälen müssen, den Kürbis ebenso. Ein Püree daraus zu kochen, konnte so schwer nicht sein. Kartoffeln hatte Phoebe schon einmal gekocht und dabei aus Versehen einen Brei erzeugt, weil sie sie zu lange im Topf gelassen hatte.
Die Tür zum Wohnzimmer war noch immer geschlossen, von drinnen drang Rices harte Stimme und die ängstlich klingende des Professors. Sie konnte nicht hören, was gesprochen wurde. Zu lauschen wagte sie nicht und so widmete sie sich wieder ihrer Arbeit.
Nachdem sie einen großen Topf mit Kartoffel- und Kürbisstückchen gefüllt hatte, feuerte sie den Herd an. Als die Flammen munter flackerten, hievte sie den Topf auf die heiße Metallplatte, gab Wasser und Salz hinzu. Während das Ganze zu kochen anfing, ging ihr auf, dass sie unmöglich pures Püree servieren konnte. Im Garten gab es Kräuter. Sie könnte sie darüberstreuen. Geröstete Zwiebeln wären auch eine Möglichkeit. Phoebe durchstöberte den Vorratsschrank auf der Suche nach weiteren Beilagen. Dosenfleisch, warum nicht? Sie schnitt es in Scheiben, holte Kräuter und hackte sie. In einer großen Pfanne briet sie Zwiebelringe.
Kartoffeln und Kürbis waren weich. Als sie versuchte, das Wasser abzugießen, war Rice plötzlich hinter ihr, nahm ihr den schweren Topf aus den Händen. „Soll das ganze Wasser raus?“
„Ja, bitte.“
Soweit sie sich erinnern konnte, war dies die erste Freundlichkeit, die er ihr seit jenem Abend im Salon ihrer Freundin erwiesen hatte. Irgendwie wirkte er zufrieden und weniger bedrohlich. Vielleicht wegen dem, was er mit dem Professor gesprochen hatte.
„Stellen Sie ihn auf den Tisch.“
Rice beobachtete sie, wie sie das Gemüse zu Brei zerstampfte und die Masse mit Butter und geriebener Muskatnuss verfeinerte.
„Wollen Sie mit uns essen?“
Phoebe rechnete fest damit, dass er ablehnen würde, doch Rice überraschte sie erneut. „Gerne.“
Kurz darauf saßen sie zu dritt um den Tisch, jeder einen Teller mit überraschend wohlschmeckendem Püree vor sich. Die angespannte Atmosphäre machte es Phoebe unmöglich, mehr als ein paar Bissen zu essen. Erleichtert atmete sie auf, als Rice, kaum dass sein Teller leer war, aufstand und verschwand. Der warnende Blick, mit dem er den Professor im Hinausgehen bedachte, zeigte deutlich, dass seine vorherige Freundlichkeit nichts weiter war als ein perverses Spiel, ähnlich dem, welches eine Katze mit einer Maus spielte.
Sie wollte aufstehen, um die Teller abzuräumen, doch der Professor hielt sie zurück, indem er ihr die Hand auf den Arm legte. „Danke! Du hast mich gerettet.“
„Was haben Sie vor Rice versteckt?“
„Unseren Schlüssel zur Freiheit.“
Sie traute ihren Ohren nicht. Konnte das wirklich wahr sein? Würde sie frei sein? Die nächsten Worte des alten Mannes dämpften ihren Optimismus. „Noch funktioniert es nicht so, wie es sollte. Aber ich bin nahe dran.“
„Was genau haben Sie vor?“
„Ich werde den Safe öffnen. Die Sender sind gleichzeitig auch die Schlüssel für unsere Fesseln. Mit ihnen können wir sie abnehmen.“
Den Tresor knacken? Wie oft hatte sie selbst schon darüber nachgedacht. Bisweilen war sie in den Keller gegangen, hatte das massive Ungetüm in Augenschein genommen, und dann allen Mut verloren. Selbst wenn sie ihre ganze Zeit darauf verwendete, sie würde das Zahlenschloss nicht knacken können. Phoebe war unklar, wie etwas, was Kürbisse zum Explodieren brachte, dabei nützlich sein konnte. Vielleicht war der Alte über die Gefangenschaft verrückt geworden, sah Hoffnung, wo es keine gab.
„Wie wollen Sie an den Inhalt kommen?“
„Die Scharniere der Tür sind ein Schwachpunkt, die Bolzen des Schlosses ein anderer. Die Maschine, die ich gebaut habe, kann beides durchtrennen. Aber ich muss das Problem mit der Hitze in den Griff bekommen. Sonst werden womöglich die Sender beschädigt. Noch ist es zu heiß. Deswegen ist der Kürbis explodiert. Sein Inneres hat zu sieden begonnen.“
Was er sagte, klang überhaupt nicht verrückt, sondern nach einem vernünftigen Plan.
„Warum hält er Sie hier eigentlich gefangen?“
„Weil er mich braucht. Ich entwickle Waffen, gefährliche Waffen. Rice ist ein einflussreicher Mann, der im Verborgenen die Strippen zieht, durch Erpressung und Bestechung. Das reicht ihm jedoch nicht, nicht mehr. Es verlangt ihn nach militärischer Überlegenheit. Sein Ziel ist es, die Macht zu ergreifen. All jene, die sich seiner Herrschaft entgegenstellen, werden sterben.“
Phoebe war schockiert. „Warum helfen Sie ihm dabei?“ Ihr Blick war eine stumme Anklage. Wie nur konnte der Wissenschaftler mit jemandem wie Rice gemeinsame Sache machen? Sie selbst würde lieber sterben, als jemanden wie Rice mit tödlichen Maschinen zu versorgen.
„Weil ich muss. Er hat meine Tochter in seiner Gewalt und ihre Kinder, meine Enkel. Wenn ich nicht tue, was er sagt, wird er sie umbringen.“ Bei diesen Worten sank er in sich zusammen, sah noch älter und gebrechlicher aus als zuvor.
Sie empfand nichts als Mitleid. „Es tut mir so leid.“
Während sie tröstend seine Hand tätschelte, kam ihr ein neuer, beunruhigender Gedanke. „Was wird mit Ihrer Familie geschehen, sollte unsere Flucht glücken? Wird er sie nicht töten?“ Auch um ihre eigenen Angehörigen machte Phoebe sich Sorgen. Ohne jeden Zweifel würde Rice seine Drohung wahr machen und ihren Vater in Misskredit bringen und so die ganze Familie. Selbst wenn die Anschuldigungen der Wahrheit entsprachen, etwas, was sie nach Stunden und Tagen des Nachdenkens nicht mehr so vehement verneinte wie damals, als Rice sie damit konfrontiert hatte, so hatten ihre Mutter und ihre Schwestern ein solches Schicksal nicht verdient.
„Dazu wird er nicht kommen. Ich werde ihn mit seinen eigenen Waffen schlagen!“ Das Gesicht des Wissenschaftlers strahlte vor Stolz. „Sobald wir frei sind, werde ich das Haus in eine tödliche Falle verwandeln. Dann wird sein nächster Besuch hier ganz sicher der letzte sein. Von ihm wird nichts bleiben als ein Häufchen Asche.“
Obwohl es ein Ausweg war, wahrscheinlich der einzige, den sie hatten, wollten sie ihre Familien retten, konnte Phoebe die Begeisterung des Professors nicht teilen. Ein Mensch würde sterben. Selbst wenn es sich dabei um Rice handelte, würde die Süße der gewonnenen Freiheit dadurch einen Hauch von Bitternis bekommen. Nichtsdestotrotz, sie wollte frei sein. Rices Tod war ein Preis, den zu zahlen sie bereit war. „Und Sie denken wirklich, dass Ihre Maschine den Safe öffnen kann?“
„Natürlich. Ein paar Tests werde ich vielleicht noch brauchen. Du kannst dich also darauf einstellen, noch öfter Kürbis-Kartoffelpüree zuzubereiten. Wobei, vielleicht wäre Freiheitsbrei der bessere Name.“
Phoebe lachte auf, das Herz voller Freude und Zuversicht. Nicht mehr lange und sie würde frei sein.
Es wurde noch so manche Portion Freiheitsbrei vertilgt, bevor Phoebe und der Professor an einem klaren Wintermorgen durch eine Lücke im Zaun das Grundstück verließen, welches ihr Gefängnis gewesen war. Sie kehrten zu ihren Familien zurück. Während Phoebe Vergessen in einem regen gesellschaftlichen Leben und wenig später in den Armen eines liebenden Mannes fand, widmete der Professor seine letzten Lebensjahre der Erfindung von Apparaten, die einzig dem Zweck dienten, Menschen zu erfreuen. Eine dampfbetriebene, fast gebäudegroße Kitzelmaschine war dabei nicht die kurioseste seiner Erfindungen. Von Alec Rice hat nie wieder jemand etwas gehört.
Freiheitsbrei (Kürbis-Kartoffelpüree)
Zutaten:
1 kg Kartoffeln
1 kg Fruchtfleisch eines Riesenkürbisses oder eines anderen Kürbisses mit nicht zu starkem Eigengeschmack
1 gutes Stück Butter (100 g oder mehr, ganz nach Geschmack)
Salz
Muskatnuss
Beilagen nach Belieben
Zubereitung:
Die Kartoffeln schälen und in Stücke schneiden. Das Fruchtfleisch des Kürbisses in ähnlich große Stücke teilen wie die Kartoffeln. Kartoffeln und Kürbis in einem Topf mit gesalzenem Wasser zum Kochen bringen.
In der Garzeit können Beilagen und Toppings zubereitet werden. Sehr lecker sind geröstete Zwiebeln, verschiedene gehackte Kräuter und zerkrümelter Hirtenkäse. Geröstete Nüsse oder Kerne geben das gewisse knusprige Extra. Auch zu geröstetem oder gegrilltem Gemüse sowie zu diversen Fleisch- und Fischgerichten ist das Kürbis-Kartoffelpüree ein idealer Begleiter. Es ist so vielseitig wie Kartoffelpüree.
Sobald Kürbis und Kartoffeln gar sind, das Wasser abgießen, die Butter und Muskatnuss nach Wunsch hinzugeben und ordentlich mit einem Kartoffelstampfer bearbeiten, bis die angestrebte Cremigkeit erreicht ist. Gemeinsam mit den gewünschten Beilagen servieren.
Tante Eufemia
Marion Bach
Eilbrief der Geheimrätin Anna Merz an ihre Schwester
Frau Generalin Clara von Veitenbach
Arnstadt, 34. Februar 1880
Liebe Clara! Es geht uns gut - wieder!
Und so komme ich dazu, weshalb ich dir weit nach Mitternacht schreibe, damit mein Brief dich ja rechtzeitig erreicht! Ich habe die Blechdrossel geschickt, dir meine Nachricht zu überbringen, denn die Telegraphenbureaus sind schon geschlossen, und so bin ich auch nicht gezwungen, mich kürzer zu fassen als notwendig. Tante Eufemia ist soeben abgereist. Sie hat uns vorgestern depeschiert – um elf Uhr - sie werde zur Mittagszeit da sein!
Das Theater, das in unserem Haushalt losbrach, kannst du dir denken!
Ich hätte dich schon früher gewarnt, aber die Strapazen haben mich völlig in Anspruch genommen. Ihre versteckten Niederträchtigkeiten kennst du – ich weiß, du verstehst mich. Ihre Weiterreise führt sie zu euch. Ich bete oft, ein Rad der Droschke möge bersten und die Familie hätte einmal Ruhe. Du verzeihst mir doch meine Offenheit? Aber einmal muss es gesagt werden! Jedes Jahr diese Besuche à la surprise! Einfach entsetzlich! Meine Geheimwaffe: Die Tante verabscheut Alkohol, doch bei Mutters Weißweinsuppe wird sie schwach. Nach einem Teller ist sie heiter, nach zweien schläft sie ein. Das Rezept habe ich beigelegt.
Ich muss nun schließen und zu Bett, denn meine Hausmädchen und die Köchin haben sich nach diesen Alterationen zwei Tage Urlaub erbeten. Ich bin schon froh, wenn sie nicht quittieren! Deshalb muss ich mich morgen selbst bekümmern. Das wird ein Spaß! Paul ist auch mit den Nerven herunter.
Falls du Hilfe benötigst, schreibe sofort und schicke die Depesche mit der Blechdrossel. Angetrieben wird sie durch die emotiovolatilen Kräfte, welche zwischen zwei aufrichtig sich liebenden Menschenherzen ihre Bahnen werfen. Unser Jüngster hat die Existenz der unsichtbaren Linien vor einem Monat entdeckt und eine Maschine erfunden, die diesen Mächten Folge leistet. Wohin das Vögelchen zu fliegen weiß? Es folgt dem pasilalinisch-sympathetischen Kompass, der dich und mich durch die Resonanz unserer Herzen verbindet und nur jene Pole kennt. Dieser Automat befindet sich in seinem Brustkasten. Dort, wo ein lebendiges Tier sein Herz trägt, besitzt die Drossel einen Stift, um den ich eines deiner Haare gewickelt habe (du erinnerst dich an die Haarlocken, die wir uns in die Alben geklebt haben?).
Wickle eines meiner Haare um den Stift, drehe den Schlüssel, so zieht sich eine Feder an und der Kompass, also der Stift, beginnt zu rotieren. Solange der sich dreht, fliegt die Drossel ihren Weg. Also dreh recht fest daran!
Und vergiss nicht, alle losen Sachen zu verstauen: Morgen ist Umstellung auf Sommerzeit! Diesmal soll das Beben ganze zehn Minuten währen! Ach, seit wir zum Mittelpunkt der Erde gereist sind und die Umdrehung unseres Planeten mechanisiert wurde, laufen die Chronographen exakter – und doch ist dieser urgewaltige Ruck des Erdballs zweimal im Jahr das reinste Desaster. Letztes Jahr, zur Umstellung auf Winterzeit, rollte mir der Terrinendeckel vom Tisch.
Anna
PS: Wie befindet sich Großmutter? Ich gönne der guten Clementine, dass sie ihre letzten Jahre in recht angenehmem Geisteszustande verlebt.
PPS: Wie viele Eier gibst du in deinen Kuchen? Paul sagt, ich soll das Backen an den Nagel hängen. Die Zahnarztrechnung überträfe bald die Gasrechnung. Wie findest du das?
Tagebuch der kleinen Marie von Veitenbach
Zu Hause am Sekretär
35. Februar 1880
Mutter sagt, mit meinen acht Jahren ist es an der Zeit, ein Diarium zu führen.
Heute ist der richtige Tag, damit zu beginnen, denn heute ist Tante Femia zu Besuch gekommen und Vater hat gesagt, das wird wieder eine denkwürdige Zeit. Schon am Frühstückstisch habe ich gewusst, dass Mutter etwas beschäftigt, denn dann tut sie immer Dinge, die ganz falsch sind. Zuerst ist eine Maschine zum Fenster hereingeflattert und hat vor Mama einen Brief hingelegt. Das Schreiben hat sie bestimmt verwirrt, denn danach ist sie ganz zerstreut gewesen. Hat die Cacaodose vor mich hingestellt und Milch hineingegossen, dabei hab ich meinen Cacao immer aus der Tasse getrunken. Papa ist ärgerlich geworden. Dann hat der Anton geklopft und gesagt, da ist eine Depesche gekommen und Mutter ist schwindelig geworden. Eufemia kommt!, hat sie gerufen und ist in die Küche gelaufen, um der Minna die gute Nachricht zu erzählen. Ihr Gesicht war ganz weiß. Papa aber ist rot geworden wie ein Apfel. Draußen hat die Köchin gerufen, wie sie das auf ihre alten Tage verdient hätte. Ich habe mich mit ihnen gefreut und in die Hände geklatscht. Ist das nicht eine schöne Überraschung?, habe ich gerufen. Fatal!, hat Vater nur gesagt. Meine Brüder Franz und Eduard wollten mich für meine Dummheit sanktionieren. Tante Femia, haben sie gesagt, ist der Tod! Und für diese Unhöflichkeit haben sie nicht einmal eine Kopfnuss einkassiert.
Weil ich beim letzten Besuch der Tante aber zu klein war, um mich daran zu erinnern, haben sie mich verschont. Jetzt weiß ich, weshalb Tante Femia der Tod ist und wir alle hoffen, dass sie recht bald wieder heimfährt.
Brief von Clara von V. an Anna und Paul M.
Creuzburg, 35. Februar, 1880
Kinder, was soll ich sagen? Eufemia meldete sich an und stand kurz darauf vor unserer Tür. Im Augenblick hat sie sich im Logierzimmer niedergelegt und gönnt sich – und uns - eine Stunde Ruhe. Dank deines Rezepts, Anna, ist immer noch nichts von ihr zu hören! Deshalb habe ich unsere Geheimwaffe Soupe Silence getauft, denn solange Eufemia schläft, ist es friedlich im Haus. Sonst aber weiß sie auch diesmal wieder mit guten Ratschlägen zu dienen: Oh, Clara! Haben eure Stubenmädchen hier freie Hand? Unsere Angestellten halten sich strengstens an meine Anweisungen. Domestiken muss man klein halten, sonst tanzen sie einem auf der Nase herum und ehe man Ohweh! rufen kann, sitzen sie am Herrschaftstisch und geben Order.
Oder: Ich kaufe immer Prima-, niemals Secunda-Qualität, sagte sie, fuhr mit dem Zeigefinger über die Blumenbordüre des Porzellans und grub die Zähne in die Unterlippe, als müsse sie ihr Mundwerk daran hindern, eine grässliche Entdeckung loszulassen. Ich wunderte mich nur, denn das Service trägt das Signet der Königlichen Porzellan-Manufaktur, welches sie letztes Frühjahr immerhin veranlasst hat, mit einem herablassenden Zischen zu bemerken, es sei nur bis zu einem gewissen Maße statthaft, zu prunken. Überschreite man hingegen die Grenze des guten Geschmacks, gelte es als hoffärtig und außerdem würde sodann, ganz nach dem Leitspruch noblesse oblige, umso größere Wohltätigkeit von einem erwartet, welche wiederum mit immensen Ausgaben verbunden sei. Man schneide sich also nur in das eigene Fleisch, wenn man seiner Gefallsucht nicht Herr werde.
Nun, ihren vergangenen Einwand scheint sie vergessen zu haben und kam diesmal auch nicht auf die Idee, den Teller herumzudrehen, um die Marke zu prüfen. Was mich auf den Gedanken bringt, dass ihre wohl- und unwohlgemeinten Ratschläge abgefeuert werden, je nach Zufall und Stimmung, wie sie Lust und innerer Impuls in einem gewissen momentum den gegebenen Zustand begreifen lassen. Aber möge da kommen was wolle, als Hausherrin werde ich mir auf keinen Fall das Szepter aus der Hand nehmen lassen, wie es letztes Frühjahr nolens volens geschehen ist – ich war damals auf einen Überfall dieser couleur nicht eingestellt -, als sie das Regime übernahm, die Kinder nach ihren Maßregeln zu erziehen begann, die Hausmädchen von früh bis spät treppauf treppab scheuchte und der Köchin auf die Finger schaute, bis der Guten die Tränen kamen. Dass ich damals nicht auch den Schlüssel zum Wäscheschrank herausgeben musste, grenzte an ein Wunder.
Du hast in deinem letzten Schreiben so anteilnehmend nach Großmutter gefragt, Anna, deshalb will ich auch von ihr berichten: Großmutter Clementine erfreut sich mit ihren fünfundachtzig Jahren bester körperlicher Gesundheit, von Sonnenauf- bis Sonnenuntergang wackelt sie durchs Haus mit einer Kondition, die ich als Backfisch nicht hätte vorweisen können. Was ihren Geisteszustand anbetrifft, so muss ich dir sagen, sie lebt in vergangenen Sphären. Mit dem Alter erwachen frühere Kindheits- und Jugenderinnerungen, mit jedem Jahr werden alte Erlebnisse realer, drängen sich ihrem inneren Auge auf und erblühen zu lebendigen Szenen, die sich wiederholen und immer wieder aufs Neue durchgespielt werden. Angelegentlich spricht sie mit der Stehlampe, unterhält sich mit dem Möbel gerade so, als wäre sie zwanzig Lenze jung und führte Konversation auf einem Ball. Oder sie postiert sich vor einer Vase und disputiert mit ihr. In hellster Aufregung! Mama hat mir einmal erzählt, die gute Clementine habe es nie verwunden, dass ihr erster Verehrer in grauer Vorzeit sich ihr einst ab- und einer anderen zugewandt hat. Wer aber dieser Don Juan gewesen sein soll, weiß niemand. Manchmal hören wir, wie sie mit diesem Herrn spricht und ihn beim Namen nennt (Ari), doch es ist eine Koseform, die uns nichts sagt.
Die Abwechslung durch Eufemias Überfall schließlich tut ihr nicht gut. Die Veränderung in unserem Tagesablauf macht sie nervös und nicht selten reagiert Großmutter ungehalten ob Eufemias wichtigtuerischem Gehabe. Soeben beim Mittagessen par exemple