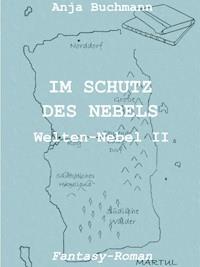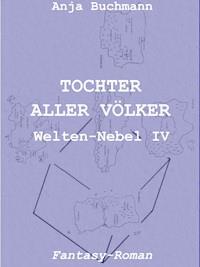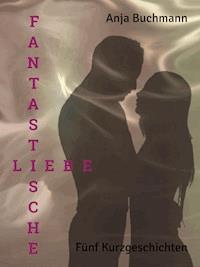Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein mysteriöser Tod, eine einsame junge Frau und zwei Männer, die um ihre Gunst buhlen. Lily hat es nicht leicht. Ihr neuer Chef Darius ist wohlhabend und tut alles, um ihr Vertrauen zu gewinnen, aber dann erfährt sie etwas über ihn, was sie aus der Bahn wirft. Und da ist auch noch der arrogante Nachbar Liam, der dem Alkohol offenbar etwas zu sehr zugeneigt ist. Das mindert die Anziehung, die er auf Lily ausübt, jedoch nicht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 90
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Herz über Blut
Herz über Blut
HERZ ÜBER BLUT
LUST AUF MEHR?
Impressum
Herz über Blut
Romantasy von Anja Buchmann
HERZ ÜBER BLUT
ENDE OKTOBER
Eine unerwartete Bewegung am Rande seines Gesichtsfelds ließ ihn zusammenzucken. Bei seiner ruckartigen Drehung hätte er beinahe die schwarze Bodenvase mit dem Bündel Weidenzweige umgerissen.
Was er für eine Bedrohung gehalten hatte, entpuppte sich als herbstlicher Lufthauch, der durch das geöffnete Fenster geweht war und die blauen Vorhänge blähte.
»Schließ' das Fenster!«, wies er einen seiner Begleiter an. Der junge Mann gehorchte.
Seine behandschuhten Hände strichen über den verblichenen roten Samtbezug eines Sessels. Er widerstand dem Drang, in dem wohlvertrauten Möbelstück Platz zu nehmen. Spuren konnte er sich nicht erlauben.
Das Geräusch des Schlüssels im Schloss. Seine beiden Angestellten reagierten schnell und nahezu geräuschlos. Nur Augenblicke später zerrten sie eine Frau mittleren Alters in das kleine Wohnzimmer. Sie war vollkommen starr, nur der Blick ihrer grünen Augen huschte panisch zwischen den Angreifern und ihm hin und her.
Die beiden Männer in den schwarzen Anzügen ließen sie rücklings auf den bunten Webteppich fallen. Er positionierte sich so, dass sie ihn gut sehen konnte. Ihre Augen spiegelten Erkennen.
»Hast du etwa gedacht, du könntest dich ewig vor mir verstecken?« Sein Lachen war kalt und misstönend. »Keine Angst, die Betäubung wird in ein paar Minuten nachlassen. Dann wirst du mir sagen, wo sie ist. Andernfalls …« Die Waffe schmiegte sich perfekt in seine Hand. Die Macht, die ihn durchströmte, war berauschend.
»Du wirst sie niemals finden!« Die Stimme der Frau zitterte. Ihre Worte aber waren klar und durchdrungen von einer eigentümlichen Kraft. Das Muskelrelaxans schien schlagartig seine Wirkung verloren zu haben. Viel zu früh. Er durfte diese Frau auf keinen Fall unterschätzen.
Seine Handlanger waren zur Stelle, hielten ihre Arme und Beine. Sie wehrte sich nicht, starrte ihn an. Ihn fröstelte. Der Raum schien um mehrere Grad kälter geworden zu sein. Er hatte keine Lust auf ihre Spielchen oder ein langwieriges Kräftemessen. »Ist das dein letztes Wort?«, fragte er, während ihre Blicke einen stummen Kampf ausfochten.
Ihre Antwort bestand aus einem Lächeln.
Er nickte und einer seiner Männer zog eine Spritze hervor. Fasziniert beobachtete er, wie die Nadel in das helle Fleisch ihres Halses drang. Es dauerte nur Sekunden, bis das Feuer ihres Blickes verlosch.
Er ließ sich auf die Knie nieder, strich ihr eine Locke aus dem Gesicht. Als sie einander das letzte Mal begegnet waren, war das Blond noch nicht von silbernen Fäden durchzogen gewesen. Sie war noch immer eine Schönheit. Ein Stich des Bedauerns durchzuckte ihn, als er ihr sanft die Lider zudrückte.
Auf der schwarz glänzenden Wölbung der Vase erblickte er für einen Moment seine eigenen müden und alternden Gesichtszüge.
Schweißgebadet wachte er auf. Das Sonnenlicht, welches durch die trüben Fensterscheiben seines Appartements sickerte, vertrieb die verstörenden Traumbilder. Liam warf einen Blick auf die Uhr. Viertel nach elf. Zu früh, bedachte er, dass seine Schicht als Türsteher erst um fünf Uhr morgens geendet hatte. Egal, er würde ohnehin nicht wieder einschlafen können. Träume, in denen er nicht er selbst war, hatte er, seit er denken konnte. Manche waren angenehm, andere eher nicht, doch selten waren sie so intensiv wie dieser. Die Emotionen und Gedanken des Mannes hatten sich so real angefühlt wie seine eigenen. Er hatte einen Blick in den Kopf eines Mörders geworfen, auch wenn es nur ein Traum war. Was sagte das über ihn aus? Mit aller Macht drängte er die Frage beiseite. Entschlossen schlug er die Decke zurück. Als er die Füße auf das blanke Laminat setzte, zuckte er kurz zurück. Dann aber hieß er die Kälte willkommen, half sie ihm doch, einen klaren Kopf zu bekommen.
Es waren nur drei Schritte bis zum Badezimmer. Insgesamt hatte seine Wohnung keine zwanzig Quadratmeter. Es störte ihn nicht weiter. Wozu unnötig Geld für eine größere Bleibe verschwenden, wenn er ohnehin nur zum Schlafen herkam.
Er stieg in die Dusche. Der Wasserstrahl glich eher einem Tröpfeln. Liam fluchte. Die Leitungen waren so alt wie das Haus. Die Wohnungsknappheit erlaubte es Hauseigentümern, selbst die schäbigsten Bruchbuden zu horrenden Preisen zu vermieten. Wieso also in Renovierungen investieren?
An Tagen wie diesem fragte er sich, warum er nicht längst seine Sachen gepackt hatte und zurück in die Kleinstadt gezogen war, aus der er stammte. Insgeheim aber wusste er, dass dies keine Option war. Er war nicht sein Bruder, der dort im Haus seiner Eltern einen auf Familienidylle machte. Die Gründe, aus denen er vor acht Jahren von dort geflüchtet war, sie existierten noch immer. Er griff sich das Handtuch, rubbelte über seinen braunen Haarschopf, warf gleichzeitig einen Blick in den Spiegel. Die Bartschatten auf Kinn und Wangen ließen ihn älter wirken als sechsundzwanzig. Liam ging zurück in den Wohnraum, trocknete den Rest seines Körpers ab, bevor er in Jeans und Pullover schlüpfte. Seine Arbeitskleidung, ein schwarzer Anzug, den er zu einem ebenso schwarzen T-Shirt trug, hing auf einem Bügel an der Schranktür.
Er hatte Hunger, und da sein Kühlschrank nichts enthielt als zwei Flaschen Bier und die Reste des Take-Aways vom Morgen, zog er gleich noch die Lederjacke und die zerlatschten Chucks an. Wenig später saß er in seinem Stammcafé. Die Bedienung brachte unaufgefordert schwarzen Kaffee und wenig später einen Teller mit Spiegeleiern und Schwarzbrot. Er aß mit gutem Appetit, um sich für den Nachmittag zu stärken. Sonntags trainierte er immer Jugendliche des Viertels in Selbstverteidigung. Kampfsport hatte ihm durch die Wirrungen der Jugend geholfen. Es war seine Art, etwas zurückzugeben.
28. NOVEMBER
Der schwere Zopf schlug bei jedem ihrer raschen Schritte gegen ihren Rücken. Für gewöhnlich nahm Lily es nicht wahr, trug sie ihr Haar von Kindesbeinen an lang. Ihre Mutter wollte es so - hatte es so gewollt. Sie erinnerte sich an den heftigen Streit, den sie gehabt hatten, nachdem sie sich zu ihrem achtzehnten Geburtstag die blonde Mähne um nicht mehr als zwei Handbreit hatte kürzen lassen. Es war sechs Jahre her und doch kam es ihr vor, als wäre es gestern gewesen. Im Gehen wühlte sie in ihrer riesigen Handtasche, fand aber kein Taschentuch in den Untiefen des abgewetzten brauen Lederungetüms. Daher wischte sie sich mit dem Ärmel des schwarzen Wollmantels über das Gesicht. Lily trug kein Make-up, das sie hätte verschmieren können.
Wenig später saß sie auf einem Friseurstuhl. »Wie viel soll ich abschneiden?«
»So viel wie möglich.«
»Sind Sie sicher? So schön lang, wie Ihr Haar ist, könnte ich es schulterlang lassen und hätte dennoch genug für zwei Perücken.«
»Die Länge und Menge entscheidet über den Preis?«
»Ja.«
»Dann machen Sie einen Kurzhaarschnitt.«
»Wie Sie wollen.«
Lily versuchte, nicht auf das Klappern der Schere zu achten. Schließlich war es nicht so, als ob sie eine Wahl hätte. Sie brauchte das Geld, das der Perückenmacher ihr für ihre hellblonde, glatte Haarpracht zu zahlen bereit war. Mit ihrem Umzug in die Stadt hatte sie ihre Stelle als Bibliothekarin aufgeben müssen. So schnell hatte sie keine neue gefunden, sodass sie sich momentan als Bedienung in einem Schnellrestaurant über Wasser hielt. Der Verdienst reichte gerade so aus, um die vollkommen überteuerte Wohnung, die Krankenversicherung und andere unbedingte Notwendigkeiten zu bezahlen. Ihre Ersparnisse waren für die Beerdigung darauf gegangen und noch hatte sie keinen Käufer für das Häuschen ihrer Mutter gefunden, sodass sie weiterhin für alle Nebenkosten aufkommen musste. Sie musste unbedingt einen besser bezahlten Job finden.
»So, fertig!«
Lily schreckte aus ihren Gedanken, warf einen Blick in den Spiegel. Der Pixie sah gut aus, frech, jung, modisch. Es war, als schaue sie ein völlig neuer Mensch an. An diesen Anblick würde sie sich noch gewöhnen müssen. Fast bereute sie ihre Entscheidung, tröstete sich damit, dass sie nun nicht mehr Stunden mit Föhnen und Kämmen zubringen musste. Waschen, etwas Gel, das war's.
Das Geld, welches der Perückenmacher ihr aushändigte, steckte sie ein, ohne es nachzuzählen.
Bis zu ihrem Arbeitsbeginn – sie hatte die Spätschicht von sechzehn Uhr bis Mitternacht – blieb ihr noch etwas Zeit. Etwas ziellos streifte sie durch die Straßen. Überall weihnachtete es. Die Geschäfte überboten sich mit Werbung für die besten und originellsten Geschenkideen. Ihr konnte es egal sein. Sie hatte niemanden, dem sie etwas schenken konnte. Ihre Mutter war die einzige Verwandtschaft gewesen, die sie hatte. Sie waren einander immer genug gewesen. Nun war Lily allein. Außer ihren Kollegen kannte sie niemanden in der Stadt. Vielleicht hätte sie ihr heimatliches Dorf nicht so übereilt verlassen sollen. Doch dann müsste sie die mitleidigen Blicke aushalten, die Fragen nach ihrem Befinden. Ertrüge sie dies? Wegzuziehen war die richtige Entscheidung gewesen.
Ein Mann rempelte sie an. Nickend nahm sie seine Entschuldigung entgegen, ohne ihn anzusehen.
Er konnte nicht anders, als der jungen Frau hinterherzustarren, die sich mit schnellen Schritten in den Strom der nachmittäglichen Flaneure einfügte. So geübt er darin war, seine Empfindungen hinter einer undurchdringlichen Maske aus höflicher Zurückhaltung zu verstecken, in diesem Augenblick sah man ihm seine Gefühle gewiss an. Das wusste Darius und es war ihm egal. Alles, was zählte, war die Frau, die inzwischen in der Masse der Menschen verschwunden war.
Dreiundzwanzig Jahre hatte er nach ihr gesucht. Monatelang hatten Detektive das Haus ihrer Mutter beobachtet. Vergeblich. Und nun stolperte er förmlich über sie? Das konnte einfach nicht mit rechten Dingen zugehen. Gwen, die verfluchte Hexe. Eigentlich war es jetzt egal, wie sie es angestellt hatte, wissen aber wollte er es dennoch. Wichtiger aber war es, Kontakt zu Lilith herzustellen. Die Stadt war groß, aber er hatte seine Leute. Darius blickte um sich, entdeckte eine Handvoll Verkehrs- und Überwachungskameras. Bildmaterial würde sich finden lassen. Er lächelte zufrieden.
29. NOVEMBER
Kam es ihm nur so vor, oder wurde die Klientel, mit der er sich an der Clubtür herumschlagen musste, immer anstrengender? Als er sich um Viertel nach sechs endlich auf den Heimweg machen konnte, war Liam mit den Nerven am Ende. Vielleicht sollte er in Zukunft versuchen, mehr Aufträge als Bodyguard zu übernehmen.
Wie aufs Stichwort klingelte sein Smartphone. Die Agentur, die ihm seine Aufträge als Personenschützer vermittelte. Er war darauf angewiesen, denn zwei bis drei Nächte pro Woche als Türsteher zu arbeiten, war zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel.
Er nahm ab. »Ja?«
Die Stimme am anderen Ende war jung und weiblich. Es war eine der zahlreichen Praktikantinnen, die für einen Hungerlohn rund um die Uhr arbeiteten und nie lange genug blieben, als dass er sich ihre Namen merkte.
Das Gespräch war kurz. Alle wichtigen Informationen würde er ohnehin noch einmal per Mail bekommen. Der Arbeitsbeginn war schon übermorgen. Normalerweise erhielt er die Aufträge mindestens eine Woche im Voraus. Noch eigenartiger an dem Job war, dass er von unbestimmter Dauer zu sein schien. Normalerweise buchte man ihn für einzelne Tage oder Stunden. Personen, die permanenten Schutz brauchten, trafen Langzeitarrangements mit freiberuflichen Bodyguards und sparten sich die Provision für die Agentur. Nun, möglicherweise wollte der Auftraggeber seine Dienste erst einmal testen, um ihn dann abzuwerben. Aber da war er bei ihm an der falschen Adresse. Er konnte sich einfach nicht vorstellen, längerfristig für eine Person zu arbeiten, artete so etwas irgendwann zwangsläufig in eine Ein-Mädchen-für-Alles-Position aus und das rund um die Uhr. Darauf konnte er verzichten. Er war kein guter Untergebener, brauchte seine Freiheit.
30. NOVEMBER