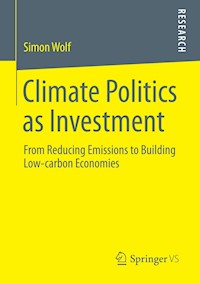3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Allgemein Naturphilosophie; Schwerpunkt menschliche Kognition und Willensfreiheit; Existentialismus,Determinismus, Phänomenologie und Soziologie; spezielle Vergleiche und Deutungen zwischen ontologischen Konzepten, kausalen Begriffen und Shunyata (Leere).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Der Destruent
Über die Kehrseite von Natur
&
die Demontage des Kausalen
ISBN Softcover: 978-3-347-91191-8
ISBN Hardcover: 978-3-347-91192-5
ISBN E-Book: 978-3-347-91193-2
Druck und Distribution im Auftrag des Autors:
tredition GmbH, An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Germany Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Für die Inhalte ist der Autor verantwortlich. Jede Verwertung ist ohne seine Zustimmung unzulässig. Die Publikation und Verbreitung erfolgen im Auftrag des Autors, zu erreichen unter: tredition GmbH, Abteilung "Impressumservice", An der Strusbek 10, 22926 Ahrensburg, Deutschland.
Die Geburt ist kein Gewinn,
das Sterben ist kein Verlust.
Beneide die frei sind,
bedaure die müssen.
Der Tod nimmt alles,
die Leere nimmt nichts.
Inhalt
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
1. Kapitel: Das antagonistische Prinzip
1.1 Mephistos Aufgabe
1.2 Die Entstehung der Absicht
1.5 Emotion - Selbstüberhebung
1.6 Organik und Selbstzweck
2. Kapitel: Innere Konstruktionen
2.1 Erscheinung und Täuschung
2.2 Imaginäre Paradiese
2.3 Kronos
3. Kapitel: Information
3.1 Entscheidungsbaum
3.4 Sinnzwang - Erbschuld
4. Kapitel: Leben
4.1 Quantität vs. Qualität
4.3 Verhalten
5. Kapitel: Tun und Nicht-Tun
5.1 Vom Reaktiv
5.3 Duktus der Guten Absicht
6. Kapitel: Leere
Einführung
Wirkungsleere
Erscheinungsleere
Ursachenleere
Ein abschließendes Modell
Anhang
Glossar
DER DESTRUENT
Cover
Titelblatt
Urheberrechte
1. Kapitel: Das antagonistische Prinzip
Glossar
DER DESTRUENT
Cover
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
1. Kapitel
Das antagonistische Prinzip
Das Selbst, das machen muss,
ist das Selbst, das lassen muss.
1.1 Mephistos Aufgabe
Wenn wir von Antagonismus sprechen meinen wir keine sichtbaren und äußeren Widersacher. Wir reden nicht von irgendwelchen heldenhaften Protagonisten aus Mythen, Legenden oder Sagen. Wir meinen auch keinen medizinischanatomischen Gegenspieler oder dualen Konzepte. Was wir meinen erklärt sich also auch nicht an Hegels dialektischem Begriff vom Widerstreit. Die Synthese der Dialektik ist ein Kompromiss zwischen zwei konträren Polen, aber kein Antagonismus, der Kompromisse ebenso komplett negiert wie demontiert.
Der Begriff des Antagonismus ist nicht abgetan mit Synonymen wie Gegenspieler, Antithese, Kontradiktion oder Gegenpart, die mittels These oder Protagonist duale Konzepte erfüllen und den Begriff von Einheit suggerieren. Das grundlegend Destruktive, das Antagonismus kennzeichnet, bietet keine Basis für Kompromisse zu gegenseitigem Nutzen. Weder tritt es in Verhandlungen noch macht es Angebote oder lässt mit sich handeln. Das Destruktive ist sowohl eine Vorgabe oder Bedingung des Finiten wie die Ultima Ratio jeder Handlungsoption. Anders ausgedrückt, das Limit jeder Fähigkeit oder Möglichkeit von Wachstum oder Expansion ist dessen Unfähigkeit oder Unmöglichkeit zur Überschreitung der Konstruktion eines Inneren-Äußeren, dem jedes System zugrunde liegt. Exakt hier greift das antagonistische Prinzip, indem es auf sich selbst zurückwirft, was sich selbst und seine Limits oder Belastungsgrenzen überschreitet1.
Das Destruktive hat keine eigene Agenda oder aktives Konzept. Es führt nichts zusammen und baut nichts auf. Es zerstört, es trennt und treibt Dinge auseinander. Diese Gegen-Wirkung eines Destruktiven ist zugleich die Folge oder Reaktion eines Konstruktiven, das an sein qualitatives und/oder quantitatives Maximum stößt oder dieses überschreitet.
Natur besteht in selbstregulierenden Prozessen, die notwendige Unter- wie Obergrenzen, Anfangs- und Randbedingungen anzeigen (Naturgesetze). Jedes Selbst von Natur, das sich als systemische Selbsterhaltung (via Selbstordnung und Selbstorganisation) zeigt, durchläuft mittels seiner Grundlagen eine zeitliche Selbstverstärkung (Entwicklung mittels Veränderung), die seine eigenen Grundlagen verändert2. Kein Selbst von Natur kann sich also über seine eigenen, jeweils spezifischen Grundlagen entwickeln. Kein Etwas (Unterschied oder Abweichung mittels Ding/Ereignis/Phänomen) kann in dieser Welt erscheinen, sprich stattfinden oder temporär bestehen, sofern es nicht quantitative/qualitative bzw. räumlichzeitliche Limits enthält.
Betrachten wir jegliche Art von System und dessen Konstruktion, wird deutlich, was die innere-äußere Wechselwirkung (System und Umgebung) eigentlich bedeutet.
Jedes innere Element, ob konkret strukturell oder physisch abstrakt, ist gleichermaßen Element eines Äußeren, wie jedes äußere Element Ursache und Wirkung eines Inneren. Jedes prozesshafte Produkt (System) einer jeweiligen Interaktion der Umgebung wirkt als Ursache der Veränderung über den Umweg seiner Umgebung zugleich auf sich selbst zurück3. Der Prozess jeder Veränderung und/oder Entwicklung resultiert daher aus der Gegensätzlichkeit innerer und äußerer Elemente, die sich als ein jeweiliges System und dessen jeweilige Umgebung konstruieren.
Veränderung ist Entwicklung.
Der Begriff der Entwicklung schließt finale Zustände generell aus. Finale Zustände sind zeitlich unmöglich, da sie als Stillstand oder Stagnation zugleich ihre eigene Destruktion einbeziehen. Alles Bestendende verändert durch sein Bestehen auch seine Bedingungen - bis zur Unmöglichkeit seines weiteren Fortbestands. Dafür sorgen die Wechselwirkungen der inneren-äußeren Elemente, aus denen dieses Bestehende effektiv hervorgeht. Kurz, jeder aktuelle Zustand (Ereignis, Erscheinung oder Phänomen) überholt sich durch sein Bestehen, indem es verändert, woraus es entstanden ist.
(Zeit selbst ist das Phänomen für die Richtung einer Wirkung, die sich in ihrem Ablauf gegen sich selbst richtet. Es ist aus Sicht von Natur einfacher innere-äußere Elemente voneinander zu trennen und getrennt zu halten als miteinander sie zu verbinden und dauerhaft im Gleichgewicht zu halten.)
Entwicklung oder was auch immer sich konkret entwickelt (Unterschied), umfasst also ebenso Konstruktion wie Destruktion - und dies unabhängig von Bewertungskategorien.
Ohne Möglichkeit von Selektion oder Korrektur keine Möglichkeit von Entwicklung. Das vordergründig Destruktive ist also hintergründiger Teil eines Konstruktiven, da es finit auf Bestehendes einwirkt.
Die vollendete Tatsache oder Endgültigkeit ist eine Veränderung, die als Sachverhalt veränderlicher Bedingungen auftritt, ob nun notwendig oder möglich. Jede Destruktion ist somit Vor-, Zwischen oder Endstufe eines konstruktiven Mechanismus, der mittels negativer Rückwirkung in eine neue Phase der Selbstorganisation übertritt. Was sich an einer Stelle ausdehnt, zieht sich an anderer Stelle zusammen etc. Jedes Limit ist zugleich eine Schutz- oder Erhaltungsfunktion für Mögliches, jedes Finite Grundlage eines Konstruktiven.
Das antagonistische Prinzip und dessen destruktiven Eingriffe in Bestehendes lässt sich durch seine negative Rückwirkung also als notwendigen Schutz- oder Erhaltungsmechanismus jeglicher Wirkung auffassen. Seine destruktive Umkehrung von konstruktiver Wirkung ist deren Zurückführung auf eine zeitlose Ursache. Anders, jede Möglichkeit, die zeitlich zwangsläufig ihre eigenen Grundlagen übersteigt, reduziert sich selbst auf ihre Notwendigkeit. Dies gilt für sämtliche Prozesse (Ereignisse, Erscheinungen oder Phänomene).
Zur allgemeinen Einordnung einer konstruktiver-destruktiven Wechselwirkung in die Abläufe von Natur lässt sich an dieser Stelle die temporale Logik heranziehen.
Möglichkeit und Unmöglichkeit4 unterstehen zeitlicher Korrektur. Die Bedingung für jedes Auftauchen von Emergenz5 (Ereignis, Erscheinung oder Phänomen) im Aktuellen ist das Vergehen (derselben Ereignisse, Erscheinungen oder Phänomene) im Aktuellen: Transformation.
Entstehung bedingt Veränderung oder Wandel von Bestehendem. Was entsteht, kann sich nur entwickeln, indem sich Bestehendes verändert. Die Transformation von Zuständen ist die fundamental notwendige Bedingung einer ‚bestmöglichen Welt‘.
Machen wir einen kurzen Ausflug ins Belletristische.
Das antagonistische Prinzip kommt nirgends trefflicher zum Ausdruck als im pathetischen Monolog des Mephistopheles6. Wenn es dort heißt: ‚Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das Gute schafft …‘, bedeutet dies nichts anders, als dass das vermeintlich Negative und Destruktive notwendiger Bestandteil einer Welt ist, die sich zeitlich verändern muss.
Und weiter: ‚Ich bin der Geist, der stets verneint!‘ Die Negation jeglicher Kompromisse ist das Aufzeigen von Limits, die für Bestehendes nicht verhandelbar sind (Naturgesetze).
Eine anhaltende Nicht-Beachtung von Notwendigem hat Konsequenzen, die eine vorherige Nicht-Beachtung mit einer gleichwertigen Unvermeidlichkeit ausgleicht. ‚Und das mit Recht; denn alles was entsteht, ist wert, dass es zugrunde geht;’. Das Recht des Destruktiven ist die Folge einer festgelegten Relation zwischen Notwendigkeit und Möglichkeit. ‚Drum besser wär’s das nichts entstünde‘, zeigt nur an, dass das Destruktive selbst, wie Mephisto es verkörpert, von einem Konstruktiven in eine Funktion gezwungen wird. Mephisto bezweifelt zwar die übergeordnete Gesamtidee, muss sie aber bekennen, da ‚der Alte‘ das Spiel und somit Tun und Wirkung bereits ungefragt angestoßen hat. Als dienstbarer Geist muss er korrigieren, was dem Bestmöglichen zuwiderläuft. ‚So ist denn alles, was ihr Sünde, Zerstörung, kurz das Böse nennt, mein eigentliches Element.‘ Daher lenkt Mephisto das Unbegrenzte, das seine zulässigen Limits überschreitet, maximal auf sich selbst zurück.
Die plumpe und wertende Allegorie eines gegensätzlichen Gut-Böse zwischen konstruktiven und destruktiven Elementen ist hier keine Ergänzung per se, sondern das notwendige Fundament für jede Wechselwirkung, die physikalische Wirkung allgemein antreibt. Veränderung, aktueller Wandel und/ oder Wandelbarkeit eines jeden Aktuellen resultiert aus der gegensätzlichen Ergänzung von Bestehendem. Jedes Antagonistische ist ein Ergänzendes, das ein Konstruktives bemisst, korrigiert und auf seine aktuelle Tauglichkeit testet, damit es temporär bestehen kann.
Mephisto selbst ist passiv, er tut nichts. Er unterlässt, lehnt das Tun grundsätzlich ab. Er verneint die Welt und baut nichts auf, da er sämtliche Dinge stets von ihrem Ende betrachtet und denkt. Für ihn ist alles, was in die Welt eintritt, entsteht oder wächst illusorisch. Es bleibt ohnehin nicht bestehen. Es zerfällt, vergeht, muss weichen. Nichts von allem bleibt zurück oder kann festgehalten werden. Für Mephisto läuft letztlich alles aufs Gleiche hinaus. Ins Vergessen.
Wozu also abstrampeln, wenn sowieso nichts zurückbleibt und alles für die Katz’ ist? Wieso der Illusion anhängen, existieren und festhalten müssen, was Tod und Vergessen zunichte machen?
Das Leben und alles Sein ist für empfindsame und leidensfähige Lebewesen kein Geschenk oder Segen, sondern sein eigener Untergang und Fluch. Sein Antagonismus bestätigt ihm die Kehrseite alles Konstruktiven. Wille ist Zwang, Sinn ist Unsinn, Wachstum ist Zerfall.
Aber gerade Mephistos Nicht-Tun, seine Ablehnung von Konstruktivem, seine Weigerung zur Aktivität und sein Unterlassen gibt ihm die unfreiwillige Rolle des Regulierenden.
Für ihn, für den alles Bestehende unnötig ist, ist das Notwendige Bedingung zur Teilnahme an einem Spiel, an dem er gar nicht teilnehmen will, aber muss. Es geht nicht ohne ihn, den erzwungenen Bösewicht und Übeltäter, der keine Kompromisse machen darf, weil diese samt und sonders dem ‚Alte‘ zufallen, der den selbstlosen Wohltäter gibt.
Das Destruktive ist Mephistos Pflichtbeitrag und Dienst am Spiel, dem ausgehandelten quid pro quo mit dem ‚Alten‘. Also reagiert Mephisto erst, sobald Extreme erreicht oder Limits überschritten werden. Und er reagiert so, dass sich die jeweils grenzverletzende Wirkung umkehrt und gegen ihre Ursache richtet. Nur dank seiner Reaktion und Korrektur kann der ‚Alte‘ ebenso letztlich konstruktiv agieren, wie Mephisto destruktiv reagieren. Das Übrige erledigt sich von selbst. Mehr ist nicht nötig zur Übertagung und Umkehrung sämtlicher Anfänge in ihre Enden.
Tatsächlich ist Mephisto also gar nicht der Übeltäter oder Bösewicht, dessen Antagonismus vorsätzlich oder willentlich Bestehendes zerstört oder vernichtet. Zum einen ist er der finale und zynische Aufklärer, der Einbildung, Zwänge und Selbsttäuschung aufzeigt. Seine Verneinung ist die zynische Form einer Aufklärung, die menschliche Aufklärungsfähigkeit und deren Ambitionen durch die Wirkung von Tod und Vergessen ins Untragbare überhöht und dort annulliert. Zum anderen ist er der ständige Befreier von Schmerz und Leiden, die aus der fehlgeleiteten Illusion einer oktroyierten Existenz erwächst. Denn das Müssen der Selbsterhaltung bewirkt in seiner Fehlauslegung von skrupelloser Selbstbehauptung oft ein gewaltsames Festhalten-Wollen, das als Macht- und Besitzanspruch Leiden erst hervorbringt.
Somit ist das Antagonistische nicht nur das reaktive Element notwendiger Limits, sondern die basale Wächterinstanz einer Selbsterhaltung, die mittels Hunger und Krankheit, Alter und Tod ihrerseits ein menschliches Loslassen dessen erzwingt, was nicht von seinen Limits loslassen kann oder will.
(Es stellt sich zurecht die Frage, ob die faktisch gescheiterte Aufklärung in ihrer bejahenden Form nicht geradezu verlangt nach ihrer verneinenden Form, wie sie der Zynismus bietet. Dass die bejahende Form der Aufklärung faktisch gescheitet ist, beweisen die allgemeine wie stetige Hinfälligkeit von menschlicher Vernunftfähigkeit sowie im Gegenzug die Wirksamkeit instinktiver Vorgaben. Was es mit beidem auf sich hat, werden wir im Textverlauf eingehend aufzeigen, nachweisen und entsprechende Rück-Schlüsse auf menschliches Verhalten ziehen.)
Wir wollen dieses antagonistische und reaktive Element einer übergeordneten Selbsterhaltung von Sein oder Werden nun verdeutlichen anhand einiger Beispiele.
Der elementare Beitrag jeder Reaktion, die aus einer entsprechende Aktion folgt, lässt sich anhand physikalischer Vorgänge besonders plastisch hervorheben. Werfen wir dazu einen Blick auf das 3. Newtonsche Gesetz7, das als Actio und Reactio das Wechselwirkungsprinzip zwischen Kräften beschreibt. Jede Kraft, die ein Körper A auf einen anderen Körper B ausübt (Actio), wirkt mit der gleichen Kraft von Körper B auf Körper A zurück (Reactio). Jede Kraft unterliegt dem Wechselwirkungsprinzip. Sie wirkt auf sich selbst zurück oder ist sich selbst entgegen gerichtet. Das Resultat der Wechselwirkung zwischen einer beliebigen Anzahl sich selbst entgegen gerichteter Kräfte ist also eine gegenseitige Ergänzung durch Gegensätzlichkeit.
Die Gleichgewichtskraft eines beliebigen Körpers (Körper X) ist also ein Produkt sämtlicher Kräfte, die sich in Summe durch ihre Gegensätzlichkeit aufheben und somit Körper X im Gleichgewicht halten.
Das Antagonistische, wie die gesetzmäßige Actio-Reactio nahelegt, ist hier nicht nur Ausgleichendes, Neutralisierendes oder Hemmendes mittels Zerstörung, sondern hat auch eine ordnende, wie schützende und erhaltende Funktion. Folglich findet jede Möglichkeit von Wirkung ihre Grenzen im Rahmen einer notwendigen Bedingung, der sie zugrunde liegt. Eine Kraft kann sich weder unbegrenzt noch unendlich verstärken, ohne sich selbst zu zerstören bzw. selbst zu regulieren. Jede aktivierte oder aktive Kraft, die wiederum das Gegenwirkende, Rückwirkende oder schlicht Reaktive aktiviert, indem sie ihre eigene Substanz überschreitet, vernichtet sich letztlich auch selbst. Jedes wirkende Selbst ist auch ein rückwirkendes Selbst, da seine Wirkung an seine Ursache (systemische Anfangs- und Randbedingungen) rückgekoppelt ist. Dieser negative Rückkopplungseffekt ist physikalisch gesetzt, da jede richtungsweisende Kraft via Wechselwirkungsprinzip immer nur funktionaler Teil der inneren-äußeren Konstruktion eines beliebigen Systems ist und sein kann. Die Obergrenze jedes Möglichen (Selbstverstärkung oder Optimierung) findet sich in einer notwendigen Untergrenze (Selbstregulierung), auf der sie zwangsläufig agiert. Die Limits jedes Möglichen sind dessen notwendige Grundlagen. Keine Wirkung kann über seine eigene Bedingung (Ursache) hinaus, ohne sich hiermit selbst zu regulieren. Die notwendigen Limits jedes Möglichen stecken also in einem Reaktiven, das dessen Ursache besetzt hält und hiermit Mögliches erst hervorbringt.
(Wir werden auf diesen fundamentalen Zusammenhang von Ursache und Wirkung noch detailliert eingehen. Siehe Kapitel 4.2 sowie Kapitel 5.1 und 5.2.)
Betrachten wir jetzt direkt das rück- und gegenwirkende bzw. antagonistische Prinzip in jedem prozesshaften Selbstmachenden und dessen Selbstlassendem (Natur).
Die rücktreibende Kraft, die jedem Pendelausschlag vordergründig entgegenwirkt, ist hintergründiger Teil der vorantreibenden Kraft. Das Gegenwirkende ist hier ebenso ein Indikator wie konstruktives Moment für Veränderung, Neuordnung und Entwicklung mittels Rückführung in ein Gleichgewicht (Nullstellung8).
Jeder Effekt von Niedergang, Zerfall, Zersetzung oder Zerstörung ist ausnahmslos im Effekt von Aufbau, Wachstum, Ausdehnung und Vermehrung angelegt. Selbst das Chaos, das mit der Zerstörung von Bestehendem einhergeht, entspricht dem inneren Ordnungsprinzip von Zeit, wobei jede Entwicklung auf die Umsetzung eines aktuellen Optimums an Möglichkeiten verweist. Die zeitliche Entwicklung sämtlicher Dinge, Ereignisse und Phänomene verordnet jede Möglichkeit von Entstehung in den Rahmen einer finalen Notwendigkeit. Emergenz ist nur möglich, da das Selbstlassende, d.h. die Vernichtung, Auflösung bzw. Zerstörung sämtlicher Dinge, Ereignisse oder Phänomene notwendig ist. Erst die Festlegung systemischer Limits ermöglicht überhaupt die Präsenz ‚formhafter‘ Struktur. Ein Unendliches ist hierbei ausgeschlossen, da alles, was strukturell überhaupt existiert und existieren kann, allein nur durch seine finiten Limits wirkt. Eine Struktur, die aktuelle Wirkung aussagt und zugleich selbst unendlich wirkt ist somit ausgeschlossen.
(Notwendigkeit ist in dieser Welt eine Grundlage, die Dinge erst ermöglicht. Optimiert sich eine Möglichkeit über ihre notwendige Grundlage erfolgt ihre unvermeidliche Einschränkung.)
Jedes offenkundige oder vordergründige ‚Gegen‘ ist somit tatsächlich ein zwangsläufiges oder hintergründiges ‚Mit‘ sowie ein abstraktes Zusammenwirken. Das scheinbare Gegeneinander ist also immer ein oktroyiertes Miteinander, das jedes duale Konzept überwindet. Was dem Inneren entgegensteht, also messbaren Widerstand und Reibung erzeugt, ist das Komplementäre, das sich ins Gegenteil überträgt. Dies gilt grundsätzlich für jede Naturbetrachtung9.
Ist jedes x-beliebige innere Element eines x-beliebigen Systems kein Teil eines Äußeren, kann es nicht temporär bestehen. Was miteinander in Kontakt tritt, interagiert auch miteinander, ganz gleich auf welcher Ebene. Folglich wirkt es stets auf sich selbst zurück und führt gänzlich intrinsisch (aus sich selbst heraus) zu effektiven Veränderungsprozessen.
Wir kommen zum letzten Aspekt, den das vordergründig destruktive Element des Antagonismus indirekt aussagt oder vorwegnimmt: Entwicklung.
Entwicklung via Veränderung oder Transformation sind immer Folge einer aktuellen Interaktion innerer und äußerer Elemente (System-Umgebung), die sich funktional übertragen. Da der Modus der Abfolge dieser Interaktion in den Ober- und Untergrenzen, Anfangs- und Randbedingungen von Systemen und ihrer Umgebung festgelegt ist, zeigen sich Ein- und Ausgang jeder aktuellen Interaktion im sichtbaren Effekt ihrer Gegensätzlichkeit10.
Das Gleiche gilt auf kategorischer Ebene. Das Mögliche trägt das Notwendige immer in sich selbst. Daher wird jedes Mögliche auch bedingt und folglich begrenzt von seiner notwendigen Grundlage. Die Bedingung jedes Möglichen findet sich daher in seiner substantiellen Ober- wie Untergrenze. Die Bedingung jeder Entstehung und dessen Ausdehnung oder Wachstun sind dessen zeitlicher Zerfall und Vergehen.
(Das Temporale, das im Notwendigen steckt und Teil jeder Wirkung ist, reguliert die Umkehrprozesse des Möglichen. Kein Sein und keine Existenz in der Natur ohne Limits. Und ebenso keine Entwicklung oder kein Werden mittels Veränderungen, wie finite Zustände sie verdeutlichen. Allein die Notwenigkeit eines Selbstlassenden ist die Möglichkeit eines Selbstmachendes. Dies gilt für sämtliche aktuellen Erscheinungen, Dinge oder Systeme.
Die Konsequenzen, die sich hieraus ableiten lassen sind ebenso umfassend und unübertrefflich wie unvermeidlich. Im menschlichen Kontext zeigt sich dieser Übergang zwischen einem Finalen, Veränderlichen und faktischer Veränderung in jeder emotionalen Erfahrung von Schmerz und Verlust, Trauer und notwendigem Neuanfang. Das zweckmäßige Loslassen von Bestehendem ist also ebenso unerlässlicher Teil sämtlicher finiter Dinge, wie vollendeter Tatsachen. Wir werden dieses zweckmäßige Loslassen, seine Bedingung und die ebenso erforderliche Haltung der Hinnahme im 5. Kapitel detailliert betrachten.)
1.2 Die Entstehung der Absicht
Zur Hervorhebung der Differenzen zwischen dem funktionalen Selbstzweck von Natur und einem menschlichen Bedeutungsdenken11 unterteilen wir an dieser Stelle zwischen Basalem und Fiktivem. Ersteres definiert generell das Selbstmachende wie Selbstlassende natürlicher wie vorsatzloser Abläufe, die menschliches Bedeutungsdenken nicht berücksichtigen. Zweites dagegen generell die menschlich-kognitive und vorsätzliche Deutung wie Auslegung natürlicher wie vorsatzloser Abläufe, die das Selbstmachende wie Selbstlassende hiermit kognitiv beugt bzw. semantisch anordnet. (Basale Fakten sind für die menschliche Emotion und die Konstruktion ihrer subjektiven Welt sekundär bis nichtig.)
Basales
Wir öffnen den Blick für das Verhältnis/Missverhältnis von menschlicher Kognition und natürlichen Limits. Unsere Kommunikationsfähigkeit mit der Natur hat ebenso ihre Limits wie der innere Monolog über die Ursache unseres Selbstbewusstseins oder die Ursache von Natur.
Wie Menschen ticken, welche Kriterien und Motive wir situativ für unsere Entscheidungen, Handlungen und Verhaltensweisen heranziehen, lässt sich nie weder exakt bestimmen noch voraussagen. Jeder Versuch der Ursachenbestimmung für menschliche Entscheidungen, Handlungen und Verhaltensweisen kann nur bei vagen Annäherung bleiben.
Mensch sein ist bereits ein ebenso komplexes System, wie dessen Wechselwirkungen mit anderen Menschen die Ursachenbestimmung menschlicher Entscheidungen, Handlungen und Verhaltensweisen weiter verkomplizieren. Zusätzliche Faktoren wie Umgebung und Situation machen die Frage nach zureichenden Gründen für jeweilige menschliche Verhaltensweisen nahezu unlösbar.
Da sämtliche Beobachtung und Erfahrung menschlicher Kognition selbst Teil der inneren-äußeren Konstruktion (Mensch-Umgebung) sind, schließen sich eindeutige Schlussfolgerungen und finale Erkenntnisse hier aus. Die Phänomenologie12bietet uns lediglich Anschauungsmaterial über die Abweichungen menschlicher Selbstbetrachtung, die Wahrnehmung der Umgebung sowie natürlicher Prozesse, die dort stattfinden. Einer der Schlüssel für menschliches Verhalten liegt zweifellos in der Intentionalität (Vorsätzlichkeit/Sinnhaftigkeit). Hier konstruiert die menschliche Kognition die Welt, also eigene Person und Umgebung nach ihren selbstreferenziellen (selbstverfassten) Erfindungen (Fiktionen).
Absicht (Vorsätzlichkeit/Sinnhaftigkeit) ist das unveränderliche wie nachweisliche Phänomen der mentalen Querverbindung von Glaube, Sinn und Bedeutung, die erst durch gemeinsame Wirkung Angst, Zweifel und Bedeutungslosigkeit der eigenen Existenz verdrängen.
Das Unfassbare kann zwar vorgestellt, aber ohne konkreten Begriff nicht konzeptualisiert werden. Gibt man ihm dagegen einen konkreten Begriff, kann man es auch konzeptualisieren, da man Vorstellungen semantisch besetzt und das Unfassbare als ein Absolutes deklariert. Anders: der Begriff (Name) eines Unfassbaren (bspw. Gott) ist der verdinglichte Begriff (Name) der Angst. Wird die Angst benannt, kann sie auch mittels Fiktion (Symbolen, Ritualen, Verhaltenskodizes) kanalisiert und manipuliert, also vereinnahmt und praktisch genutzt werden - primär zu einer verstärkten Selbstüberhebung, sowie zu deren Legitimation (Berechtigung).
Fiktives
Es ist immer die menschlichen Fabel einer Selbstüberhebung, sprich ‚Erfindung von Bedeutung‘, die über eine aktuelle Selbsterhaltung hinausweist und die Legitimation zur vorsätzlichen Existenz liefert. Denn Bedeutung lässt sich hier auffassen als die Legitimation menschlicher Eingriffe in natürliche Prozesse, die natürliche Endlichkeiten/Limits wiederum vorsätzlich negieren.
Die menschliche Negation natürlicher Endlichkeiten/Limits entspringt einer menschlichen Kognition, die Sachverhalte, Tatsachen und Fakten vor allem zwecks Selbstoptimierung semantisch auslegt (umdeutet, verkürzt, verdrängt oder ignoriert) und in einen Zusammenhang stellt, der eine selbstverfasste Fiktion ‚vorstellt‘. Exakt hier entstehen menschliche Vorstellung13, Erwartungs- und Anspruchskategorien, die über die rationale Sicherung einer aktuellen Selbsterhaltung hinaustreten.
(Ein kurzer und vorausgreifender Einschub, den wir im Textverlauf noch eingehend erörtern. - Die menschliche Fiktion der Bedeutung generiert sich de facto aus der Illusion menschlicher Emotion Menschen benötigen zu ihrer Lebensfähigkeit (Sinn, Glauben) eine stetige externe Resonanz, sprich Selbst-Bestätigung und Versicherung ihrer Emotionen. Menschliche Vorsätzlichkeit ist nichts anderes als ein emotionales Besetzen, Verinnerlichen und Festhalten variabler wie veränderlicher Dinge und Erscheinungen, Ereignisse oder Phänomene, die wir tagtäglich registrieren und subjektivieren. Da das eigene Leben jederzeit abrupt enden kann, greift die Emotion mittels Vorsätzlichkeit und Bedeutung, Glauben und Sinn nach einer fiktiven Sicherheit, um Angst und Ungewissheit zu verdrängen.)
Das selbstverfasste und autosuggestive Konzept menschlicher Fiktion (mittels spiritueller/ideologischer Glaubenssysteme) ist sowohl ein Schutz vor ständigen Zweifeln wie eine methodisch organisierte Selbstreferenz zur Bestätigung eigener Absichten und Zwecke.
Die Fähigkeit der Inhärenz14 (Verknüpfung von Ding und Eigenschaft) generiert eine Vorsätzlichkeit, die aus semantisch ausgelegten Sachverhalten, Fakten und Tatsachen ein persönliches Anspruchsdenken (Verbindung von Vorstellung und Emotion) über gesamtheitliche Erfordernisse (Kooperation von Person und Umgebung) stellt. Folglich ist die menschliche Vorsätzlichkeit immer gleichbedeutend mit einer Deutung und Auslegung menschlicher Lebenswirklichkeit, die nichts mit den Fakten und Sachverhalten existentieller Grundbedingungen und deren basalen Abläufen zu tun haben.
Die Welt, die sich menschliche Vorsätzlichkeit mittels ihrer semantischen Deutung und Auslegung baut, berücksichtigt keine natürlichen und somit vorsatzlosen Abläufe.
Menschliche Vorsätze/Absichten sind stets Ausdruck emotionaler Motive und Ziele, die erst mittels subjektiver Bedeutung Sinn ergeben. Allein der Sinn verdrängt die menschliche Erfahrung des Absurden, die wir als semantischen Bruch erleben. Dieses Erlebnis vermeintlich sinnloser Ereignisse, die unsere selbstverfasste Fiktion in Frage stellen, ist die Erfahrung eines Absurden, dass den Widerspruch zwischen menschlichem Sinn und einer vorsatzlosen Natur anzeigt.
Um ständigen Zweifeln und letztlich der Verzweiflung an diesem Widerspruch zu entgehen, kehren wir stetig zurück in die Sicherheit einer selbstverfassten Fiktion, die unsere Vorsätzlichkeit bestärkt und unserer Existenz mittels Glauben Sinn und Bedeutung zuspricht.
Da allerdings jede Bedeutung, die über biologische Selbsterhaltung und Reproduktion hinausgeht subjektiv oder intersubjektiv vereinbart wie bestärkt ist, bleibt menschlicher Sinn stets fiktiv.
Bemerke: Das Selbstmachende wie Selbstlassende (Natur) ist abstinent von den selbstverfassten Fabeln und Einbildungen, Erfindungen oder Fiktionen einer vorsätzlichen/sinnhaften Selbstüberhebung. Menschliche Vorsätzlichkeit samt ihrer fiktiven Deutung und Auslegung (subjektiver Glaube, Sinn und Bedeutung) basaler Größen, lässt sich daher als eine kognitive Konstruktion oder Leistung (Inhärenz) emotionaler Motive auffassen, die einer instinktiven Vorgabe entspricht.
(Wir werden in Kapitel 2.5 sowie 3.2 noch näher darauf eingehen.)
1.3 Die Täuschung vom Ding
Ohne Vorstellung kein Glauben. Die menschliche Fähigkeit der Verknüpfung von Vorstellung und Emotion verlangt nach einer semantische Konsistenz, in der alles, was die Wahrnehmung registrieren kann, auch seinen Platz, seinen Sinn und seine Bedeutung hat.
Das Weltganze konstruiert sich durch die Vorsätzlichkeit. Da die Vorstellung per se aber keine empirische Grenze einbezieht und ziehen kann, bleiben Sinn und Bedeutung eine selbstreferenzielle (selbstbezogene) Täuschung.
Glauben, Sinn und Bedeutung sind stets selbstbezogene Konstruktionen, da ohne die externe Bestätigung oder Resonanz objektiv messbarer Größen.
Die ‚Vorstellung vom Ding‘15 erzeugt eine Subjektivität, die sich stets zeitlich neu adaptiert. Das Ding ist daher nie das, was wir glauben. Das Weltganze ist stets ein aktuelles und dynamisches Produkt veränderlicher Emotion und Vorstellung, sprich eigener Vorsätzlichkeit.
Ob nun einzelne, viele oder wenige Menschen einem spirituellen oder ideologischen Konzept folgen, das zwangsweise semantische Konsistenz bedingt und/oder propagiert, ist irrelevant für dessen basale Hinfälligkeit. (Die basalen Abläufe von Natur sind semantisch inkonsistent, da vorsatzlos. Glaube, Sinn und Bedeutung sind eine Konstruktion menschlicher Vorsätzlichkeit.)
Die Vorstellung baut eine Fabel, aus der sich der Glaube bedient. Die ‚Vorstellung vom Ding‘ ist die ‚Täuschung vom Ding‘, da eine subjektiv modellierbare Erscheinung der Vorsätzlichkeit. Platons Höhlengleichnis und dessen Erkenntnis der wandelbaren Deutung ist an dieser Stelle recht zutreffend. Denn das Ding ist ein aktuelles Phänomen oder Ereignis (temporäre und wandelbare Erscheinung) der Natur, das allein in basalen Kausalitäten verhaftet ist. Somit fügt es sich auch nicht in die menschlichen Denkmuster semantischer Deutung und Auslegung.
Wir sehen dies an der Konstruktion von Zufall, der uns das Eintreten des Unvorstellbaren oder Unvorhersehbaren vergegenwärtigt. Ein Ereignis tritt ein, dass unseren Vorstellungs- und/oder Erfahrungshorizont unterläuft oder übersteigt. Seine Wirkung ‚erschüttert‘ unser Leben, da es uns die Hinfälligkeit unsrer Lebensinhalte und Glaubenssätze aufzeigt, Sinn und Bedeutung ad absurdum führt. Da die Wirklichkeit an sich kontingente Eigenschaften16 aufweist, sind die Phänomene und Dinge dieser Welt selbst fluktuativ und also semantisch inkonsistent.
(Jeder stationäre Makrozustand in dieser Welt ist das aktuelle Potential basaler Kausalitäten. Ein höheres Maß an semantischer Bestimmung ist nicht möglich.)
Natur enthält für ihre Abläufe Notwendigkeiten. Zwar bietet sie in diesen Abläufen zugleich Möglichkeiten (Deutung, Auslegung), verfolgt aber dennoch keinerlei Absicht. Ihr Bedeutungskontext umfasst ausschließlich einen physikalischen, chemischen und biologischen Erfahrungshorizont.
Was Natur generell ermöglicht ist daher auch generell möglich - selbst ohne Plausibilität, ersichtliches Motiv, ausreichendes Argument oder zureichenden Grund. Hier gelten basale Kausalitäten und Korrelationen. Wir können sagen: Das physische Zusammentreffen (Wechselbeziehungen/Korrelationen) von Dingen mit kontingenten Eigenschaften ist der zureichende Grund für basale Kausalitäten. Anders: Ist die Möglichkeit für beliebige oder bestimmte Ereignisse gegeben, können diese Ereignisse auch zeitlich stattfinden. Und dies fernab von menschlicher Logik, ethischer Überzeugungen, Tabus oder emotionaler Tragfähigkeit.
Der Gedanke der Abwesenheit in der Aktualität ist isoliert von der jeweiligen Umgebung und daher ein Paradigma für die menschliche Separation von der Natur. Um Entstehung und Abfolge semantischer Konsistenz (menschliches Bedeutungsdenken) zu verdeutlichen, bedarf es dem Blick auf die menschliche Vorsätzlichkeit.
Die Verbindung von Vorstellung und Emotion (Vorsätzlichkeit) verweist bereits auf eine Subjektivität, die allerdings noch unbestätigt ist. Zu deren Bestätigung bedarf es erst der Generalisierung. Also generiert die Subjektivität des Individuums nun via kollektiver Übereinstimmung diverser Absichten/Vorsätze die Intersubjektivität des Kollektivs (Gruppe, Gemeinschaft, Organisation, Gesellschaft und Staat).
Was eine jeweilige Mehrheit vorsätzlich anstrebt ist Grundlage einer Generalisierung, die letztlich als Vorgabe subjektiver Bestätigung dient17. Hierfür versichert sich die Intersubjektivität des Kollektivs der semantischen Konsistenz (Fiktion) mittels ihrer kollektiven Generalisierung (Regierungen und Autoritäten, Institutionen, Behörden und Medien). Das Letztere fungiert als Abgleich des einzelnen Akteurs, der stets generalisiert, was ihm das Letztere subjektiv bestätigt.
Anders: die eigene Bedeutung und Identität wird bestätigt mittels mentalem Abgleich und emotionaler Besetzung jener zahllosen Angebote an Bedeutungen, die Interessen-, Wertgruppen und Gemeinschaften erfinden. Jedes individuelle Bekenntnis zu jeweiligen Bedeutungen generiert sich aus dem Wirkungsgrad einer emotionalen Resonanz. Konkret: das jeweilige Angebote bestätigt die emotionalen Motive des Betreffenden. Wir halten fest am Ding, das uns emotional berührt - ob bewusst oder unbewusst. Wir halten dran fest, weil seine aktuelle Erscheinung mit unserer aktuellen Vorsätzlichkeit zusammentrifft. Umso mehr, je höher der Wirkungsgrad seiner emotionalen Resonanz. Exakt hier beginnt die menschliche Fiktion von Glaube, Sinn und Bedeutung - in der emotionalen Besetzung von funktionalem Selbstzweck (Natur).
Dass der funktionale Selbstzweck de facto überhaupt nicht emotional besetzt werden kann, da sämtliche Dinge in basalen Kausalitäten stehen, ist für die menschliche Fähigkeit der subjektiven Deutung und Auslegung (Fiktion) dieser Dinge nichtig bis vollständig hinfällig.
(Emotionale Besetzung ist semantische Besetzung. Was von sämtlichen Dingen emotional besetzt, folglich gedeutet, vorsätzlich herausgegriffen und mental separiert wird, sind ausschließlich einzelnen Erscheinungen. Somit ist die semantische Konsistenz an menschliche Vorsätzlichkeit/Sinnhaftigkeit gekoppelt.)
Sämtliche substantiellen Dinge, Phänomene oder Ereignisse, selbst mentale Dinge wie Emotionen, Ideen oder Vorstellungen sind immer prozesshaft. Es sind Erscheinungen im Wandel bzw. funktionale Konstruktionen im Werden. Das heißt, sie entstehen und vergehen durch ein Selbstmachendes wie Selbstlassendes (Natur). Daher können sie auf Dauer nie durch vorsätzliche Einflüsse forciert, gehalten, verändert oder umgestaltet werden. Sondern sie können in ihrem selbstmachenden Ablauf immer nur gelassen werden.
Da die emotionale Besetzung und somit zugleich die semantische Anordnung einzelner Naturphänomene, Erscheinungen oder Dinge eine fixe Eigenart menschlicher Kognition ist, ignorieren Menschen mittels ihrer Emotionen auch vorsätzlich die alleinige Gültigkeit basaler Kausalitäten.
1.4 Vom Bild der Fiktion
Der Modus der menschlichen Kognition besteht in der Verknüpfung von zuvor kognitiv separierten Dingen und Eigenschaften, die in der Umgebung (Natur) zeitlich/räumlich voneinander getrennt sind. Die Verknüpfung von Information (Inhärenz), die sich in der menschlichen Kognition zufällig überlagert oder zusammentrifft, bewirkt eine selbstverfasste Fabel oder Fiktion.
Was hier in der menschlichen Informationsverarbeitung (Kognition) miteinander korreliert sind Dinge und Eigenschaften, die in der Natur nicht gemeinsam vorliegen, aber unter menschlichem Denkprozess und Eingriff wechsel- oder zusammenwirken können. Ihre wirksame Verknüpfung ist ein Resultat aktueller Erscheinung und gespeicherter Information (Gedächtnis), die zwischen aktueller Wahrnehmung und spontanem Gedächtnisinhalt eine assoziative Querverbindung erzeugt. Die Assoziation (Vorstellung und subjektive Bezugnahme) ist stets emotional motiviert, da sich die inhärenten Zusammenhänge zwischen Vorstellung und subjektivem Bezug aus einer selbsterdachten Fabel ergeben. Erst der subjektive Bezug bewirkt zwischen den Korrelaten (aktuelle Wahrnehmung und gespeicherte Information) die semantische Anordnung ihrer Zusammenhänge.
Das Vorgestellte (Konstrukt) macht Sinn, da es immer aus subjektiver Bezugnahme entsteht, also Bezug auf die emotionalen Motive eigener Vorsätzlichkeit nimmt.
(Inhärenz bringt Dinge und Eigenschaften zweckdienlich und nutzbar zusammen, die in der Umgebung getrennt vorliegen und/oder nicht zusammengehören.)
Dieser kognitive Prozess der emotionalen Besetzung (Inhärenz) führt zwangsläufig zur Einbildung (Imagination) einer semantischen Konsistenz und letztlich zu personalem Sinnzwang. (Wir werden den Begriff vom Sinnzwang in Kapitel 3.4. noch ausführlich erörtern.)
‚Sinn‘ macht nur, was auch subjektiv plausibel ist, also derart ausgelegt oder gedeutet werden kann, dass es seinem Akteur/ Akteueren zweckdienlich nützt und daher glaubwürdig ist.
Die Generalisierung eines erdachten Weltganzen findet sich daher in einem Sinnzwang, der intersubjektive Symbole und Rituale erzeugt, um seinen Glauben an eine übergeordnete Daseinsfunktion zu bestätigen. Die subjektive und adaptive Konstruktion von universeller Bedeutung ist folglich der unvermeidliche Modus menschlicher Kognition. Sein Zweck ist die Verdrängung eines Absurden, das jeder menschlichen Forderung nach einem übergeordneten Daseinszweck von Mensch wie Natur eine klare Absage erteilt.
(Wir erleben und erfahren dies am semantischen Bruch, den subjektiv sinnlose/vorsatzlose Ereignisse emotional erzeugen. Unsere Fiktion wird erschüttert, da das Vorsatzlose das emotionale Motiv unserer Vorsätzlichkeit/Sinnhaftigkeit demontiert).
Dass Ereignisse schlicht geschehen oder eintreten, da sie entweder durch basale Kausalitäten (natürliche Abläufe) oder durch abweichenden Vorsatz (menschliche Handlungen) motiviert sind, bezeugt die Nichtigkeit von menschlichem Bedeutungsdenken. Ereignisse von semantischer Inkonsistenz sind somit zum einen die Norm basaler Kausalitäten, in der sich spontane Zufälligkeiten akut überlagern. Zum anderen sind sie Ergebnis menschlicher Vorsätze, die eigenen Vorsätzen aktuell zuwiderlaufen.
Physikalische Grundgrößen (Druck, Reibung oder Beschleunigung) nehmen keine Rücksicht auf menschliche Betrachtungsweisen von Absicht, Sinn oder Zweckmäßigkeit. Sie sind vorsatzlose Vorgänge selbstorganisierter Möglichkeiten, die als Wechselwirkungen stattfinden.
In einer Welt der menschlichen Willensfreiheit besteht jederzeit die Möglichkeit der skrupellosen Selbstbehauptung, die in ihren emotionalen Motiven, Vorsätzen und Handlungen keine Rücksicht auf fremde Emotionen, Vorsätze und Ziele nimmt. Da der menschliche Glaube allerdings die Wirksamkeit der semantischen Inkonsistenz negiert, behalten die menschengemachten und intersubjektiven Symbole, Rituale und Verhaltenskodizes (kollektiver Ablass mittels semantischer Überhöhung) ihre emotionale Wirkung. Ihr Zweck ist naheliegend. Sie befrieden das Absurde, das die Wirksamkeit der semantischen Inkonsistenz situativ in uns weckt.
Exakt hiermit stärken sie den Anspruch menschlicher Bedeutsamkeit. Konkret: Symbole, Rituale etc. kompensieren die banale Tatsache, dass unser Bedeutungsdenken (Glaube, Sinn und Bedeutung) nicht nur fiktiv ist, sondern für die natürlichen Abläufe völlig belanglos. Sie überdecken den semantischen Bruch einer Begründung, die nach basalem Ermessen keinen Sinn ergibt. Da Natur keine emotionalen Motive hat, verfolgt sie auch keine Absichten oder Ziele.
(Die Frage nach den menschlichen Motiven, basalen Ursachen oder Gründen von Ereignissen kann die Empfindung des Absurden u.U. zwar abmildern, aber nicht ignorieren.)
Der semantische Bruch enthält keine Antwort, die das emotionale Motiv eigener Vorsätzlichkeit beseitigt, da sich die Emotion nicht mit rationalen Fakten abfinden kann. Ob rationale Fakten jeweilige Ereignisse nun vollständig oder unvollständig beschreiben, ist für die Emotion und ihre Forderung der semantischen Konsistenz irrelevant. Die Konsequenzen, die sich hieraus ergeben, sind vielschichtig.
Allgemein: Sowohl der absichtslose Zufall (aufgrund basaler Kausalität) wie der abweichende Vorsatz (aufgrund menschlicher Motive) fügen sich in kein subjektiv konstruiertes Bedeutungsdenken. Daher bewirkt die Erfahrung des Absurden stets Skepsis und Zweifel. Skepsis und Zweifel sind allerdings eine Gefahr für jede intersubjektive Vereinbarung im menschlichen Bedeutungsdenken.
‚Der Zweifel ist der Feind des Glaubens’.
Da die Erkenntnis der Täuschung von Vorsätzlichkeit/Sinnhaftigkeit, der Täuschung menschlicher Absichten und Bedeutungen nicht für rationale Fakten zugänglich ist, muss die Erfahrung des Absurden also anderweitig kompensiert werden. Also wird das Absurde kompensiert mittels einer anderen Täuschung, die Absichten modifiziert, neue Sinnhaftigkeit schafft und somit der emotionalen Forderung nach semantischer Konsistenz nachgibt.
Gibt man der Emotion sinnliche Anreize, liefert man ihr das Motiv für veränderliche Vorstellungen und Vorsätze.
Wieder ist es das zeitlich Veränderliche (Erfahrung), sprich die Erscheinung vom Ding, das via Deutung und Auslegung auf emotionale Motive zurückwirkt. Denn ausschließlich Emotion baut sich ihr jeweiliges Konzept aus Glauben, Sinn und Bedeutung. Die menschliche Emotion kann dieses Konzept beliebig verschieben, sie kann es umdrehen oder auf den Kopf stellen. Aber sie kann es unmöglich ablegen und das Absurde akzeptieren. Allein das persönliche, wie fiktive Deuten/Auslegen und folglich emotionale Festhalten an der Erscheinung vom Ding verdrängt die Existenzangst (siehe Kapitel 3.1) und sichert Sinn.
1.5 Emotion - Selbstüberhebung
Wir fragen nun nach den emotionalen Anreizen menschlicher Bedeutung. Wie werden semantische Konsistenz und Sinnhaftigkeit zwischen Menschen, also intersubjektiv generiert, organisiert und vertrieben? Betrachten wir uns die Selbstreferenz gesellschaftlicher Symbole, Rituale und Verhaltenskodizes sowie die Ursachen ihrer Erfindungen.