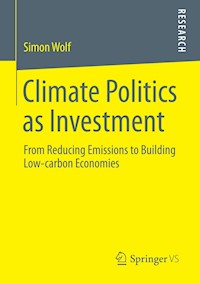3,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: tredition
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Zur Sache mit der ZEIT: ZEIT ist die Selbstregulierung einer Information, die sich in diskreten Wellen ringförmig auf der Oberfläche des Vakuums ausbreitet und Unterschied erzeugt. Ihre ringförmige Ausbreitung führt hierbei zu stationären Überlagerungen ihrer Wellen und folglich Strömungen, die sich mittels Krümmung als Materie verknüpfen. Ein Vergleich aus der Hydrodynamik: eine schwere Fluidschicht kann einer leichten Fluidschicht als Erhöhung dienen, aus der wellenförmige Ablagerungen (sogenannte Rippel) entstehen, die sich u. U. zu Clustern verbinden. Krümmung (Gravitation) ist letztlich nichts anderes als die strukturelle Überlagerung verknüpfter und unverknüpfter Wellen sowie deren Strömungen. Noch einfacher, Gravitation ist für Zeit eine Möglichkeit von Gedächtnis. Dass sich die Information von Zeit am Rand von Strömungen festsetzen, dort wiederholen und vervielfältigen kann, liegt einzig an der Möglichkeit ihrer Krümmung. Gravitation sei daher ein entropischer Morphismus von Zeit, der solange Präsenz und somit die zeitliche Entwicklung von Information erlaubt, bis das Vergessen die strukturelle Überlagerung zwischen Gedächtnis und Präsenz (verknüpften und unverknüpften Wellen) zerreißt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 317
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Zeit
Gedächtnis & Präsenz im Vergessen
Thermische Regulierung& Verstärkung im Vakuum
Simon Wolf
© 2021, Simon Wolf
Verlag und Druck: Tredition GmbH
Halenreie 40-44, Hamburg
978-3-347-11959-8 (Paperback)
978-3-347-11960-4 (Hardcover)
978-3-347-11961-1 (e-Book)
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Verlages und des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
INHALT
Vorwort
I. Kapitel: Das Weltganze
II. Kapitel: Im Drehmoment
III. Kapitel: Neuronale Expansion
IV. Kapitel: Der menschliche Zeitbegriff
V. Kapitel: Holografie
VI. Kapitel: H
VII. Kapitel: Zeitanalyse
Anhang
Glossar und Bibliografie
Vorwort
Ontologie ist ein weites Feld. Das Weltganze kennt keine Entitäten oder Attribute. Das Feld der Ontologie verlangt daher nach unkonventionellen Methoden.
Das philosophische Erbe, seine Schulen und Disziplinen zwingt jede Gestaltperspektive in vorgefertigte Muster. Die Unendlichkeitsdimension der Informationsaspekte öffnet zwar das ontologische Feld, aber erzeugt eine chaotische Gestaltperspektive, die eine holistische Betrachtung von Natur erschwert hat und weiterhin erschwert. !
Unsere neuzeitliche Dualismen und unser Reduktionsmus sind kontraproduktive Methoden, die sich in müßigen und konservativen Redundanzen verzetteln und das Weltganze auseinander dividieren. Sie spalten und zerlegen, was unter dualen oder reduktionistischen Aspekten nicht als Einheit akzeptiert werden kann. Am Ende erhalten wir wiederum eine Reihe von Attributen, an die wir, zwecks Deduktion hypothetischer Entitäten, synthetische Metriken legen.
Holismus und wissenschaftliche Logik sind keine Freunde. Versucht man die Einheit von Natur daher mittels zeitlicher Logik zu rekonstruieren, ist man automatisch an dualistische Ansätze oder Hilfsmittel gebunden. Die Fragen nach Sein und Nichts, Existenz und Nicht-Existenz, Kosmos und Kybernetik sind seit der Antike und deren erstmaliger Möglichkeit zur Dokumentation stets dieselben. Ihre möglichen Antworten werden im Zuge einer fortschreitenden Wissenschaft lediglich aktualisiert. Sie verlagern Akzente, reformieren Aspekte, aber die Suche nach Ursache, mathematischer Strategie und Ziel von Natur bleibt bestehen.
Philosophie als zeitversetzte und skeptische Rückfrage an Erkenntnis kann, darf und muss nach neuen Methoden greifen, um das Phänomen Natur gesamtheitlich zu erfassen. Es ist ihre Aufgabe Altlasten abzutragen und altbekannte Geräte sowie Materialen in einem verändertem Licht zu präsentieren. Jede Gestaltperspektive kann nur neue Informationsaspekte gewinnen, wenn sie einen unbefangen Blick riskiert.
Das Informationszeitalter ist gnadenlos. Seine Fülle, die paradoxe Perspektiven und Aspekte hervorbringt, kann ebenso überfordern, wie es persönliche Bekenntnisse für eindeutige Standpunkte erschwert oder dogmatisch manifestiert. Informative Konfusion und Manipulation als Produkte einer medialen Dauerpräsenz sind an der Tagesordnung. (Dass das menschliche Verständnis für kausale Zusammenhänge im digitalen Zeitalter immer mehr verloren geht, liegt auch daran, dass dem Einzelnen ‚die Zeit zu persönlicher Reflexion und Erkenntnisgewinn‘ gestohlen wird. Die Digitalisierung, die sämtliche Abläufe der menschlichen Lebenswirklichkeit beschleunigt, hebelt jedes ‚Nachdenken’ immer effektiver aus.)
Die ständige Revision und Adaption von Wissen hat eine informative Zweideutigkeit hervorgerufen, die ständig an Fakten rüttelt, selbstgefällige Interpretationen physischer Wirklichkeiten versucht und zugleich ignorante Tendenzen verstärkt.
Denjenigen, die von der Informationsflut Abstand gewinnen und den wissenschaftlich-faktischen Rahmen physischer Wirklichkeit akzeptieren, eröffnet das Informationszeitalter dennoch ungeahnte heuristische Möglichkeiten.
,Das naturwissenschaftliche Denken hat seine Grenze und reicht nicht aus, das Weltganze zu erklären’, so John Ruskin.
Wir wollen das Weltganze daher auch nicht denken, sondern es in groben Zügen durch seine zeitlich-formalen Fundamente betrachten. Wir sehen uns keine einzelnen Attribute an, sondern wir wollen zeigen auf welcher Grundlage das Ganze interagiert. Die Prämissen des Weltganzen sind unveränderlich. Alles ist eins, und alles erscheint ‚in Ereignis‘ mittels zeitgequantelter Information. (Nur da alles eins ist, gibt es die temporäre Möglichkeit zu stationär begrenzten Makrozustände, die sich aus der Energieumwandlung/Informationsverarbeitung hoher Mikrozustände bilden.)
Was der Existentialist mit Sein und Nichts klassifiziert, ist Information. Es gibt keine Informationsleere in einer Natur, in der nichts verloren und nicht gewonnen werden kann.
Nach menschlicher Perspektive ist das Sein unendlich. Für die Natur ist es bestenfalls eine temporale Modalität mathematischer Wahrscheinlichkeit, in der fundamentale Aussagen über Notwendigkeit, Möglichkeit, Unmöglichkeit und Kontingenz ‚Ereignisse‘ iterieren. Zeit misst nichts, speichert nichts und reproduziert auch keine Daten, sie läuft nur weiter.
Alles was ist, ist daher aktuell verfügbare Information. Alles was sein kann, ist potentiell verfügbare Information. Alles was nicht sein kann, ist ebenso potentiell verfügbare Information. Nur das Aktuelle klammert aus, was es als laufender Prozess bereits bereithält.
Natur ist die numerische Vernetzung periodischer Signale, die Information vorstellen. Kommunikation regelt somit nicht nur die Selbstorganisation von Natur, sondern auch ihre Dynamik. Da Natur eine Anti-Leere vorstellt und Information eine Anti-Leere definiert, ist Information ein zentraler Begriff ‚dieser Welt‘. (Es gibt kein Nichts, das die Natur umgibt.) Ihr Grundbaustein ist das Zeichen, das einer methodischen Verarbeitung unterliegt.
Ihre Information ist zeitgequantelt und daher nicht nur eine temporale Ansage zur Darstellung von Gestalt. Sie bildet ebenso den gestaltspezifischen Oberbegriff für zeitabhängige Abläufe, die sich als verfügbare Signale, oder ganz allgemein, als Möglichkeit von Kommunikation erweisen. (Kommunikation ist bereits der Austausch von Information zwischen Sender und Empfänger. Sie lässt sich daher auch beschreiben als eine unbestimmte Menge informativer Transportmittel, die jedem Ereignis mittels Zeit zugrunde liegen und zur Verfügung stehen.)
Natur tut nicht mehr als nötig, und was sie tut, dient einem gesamtheitlichen Zweck, der keine Separation zulässt. Anderseits kann eine endliche Menge von Zeichen bestenfalls syntaktisch verknüpft (Informationseinheit/Bit) und in einen pragmatischen Kontext gestellt werden (Gestalt).
Ihre Semantik, die nach einem Programm verlangt, bleibt allerdings verschlossen. Natur hat keinen Plan und kein Programm, kein Bewusstsein oder Ziel. Was geschieht, geschieht zwar durch Kooperation, aber ohne Vorsatz. Nur die menschliche Bewusstseinsform verlangt stetig nach Bedeutung und Plan, Programm oder Ziel. (Dass sich etwas unendlich oft und (aus eigener Kraft) am eigenen Schopf aus einem unbekannten Sumpf zieht, übersteigt unseren Verstand, dessen kausale Anordnung stets nach Bedeutung und Plan, Programm oder Ziel verlangt.)
Der menschliche Geist legt seine synthetischen und normierten Metriken an die Natur. Er wiegt, misst, rechnet, erfindet Technik und hiermit künstliche Regelsysteme. Er müht sich um größtmögliche Neutralität und objektive Betrachtung von Natur. Aber er vergisst, dass er selbst Teil der Natur und biologisch konditioniert ist. Seine nüchtern-rationale Erkenntnis der Natur ist bislang nur eine Selbsterkenntnis, die seine emotionalen Motive rigoros ausklammert.
Jede Gestaltperspektive ist limitiert auf ihre Ursache: Sein (Existenz). Da dieses Sein aber eine materiell-aktuelle Ebene der Natur ausdrückt, ist jede Gestaltperspektive ans Gegenwärtige gebunden. Was wir als Sein bezeichnen ist Gegenwart, und die Möglichkeiten von Sein erschöpfen sich an ihrer temporal-physischen Regulierung. Sein kann also ebenso als die temporäre Information einer formal-möglichen und daher endlichen Gegenwart gelten, die ‚diese‘ Welt reflektiert. (Natur ist ein infiniter Informationsaspekt, der keine finale Aussage über Anzahl und Möglichkeit diverser Informations-Modi zulässt.) Die noch bestmöglich verfügbare Objektivierung von Natur liegt in einem Holismus, der sämtliche temporale Information (Naturgesetze) in eine strukturellen Anwendung (Rahmenbedingungen) einordnet.
Der gedankliche Schwerpunkt der folgenden Ausflüge findet sich folglich in einer phänomenologisch-informationstheoretischen Rückfrage an temporale Begriffe. Was uns hier interessieren soll, ist die Metrik von Zeit und ihr informativer Modus, der unser Weltbild, unsere mentale Konstruktion und letztlich unser Selbstbild bestimmt.
Die Unendlichkeitsdimension neuronaler Netze bietet der Ontologie unendliche viele Erklärungsmodelle zum Weltganzen, zu Sein und Nichts, Metaphysik und Kosmos.
Wir greifen in diesem Buch lediglich einen Bruchteil unverbindlicher und spekulativer Erklärungsansätze heraus, um das hochabstraktes Phänomen namens Natur ‚in etwa‘ und gedanklich ‚halbwegs plausibel‘ einzuordnen. Sowenig es für jede Gestaltperspektive eine absolute Wahrheit geben kann, sowenig schließen sich scheinbar gegensätzliche Informationsaspekte bei der Suche nach relativen Wahrheiten gegenseitig aus. Was wir sehen ist immer nur die helle Oberfläche
der Fläche, aber nicht ihre dunkle Unterseite. Somit können wir auch den Unterschied zwischen Glauben und Wissen auch nicht aufheben. Denn jeder Unterschied, ganz gleich ob imaginär oder real, ist bereits eine Fiktion, die ebenso eine unterschiedslose Ursache und Gleichheit verdeckt, wie sie hinter dieser Ursache oder Gleichheit zurückbleibt. Die Forderung nach einer semantisch konsistenten Theorie zum Weltganzen kann daher nicht aufrechterhalten werden ohne berechtigte Widersprüche und fortwährende Zweifel. Bedeutung hat nichts zu tun mit Funktionalität. Aber nur Bedeutung kann Funktionalität zuordnen. Unsere mentale Konstruktion lässt uns keine andere Wahl als den stetigen Wechsel zwischen Irrtum und Einsicht. Von daher können wir uns lediglich bemühen den Unterschiedsgrad zwischen Glauben und Wissen weiter zu verringern. Um aus Unwissenheit natürlich nur einmal mehr zu scheitern … da wir ‚ohne Sinn‘ nicht können und also glauben müssen.