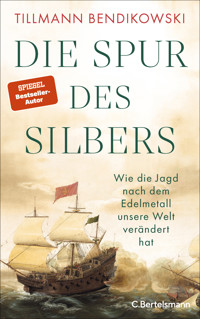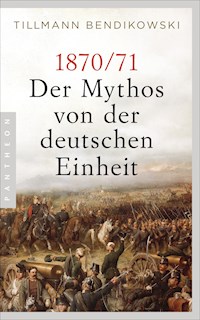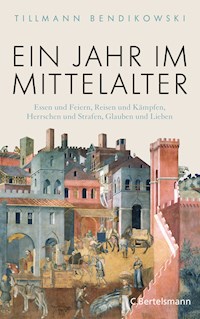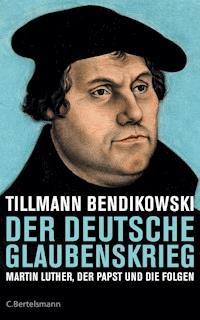
5,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Bertelsmann, C.
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Das Buch zum Jubiläum – 500 Jahre Reformation
Die Religion ist zurück. Im positiven Sinn, etwa in Gestalt von Papst Franziskus, der seiner Kirche neue Glaubwürdigkeit erkämpft; im negativen Sinn, wenn Intoleranz und Gewaltherrschaft die Menschenwürde mit Füßen treten. Der Historiker Tillmann Bendikowski nimmt das 500-jährige Jubiläum der Reformation 2017 zum Anlass, die Geschichte des deutschen Glaubenskriegs zwischen Katholiken und Protestanten neu zu erzählen. Er erinnert an die religiös motivierten Kriege, die Deutschland verheerten, an die alltäglichen Konflikte zwischen Katholiken und Protestanten. Bis heute steht die Frage nach dem „richtigen“ Glauben zwischen den Kirchen in Deutschland. Bendikowski befragt die deutsche Kirchenspaltung mit ihren konkurrierenden Heilsangeboten im Blick auf aktuelle und zukünftige Herausforderungen: Was können wir aus dieser spezifisch deutschen Geschichte für ein friedliches Miteinander von Religionen lernen?
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 492
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Tillmann Bendikowski
DER DEUTSCHE GLAUBENSKRIEG
Martin Luther, der Papst und die Folgen
C. Bertelsmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
© 2016 by C. Bertelsmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: buxdesign München
Bildredaktion: Dietlinde Orendi
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-18255-7V001
www.cbertelsmann.de
Inhalt
Vorwort: Die deutsche Geschichte – eine Sache des Glaubens
1. Die Konfessionen werden erfunden
Martin Luther und Leo X. – der Ketzer und der Antichrist
Neue Kirchen, neues Glück, neuer Streit
Die Katastrophe: Dreißig Jahre Krieg
2. Gibt es Frieden zwischen den Religionen?
Eine Frage der Toleranz
Die Entdeckung des Andersgläubigen
3. Deutschland im konfessionellen Streit
Die Mischehen und der religiöse Verfolgungswahn
Von Herrenmenschen und Dummköpfen
Gemeinsame Ängste, gemeinsame Feinde
4. Der Streit geht in die Welt: Neue Beglückungsgemeinschaften
Sekten und Atheisten
Das Leben und seine Reform
Der politische Glaube
5. Das Erbe und seine politischen Folgen
Kein Kompromiss: Die verspielte Weimarer Demokratie
Der Feind meines Feindes: Das »Dritte Reich«
Der verlorene Himmel? Deutschland nach 1945
Bilanz: Die deutsche Geschichte – ein Lehrstück
Anmerkungen
Literatur
Bildnachweis
Bildteil
Vorwort: Die deutsche Geschichte – eine Sache des Glaubens
Nun sag, wie hast du’s mit der Religion?
(Gretchen zu Faust)
Wir leben in einer eigentümlichen Zeit: Die Religion kehrt zurück. Hat es damit angefangen, als »wir« Papst wurden? Als Joseph Kardinal Ratzinger im Jahr 2005 als Benedikt XVI. zum Oberhaupt der römischen Weltkirche aufstieg? Als nicht nur die Katholiken in Deutschland plötzlich mehr denn je nach Rom schauten, in der Hoffnung auf spirituelle Impulse oder gar geistiges Heil? Und man hat den Eindruck, als hätte sich diese Begeisterung nach der Wahl des Jesuiten Jorge Mario Bergoglio zum Papst 2013 noch einmal gesteigert. Wie ein Verkünder lang ersehnter Wahrheiten erscheint dieser Papst Franziskus vielen, auch weil er augenscheinlich den Prunk der angeblich so dekadenten vatikanischen Kurie verachtet. Er richtet seinen Blick stattdessen auf die Not der Armen und ist durch sein gesamtes Auftreten auch für die Politiker dieser Welt zu einer neuen moralischen Instanz aufgestiegen.
Es ist nicht nur der Katholizismus, der hierzulande eine Belebung erhofft. Auch der deutsche Protestantismus erlebt eine neue Zeit, die einige sogar als notwendige Phase einer neuen Identitätsstiftung empfinden. Emotionaler und theologischer Fluchtpunkt dieser Hoffnung ist fraglos das große Jubiläum im Jahr 2017: Fünfhundert Jahre nach der Reformation wird in Deutschland dieses weltgeschichtliche Ereignis mit großem Aufwand gefeiert. Wird das auch dazu führen, dass evangelisches Kirchenleben und Selbstbewusstsein wieder erstarken? Könnte das Reformationsjubiläum als Impuls für die Protestanten so wichtig werden, wie es die Wahl des »deutschen Papstes« Benedikt vor einigen Jahren für die Katholiken war? Vieles deutet darauf hin. Die Reformatoren wollten damals nichts weniger als »eine Reform der ganzen Kirche an Haupt und Gliedern«, heißt es im aktuellen Grundlagentext der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) dazu. »Dieses Anliegen darf nach fünfhundert Jahren nicht aus dem Blick geraten.«1 Die katholische Kirche hört das fraglos nicht so gern: Mit der »ganzen Kirche« muss auch sie sich angesprochen fühlen, und ob sie sich ausgerechnet von der EKD eine Reform an Haupt und Gliedern ans Herz legen lassen will, lässt sich wohl bezweifeln.
Die Jubiläumsvorbereitungen für 2017 fallen in eine Zeit, in der die Auseinandersetzung um den rechten Glauben keine Privatangelegenheit zwischen mehr oder weniger frommen Mitmenschen ist. Längst ist die Frage nach dem Verhältnis von Politik und Religion wieder ein zentraler Gegenstand der öffentlichen Debatte. Das Auftreten radikaler islamischer Gruppen verschreckt die Menschen, der Begriff des »Andersgläubigen« taucht wieder aus den Tiefen einer finsteren Vergangenheit auf. Toleranz gegenüber anderen Glaubensangeboten wird zuweilen zum Gebot der Stunde, während der Staat sich herausgefordert sieht, an sein höchsteigenes Interesse zur Wahrung des inneren Friedens zu erinnern und sich Gedanken darüber zu machen, mit welchen Mitteln er diesen notfalls durchsetzen kann.
Diese Rückkehr des Religiösen wirft viele Fragen auf. Dabei handelt es sich nicht um ein neues Phänomen. Denn es gibt hier Aspekte, die wir aus unserer eigenen Geschichte recht gut kennen. Dass Menschen die eigene Religion als wertvoller und »wahrer« empfinden als den Glauben der anderen, dass Angehörige unterschiedlicher Religionen kulturell weitgehend getrennt voneinander leben, dass sie sich wegen der Verletzung ihrer religiösen Gefühle auf der Straße prügeln und dass sie für den vermeintlich rechten Glauben gegeneinander in den Krieg ziehen – all das kennen wir Deutschen nur allzu gut. Denn in religiöser Hinsicht nahm Deutschland über Jahrhunderte hinweg eine Sonderstellung unter den europäischen Nationen ein: Nirgendwo sonst lebten Katholiken und Protestanten in einem religiös so tief gespalteten Land. Als gemischtkonfessionelle Nation wider Willen hat dieses Land seit den Tagen Martin Luthers seine ganz eigenen Erfahrungen mit dem Ringen um den »wahren Glauben« an den »richtigen Gott« machen müssen. Lange herrschte hier eine Atmosphäre, die stets von religiöser Konkurrenz, oft von offener Feindschaft und zuweilen von Hass bestimmt war. Ein regelrechter Glaubenskrieg durchzieht unsere Vergangenheit, und er hat die Menschen in diesem Land verändert. Er hat uns geprägt.
Dieser jahrhundertelange Dauerkonflikt zwischen Katholiken und Protestanten führte auch dazu, dass sich mit dem 19. Jahrhundert abseits der Kirchen neue Gemeinschaften bildeten, in denen die Deutschen fortan ihr Heil, ihr Glück suchten. Es entstanden Gruppierungen, die im Folgenden als neue »Beglückungsgemeinschaften« bezeichnet werden. Sie hatten neben religiösen auch politische oder lebensreformerische, durchaus glaubensähnliche Heilsversprechen und Vorstellungen von einem (auch irdischen) Paradies im Angebot. Vieles, was die christlichen Konfessionen auszeichnet, fand sich hier in abgewandelter, mal mehr, mal weniger säkularisierter Form wieder: Märtyrer, Heilige, Propheten, Gläubige samt Verachtung der Ungläubigen oder die Überzeugung von der eigenen Auserwähltheit. Der Glaubenskrieg, der zuvor ein rein religiöser und interkonfessioneller Konflikt gewesen war, weitete sich durch diese neuen Beglückungsgemeinschaften sogar noch aus, Bekenntnistreue und Dogmatismus machten fortan Karriere auch außerhalb der Kirchen.
Dieses Buch widmet sich deshalb nicht nur Entstehung und Verlauf der konfessionellen Auseinandersetzungen in den zurückliegenden Jahrhunderten, sondern auch dem Übergreifen dieses Konflikts und der damit verbundenen antagonistischen Grundhaltung auf andere gesellschaftliche Gruppen. Die Deutschen, ihre Religionen und ihre politische Kultur – das ist eine ganz besondere Konfliktgeschichte. Zugleich stellt sich die Frage, ob wir aus der deutschen Geschichte etwas für ein friedliches Verhältnis zwischen den Religionen lernen können. Einen Versuch ist es wert.
1. Die Konfessionen werden erfunden
Wir leben in einer Zeit, in der nicht nur Kinder Schwierigkeiten damit haben, die Unterschiede zwischen Katholiken und Protestanten plausibel zu erklären. Alte Gegensätze scheinen sich abgeschwächt zu haben, theologische Details interessieren selbst das Kirchenvolk offenkundig immer weniger. Oft reicht es heute schon, sich bei der Frage nach den Unterscheidungsmerkmalen der Konfessionen mit dem Hinweis zu begnügen, die einen hätten einen Papst, die anderen aber offensichtlich nicht. Dass heute die theologischen und kulturellen Differenzen zwischen Katholiken und Protestanten nicht mehr so präsent sind, ließe sich entweder als hoffnungsvolles Zeichen einer erfolgreichen Ökumene interpretieren oder aber als Ausdruck des generellen Bedeutungsverlustes der christlichen Kirchen in Deutschland, denn die stärkste »Religion« bilden hierzulande längst die Konfessionslosen. Mehr als ein Drittel der Bevölkerung wird ihnen zugerechnet, Katholiken und Protestanten liegen jeweils knapp dahinter. Heute, so hat man den Eindruck, sind es die Unterschiede zwischen Christen und Nichtchristen, die in diesem Lande von Bedeutung sind; dass sich Christen immer noch nach Konfessionen unterscheiden, scheint dagegen eher belanglos zu werden.
Das war einmal ganz anders. Denn Deutschland ist das Land, in dem der konfessionelle Gegensatz erfunden wurde. Hier stand schließlich die Wiege einer der größten Umwälzungen, die Europa zu Beginn der Neuzeit erfasst hat, eine wahre Revolution der Befreiung: Mit der von Martin Luther angestoßenen Reformation formierte sich ein Aufstand des religiösen Gewissens gegen kirchliche Missstände, der dann aber bekanntermaßen nicht zur großen Reform der einen gemeinsamen christlichen Kirche führte, sondern zur Geburt weiterer, neuer Kirchen. Das brachte die Menschen in Deutschland in neue Schwierigkeiten, denn fortan standen sie vor der Wahl unterschiedlicher Bekenntnisse, wobei diese Wahl lange Zeit keineswegs eine freie war, sondern von ihrem jeweiligen Landesherrn für alle Untertanen entschieden wurde. Neue Kirchen entstanden, man kannte nun beispielsweise Lutheraner ebenso wie Calvinisten. Und die verbliebenen Katholiken mussten sich notgedrungen den neuen Herausforderungen stellen, um überhaupt zu überleben. Und dies alles zu einer Zeit, da Religion und der Glaube den Alltag fast vollständig prägten. Denn noch lange nach der Reformation blieben die Kirche und ihre Geistlichen selbstbewusste Inhaber auch von politischer Macht; sie bestimmten den Gang der großen Politik, und sie hatten den Alltag in den Städten und Dörfern weitgehend im Griff. Politisches, soziales und wirtschaftliches Leben – das existierte in Deutschland nicht ohne Religion und Kirche. Als es die Kirche nach der Reformation gleich zweimal gab, mussten sich die Menschen damit irgendwie arrangieren, sie mussten fortan notgedrungen mit der Trennung nach Katholiken und Protestanten leben. Und das, so gut es eben ging – aber so richtig gut ging das zunächst einmal gar nicht.
Dass die neue Koexistenz nicht so recht gelingen wollte, lag zu einem gewissen Maß auch an den beiden Männern, die den Anfang dieser Geschichte bilden. Einer von ihnen ist erwartungsgemäß Martin Luther, der in der deutschen Erinnerung für die Reformation steht, wenngleich es zum Teil weitere bedeutende und einflussreiche Reformatoren gab, etwa Ulrich Zwingli, Philipp Melanchthon oder Johannes Calvin. Luther agierte nicht allein auf der Bühne der Religionsgeschichte, mit ihm waren dort nicht nur seine Mitstreiter und Wegbegleiter versammelt, sondern von Beginn an auch seine Kritiker und erklärten Feinde, die ihn schon recht bald zum Teufel wünschten – wenn sie ihn nicht sogar selbst für diesen hielten. Auch wenn sich das historische Großereignis der Glaubensspaltung keineswegs auf so etwas wie ein Duell zweier Männer reduzieren lässt, ist es in diesem Falle gleichermaßen reizvoll wie erhellend, die beiden großen Gegenspieler im Umfeld der Reformation einmal genauer in den Blick zu nehmen: Hier der glaubensfeste Augustinermönch Martin Luther, der zunächst mit sich und dann mit der ganzen Welt um den rechten Glauben rang, dort der Renaissancepapst Leo X., der wie nur wenige andere Kirchenfürsten Reichtum und Dekadenz verkörperte und unter dem die Kirche Christi zu einem bloßen Machtapparat einflussreicher Familien und Cliquen verkommen war. Der dekadente Papst und der gewissensstarke Reformator haben sich persönlich nie getroffen, und doch sind sie im 16. Jahrhundert die Hauptprotagonisten im Kampf um den »wahren Glauben«. Einst waren sie Brüder in dem einen, gemeinsamen Glauben, doch bald traktierten sie sich gegenseitig mit den heftigsten Vorwürfen. Als »Antichrist« beschimpfte der eine den anderen, und der wiederum verurteilte seinen Gegenspieler als »Ketzer«. Das Tor zur Glaubensspaltung stand weit offen …
Martin Luther und Leo X. – der Ketzer und der Antichrist
Mit dem 16. Jahrhundert lassen die Historiker traditionell die Neuzeit beginnen. Das ist keine willkürliche Setzung, denn zu diesem Zeitpunkt ergriff eine ungeheure Dynamik die europäische Welt. Diese Welt war aufregend. Viel Neues geriet in den Blick der Menschen, zahlreiche alte Sicherheiten gingen verloren. Das machte gleichermaßen Mut wie Angst, neue Antworten auf eine sich verändernde Welt mussten her. Wie konnten diese aussehen?
Vor allem die Entdeckung neuer Welten im geografischen Sinn veränderte Europa. Immer mehr wagemutige Seefahrer stachen in See, um kürzere Wege zu alten, schon bekannten Reichen zu erkunden oder unentdecktes Land aufzuspüren, immer auch getrieben von Berichten über sagenhafte Schätze und Reichtümer. Die Welt ist eine Kugel – da waren sich die Gebildeten unter ihnen bereits sicher, auch Christoph Kolumbus, der auf der Suche nach dem Seeweg nach Indien unversehens Amerika entdeckte. Andere Wagemutige unternahmen Erkundungsreisen auf dem Landweg, etwa in das Innere Afrikas und immer wieder Richtung Asien. Und die Kunde von den neuen Dingen fand ebenso wie die Erkenntnisse der neuen Wissenschaften jetzt ihren Weg in eine völlig veränderte Öffentlichkeit. Die beweglichen Lettern, deren Erfindung sich bis heute mit dem Namen Johannes Gutenberg verbindet, revolutionierte die Produktion von Büchern. Im Jahr 1480 waren bereits in 110 europäischen Städten Buchdruckereien in Betrieb, davon 30 in Deutschland.2 Die Welt wurde spürbar größer, und immer mehr Menschen nahmen Notiz von den damit einhergehenden Veränderungen. Dieses 16. Jahrhundert versprach ein unglaublich spannendes Säkulum zu werden.
Die Dynamik dieser neuen Zeit machte erwartungsgemäß auch nicht halt vor dem christlichen Glauben. Vieles geriet in Bewegung. Ein neues »frommes« Verhalten entwickelte sich, das Priestern wie Laien ganz neue Formen der Beschäftigung mit Gott und der Verkündigung ermöglichte. Sie lösten sich vielfach von alten, in zahlreichen Zwängen überkommenen Vorgaben, der Glaube bekam Züge von Privatheit und Individualität, die einer allmächtigen und stets präsenten Kirche immer weniger bedurften. Viele gute Christenmenschen waren eher still und fromm, nicht laut und machtbewusst – ganz anders als die alles beherrschende römische Kirche mit ihrem pompösen Auftreten. Der Papst im fernen Rom – ohnehin nur erreichbar für die wenigen Mächtigen und Reichen, und auch das erst nach wochenlanger beschwerlicher Reise über die Alpen – hielt sich für das Maß aller kirchlichen (und weltlichen) Dinge: Er hatte sich von der zwischenzeitlichen Mitbestimmung der Konzilien befreit und war zum ersten religiösen Herrscher Europas aufgestiegen.3
Doch kein Herrscher ohne Kritiker. So war und blieb auch der Papst nicht unumstritten. Bereits am Ende des 15. Jahrhunderts hatte sich Unbehagen in der römischen Kirche geregt, vor allem nördlich der Alpen im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation. Immer mehr Zeitgenossen waren darüber irritiert, wie sehr sich die Kurie in Rom mit einem untrüglich scheinenden Instinkt für gute Geschäfte dem italienischen Handelskapitalismus geöffnet hatte. Die Kirche bediente sich gekonnt der modernen Finanzmethoden, gerade wenn es um die ausufernden Bauvorhaben des jeweiligen Papstes ging. Im Vatikan wurde mehr als je zuvor geplant und gebaut, nicht nur am imposanten päpstlichen Palast, sondern vor allem am neuen, riesigen Petersdom, der zum Symbol für die römische Weltmacht werden sollte. Rom und seine Päpste schienen keine Grenzen mehr zu kennen. Repräsentativer und monströser als je zuvor agierten die Kirchenoberhäupter, immer prächtiger mussten die neuen Gebäude und Kirchen sein, die ihren politischen und kulturellen Machtanspruch unterstreichen sollten.
Es sind die sogenannten Renaissancepäpste dieser Zeit, die einen besonders prachtvoll ausgeprägten Lebensstil an den Tag legten. Sie schufen dadurch zugleich ein inspirierendes Umfeld für Wissenschaften und Künste. Damit wurde Rom zu einem ersten Zentrum der Renaissance. Fraglos profitierte ganz Europa von dieser »Wiedergeburt« der Antike und von den neuen intellektuellen Impulsen ihrer Protagonisten. Rom tat aber nicht nur anderen Gutes, sondern dachte stets auch an sich selbst: Die römischen Kirchenoberhäupter agierten wie »verweltlichte Macht- und Genusspäpste«. Einer der »verruchtesten« unter ihnen – so der Luther-Biograf Heinz Schilling – war der aus dem reichen Geschlecht der Borgia stammende Papst Alexander VI. (Pontifikat 1492–1503). Selbst gutwilligsten katholischen Theologen und Historikern bietet sich als Entschuldigung wohl nur an, dass es eigentlich der Beweis für den göttlichen Ursprung der katholischen Kirche gewesen sein muss, solch ein Kirchenoberhaupt überhaupt überstanden zu haben.4 In der Tat fällt es schwer, etwas Frommes über diesen Mann zu sagen, und nicht von ungefähr sind deshalb nur weltliche »Verdienste« überliefert: dass er nur durch Stimmenkauf auf den päpstlichen Stuhl gekommen war, dass er neun Kinder mit verschiedenen Mätressen hatte, dass er sein Pontifikat vor allem als politisches Instrument verstand, um den Einfluss seiner eigenen Familie zu fördern. Keine Frage: Alexander VI. war machtbewusst und skrupellos – und damit ein durchaus typischer Papst seiner Zeit.
Galt dieser Alexander der Nachwelt schon als fragwürdiger Papst in der Nachfolge Christi, so trifft allerdings auf einen seiner Nachfolger das wenig schmeichelhafte Kompliment zu, dass seine Regentschaft zum wohl verhängnisvollsten Pontifikat der Kirchengeschichte wurde. Die Rede ist von Leo X. Viele wissen heute von ihm nur noch, dass er das Pech hatte, ausgerechnet zu Luthers Zeiten den Nachfolger Petri zu geben und die Wucht der aufkommenden reformatorischen Bewegung kolossal zu unterschätzen. Tatsächlich passt solch eine Fehleinschätzung zu diesem Mann, der viel zu sehr mit anderen Dingen beschäftigt war, als dass er ein Ohr für die schärfer werdende Kritik an der kirchlichen Herrschaft gehabt hätte. Macht, Besitz, Geld und die schönen Künste waren die Dinge, die seine Zeit und seine Aufmerksamkeit als Papst vor allem anderen beanspruchten. Das lag auch an der Herkunft dieses Kirchenfürsten.
Leo X. wurde als Giovanni de’ Medici am 11. Dezember 1475 in Florenz geboren, stammte also aus der mächtigen Bankiers- und Unternehmerdynastie der Medici. Seine Familie dominierte mit ihrem Kapital und ihrem Einfluss die mittelalterliche Republik Florenz, Giovannis Vater Lorenzo erhielt nicht zufällig den Beinamen »der Prächtige«. Er war de facto zum Alleinherrscher der Republik aufgestiegen. In dieser Herrscherfamilie gehörte es zum guten Ton, umfassend humanistisch gebildet zu sein. Ebenso selbstverständlich war die großzügige finanzielle Förderung von Wissenschaft und Kunst; neben vielen anderen kam beispielsweise der junge Michelangelo in den Genuss einer solchen Unterstützung. Als strategisch denkendes Familienoberhaupt hatte Lorenzo schon früh festgelegt, was aus seinen Söhnen werden sollte, damit sie den Einfluss der Dynastie sichern und vergrößern konnten. In Bezug auf seinen zweitgeborenen Sohn Giovanni entschied sich der Vater für den geistlichen Stand. Die Familie der Medici hatte immer gute Geschäfte mit der päpstlichen Kurie gemacht, da schadete es nach Meinung des Vaters nicht, selbst einen Geistlichen in den eigenen Reihen zu haben, der in der Hierarchie des Vatikans möglichst weit aufsteigen sollte. Und sicherheitshalber vermählte Lorenzo auch noch seine Tochter Maddalena mit dem Sohn des seit 1484 amtierenden Papstes Innozenz VIII., an dessen Hof Korruption und Vetternwirtschaft ganz offen betrieben wurden.5
Im Sinne einer solchen Karriere wurde alles für das Fortkommen des jungen Giovanni getan. Von führenden Humanisten erzogen und mit reichen Pfründen ausgestattet, wurde er vom amtierenden Papst, der seinerseits an guten Beziehungen zu der florentinischen Familie interessiert war, schon 1489 zum Kardinal erhoben, obwohl der Junge da gerade einmal 14 Jahre alt war. Heutige Vorstellungen davon, was einen Geistlichen zu dieser hohen kirchlichen Würde befähigt, spielten damals erkennbar eine untergeordnete Rolle. Zunächst konnte sich der junge Mann auch gar nicht auf theologische Fragen oder das Heil der Kirche konzentrieren, denn er musste turbulente Jahre überstehen: Seine Familie wurde 1494 von oppositionellen Gruppen aus der Stadt ins Exil getrieben, Giovanni floh zunächst nach Bologna, reiste dann später nach Deutschland, Flandern und Frankreich, um im Jahr 1500 in Rom einzutreffen und dort zunehmend an politischem Einfluss zu gewinnen. Binnen weniger Jahre machte er Karriere im Vatikan und übernahm 1512 schließlich sogar – das war eine besondere Auszeichnung – den Befehl über ein päpstlich-spanisches Heer, das die nach Italien vorgedrungenen feindlichen Franzosen vertreiben sollte. Er wurde allerdings gefangen genommen, konnte jedoch mit viel Glück fliehen und sich wieder in Rom in Sicherheit bringen. Ein durchschnittliches Kardinalsleben? Heute sicher nicht, doch zur damaligen Zeit absolut im Rahmen für Würdenträger einer Kirche, die tief verstrickt waren in die Turbulenzen der europäischen Machtpolitik.
Fortan ist das Glück Giovanni de’ Medici wieder hold. Seine im Exil lebende Familie konnte nach politischen Umwälzungen wieder in das heimatliche Florenz zurückkehren, er selbst übernahm als Familienoberhaupt rasch die politische Führung der Stadt, und der nächste Karrieresprung stand schon an: Als im Februar 1513 Papst Julius II. starb, entschieden sich die Kardinäle nach kurzem Konklave für den 37-Jährigen. Was gab es denn auch groß zu besprechen, wenn der Preis stimmte? Dass sich Papstwähler von den mächtigen italienischen Stadtfamilien bestechen ließen, war bekannt. Neapel, Venedig, Florenz – alle wollten sie das lukrative päpstliche Ruder übernehmen. Jetzt waren es eben die Medici aus Florenz.
Dass Giovanni de’ Medici offensichtlich die eine oder andere Voraussetzung für das Papstamt fehlte, war letztlich kein Hindernis. Er war zwar in jungen Jahren zum Kardinal erhoben worden, hatte jedoch die sonst üblichen Stationen der priesterlichen Karriere übersprungen. Das musste nach seiner Wahl der Form halber rasch nachgeholt werden. Am 15. März 1513 erhielt er die Priesterweihe, zwei Tage später die Bischofsweihe, wieder zwei Tage später wurde er zum Papst gekrönt6 – zumindest in dieser Hinsicht musste alles seine Ordnung haben. Als Leo X. war Giovanni de’ Medici nun im Zentrum der kirchlichen und weltlichen Macht angekommen und stand demonstrativ für die Allianz von Kirche und italienischer Hochfinanz. So hatte es sich sein inzwischen allerdings verstorbener Vater Lorenzo als weitblickender Kaufmann immer gewünscht. Er wäre fraglos stolz gewesen auf seinen Zögling.
Der neue Papst war ein Mann von Welt. Er kannte Europa zum Teil aus eigener Anschauung, er war gebildet und zudem ein Kirchenfürst von gutem und erlesenem Geschmack. Vornehm ausgedrückt, führte er »Rom und die Christenheit in heiterer Gelassenheit auf einen Höhepunkt ästhetischer Repräsentation«.7 Der mächtige Herrscher befleißigte sich also eines in jeder Hinsicht feudalen Lebensstils: Er pflegte sich morgens spät zu erheben, nutzte die Vormittage gewöhnlich für Audienzen und den Besuch der Messe, um nach dem Essen zunächst zu ruhen und dann einen Ausritt durch die ausgedehnten vatikanischen Gärten zu unternehmen. War er auf Reisen, nahm er gern an den von ihm so geschätzten Jagdausflügen teil. Auch wenn er sich hinsichtlich seiner persönlichen Essgewohnheiten eher zu mäßigen schien, ließ er gern heitere und üppige Gelage an seinem Hof ausrichten. Vor allem die musikalische Unterhaltung hatte es ihm dabei angetan; er liebte die Musik, hatte sich früher sogar an eigenen Kompositionen versucht und lud jetzt Künstler aus Italien, Frankreich und Spanien nach Rom ein, um sich an ihren Auftritten zu erfreuen. Noch tief in der Nacht, so hieß es in einer späteren Beschreibung, erfüllten für gewöhnlich die Klänge heiterer Musik den Vatikan.8 Das Leben unter diesem Papst war bunt, fröhlich und oft ziemlich laut.
Zu gutem Essen und erlesener Musik gehörten auch jene poetischen Darbietungen, an denen sich der Papst selbst beteiligte. Die Kunst, aus dem Stegreif Verse zu machen, war zu dieser Zeit hoch geschätzt, regelmäßig wurden Wettbewerbe um die besten Einfälle und Vorträge veranstaltet. Neben diesen »Sprach-Spielen« gab es auch Auftritte professioneller Possenreißer, die als Spaßmacher eher den schlichteren Humor bedienten und für aufregend derbe Späße sorgten. »An derselben Tafel, an welcher Kardinäle, Botschafter, Dichter und Künstler bewirtet wurden«, so beschrieb es ein Kirchenhistoriker später erkennbar irritiert, »durften Possenreißer, halb verrückte Poeten und sonstige Schmarotzer ihr abstoßendes und närrisches Wesen treiben.«9 So heißt es dazu beim Renaissancehistoriker Jacob Burckhardt:
»Ganz merkwürdig zeigt sich in Papst LeoX. die echte florentinische Vorliebe für Spaßmacher. Der ›auf die feinsten geistigen Genüsse gerichtete und darin unersättliche‹ Fürst erträgt und verlangt doch an seiner Tafel ein paar witzige Possenreißer und Freßkünstler, darunter zwei Mönche und einen Krüppel; bei festlichen Zeiten behandelte er sie mit gesucht antikem Hohn als Parasiten, indem ihnen Affen und Raben unter dem Anschein köstlicher Braten aufgestellt werden.«10
Leo liebte zugleich das Kunstvolle und Kostbare. Er mochte nicht nur die Musik und ließ die besten Künstler an seinen Hof rufen, sondern kaufte auch gern aufwendig mit Gold und Silber verzierte Musikinstrumente. Er stieg zum großen Mäzen für Dichter, Gelehrte, Musiker und Künstler auf, Rom wurde zu einem Zentrum des künstlerischen Lebens: Michelangelo, Raffael und viele andere kamen. Übrigens führte das Aufeinandertreffen so bedeutender Künstler auch zu ständigen Konflikten. So waren gegenseitige Verdächtigungen und Intrigen zwischen Michelangelo und Raffael nahezu an der Tagesordnung. Gleichwohl, und mit welcher Begleitmusik auch immer versehen: Am Tiber wurden Kunst und Geschäfte gemacht. Und Leo X. lebte allen in der Stadt eine demonstrative klerikale Prunksucht und Verschwendung vor. Der Historiker Leopold von Ranke sollte später einmal von ihm als einem Papst in einer Art »geistiger Trunkenheit« sprechen, den sein Geschick »von Genuß zu Genuß« trug.11 Die Nachwelt hat diese »Trunkenheit« und Verschwendungssucht wiederholt angeprangert und zuweilen dann doch ein wenig sentimental auf die ungeheure künstlerische und wissenschaftliche Fülle dieses Lebens im Vatikan geschaut. Die Kultur der Renaissance hatte hier einen Fürstenhof und ein höfisches Leben der Extraklasse erlebt, die auch Jacob Burckhardt begeisterte:
»Rom hatte seinen wahrhaft einzigen Hof LeosX., eine Gesellschaft von so besonderer Art, wie sie sonst in der Weltgeschichte nicht wieder vorkommt.«12
Die höchst weltliche Folge dieses gesellschaftlichen Lebens war allerdings eine notorische Geldnot, die Leos Pontifikat begleiten sollte – das gute Leben kostete einfach zu viel Geld. Oder, wie es einmal formuliert wurde: Leo konnte eben »kein Geld beisammen sehen«.13 Der Papst musste immer wieder neue Anleihen aufnehmen, längst nicht mehr nur bei den Bankiers, sondern auch bei Privatleuten oder anderen Kardinälen, die damit wiederum Einfluss auf ihn nehmen konnten. Der Vatikan brauchte Geld, auch weil sich zu allem Überfluss die päpstlichen Beamten als korrupt und geldgierig erwiesen. In der gesamten christlichen Welt war die Redewendung wohlbekannt, dass man in Rom eigentlich alles kaufen könne – und damit waren eben auch die geistlichen Güter gemeint. Selbst die Frohe Botschaft schien nur eine Frage des Geldes zu sein, weil Papst Leo X. seine Kirche und ihre Gläubigen zunehmend auf die Rolle von Geldbeschaffern reduzierte.
Zum zentralen Instrument des päpstlichen Geldbeschaffungssystems wurden die Ablässe. Sie sorgten bei Laien wie Klerikern zunehmend für Unmut und führten bald zu immer lauter werdender Kritik. Dabei waren diese Nachlässe zeitlicher Sündenstrafen – das waren Ablässe im theologischen Sinne – auch unter Leo X. kein neues Phänomen, nur entwickelten sich unter seinem Pontifikat vermehrt neue Formen und Dimensionen dieses Handels mit Gott. Eine regelrechte Kommerzialisierung des Ablasses hatte bereits im 14. Jahrhundert eingesetzt, nun, zu Beginn des 16. Jahrhunderts, erreichte sie ihren Höhepunkt durch den planmäßigen und von der Kirche immer massiver geförderten Ablasshandel. Damit geriet die ursprünglich gut gemeinte theologische Sündenvergebung in einen ganz und gar irdischen Kreislauf von Geldgier und Machtpolitik. Einige der Ablassprediger, die jetzt durch die Lande zogen, gingen sogar so weit, die Ablassbriefe wie Geld zu verwenden – und manch einer hatte augenscheinlich auch noch Gefallen daran, ausgerechnet Besuche bei Prostituierten mit diesen Briefen zu bezahlen.14 Das ging in den Augen selbst wohlmeinender Zeitgenossen dann doch deutlich zu weit. Schließlich spaltete der Ablass die Gläubigen: Den einen galt er als gottgefälliges Werk, als menschenfreundliche Verantwortung gegenüber dem Jenseits (weil der Ablass inzwischen auch für bereits Verstorbene erwirkt werden konnte) und zudem als willkommene Erleichterung der eigenen Sündenlast. Den anderen hingegen war er weltliches Instrument der Ausplünderung der Gläubigen durch die korrupte römische Kurie. Der mittelalterliche Lyriker Walther von der Vogelweide gehörte schon im 13. Jahrhundert zu den scharfen Kritikern:
»Saget an, hêr Stoc, hât iuch der bâbest her gesendet, daz ir in rîchet und uns Tiuschen ermet unde swendet?«
(Sagt an, Herr Opferstock, hat euchder Papst hergesandt,damit ihr ihn reich macht unduns Deutsche arm macht und auszehrt?)15
Kritik am Ablass hatte also eine Tradition, wenngleich es weiterhin auch Zustimmung gab. Von Gläubigen geschätzt waren etwa die Ablässe für Besuche der Peterskirche oder später der Grabeskirche des heiligen Franziskus in Assisi. Auch für die Teilnahme an Kreuzzügen winkte der Nachlass zeitlicher Strafen vor Gott. Gleiches galt für die Käufer von Ablassbildern, den seit dem 15. Jahrhundert eigens für diesen Zweck angefertigten Holzschnitten oder Kupferstichen. Es gab in einer Welt der religiösen Bedürfnisse offensichtlich eine Nachfrage nach theologischem Angebot.
In Deutschland nahmen das Gebaren der Ablassprediger und überhaupt die Organisation dieses frommen Handels indes ein solches Ausmaß an, dass schließlich die große Politik involviert beziehungsweise selbst ein Teil dieses Geschäftes wurde: Die Landesherren im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation ließen zu Beginn des 16. Jahrhunderts auf ihren Territorien die Ablassprediger mit ihren Predigten und Verkäufen gewähren, erwarteten dafür aber selbstverständlich eine angemessene Beteiligung an den Erlösen. Andernfalls, so drohten die weltlichen Herren der Kirche, würden sie den schwunghaften Handel kurzerhand untersagen. Das war eine Form der Erpressung, der sich selbst die Kurie beugen musste (wohl in der berechtigten Hoffnung, dass trotz dieser Beteiligung noch genug in der eigenen Kasse übrig bleiben würde). Und so sagte der Papst in Einzelfällen einem Landesherrn bis zu zwei Drittel der Einnahmen zu – ein lukratives Geschäft, für das der Fürst selbst ja fast keine eigenen Leistungen beisteuern musste.16 So hatten nun also viele etwas vom Ablasshandel: der Papst in Rom ebenso wie die Herrscher auf dem europäischen Kontinent – und mit viel gutem Glauben selbstverständlich auch die Gläubigen, die für sich oder ihre Angehörigen zumindest den drohenden Aufenthalt im Fegefeuer durch eine Geldzahlung verkürzt zu haben glaubten.17 Wenn sie sich diesen Handel finanziell leisten konnten …
»Wenn das Geld im Kasten klingt,die Seele aus dem Feuer springt.«
(Inschrift auf Ablasstruhen zu Beginn des 16. Jahrhunderts)
Aber Rom brauchte immer mehr Geld, konkret für den Bau des neuen Petersdoms. Der sollte nach dem Willen der Renaissancepäpste etwas Besonderes werden. Bislang stand an diesem zentralen Ort im Vatikan eine Basilika aus dem 4. Jahrhundert, über dem vermeintlichen Grab des Apostels Petrus. Jetzt sollte diese Grabkirche, die zugleich auch Hauptkirche des Papstes war, nicht mehr durch weitere Um- oder Anbauten vergrößert und verschönert werden. Man entschied sich vielmehr für Abriss und Neubau. 1506 hatte Papst Julius II. – der Vorgänger Leos X. – den Grundstein für den größten Kirchenbau der Welt gelegt. Nur die teuersten Materialien, nur die besten Baumeister und Künstler sollten das mächtige Gotteshaus prägen. Vier Jahrzehnte nach der Grundsteinlegung sollte beispielsweise Michelangelo als Bauleiter der Petruskirche fungieren. Julius II. hatte bereits 1507 einen Ablass zur Finanzierung des Neubaus im Herzen des Vatikans ausgeschrieben. Und wenngleich Leo X. bei Beginn seines Pontifikats 1513 einer vatikanischen Tradition gemäß zunächst alle zuvor bewilligten Ablässe wiederrufen ließ – jenen zur Förderung des Baus von St. Peter nahm er ausdrücklich aus. Darüber hinaus erweiterte er die Zahl derjenigen Länder, in denen jener künftig verkauft werden durfte.
Der sogenannte Petersablass sollte Geschichte machen, denn gerade der Umgang mit ihm erschien selbst jenen Zeitgenossen als besonders skandalös, die durch die Ablasspraxis der Kirche schon Kummer gewohnt waren. Das galt besonders für die Vereinbarung Roms mit Albrecht von Brandenburg, dem in Deutschland einflussreichen Erzbischof von Mainz und Magdeburg. Dieser hatte sich zwar durch zahlreiche Zahlungsverpflichtungen auch gegenüber dem Vatikan in eine finanziell angespannte Situation gebracht: Da waren zunächst die noch ausstehenden Konfirmationsgebühren – 14 000 Gulden waren allein als Zahlung zur Bestätigung seiner Wahl an den Papst fällig. Und Albrecht hatte dem Mainzer Domkapitel versprochen, diese Summe im Falle seiner Wahl nicht seiner neuen Diözese aufzubürden, sondern sie selbst zu bezahlen. Zugleich hatte er aber noch weitere 10 000 Gulden an den Papst zu zahlen, damit er zugleich Erzbischof von Magdeburg und Administrator des Bistums Halberstadt bleiben durfte.18 Der Aufstieg in der kirchlichen Hierarchie hatte eben seinen Preis.
Mit den Päpsten in Rom verband Albrecht seine Vorliebe für die Künste der Renaissance. Auch er förderte sie nach Kräften – schließlich war er als einer der sieben Kurfürsten im Reich (die den König wählten) einer der mächtigsten deutschen Regenten. Doch wie der Vatikan stieß auch der Erzbischof trotz der Anhäufung von Pfründen schließlich an die Grenzen seiner finanziellen Leistungsfähigkeit. Er brauchte dringend Geld. In seiner Not wandte er sich an das Bankhaus der Fugger, das finanzkräftig genug war, um dem Herrscher vorerst aus der Klemme zu helfen. Jacob II. Fugger (dem die Nachwelt treffenderweise den Beinamen »der Reiche« verlieh) war auch als der Bankier der Päpste und der Kurie bekannt. In seiner Zeit waren die Fugger zum größten europäischen Bankhaus aufgestiegen. Das schien Albrecht die beste Adresse zu sein, um sich Geld zu leihen und die Rückzahlung seiner Schulden an einen besonders ambitionierten Ablasshandel zu koppeln. Er wollte dafür in seinem Herrschaftsgebiet Ablässe für wenigstens 52 000 Gulden verkaufen – eine damals unglaublich hohe Summe. Dass es hierbei nicht nur um das Seelenheil der Gläubigen ging, sondern zunächst auch um ein gutes Geschäft des Erzbischofs Albrecht und im nächsten Schritt um die Ansprüche der Gläubiger, war allen Beteiligten nur allzu klar. Zur Sicherung ihrer Ansprüche begleiteten nämlich Vertreter des Bankhauses Fugger die Ablassprediger fortan bei ihrer »seelsorglichen« Arbeit, weniger um das vermeintlich fromme Werk zu unterstützen, als vielmehr direkt vor Ort ihren zugesagten Anteil an dem Handel einzukassieren.19 Sicher war sicher. Dieses Auftreten war sogar den Organisatoren des Ablasshandels unangenehm, deshalb sollte das einfache Volk von diesen politischen Abmachungen hinter dem theologischen Geschäft möglichst nichts erfahren – aber das wusste selbstverständlich Bescheid.
Der derart weltlich betriebene Handel mit den Ablässen war längst in zahlreichen Ländern zu einem Ärgernis geworden. Nicht nur in Deutschland klagten die Stände, die Städte und Herrschaften über die verlangten Ablassgelder und die hohen Steuern für die Kurie. Die Kritik am päpstlichen Rom nahm zu. Viele stellten sich die Frage, inwieweit der Ablasshandel in dieser Form eigentlich noch mit den ursprünglichen Ideen des Christentums zu vereinbaren war. Aber es ging nicht nur um Theologie, sondern seitens der Landesherren und Städte auch um möglichen Widerstand gegen finanzielle Ausbeutung. Wieder andere nutzten die Gelegenheit, antiitalienische, weil durchaus auch nationale Töne anzustimmen.20 Ämterkauf und Nepotismus wurden so offensichtlich betrieben, dass die moralische und theologische Glaubwürdigkeit der Kirche zunehmend schwand.
Zusätzlich erschüttert wurde die Stellung der römischen Herrschaft durch die Kritik der Humanisten. Sie schlugen einen neuen Ton an, spotteten über Mönche und Päpste, machten die Lebensführung des gesamten geistlichen Standes zum Thema. Zugleich erschloss der Humanismus den Zugang zu den antiken Sprachen und damit zum Studium auch der biblischen Texte im Original. Gerade in Deutschland beeinflussten die Humanisten viele der späteren Reformatoren und verbanden ihre Kritik an Rom von Beginn an mit der deutschen Frage. So auch der populäre Humanist Ulrich von Hutten. Die Ausbeutung und Unfreiheit Deutschlands sah er mitverursacht durch die Finanzgier des Vatikans. Er beschrieb diese Verbindung, als er sich 1520 erstmals in deutscher Sprache mit seiner Clag vnd Vormanung gegen den übermässigen vnchristlichen Gewalt des Bapsts zu Rom an eine breitere Leserschaft wandte. In dieser in Versform gehaltenen Flugschrift machte er die Papstkirche direkt für die Ausbeutung und die Unfreiheit Deutschlands verantwortlich.21
Doch bei aller Kritik an Rom: Die Menschen in den deutschen Ländern waren im Rahmen der damaligen Zeit gläubige Menschen, besonders gläubige sogar. Das beginnende 16. Jahrhundert war von einer Frömmigkeit erfüllt, die von einem tiefen Glauben an Erlösung geprägt war. Die Verehrung von Heiligen und Reliquien war weit verbreitet, Massen von Menschen strömten zu Wallfahrten zusammen. Die Bedenken gegen Rom waren also ein Beleg für eine wachsende Kirchenkritik, aber keineswegs so etwas wie ein Vorbote eines neuen Unglaubens außerhalb des christlichen Weltbildes. Fast schien es, als hätte die römische Kirche sogar ein Problem, der zunehmenden Volksfrömmigkeit noch gerecht zu werden. Die Gläubigen nahmen die Sache zuweilen selbst in die Hand: So mehrten sich in den Städten die Fälle, in denen begüterte Bürger mit Stiftungen und Spenden ihr persönliches Seelenheil sichern wollten; auf diesem Wege füllten sich die Kirchen mit Altären und religiösen Kunstwerken. Neue Formen der Heiligen- und Reliquienverehrung griffen um sich, die Wallfahrten wurden zum sichtbaren Ausdruck einer neuen Volksfrömmigkeit. Denn die Menschen in Deutschland waren am Vorabend der Reformation alles andere als ungläubig, tatsächlich waren sie viel frommer als lange zuvor.22
Damit trafen also zwei Phänomene aufeinander, die zusammen eine besondere historische Sprengkraft hatten: die neue, tiefe Frömmigkeit und die heftige Kritik an den offensichtlichen Missständen der Kirche. Und diese Kritik betraf längst keineswegs nur den Ablass: Das gesamte Auftreten der Kirche, ihrer Bischöfe und Geistlichen stand nun im Fokus. Die Gläubigen waren unzufrieden, und die Laien hatten längst begonnen, die gesellschaftliche Führungsrolle der Kirche anzufechten. Sie wollten nicht länger hinnehmen, dass der Klerus die Kirche zuvörderst als sein Eigentum betrachtete, das lediglich dem eigenen wirtschaftlichen Vorteil und der Befriedigung privater Gelüste diente. Und die fetten Pfründen der Reichskirche wurden offenkundig nur noch zur Versorgung des Adels verwendet, nicht aber für irgendwelche religiösen Zwecke.23 Mit dem Christentum hatte das doch eigentlich nicht mehr viel zu tun, oder?
Die römische Kirche sah das anders, und wer in seiner Kritik an ihr zu weit ging, wurde verfolgt und gemaßregelt. Deshalb musste man es sich zu dieser Zeit gut überlegen, ob man die Öffentlichkeit oder Kirchenfürsten an seinen Gedanken teilhaben lassen wollte. Zu denen, die sich nach reiflicher Überlegung dazu entschlossen hatten, zählt der deutsche Augustinermönch Martin Luther (1483–1546). Er war weniger erzürnt über die kirchliche Lehre vom Ablass als vielmehr über den im Lande praktizierten Ablasshandel, vor allem über den Petersablass und dessen Verkauf auf dem Gebiet des Mainzer und Magdeburger Erzbischofs Albrecht. Luther ließ es nicht, wie so viele andere, bei stiller Ablehnung bewenden, sondern gab seiner Empörung Ausdruck. Er griff zur Feder und schrieb dem nach Ablassgeldern schielenden Erzbischof Albrecht 1517 einen wütenden Brief, der an Klarheit nichts zu wünschen ließ:
»Hochwürdiger Vater in Christus, durchlauchtigster Kurfürst!… Es wird im Lande unter dem Schutz Eures erlauchten Titels der päpstliche Ablaß zum Bau von Sankt Peter feilgeboten. Ich klage dabei nicht so sehr über das Geschrei der Ablaßprediger, das ich persönlich nicht gehört habe. Wohl aber bin ich schmerzlich erzürnt über die grundfalsche Auffassung, die das Volk daraus gewinnt und mit der man sich überall öffentlich brüstet. Offenbar glauben die unglücklichen Seelen, ihrer Seligkeit sicher zu sein, sobald sie nur einen Ablaßbrief gelöst haben; ebenso glauben sie, daß die Seelen sofort aus dem Fegefeuer fahren, sobald sie das Lösegeld in den Kasten gelegt hätten.«24
Martin Luther hielt diesen ganzen Ablasshandel für einen feisten Schwindel und erklärte dem Erzbischof und Kurfürsten Albrecht zudem unverblümt, dass er in dieser Sache »nicht länger schweigen« könne. Die Vorstellung von einem Ablass sei theologisch abwegig, die Menschen würden getäuscht – und wer den Ablasshandel begünstige, vergehe sich im Grunde genommen an diesen armen Seelen, die um ihr Heil fürchten. Das war eine klare Absage an die gesamte herrschende Finanzierungspraxis der Kirche. Und der Erzbischof? Der reagierte vergleichsweise gelassen. Er verwarf diese Kritik zunächst einmal nicht, sondern forderte ein Gutachten der Universität Mainz an, das allerdings etwas vage ausfiel und empfahl, die Sache zur Entscheidung doch lieber dem Papst zu übergeben. Den hatte Albrecht allerdings schon selbst informiert. Doch Leo X. fand das Auftreten des Augustinermönches im fernen Deutschland wohl nicht weiter bedrohlich, und so legten seine Räte den Fall vorerst zu den Akten, statt – was denkbar gewesen wäre – unmittelbar einen Prozess gegen Luther anzustrengen.25
Martin Luther war zu diesem Zeitpunkt in deutschen Landen bereits ein durchaus bekannter Mann. Der 1483 in Eisleben geborene und in Mansfeld aufgewachsene Sprössling einer Bergwerksunternehmerfamilie hatte die Universität Erfurt besucht und zunächst auf Wunsch des Vaters ein Studium der Jurisprudenz angefangen. Das brach er jedoch 1505 ab und entschied sich stattdessen für ein Leben im Kloster. Auf ihn wartete nun ein strenges Mönchsleben bei den Augustinereremiten in Erfurt. Sein Orden erkannte früh Kraft und auch Durchsetzungsvermögen des Mannes, und so stieg er bald in der Hierarchie des Klosters auf. Er wurde 1510 oder 1511 vermutlich sogar mit einer – wie es hieß – Reise »in Ordensangelegenheiten« nach Rom betraut, was als eine Auszeichnung zu verstehen war.
Bei dieser wie bei anderen Gelegenheiten hatte der Mönch schon längst gezeigt, dass er zu eigenständigem Denken fähig und willens war. Sein Biograf Heinz Schilling bescheinigt dem ab 1512 dann als Professor in Wittenberg forschenden und lehrenden Luther bereits für diesen Lebensabschnitt »jene Entschiedenheit und Querköpfigkeit des späteren Reformators, die ihn zu bedingungslosem Widerstand gegen alles befähigten, was ihn von der einmal erkannten Wahrheit abzubringen suchte, selbst gegen Papst und Kaiser«.26 War das nicht der richtige Mann für eine dringend nötige Revolution? Wer, wenn nicht dieser junge, intelligente und willensstarke Martin Luther, konnte das längst überfällige Aufbegehren gegen den Zustand der Kirche entscheidend vorantreiben? Und war nicht genau jetzt dafür auch der richtige Zeitpunkt? Er könne in dieser Angelegenheit »nicht länger schweigen«, hatte Luther Erzbischof Albrecht angesichts des skandalösen Ablasshandels erklärt. Es mag sein, dass Albrecht die erwähnte »Querköpfigkeit« und Hartnäckigkeit des Augustiners unterschätzt hat. Denn wenn dieser sagte, er könne nicht schweigen, dann meinte er das auch so. Martin Luther schwieg nicht. Schon mit seinem Schreiben an den Erzbischof legte er seine 95 Thesen vor. Sie kursierten bald unter dem lateinischen Titel Disputatio pro declaratione virtutis indulgentiarum. Es war eine Abrechnung, in der es beispielsweise hieß:
»Der Papst erläßt den Seelen im Fegfeuer keine einzige Strafe, die sie nach den kirchenrechtlichen Bestimmungen in diesem Leben hätten abtragen müssen.
Wenn überhaupt irgendein Erlaß aller Strafen jemandem gewährt werden kann, dann ist gewiß, dass er nur den Vollkommensten, d. h. den Allerwenigsten gewährt werden kann.
Unausweichlich wird deshalb der größte Teil des Volkes betrogen durch jene unterschiedslose und großspurige Zusage erlassener Strafe …
Lug und Trug predigen diejenigen, die sagen, die Seele erhebe sich aus dem Fegefeuer, sobald die Münze in den Kasten fällt.
Das ist gewiß: Fällt die Münze klingend in den Kasten, können Gewinn und Habgier zunehmen. Die Fürbitte der Kirche aber liegt allein in Gottes Ermessen.«27
Es war der 31. Oktober 1517. Die Nachwelt hat später irrtümlich das Bild verbreitet, wonach der Mönch selbst diese Thesen an die Wittenberger Schlosskirche genagelt haben soll. Doch einen solchen revolutionären Thesenanschlag durch den hammerschwingenden Reformator hat es wohl nicht gegeben. Womöglich hatte ein Mitstreiter den Text tatsächlich an der Schlosskirche ausgehängt, dann aber wohl im Sinne der Ankündigung einer akademischen Disputation und der Aufforderung zur Diskussion mit dem Urheber. Aber ganz sicher hat Luther die Thesen umgehend als Plakat drucken lassen – damit hängte der Mönch die Kritik an seiner Kirche, wenn auch nicht wörtlich an die Tür der Schlosskirche, so doch zumindest in einem publizistischen Sinne an die ganz große Glocke, um von Beginn an eine möglichst breite Öffentlichkeit zu erreichen: Kollegen und Bekannte, humanistisch gebildete Mönche und Kleriker, seine Studenten und auch Laien.28
Luthers Text wurde zu einem Fanal. Vielleicht war er selbst überrascht von der Geschwindigkeit, mit der sich seine Ablassthesen verbreiteten, und womöglich auch von der beachtlichen Zustimmung, die seine Ausführungen erfuhren. Binnen kurzer Zeit kursierten seine Thesen in den Kreisen deutscher Humanisten und Theologen. Dabei kam ihm zugute, dass der Buchdruck in den Jahren zuvor die technischen Voraussetzungen für die auflagenstarke Verbreitung von solchen Texten geschaffen hatte. Erst auf diesem Wege entstand durch das neue Medium eine eigenständige reformatorische Öffentlichkeit, vor allem in den Städten, wo viele Bürger offen waren für neue, belebende Ideen. So wurde die Reformation zugleich zu einer Medienrevolution: Luthers bereits im folgenden Jahr vorgelegter Sermon überAblaß und Gnade, der in deutscher Sprache erschien und seine Kritik am Ablasshandel zusammenfasste, wurde binnen zwei Jahren 25-mal nachgedruckt und erreichte eine Auflage von etwa 60 000 Exemplaren.29 Später sollte die Zahl der kursierenden Schriften in die Millionen gehen. Das war ein grandioser publizistischer Erfolg – und ein untrügliches Zeichen dafür, dass Martin Luther mit seinen Gedanken einen Nerv der Zeit getroffen hatte. Er war der Mann der Stunde.
Im Jahr 1520 folgte An den christlichenAdel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung. Mit dieser sprachmächtigen Schrift ging Luther in seiner Kritik gegenüber Rom noch einen Schritt weiter und bestritt darin auch die Autorität des Papstes über die weltlichen Obrigkeiten. Überhaupt müsse der Papst endlich dazu angehalten werden, wieder in Demut und wirklicher Nachfolge Christi zu leben. Der aufwendige Lebensstil des Kirchenoberhauptes müsse kritisch unter die Lupe genommen und ein Konzil einberufen werden. Über den Missbrauch von Wallfahrten sei ebenso zu sprechen wie über die in der Heiligen Schrift nirgendwo vorgeschriebene Ehelosigkeit der Priester. Zudem forderte Luther nun auch die Unabhängigkeit des deutschen Kaisertums vom Papst sowie die Errichtung einer von Rom unabhängigen Kirche. Der Augustiner war grundsätzlich geworden – er ging Schritt für Schritt die Verfehlungen seiner Kirche durch und scheute nicht davor zurück, vermeintlich radikale Forderungen zu stellen.
Im selben Jahr publizierte Luther, seit einigen Jahren bereits Professor für Bibelauslegung an der Wittenberger Universität, seine endgültige Abrechnung mit der römischen Priesterkirche: Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche war seine zunächst auf Lateinisch (De captivitate Babylonica ecclesiae) erschienene Schrift betitelt, in der er das Papsttum und die Kirche wegen der herrschenden Sakramentspraxis beschuldigte, eine regelrechte Knechtschaft der Seelen verursacht zu haben. Die Sakramente seien längst nicht mehr in Händen der Christen, sondern – weil es nur den Priestern vorbehalten sei, sie zu spenden – im Besitz der römischen Kirche. Und die missbrauche sie als Instrument ihrer Herrschaft über die Menschen. Er selbst wolle von den bekannten sieben Sakramenten ohnehin nur noch drei gelten lassen: die Eucharistie (wobei er zugleich beklagte, dass dem Laien dabei der Kelch versagt wurde), die Taufe und die Buße. Das war die offene Abrechnung mit dem Kern der römischen Priesterkirche.
»Grundsätzlich und als erstes muß ich verneinen, daß es sieben Sakramente gibt, und kann zur Zeit drei dafür setzen: die Taufe, die Buße, das Brot. Und diese alle sind uns durch die römische Kurie in elende Gefangenschaft geraten, und die Kirche ist all ihrer Freiheit beraubt.«30
Ebenfalls 1520 erschien schließlich Luthers berühmteste reformatorische Flugschrift Von der Freiheit eines Christenmenschen, versehen mit einem persönlichen Sendschreiben an Papst Leo X. Letzteres erschien durchaus sinnvoll, denn inzwischen hatten Kirche und Papst auf Luthers Kritik reagiert – allerdings anders, als dieser erhofft hatte. Während Luther in Wittenberg über seinen reformatorischen Schriften saß, hatten die theologischen Fakultäten in Köln und Löwen über seine Thesen beraten und ihn daraufhin zum Häretiker erklärt. Zugleich war in Rom ein Ketzerprozess gegen ihn eröffnet worden – und in beiden Fällen wurde Luther selbst nicht gehört. Das Urteil in Rom erfolgte rasch und fiel eindeutig aus. Im selben Jahr noch wurden 41 Irrlehren des Wittenbergers aufgelistet. Luther wurde eine Frist von 60 Tagen gesetzt, seine Thesen zu widerrufen. Sollte er es nicht tun, würde er exkommuniziert und somit aus der Kirche verstoßen werden:31
»Weil die genannten Irrtümer und viele andere in den Büchlein oder Schriften eines gewissen Martin Luther enthalten sind, verdammen, verwerfen und verstoßen wir zugleich die genannten Bücher und alle Schriften, ob sie in lateinischer oder deutscher Sprache geschrieben sind … Sie sollen alle sogleich nach ihrer Veröffentlichung, wo immer sie sich befinden, durch die zuständigen Bischöfe und andere oben erwähnte Personen gesucht, öffentlich und feierlich in Gegenwart der Geistlichkeit und des Volkes bei allen und jeder angedrohten Strafe verbrannt werden.«
Deutlicher als in dieser Strafandrohung ging es nicht – und entschlossener konnte auch der Widerstand nicht sein, den Martin Luther der römischen Drohung entgegensetzte. Ein Widerruf kam für den kompromisslosen Gottesmann nicht infrage, also wurde er entsprechend der päpstlichen Drohung im Januar 1521 offiziell zum Ketzer erklärt. Das hatte nun auch weltliche Folgen: Der römisch-deutsche König und spätere Kaiser Karl V. sah sich nach den herrschenden Vorstellungen von Kaisertum und Reich als Beschützer des christlichen Abendlandes, das Treiben eines Ketzers in seinem Reich wollte er deshalb keineswegs dulden. Er strebte folglich die Ächtung des unbequemen Geistes an, durch Verhängung der sogenannten Reichsacht, die den Betroffenen für vogelfrei erklärte und ihn damit rechtlos machte. Dafür musste Karl V. allerdings eine rechtliche Hürde nehmen: Vor einer solchen Maßnahme war, anders als bei den kirchlichen Verfahren in Rom, der Beschuldigte selbst zu hören, auch wenn man sich über die Verurteilung vielleicht schon längst einig war. Martin Luther durfte sich also erklären. So kam es im April 1521 auf dem Reichstag zu Worms zu einem historischen Zusammentreffen.
Mit Recht wurde später darauf hingewiesen, dass bei diesem Reichstag zwei denkbar unterschiedliche Männer aufeinandertrafen, die aus zwei Welten stammten, wie sie gegensätzlicher kaum sein konnten. Der Habsburger stand erst am Beginn seiner Herrscherlaufbahn. Er war 21 Jahre alt, 1516 als Karl I. König von Spanien und 1519 zum römisch-deutschen König gewählt worden. Da sein Herrschaftsgebiet große Teile des Herzogtums Burgund sowie die Königreiche Kastilien und Aragon (also die heutigen Territorien von Picardie, Belgien, Niederlande, Spanien, Süditalien samt überseeischen Kolonien) umfasste, war Karl außenpolitisch gefordert; vor allem die Rivalität zum Königreich Frankreich prägte seine Regentschaft. Eine innenpolitische Krise, ausgelöst von einer Grundsatzdebatte über das Existenzrecht der päpstlichen Kirche, konnte er da nicht gebrauchen. Sollten Karl V. und Martin Luther womöglich im Vorfeld die Hoffnung gehabt haben, den jeweils anderen zu »bekehren« und auf die eigene Seite zu ziehen, so wurden sie enttäuscht. Vielmehr wurden die Gegensätze durch die Begegnung in Worms größer. Luther wurden zu Beginn der Anhörung seine Schriften vorgelegt: Das seien wohl seine Werke, erwiderte der Wittenberger Professor, aber zu widerrufen habe er nichts. Auch der Vorwurf, es sei doch eine Anmaßung, wenn er als Einzelner für sich die Wahrheit beanspruchen würde, fast allein gegen die Kirche und das ganze Reich, konnte den Augustiner nicht beeindrucken. Er blieb selbstbewusst und unnachgiebig. Auch wenn er als Einziger in der Gewissheit lebe, die Wahrheit zu verkünden, so bleibe dies doch seine Aufgabe. Gott selbst habe ihn dazu gebracht – nun müsse er diesen Weg auch weitergehen. Und dann folgte jener später so berühmt gewordene Ausspruch, der auf lange Zeit zu einem stolzen Erbe des Protestantismus werden sollte:
»Und solange mein Gewissen durch die Worte Gottes gefangen ist, kann und will ich nichts widerrufen, weil es unsicher ist und die Seligkeit bedroht, etwas gegen das Gewissen zu tun. Gott helf mir. Amen.«32
Damit war alles gesagt. Martin Luther fühlte sich durch Gottes Wort in die Pflicht genommen, es oblag ihm nicht, seinen Kurs zu verlassen. Wohl ohne sein Zutun formulierten geschickte Lektoren sein Bekenntnis von Worms dann kurze Zeit später für die Nachwelt griffiger um zu: »Ich kann nicht anders, hier stehe ich, Gott helfe mir, Amen.«33
So angetan Luthers Anhänger von seinem Auftritt waren, so unbeeindruckt zeigten sich seine Gegner. Ein venezianischer Gesandter sprach von einem »sehr mittelmäßigen Auftritt«, und der König meinte schlicht: »Der wird mich nicht zum Ketzer machen.« Zwar beherrschte Karl kaum die lateinische und die deutsche Sprache, doch er glaubte genug von dem verstanden zu haben, was dieser Augustinermönch von sich gegeben hatte.34 Denn deutlicher konnte die Situation ja nicht sein: Der selbst ernannte Reformator hatte sich zu seinen Äußerungen bekannt und darüber hinaus keine Möglichkeit gesehen, der römischen Kirche entgegenzukommen. Und der Kaiser fühlte sich als Verteidiger des Glaubens, er musste als solcher unbeirrt an der kirchlichen Tradition festhalten. So diktierte er eine lange – französische – Deklaration, in der er Luthers Irrtum festschreiben ließ:
»Denn es ist gewiß, daß ein einzelner Ordensbruder irrt mit seiner Meinung, die gegen die ganze Christenheit ist sowohl während der vergangenen tausend und mehr Jahre als auch in der Gegenwart; dieser Ansicht nach wäre die ganze genannte Christenheit immer im Irrtum gewesen und würde es heute noch sein.«35
Der Augustinermönch Martin Luther wurde mit der Reichsacht belegt und war fortan vogelfrei. Lektüre und Verbreitung seiner Schriften wurden verboten. War Luther jetzt tatsächlich in ernster Gefahr? Sicherheitshalber zogen ihn seine Anhänger aus dem Verkehr. Auf der Rückreise von Worms nach Wittenberg wurde er am Fuß der Wartburg südwestlich von Eisenach Opfer einer vorgetäuschten Entführung. Kurfürst Friedrich der Weise von Sachsen hatte die »Tat« in Auftrag gegeben, um seinen Schützling nach Verhängung der Reichsacht in Sicherheit zu bringen. Als »Junker Jörg« brachte man den Reformator auf die Wartburg, die sich für ein Versteck recht gut eignete, weil sie ein wenig in Vergessenheit geraten war. Die einstige Residenz der mächtigen Ludowinger hatte im 12. und 13. Jahrhundert noch als Musterbeispiel spätromanischer Baukunst gegolten und gleichermaßen als beeindruckendes Herrschaftssymbol wie kulturelles Zentrum höfischer Kultur gedient. Doch seit sie im Jahr 1263 in den Besitz der Wettiner gelangt war, hatte sie an Ausstrahlung erheblich eingebüßt. Notdürftig erhalten, hatte sie inzwischen nur noch regionale Bedeutung.36 Ein denkbar gutes Versteck also abseits des großen politischen Geschehens.
Kirche und Reich hatten ihr Urteil gesprochen, aber schon in diesem Moment muss es illusorisch erschienen sein, dass damit Ruhe in Deutschland einkehren würde. Zu viel war bereits geschrieben und gelesen worden. Während der Beratungen in Worms wurde das ungeheuer große öffentliche Interesse offenbar, denn dies war kein Geheimtreffen, dessen Verlauf nur wenige Eingeweihte interessierte. Ganz im Gegenteil: Gerüchte schwirrten in der aufgeladenen Stimmung auf den Straßen der Stadt umher, es gab anonyme Drohungen und offene Unterstützung. Nein, beendet wurde mit dem Schuldspruch nichts. »Den meisten Reichsständen«, so urteilt Heinz Schilling, »gefiel die mit dem Wormser Edikt, so der bald berühmt-berüchtigte Name des Erlasses, verhängte Acht gegen Luther ganz und gar nicht. Ebenso wenig der großen Mehrzahl der Deutschen.«37 Der Reformator hatte nicht nur in den deutschen Landen Unterstützer, seine Ideen – allen voran seine Kritik an der Papstkirche – waren auch in den angrenzenden Ländern auf Resonanz gestoßen. Rom war darüber selbstverständlich informiert, verärgert und irritiert. Schon vor dem Wormser Reichstag hatte der päpstliche Nuntius an den Vatikan gemeldet, dass ganz Deutschland »in heller Aufruhr« sei: »Neun Zehntel erheben das Feldgeschrei ›Luther‹, und für das übrige Zehntel, falls ihm Luther gleichgültig ist, lautet die Losung wenigstens ›Tod dem römischen Hof‹.«38
Totgeschlagen wurde in diesem Moment noch niemand – aber die Bücher, die die neuen Ideen transportierten, wurden bereits demonstrativ vernichtet. Am 12. November 1520 waren auf Veranlassung des päpstlichen Nuntius in Köln und Mainz die Werke Martin Luthers öffentlich verbrannt worden. Die Reformatoren wollten da nicht zurückstehen und veranstalteten einen Monat später ihrerseits einen Anschlag auf das gedruckte päpstliche Wort. Wer dem Studium der evangelischen Wahrheit zugeneigt sei, so hieß es in Wittenberg, möge sich abends vor einem der Stadttore einfinden.39 So ein Spektakel war zu dieser Zeit zwar nicht an der Tagesordnung, aber noch lange nicht so negativ besetzt wie in heutiger Zeit. Ungewöhnlich in diesem Fall waren allerdings nicht nur der Ort der Verbrennung (nämlich der Schindanger, wo sich die Bürger normalerweise der für unehrlich erachteten Dinge entledigten), sondern vor allem auch die demonstrativ vernichteten Werke. In den Flammen landeten nämlich mehrere Ausgaben des kanonischen Rechts, eine Handschrift scholastischer Beichtpraxis sowie Traktate von Luther-Gegnern. Der Reformator hätte gern auch noch Schriften des großen Thomas von Aquin verbrannt, doch der örtliche Bibliothekar verhinderte dies mit dem Hinweis, man brauche diese Schriften doch noch als Grundlagenliteratur für die Ausbildung der Theologiestudenten. Als schließlich das Feuer schon brannte, trat Martin Luther selbst an die Flammen und warf einen Druck der gegen ihn verhängten Bannandrohungsbulle hinein. Ob er dabei wirklich die folgenden Worte gesagt hat, bleibt offen. Zuzutrauen wären sie dem überzeugten Streiter auf jeden Fall:
»Weil du die Wahrheit Gottes verderbt hast, verderbe dich heute der Herr. Hinein damit ins Feuer.«40
Als über den streitbaren Mönch in Worms die Reichsacht verhängt worden war, befand sich Martin Luther längst in Sicherheit. Unter dem Schutz seines Landesherrn, des Kurfürsten von Sachsen, fand er auf der Wartburg auch die erforderliche Zeit für seine Arbeit. Heinz Schilling nennt die nun folgenden zwölf Monate auf der Burg einen »Glücksfall« für den Reformator, weil dieser nun – den Tagesgeschäften entrückt – die theologischen Grundlagentexte abfassen konnte, die er und seine Gefolgsleute zur Absicherung der neuen Lehre und der damit einhergehenden Erneuerung von Gottesdienst und Kirchenordnungen dringend benötigten. Aber Martin Luther war keineswegs aus der Welt: Er blieb nicht nur weiterhin Mittelpunkt des Wittenberger Reformkreises, sondern er war darüber hinaus auch durch seine Schriften im ganzen Land präsent. Zudem musste er sich – durch Korrespondenzen bestens über die Geschehnisse im Reich unterrichtet – immer wieder gegen kirchliche Vorwürfe zur Wehr setzen. Denn Rom nahm die reformatorischen Schriften keineswegs kampflos hin, und aus diesem Streit um den rechten Glauben konnte sich Luther als Anführer der Reformation nicht einfach heraushalten.41
So hatte auch Luthers theologische Grundaussage die kirchliche Welt längst erschüttert: Schon vor Jahren hatte er aus seinem eigenen religiösen Erleben heraus die Vorstellung formuliert, dass der Mensch in seiner Sündhaftigkeit nicht aus eigener Kraft das Heil erlangen könne – und dass auch die von der Kirche bereitgestellten Mittel ihm dabei nicht helfen würden. Damit war der Weg zur Rechtfertigungslehre frei: Eine Rechtfertigung des Menschen vor Gott werde nicht durch irgendwelche Leistungen bewirkt, sondern sie sei ein Geschenk Gottes, das der Mensch als Gnade nur dankbar entgegennehmen könne, wenn er an das Heil glaube. Die zentralen Elemente dieser neuen Theologie waren und sind die vier Soli: Allein durch Christus (solus Christus), allein durch die Gnade Gottes (sola gratia), allein durch den Glauben (sola fide) und allein durch die Schrift (sola scriptura) komme der Mensch zum richtigen Glauben.
Auch eine praktische Frage konnte und wollte Luther nicht länger unkommentiert lassen: die Frage nach Zölibat und Mönchsgelübde. Dass diese Lebensformen nicht aus der Bibel heraus begründbar und deshalb also Erfindungen der Papstkirche seien, hatte er schon zuvor in einer seiner Schriften erklärt. Damit war er auf große Resonanz gestoßen. Während er selbst auf der Wartburg noch entschlossen war, weiterhin im Mönchsstand zu leben, wagten andere Pfarrer bereits den Schritt in eine neue Zeit: Nahe Wittenberg ging nun ein erster Geistlicher offiziell eine Priesterehe ein – und Luther gratulierte den Neuvermählten und wünschte ihnen Glück. In den folgenden Wochen erlebte der Zölibat einen regelrechten Dammbruch – Dutzende von Priestern gründeten nun Pfarrfamilien. Wenn sich Luther anfangs zuweilen skeptisch zeigte, dann deshalb, weil er die wirtschaftlichen Folgen für die Betroffenen fürchtete. Die Eheschließung eines Priesters führte schließlich zu dessen Amtsenthebung und brachte wegen der ausfallenden Einkünfte möglicherweise große Not über junge Familien. Doch das waren weltliche Bedenken, theologisch legte der Reformator bald nach und lehnte für eine erneuerte Kirche Mönchtum und Zölibat angesichts der gottgeschenkten evangelischen Freiheit kategorisch ab. Für die katholischen Gegner war diese Festlegung ein weiteres, höchst alarmierendes Zeichen der Häresie, während man auf reformatorischer Seite diese Klarstellung als wahren »Anfang der Befreiung von Mönchen und Nonnen« feierte, die das öffentliche Leben in Deutschland umstürzen werde.42
Luther selbst lebte trotz seiner Angriffe auf das Mönchtum noch zölibatär. Auch nach seiner Rückkehr in das Wittenberger Augustinerkloster 1522 trug er öffentlich zunächst weiter die Mönchskutte, erst seit Oktober 1524 demonstrativ weltliche Kleidung. 1525 setzte er durch seine Heirat mit Katharina von Bora, die gemeinsam mit anderen Nonnen aus einem Zisterzienserkloster geflohen war, ein deutliches Zeichen dafür, dass auch er aus seinen theoretischen Schriften praktische Konsequenzen für sein persönliches Leben ziehen wollte. Die Ehe wurde indes weitgehend heimlich geschlossen, nur eine kleine Gruppe von engen Freunden war geladen. Doch diese Suche nach dem privaten Glück konnte selbstverständlich keine private Angelegenheit bleiben, die Heirat erregte noch lange nach Bekanntwerden die Gemüter. Es waren vor allem die Gegner Luthers, die nun den Reformator und seine Ehefrau genüsslich mit Häme und Spott überzogen. Sie konnten diese Verbindung einfach nicht akzeptieren und unterstellten Luther eine unkontrollierte Sexualität; auch Katharina wurde in dieser Hinsicht dauerhaft denunziert. Diese Verunglimpfung sollte sich auf katholischer Seite übrigens lange halten und das populäre Luther-Bild bis ins 19. Jahrhundert hinein negativ prägen. Der Reformator selbst hatte von seinen Gegnern nichts anderes erwartet als die persönliche Verunglimpfung. Letztlich sah er sich durch diese Angriffe in seiner Meinung durchaus bestätigt, dass er mit seiner Eheschließung Gottes Weisung erfüllt hatte.43
Die wenigen Jahre seit dem Thesenanschlag hatten Luthers Leben also nachhaltig verändert; er hatte den Papst kritisiert, mit Rom gebrochen, sein Mönchsleben beendet und schließlich geheiratet. Doch was er in diesen Jahren initiiert hatte, war weit mehr als eine Diskussion um den richtigen Glauben und die daraus abzuleitende Lebensführung des Einzelnen. Das war es zwar in seinem Ursprung, aber es ging von Beginn an auch um politische Fragen. Und die Reformation löste ein politisches Erdbeben aus. Die Gesellschaft des beginnenden 16. Jahrhunderts war in Bewegung geraten, soziale und politische Anliegen diverser Bevölkerungsgruppen verlangten nach Klärung. Das Reich sah sich angesichts des Auseinanderbrechens der vormals alles vereinenden Kirche mit einer Legitimations- und Organisationskrise konfrontiert, in den Städten etablierten sich Bürger und Räte mit alten und neuen Ansprüchen, die Ritter fürchteten um ihren Einfluss, und auf dem Lande drohten die Bauern mit Revolten, wenn sie ihre traditionellen Rechte bedroht sahen. In dieser Gemengelage höchst unterschiedlicher und sich widersprechender Interessen wirkte die Spaltung der Kirche eskalierend. Die Reformation eröffnete hier nicht nur neue Möglichkeiten des Glaubens, sondern lieferte zugleich auch neue Anlässe und Formen der Konfrontation. So verband sich auch jener Konflikt, der als Bauernkrieg von 1524/25 in die Geschichtsbücher einging, mit der neuen religiösen Bewegung. Die Frage nach dem richtigen Glauben wurde zur sozialen Frage, deren Beantwortung im Kampf auf Leben und Tod ausgefochten werden sollte.