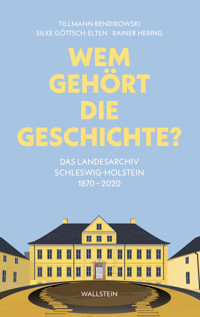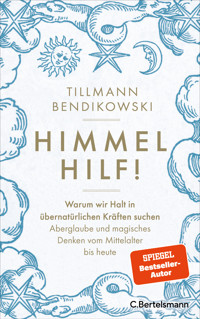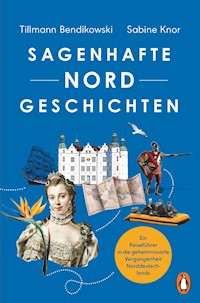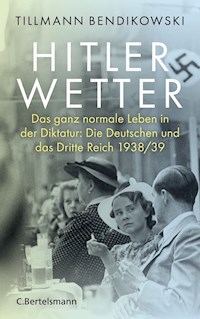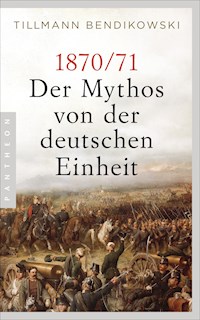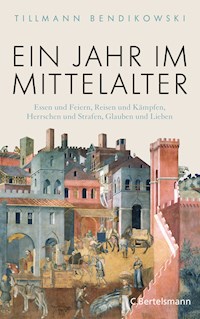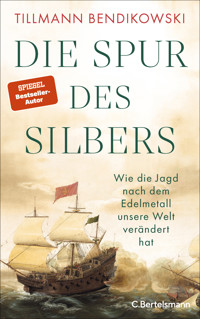
22,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie die globalisierte Welt entstand – eine neue Geschichte des Silbers vom Mittelalter bis heute
Es ist weich und wandelbar, ein sagenhaftes Element, über Jahrhunderte brachte es Macht und Reichtum, aber auch Ausbeutung und Elend: Silber hat die Welt verändert. Und es bewegt unsere Welt bis heute, als Rohstoff und als Wertanlage. Tillmann Bendikowski erzählt uns seine atemberaubende Geschichte.
In vielen Szenen beschreibt er die Jagd nach dem Edelmetall und verfolgt die Spur des Silbers rund um die Welt: Von der Ausbeutung der Silberminen durch die Spanier, den Silberflotten und der Sklaverei, vom globalen Handel, der neben grenzenlosem Profit auch Elend und Hunger mit sich brachte, über das NS-Raubsilber bis zum Familiensilber unserer Zeit. Es sind Geschichten von Königen und Sklaven, von Konquistadoren, Piraten und Kaufleuten. Ohne die faszinierende Geschichte des Silbers ist die Welt von heute nicht zu verstehen.
Mit zahlreichen Abbildungen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 355
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Es ist weich und wandelbar, ein sagenhaftes Element, über Jahrhunderte brachte es Macht und Reichtum, aber auch Ausbeutung und Elend: Silber hat die Welt verändert. Und es bewegt unsere Welt bis heute, als Rohstoff und als Wertanlage. Tillmann Bendikowski erzählt uns seine atemberaubende Geschichte. In vielen Szenen beschreibt er die Jagd nach dem Edelmetall und verfolgt die Spur des Silbers rund um die Welt: Von der Ausbeutung der Silberminen durch die Spanier, den Silberflotten und der Sklaverei, vom globalen Handel, der neben grenzenlosem Profit auch Elend und Hunger mit sich brachte, über das NS-Raubsilber bis zum Familiensilber unserer Zeit. Es sind Geschichten von Königen und Sklaven, von Konquistadoren, Piraten und Kaufleuten. Ohne die faszinierende Geschichte des Silbers ist die Welt von heute nicht zu verstehen.
Autor
Dr. Tillmann Bendikowski, geb. 1965, ist Journalist und promovierter Historiker. Als Gründer und Leiter der Medienagentur Geschichte in Hamburg schreibt er Beiträge für Printmedien und Hörfunk und betreut die wissenschaftliche Realisierung von Forschungsprojekten und historischen Ausstellungen. Seit 2020 ist er als Kommentator im NDR-Fernsehen zu sehen, wo er in der Reihe »DAS! historisch« Geschichte zum Sprechen bringt, und zudem regelmäßiger Gesprächspartner bei Spiegel TV. Bei C.Bertelsmann erschienen Ein Jahr im Mittelalter (2019), 1870/71: Der Mythos von der deutschen Einheit (2020), der Bestseller Hitlerwetter. Das ganz normale Leben in der Diktatur: Die Deutschen und das Dritte Reich 1938/39 (2022) und zuletzt Himmel Hilf. Warum wir Halt in übernatürlichen Kräften suchen: Aberglaube und magisches Denken vom Mittelalter bis heute (2023).
TILLMANN BENDIKOWSKI
DIE SPUR DES SILBERS
Wie die Jagd nach dem Edelmetall unsere Welt verändert hat
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
© 2025 by C. Bertelsmann Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich
Pflichtinformationen nach GPSR.)
Lektorat: Eckard Schuster, München
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, München
Umschlagabbildung: © wikimedia commons, Cornelis Verbeeck, »Naval Encounter between Dutch and Spanish Warships«, 1618/1620, public domain
Vorsatz vorne: Karte von Peter Palm, Berlin Vorsatz hinten: Karte von Theodor de Bry aus Das vierdte Buch von der neuwen Welt
Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-31804-8V001
www.cbertelsmann.de
Inhalt
Einleitung: Was der Silberlöffel erzählt
Das Mittelalter und der Traum vom Reichtum
Die Europäer in Amerika: Der Raubzug beginnt
Potosí – die Silberstadt in den Anden
Händler, Seeleute, Piraten: Das Silber geht um die Welt
Der Fluch des Silbers
Münzen, Schmuck und alltägliche Dinge – das Silber des Volkes
Silber wird gestohlen – neue Raubzüge
Unser Silber – die Geschichte geht weiter
Literatur
Anmerkungen
Register
Bildteil
Gold und Silber lieb’ ich sehr. Kann’s auch gut gebrauchen.
Aus einem deutschen Studentenlied des 19. Jahrhunderts[1]
Einleitung: Was der Silberlöffel erzählt
Wer zu Hause in seine Besteckschublade greift und einen alten Silberlöffel herausholt, hält unversehens ein Stück Menschheitsgeschichte in den Händen. Gut, mit so einem Löffel lässt sich wunderbar eine Tasse Tee oder Kaffee umrühren. Aber nehmen wir einmal an – ein kleines Gedankenexperiment –, dieser Gebrauchsgegenstand und mit ihm das Silber könnten aus ihrem Leben erzählen. Wir müssen ihn also nur an unser Ohr halten und aufmerksam zuhören. Aber Vorsicht, es könnte laut werden: Zur Geschichte des Silbers gehört nämlich nicht nur das zufriedene Lachen erfolgreicher Händler und mächtiger Könige im Mittelalter, sondern auch das aufgeregte Geschwätz der Seefahrer und Entdecker, die am Beginn der Neuzeit gen Westen in See stechen, um in fremden Welten möglichst fette Beute zu machen. Hinzu kommt das Geschrei spanischer Konquistadoren, die auf der anderen Seite des Atlantiks rücksichtlos einen neuen Kontinent ausbeuten, ebenso das Wehklagen geschundener amerikanischer Indigener und auch afrikanischer Sklaven, das Gebrüll gieriger Piraten, sodann schließlich die laute Freude reicher Kaufleute, dreister Schmuggler und rücksichtsloser Diebe.
All diese Menschen waren an der atemberaubenden Geschichte des Silbers beteiligt, die nach der ersten Amerikafahrt von Christoph Kolumbus im Jahr 1492 eine entscheidende Wende erfuhr. Denn schon bald darauf veränderte das Silber, über das die Menschen in Europa zuvor nur in bescheidenem Maße verfügt hatten, die gesamte Welt. Es wurde in riesigen Mengen auf dem amerikanischen Kontinent gefördert und schon im 16. Jahrhundert vor allem von den Spaniern nach Europa und Asien gebracht. Zahllose Kisten voller Barren und Münzen setzten Menschen und zugleich die unterschiedlichsten Handelswaren aus aller Herren Länder in Bewegung – eine Bewegung, die letztlich bis heute nicht zum Stillstand gekommen ist, denn es etablierte sich schon vor sechs Jahrhunderten ein weltweiter Handel. Das Silber steht damit maßgeblich am Anfang der Globalisierung, wie wir sie gegenwärtig kennen.
Dieses Edelmetall war eben nie ein Metall wie andere auch. Der Silbererzabbau und die Weiterverarbeitung zu Silber waren Schwerstarbeit, oft unter Bedingungen, die für die Menschen kaum zu ertragen waren und sie zuweilen das Leben kosteten. Aber es weckte die Gier der Menschen wie sonst nur das Gold, das es aber in viel kleineren Mengen gab und für die allermeisten Menschen somit unerschwinglich blieb. Mit dem Silber verband sich bereits im Mittelalter der Traum vom Reichtum und von einem guten Leben, und die Gier nach diesem Edelmetall war schon zu dieser Zeit enorm. Das Gold war damals tendenziell eine Ware, ein Luxusgut – das Silber hingegen war und blieb lange das eigentliche Geld, das Zahlungsmittel für die Welt.
Und so bestand aus diesem Edelmetall im 16. Jahrhundert die erste weltweit anerkannte Währung – der spanischePeso –, und es war das Silber, das den Handel zwischen Asien, Amerika und Europa ermöglichte, Handelswege schuf, deren Routen auch in der heutigen Weltwirtschaft noch zu erkennen sind, aber auch für die erste weltweite Inflation sorgte, die bis ins 19. Jahrhundert zu spüren war. Zugleich veränderte das Silber das Preis- und Lohngefüge auf der Welt: Wenn in der frühen Neuzeit Arbeiterinnen und Arbeiter aus den östlichen Regionen Europas gen Westen zogen, weil dort die Löhne höher waren, so zeugt dies nicht nur von der langen Tradition von Arbeitsmigration in Europa. Es war auch die Folge eines riesigen Silberstroms, der sich über den Globus ergoss. Und ganz nebenbei: Es wurde auch erst durch Silber möglich, dass England zu einer Nation der Teetrinker wurde.
Es ist diese Geschichte, die im Prinzip in jedem Löffel aus Silber steckt: Denn das Edelmetall, einmal gewonnen, verschwand nicht mehr von dieser Welt. Es konnte zwar gestohlen, eingeschmolzen oder in anderer Form wieder auf den Markt gebracht werden, als neue Münze eines anderen Landes, als kunstvoller Schmuck oder mächtiger Prunkpokal, als schönes Besteck oder dekorativer Serviettenring. Aber es war immer noch da. Auch wenn in Not- und Kriegszeiten Silberschätze versteckt und vergraben wurden, so tauchten viele von ihnen wieder auf, wenngleich zuweilen erst nach Jahrhunderten. Woher stammt das dann gefundene oder weitergegebene Silber dann im Einzelfall? Womöglich wurde es einst im Mittelalter in einem Silberstollen im Harz oder im 16. Jahrhundert in spanischen Bergwerken in den heutigen Ländern Mexiko oder Peru gewonnen. Vielleicht hatte es später auch in den Silberbeständen gesteckt, die die Nationalsozialisten 1938 den jüdischen Deutschen raubten, oder es stammte aus einem der Gutshäuser, die in der frühen DDR im Zuge der Zwangskollektivierung geplündert wurden. Auch wenn sich die Herkunft im Einzelfall womöglich nicht zuverlässig zurückverfolgen lässt, so bleibt die historische Spur des Silbers letztlich doch erkennbar. Sie zeugt von der Jagd der Menschen nach Reichtum, die zugleich – und dies bis heute – andere Menschen in die Armut treibt. Damit ist die Geschichte des Silbers auch eine Geschichte des Unrechts und der Ungerechtigkeit.
Vom rein ökonomischen Nutzen abgesehen, diente das Silber den Menschen seit Jahrhunderten auch zu ästhetischen Zwecken, denn es ist bekanntermaßen zunächst einmal schön anzuschauen. Es ist von allen Metallen dasjenige, das am meisten glänzt (auch wenn es dafür zuweilen aufwendig geputzt werden muss). Das Silberschmiedehandwerk schuf daraus große und kleine kunsthandwerkliche Wunder – ganze Altäre aus Silber schmückten manche Kirche und ließen die Menschen über diese Pracht und zugleich den damit verbundenen Reichtum staunen. Und noch immer ist Silber Ausgangsmaterial für Schmuck, für Ringe und Ketten, aber auch für Amulette oder Kunstgegenstände, für Becher und Pokale. Darüber hinaus wird Silber heute auch in der Medizin eingesetzt und ist zugleich für viele industrielle Produkte unersetzlich, etwa in vielen Bereichen der Elektrotechnik – schließlich besitzt es unter allen Metallen die höchste Leitfähigkeit für Wärme und Elektrizität.
Die Menschen scheinen weiterhin nicht ohne das Silber auszukommen, es ist aus unserem Alltag nicht wegzudenken. Längst dient es auch wieder als private Geldanlage. Allerdings mehren sich die Warnungen, dass das Edelmetall schon in naher Zukunft knapp werden könnte: Zu verschwenderisch wurde lange damit umgegangen, in der Summe landete viel zu viel davon auf dem Müll und kann nicht mehr zurückgewonnen werden, während die Vorkommen auf der Welt womöglich bald erschöpft sind. Wird in Zukunft das Silber also knapp? Kann es weiterhin Garant für Handel und Reichtum sein? Eines ist sicher: Die Geschichte des Silbers ist noch nicht zu Ende …
Als niemand mehr daheim war, ging Aschenputtel zu seiner Mutter Grab unter dem Haselbaum und rief: »Bäumchen, rüttel dich und schüttel dich, wirf Gold und Silber über mich.« Da warf ihm der Vogel ein golden und silbern Kleid herunter, und mit Seide und Silber ausgestickte Pantoffeln. Da zog es das Kleid an, und ging zur Hochzeit.
Aus dem Märchen »Aschenputtel«[2]
Das Mittelalter und der Traum vom Reichtum
Mit Silber ließ sich im Mittelalter im Grunde alles kaufen. Essen und Trinken im Überfluss, vielleicht ein großes Fass mit gutem Wein oder sogar exotische Gewürze aus dem fernen Morgenland. Wer reich genug war, konnte damit Häuser, Burgen und Schlösser bauen lassen, Soldaten und Söldner anheuern, Kriege führen, aber auch Reliquien kaufen, Prostituierte bezahlen, Adelige und Kleriker bestechen – oder im ungünstigsten Fall auch alle seine Münzen beim Glücksspiel verlieren. Sogar die Wahl zum König hatte letztlich ihren Preis. Wer also Silber hatte, konnte sich ein gutes Leben leisten. Doch das waren die wenigsten, allen anderen blieb letztlich nur der Traum vom Reichtum.
Die allermeisten Menschen kannten das Edelmetall nämlich nur vom Hörensagen. Silber war im Mittelalter zwar ein fester Bestandteil der vielen Geschichten von sagenhaftem Reichtum fremder Herrscher oder von Prinzessinnen und Rittern – aber echtes Silber hatte bis ins Spätmittelalter hinein nur eine Minderheit der Bevölkerung wirklich in der Hand gehabt. Höchstens hatten die Untertanen in der feudalen Gesellschaft jener Zeit es schon einmal aufblitzen sehen: bei einem festlichen Umzug eines Grafen vielleicht, dem sie womöglich als Leibeigene zu Dienst verpflichtet waren. Oder eben auch bei einem sonntäglichen Gottesdienst, in dem der Priester beim Abendmahl einen silbernen Kelch in die Höhe reckte, in welchem sich nach christlicher Erzählung das große Wunder von der Wandlung des Weins in das Blut Christi vollzog. Was der Mann der Kirche da in den Händen hielt, war nicht weniger als ein Kelch voller Wunder. Und dieser war schon in frühen Zeiten mindestens aus kostbarem Silber gefertigt, manchmal war er sogar noch zusätzlich vergoldet. Was für ein Anblick!
Aber es blieb eben zumeist nur beim Anschauen und Staunen: Das glänzende Edelmetall gehörte den Reichen, den Adeligen, den Klerikern. Wenn es im Alltag darum ging, dringend benötigte Waren wie vor allem Lebensmittel zu erwerben, blieb über lange Zeit der Tauschhandel das Mittel der Wahl. Nur wenn der nicht mehr funktionierte, weil die Waren über weite Strecken transportiert werden mussten, also erst in der nächsten Stadt oder gar in anderen Ländern wieder verkauft wurden, war der Griff zur Münze notwendig. Doch auch dann hielten die meisten Menschen im Mittelalter überwiegend Kupfer- oder Blechmünzen in den Händen. Denn der Wert einer durchschnittlichen Silbermünze überstieg mühelos den Preis für ein Brot oder ein paar eingesalzene Heringe auf dem Markt des nächsten Nachbarstädtchens. So ein wertvolles Geldstück kam deshalb nur bei bedeutenden Geschäften zum Einsatz.
Schon eine einzelne Silbermünze, abhängig von ihrer Größe und ihrem Gewicht, konnte einen Unterschied machen zwischen hungrig und satt sein, ein einziges dieser Geldstücke also womöglich eine Familie vor dem Verhungern retten. Mehrere, gar Dutzende Silbermünzen veränderten dann schon das komplette Leben. Das war im Mittelalter keine neue Erfahrung, denn schon in der Antike wurde Silber gefördert und verarbeitet, die Griechen, Römer und Ägypter schätzten es ebenso wie die Stämme Germaniens. Und wie schon im Altertum blieb das Silber neben dem Gold auch in der mittelalterlichen Welt das begehrteste Metall. Gold war und blieb allerdings immer ein Schatz, eine Ware, kein Gegenstand des alltäglichen Handelns. Gekauft und bezahlt wurde in Silber in Form von Münzen oder Barren.
So war und blieb das Silber beim Geld und beim Zahlungsverkehr schlicht das Maß der Dinge. Das galt auch für die große Politik. Die politische und klerikale Führungsschicht des Mittelalters setzte das Edelmetall wie selbstverständlich für den Erhalt und den Ausbau der eigenen Macht ein, es war das Schmiermittel ihres politischen Handelns schlechthin. Es herrschte kein Graf, kein Herzog, kein Erzbischof und erst recht kein König und Kaiser, der nicht Zugriff auf mehr oder weniger üppige Silberreserven hatte. Brauchte es zwischen den kleinen und großen Fürsten einen Gefallen oder gar politische und militärische Unterstützung, dann half die nötige Menge Silber nach. So ließ sich beispielsweise der Erzbischof von Köln im 13. Jahrhundert seine Unterstützung der Engländer einst mit viel Silber bezahlen, und einen erheblichen Teil davon ließ er umgehend weiter nach Rom transportieren, um damit wiederum seine eigene Stellung beim Papst zu stärken.[3] Und auch der bayerische Herzog nahm im 13. Jahrhundert gerne das Silber des Königs von Böhmen entgegen, der in seinem Herrschaftsgebiet reich mit diesem Edelmetalle gesegnet war – und sicherte ihm im Gegenzug zu, bei einem möglichen Krieg sich ihm gegenüber neutral zu verhalten. Wie viel im Einzelfall bei dieser Pflege der politischen Beziehungen tatsächlich gezahlt wurde, lässt sich rückblickend nicht immer klären, aber die erwähnte Zahlung des böhmischen Königs war vor acht Jahrhunderten so umfangreich, dass ein Zeuge des Geschehens, ein Chronist aus dem bayerischen Kloster Fürstenfeld, beeindruckt notierte:[4] »Ich selbst habe gesehen, wie der König auf einem Wagen ein mit Silber angefülltes Faß … nach Straubing sandte, und wenn ich diese riesige Summe nicht selbst gesehen hätte und ein anderer hätte mir davon erzählt, so würde ich demselben ohne Zweifel nicht geglaubt haben.«
Selbst bei deutschen Königswahlen, bei denen sich die Kandidaten stets die Gunst der mächtigen Kurfürsten sichern mussten, floss offensichtlich zuweilen reichlich Silber. Zwar wissen wir heute nicht mehr genau, in wie vielen Fällen das tatsächlich geschah, aber ganz sicher war es der Fall bei der Doppelwahl des Jahres 1198, bei der sich die Herrscherhäuser der Staufer und der Welfen um die Macht im Reich stritten. Philipp von Schwaben wurde damals nur durch den Einsatz riesiger Bestechungsgelder zum König erkoren, die wiederum Kölner Kaufleute und Geldmakler aus England in das Stauferreich vermittelt hatten.[5]
Auch die Päpste, die ja ebenfalls massiv am großen Spiel der Politik beteiligt waren, bauten zielstrebig ihre Silbervorräte aus und setzten sie für ihre Zwecke ein. So ließ sich im 14. Jahrhundert der in Avignon residierende Papst Johannes XXII. (wohl 1245 – 1334) die ihm zustehenden Beiträge der Kirchen aus den verschiedenen Teilen Europas selbstverständlich in Silber liefern – in diesem Fall in Form von Barren, weil diese leichter zu transportieren waren. Insgesamt, so wurde nach seinem Tod errechnet, erhielt der Kirchenfürst während seines Pontifikats so über eine Tonne des wertvollen Metalls.[6] Das war auch für einen Kirchenfürsten des Mittelalters eine überdurchschnittliche Summe, aber dieser Papst galt ja schließlich auch als einer der reichsten Herrscher des Kontinents.
Die Kirche benötigte das Silber aber nicht nur für die Absicherung von bischöflicher und erst recht päpstlicher Macht, sondern auch für den Aufbau der kirchlichen Infrastruktur. Denn die Errichtung von Kirchen wie auch deren Ausstattung waren kostspielig. Und so galt es stets als gottgefälliges Werk, der Kirche für diese Zwecke Geld zu spenden. Eine solche Zuwendung konnte Teil einer Buße sein und diente – so die Hoffnung der gläubigen Christen – als Mittel zur Rettung des eigenen Seelenheils. Ein Chronist des 12. Jahrhunderts berichtete von einem Mann, der seinem im Sterben liegenden Freund von der Gastfreundschaft der Benediktiner im Kloster Maria Laach berichtet – worauf dieser den Mönchen seine Hinterlassenschaft von vierzig Silbermark »zum Heil meiner Seele« vermachte.[7]
Was nun aus Sicht eines guten Christenmenschen moralisch oder unmoralisch erschien, wenn es um Geld ging, auch darüber entschied die Kirche. Sie sorgte dafür, dass am Silber einerseits ein historischer Makel haftete. Schließlich waren es einst dreißig Silberlinge, für die nach christlicher Überlieferung Judas Iskariot den Verrat an Jesus begangen haben soll – der »Judaslohn« bestand also aus Silbermünzen. Andererseits wies die Kirche den Weg zu einer gottgefälligen Verwendung von Geld. Dazu zählte beispielsweise der Erwerb kostbarer Reliquien. In diesem Sinn berichtete im 13. Jahrhundert der Chronist Caesarius von Heisterbach von einem Kaufmann, der ins Heilige Land gereist war und dort eine Armreliquie von Johannes dem Täufer entdeckt hatte. Der Geliebten des Besitzers machte er deshalb ein Angebot, das sie angeblich nicht ablehnen konnte:[8] »Wenn Du dafür sorgst, daß ich in den Besitz der Reliquie von Johannes dem Täufer komme, die Dein Liebhaber bewacht, werde ich Dir 140 Pfund Silber geben.«
Silber war wertvoll, weil es eine begrenzte Ressource war. Es kam zwar in der Natur vor, musste aber in den allermeisten Fällen aufwendig gewonnen werden. Und es war im Mittelalter nicht erlaubt, einfach selbst nach Silber zu graben. Könige und Kaiser reklamierten aufgrund des sogenannten Bergregals das alleinige Verfügungsrecht über alle Bodenschätze für sich. Wenn sie einem anderen Landesherrn in ihrem Reich den Abbau von Bodenschätzen erlaubten und also auf ihr Recht für bestimmte Orte oder Regionen verzichteten, ließen sie sich dieses Privileg selbstverständlich gut bezahlen. Kaiser Friedrich I. (um 1122 – 1190) forderte beispielsweise für die Verpachtung von Silbergruben an den Bischof von Brixen immerhin die Hälfte des Ertrags.[9] In den folgenden Jahrhunderten wurde das kaiserliche Bergregal weitgehend auf die Landesherren übertragen. Die wurden dadurch reich – wenn sie denn auf dem richtigen Grund und Boden saßen …
Das traf auf jeden Fall auch auf den Markgrafen Otto von Meißen (1125 – 1190) zu. In seinem Herrschaftsbereich im sächsischen Freiberg lagen einige der ertragreichsten Silberminen des Hochmittelalters. Diese trugen dem Landesherrn so viel ein, dass er später den Beinamen »der Reiche« erhielt: Sein Vermögen wurde im Jahr 1189 auf mehr als 30 000 Silbermark geschätzt, zumeist in Form von Silberbarren. Daraus ließ er große Mengen von Silberpfennigen schlagen, es könnten während seiner Regentschaft bis zu zehn Millionen solcher Münzen entstanden sein. Dieser Pfennig war in diesem Teil Deutschlands die am weitesten verbreitete Münze.[10] Und was machte der reiche Otto mit dem ganzen Edelmetall? Zunächst erwarb er zahlreiche Ländereien, finanzierte den Bau von Wehrmauern etwa in Leipzig, Eisenberg, Weißenfels oder Freiberg, und weil dann immer noch genug Geld da war, vermachte er noch 3000 Silbermark dem Kloster Zella – für das Seelenheil des edlen Spenders. Nach seinem Tod, so der Markgraf, sollte das Geld den umliegenden Kirchen zugutekommen. So viel Grundbesitz wie möglich anzuhäufen, ausreichende Sicherheit vor Feinden sowie rechtzeitige Vorsorge für das eigene Seelenheil – dafür verwendeten die weitsichtigen Mächtigen zu dieser Zeit ihr Silber.[11]
Das Beispiel des reichen Otto zeigt, dass es zuweilen eben auch pures Glück war, ob ein kleiner Fürst nun zu einem finanzkräftigen Herrscher aufstieg oder ein mehr oder weniger unbedeutender Adeliger blieb. Führten die Markgrafen von Meißen in Deutschland aufgrund der Silbervorkommen von Freiberg ein luxuriöses Leben, so war dies in Italien den Bischöfen von Volterra möglich, weil sie über die Silberminen von Montieri in der Toskana verfügten.[12] Und auch die böhmischen Herrscher zählten zu den wohlhabendsten Herrschern im Reich, weil sich auf ihrem Territorium ergiebige Silberminen befanden.[13]
Die Gewinnung von Silber selbst war allerdings aufwendig. Denn in den wenigsten Fällen fand es sich in reiner, also gediegener Form, sondern zumeist als Erz vermengt mit anderen Metallen, vor allem mit sogenannten taubem und also wertlosem Gestein. Die Silbererze mussten also zunächst mühselig aus dem Felsen herausgeschlagen und, da Silberbergbau fast immer unter Tage betrieben wurde, aus den Stollen herausgeschafft und anschließend auch noch verhüttet werden. Erst bei diesen Schmelzprozessen wurde dann das Edelmetall, aber auch Kupfer und Blei gewonnen, zuweilen auch das seltene Gold. Vermutlich schon im 8. Jahrhundert betrieben die Menschen im Elsass Silberbergbau, zu Beginn des 10. Jahrhunderts auch im Erzgebirge und im Harz,[14] fast gleichzeitig zudem in den Vogesen und ab 1028 im südlichen Schwarzwald. Im 12. Jahrhunderts wurden weitere Vorkommen entdeckt, außer im sächsischen Freiberg auch in Kärnten, in der Toskana und auf Sardinien.
Der Bergbau war eine technische Herausforderung, und früh waren es deutsche Bergleute, die aufgrund ihrer besonderen Expertise in ganz Europa bekannt und gefragt waren. Weil sie für die Grund- und Landesherren von so großem Nutzen waren, erfreuten sie sich schon bald außerordentlicher rechtlicher Freizügigkeit und waren aus diesem Grund ausgesprochen mobil. So zogen fränkische Bergleute schon im 10. Jahrhundert in den Harz, später wanderten sie weiter ins Erzgebirge, nach Böhmen, Ungarn und auch in die Toskana.[15] Deutsche Bergmannskunst war im Mittelalter auf dem ganzen Kontinent gefragt: Das englische Bergwerk von Carlisle wurde von 1166 bis 1178 von Deutschen geleitet, und auf Sardinien arbeiteten im Jahr 1160 nachweislich achtzehn deutsche Bergleute.[16]
Wo immer Silber gefunden wurde, gab es die Aussicht auf Reichtum und damit auf ein sorgenfreies Leben. Kein Wunder also, dass sich die Nachrichten von einem angeblichen oder tatsächlichen Silberfund rasch verbreiteten und die Menschen umgehend Jagd auf das Edelmetall machten. Zuweilen erinnerte die Atmosphäre an den Orten des mittelalterlichen Silberabbaus spätere Betrachter an den Goldrausch, wie er Jahrhunderte später beispielsweise in Kalifornien zu beobachten sein sollte. Im erwähnten sächsischen Freiberg etwa griff im Mittelalter eine solche Euphorie um sich, als nahe der Oberfläche reines, also gediegenes Silber gefunden wurde. Solche Funde waren sehr selten, sprachen sich in Windeseile herum und lockten umgehend die ersten Schatzgräber an. In Freiberg – an anderen Orten dürfte es ähnlich gewesen sein – taten diese sich allerdings durch ein recht planloses, überhastetes Graben hervor und verwandelten die Oberfläche nahe der ersten Silberfunde durch das Auftürmen von wertlosem Gestein in eine regelrechte Trümmerlandschaft.[17] Viele Männer setzten auf denkbar primitive Grabungstechniken, wenn sie »mit wenig mehr als Spaten und Hacke bewaffnet in primitive Löcher oder Stollen im Berg einstiegen«. Oft reichte ein neues Gerücht aus, um neue spekulative Grabungen auszulösen, und allzu großer Leichtsinn führte dabei regelmäßig dazu, dass solche Orte ein Zuschussgeschäft wurden – viele Gruben hatten letztlich höhere Kosten als Erträge.[18]
Auch das böhmische Joachimsthal erlebte so einen rasanten Aufstieg, als dort Anfang des 16. Jahrhunderts Silber gefunden wurde: Umgehend strömten die Menschen herbei, doch waren die Vorkommen erschöpft oder zu aufwendig zu fördern, verschwanden sie auch schnell wieder. Ein Autor beschrieb Ende des 19. Jahrhunderts die Entwicklung vor Ort:[19]
In gleicher Weise lockte der Ruf des Silberreichtums des Erzgebirges Abenteurer aus allen Ländern und aus allen Ständen an. Städte entstanden in unwirthbaren Gegenden in erstaunlich kurzer Zeit, um oft ebenso rasch wieder zur Unbedeutendheit herabzusinken, wenn der Bergsegen erschöpft war. Dies war bei dem sächsischen Silberbergbau im zweiten Jahrzehnt des sechzehnten Jahrhunderts bereits eingetreten. Die reichen Erzmittel waren abgebaut, die Ausbeute ließ nach, die fahrenden Bergleute sahen sich nach lohnenderer Arbeit um.
In Joachimsthal arbeiteten und wohnten nur drei Jahre nach der Besiedlung eines Tales so viele Menschen, dass die Siedlung das Stadtrecht erhielt und zum Zentrum des Silberabbaus im Erzgebirge aufstieg. Das Silber und die Aussicht auf schnellen Reichtum prägten die Menschen an solchen Orten, hieß es weiter:[20]
Es war eine eigentümlich gemischte Gesellschaft, die sich in der neuen Stadt zusammengefunden hatte. Viele unruhige Köpfe waren darunter, … aber auch viele tüchtige, nach Besserem ringende Kräfte, das bezeugen die vielen gemeinnützigen Stiftungen aus eigener Kraft und eigenen Mitteln und die gute städtische Verwaltung.
Für alle diese Menschen war Silber der Stoff, aus dem die Träume waren. Und diese hielten auch Einzug in die Welt der Sagen und Volksmärchen. Manch ein armer Bergmann mochte nachts von einem Engel geträumt haben, der ihm den Weg zu einem Silberschatz und damit zu einem unbeschwerten Leben zeigte. Genau das soll auch einem Mann geschehen sein, der so eines Nachts den entscheidenden Tipp für die Entdeckung der Silberminen von Annaberg im Erzgebirge erhalten haben soll. Denn dort, so verbreitete sich die Legende, lebte ein wackerer Bergmann namens Daniel Knappe, der zwar fleißig und unentwegt arbeitete, aber seine Familie dennoch nicht ernähren konnte. Weil er aber ein gottesfürchtiger Mann war, soll ihm in seiner Not der Engel des Herrn erschienen sein, der ihm mit diesen Worten den Weg zum Glück gewiesen habe:[21] »Geh’ hin und suche in der tiefsten Tiefe des Waldes den Baum auf, in dessen Zweigen silberne Eier ruhen.«
Am nächsten Morgen machte sich der wackere Knappe demnach auf den Weg, und auch wenn er an dem Baum keine silbernen Eier fand, so entdeckte er unter den Wurzeln gleichwohl »reiche Silberstufen in Menge«, die ihn letztlich reich machten.[22] Die Geschichte wurde zur Gründungslegende der Stadt Annaberg, und ähnliche Geschichten sind auch für viele andere Silberfundorte überliefert. Offensichtlich war es bei den vielen Glücksrittern beliebt, auf ähnliche spontane Funde oder eben himmlische Eingebungen zu hoffen. Aber auch magische Praktiken schienen manchen den Weg zu weisen: Auf der Suche nach Silbererzvorkommen nutzten offensichtlich Bergleute mit Vorliebe auch Wünschelruten aus dem Holz von Haselnuss.[23] Doch Zufallsfunde, selbst mithilfe solcher Praktiken, blieben in aller Regel aus. Wenn jemand auf Silber stieß, war dies zumeist vielmehr das Ergebnis von ausgiebiger Prospektion, von langer Suche und aufwendigen Schürfarbeiten, und erst diese schufen dann den Zugang zu ergiebigen Lagerstätten.
Der Abbau von silberhaltigem Gestein selbst war harte körperliche Arbeit und verlangte zugleich professionelle Bergwerksarbeit. Zunächst mussten die Stollen vorangetrieben und gesichert werden, im besten Fall wurde für ausreichende Zufuhr mit frischer Luft gesorgt. Und da der Silberbergbau bereits im Mittelalter in immer noch größere Tiefen vorangetrieben wurde, wuchsen die technischen Herausforderungen und die Nachfrage nach neuen Innovationen und Spezialisten. Im 13. Jahrhundert schufteten die Bergleute etwa in Goslar bereits bis zu 160 Meter unter Tage und damit bereits im Bereich des Grundwassers, was eine ständige Gefahr bedeutete.[24] Es zeigte sich, wie sehr das Wasser gleichermaßen der Freund wie der Feind des Bergmannes war. Der Kampf gegen eindringendes Wasser war an der Tagesordnung, Wasserknechte wurden zum Abschöpfen eingestellt, zuweilen auch Grubenpferde. Außerhalb der Gruben war Wasser als Energielieferant hingegen dringend nötig. Erste Staudämme entstanden, mit Wasserkraft wurden beispielsweise die Gebläse für die Öfen betrieben, in denen das Silbererz geschmolzen wurde, sowie Pumpen zur Entwässerung der Stollen.
Die Menschen bezahlten im Mittelalter einen hohen Preis, um an das Silber zu gelangen. Chronisten berichten, dass zuweilen Grubenwände einbrachen und Menschen »von den Erd- und Steinmassen« verschüttet wurden.[25] Selbst Frauen und Kinder mussten bei dieser Arbeit mithelfen, Letztere wurden etwa eingesetzt, um die Karren mit dem losgeschlagenen Gestein unter Tage durch die niedrigen Stollen zu schieben.[26] Georg Agricola (1494 – 1555), der als Stadtarzt in Sankt Joachimsthal gewirkt hatte und später als Mineraloge wichtige Grundlagen für die Bergbaukunde legte, berichtete in seiner einschlägigen Darstellung über das Berg- und Hüttenwesen aus dem Jahr 1557 von den Unglücksfällen, die den Bergleuten drohten. Diese Unfälle schädigten »die Glieder, andere befallen die Lungen, andere die Augen, einige endlich töten die Menschen«. Es gab Schächte, in denen die Bergleute permanent in kaltem Wasser standen und arbeiteten, in besonders trockenen Schächten hingegen setzte ihnen der Staub zu, sodass sie von Atembeschwerden und Lungenerkrankungen geplagt wurden. Die schlechten Arbeitsbedingungen, so Agricola, führten überall dort, wo Bergbau betrieben wurde, zu hoher Sterblichkeit:[27]
Auf den Gruben der Karpathen findet man Frauen, die sieben Männer gehabt haben, welche alle jene unheilvolle Schwindsucht dahingerafft hat. In Altenberg im Meißnischen findet sich schwarzer Hüttenrauch in den Gruben, der Wunden und Geschwüre bis auf die Knochen ausnagt … Auch gibt es eine Art von Cadmia, welche die Füße der Arbeiter, wenn sie vom Wasser naß werden, und auch die Hände zerfrißt, ebenso beschädigt sie die Lungen und Augen.
Unfälle bei der Arbeit, so Agricola, kamen hinzu: Arbeiter stürzten von Leitern und brachen sich »Arme, Beine und das Genick«, zuweilen wurden sie von Gestein erschlagen oder wurden verschüttet, wenn ganze Gruben einstürzten:[28]
Als einstmals der Rammelsberg bei Goslar zusammenbrach, sollen nach der Chronik in den Trümmern so viel Menschen umgekommen sein, daß an einem Tage etwa vierhundert Frauen ihrer Männer beraubt wurden. Auch brach zu Altenberg vor elf Jahren ein abgebauter Teil des unterhöhlten Berges zusammen und erdrückte unvermutet sechs Arbeiter, auch zog er ein Haus in die Tiefe und zusammen mit der Mutter ein Söhnlein.
Die Jagd nach dem Silber brachte die Menschen immer wieder in Gefahr. Weil die Landesherren stets auf rasche Ausbeutung der Vorkommen drängten, ging der Abbau zuweilen auf Kosten der Sicherheit. Die Gefahren dieser Gier waren bekannt, weshalb sich früh entsprechende Warnungen fanden, etwa in einer Sammlung bergbaukundlicher Texte aus der Mitte des 16. Jahrhunderts:[29]
Wenn ein Herr und Landesfürst ein Bergwerk weiter belasten will, darf er nicht darauf sehen, ob zehn oder zwanzig reich sind und das ertragen können. Er sollte vielmehr erwägen, daß die Belastung von Stund an das gemeine Bergwerk und alle trifft, die es angeht und die es bauen. Dabei werden Tagelöhner und Spinnerinnen nicht verschont, weil auf zehn Reiche hundert Arme kommen … Kein Betrieb verfällt oder vergeht schneller als Bergwerke.
Aber die Silberquellen sprudelten, und das Reich der deutschen Könige stieg bis zum Ende des Mittelalters zum wichtigsten Bergbauland Europas auf, und dies galt eben auch für die Gewinnung von Silber. Im 13. Jahrhundert existierten in Deutschland die damals produktivsten Minen der Epoche,[30] um 1500 stammten vermutlich drei Viertel des in Europa gewonnenen Silbers aus dem römisch-deutschen Reich.[31]
Der Abbau wurde immer intensiver betrieben, und damit stiegen auch die Kosten. Wer sich die Silbergewinnung in größerem Stil nicht leisten konnte, sicherte sich die Unterstützung von Geld- und Kreditgebern. Sehr erfolgreich boten sich dafür seit dem 15. Jahrhundert Augsburger Kaufleute und Handelsfirmen an, allen voran die Fugger und Welser. Sie versorgten die Fürsten und Könige mit Geld und Krediten, sicherten sich im Gegenzug aber eigene Rechte an dem herrschaftlichen Bergregal. Das war eine denkbar gewinnbringende Investition, denn so erhielten diese Handelshäuser das in den eigenen Bergwerken geförderte Silber zu einem deutlich unter dem Marktwert liegenden Preis. Wenn sie mit diesem billigen Geld dann Waren kauften und anschließend wieder verkauften, war ihre Gewinnspanne denkbar groß. Das galt vor allem für den Handel mit asiatischen Waren, weil im indischen und asiatischen Handelsraum das Silber wegen der großen Nachfrage ohnehin schon etwa doppelt so viel wert war wie in Europa – hier waren für die Geldgeber Gewinne von zuweilen über hundert Prozent möglich.[32] So wurde das Silber am Ende des Mittelalters endgültig zu einem großen Geschäft, und nicht zufällig pachteten Kaufleute der Hanse zuweilen gleich selbst Silberminen, um an dem Edelmetall besser verdienen zu können.[33]
Es zeigt sich zugleich, wie sehr das Silber dabei stets in Bewegung war. Einmal gefunden und verhüttet, sorgte es zwar zunächst in der jeweiligen Region für einen wirtschaftlichen Aufschwung. So kam etwa in Sachsen anfangs viel Silber auf den freien Markt und belebte zunächst die regionale Wirtschaft. Doch schon auf mittlere Sicht floss das Silber in Form von Münzen auch wieder aus den Förderregionen ab, wenn es nicht ohnehin schon zuvor unmittelbar in die Hände der großen Handelshäuser geriet, die es beispielsweise für ihren Fernhandel verwendeten.[34] Doch vor allem kurbelte das neu gefundene Silber die Produktion der Silbermünzen an. Und so gab es schlicht mehr Geld auf den Märkten der kleinen und großen Städte und für den Fernhandel, viele neue Münzstätten lieferten die notwendigen Zahlungsmittel für die wachsende Wirtschaft. Anfang des 12. Jahrhunderts existierten in Mitteleuropa nur zwei Dutzend Münzstätten, bis Ende des Jahrhunderts waren es bereits über 200.[35] Die Geschichtsforschung spricht von einer regelrechten kommerziellen Revolution und einer mit ihr einhergehenden Monetarisierung ab dem 12. Jahrhundert, die geprägt war von einer ungeheuren Belebung des europäischen Binnen- und Außenhandels. Aber auch die massenhafte Gründung von Städten in ganz Europa war eng mit dem verfügbaren Silber und der Menge des daraus geprägten Geldes verknüpft: Es entstanden neue Handelsplätze, es flossen Zölle und Abgaben, die Landesherren gestanden den Städten auch gegen entsprechende Zahlungen zunehmend Rechte zu.
Zudem wurde der Gebrauch von Münzen immer selbstverständlicher. So setzte sich beispielsweise im Hochmittelalter zunehmend der Trend durch, dass Grundbesitzer sich die fällige Pacht in Form von Geld bezahlen ließen. Nach und nach mussten schließlich selbst die Bauern Zugriff auf Münzen haben. Das bedeutete, dass sie ihre Waren auf den lokalen Märkten verkaufen mussten, um in den Besitz von Münzen zu gelangen, die sie dann wiederum ihrem Herrn für die Pacht geben konnten.[36] Am Ende des Mittelalters war dann schließlich ein Alltag ohne Münzen nicht mehr denkbar. Und dabei war die Silbermünze Maß aller Dinge. Sie war gleichermaßen wertvoll wie praktikabel für die Monetarisierung der Gesellschaft – ganz im Gegensatz zu den Goldmünzen, die ein Vielfaches wert waren, mit denen aber niemand auf den Markt gehen und Lebensmittel kaufen konnte …
Und die Münzen waren wie das Silber selbst im Grunde immer in Bewegung, sie wanderten wörtlich von der einen Hand zur anderen. Die Kaufleute transportierten sie über weite Distanzen. Deutsches Silber gelangte beispielsweise nach Italien, so wurden Prägestätten von Venedig im 13. Jahrhundert vor allem mit deutschem Silber beliefert. Silber aus Sachsen oder dem Erzgebirge floss ebenso in die südlichen Niederlande und in die Champagne, von wo aus es sich über ganz Frankreich verteilte, weil es zumeist für den Kauf von Nahrungsmitteln verwendet wurde. Und die Kaufleute der Hanse brachten das Silber nicht nur in den Westen, vor allem nach England, sondern über das Baltikum auch in den Osten Europas.[37] Auf Wanderschaft gingen zum Leidwesen der Menschen aber auch gefälschte Münzen. So plagten sich beispielsweise im 13. Jahrhundert die Kaufleute und Fürsten in England mit gefälschten Sterlingen herum, die auf dem europäischen Festland geprägt worden waren und dann über den Kanal verschifft wurden.[38] Weckte das Silber also in den Menschen nicht nur den Antrieb zum Handel, sondern schlicht auch die nackte Gier? Einige mittelalterliche Autoren sahen dies so und klagten darüber, dass das Geld nicht nur wie ein »König« oder ein »Kaiser« verehrt wurde, sondern letztlich wie ein neuer »Gott«.[39]
Dazu passt, dass das Silber nicht nur als Geld verwendet wurde. Das Edelmetall war wegen seiner Schönheit und wegen seines Glanzes nicht wegzudenken aus der mittelalterlichen Goldschmiedekunst, auch weil es leicht zu verarbeiten und vor allem preiswerter war als Gold.[40] Das Ergebnis der Goldschmiedearbeiten waren neben Schmuck vor allem Gegenstände für sakrale Zwecke. Schon im 10. und 11. Jahrhundert zählten kunstvoll gearbeitete silberne Becher mit Unterschalen zu den kostbaren Kleinodien des Klosters Monte Casino.[41] Zunehmend wurden für die Kirchen wertvolle Kelche und Hostienschalen, Monstranzen, Weihrauchfässer und -schiffchen, Kännchen oder Kerzenleuchter gefertigt; viele von ihnen wurden vergoldet, um sie noch wertvoller und ästhetischer erscheinen zu lassen.
In der christlichen Glaubenswelt des Mittelalters war Silber ohnehin nicht nur ein bloßes Metall – mit Gold und Edelsteinen zählte es zu den »Zeichen frommen Dienstes«, durfte also am Altar möglichst nicht fehlen und galt als Weihegabe zum Lob Gottes und der Heiligen. Auch diente es als Sühneopfer reumütiger Sünder oder als Votivgabe für die Erlangung eines Platzes im Himmel. Zudem kam dieses Edelmetall in seiner glänzenden Form für die Menschen des Mittelalters der Farbe Weiß sehr nahe, und die galt als Farbe Gottes wie auch der Engel. Gemeinsam mit Gold stand das Silber überdies sinnbildlich für die Auferstehung und die Unsterblichkeit.[42] Konkret wurde die Läuterung des Silbers, also seine Befreiung vom Blei, um einen noch höheren Reinheitsgrad zu erreichen, mit dem Psalm 12,7 aus dem Alten Testament in Verbindung gebracht. Dort heißt es:[43]
Die Worte des Herrn sind lautere WorteSilber, geschmolzen im Ofen.von Schlacken gereinigt siebenfach.
Das geläuterte Silber stand in der christlichen Symbolik dementsprechend für die Reinheit des Wortes Gottes, zugleich aber auch für den Mond sowie für die Gottesmutter Maria. Deren Mutter Anna avancierte schließlich auch zur Schutzpatronin des Silberbergbaus.[44]
Für die Christen war Silber also keineswegs ein Material wie jedes andere. Das galt in besonderem Maße für die Reliquien, die einen festen Platz in der mittelalterlichen Welt der Frömmigkeit hatten. Sie wurden in kunstvollen Gefäßen oder Truhen aufbewahrt, aber auch mit wertvollen Materialien eingefasst – früh schon mit Silber, dann immer häufiger auch in Gold. Dazu zählt beispielsweise das silberne Bernwardkreuz von Hildesheim aus dem 11. Jahrhundert, in dessen Corpus verschiedene Reliquien verborgen waren.[45] Und der um das Jahr 1200 verstorbene englische Bischof Hugo von Lincoln, ein selbst für klerikale Kreise außergewöhnlicher Liebhaber von Reliquien, führte stets ein Silberkästchen mit zahlreichen, an verschiedenen Orten erworbenen Reliquien mit sich.[46] Im Zweifelsfall war es für die Kirche offensichtlich auch zweitrangig, auf welchem Weg die mit Silber verzierten Reliquien in ihren Besitz kamen. Auch kulturelles Raubgut wurde gerne genommen; die Plünderung der christlich-orthodoxen Stadt Konstantinopel durch christlich-römische Kreuzfahrer im Jahr 1204 bescherte beispielsweise den europäischen Bischofsstädten zahlreiche Reliquien. Dazu zählte etwa der Schädel des Apostels Jacobus, der die Bischofsstadt Halberstadt in einem silbernen Behälter erreichte, oder der vordere Teil des Schädels Johannes’ des Täufers, der in der Kathedrale im französischen Amiens auf einem Silberteller dargebracht wurde.[47]
Wie andere seltene und wertvolle Substanzen auch hatte das Silber zudem einen festen Platz in den Arzneibüchern des Mittelalters. So empfahl es beispielsweise Hildegard von Bingen. Für sie war das Silber »kalt«; dem Metall wohne ein »kalter Wind« inne, und dies könne bei bestimmten Erkrankungen therapeutisch genutzt werden. Im Mittelalter herrschte die Vorstellung von der Existenz von verschiedenen Körpersäften vor, die im Gleichgewicht gehalten werden müssten. Und das Silber, so Hildegard von Bingen, könnte auch hier helfen:[48]
Ein Mensch …, der Überfluss an Säften in sich hat und sie durch Ausspeiung oft auswirft, der glühe sehr rein gemachtes Silber im Feuer, und so warm lege er es in guten Wein, und dies mache er drei- oder viermal, damit jener Wein davon warm werde. Und er trinke so oft nüchtern und abends, und dies vermindert die überflüssigen Säfte in ihm, das heißt bringt sie zum Verschwinden.
Mit Silber ließen sich womöglich Krankheiten heilen, ganz sicher ließen sich damit aber auch Kriege führen – eine ausreichende Menge davon einmal vorausgesetzt. Die eigenen Truppen mussten ausreichend mit Sold versorgt werden, Waffen beschafft und alliierte Fürsten ausgezahlt werden. Fürsten und Städte brachten regelmäßig erhebliche Summen für Angriff oder Verteidigung auf, und deshalb wurden auch die Verlierer von Schlachten regelmäßig zur Kasse gebeten. Als etwa Pisa im Jahr 1284 bei Meloria die größte Seeschlacht des Mittelalters verloren hatte, war an die siegreiche Republik Genua die Zahlung von 20 000 Mark in Silberbarren fällig.[49] Und bei günstiger Gelegenheit griffen weltliche und geistliche Herren ebenfalls zu Gewalt, um sich noch direkter in den Besitz des begehrten Edelmetalls zu bringen. Bereits im Jahr 1257 brachten die Genuesen ein Pisaner Schiff auf, dass 20 000 Silbermark geladen hatte – rund fünf Tonnen.[50] Gewalt im großen Stil begleitete die Geschichte des Silbers schon im Mittelalter.
Zugleich war das Edelmetall auch das Mittel der Wahl, wenn es um Erpressung und Lösegeld ging. Die Gefangennahme einer wichtigen politischen Persönlichkeit mit der Aussicht, für diese ein Lösegeld erpressen zu können, war im Mittelalter eine durchaus beliebte Methode, um die eigene Staatskasse aufzufüllen. Jeder erbeutete Adelige, ein Herzog oder in besonderen Fällen sogar ein König stellte stets ein lukratives Geschäft dar. Wollten seine Angehörigen oder der Hofstaat den Regenten unversehrt zurückbekommen, wurde eine stattliche Summe fällig.
Es gab zwar keine offizielle Preisliste, wie viel Silber sich für welche Geisel verlangen ließ, aber mit dem Abstand der Jahrhunderte lässt sich erkennen, welcher Gefangene seinen Lieben oder Verbündeten daheim wie viel wert war: Für einen erbeuteten angesehenen Ritter konnte beispielsweise der König von England im Jahr 1215 schon mal 2,3 oder auch 4,6 Kilogramm Silber verlangen, die Sarazenen erhielten für die Freilassung eines Kanonikers vom Heiligen Grab zu Jerusalem im Jahr 1161 sogar die stolze Summe von 454 Kilogramm Silber. Doch das waren – mit Verlaub – dennoch ziemlich kleine Fische. Richtig viel Geld brachten gefangene Fürsten ein, etwa Albrecht I., der Herzog von Braunschweig-Lüneburg (1236 – 1279). In diesem Fall wurden im 13. Jahrhundert 1870 Kilogramm Silber fällig. Und für den mächtigen Erzbischof von Köln, Siegfried von Westerburg (gest. 1297), wurden 2333 Kilogramm Silber als Lösegeld aufgerufen. Aber am meisten brachten immer noch gefangene Könige, etwa Richard I. von England (1157 – 1199), genannt Richard Löwenherz. Ihn ließen seine Häscher, Kaiser Heinrich VI. sowie Herzog Leopold von Österreich, im Jahr 1194 erst nach der Zahlung von über 23 000 Kilogramm Silber wieder frei.[51]
Es kann nicht verwundern, dass dieses lukrative Geschäft auf den Schlachtfeldern zu einem regelrechten Wettstreit um eine potenzielle Geisel führte. Bei der Schlacht von Bouvines im Jahr 1214 stritten sich gleich drei Ritter über die Gefangennahme Rainalds von Boulogne (um 1165 – 1227). Sie waren offensichtlich nahezu gleichzeitig zur Stelle, als der begehrte Graf vom Pferd stürzte. Als sie sich nicht einigen konnten, wem der Mann nun als Beute zustand, kam sogar noch ein vierter Ritter hinzu, der nun ebenfalls seinen Anspruch auf den Gefangenen geltend machte. Was die adeligen Streithähne noch nicht ahnten: Ihr Gerangel wurde nach der Schlacht ohnehin überflüssig, weil der königliche Oberbefehlshaber nämlich befahl, ihm alle Gefangenen persönlich auszuliefern. Wohl aufgrund solcher Erfahrungen verbaten König Eduard I. von England (1239 – 1307) oder später auch der burgundische Herzog Johann Ohnefurcht (1371 – 1419) ihren Heeren nicht nur das Plündern, sondern auch die Gefangennahme von Kriegsgegnern bei schwerer Strafe. Ganz offensichtlich hatten sich ihre Soldaten in jüngster Zeit mehr um die Jagd auf Geiseln als um die Fortsetzung des Kampfes bemüht …[52]
Aber nicht nur prominente Geiseln wurden im Mittelalter in Silber aufgewogen. In adeligen Kreisen wurde auch der Wert einer Frau in diesem Edelmetall bemessen, und zwar, wenn es um die Mitgift ging, auch als Brautschatz oder Aussteuer bezeichnet. Sie war einerseits eine Vorwegnahme des rechtmäßigen Erbes der Braut seitens des eigenen Elternhauses, zugleich aber vor allem ein entscheidender Beitrag zur Existenzgründung der frisch Vermählten. Die Summe, die der Ehemann dabei einstrich, war zuweilen so erheblich, dass er sich – oder der Familie – richtig etwas leisten konnte. Also Augen auf bei der Partnerwahl, zumindest was die finanziellen Startmöglichkeiten eines Paares anging: Zwischen 2300 und 3500 Kilogramm Silber – da sind sich die Chronisten nicht ganz einig – brachte beispielsweise die noch minderjährige englische Prinzessin Mathilde im Jahr 1114 mit an den Hof der Salier, wo sich der junge deutsche König Heinrich V. (vermutlich 1086 – 1125) gleichermaßen über die Ehefrau wie über das Edelmetall gefreut haben dürfte. Er wusste nämlich zu diesem Zeitpunkt wohl schon ziemlich genau, was er mit dem Silberregen anfangen wollte: Als er kurz darauf nach Rom aufbrach, um sich vom Papst zum Kaiser krönen zu lassen, wurde die prunkvolle Ausstattung seines Gefolges zu einem Gutteil mit dem englischen Silber finanziert.[53]