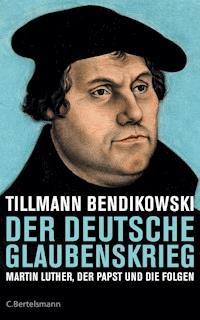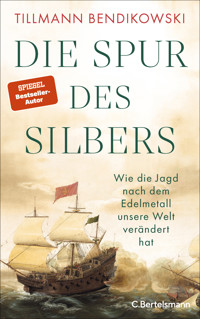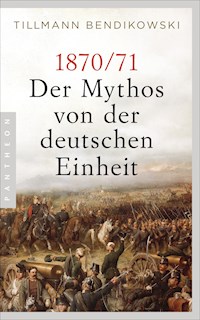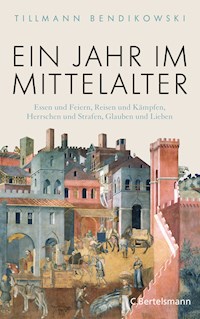6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Im Herbst 2015 wurde in Deutschland die Willkommenskultur geboren. Eine Kultur des Helfens, die schnell, pragmatisch und effektiv von tausenden Menschen gelebt wurde, um jenen ein erstes Überleben zu sichern, die zu Hunderttausenden vor Krieg und Hunger flohen. Infrastrukturen des Helfens entstanden binnen kürzester Zeit aus der Mitte der Bürgergesellschaft und ließen staatliche Hilfssysteme starr und schwerfällig erscheinen. Tillmann Bendikowski hat das zum Anlass genommen, diesem erstaunlichen Phänomen in Geschichte und Gegenwart nachzuspüren. Anhand von Gesprächen mit Menschen, die unterschiedliche Erfahrungen mit dem Helfen gemacht haben, und mit Blick auf jene, die zu Ikonen der Barmherzigkeit geworden sind, zeigt er, wie Hilfsbereitschaft Menschen und Gesellschaften verändert und dass diese ein Gradmesser für die Menschlichkeit einer Gemeinschaft sein kann. Bendikowski forscht aber auch nach psychologischen Aspekten des Helfenwollens.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 362
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Buch
Im Herbst 2015 wurde in Deutschland die Willkommenskultur geboren. Eine Kultur des Helfens, die schnell, pragmatisch und effektiv von Tausenden Menschen gelebt wurde, um jenen ein erstes Überleben zu sichern, die zu Hunderttausenden vor Krieg und Hunger flohen. Infrastrukturen des Helfens entstanden binnen kürzester Zeit aus der Mitte der Bürgergesellschaft heraus und ließen staatliche Hilfesysteme starr und schwerfällig erscheinen. Tillmann Bendikowski hat das zum Anlass genommen, diesem erstaunlichen Phänomen in Geschichte und Gegenwart nachzuspüren. Anhand von Gesprächen mit Menschen, die unterschiedliche Erfahrungen mit dem Helfen gemacht haben, und mit Blick auf jene, die zu Ikonen der Barmherzigkeit geworden sind, zeigt er, wie Hilfsbereitschaft Menschen und Gesellschaften verändert und dass diese ein Gradmesser für die Menschlichkeit einer Gemeinschaft sein kann. Bendikowski forscht aber auch nach psychologischen Aspekten des Helfenwollens.
Autor
Dr. Tillmann Bendikowski, geb. 1965, Journalist und Historiker, promovierte 1999 bei Prof. Hans Mommsen an der Ruhr-Universität Bochum. Als Gründer und Leiter der Medienagentur Geschichte in Hamburg schreibt er Beiträge für Printmedien und Hörfunk und betreut die wissenschaftliche Realisierung von Forschungsprojekten und historischen Ausstellungen. Er verfasste u. a. »Der Tag, an dem Deutschland entstand. Geschichte der Varusschlacht« (2008), »Friedrich der Große« (2011), »Sommer 1914« (2014) und »Der deutsche Glaubenskrieg« (2016).
TILLMANN BENDIKOWSKI
Helfen
Warum wir für andere da sind
C. Bertelsmann
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag weist ausdrücklich darauf hin, dass im Text enthaltene externe Links vom Verlag nur bis zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung eingesehen werden konnten. Auf spätere Veränderungen hat der Verlag keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
1. Auflage
© 2016 C. Bertelsmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-19530-4V001www.cbertelsmann.de
INHALT
Vorwort: Eine Kultur des Helfens
1. DAS HUMANITÄRE SOMMERMÄRCHEN
Das tote Kind und der barmherzige Samariter
Helfer unter Verdacht
2. WARUM HILFT EIN MENSCH?
Vom Nutzen und Nachteil des Mitleids
Die Christen und die Barmherzigkeit
Der Menschenfreund: Mit Vernunft Gutes tun
3. KEINE HILFE
Die Klage über den Egoismus
In Zeiten der Unfreiheit
4. HELFEN ALS VERSPRECHEN
Die Familie: Helfen über Generationen hinweg?
Helfen in der sozialen Not
Der Staat als Sozialstaat
5. DAS HELFEN IN DER KRITIK
Die Entdeckung des Helfersyndroms
Hilfe und Herrschaft
Die Grenzen des Helfens
Resümee: In welchem Land wir leben wollen
Anmerkungen
Literatur
Register
Eine Hand, die um Hilfe bittet.Eine Hand, die Hilfe gewährt.Es ist die gleiche Geste.
VORWORT EINE KULTUR DES HELFENS
Edel sei der Mensch, hilfreich und gut. Denn das allein unterscheidet ihn von allen Wesen, die wir kennen.
Johann Wolfgang von Goethe
Deutschland im Sommer 2015: Das Land war plötzlich nicht mehr wiederzuerkennen. Als die Flüchtlinge zu Hunderttausenden ins Land kamen, waren sie plötzlich da, die hilfreichen Menschen. An Bahnhöfen streiften sich Studenten gelbe Warnwesten über, um völlig entkräftete Menschen aufzulesen und zu Sammelplätzen zu geleiten. Passanten brachten spontan Lebensmittel oder kauften auf Bitten der Helfer dringend benötigte Windeln in einem nahen Supermarkt. Schulen im ganzen Land sammelten Kleider und Kinderspielzeug, Betriebe und Vereine organisierten Unterstützung. In Turnhallen, Theatern und schließlich sogar in Jugendherbergen fanden die Gestrandeten Zuflucht, während überall eilig Wohncontainer und Zelte aufgebaut wurden, um den Menschen zumindest ein provisorisches Dach über dem Kopf bieten zu können. Unerwartet viele Deutsche demonstrierten, dass sie helfen wollten und helfen konnten. Deutschland schien in diesen Tagen ein anderes, ein neues Gesicht zu zeigen – die »Willkommenskultur« war geboren und wurde zu einem neuen, festen Begriff in der politischen Kultur.
Hatte sich Deutschland verändert? Als die Flüchtlinge in immer größerer Zahl kamen, machten auch fremdenfeindliche Zwischenfälle und Demonstrationen Schlagzeilen. Geplante und sogar bereits genutzte Unterkünfte für Flüchtlinge wurden angezündet, manchmal entkamen Menschen nur mit knapper Not dem Tod. Tausende selbsternannte »Retter« eines imaginären »Abendlandes« zogen abends durch deutsche Städte und agitierten gegen die Zuwanderer und die Politik der Bundesregierung. Ihre Wortwahl und ihre Methoden waren abschreckend, der symbolische Galgen für den SPD-Vorsitzenden und Vizekanzler Sigmar Gabriel ist bis heute unvergessen. Unterdessen erreichte die Zahl rechtsextremistischer Straftaten einen neuen Höhepunkt. Das war die hässliche Seite des Jahres 2015, die auch das Gegenteil der Willkommenskultur offenbarte.
Aber die Veränderungen, die durch die kollektive Hilfsbereitschaft vorangetrieben worden waren, ließen sich nicht mehr rückgängig machen. Innerhalb kurzer Zeit hatten sich, zumeist ohne festen organisatorischen Charakter und zuweilen nur vorübergehend, lokale Hilfsstrukturen gebildet, die zusammengenommen die Grundlage für eine neue Kultur des Helfens bildeten. Alle Beteiligten machten damals eine neue Erfahrung: Zu Helfern gewordene »normale« Menschen lernten Tag für Tag, dass sie Not rasch lindern konnten und dass sie manchmal sogar schneller, konkreter und effektiver helfen konnten als der Staat. Und die etablierten Strukturen des Sozialstaates nahmen ebenso wie die großen Hilfsorganisationen dieses unerwartete zivilgesellschaftliche Angebot des Zupackens nach anfänglicher Irritation gern an, nicht zuletzt weil die staatlichen Stellen vom Ausmaß der Herausforderung erstaunlich rasch überfordert wurden.
Gemeinsam versuchten fortan professionelle und ehrenamtliche Helfer, auch unkonventionelle Wege zu gehen – oft mit Erfolg. Das machte wiederum Mut, sich auch weiterhin für die Gestrandeten zu engagieren. Es ging hierbei nicht um abstrakte Flüchtlingspolitik, über die man schon im Sommer 2015, mehr noch aber dann in der Folgezeit, heftig stritt. Vielmehr wurde abseits politischer oder ideologischer Debatten schlicht praktisch geholfen. Und dies in einem ganz essenziellen Maß: Kinder mussten erst einmal Nahrung und Kleidung erhalten, Familien brauchten für den Herbst und den Winter wenigstens eine vorläufige Bleibe. Es war ein Helfen in einem ganz ursprünglichen Sinn gefordert: Hilfe zum Überleben. Das war eine neue Herausforderung für die Deutschen, die sich in dieser Situation großzügig mit ihrer Hilfsbereitschaft zeigten.
Der Impuls zum Helfen wurde auch nicht dadurch geschmälert, dass man die engagierten Zeitgenossen zuweilen belächelte oder sie gar als »Gutmenschen« bezeichnete, was ausdrücklich als Kritik an ihrem Engagement und ihren Motiven gemeint war. Eine große Tageszeitung schrieb sogar von einem »Helfersyndrom im Endstadium«, an dem die Menschen in diesem Land angeblich litten. Auch das sollte die aktuell geleistete Hilfe als etwas potenziell Pathologisches denunzieren. Dazu passte auch, dass das Nachrichtenmagazin Der Spiegel im September 2015 die Bundeskanzlerin, verfremdet als die einst bei den Ärmsten in Kalkutta tätige Ordensschwester Mutter Teresa, als »Mutter Angela« aufs Titelbild hob. Auch das war keineswegs als Auszeichnung zu verstehen: Angela Merkel, so die Vermutung sogar im Kreis ihrer eigenen Partei, sei vor lauter Barmherzigkeit der Sinn für die Realität abhandengekommen. Ist die Kanzlerin also ein guter, aber reichlich naiver Mensch?
Solcher Spott über die Regierungschefin lenkt zugleich den Blick auf eine Dimension des Helfens, die in den tagespolitischen Auseinandersetzungen vergessen wird: So wie Mutter Teresa für Millionen immer noch eine Ikone der christlichen Nächstenliebe ist, so gibt es auch andere Vorbilder des Helfens, die wir nicht nur kennen, sondern die noch immer eine hohe Wertschätzung als moralische Vorbilder genießen. Allen voran der barmherzige Samariter aus dem Neuen Testament, aber auch Persönlichkeiten wie Florence Nightingale oder Friedrich von Bodelschwingh, Albert Schweitzer, Karlheinz Böhm oder der 2016 verstorbene Rupert Neudeck, dessen Einsatz zur Rettung von Bootsflüchtlingen plötzlich wieder so aktuell wurde. Prominente Helfer waren und sind unverzichtbar für die kulturelle Prägung unseres Landes, weil sie in besonderem Maß für eine – vermeintliche – Selbstverständlichkeit stehen: Wenn ein Mensch in Not gerät, wird ihm ein anderer zu Hilfe eilen. Wir gehen unausgesprochen alle davon aus, dass es eine intakte Kultur des Helfens in unserer Gesellschaft gibt.
Was sind das für Menschen, die anderen zu Hilfe eilen? Sicher, das sind zunächst einmal die professionellen Retter in der Not: Feuerwehrleute und Rettungssanitäter, Katastrophenschützer und Notfallseelsorger; im Alltag sind es Ärzte und das Pflegepersonal in Krankenhäusern und Altenheimen, von »helfenden Berufen« ist in diesem Zusammenhang die Rede. Warum ergreifen Menschen einen solchen Beruf? Und was treibt die vielen Ehrenamtlichen im Lande an, die bei der Freiwilligen Feuerwehr ihren Dienst tun, bei einer »Tafel« Lebensmittel an bedürftige Mitmenschen ausgeben, eine kirchliche Kleiderkammer organisieren oder nach ihrem Feierabend noch das Radio des örtlichen Krankenhauses betreiben? So höchst unterschiedlich ihre Motive sein mögen, so prägen sie doch alle zusammen, die Hauptamtlichen wie die Ehrenamtlichen, das gesellschaftliche Klima, denn die Kultur des Helfens ist auch ein Gradmesser für den Zustand der Menschlichkeit in einem Land.
Zugleich ist es einsichtig, dass jede Kultur des Helfens ihre eigene Geschichte hat. Zu dieser Geschichte gehört, dass unsere heutige Hilfsbereitschaft auch das Ergebnis früherer Bemühungen und Erfahrungen auf diesem Gebiet ist, aber auch, dass früher anders geholfen wurde als heute. Hilfe für Kranke sah in Zeiten der Pest anders aus als in Zeiten von Ebola. Die Sorge um Verwundete war im Dreißigjährigen Krieg eine andere als in heutigen Kriegen. Im Mittelalter musste selbst der König nach dem Kirchgang einem Bettler ein Almosen geben (lassen) – täte dies heute der Bundespräsident, würde er sich selbst wie den Bettler der Lächerlichkeit preisgeben oder gar hochmütig und herablassend wirken. Es gab früher Menschen, die nicht nur Aussätzige pflegten, sondern sie auch noch demonstrativ in der Öffentlichkeit küssten. Und gleichzeitig gab es immer schon Menschen, die deutlich zögerlicher waren und aus Angst, Scheu, Unfähigkeit oder Egoismus anderen ihre Hilfe versagten.
Auch der Staat trat erst in jüngerer Zeit als Sozialstaat auf; es dauerte lange, bis die Sorge um Arme, Arbeitslose, Kranke und Alte zur Aufgabe der Allgemeinheit erhoben und von ihr finanziert wurde. In Deutschland war die Einführung der Sozialversicherung unter Reichskanzler Otto von Bismarck eine solche Wegmarke. Der Staat übernahm fortan und in wachsendem Maß die Verantwortung als institutioneller Helfer. Lange war dies selbstverständlich, heute nicht mehr: Längst haben die Kritik am modernen Sozialstaat sowie tatsächliche oder vermeintliche finanzielle Zwänge dazu beigetragen, den Staat aus der Helferrolle zurückzudrängen. Auch das wird nicht ohne Folgen für die Kultur des Helfens im Land bleiben.
Eine Geschichte des Helfens kommt nicht umhin, auch die unterlassene Hilfe in den Blick zu nehmen, die der Gesetzgeber heute ausdrücklich unter Strafe gestellt hat. Es gab und gibt immer auch Menschen, die in Notsituationen anderen nicht helfen. Sind das dann immer zwangsläufig Egoisten? Schlechte Menschen? Verfügen sie über eine dissoziale Persönlichkeit, wie Psychologen das nennen und diese der prosozialen Persönlichkeit gegenüberstellen? Oder haben sie möglicherweise einfach nur eine andere Vorstellung von sinnvoller Hilfe als der große Rest der Gesellschaft? Und vergessen wir nicht das katastrophale Versagen aller Hilfesysteme während des »Dritten Reiches«: Ohne nennenswerten Protest wurden Millionen Menschen entrechtet, ausgegrenzt, verfolgt und ermordet. Kaum jemand kam ihnen zu Hilfe. Das Helfen wurde tendenziell zu einem Akt des Widerstandes gegen die Diktatur: Wer den Ausgegrenzten und Verfolgten half, wurde selbst zum politischen Feind erklärt. Auch dies ist ein Kapitel in der Geschichte des Helfens.
Schließlich wird immer auch Kritik und Zweifel am Helfen laut: an bestimmten Formen von Unterstützung und Zuwendung, an den Beweggründen von Helfern und auch an den Folgen von Hilfsmaßnahmen. Ein prominentes Beispiel dafür ist die Entwicklungshilfe, die in ihrer traditionellen Ausprägung schon lange in den Verdacht geraten ist, in sehr viel größerem Umfang die Interessen der Industrienationen im Blick zu haben als die nachhaltige Verbesserung oder gar politische und ökonomische Gleichberechtigung der sogenannten Entwicklungsländer. Macht sich also womöglich ausgerechnet derjenige verdächtig, der anderen hilft?
Dieses Buch will das Phänomen des Helfens in seinen individuellen wie kollektiven Formen umreißen. Die aktuelle Herausforderung der deutschen Gesellschaft durch die Ankunft der Flüchtlinge bildet dabei lediglich den Anlass, wenngleich einen sehr gewichtigen. Die Herangehensweise ist darüber hinaus bewusst historisch, weil es viele Traditionen gibt, die uns in unserer Haltung gegenüber dem Helfen prägen. Und wenn wir wissen, was der Ursprung des Helfens als einer individuellen und gesellschaftlichen Errungenschaft ist, können wir womöglich bemessen, wie sich diese weiter verändern wird.
Die Entstehung dieses Buches ist von zahlreichen Gesprächen begleitet worden. Menschen, die sehr unterschiedliche Erfahrungen mit dem Helfen gemacht haben, stellten sich freundlicherweise als Interviewpartner zur Verfügung: Reiner Hoffmann, der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes; Moritz Heisler, der in Hamburg die Hilfe für Flüchtlinge geprägt hat; Erzbischof Stefan Heße, Sonderbeauftragter der Deutschen Bischofskonferenz für Flüchtlingsfragen; Ulrich Schneider, Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes; Professor Jan Ehlers von der Universität Witten-Herdecke. Ihre Erfahrungen und Einschätzungen helfen zu verstehen, was Helfen ist und was es sein kann.
Dieses Buch hat unverzichtbare Hilfe erhalten von Dr. Arnd Hoffmann (Köln). Er hat das Projekt wissenschaftlich und freundschaftlich begleitet. Dafür gebührt ihm großer Dank.
Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch.
Friedrich Hölderlin
1. DAS HUMANITÄRE SOMMERMÄRCHEN
Das tote Kind und der barmherzige Samariter
Jeder von uns hat seine eigenen Bilder vor Augen, wenn er an den Sommer 2015 denkt. Mancher mag an Szenen auf den Bahnhöfen denken, wo übernächtigte und orientierungslose Familien aus den Zügen stiegen. Viele sahen in diesen Wochen und Monaten zum ersten Mal in einem solchen Ausmaß Menschen in Not, übernächtigte Kinder und entkräftete Mütter, Menschen ohne ausreichende Kleidung, hungrig und traumatisiert von Kriegs- und Fluchterfahrungen. Das hatten die Deutschen, von denen die meisten den Zweiten Weltkrieg und die Flucht aus dem Osten nur noch vom Hörensagen und aus dem Geschichtsunterricht kennen, noch nicht erlebt. Berichte über das Schicksal von Flüchtlingen kannte man nur aus dem Fernsehen, jetzt konnte jeder hierzulande selbst sehen, was Flucht und Ankunft in einem fremden Land bedeuteten. Zu den Eindrücken aus der eigenen Lebenswelt gesellten sich die Bilder, die die Medien verbreiteten.
Einige dieser Bilder gingen um die Welt. Dazu zählte auch eines, das leider nicht das Helfen zeigte, sondern ein Kind, dem eben nicht mehr rechtzeitig geholfen werden konnte. Es war die Fotografie des dreijährigen Aylan Kurdi aus Syrien, der Anfang September 2015 tot an den Strand der türkischen Küste gespült wurde. Der kleine Junge war mit seiner Familie an Bord eines Bootes gegangen, das sie mit anderen syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen von der Türkei zur griechischen Insel Kos bringen sollte. Viel Geld bezahlte die Familie einem Schleuser dafür, es sollte der erste Schritt in Richtung Kanada sein, das Ziel ihrer Flucht, wo eine Tante der Kinder lebt und auf sie wartete. Doch das mit Menschen überladene Schiff geriet in schwere See und kenterte. Das berichtete später Aylans Vater, der ebenfalls an Bord war. Und er musste mit ansehen, wie seine beiden Söhne und seine Frau ertranken, er selbst wurde Stunden später gerettet.
Aylans Leichnam am Strand der türkischen Küste wurde ein schreckliches Symbol für die Flüchtlingskatastrophe: Ein Junge in bunter Sommerkleidung liegt auf dem Bauch an der Wasserkante des Strandes. Eine türkische Fotografin drückt schließlich auf den Auslöser, und bald sieht die ganze Welt den toten Jungen und auch den Polizisten, der hinzutritt. Im Vergleich zu dem kleinen Leichnam wirkt der Mann riesig; er nimmt das tote Kind so vorsichtig und pietätvoll auf, wie es ihm möglich ist. »Ein Foto, um die Welt zum Schweigen zu bringen«, schrieb eine italienische Zeitung. Sollte die Fotografin tatsächlich die Absicht gehabt haben, dass über die Tragödie der Flüchtlinge nachgedacht wird, dann hatte sie das erreicht. Für einen Moment schien das Bild die Welt tatsächlich zum Schweigen zu bringen. Es verbreitete schieres Entsetzen. Denn dieses Foto zeigte kein fremdes Leid irgendwo in einem versteckten Winkel der Welt. Daran hatte man sich in Europa schließlich längst gewöhnt, gewöhnen müssen: dass irgendwo in Afrika Menschen verhungerten, dass irgendwo in Asien Dörfer überschwemmt und ihre Einwohner heimatlos wurden oder dass selbsternannte Gotteskrieger im Irak wehrlosen Menschen die Köpfe abschlugen.
Das alles war fraglos grässlich genug, fand aber doch in einer eigentümlichen Distanz zum »normalen« Leben in Deutschland und Europa statt, der Schrecken blieb fern und fremd. Aber das Foto vom kleinen Aylan stellte keine Distanz, sondern in erschreckender Weise Nähe her: Mit seinem roten T-Shirt und seiner blauen Hose sah er aus wie unsere Kinder, der Strand wirkte so, wie ihn viele Deutsche aus ihrem Urlaub kennen, dieser Junge hätte fast ein Touristenkind aus Deutschland sein können. Lange hatte man den Eindruck, die Flüchtlingsnot sei das Leiden anderer Menschen, weit weg von unserem Leben. Der Tod dieses Jungen ging den Menschen in Europa nahe. Unter der Wucht dieses Bildes entschied sogar die britische Regierung, die bislang äußerste Zurückhaltung im Umgang mit den Flüchtlingen demonstriert hatte, einige von ihnen im Land aufzunehmen.
Während die deutschen Medien noch uneins waren, ob und in welchem Maße man dieses Bild der eigenen Leserschaft zeigen sollte – so druckte etwa die Bild-Zeitung das Foto ganzseitig ab mit der Begründung, solche grausamen Bilder seien nun einmal Dokumente der Wirklichkeit, die man dem mündigen Publikum nicht vorenthalten könne, andere Zeitungsredaktionen hingegen rechtfertigten ihren Verzicht auf den Abdruck mit Rücksichtnahme auf die Würde des Toten –, war das Bild vor allem durch das Internet schon längst überall präsent und hatte die Menschen tief bewegt. Und viele Deutsche fühlten sich bestärkt in der Absicht, auf die ungeheure humanitäre Katastrophe mit so viel Hilfe zu reagieren, wie sie nur konnten. »Wir können nicht zulassen, dass Kinder auf der Flucht sterben, dass Kriegsflüchtlinge im Stich gelassen werden«, so die Stimmung, »wir müssen helfen.«
Helfen? Das hatten die Deutschen bis zu diesem September, als Aylan ertrank, bereits praktiziert. Sie hatten die Medien, die Politik und vielleicht auch sich selbst überrascht, indem sie nicht ausschließlich und zuerst nach den Problemen fragten, die der Zustrom von Flüchtlingen mit sich bringen würde, sondern abseits der großen politischen Debatten spontane und wirksame Hilfe organisierten: Die bald so bezeichnete »Willkommenskultur« war geboren. Viele große und kleine Beispiele dafür konnte man alltäglich selbst erleben, über viele Aktionen berichteten die Medien ausführlich. Man kann die Ereignisse dieser Monate des Jahres 2015 wohl als »humanitäres Sommermärchen« bezeichnen. Als Deutscher fand man sich in diesem Moment in einer eigentümlichen, fast irreal anmutenden Situation wieder: Das eigene Land wurde zu einem Zufluchtsort der Verfolgten. Ausgerechnet das Land, das selber noch vor gut zwei Generationen Krieg und Massenmord über Europa gebracht hatte, präsentierte sich nun als Symbol der Hoffnung. Wer noch die von Polemik durchtränkte »Asyl«-Diskussion Anfang der 1990er-Jahre in Erinnerung hatte, als erste Flüchtlingsheime brannten und dann der Deutsche Bundestag im sogenannten »Asylkompromiss« von 1992/93 das Asylrecht bis zur Unkenntlichkeit verstümmelte, der wollte jetzt seinen Augen nicht trauen: »Refugees welcome«? Flüchtlinge, die vor laufenden Kameras Liebeserklärungen gegenüber der christdemokratischen Kanzlerin abgaben, und ganz normale Deutsche, die umstandslos mit anpackten und halfen? Plötzlich, so schien es, würde ein wenig im Kleinen wahr, was diese Welt im Großen braucht: die tatkräftige Hilfe der reichen Industrienationen für die Verfolgten und Armen dieser Welt.
Das Bild des toten Jungen blieb übrigens über den Tag hinaus in den Medien präsent, auch weil es der chinesische Künstler Ai Weiwei Anfang 2016 spektakulär aufgriff: Er ließ sich selbst fotografieren, und zwar am Strand der griechischen Insel Lesbos (immer noch Ziel zahlreicher Flüchtlinge) in ebenjener Haltung, in der zuvor Aylan Kurdi gefunden worden war. Der Künstler wollte damit an das Leid der Flüchtlinge erinnern und gegen Verschärfungen des Asylrechts in europäischen Staaten demonstrieren. Die Reaktionen auf diese Fotografie waren zwar auch ablehnend, doch wurde die kritische Intention Ai Weiweis durchaus anerkannt. »Die Geste mag hilflos sein«, kommentierte die Frankfurter Allgemeine Zeitung. »Zynisch ist sie nicht.«1
Das Bild vom toten Flüchtlingsjungen lebte also in der Kunst und womöglich in der kollektiven Erinnerung der Europäer fort. Es konnte allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Sterben der Flüchtlinge schon länger andauerte und das Mittelmeer schon lange zum Massengrab geworden war. Im Jahr 2014 sollen insgesamt mehr als 3000 Menschen bei dem Versuch ertrunken sein, über dieses Meer Europa zu erreichen. Erstmals schreckte die Welt Anfang Oktober 2013 auf, als vor der italienischen Insel Lampedusa fast 400 Flüchtlinge aus Somalia und Eritrea ertranken, nachdem das völlig überladene Schiff gekentert war. Rund 150 Menschen konnten gerettet werden. Die europäischen Staaten und Regierungen zeigten sich entsetzt, doch über konkrete Hilfe, etwa über die Aufnahme der geretteten Flüchtlinge dieser Wochen, konnte man sich nicht einigen. Anfangs war man auf dem ganzen Kontinent dankbar für die Anstrengungen der italienischen Regierung, die mit großen finanziellen und logistischen Anstrengungen im Rahmen ihres Programms »Mare Nostrum« die Marine und die Küstenwache des Landes zur Seenotrettung im Mittelmeer einsetzte. Zehntausende Menschen verdanken dieser Operation ihr Leben – sie lief allerdings zum 31. Oktober 2014 aus. Ihr folgte die Operation »Triton«, die allerdings nicht in erster Linie der Seenotrettung dienen sollte, sondern der »Sicherung« der EU-Außengrenzen gegen illegale Einwanderung.
Zu denen, die das Bootsunglück vor Lampedusa nicht nur als singuläre humanitäre Katastrophe, sondern auch als Mahnung zu einer Kehrtwende der bisherigen europäischen Politik interpretierten, zählte Papst Franziskus. Er reiste im Juli 2013, vier Monate nach seiner Wahl zum Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche, auf die kleine italienische Insel, um der auf der Flucht ertrunkenen Menschen zu gedenken, einen Gottesdienst zu feiern und zugleich die Weltöffentlichkeit an ihre Pflicht zu erinnern: Die Menschen scheinen in der globalisierten Welt in eine »globalisierte Gleichgültigkeit« gefallen zu sein, kritisierte der Pontifex. Nicht nur die Politik müsse man wegen ihres Versagens für solche Katastrophen verantwortlich machen, alle Menschen müssten sich auf ihre Menschlichkeit besinnen. Franziskus erinnerte während des Gottesdienstes an das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Der habe damals schließlich geholfen, so der Papst. Aber was tun wir heute?
»Wir sehen den halb toten Bruder am Straßenrand und denken vielleicht ›der Arme!‹ und gehen weiter unseres Weges, weil es nicht unsere Aufgabe ist; und wir glauben, dass alles in Ordnung sei. … Die Kultur des Wohlergehens, die uns an uns selber denken lässt, macht uns unsensibel für die Schreie der anderen.«2
Der Papst führte also zu einem Zeitpunkt, als die Flüchtlingskrise in Europa noch gar nicht ihre spätere Dimension erreicht hatte, eine der zentralen christlichen Ikonen des Helfens in die Debatte ein. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter zielt auf den Kern der christlichen Nächstenliebe, auf das, was den barmherzigen Christen ausmachen sollte. Wie dieser Samariter müssten die Menschen heute angesichts der Not auf dem Mittelmeer handeln, mahnte Papst Franziskus.
Die Figur des barmherzigen Samariters begleitet die Menschen seit zwei Jahrtausenden als Verkörperung der Aufforderung zum Helfen weit über den engeren katholisch-kirchlichen Kreis hinaus. Dieser Samariter ist Mahnung und Vorbild. Heute findet sich sein Name in unterschiedlichen Zusammenhängen des organisierten Helfens wieder, beispielsweise im Namen »Arbeiter-Samariter-Bund«. Seine Geschichte wird in der Bibel, im Lukas-Evangelium, erzählt. Ob sie sich wirklich so abgespielt hat, wie wir sie heute kennen, ist zwar fraglich, aber für die Wirkungsgeschichte letztlich zweitrangig. Jesus habe diese Beispielerzählung der Überlieferung nach in einer seiner Debatten mit den Schriftgelehrten angeführt, die zu seiner Zeit die führenden Intellektuellen der jüdischen Gesellschaft waren. Sie hatten bekanntlich einiges mit dem vermeintlichen neuen Messias zu diskutieren, weil dieser Neuerungen das Wort redete, die sich nicht mit dem jüdischen Gesetz und der bis dahin geübten Praxis vereinbaren ließen. So auch bei der in diesem Fall verhandelten Frage, auf wen sich das von allen anerkannte göttliche Gebot beziehe, wonach man seinen Nächsten wie sich selbst lieben solle. »Wer ist denn mein Nächster?«, fragte einer der Gelehrten. Nach seiner eigenen – und geltenden – Auffassung war das immer nur der eigene Stammesbruder, aber keinesfalls ein Ungläubiger oder gar ein Feind. Würde Jesus jetzt der Feindesliebe das Wort reden und sich damit nach jüdischem Gesetz als Freund der Feinde Israels entlarven? Dann würde er als Verräter dastehen. Die Frage war also eine Falle, in die der Mann aus Galiläa allerdings nicht hineinzutappen gedachte. Er begann stattdessen die folgende Geschichte zu erzählen:
»Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder, dann gingen sie weg und ließen ihn halb tot liegen.«
Die Straße zwischen Jerusalem und Jericho war zu jener Zeit für jeden Reisenden eine unangenehme Etappe. Die über 30 Kilometer lange Strecke führte durch die judäische Wüste, genauer durch das Wadi Quilt, ein karges, baumloses und von Schluchten und Höhlen geprägtes Gelände. Zudem galt es zwischen beiden Orten fast 1000 Höhenmeter zu bewältigen (Jericho liegt 200 Meter unter dem Meeresspiegel). Die Gegend abseits der Route war einsam und damit wie gemacht für Räuber, die hier kaum riskieren mussten, nach einem Überfall gefasst und bestraft zu werden. So waren also Raubüberfalle auf dieser Strecke ein verbreitetes Phänomen, häufig stockte sogar die Versorgung der Städte mit Waren, weil wieder einmal Kaufleute ausgeplündert worden waren. Welchen Beruf der Reisende in dieser biblischen Erzählung ausübte, erfahren wir nicht, aber vielleicht war er ein Kaufmann, womöglich bepackt mit Waren oder Geld. Wirklich reich wird er allerdings nicht gewesen sein, sonst hätte er sich eine Eskorte leisten können und wäre in einer Reisegesellschaft unterwegs gewesen. Dennoch muss er den Eindruck gemacht haben, ein lohnenswertes Ziel zu sein. Und so schlugen die Räuber zu.
Das Mittel der Wahl war in so einem Fall ein Knüppel. Vermutlich schlugen sie ihm auf den Kopf (womöglich aus einem Hinterhalt), sicher gingen sie dabei nicht zimperlich vor – der Mann verlor das Bewusstsein. Als er das Glück hatte, wieder zu sich zu kommen, waren die Banditen über alle Berge und mit ihnen seine gesamte Habe. Denn die Räuber waren gründlich: Geld, Gepäck und sogar seine Kleidung hatten sie mitgehen lassen. Den Reisenden ließen sie hilflos zurück. Er war so schwer verletzt, dass er seinen Weg nach Jericho nicht fortsetzen konnte. Blutig und verdreckt, nahezu nackt lag er da. Er hatte Schmerzen, vielleicht krümmte er sich und musste laut aufstöhnen. Wer ihn sah, musste sich wohl ekeln.
Der Ort des Überfalls war einsam, es konnte lange dauern, bis Hilfe kam. Wenn sie denn kam. In diesem Fall näherten sich tatsächlich Menschen – aber sie halfen ihm nicht. Sie ließen ihn liegen in seinem Blut und Dreck, vielleicht tat er ihnen leid, aber niemand hielt inne, um sich seiner anzunehmen. Da kam ein Priester des Weges. Doch als der Gottesmann den Verwundeten sah, so heißt es im Lukas-Evangelium, ging er vorüber. Ein Skandal? Wenn der Priester diese Strecke häufiger passierte, wird es nicht das erste Opfer eines Überfalls gewesen sein, das er hier liegen sah. Womöglich hatten sich er und andere Reisende an diesen Anblick gewöhnt. Halfen sie deshalb nicht?
Schwerer wog für den Priester, dass er kraft seines Amtes möglichst nicht mit Blut in Berührung kommen durfte. Und sollte er seinen Dienst im Tempel von Jerusalem am Brandopferaltar versehen, dann galt dies in besonderem Maß. Dann wären umständliche rituelle Waschungen nötig gewesen, und vermutlich hätte er für Wochen nicht seinen Platz im Tempel einnehmen können. Außerdem war die praktische Hilfe für Kranke gar nicht seine Aufgabe, das galt in dieser Gesellschaft nämlich als Frauensache. Er diente im Tempel, brachte darüber hinaus dem Volk das Gesetz nahe, erklärte es und konnte bei einfachen Rechtsstreitigkeiten helfen. Sich zu dem Verletzten hinabzubeugen, entsprach weder seinem sozialen Status noch den Erwartungen dieser Gesellschaft. Der Mann ging also weiter. Selbstverständlich.
Der Priester war nicht der Einzige, der nicht half. Auch von einem anderen Reisenden wird berichtet, der den armen Mann nur anschaute und unverrichteter Dinge weiterzog. Es war ein Levit, also ein Mitglied des israelitischen Stammes der Leviten. Doch auch dieser ging weiter, ohne zu helfen. Wie ging es weiter?
»Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid.«
An dieser Stelle ist die Bibel in ihrer heutigen Übersetzung zurückhaltend höflich in der Formulierung. Von Mitleid ist die Rede, in manchen Übersetzungen davon, dass es ihn »jammerte«. Im Urtext heißt es sehr viel anschaulicher, dass sich ihm Magen und Eingeweide im Leib umdrehten. Ihm wurde also schlecht angesichts des Elends am Wegesrand. Und das ausgerechnet diesem Mann aus Samarien, wo sich eine eigenständige Glaubensgemeinschaft gebildet hatte, die von der Kultgemeinschaft der Judäer ausgeschlossen worden war. Die Schriftgelehrten, die dieser Geschichte lauschten, mussten an dieser Stelle vermutlich schlucken: Nicht der Priester, nicht der Levit, dafür aber der »Ungläubige« aus Samarien blieb stehen und half?
So geschah es tatsächlich. Der Samariter stieg von seinem Reittier, wendete sich dem Verwundeten zu und – so heißt es – versorgte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie schließlich. Sicherlich wird er ihm etwas zu trinken gegeben und ihn in irgendeiner Form auch mit Kleidung versorgt haben, damit er seine Blöße bedecken konnte. Dann hob er den Überfallenen auf sein Reittier und machte sich mit ihm auf den Weg zu einer der Herbergen, von denen es entlang der Strecke zwischen Jerusalem und Jericho zahlreiche gab. Dort erhielt er ein Quartier für die Nacht. Am nächsten Morgen zog der Samariter weiter, gab dem Herbergswirt aber noch zwei Denare, damit der den Verwundeten auch weiterhin umsorge und verköstige. Aber damit nicht genug: Der Samariter nahm dem Wirt die Zusage ab, die Pflege fortzusetzen: »Sorge für ihn«, forderte er ihn auf. Mehr noch: Selbst wenn das Geld verbraucht sei, solle der Wirt ihn weiterpflegen. Er werde die entstandenen Kosten übernehmen, wenn er das nächste Mal vorbeikomme. Das schien Versprechen wie Ankündigung der Kontrolle zugleich zu sein: Der Samariter würde also wieder vorbeischauen und nach dem Rechten sehen. Er ist erkennbar nicht mittellos und wird sein Wort halten. Und der Wirt, so macht die Erzählung glauben, ebenfalls.
Soweit die Geschichte, die Jesus laut Lukas-Evangelium im Kreis seiner Kritiker erzählte. Haben sie ihn verstanden? Haben sie ihre Lektion gelernt? Sicherheitshalber fragt der Mann aus Galiläa bei einem der Schriftgelehrten noch einmal nach:
»Was meinst du: Wer von diesen dreien hat sich als der Nächste dessen erwiesen, der von den Räubern überfallen wurde?«
An diesem Punkt war mit Jesus schlecht zu diskutieren, dazu war die Geschichte einfach zu gut. Der Gesetzeslehrer musste seine Niederlage einsehen und gestand, dass es derjenige war, »der barmherzig an ihm gehandelt hat«. Die Antwort fiel dem Mann schwer, er brachte wohl auch deshalb den Namen »Samariter« nicht über die Lippen. Denn es ist ausgerechnet dieser Andersgläubige, der hilft. Die Zumutung dieser Beispielerzählung besteht darin, dass Jesus gerade diesen als Nächsten bezeichnet, also nicht das Opfer des Überfalls, sondern denjenigen, der ihm zu Hilfe kommt. Diesen solle der Schriftgelehrte nach göttlichem Gebot lieben wie sich selbst, den verhassten Andersgläubigen also. Was für eine Zumutung. Die gilt es jedoch zu akzeptieren, ebenso wie die Aufforderung: »So gehe hin und tue desgleichen.«
Diese Geschichte wird zu einer der grundlegenden Erzählungen des Christentums. Sie hielt Einzug in Predigten und in die Erbauungsliteratur. Dabei entwickelte sich eine über Jahrhunderte fortdauernde Geschichte der Auslegung, wonach diese Beispielerzählung allegorisch verstanden werden müsse, und zwar als Gleichnis der gesamten christlichen Heilsgeschichte. Es beginne demnach mit dem Sündenfall Adams (mit dem überfallenen Reisenden sei der erste Mensch gemeint) und ende mit der Ankündigung des Jüngsten Gerichts (der Wirt erscheine als Diener der Kirche, dem Christus bei seiner Wiederkehr seinen Dienst reich belohnen werde).3 Damit reicht innerhalb der Kirche die Beispielerzählung vom barmherzigen Samariter durchaus über das eigentliche Motiv des konkreten Helfens hinaus.
Auch als Motiv der Kunstgeschichte wird der Samariter mit seiner guten Tat weltbekannt. Schon im Mittelalter gab es viele Wiedergaben des Motivs, etwa im berühmten Evangeliar Heinrichs des Löwen im späten 12. Jahrhundert oder in Fenstern der Kathedralen von Bourges, Chartres oder Sens im frühen 13. Jahrhundert. Auch in der Neuzeit wurde das Motiv in der Kunst fortwährend aufgegriffen, von Eugène Delacroix oder Ferdinand Hodler, Erich Heckel oder Ernst Barlach, Vincent van Gogh oder Ernst Ludwig Kirchner.4
Das Bild vom barmherzigen Samariter prägte sich also tief ein in das Bewusstsein der Christen. Aber hat es auch heute noch praktische Konsequenzen? Schaut man sich in unserem Land um, so scheint in den vergangenen Jahren der helfende Mensch auf den ersten Blick ein gesellschaftliches Auslaufmodell geworden zu sein. So war es vor wenigen Jahren noch angesagt, den Rückgang des ehrenamtlichen Engagements als Indikator für den Rückgang der Hilfsbereitschaft generell zu beklagen. Nicht zuletzt weil den traditionellen großen Wohlfahrtsverbänden zunehmend die Ehrenamtlichen fehlten, wurde eine »Krise des Ehrenamtes« ausgerufen. Schwindendes Verantwortungsgefühl und eine Individualisierung der Gesellschaft, deren Mitglieder mehr denn je vor allem die Verwirklichung eigener Wünsche propagierten, wurden beklagt. Unter Verdacht gestellt wurde vor allem die nachwachsende Generation: Die Jugendlichen und jungen Erwachsenen engagierten sich nicht mehr ehrenamtlich für ihre Mitmenschen, so hieß es oft – und gemeint war vor allem: Sie engagierten sich nicht mehr in den traditionellen Vereins- und Verbandsstrukturen ihrer Eltern und Großeltern. In den Sportvereinen, in den Ortsvereinen des Roten Kreuzes, bei den Feuerwehren oder den Pfadfindern – überall schien der Nachwuchs zu schwinden. Eine »Generation Ich« wachse da heran, die sich dem eigenen Wohl, aber nicht mehr dem gesellschaftlichen verpflichtet fühle. Eine Jugend auf dem Ego-Trip, da waren sich die Älteren einig, die nur an sich selbst denke – und besonders an ihren eigenen Spaß.
Soweit das Vorurteil gegenüber der nachwachsenden Generation. Aber auch die Erwachsenen standen im Verdacht, den Impuls zur gegenseitigen Hilfe kaum mehr zu verspüren oder ihm zumindest keine konkreten Taten folgen zu lassen. Die Deutschen, so eine weit verbreitete Einschätzung, seien wie alle Menschen in den modernen Industriestaaten längst von der durchorganisierten Hilfe des Sozialstaates und seiner Institutionen abhängig geworden. Der Staat helfe schließlich – deshalb schauten Bürger nur noch zu und seien letztlich zur Hilfe unfähig geworden. So schrieb ein Journalist im Jahr 2005:
»Es gibt Gesetze, die das Helfen zur Pflicht machen. Immer dicker wird das Buch der Sozialgesetze. Immer öfter sind es professionelle, hauptamtliche Helfer, die ihre Hilfe anbieten, Experten fürs Helfen also. Immer seltener ist es nötig, dass die Bürger einander selbst helfen.«5
Aber stimmt diese Wahrnehmung tatsächlich? »Menschen verweigern sich nicht der Verantwortung und dem Engagement«, urteilen dagegen die Sozialforscher Anne Hacket und Gerd Mutz. Die Deutschen bewegten sich keineswegs zwangsläufig auf eine »wie auch immer formierte Erlebnisgesellschaft« zu. Die beiden Forscher monierten im Jahr 2002, dass der oft beklagte Motivwandel in Bezug auf Engagement, der mit einem übergreifenden Wertewandel in der Gesellschaft einhergeht, empirisch gar nicht nachzuweisen sei.6 Er werde lediglich behauptet. Auch der Bochumer Sozialpsychologe Hans-Werner Bierhoff machte bei seiner Beschäftigung mit prosozialem Verhalten die Erfahrung, dass die Hilfsbereitschaft der Deutschen eher geringer eingeschätzt wird. Er ließ Studenten die Hilfsbereitschaft in der Gesellschaft beurteilen – auf einer Skala von 1 (zu wenig) bis 9 (zu viel). Häufig wurde die 3 angekreuzt, die »Norm des Helfens« sei also gesellschaftlich unterrepräsentiert.7
Angesichts dieser Wahrnehmung sahen sich auch die etablierten politischen Strukturen veranlasst zu reagieren. Bundeskanzler Gerhard Schröder hatte einst die »zivile Bürgergesellschaft« als Ziel gesellschaftspolitischen Engagements ausgegeben. Und der deutsche Bundestag setzte 2001, das zum »Internationalen Jahr der Freiwilligen« ausgerufen worden war, eine Enquete-Kommission zur »Zukunft des bürgerschaftlichen Engagements« ein. Man wollte neuen Schwung in das Helfen bringen, und so schossen allerorten »Freiwilligenbüros« aus dem Boden. Preise für »Aktive Bürgerschaft« werden seither verliehen, die Ehrenamtlichen werden in Lokalzeitungen gelobt, mit Auszeichnungen bedacht und vom Bundespräsidenten empfangen.8
Diese Hinwendung zum ehrenamtlichen Helfer hatte einen guten Grund: Zeitgleich wurde nämlich der Sozialstaat abgebaut. Mit der Agenda 2010 der rot-grünen Bundesregierung unter Gerhard Schröder wurden erstmals massive Einschnitte und Veränderungen des deutschen Sozialsystems vorgenommen. Der Staat als vertrauter Helfer, der für das Kindergeld und die Rente sorgt, der bei Arbeitslosigkeit und Berufsunfähigkeit zumindest einen erheblichen Teil der finanziellen Einbußen auffängt, dieser Staat veränderte fortan sein Profil: Er verlor Zuständigkeiten und damit Verantwortung, er forderte vom einzelnen Bürger mehr Engagement und auch mehr eigene Mittel, wenn es um die Kosten für seine Gesundheit oder für seine Altersvorsorge geht. Die Debatte um Sinn und Unsinn dieser Einschnitte soll hier nicht geführt werden, festzuhalten bleibt allerdings, dass die »Entdeckung« des Ehrenamtes parallel zu den Kürzungen im Sozialsystem erfolgte, vielleicht so erfolgen musste. Wo der Staat nun nicht mehr helfen konnte, musste das bürgerschaftliche Engagement einspringen. Aber konnte das so einfach geweckt werden? Musste man die vielen barmherzigen Samariter einfach nur »aufwecken«?
Das Bundesfamilienministerium lässt seit 1999 in fünfjährigem Abstand die Freiwilligenarbeit im Lande untersuchen und kommt dabei zu durchaus positiven Ergebnissen: Es gebe eigentlich gar keine Krise des Ehrenamtes, war da zu lesen, stattdessen könne das Ehrenamt »als kulturell robuste Idee eingeschätzt werden, die weiterhin in einem gewissen Umfang auch die jüngeren Menschen beeinflusst«.9 Bei der Vorlage des Berichts im Jahr 2010 verkündete die damalige Bundesfamilienministerin Kristina Schröder erfreut das Ergebnis:
»Die gute Nachricht vorweg: Die Anzahl der Engagierten ist seit zehn Jahren auf hohem Niveau stabil. 36 Prozent der Bürgerinnen und Bürger haben eine oder mehrere freiwillige Tätigkeiten übernommen – das sind mehr als 23 Millionen Menschen in Deutschland. … Für immer mehr Bürgerinnen und Bürger ist das eigene Engagement ein wichtiger Teil ihres Lebens.«10
Allerdings folgt bekanntlich einer guten Nachricht zuweilen gern eine weniger gute, so auch in diesem Fall: Man könne trotz positiver Ergebnisse nicht einfach mit einer »andauernden Fortsetzung dieses Trends rechnen«, so Ministerin Schröder. Denn es existierten Strukturen in modernen Gesellschaften, die der Freiwilligenarbeit zwangsläufig Grenzen setzten: eine verstärkte regionale Mobilität, der demographische Wandel sowie die gestiegenen zeitlichen Anforderungen in Ausbildung und Beruf.11 Kurzum: Es gibt zwar die generelle Hilfsbereitschaft in Form des ehrenamtlichen Engagements, es gibt eine von diesem Ehrenamt mitgeprägte Kultur des Helfens in der deutschen Gesellschaft, aber sie ist auch von den übrigen Bedingungen in diesem Land abhängig: Je mehr Menschen immer mehr Zeit darauf verwenden müssen, ihren Lebensunterhalt zu verdienen sowie soziale Risiken wie Altersarmut oder Berufsunfähigkeit in einem sehr viel umfangreicheren Maß finanziell abzusichern, und je mehr ein sich verändernder Arbeitsmarkt immer mehr Abwesenheit vom Wohnort verlangt, desto spürbarer werden die Folgen für das kollektive Helfen in Form des Ehrenamtes sein. Noch ist das Fundament stabil, und darauf ist vielleicht maßgeblich die überraschend hohe Hilfsbereitschaft gegenüber den Flüchtlingen zurückzuführen. Dass die Deutschen helfen, ist ja keine neue Erfahrung …
»Diese Hilfsbereitschaft kam ja nicht über Nacht«
DGB-Vorsitzender Reiner Hoffmann
Das Gespräch mit Reiner Hoffmann fand am 11. Februar 2016 in Berlin statt, wenige Stunden nach der offiziellen Vorstellung der »Allianz für Weltoffenheit, Solidarität, Demokratie und Rechtsstaat – gegen Intoleranz, Menschenfeindlichkeit und Gewalt«, im Gebäude des DGB-Bundesvorstands. Dazu schlossen sich an diesem Tag die Bundesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege, die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, die Deutsche Bischofskonferenz, der Deutsche Kulturrat e.V., der Deutsche Naturschutzring, der Deutsche Olympische Sportbund, die Evangelische Kirche in Deutschland, der Koordinationsrat der Muslime sowie der Zentralrat der Juden in Deutschland zusammen. »Ja, Deutschland steht vor großen Herausforderungen«, sagt Hoffmann mit Blick auf die Ankunft der Flüchtlinge, aber die Partner dieser »Allianz« seien überzeugt, dass die Zivilgesellschaft diese Herausforderung meistern könne.
»Ich erinnere mich sehr gut an eine Begebenheit Ende September 2015 am Rande des Kongresses des Europäischen Gewerkschaftsbundes in Paris. Da sprach mich ein Kollege der CGT an, also der alten kommunistischen Gewerkschaft in Frankreich: ›Reiner, was da bei euch in Deutschland gerade passiert, ist für uns in Frankreich unvorstellbar. Und wir sind ein wenig neidisch, wie ihr da reagiert – so positiv und so hilfsbereit.‹ Wenn man solche Reaktionen als Deutscher bekommt, wie die eigene Bevölkerung mit der Herausforderung durch die Flüchtlinge umgeht, dann macht das einen auch ein wenig stolz.
Aber ich glaube nicht, dass sich Deutschland im Sommer 2015 so sehr verändert hat. Diese Hilfsbereitschaft kam ja nicht über Nacht. Es gab immer schon ein ungeheuer großes zivilgesellschaftliches Engagement, das wir in dieser Form aber nicht so wahrgenommen haben. Vieles hat im Kleinen stattgefunden, was vielleicht schon als selbstverständlich wahrgenommen wurde – oder vielleicht gar nicht mehr wahrgenommen wurde – und was dann angesichts des schieren Umfangs der Flüchtlingshilfe noch einmal ganz anders sichtbar wurde.
Dazu gehört auch diese – manche nennen das ja abfällig – Vereinsmeierei. Aber gerade in diesem Vereinsleben lebt doch ein großer Teil des sozialen Engagements. Die Hilfsbereitschaft, die gegenwärtig gegenüber den Flüchtlingen gezeigt wird, kam doch nicht einfach über Nacht. Die Grundlage dafür existierte schon längst. Nach wie vor leben wir in einer Gesellschaft, in der man auf die Hilfe der Nächsten vertrauen kann.«
Das Vertrauen in die Hilfsbereitschaft der Deutschen scheint also vorhanden zu sein. Und man kann den Eindruck haben, dass sich viele Bürger im Moment der großen Herausforderung durch die Ankunft der Flüchtlinge daran erinnerten, was die deutsche Gesellschaft zusammenhält. Von einer »Krise des Ehrenamts« kann nicht die Rede sein, von einer nachwachsenden Generation von Egoisten auch nicht – all das ist widerlegt worden. Nein, der barmherzige Samariter scheint nicht vergessen zu sein. Auch wenn die biblische Geschichte in ihren Details und ihrem Kontext nicht mehr umfassend bekannt sein mag – der damit verbundene Impuls, dem in Not geratenen Menschen zu helfen, hat überlebt. Wollte man einen Menschen für seinen Dienst am Nächsten angemessen würdigen, dann war und ist es eine Auszeichnung, ihn als Helfer in der Tradition dieser neutestamentarischen Gestalt zu bezeichnen. Das tat beispielsweise die ehemalige FDP-Politikerin Hildegard Hamm-Brücher im Jahr 2003, als der »Cap Anamur«-Gründer Rupert Neudeck mit dem Marion Dönhoff Preis ausgezeichnet wurde. Sie gab ihrer Laudatio den Titel: »Über barmherzige Samariter heute und über das ›Prinzip Verantwortung‹ als Bewährungsprobe für unsere Gesellschaft.«
Bei solchen Gelegenheiten erscheint der barmherzige Samariter nicht mehr nur in christlichem Kontext, wenngleich in diesem Fall mit Rupert Neudeck ein bekennender Katholik so bezeichnet wurde. Die Figur aus der Bibel funktioniert als moralischer Appell auch außerhalb von christlichen Zusammenhängen. Man kann den Samariter als Vorbild zitieren, ohne eine spezifisch christliche Motivation des Helfens zu fordern. Auch andere christliche Traditionen wurden übrigens während der Flüchtlingskrise bemüht, wenn es um den Appell an die nicht nachlassende Hilfsbereitschaft ging. So zitierte selbst Dietmar Bartsch, einer der beiden Vorsitzenden der Fraktion »Die Linke« im deutschen Bundestag, in diesem Zusammenhang die Bibel und unterstützte im November 2015 im Plenum ausdrücklich die Bundeskanzlerin für ihre Haltung in der Flüchtlingspolitik gegen Kritik aus ihrer Partei, der CDU: »Ich war fremd und obdachlos, und ihr habt mich aufgenommen.« So steht es in den sogenannten Werken der Barmherzigkeit, die im Matthäus-Evangelium niedergeschrieben sind und die die traditionelle Grundlage der christlichen Nächstenliebe bilden. »Das ist menschlich«, so Bartsch, und in die Gegenwart übersetzt bedeute diese Stelle nichts anderes als das populäre Wort der Bundeskanzlerin: »Wir schaffen das!« Ein Linke-Politiker lobt die konservative Kanzlerin für ihre Politik biblisch geforderter Barmherzigkeit – das humanitäre Sommermärchen legte erstaunliche Gemeinsamkeiten des Helfens auf der Grundlage eines über alle Parteigrenzen hinweg gemeinsamen Erbes frei.
Weil der barmherzige Samariter in welcher Form auch immer noch seinen Platz in der deutschen Gesellschaft hat, glauben viele an ein spezifisch christliches Fundament der Hilfsbereitschaft in der Flüchtlingskrise. So erklärte Bernd Fabritius, Präsident des Bundes der Vertriebenen, dass die Flüchtlinge des Jahres 2015 in Deutschland deshalb Hilfe erfahren, weil »Anteilnahme und Nächstenliebe dem uns prägenden christlichen Menschenbild entsprechen«.12 Und auch für die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner ist neben der Solidarität und dem Verantwortungsgefühl die »Nächstenliebe« ein Hauptbestandteil christlich-demokratischer Politik. In der Bibel sei doch davon die Rede, dem Armen und dem Fremdling Gutes zu tun, und deshalb täten es die Deutschen.13 Der langjährige SPD-Politiker Klaus von Dohnanyi ging noch einen Schritt weiter und erinnerte die Flüchtlinge daran, dass es das christliche Erbe sei, dem die sie die freundliche Aufnahme in Deutschland verdankten:
»Das Christentum bleibt doch eine unersetzliche, fundamentale Grundlage unserer westlichen Kultur, und man kann nur hoffen, dass auch die nun zuwandernden Muslime dieses christliche Element europäischer politischer Kultur honorieren und nie vergessen werden, aus welcher Überzeugung wir sie so freundschaftlich aufgenommen haben.«14
Das war eine durchaus gewagte These. Trotz sprachlicher Bezüge zur Bibel und trotz der hohen medialen Wirkung der Papstpredigt auf Lampedusa scheint es übereilt, das humanitäre Sommermärchen von 2015 als ein christliches Phänomen darzustellen. Solchen Aussagen scheinen zu optimistische Einschätzungen des Stellenwerts des christlichen Glaubens in unserer Gesellschaft zugrunde zu liegen. Schließlich sind die Christen in Deutschland inzwischen nur noch eine schrumpfende Größe, seit Jahrzehnten nimmt der Anteil der Kirchenmitglieder an der Gesamtgesellschaft ab. Für den Osten des Landes hat sich längst eine »Kultur der Konfessionslosigkeit« etabliert: 67 Prozent der Menschen gehören dort keiner Religionsgemeinschaft an. Im Westen sind zwar vier von fünf Deutschen Mitglied einer solchen Gemeinschaft, doch nur ein geringer Teil von ihnen zählt zu den Kirchgängern. Zudem sei selbst bei kirchennahen Frauen und Männern, so hat es der Historiker Thomas Großbölting jüngst diagnostiziert, das Wissen über die eigene Religion sehr begrenzt, und nur eine Minderheit sei überhaupt darum bemüht, »mithilfe des Glaubens ein sinnvolles Leben zu führen«.15