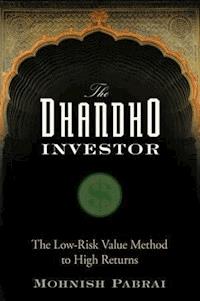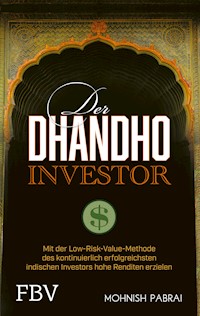
13,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FinanzBuch Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
In Der Dhandho-Investor legt Mohnish Pabrai auf unkomplizierte und unterhaltsame Weise die Grundlagen des erfolgreichen Value Investing dar. Die Dhandho-Methode erweitert die bahnbrechenden Prinzipien des Value Investing von Benjamin Graham, Warren Buffett und Charlie Munger um die Weisheiten und Erfahrungen der erfolgreichsten indischen Händler und Geschäftsleute. Die Leser werden in wichtige und leicht zugängliche Value-Investing-Konzepte eingeführt und lernen ganz praktisch, über die Anwendung der Kelly-Formel in unterbewertete Aktien zu investieren. Jeder Anleger, der sich das Konzept des Dhando-Investors zu eigen macht, hat die einmalige Chance einer beträchtlichen Steigerung seiner Fähigkeit, die Märkte zu durchschauen und Erfolge einzufahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 244
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
MOHNISH PABRAI
DER DHANDHO-INVESTOR
Mit der Low-Risk-Value-Methode des kontinuierlich erfolgreichsten indischen Investors hohe Renditen erzielen
MOHNISH PABRAI
DER DHANDHO-INVESTOR
Mit der Low-Risk-Value-Methode des kontinuierlich erfolgreichsten indischen Investors hohe Renditen erzielen
FBV
Bibliografische Information der Deutschen NationalbibliothekDie Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie. Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
1. Auflage 2023
© 2023 by FinanzBuch Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Wichtiger Hinweis
Die im Buch veröffentlichten Ratschläge wurden von Verfasser und Verlag sorgfältig erarbeitet und geprüft. Eine Garantie kann dennoch nicht übernommen werden. Ebenso ist die Haftung des Verfassers beziehungsweise des Verlages und seiner Beauftragten für Personen-, Sach- und Vermögensschäden ausgeschlossen.
Die englische Originalausgabe erschien 2007 bei John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey unter dem Titel The Dhandho Investor. © 2007 by Mohnish Pabrai. All rights reserved.
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Übersetzung: Maria Bühler
Korrektorat: Rainer Weber
Umschlaggestaltung: Marc-Torben Fischer in Anlehnung an das Original
von Michael Freeland
Umschlagabbildung: © Jan Butchofsky/Getty Images
Satz: Ortrud Müller, Die Buchmacher, Köln
eBook by tool-e-byte
ISBN Print 978-3-95972-666-5
ISBN E-Book (PDF) 978-3-98609-281-8
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-98609-282-5
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.finanzbuchverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Inhalt
Danksagung
Kapitel 1Geschäfte ohne Risiko: Die Dhandho-Philosophie für Motelbetreiber
Kapitel 2Eine Variation des Dhandho-Konzepts
Kapitel 3Dhandho-Investor Richard Branson
Kapitel 4Das Dhandho-Konzept in der Stahlbranche
Kapitel 5Die Eckpunkte der Dhandho-Philosophie
Kapitel 6Dhandho-Lektion Nr. 1Investieren Sie in bereits bestehende Unternehmen
Kapitel 7Dhandho-Lektion Nr. 2Investieren Sie in Unternehmen, die Sie verstehen
Kapitel 8Dhandho-Lektion Nr. 3Investieren Sie in Not leidende Unternehmen in Not leidenden Branchen
Kapitel 9Dhandho-Lektion Nr. 4Investieren Sie in Unternehmen mit einem dauerhaften Wettbewerbsvorteil
Kapitel 10Dhandho-Lektion Nr. 5Platzieren Sie nur wenige Wetten, die umso höhere Gewinne versprechen
Kapitel 11Dhandho-Lektion Nr. 6Nutzen Sie Arbitragechancen
Kapitel 12Dhandho-Lektion Nr. 7Eine Sicherheitsmarge muss sein – immer!
Kapitel 13Dhandho-Lektion Nr. 8Investieren Sie in Unternehmen mit niedrigem Risiko und hoher Ungewissheit
Kapitel 14Dhandho-Lektion Nr. 9Investieren Sie lieber in Nachahmer als in Erfinder
Kapitel 15Abhimanyus Dilemma oder die Kunst des Ausstiegs
Kapitel 16Indexstrategie oder keine Indexstrategie, das ist hier die Frage
Kapitel 17Arjuna und die Konzentration auf das Ziel: Anlagetipps von einem großartigen Krieger
Anmerkungen
Für meine drei Gurus:Warren Buffett, Charlie Munger und Om Pabrai
Danksagung
IN DEM VORLIEGENDEN BUCH, Der Dhandho-Investor, sind Gedanken und Ideen zusammengefasst, auf die ich bei meiner Lektüre, im Zusammensein mit meinen Freunden und bei vielen anderen Gelegenheiten gestoßen bin. Ich selbst entwickle eigentlich nur wenig eigene Konzepte. So gut wie alles, was in diesem Buch enthalten ist, geht also auf andere Menschen zurück.
Ohne Warren Buffett gäbe es auch keinen Pabrai Funds und ganz gewiss nicht dieses Buch. Der Einfluss, den Warren Buffett und Charlie Munger auf mich ausübten, kann gar nicht genug betont werden. Auf die ein oder andere Weise haben sie praktisch jede Seite dieses Buches geprägt. Ich werde immer in ihrer Schuld stehen, weil sie mich über Jahrzehnte selbstlos an ihrer unschätzbaren Weisheit teilhaben ließen. Danke, Warren und Charlie.
Meinem lieben Freund Pat Fitzgerald und seiner Tochter Michelle danke ich für ihren Vorschlag, dieses Buch zu schreiben. Es war kein Vorhaben, das von Anfang an auf meiner To-do-Liste stand. Ich weiß ihre Hartnäckigkeit und ihre Ermutigung zu schätzen. Michelle hat sich sehr stark persönlich für dieses Projekt interessiert und ich bin ihr für all ihre Bemühungen dankbar. Meiner Herausgeberin bei Wiley, Debra Englander, möchte ich für ihre vielen hervorragenden Vorschläge danken. Es war mir ein großes Vergnügen, mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von Wiley zusammenzuarbeiten, einschließlich Greg Friedman und Christina Verigan.
Meine Kolleginnen und Kollegen bei der Young Presidents’ Organization (YPO) begleiteten mich auf jedem Schritt meines Weges. Mein Dank gilt Terry Adams, Andy Graham, Dave House, Michael Maas, Mark Moses, Jay Reid und Ryan Rieches. In den vergangenen neun Jahren bereicherte die YPO mein Leben ungemein. Ohne meine Mitgliedschaft bei der YPO würde es wahrscheinlich weder den Pabrai Funds noch dieses Buch geben. Es ist so gut wie unmöglich, mehr zu geben, als man von der YPO bekommt. Ich werde dieser erstaunlichen Organisation immer zu Dank verpflichtet sein.
Den Begriff »Dhandho« hörte ich zum ersten Mal aus dem Munde von Ajay Desai, meinem Zimmergenossen am College. Wir verloren uns für etwa ein Jahrzehnt aus den Augen und freuten uns beide sehr, als wir uns wieder trafen und unsere anregenden Dhandho-Gespräche wieder aufnehmen konnten. Danke, Ajay.
Meine wunderbare Büromanagerin bei Pabrai Funds, Isabelle Secor, und Marybeth Nagy von Source4 leisteten hervorragende Arbeit beim Lektorat des Manuskripts. Danke, Marybeth und Isabelle. Mein Dank gilt auch Whitney Tilson für all ihre Verbesserungsvorschläge. Mein Freund Shai Dardashti bestärkte mich darin, die so wichtigen Bemerkungen über das Zurückgeben in das Buch aufzunehmen. Danke, Shai. Mein guter Freund und Nachbar Samir Doshi machte mich mit Manilal Chaudhuri bekannt und ermöglichte so das Gespräch mit Manilal. Schließlich gebührt auch Manilal Dank dafür, dass er sich in seinem vielbeschäftigten Alltag Zeit für unser Treffen und unser Gespräch genommen hat.
Meine Töchter Monsoon und Momachie waren von Anfang an begeistert von meinem Plan, ein Buch zu schreiben. Während ich daran arbeitete, hatte ich sie und ihre künftigen Kinder und Enkelkinder im Kopf. Der Gedanke, dass eines Tages einer meiner Urenkel ein verstaubtes Exemplar von Der Dhandho-Investor aus dem Regal ziehen und es lesen könnte, bereitet mir großes Vergnügen. Ich werde das wahrscheinlich nicht mehr erleben, aber allein der Gedanke daran hat mich - mehr als alles andere - jeden Tag von Neuem motiviert.
Mein verstorbener Vater Om Pabrai begann mir bereits im Kindesalter unschätzbar wertvolle Dhandho-Lektionen zu erteilen. Und er hörte nie auf damit. Ich hatte praktisch schon einen MBA in der Tasche, bevor ich auf das College ging. Ich wende seine Lektionen täglich an. Danke, Papa. Ich vermisse dich. Auch die Überschlagsrechnungen meiner Mutter sind mir immer noch nützlich, wenn ich ein Unternehmen schnell analysieren will.
Meine beste Freundin und Ehefrau, Harina Kapoor, hat all meine Unterfangen immer rückhaltlos unterstützt. Sie las das Manuskript als Erste. Danke, Janaam. Ich liebe dich mehr, als du je wissen wirst. Das Leben ist eine Reise und die Reise ist das Ziel. Unzählige Menschen haben diese Reise zu einem fantastischen Abenteuer für mich gemacht. Jedem Einzelnen von ihnen schulde ich meinen Dank.
Kapitel 1Geschäfte ohne Risiko:Die Dhandho-Philosophie für Motelbetreiber
ETWA EIN PROZENT DER Bevölkerung der Vereinigten Staaten ist indischer Herkunft. Das sind rund drei Millionen Menschen. Von diesen drei Millionen stammt ein relativ geringer Teil aus dem indischen Bundesstaat Gujarat, dem Geburtsort Mahatma Gandhis. Eine noch viel kleinere Gruppe der Gujaratis, die Patels, kommt aus einem winzigen Gebiet in Süd-Gujarat. Somit ist weniger als jeder fünfhundertste Amerikaner ein Patel. Umso erstaunlicher ist es, dass über die Hälfte aller Motels im gesamten Land den Patels gehören und von ihnen geführt werden. Noch bemerkenswerter: Vor nur 35 Jahren gab es praktisch keine Patels in den Vereinigten Staaten. Sie kamen erst Anfang der 70er-Jahre als Flüchtlinge ins Land, ohne Bildung und ohne Vermögen. Ihr gebrochenes Englisch verbesserte ihre Ausgangsposition nicht gerade. Doch trotz dieser äußerst schwierigen Anfänge schafften die Patels einen kometenhaften Aufstieg. Sie besitzen heute in den Vereinigten Staaten Motels im Wert von über 40 Milliarden Dollar, bezahlen über 725 Millionen Dollar Steuern jährlich und beschäftigen fast eine Million Menschen. Wie gelang es dieser kleinen und mittellosen ethnischen Gruppe, aus dem Nichts heraus ein solches Imperium aufzubauen? Es gibt dafür eine Erklärung, die sich in einem Wort ausdrücken lässt: Dhandho.
Dhandho (dhund-doe ausgesprochen) ist ein Wort aus der Gujarati-Sprache. Dhan geht auf den aus dem Sanskrit stammenden Begriff Dhana für Wohlstand zurück. Dhan-dho bedeutet wörtlich übersetzt »Bemühungen, um Wohlstand zu schaffen« und wird einfach für »Geschäfte« verwendet. Was sind Geschäfte sonst, wenn nicht das Bemühen darum, Wohlstand zu schaffen?
Aber das Dhandho-Konzept erhält eine noch viel konkretere Bedeutung, wenn man es auf die Strategie der Patels bezieht, mit niedrigem Risiko hohe Erträge zu erzielen. Ansonsten gilt ja gemeinhin der Lehrsatz, dass hohe Renditen zwangsläufig mit hohen Risiken verbunden sind. Dhandho stellt diese Annahme jedoch auf den Kopf: Mit Dhandho wird das Risiko minimiert und der Ertrag maximiert. Für einen typischen Patel ist es so selbstverständlich wie das Atmen, dass ein geschäftliches Vorhaben risikolos ist, wenn die Dhandho-Philosophie angewendet wird. Dhandho lässt sich folglich als das Bemühen zusammenfassen, Wohlstand zu schaffen, ohne Risiken einzugehen.
Nicht nur Unternehmer sollten sich eine Scheibe von der Dhandho-Philosophie der Patels abschneiden, sondern auch die Zielgruppe dieses Buches - Anleger und Vermögensverwalter. Dhandho ist eine Investmentphilosophie, die ihresgleichen sucht. Wenn ein Anleger für praktisch risikofreie Anlagen immer wieder mit enormen Renditen belohnt wird, lassen sich erstaunliche Ergebnisse erzielen. Nur mit Dhandho lässt sich erklären, wie die Patels in den vergangenen 30 Jahren ein solches Vermögen anhäufen konnten.
Aber ich greife vor. Lehnen Sie sich zurück, entspannen Sie sich und öffnen Sie sich für die Botschaft dieses Buches. Sie beginnen gerade eine bemerkenswerte Reise, die sich für Sie hoffentlich genauso lohnen wird, wie es bei mir und Generationen von Patel-Geschäftsleuten der Fall war.
Gujarat liegt am Arabischen Meer und verfügt über eine lange, landschaftlich reizvolle Küste mit mehreren Naturhäfen. Der Wendekreis des Krebses verläuft direkt durch diesen Bundesstaat. Im Lauf der Jahrhunderte war Gujarat immer ein idealer Ort für den Handel mit benachbarten asiatischen und afrikanischen Ländern. In seiner reichen Geschichte erwies sich Gujarat als ein Schmelztiegel vieler verschiedener Kulturen. Im zwölften Jahrhundert bot es Zuflucht für die Parsis, die vor der religiösen Verfolgung im Iran flohen und in Gujarat freundliche Aufnahme fanden. In der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts kamen die Ismailis aus dem Iran an. Mehrere Jahrhunderte lang war es für die Gujaratis ganz selbstverständlich, zu ihren asiatischen und afrikanischen Nachbarn zu reisen und Handel mit ihnen zu treiben.
Die Patels waren ursprünglich als Patidars bekannt, was sich ungefähr mit »Vermieter« übersetzen lässt. In den meisten Dörfern in Gujarat gab es einen vom Herrscher ernannten Patidar, der die Grundsteuern eintrieb, für die Sicherheit sorgte und die Landwirtschaft organisierte. Im Mittelalter wurden die Patidars wegen ihrer Führungsqualitäten und ihres landwirtschaftlichen Könnens ausgewählt. Für gewöhnlich hatten die Patels große Familien. Aber da das Land für jeden Sohn in immer kleinere Parzellen geteilt wurde, erwies es sich als immer schwieriger, mit der Landwirtschaft den Lebensunterhalt zu verdienen. Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts wanderten deshalb zahlreiche Ismailis und Patels aus Gujarat in Länder wie Uganda aus. Sie ließen sich als Händler nieder oder verpflichteten sich als Arbeiter zum Bau der Eisenbahnen.
Die Patels und die Ismailis waren schon immer gute Geschäftsleute gewesen. In den folgenden Jahrzehnten übernahmen sie (mit ihren Dhandho-Methoden) die Kontrolle über weite Teile der Geschäftswelt in Uganda. Im Jahr 1972 jedoch ergriff General Idi Amin als Diktator die Macht. Er erklärte, dass »Afrika den Afrikanern« gehöre und Nicht-Afrikaner das Land verlassen müssten. Amin war schon deshalb kein großer Verehrer der Patels, weil sie den größten Teil der Wirtschaft kontrollierten. Die Tatsache, dass die meisten »Nicht-Afrikaner« wie die Patels und die Ismailis in Uganda geboren waren, dort seit Generationen lebten und kein anderes Zuhause hatten, war für Amin belanglos. Für ihn war es einfach: Afrika gehörte den Afrikanern.
Amin entzog allen Asiaten die Aufenthaltsgenehmigungen, unabhängig davon, ob sie eine Heimat hatten, in die sie zurückkehren konnten. Der ugandische Staat beschlagnahmte ihre Unternehmen und verstaatlichte diese ohne jede Entschädigung. Insgesamt 70.000 Gujaratis verloren praktisch ihr ganzes Vermögen und wurden Ende 1972 aus dem Land vertrieben.
In den Jahren 1972 und 1973 gab es auf der Welt mehrere Brennpunkte, die eine Rolle für das künftige Schicksal dieser verwaisten Patels spielten. Die Gründung von Bangladesch im Jahr 1971 und der Krieg mit Pakistan um dessen Unabhängigkeit hatten bereits zu einer ernsthaften Flüchtlingskrise in Indien geführt. Millionen verarmter Bangladescher waren nach Indien geflohen. In der Folge weigerte sich die indische Regierung, den aus Uganda vertriebenen Flüchtlingen indischer Herkunft ein Recht zur Einreise nach Indien zu gewähren.
Außerdem fiel die Vertreibung der Patels durch Idi Amin mit dem Ende des Vietnamkriegs zusammen, der den Vereinigten Staaten einen starken Zustrom vietnamesischer Flüchtlinge bescherte. Präsident Nixon und Außenminister Kissinger waren mit der Situation in Uganda durchaus vertraut und hatten Mitleid mit dem Schicksal der Patels, konnten aber nur eine begrenzte Anzahl von Flüchtlingen indischer Herkunft aufnehmen. Als »Mitglieder des Commonwealth« war es der überwiegenden Mehrheit der Patels und Ismailis erlaubt, sich in England und Kanada niederzulassen. Einige Tausend Familien wurden auch von den Vereinigten Staaten aufgenommen.
Die ersten Patels, die in den Vereinigten Staaten Zuflucht fanden, betätigten sich in der Motelbranche. Tausende von Patels, die später ankamen, folgten ihnen und wurden ebenfalls Motelbetreiber. Warum ausgerechnet Motels? Und warum entschieden sich praktisch alle Patels für dieselbe Branche?
Untersucht man die Geschichte ethnischer Gruppen, die in fremde Länder auswandern, kristallisiert sich ein Muster heraus: So wurden in Chicago viele der ersten irischen Einwanderer Polizeibeamte, während die meisten Hausmädchen Polinnen waren. In New York City dominierten Koreaner das Lebensmittelgeschäft, Chinesen betrieben viele Reinigungen, und Sikhs und Pakistani fuhren die meisten Taxis. Bei den Mietwagenfirmen am San Jose International Airport Kalifornien bietet sich ein kurioser Anblick, denn dort sind fast nur ältere, Turban tragende Sikhs beschäftigt. In Las Vegas gibt es eine große Bevölkerungsgruppe von osteuropäischen Taxifahrern und die meisten Prostituierten in Dubai stammen aus Osteuropa oder Russland.
Letztlich konzentrieren sich ethnische Gruppen deshalb in bestimmten Berufen, weil Rollenmodelle eine wichtige Rolle bei der Berufswahl spielen. Wenn jemand ein ähnliches Aussehen hat, unter ähnlichen Umständen aufgewachsen ist, derselben Religion angehört, eine vergleichbare Schule besucht hat und ein gutes Auskommen findet, übernimmt er natürlich eine gewisse Vorbildfunktion für andere Einwanderer, die ihre Berufung noch suchen. Groß gewachsene afroamerikanische Kinder in den Wohngegenden mit niedrigem Einkommen sehen regelmäßig groß gewachsene afroamerikanische Männer, die für die NBA spielen und ein Leben in Saus und Braus führen. Sie wissen, dass die Kindheit dieser Basketballstars ihrer eigenen recht ähnlich war. Damit liegt ein enormer Motivationsfaktor vor, sich ins Basketballtraining zu stürzen.
Aber damit ist die Frage noch nicht beantwortet, warum sich die ersten Patels in den Vereinigten Staaten für das Motelgeschäft entschieden. Warum betrieben sie keine Lebensmittelgeschäfte, Wäschereien oder Drogerien? Warum ausgerechnet Motels? Und warum suchten sie sich nicht einfach eine Festanstellung, anstatt sich selbstständig zu machen? Zum Teil liegt die Antwort in einer weiteren demografischen Veränderung, die Anfang der 70er-Jahre in den Vereinigten Staaten stattfand. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam es zu einem enormen Wachstum der Vororte und das Schnellstraßennetz zwischen den Bundesstaaten wurde in großem Maßstab ausgebaut. Das Automobil war in der Mittelklasse zum Standard geworden und von Familien geführte Motels schossen entlang der neu gebauten Fernstraßen wie Pilze aus dem Boden. Das Ölembargo der Araber im Jahr 1973 und eine falsche amerikanische Wirtschaftspolitik (Preis- und Lohnkontrollen) rissen das ganze Land in eine tiefe Rezession.
Das Motelgeschäft ist in starkem Maß von der Konjunktur abhängig. Folglich ließ die Rezession, gekoppelt mit den exorbitanten Benzinpreisen, die Buchungszahlen in den Keller fallen. Viele kleine, unbedeutende Motels wurden von den Banken zwangsvollstreckt oder unter Wert verkauft. Gleichzeitig wurden die Kinder dieser alten Motelbesitzerfamilien erwachsen und fanden genügend Möglichkeiten außerhalb des Motelgeschäfts, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Sie zogen in Scharen davon, um ihr Glück woanders zu suchen.
Papa Patel
Wir schreiben das Jahr 1973. Papa Patel wurde aus Kampala, Uganda, vertrieben und landete mit seiner Frau und seinen drei Kindern im Teenageralter irgendwo in den USA. Ihm blieben nur etwa zwei Monate Zeit, um seine Abreise zu planen, und er tauschte sein verbliebenes Vermögen so weit wie möglich in Gold und Devisen, um es aus dem Land zu schmuggeln. Es ist ohnehin nicht viel - nur einige Tausend Dollar. Da er eine Familie zu ernähren hat, versucht er, sich in der neuen Umgebung möglichst schnell zurechtzufinden. Er überlegt sich, dass er mit seinem starken Akzent und gebrochenen Englisch im Supermarkt Lebensmittel zum Mindestlohn verpacken könnte.
Dann sieht Papa Patel ein kleines Motel mit 20 Zimmern, das zum Verkauf steht. Der Preis erscheint ihm sehr niedrig und er kommt ins Grübeln. Die Bank würde ihm wahrscheinlich 80 bis 90 Prozent des Kaufpreises finanzieren. Seine Familie könnte dort wohnen und er würde die Miete sparen. Für den Erwerb des Motels würde er nur einige Tausend Dollar Kapital benötigen. Er sammelt bei sich und seinen engen Verwandten etwa 5000 Dollar ein und kauft das Motel. Dahyabhai Patel, einer der ersten Patels in den Vereinigten Staaten, brachte es auf den Punkt. »Die erforderliche Investition war gering und ich konnte mein Unterkunftsproblem lösen, weil ich [mit meiner Familie] dort leben und arbeiten konnte.«1
Papa Patel bezieht mit seiner Familie einige Räume des Motels, um nicht noch zusätzlich Miete bezahlen müssen. Da keine Arbeitswege anfallen, ist auch der Unterhalt für das Auto sehr günstig. Selbst das kleinste Motel benötigt eine rund um die Uhr besetzte Rezeption und jemanden, der die Zimmer sauber macht und die Wäsche wäscht. Das sind mindestens vier Menschen, die jeweils acht Stunden arbeiten. Papa Patel entlässt alle angestellten Kräfte. Gemeinsam mit seiner Frau kümmert er sich um das Geschäft und wird abends, an den Wochenenden und in den Ferien von seinen Kindern unterstützt. Dahyabhai Patel sagte im Rückblick auf diese Anfänge: »Ich war mein eigener Rezeptionist, Schreiner, Klempner, Zimmermädchen, Elektriker und vieles andere mehr.«2 Da Papa Patel also keine Angestellten bezahlen muss und die Ausgaben streng kontrolliert, hat sein Motel die niedrigsten Betriebskosten in der Gegend. Er bietet unschlagbar günstige Zimmerpreise an und erzielt dennoch gleich viel oder noch höhere Erträge je Zimmer als sein Vorgänger und seine Konkurrenten. Folglich wird sein Motel häufiger gebucht und seine Gewinne sind überdurchschnittlich hoch. Seine Konkurrenten dagegen müssen zusehen, wie ihre Auslastung sinkt. Der Druck auf die Zimmerpreise wächst. Ihre Kostenstrukturen verbieten es ihnen jedoch, sich den Preisen von Patels Motel anzunähern. Sie befinden sich in einer Spirale sinkender Auslastung und sinkender Gewinne.
Der typische Patel ist Vegetarier und pflegt einen bescheidenen Lebensstil. Da die meisten Restaurants in den Vereinigten Staaten in den 70er-Jahren keine vegetarischen Gerichte anbieten, ist es ohnehin naheliegend - und viel preiswerter -, zu Hause zu essen. Die Patel-Familien sind Tag und Nacht mit ihrer Arbeit im Motel beschäftigt und haben wenig Zeit für Freizeitaktivitäten. Folglich sind ihre gesamten Lebenshaltungskosten enorm niedrig. Mit einem einzigen Auto - meist einer billigen Blechkiste -, ohne Belastungen durch Miete, Gas und Strom und ohne Kosten für Arbeitswege, Restaurantbesuche, Urlaub oder Freizeitvergnügungen kommt Papa Patels Familie problemlos mit weniger als 5000 Dollar jährlich aus.
Die Preise sind in den 70er-Jahren weit niedriger als heute - der Mindestlohn liegt bei nur 1,60 Dollar. Wenn Papa und Mama Patel jeweils eine Vollzeitstelle annehmen würden, könnten sie bestenfalls ein Jahreseinkommen von etwa 6000 Dollar erzielen. Kaufen sie dagegen ein Motel mit 20 Zimmern zu dem äußerst günstigen Preis von 50.000 Dollar, leisten darauf eine Anzahlung von 5000 Dollar und finanzieren den Rest, erzielen sie selbst mit Übernachtungspreisen von 12 bis 13 Dollar und einer durchschnittlichen Auslastung von 50 bis 60 Prozent einen Jahresumsatz von 50.000 Dollar.
Anfang der 70er-Jahre, als Staatsanleihen eine Rendite von etwa 5 Prozent abwerfen, finanzieren die meisten Banken den Kauf eines Motels sehr bereitwillig zu einem Zinssatz von 10 bis 12 Prozent und nehmen die Immobilie als Sicherheit. Mr. Patel zahlt jährlich etwa 5000 Dollar Zinsen, 5000 Dollar Tilgung und weitere 5000 bis 10.000 Dollar für Motelbedarf, Instandhaltung und Gas, Wasser und Strom. Die Ausgaben liegen damit insgesamt unter 20.000 Dollar. Selbst wenn die Familie weitere 5000 Dollar jährlich für den Lebensunterhalt aufwendet (ein hoher Betrag im Jahr 1970), bleiben Papa Patel nach Abzug aller Steuern und der Lebenshaltungskosten über 15.000 Dollar jährlich übrig. Wären die 5000 Dollar von einem anderen Patel geliehen gewesen, hätte er sie in vier Monaten vollständig zurückzahlen können. Er könnte sogar überlegen, ob er die Hypothek für das Motel in nur drei Jahren zurückzahlt.
Die jährliche Rendite auf das eingesetzte Kapital von 5000 Dollar liegt bei erstaunlichen 400 Prozent (20.000 Dollar jährlicher Ertrag - 15.000 Dollar Cashflow und 5000 Dollar Tilgung). Borgt er die 5000 Dollar von einem anderen Patel, ist die Rendite auf das eingesetzte Kapital sogar unbegrenzt: Er setzt 0 Dollar ein und erzielt jährlich 20.000 Dollar. Vielleicht wenden Sie nun ein: Das ist alles schön und gut, aber was geschieht, wenn die Geschäfte nicht laufen?
Für seinen ersten Motelkauf muss Papa Patel nicht nur die Immobilie als Sicherheit verpfänden, sondern wahrscheinlich auch eine persönliche Garantie an den Kreditgeber abgeben. Aber da Papa Patel bestenfalls 5000 Dollar besitzt, ist eine persönliche Garantie nichts wert. Wenn er den Kredit nicht mehr bedienen kann, könnte die Bank nur die Immobilie übernehmen, denn neben dem Motel besitzt er kein weiteres Vermögen. Die Bank ist aber nicht unbedingt daran interessiert, das Motel zu übernehmen und zu betreiben, da sie nicht über die notwendigen Fähigkeiten und Kenntnisse verfügt. Es wäre für sie also sehr schwer, ein verlustbringendes Motel zu verkaufen und ihre Forderungen einzutreiben.
Es ist ganz einfach: Kann ein Patel das Motel nicht rentabel betreiben, dann kann es niemand. Also sollte die Bank tunlichst die Zusammenarbeit mit Papa Patel suchen, um das Motel in die schwarzen Zahlen zu bringen. Sie wird es folglich vorziehen, erneut über die Konditionen zu verhandeln und Papa Patel dabei zu unterstützen, die Wende herbeizuführen. Sie könnte beispielsweise einen Aufschub von einigen Monaten für die Zins- und Tilgungszahlungen gewähren, bis sich die allgemeine Wirtschaftslage wieder bessert. Vielleicht hebt sie dazu den Kreditzins an, um dem eigenen Risiko Rechnung zu tragen. Jedenfalls wird Papa Patel das Motel weiter betreiben, er wird dort weiter mit seiner Familie wohnen und er wird alles geben, um es zu schaffen - denn er hat keine Wahl. Entweder erzielt er mit dem Motel bald Gewinne oder er geht pleite und verliert sein Dach über dem Kopf.
An dieser Stelle sei daran erinnert, dass es sich bei dem Motel grundsätzlich um ein solides Geschäftsmodell handelt, mit dem sich viele Jahre lang gute Gewinne erwirtschaften ließen. Ein Motel zu betreiben ist kein Hexenwerk. Es handelt sich um ein Geschäft, bei dem ein Billiganbieter über einen unschlagbaren Wettbewerbsvorteil verfügt, und niemand kann ein Motel preiswerter betreiben als Papa Patel. Das Motelgeschäft entwickelt sich im Gleichklang mit der allgemeinen Wirtschaftslage. Irgendwann wird die Konjunktur wieder anspringen, die Rückstände bei der Bank werden beglichen und alle sind zufrieden - am meisten Papa Patel.
Sehen wir uns diese Investition als eine Wette an. Dann sind drei Ergebnisse denkbar.
Möglichkeit Nr. 1: Die Investition von 5000 Dollar bringt eine auf Jahresbasis berechnete Rendite von 400 Prozent ein. Es wird unterstellt, dass diese Entwicklung zehn Jahre anhält und das Unternehmen für denselben Preis, zu dem es gekauft wurde, veräußert wird (50.000 Dollar). Dies ist mit einer Anleihe vergleichbar, die jährlich 300 Prozent Zinsen einbringt und bei der die letzte Zinszahlung im Jahr 10 bei 900 Prozent liegt. Dies entspricht einer auf Jahresbasis umgerechneten Rendite von über 50 Prozent für zehn Jahre. Der diskontierte Cashflow wird bei einem angenommenen Abzinsungssatz von 10 Prozent in Tabelle 1.1 dargestellt.
Möglichkeit Nr. 2: Die Wirtschaft driftet in eine schwere Rezession und die Geschäfte laufen mehrere Jahre lang sehr schlecht. Die Bank setzt sich mit Herrn Patel zusammen und verhandelt wie oben beschrieben über die Kreditbedingungen. Herr Patel erzielt fünf Jahre lang eine Rendite von null. Als die Konjunktur wieder anzieht, beginnt er, jährlich 10.000 Dollar an überschüssigem freiem Cashflow zu erzielen (200 Prozent Rendite jährlich nach fünf Jahren). Das Motel wird im Jahr 10 zum ursprünglichen Kaufpreis verkauft. Jetzt ist die Investition mit einer Anleihe vergleichbar, die fünf Jahre lang keine Zinsen und dann fünf Jahre lang 200 Prozent Zinsen mit einer abschließenden Zinszahlung von 900 Prozent einbringt (siehe Tabelle 1.2). Dies entspricht einer auf Jahresbasis umgerechneten Rendite von über 40 Prozent für zehn Jahre.
Tabelle 1.1: Darstellung des diskontierten Cashflows im bestmöglichen Fall für Papa Patel
JahrFreier Cashflow (in US-Dollar)Barwert des künftigen Cashflows (in Mio. US-Dollar)Überschüssige Liquidität 0115.00013.636215.00012.397315.00011.270415.00010.245515.0009.314615.0008.467715.0007.697815.0006.998915.0006.3611015.0005.78310Verkaufspreis 50.00019.277Summe 111.445Tabelle 1.2: Analyse des diskontierten Cashflows im suboptimalen Fall für Papa Patel
JahrFreier Cashflow (in US-Dollar)Barwert (in Mio. US-Dollar) des künftigen CashflowsÜberschüssige Liquidität 0100200300400500615.0006.645715.0005.131815.0004.665915.0004.2401015.0003.85410Verkaufspreis 50.00019.277Summe 42.812Möglichkeit Nr. 3: Es tritt eine sehr schwere Rezession ein und die Geschäfte laufen katastrophal. Herr Patel kann seinen Kredit nicht mehr bedienen, die Bank leitet die Zwangsvollstreckung ein und Herr Patel verliert seine Investition. Die auf Jahresbasis umgerechnete Rendite beträgt 100 Prozent.
Diese drei Möglichkeiten decken letztlich das gesamte Risikospektrum ab. Wir nehmen für die erste Möglichkeit eine Wahrscheinlichkeit von 80 Prozent und für die zweite und dritte Möglichkeit eine Wahrscheinlichkeit von jeweils 10 Prozent an. Dies sind sehr vorsichtige Schätzungen, denn die Chance, dass das Motel weit schlechter als vorhergesagt läuft, liegt bei 1:5, auch wenn es zu einem sehr günstigen Preis gekauft und von einem hervorragenden und sehr kostenbewussten Betreiber geführt wurde. Wir nehmen auch unrealistischerweise an, dass der Wert des Motels und die Zimmerpreise über zehn Jahre lang nicht ansteigen. Aber selbst dann liegt die nach Wahrscheinlichkeit gewichtete, auf Jahresbasis umgerechnete Rendite noch bei deutlich über 40 Prozent. Der erwartete Barwert dieser Investition beträgt etwa 93.400 Dollar (0,8 × 111.445 Dollar + 0,1 × 42.812 Dollar). Aus Sicht von Papa Patel liegt die Chance bei 10 Prozent, dass er 5000 Dollar verliert, und bei 90 Prozent, dass er am Ende über 100.000 Dollar hat (bei einer Chance von 80 Prozent, dass er nach zehn Jahren über 200.000 Dollar verfügt). Für mich klingt das nach einer sehr sicheren Wette.
Wenn Sie auf der Pferderennbahn die Chance hätten, Ihren Einsatz mit einer Wahrscheinlichkeit von 90 Prozent zu verzwanzigfachen, während das Risiko eines Verlusts des Einsatzes nur bei 10 Prozent läge, würden Sie diese Wette abschließen? Ganz bestimmt! Sie würden diese Wette immer und immer wieder abschließen und am besten einen großen Teil Ihres Vermögens einsetzen. Der Einsatz ist zwar nicht völlig risikofrei, aber das Risiko sehr niedrig und die Rendite sehr hoch. Bei Kopf gewinnen Sie, bei Zahl verlieren Sie nicht viel!
Der Skeptiker in Ihnen ist vielleicht noch nicht überzeugt, dass das Risiko wirklich niedrig ist. Vielleicht halten Sie die Möglichkeit einer Pleite immer noch für sehr real, wenn Sie das gesamte Vermögen einsetzen (wie es bei Papa Patel der Fall ist).
Papa Patel setzt tatsächlich alles auf eine Karte, aber er hat noch einen Trumpf im Ärmel. Wenn der Kreditgeber die Zwangsvollstreckung einleitet und er das Motel verliert, könnten seine Frau und er eine Festanstellung annehmen. Sie könnten nicht mehr 40 Stunden, sondern 60 Stunden in der Woche arbeiten und beispielsweise Lebensmittel einpacken und möglichst viel sparen. Bei einem Mindestlohn von 1,60 Dollar im Jahr 1973 verdienen sie 9600 Dollar jährlich. Nach Steuern können sie leicht 2000 bis 4000 Dollar jährlich beiseitelegen. Bereits nach zwei Jahren würde Papa Patel wieder auf der Bildfläche erscheinen, ein weiteres Motel kaufen und es noch einmal versuchen.
Die Wahrscheinlichkeit, dieses Spiel zweimal hintereinander zu verlieren, liegt bei 1:100. Umgekehrt beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass die Wette mindestens einmal aufgeht, etwa 99 Prozent. In diesem Fall erzielt Papa Patel eine Rendite von mehr als dem Zehnfachen. Das ist ein enorm niedriges Risiko mit enorm hohen Erträgen. Hier muss man einfach sagen: Bei Kopf gewinnen, bei Zahl aber nicht viel verlieren!
Bei einem so hohen Cashflow schwimmt Papa Patel bald in Geld. Sein Lebensstil ist jedoch nach wie vor bescheiden. Als sein ältester Sohn volljährig wird, übergibt er ihm das Motel. Die Familie kauft ein kleines Haus und sucht sich das nächste Motel, das es betreiben kann.
Dieses Mal ist es ein größerer Betrieb mit 50 Zimmern. Die Familie lebt nicht mehr im Motel, erledigt aber immer noch den größten Teil der Arbeit mit nur wenigen bezahlten Kräften. Das Rezept ist einfach: Die Kosten so niedrig wie möglich halten, die Konkurrenten bei den Zimmerpreisen unterbieten, die Auslastung erhöhen und den freien Cashflow maximieren. Im Lauf der Zeit werden die Motels an Verwandte aus der Sippe der Patels übergeben, während immer mehr neue Motels dazugekauft werden.
Der Erfolg der Patels beruht auf dem Schneeballprinzip. So kamen die eingangs erwähnten Zahlen zustande, wonach sich die Hälfte aller Motels in den Vereinigten Staaten im Eigentum von Patels befindet. Als die Patels den Motelmarkt ausgereizt hatten, begannen sie, höherwertigere Hotels zu kaufen und in verschiedene Geschäfte zu investieren, bei denen sie ihr Betriebsmodell der niedrigen Kosten als unschlagbaren Wettbewerbsvorteil einsetzten. Beispiele sind Tankstellen, Franchise-Unternehmen wie Dunkin’ Donuts oder kleine Lebensmittelgeschäfte (7-Elevens). Manche investierten sogar in Time-Sharing-Wohnanlagen. Der Schneeball rollt weiter - und wird größer und größer.
Kapitel 2Eine Variation des Dhandho-Konzepts
SO INTERESSANT DIE DHANDHO-ERFOLGSSTORY