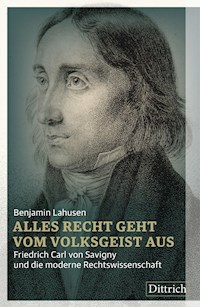26,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. H. Beck
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Kaum beirrt von Bombenkrieg, Kapitulation und alliierter Besatzung liefen Gerichtsverfahren vor und nach 1945 einfach weiter, mit denselben Akteuren, nach den gleichen Regeln. Der Rechtshistoriker Benjamin Lahusen deckt in seiner fulminanten Studie unheimliche Kontinuitäten der deutschen Justiz auf und zeichnet so das eindringliche Bild einer Gesellschaft, die den großen Einschnitt so klein wie möglich hielt. Stuttgart, im September 1944: Das Justizgebäude wird durch neun Sprengbomben und zahlreiche Brandbomben weitgehend zerstört, doch stolz meldet der Generalstaatsanwalt, dass bereits am nächsten Morgen «noch in den Rauchschwaden... eine Reihe von Strafverhandlungen durchgeführt» wurden. Auch andernorts wird der Dienstbetrieb in teils noch brennenden Gebäuden aufrechterhalten, später selbst unter Artilleriebeschuss. Benjamin Lahusen hat sich die Akten zahlreicher Gerichte – darunter des Amtsgerichts Auschwitz – aus den Jahren vor und nach 1945 angesehen und beschreibt höchst anschaulich, wie weder «Endkampf» noch staatlicher Zusammenbruch den juristischen Dienstbetrieb unterbrechen konnten. Er erklärt, warum ein Stillstand der Rechtspflege unter allen Umständen vermieden werden sollte, und zeigt, wie nach dem Krieg altgediente Juristen pflichtbewusst das alltägliche Recht des Dritten Reichs so weiterführten, als wäre nichts passiert. Wenn es noch eines Beweises dafür bedarf, dass es 1945 keine «Stunde Null» gab, dann liegt er mit diesem glänzend geschriebenen Buch vor.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Benjamin Lahusen
«Der Dienstbetrieb ist nicht gestört»
Die Deutschen und ihre Justiz 1943–1948
C.H.Beck
Zum Buch
Kaum beirrt von Bombenkrieg, Kapitulation und alliierter Besatzung liefen Gerichtsverfahren vor und nach 1945 einfach weiter, mit denselben Akteuren, nach den gleichen Regeln. Benjamin Lahusen deckt in seiner fulminanten Studie unheimliche Kontinuitäten der deutschen Justiz auf und zeichnet so das eindringliche Bild einer Gesellschaft, die den großen Einschnitt so klein wie möglich hielt.
Stuttgart, im September 1944: Das Justizgebäude wird durch neun Sprengbomben und zahlreiche Brandbomben weitgehend zerstört, doch stolz meldet der Generalstaatsanwalt, dass bereits am nächsten Morgen «noch in den Rauchschwaden … eine Reihe von Strafverhandlungen durchgeführt» wurden. Auch andernorts wird der Dienstbetrieb in teils noch brennenden Gebäuden aufrechterhalten, später selbst unter Artilleriebeschuss. Benjamin Lahusen hat sich die Akten zahlreicher Gerichte – darunter des Amtsgerichts Auschwitz – aus den Jahren vor und nach 1945 angesehen und beschreibt höchst anschaulich, wie weder «Endkampf» noch staatlicher Zusammenbruch den juristischen Dienstbetrieb unterbrechen konnten. Er erklärt, warum ein Stillstand der Rechtspflege unter allen Umständen vermieden werden sollte, und zeigt, wie nach dem Krieg altgediente Juristen pflichtbewusst das alltägliche Recht des Dritten Reichs so weiterführten, als wäre nichts passiert. Wenn es noch eines Beweises dafür bedarf, dass es 1945 keine «Stunde Null» gab, dann liegt er mit diesem glänzend geschriebenen Buch vor.
Über den Autor
Benjamin Lahusen ist Professor für Bürgerliches Recht und Neuere Rechtsgeschichte an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) sowie Leiter der Geschäftsstelle der «Beratenden Kommission im Zusammenhang mit der Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturguts, insbesondere aus jüdischem Besitz». Er schreibt regelmäßig für die ZEIT und gibt bei C.H.Beck die Zeitschrift «Myops» heraus.
Inhalt
Vorwort
Einführung: Außerordentliche Normalität
Papierwelt
Justiz im totalen Krieg
Ius stat: Wenn die Rechtspflege stillsteht
Schnitt-Stelle 1945
Eine Stunde Null gab es nicht
Geteilte Normalität
Von der rohen Gewalt zu den Akten
Zwischen Chaos und Kosmos
1. Die Freuden der Pflicht: Dienstbetrieb im Endkampf
Die Dogmatik des Justitiums
Ius non stat: Die Vermeidung des Stillstands
Luftkrieg und Luftschutz
Schriftgut
Beamtenpflichten: Justizdienst als Kriegsdienst
Der Geschäftsbetrieb und seine Helden
Allerletzte Erledigungen
Fiat iustitia et pereat mundus
2. Das Recht der guten Leute: Auf den Spuren der deutschen Seele
Neustadt, eine Montage
Im Schatten des deutschen Waldes
Germanische Sonne
Fernab des Krieges
Die Rechtswahrer der Provinz
Jahreschronik des Neustädter Strafrechts
Eine Frage der Ehre
Endkampf um die Kehrwoche
Widerstand durch Unterlassen
Rechtsbewährungsprinzip und Wiederverwendung
Das richtige Leben im richtigen
3. Die Parzellierung des Todes: Das Amtsgericht Auschwitz und die Grundbücher der IG Farben
Grund und Buch
Eine Kleinstadt im neuen deutschen Lebensraum
Aufbau Ost
«Ethnische Flurbereinigung»
Juristisches Bodenpersonal
Die Auflassung des Betriebsgeländes
Ein Amtsgericht wird überflüssig
Räumen und Reinwaschen
Grundbuch der Erinnerung
4. Lastenausgleich: Das Sondergericht Aachen und sein letzter Richter
Hans Keutgen: Ein normaler Lebensweg
Der Bilderbuchjurist
Volksschädlinge, Schwarzschlachter, Lebensmittelkartenfälscher
Sonderrichter und Scharfmacher
Die Evakuierung der Stadt
Die Front rückt näher: Ausweichquartiere
Rundreise im Reich
Aachener Normalrichter, bekannte Gesichter
Selbstjustiz: «Weglegen»
Provinzfürst mit kassierter Vergangenheit
Trennungsentschädigung
Rechtsmensch «bis zur eigenen Auflösung»
5. Auf der Flucht: Die Verlagerung der Gerichtsbehörden im Winter 1944/45
Wohin mit dem OLG Stettin?
Übung für den Ernstfall: Parole «Frühlingsfest»
Hoffnung auf Rückkehr: «z.Zt.»
Die Macht des Papiers
Erwartung des Untergangs: «noch»
Wiederaufnahme des Dienstes
Sonder-Sondergerichte
Akten und Stempel: verbrennen, vergraben, vernichten
Gerichte unter Zugzwang
Anschlussverwendung
Weitherzigkeit ist keine juristische Kategorie
Das Ende
6. Zwischen den Jahren: Der Stillstand der Rechtspflege im Sommer 1945
Nichts aus dem Nichts
Die Entreichlichung der Justiz
Geschäftsbetrieb in der Stunde Null
Alliierte Störungen
Neue Volksjuristen im Osten
Altgediente Volljuristen im Westen
Recycling
Rechtshängigkeit: Die Last der Altfälle
Rechtsfriede, endlich
7. Die Abwicklung: Der Krieg und sein langes Ende
Selbstbetrug: Das Justitium von 1945
Die Verbannung des Krieges aus der Rechtsordnung
Alte neue Normalitäten
Abwicklungsstellen
Altpapier
Rechtstransfer aus den verlorenen Gebieten
Rechtsvergleichung oder Ein Gesetz, das niemand mehr braucht
Schlussstriche und geflüchtetes Schriftgut
Epilog Der Traum vom echten Leben
Allmachtsfantasien
Normalität als Strategie
Zivilisation oder Perversion
§
Dank
Anmerkungen
Vorwort
Einführung: Außerordentliche Normalität
1. Die Freuden der Pflicht: Dienstbetrieb im Endkampf
2. Das Recht der guten Leute: Auf den Spuren der deutschen Seele
3. Die Parzellierung des Todes: Das Amtsgericht Auschwitz und die Grundbücher der IG Farben
4. Lastenausgleich: Das Sondergericht Aachen und sein letzter Richter
5. Auf der Flucht: Die Verlagerung der Gerichtsbehörden im Winter 1944/45
6. Zwischen den Jahren: Der Stillstand der Rechtspflege im Sommer 1945
7. Die Abwicklung: Der Krieg und sein langes Ende
Epilog Der Traum vom echten Leben
Dank
Quellen
Ungedruckte Quellen
Amtliche Sammlungen und Quelleneditionen
Personenregister
Ortsregister
Vorwort
«Füsse reinigen, Rauchen verboten, Spucknapfe benutzen», mahnt eine Tafel den Besucher des Amtsgerichts im Berliner Stadtteil Lichtenberg. Eine durchaus einleuchtende Hausordnung: Schon Heinrich Heine bekundete, ihn ängstige ein Land, wo die Menschen «ohne Spucknapf speien»,[1] und Norbert Elias wies der Einhegung des abendländischen Spuckens im Prozess der Zivilisation ein ganzes Kapitel zu.[2] An einem Gericht, das unzweifelhaft ein Bestandteil der Zivilisation ist, sind Spucknäpfe deshalb gut aufgehoben.
Für den, der sich auf dem Weg zum Volljuristen befindet, ist ein Gericht allerdings auch dies: ein Ort quälender Langeweile und lähmender Pedanterie. Nach Klaus Eschens klassischer Beschreibung beschließt die Referendarausbildung die Dressur zum Flohzirkus; danach bleiben die Flöhe auch dann im Kriechgang, wenn sie bereits in die Freiheit entlassen wurden.[3] Für diesen letzten Schritt haben mich höhere Mächte aus der Justizverwaltung ausgerechnet an das zivilisatorisch einwandfreie Amtsgericht Lichtenberg entsendet. Dort musste ich Stunden des Grauens verbringen: Arbeitsgemeinschaft für Referendare im Zivilprozessrecht. In der höchsten Not, als die Uhr noch eine lange Reihe intellektueller Tiefschläge verhieß und sich das Gemüt nur noch für wenige Minuten dagegen gefeit sah, wanderte der verzweifelte Blick durch die kargen Landschaften der Zivilprozessordnung, um dort irgendeine Ablenkung zu finden. Das Wunder geschah: Die Lektüre von § 245, der die «Unterbrechung durch Stillstand der Rechtspflege» im Kriegsfall regelt, brachte die eigenen Vorstellungswelten durcheinander, und für zusätzliche Verwunderung sorgte eine Fußnote – vom Verlag C.H.Beck vor Jahrzehnten gewohnt nutzerfreundlich angebracht –, die den Leser «wegen der Aufnahme von Verfahren, die am 8. 5. 1945 bei Gerichten anhängig waren, an denen deutsche Gerichtsbarkeit nicht mehr ausgeübt wird», an das Zuständigkeitsergänzungsgesetz von 1952 verwies. Damit war das Thema für den nächsten Qualifizierungsschritt gefunden, und über die Frage, welche Gerichtsverfahren in den letzten Kriegswochen überhaupt noch anhängig waren und wer ein Interesse daran gehabt haben könnte, sie 1952 fortzusetzen, ging irgendwann auch das Referendariat zu Ende.
Das war 2009. Seither habe ich viel in Archiven im In- und Ausland gearbeitet und versucht herauszufinden, ob das, was die Langeweile als Thema identifiziert hatte, tatsächlich eines war. Für Juristen ist das an sich kein aufregender Stoff. Auf welche Weise und aus welchen Gründen das Recht sich in Momenten der existentiellen Krise in die Papierwelten des Justitiums zurückzieht, ist den Rechtsarbeitern zumeist herzlich gleichgültig; sie halten den Stillstand der Rechtspflege für ein Relikt aus einer Zeit, in der man noch die Benutzung von Spucknäpfen anmahnen musste. Sinnfällig ist Johann Peter Hebels Geschichte über einen Leinwandweber, der 1817 davon hörte, dass der jüngst eingerichtete Bundestag in Frankfurt sich mit den Angelegenheiten des untergegangenen Reichskammergerichts beschäftige. Weil auch der Weber dort noch einen Prozess anhängig hatte, zog er mit seinen Aktenpaketen nach Frankfurt an der Oder, musste da feststellen, dass Frankfurt am Main gemeint war, und erfuhr, als er dort nach einer abermals beschwerlichen Reise schließlich ankam, dass der Bundestag nur die Renten der ehemaligen Richter regeln wollte, die anhängigen Verfahren aber auf sich beruhen ließ. Der Weber verkaufte daraufhin seine Akten als Altpapier an einen vorüberziehenden Gewürzhändler und reiste vom Erlös zurück in die Heimat, wo er mit leeren Händen ankam. «An meine Frankfurter Reise», so resümierte er tapfer, «will ich denken.»[4] Man wühlt sich durch, das Recht wurstelt mit, und das Leben zieht weiter fröhlich seine Bahnen.
Im Frühjahr 2020 war meine Arbeit fertig und wurde für würdig befunden, als juristische Habilitationsschrift durchzugehen. Für das vorliegende Buch habe ich das Manuskript noch einmal überarbeitet und insbesondere den Apparat stark gekürzt. Dabei sind viele Werke aus den Anmerkungen verschwunden, die ich nicht direkt zitiere, die für die Arbeit gleichwohl wichtig waren. Um außer den zitierten auch die allgemein konsultierten Werke nachvollziehbar zu machen, ist das gesamte Literaturverzeichnis auf meiner Homepage abrufbar (www.rewi.europa-uni.de/de/lehrstuhl/br/rechtsgeschichte/Prof/index.html).
Ich verwende in diesem Buch nur sehr selten eine geschlechtergerechte Sprache. Sensible Ausdrucksformen sind ein wichtiges Anliegen. Hier treffen sie aber auf eine historische Zeit, die sich – neben vielem anderen – auch in Geschlechterfragen durch größte Ungerechtigkeit auszeichnet. Die Akteure dieser Epoche waren, gerade in der Justiz, fast ausnahmslos Männer, und deshalb treten sie hier auch als solche auf; mein Maskulinum ist also ein spezifisches, kein generisches.
Während der Schlussredaktion hat der Weltgeist dem Buch unvermittelt ein verändertes Umfeld beschert. Ein neues Virus zirkulierte, und plötzlich stand die Welt still. Im Februar 2020 raste der Stillstand auf Europa zu, und danach verging kaum ein Tag, an dem nicht ein bis eben noch für aberwitzig gehaltenes Szenario zur neuen Normalität erklärt wurde. Dass eine Epidemie die Rechtspflege zum Erliegen bringen könne, wird in der juristischen Gebrauchsliteratur schon seit der frühen Neuzeit als Standardfall erörtert,[5] genau wie seit langem Einigkeit darüber besteht, dass dieser Fall niemals eintreten wird.[6] Auch 2020 reagierte die Zunft deshalb so, wie sie es seit Jahrhunderten erprobt hatte: Die drohende Störung der juristischen Programme wurde ihrerseits juridifiziert. Zwei Wochen nach der landesweiten Kontaktsperre erschien die erste Fachzeitschrift, in der es die versammelten Rechtsprobleme der neuen Pandemie zu bestaunen gab, die ersten Handbücher folgten rasch.
Dieses Buch handelt davon, wie sich das Recht unbeirrt von den Widrigkeiten seiner Umwelt entfaltet und dabei eine Pandemie und selbst einen Krieg ausblenden kann. Als das Buch bereits fertig war, wurde die Welt erneut eine andere. Am 24. Februar 2022 überschritten die Heere der russischen Föderation die ukrainische Grenze und der Krieg brach los, das heißt, es trat ein Ereignis ein, das dem menschlichen Verstand sowie der menschlichen Natur durchaus zuwider ist. Das Recht als System kann solche Vorgänge verdrängen. Es sei zu Protokoll gegeben: Ein Mensch kann das nicht.
Einführung: Außerordentliche Normalität
Papierwelt
Es beginnt mit dem Papier. Seine Oberfläche ist rau und porös, die Farbe ein schmutziges Beige; der Geruch verortet die Bündel irgendwo im Souterrain der Geschichte. Zahlreiche Risse wandern von den Rändern ins Zentrum, viele Faltstellen sind gebrochen, den Aktendeckeln gelingt es nur mit Mühe, ihr Innenleben zu bändigen. Die Akten haben, das zeigen sie ohne große Umschweife, ihre Zeit gehabt: Sie sind durch Hände gegangen, über Schreibtische gewandert, zwischen Behörden zirkuliert, sie kamen auf Vorlage und Wiedervorlage, wurden angefordert, gelesen, beachtet, umgesetzt, bis ihr normatives Leuchten von den Zeitläuften erst verdunkelt wurde und schließlich ganz erlosch. Ein schroffes «Weglegen» war das Ende. Gemessen an seinen ursprünglichen Zwecken war das Papier jetzt nutzlos geworden; für eine Anstandsfrist blieb es vor Ort, aber irgendwann kam unweigerlich die Übergabe an die amtliche Verwahrstelle für Altpapier: das Archiv. Dort bekam es neue Gebrauchsspuren – Signaturen, Stempel, Aufkleber –, wurde umsortiert – in Büscheln, Schubern, Schriftgutbehältern –, normativ rekonfiguriert – Archivwürdigkeit, Datenschutz, Persönlichkeitsrechte –, bevor der nächste Verwertungskreislauf eröffnet werden konnte. Das Papier beschreibt jetzt die Zeit, in der es einstmals selbst beschrieben wurde, aus den Akten sprudelt die Geschichte. Die Akten komprimieren Zeit, Entstehungszeit, Gebrauchszeit, Erinnerungszeit, Geschichtszeit, ein papiernes Zeitgestrüpp, das sich zwischen heute und gestern schiebt und den Blick zurück leicht in die Irre führt. Es beginnt mit dem Papier. Aber wann?
Justiz im totalen Krieg
Am 26. August 1944 leitete das Reichsjustizministerium an die Oberlandesgerichte einige Überlegungen von Joseph Goebbels weiter, die dieser, soeben zum Reichsbevollmächtigten für den totalen Kriegseinsatz ernannt, unter dem Titel «Lebensstil im totalen Kriege» zusammengetragen hatte. Das öffentliche Leben, monierte Goebbels, trage «mancherorts noch einen teilweise stark friedensmäßigen Charakter», Theateraufführungen versuchten durch eine «möglichst prunkvolle Inszenierung» zu glänzen, Ausstellungen «durch den bei ihrer Eröffnung gereichten Imbiß». Damit müsse es ein Ende haben. Künftig habe jede Form von Geselligkeit – Empfänge, Amtseinführungen, Festwochen, Musiktage, Familienfeiern – zu unterbleiben, wenn sie nicht unmittelbar den Kriegsanstrengungen gelte; es sei fortan eine Ehre, einen sichtbar enthaltsamen Lebensstil zu pflegen und dem Ausland zu demonstrieren, dass von Deutschland Kompromissbereitschaft nicht zu erwarten sei.[1] Die Erfordernisse des Krieges wurden zur Richtschnur für das gesamte Leben. Mit Folgen auf allen Ebenen: Wenige Tage später gab Reichsjustizminister Otto Thierack bekannt, er werde ab sofort auf «Glückwunschschreiben aller Art» verzichten und «lediglich noch Kondolenzschreiben an Angehörige von Gefallenen unterzeichnen».[2] In der Woche darauf traf es die Toiletten, von denen man sich ebenfalls Ressourcen für den Krieg versprach; erbost musste man feststellen, noch immer würden regelmäßig Zeitspüler tätig, die einen Wasserverbrauch auslösten, «der sachlich nicht gerechtfertigt» sei.[3]
Dann waren die Justizbediensteten selbst dran. Um die Bevölkerung in ihrer Arbeitskraft möglichst wenig zu beeinträchtigen, wurden die Einsatzzeiten bei Gericht im Spätsommer 1944 auf wöchentlich sechzig Stunden erhöht und Sonntagsarbeit eingeführt,[4] was freilich schon mit nahendem Winter wieder rückgängig gemacht werden musste, weil es für einen längeren Betrieb am Tage an Heizmitteln und Strom fehlte.[5] Am 1. November notierten die Buchhalter im Ministerium, dass die Richterschaft nun prozentual mehr Gefallene zu beklagen habe als noch im Ersten Weltkrieg.[6] In Danzig ließ man die Guillotine und den Galgen in Kisten verpacken, um sie angesichts der erwarteten sowjetischen Offensive in Sicherheit zu bringen,[7] und in Stettin erhielten die Justizbehörden Ende 1944 eine Weihnachtskarte mit einem aufmunternden Zitat des Kriegsmetaphysikers Heinrich von Treitschke: «Darin eben liegt die Hoheit des Krieges, daß der kleine Mensch ganz verschwindet vor dem großen Gedanken des Staates; die Aufopferung der Volksgenossen füreinander zeigt sich nirgends so herrlich.»[8]
Staat, Volk, Opfer, Herrlichkeit: Wo solche historischen Zentnerwörter zu vergeben sind, da leistet auch die Justiz gerne ihren Beitrag. Sie war gut gerüstet in den Krieg gezogen. Schon 1937 hatten im Ministerium streng vertraulich die entsprechenden Vorbereitungen begonnen, unter dankbarer Verwendung der reichen Erfahrungen aus dem Ersten Weltkrieg.[9] Zu Kriegsbeginn lagen nicht weniger als einunddreißig Gesetze und Verordnungen parat, um die Justiz auf den Kriegsbetrieb umzustellen. Zwei Überlegungen waren dabei maßgeblich. Zum einen sollte die Rechtsverwaltung dem Krieg möglichst nicht in die Quere kommen. Für die Front musste Personal gespart werden, und wer im Einsatz war, erhielt einen umfassenden Rechtsschutz gegen juristische Behelligungen in der Heimat. Zum anderen aber sollte die Zivilbevölkerung auf juristische Dienstleistungen nicht verzichten müssen. Das Recht durfte den Krieg nicht stören, aber umgekehrt durfte auch der Krieg das Recht nicht zu sehr stören. Justus Wilhelm Hedemann, der Grandseigneur der nationalsozialistischen Rechtserneuerung, gab dazu die Parole aus, ein Staat könne sich einen Verzicht auf seine Rechtsordnung «selbst im erbittertsten und großartigsten Kriege» nicht leisten; man wisse aus dem letzten Krieg, dass «das bürgerliche Rechtsleben trotz schwerster Kriegsereignisse unablässig weiterläuft», weshalb die ordentlichen Gerichte «das Palladium der Rechtspflege auf dem Gebiete des bürgerlichen Lebens bleiben» müssten.[10]
Und das blieben sie. Im Februar 1943, nach der Niederlage bei Stalingrad, wurde eine erste große Schließungswelle angekündigt, deren Umsetzung jedoch so viele Bedenken auslöste, dass von den gut 2000 Amtsgerichten am Ende gerade einmal 98 stillgelegt wurden.[11] Kurz darauf erging die Anweisung, alle Rechtsstreitigkeiten zurückzustellen, deren Erledigung «während des Krieges nicht dringlich» sei.[12] Auch diese Maßnahme blieb ohne größere Auswirkungen. Was «kriegsdringlich» bedeute – zumal im Hinblick auf einen Zivilprozess –, wusste niemand. Die Justiz übersetzte «Kriegsdringlichkeit» deshalb mit «Prozessökonomie» und nutzte das Instrument, um die eigene Bedeutung für die Heimatfront herauszustreichen und zugleich das alltägliche Arbeitspensum zu steuern. Aufwendige Verfahren wurden zurückgestellt – betroffen waren 2 bis 4 Prozent aller Eingänge –, der Rest ging weiter wie zuvor.[13]
Freilich war dieser Rest trotzdem mit dem Arbeitsanfall zu Friedenszeiten nicht vergleichbar. Die politischen, wirtschaftlichen und ideologischen Rahmenbedingungen des Krieges hatten die Justizstatistik auf allen Ebenen stark verändert. Die letzten Einberufungen zum Volkssturm schrumpften den Personalbestand von 1939 auf etwa 30 Prozent, von den fast 14.000 Richterstellen waren 1944 nur noch gut 6000 besetzt.[14] Auch die Prozesse wurden immer weniger. Im Strafrecht waren zunächst mehr und mehr Zuständigkeiten an die Sondergerichte gegangen, ein Trend, den man seit 1943 wieder zu entzerren versuchte. Gewöhnliche Kriminalität sollte nach Möglichkeit im Verwaltungswege erledigt oder vor den ordentlichen Gerichten angeklagt werden. Die Strafjustiz war deshalb spürbar zurückgegangen, bekam aber noch immer gut zu tun. Im Zivilrecht dagegen hatte es tiefere Einschnitte gegeben. Vermögensrechtliche Auseinandersetzungen waren um etwa drei Viertel eingebrochen; eine förmliche Explosion von Ehescheidungen und Unterhaltssachen und der kontinuierliche Bestand von Mietstreitigkeiten kompensierten den Rückgang nur zum Teil.
Im Herbst 1944, als Goebbels dem öffentlichen Leben endgültig den friedensmäßigen Anstrich nehmen wollte, erging ein weiterer Schlag gegen die angestammte Gerichtsverfassung. Am 27. September wurde der Rechtsweg im Prinzip abgeschafft. Die Oberlandesgerichte sollten ganz verschwinden, das Reichsgericht nur noch dürftige Restzuständigkeiten verwalten, Frist: sechs Wochen. Aber auch diese radikale Sparmaßnahme blieb auf halbem Wege stecken. Die Frist, die den Gerichten zur eigenen Abwicklung gesetzt wurde, musste mehrfach verlängert werden und wurde schließlich vom Kriegsende kassiert.[15] Selbst hemdsärmelig vorgetragene Extremlösungen – «Ach was, die Justiz kriegswichtiger Betrieb, der Scheißdreck hört eben auf», bekam der Jenaer Generalstaatsanwalt im Oktober 1944 zu hören[16] – führten intern nur zu Befremden und äußerstenfalls zu einem Vermerk. Sogar Goebbels musste sich darüber belehren lassen, dass eine Abschaffung der Justiz den Erhalt der staatlichen Ordnung gefährden, der Bevölkerung «ein Gefühl der Rechtslosigkeit» vermitteln und generell «chaotische Zustände» auslösen würde.[17]
Und dann war da noch der juristische Eigensinn. Die traditionelle Halsstarrigkeit des Berufsstandes hatte sich auch im totalen Krieg erhalten. Im November 1944 wurde den Richtern in einer ausführlichen Rundverfügung offenbart, dass künftig anstelle der umständlichen Berechnung der Gerichtskosten nach Streitwert und Gebührenordnung eine «freie Schätzung» des Richters zu treten habe.[18] Ein derartiger Anwurf trieb die Justiz in den Widerstand. Der Landgerichtspräsident von Nordhausen am Harz bemühte die letzten Geschütze dogmatischer Differenzierungslust, um das ganze Ausmaß des gesetzgeberischen Versagens vorzuführen: Wenn der Beklagte verliere und auferlegt bekomme, die Anwaltskosten und den Gebührenvorschuss des Gegners zu erstatten, Letzterer aber unter den tatsächlichen Kosten liege, dann müsse der Kläger über diese tatsächlichen Kosten einen Titel gegen den Beklagten bekommen. Dies sei nur durch ein Kostenfestsetzungsverfahren möglich, das in diesem Falle sogar – anders als früher – auch ohne ausdrücklichen Antrag durchzuführen sei. Im Nordhäuser Bezirk, so resümierte der Bericht, lehne man das neue Kostenrecht deshalb ausnahmslos ab; es sei «unzweckmäßig und nicht zeitgemäß».[19]
Wer mochte da widersprechen? Der Vorwurf, die Anforderungen der Zeit zu verfehlen, musste sich auf das beziehen, was die staatliche Propaganda als die «lebensentscheidende Schicksalsstunde unseres Volkes» bezeichnete.[20] Im September 1944 stand die Rote Armee vor den Grenzen Ostpreußens, die Bevölkerung arbeitete an den Verteidigungswällen und versammelte sich zum Volkssturm, im Westen überschritten US-amerikanische Truppen erstmals die Reichsgrenze. Das Kostenrecht war wohl wirklich nicht geeignet, in dieser Krise einen messbaren Beitrag zu leisten, ganz gleich, ob mit oder ohne freie Schätzung. Gleichwohl ließ sich nur schwerlich verbergen, dass die Rechtsarbeiter in ihrer herrlichen Aufopferung für Staat und Volk nicht nur die üblichen Biotope juristischer Besserwisserei pflegten, sondern auch ihre ohnehin bestehende Neigung zur Seelenblindheit weiter kultivierten. Die Juristen klammerten sich an die wenigen Probleme, die sie noch selbst lösen konnten. Im November 1944 ersann der Landgerichtspräsident von Aachen, der seinen Sprengel zu diesem Zeitpunkt bereits eingebüßt hatte und deshalb in Düren saß, detaillierte Regelungen darüber, wie man künftige Verlagerungen schon jetzt vorbereiten könne; als sein ausgeklügelter Plan die Vorgesetzten in Berlin erreichte, war auch der neue Amtssitz in Düren durch einen Bombenangriff zerstört, weshalb man sich im Reichsjustizministerium auf den knappen Vermerk beschränkte: «Durch die Entwicklung überholt».[21]
Man verwaltete den eigenen Untergang, sachlich, nüchtern, realitätsfern. Je tiefer die Alliierten ins Landesinnere vorstießen, desto größer wurde die Leerstelle in der deutschen Justiz. Zum Jahresende 1944 musste der Oberlandesgerichtspräsident von Zweibrücken dem Reichsjustizministerium eingestehen, «daß der weitaus größte Teil der lothringischen Gerichte mir nicht mehr zugänglich ist».[22] Am 5. Februar 1945 gab der Oberlandesgerichtspräsident von Breslau den blanken Irrsinn zu Protokoll, die Lage in seinem Bezirk könne «zur Zeit als wesentlich entspannt angesehen werden» – eine fast schon schizoide Behauptung: zwei Landgerichte waren bereits von der Roten Armee besetzt, das Oberlandesgericht selbst hatte Breslau wegen akuter Feindbedrohung verlassen.[23] Der Dienstweg führte über immer verschlungenere Seitenpfade, um dem Dienst überhaupt noch einen Weg durch das kleiner werdende Reich zu bahnen. Am 10. April 1945 erkundigte sich der Rostocker Generalstaatsanwalt, der wegen der Zerstörung seines Dienstsitzes schon seit drei Jahren in Schwerin residierte, beim Reichsjustizministerium, das seinerseits nur noch mit einem winzigen Notbestand in Berlin saß, nach dem Schicksal seiner Kollegen. Telefonisch wurde ihm mitgeteilt, dass «für die Behörden des Oberlandesgerichts Köln, Düsseldorf, Frankfurt/M., Darmstadt, Zweibrücken, Kassel weder Ausweichstellen noch Verwaltungsstäbe eingerichtet» seien;[24] Königsberg, Danzig, Breslau, Stettin, Kattowitz waren da ohnehin schon verloren. Dem deutschen Recht kam sein Geltungsbereich abhanden. Eine gute Woche später verschwand mit der Besetzung von Leipzig durch US-amerikanische Truppen das Reichsgericht, kurz darauf lösten sich auch die letzten Reste des Ministeriums auf. Mit der Kapitulation des Deutschen Reichs war die Rechtsverwaltung an ihr Ende gelangt. Die Rechtspflege stand still.
Ius stat: Wenn die Rechtspflege stillsteht
Ganz hinten in der juristischen Wunderkammer war freilich auch für diesen absonderlichen Fall eine Rechtsfolge vorgesehen. Die Rechtspflege steht still – ius stat, murmelt dazu der gebildete Jurist, weshalb der Stillstand der Rechtspflege auch «Justitium» genannt wird, ein eigenartiges Überbleibsel aus dem Altertum, entstanden irgendwo in den Tiefen der römischen Republik, als man sämtliche anstehenden Gerichtsverhandlungen unterbrach, wenn die Truppen ausgehoben werden mussten.[25] Bald wurde daraus ein allgemeines Symbol für Großereignisse des öffentlichen Lebens. Wo ein Tempel einzuweihen, ein kaiserlicher Nachfahre zu bestaunen oder der Tod eines Herrschers zu beklagen war, da konnte ein Justitium ausgerufen werden, und entsprechend bunt gefächert war das Repertoire an denkbaren Maßnahmen: Schließung von Staatskasse, Wechselstuben, Märkten und Läden, Aussetzung von Versteigerungen, von Senatssitzungen und Gerichtsverhandlungen, ergänzt um, je nach Anlass, Verzicht auf Schmuck, Festgewänder, Eheschließungen oder Opfergaben. Eine Art Lockdown. Das Justitium legte das öffentliche Leben in einem nachgerade sprichwörtlichen Sinne lahm; bei Livius ist von einem iustitio simile otium die Rede, einer dem Justitium ähnlichen Ruhe.[26]
Die Neuzeit entdeckte das Justitium in einem technischeren Sinne wieder. Tempore hostilitatis non currit praescriptio, hieß es im Kirchenrecht schon seit dem 12. Jahrhundert,[27] bei höherer Gewalt läuft die Verjährung nicht. In der weltlichen Gesetzgebung taucht dieser Gedanke ab der frühen Neuzeit auf, etwa im preußischen Allgemeinen Landrecht von 1620, das vorschrieb, bei Krieg, Pest, Flut oder «ander noth» die Verjährung zu unterbrechen.[28] Ein halbes Jahrhundert danach erging das erste ausdrücklich so genannte Justitium der Neuzeit: 1671 verhängte der Große Kurfürst über die Jahre 1626 bis 1648 rückwirkend ein Justitium, damit «der Lauff sothaner Jahre niemanden an seinen Rechten schädlich seyn solle».[29] Die Ordnung des Rechts sollte von der Unordnung der Welt nicht gestört werden. Mit dem Justitium ließ sich letztlich jeder Ausnahmezustand juristisch operationalisieren, indem er – wenn gar nichts mehr half – kurzerhand für irrelevant erklärt wurde.
Für das neuzeitliche Recht ist das ein durchaus typischer Vorgang. Sobald das Funktionieren des Rechts in Gefahr geriet, erließ man einfach noch mehr Recht. 1780 hielt das Justitium offiziell Einzug in die neue preußische Prozessordnung, wurde danach in allen Reformen übernommen und landete schließlich 1877 in der Zivilprozessordnung für das Deutsche Reich.[30] Der Regierungsentwurf formulierte knapp: «Hört in Folge eines Krieges oder eines anderen Ereignisses die Thätigkeit des Gerichts auf, so wird für die Dauer dieses Zustandes das Verfahren unterbrochen.» Der Vorschlag enthielt keine Begründung, wurde sowohl in erster als auch in zweiter Lesung ohne Debatte angenommen und seither, von Anpassungen der Rechtschreibung abgesehen, nicht ein einziges Mal geändert.[31] Keine großen Worte: Der Stillstand des Rechts versteht sich von selbst.
Was soll man auch dazu sagen? Wenn die Gerichte nicht mehr arbeiten, dann arbeiten sie nicht mehr. Jenseits ihrer eigenen Bahnen hat diese unbekümmerte Tautologie kaum Spuren hinterlassen. Auch in zweihundert Jahren engagierter Militärgeschichte wurde nur eine Handvoll Fußnoten produziert.[32] Aber bei aller Sinnlosigkeit hatte die Vorschrift durchaus Hintersinn. Mit dem Stillstand der Rechtspflege erhielt das Recht ein Instrument, um die Gefahr von Rechtlosigkeit juristisch zu bannen, eine Art juristischen Grenzwert, der zwischen Sein und Nicht-Sein des Rechts entscheidet und dabei vorgibt, auch diese Frage sei eine Rechtsfrage. Im Justitium ruhte ein verkapselter Mythos, der in sich die Erinnerung an einen Meilenstein der juristischen Phylogenese trug, den Übergang zur Allgegenwart des Rechts. Mitte des 19. Jahrhunderts kleidete Philipp Eduard Huschke, ein bibeltreuer Romanist, dieses nimmermüde Fortschreiten des Rechts in eine besonders hingebungsvolle Bildsprache: «Der Ausdruck iustitium selbst, verglichen z.B. mit solstitium, drückt auch offenbar die Vorstellung aus, dass die iuris dictio an sich durch alle Werkeltage fortläuft wie die Sonne am Himmel.»[33]
Ausgerechnet mit dem Stillstand der Rechtspflege verknüpft sich damit eine nachgerade messianische Heilserwartung. Im Justitium antizipiert das Recht sich selbst. Irgendwann wird es weitergehen; und wenn es dann ganz anders ist als zuvor, dann ist es immer noch normal. Das Recht verteilt die Gnade seiner Normativität an allen Orten und zu allen Zeiten. Diese juristische Theologie ist keine Frage des Glaubens. Die juristische Realität ruht auf einem opulent institutionalisierten Kompendium von Regeln, das sich in seinem Vollzug zur Not selbst beglaubigen kann. Nichts kommt im Recht aus dem Nichts. Die Normativität der Programme zwingt dazu, auch bei einem radikalen Neubeginn Anknüpfungspunkte in der eigenen Systemgeschichte zu suchen, Gesetze, Verordnungen, Präjudizien, wissenschaftliche Autoritäten. Wer am Recht zweifelt, dem stehen deshalb Gesetzblätter, Bibliotheken und Anwaltskanzleien in großer Zahl zur Verfügung; sofern das nicht ausreicht, um dem juristischen Urvertrauen auf die Sprünge zu helfen, dann droht der Gerichtsvollzieher und bei hartnäckigen Sündern das Gefängnis. Das Recht ist immer da, ob man will oder nicht.
Und so ist es nur konsequent, wenn sich in der juristischen Literatur des 20. Jahrhunderts, ungetrübt von jeder Ironie, die befremdliche Einschätzung durchsetzen konnte, «eine rein tatsächliche Behinderung des Gerichts» – was immer das im Unterschied zu Krieg oder Überschwemmung sein mag – führe genauso wenig zum Stillstand der Rechtspflege wie der «Tod aller Richter».[34] Eingeführt hat diesen Gedanken der Standardkommentar von Adolf Baumbach in der 11. Auflage von 1936 (die 1. Auflage erschien 1924). Sind die Richter am Leben, geht das Recht seinen gewohnten Gang, sind sie erst einmal tot, auch. Und dann? «Über die Tatsache des Stillstands der Rechtspflege», belehrt Baumbach verblüffend leichthändig weiter, «entscheidet der Richter.»[35] Irgendwo wird sich schon jemand finden, um den letal verhinderten Kollegen zu ersetzen, ein anderer Richter, ein neuer Richter, ein Sofortrichter, ein Pseudorichter, den erst die Selbsternennung zum Normalrichter aufsteigen lässt. Was auch immer. Ein kurzes Flackern im Maschinenraum, und dann arbeitet die Rechtspflege wieder so ruhig und so verlässlich wie sonst auch. Ob das Recht noch existiert, ist eine Frage – des Rechts.
Schnitt-Stelle 1945
Der Stillstand, zu dem der Ausgang des Zweiten Weltkriegs die deutsche Rechtspflege zwang, von Zeitgenossen als «komische Ausgeburt theoretisierender Begriffsspekulation» bezeichnet[36] und später zum «juristischen GAU» stilisiert,[37] lag also durchaus nicht jenseits der juristischen Vorstellungskraft. Da die Justiz selbst darüber befinden sollte, ob sie noch einsatzfähig war oder nicht, blieb sogar ihre Nicht-Existenz von ihrer Existenz abhängig. Das war auch 1945 so. Die Alliierten schlossen alle Gerichte unter ihrer Herrschaft, verpflichteten den Apparat auf Demokratie und Rechtsstaat, entnazifizierten das Personal und erlaubten irgendwann die Fortsetzung des Dienstbetriebs, zumeist nach einigen Wochen. Sie hatten viele neue Ideen mitgebracht. Aber kein neues Papier. «Wir hatten nicht einmal Papier, sondern fingen an auf der Rückseite ehemaliger Kalender der Gauleitung», erinnerte sich später Werner Baerns, der zweite Nachkriegspräsident des Oberlandesgerichts Düsseldorf.[38] Die Abfälle der alten wurden die Grundlage der neuen Justizverwaltung.
Notpapier lieferte die Ingredienzen der Rechtsarbeit, dünn und brüchig, vollgesogen von der Zeit; Urteile, Beschlüsse, Verfügungen, Gerichtskostenmarken, Zustellungsurkunden der Deutschen Reichspost, sämtliche übersät mit den Emblemen der untergegangenen Herrschaft. Nach der Besetzung wurden sie durchgestrichen, überklebt, herausgeschnitten; «ein Durchstreichen des Hakenkreuzwappens mit Federstrichen genügt nicht», schärfte das Stuttgarter Justizministerium seinen Behörden ein, das verpönte Symbol müsse vollständig unkenntlich gemacht werden.[39] Bis Ende der 1940er-Jahre verkündeten, oft nur notdürftig verborgen, anwaltliche Briefköpfe die einstige Mitgliedschaft im Nationalsozialistischen Rechtswahrerbund. Auch bei den Gerichten musste zu dieser Zeit noch gelegentlich gemahnt werden. 1949 beklagte das Amtsgericht Berlin-Mitte, auf offiziellen Schreiben seien jüngst nationalsozialistische Embleme verwendet worden, und bemerkte weiter: «Dies hat bei den Empfängern Anstoß erregt und zu Mißdeutungen Anlaß gegeben.»[40]
Missdeutungen: Die neue Zeit war nicht mehr die alte. Aber die neue war sie auch noch nicht. Eine eindeutige Verortung in dieser Zwischen-Zeit war unmöglich. Selten wurde sie überhaupt nur versucht, und wenn, dann gut versteckt irgendwo in den Fahrtenbüchern der bürokratischen Maschinerie. Im Tagebuch für Justizverwaltungsangelegenheiten des Landgerichts im sächsischen Freiberg dokumentiert ein letzter Eintrag am 5. Mai 1945 die «Belegung von Diensträumen durch die Wehrmacht», Ende Juni geht es weiter mit der «Ingangsetzung der Justiz» und der «Meldung der aus politischen Gründen beurlaubten Gefolgschaftsmitglieder».[41] Dazwischen ein mickriger, krummer Doppelstrich, später verstärkt durch eine scharf gezogene rote Linie, eine schmucklose Illustration des Umbruchs. Am Amtsgericht Hannover hat ein namenloser Justizangestellter ein verschämtes rotes Strichlein ins Strafprozessregister gesetzt, das die Termine vom 6. April 1945 (drei Fälle von Hehlerei, bestraft mit zwischen zwei und acht Monaten Gefängnis) vom ersten Diebstahl abgrenzt, der am 13. Juni unter der neuen Ordnung abgeurteilt wurde (Strafe: 50,– RM).[42] Am Landgericht Plauen erlaubte sich der Sachbearbeiter ein besonders markantes Ornament. Seinen Strich im Zivilprozessregister versah er zunächst mit einem kernigen Titel – «Neue Eingänge seit der Besetzung durch die alliierten Truppen» –, um in einem zweiten Schritt sogar neue Aktenzeichen einzuführen, mit denen der Beginn auch der bereits laufenden Verfahren auf die Zeit nach der Kapitulation verschoben wurde.[43]
Ein derartiger Akt der geschichtspolitischen Selbstermächtigung war freilich ein Einzelfall. Eingriffe in die statistische Erfassung des Jahresgeschäfts oder in die Nummerierung der Akten wurden sonst nicht einmal in Erwägung gezogen. Die Justizverfahren hatten sich vom Zeitgeschehen emanzipiert, sie folgten einer juristischen Choreografie, die nicht notwendig von den Dramen der Weltgeschichte vorgeschrieben wurde. Ein unauffälliger Strich blieb die kühnste Maßnahme, verwegen, weil von der Aktenordnung nicht vorgesehen, aber metaphorisch verkürzt, weil die kleinen Schlussstriche avant la lettre auf die eigentlich angezeigte Bilanz verzichteten. Der Schlussstrich gewährte umstandslos eine neue Kreditlinie, er symbolisierte einen Schluss ohne Schlussrechnung. Vor Gericht waren der Massenmord, die Zerstörungen, das Kriegsende, die anschließende Entnazifizierung und die neue politische Rahmenordnung Umstände, deren juristische Relevanz von Fall zu Fall gesondert erwiesen werden musste.
Nur ein Beispiel: Am 27. März 1945 antwortete ein Anwalt auf eine eben erhobene Klage vor dem Landgericht Stuttgart, er werde «im Hinblick auf die gegebenen Verhältnisse und meine Inanspruchnahme als Mitglied des Volkssturms erst in einiger Zeit antworten können». Das nächste Blatt in der Akte dokumentiert die Replik des Klägeranwalts vom 1. Dezember 1945. Das ganze Schreiben: «In Sachen Kuhn/Müller konnte der Rechtsstreit wegen der Feindbesetzung seinerzeit nicht weitergeführt werden. Ich rufe hiemit [sic] wieder an und bitte, neuen Verhandlungstermin zu bestimmen. Sogleich fordere ich den Beklagten zur Abgabe der immer noch ausstehenden Klagebeantwortung auf.»[44] In der Handlungslogik des Rechts sind Krieg und Frieden also, um eine Formulierung von Niklas Luhmann aufzugreifen, ein Rauschen in der Umwelt. «Man lebte in einer Fiktion des Fortbestehens des Dienstbetriebes», erinnerte sich ein Zeitzeuge im Rückblick;[45] nicht einmal die Geschäftsverteilungspläne wurden in ihrer Gültigkeit angezweifelt, sondern lediglich «für den Rest des Geschäftsjahres 1945» neu justiert.[46] Das Jahr 1945 war ein zeitliches Kontinuum, wie alle Jahre zuvor auch.
Eine Stunde Null gab es nicht
Das hat man lange verdrängt. Der 8. Mai kam auch noch Jahrzehnte nach Kriegsende als Zäsur zum Einsatz, um einen epochalen Übergang von einem nationalsozialistischen Davor zu einem zwangsdemokratisierten Danach zu kennzeichnen. Bis zum 8. Mai war es düster, danach begann der mühselige Wiederaufbau, im Westen mit sehr viel mehr Erfolg als im Osten. In Anlehnung an den militärischen Sprachgebrauch nannte man diesen Wendepunkt «Stunde Null». Mittlerweile ist seit langem bekannt, dass es diese «Stunde Null» nie gegeben hat. Gleichwohl geht vom 8. Mai noch immer so etwas wie eine narrative Fernwirkung aus. Man erkennt das zunächst an der nach wie vor getrennten Behandlung von Krieg und Nachkrieg. Insbesondere die letzten Kriegsmonate, in denen die ohnehin allgegenwärtige Gewalt noch einmal stark verdichtet wurde, sind vielfach beschrieben worden, während sich umgekehrt Untersuchungen über den Alltag in den deutschen Ruinenlandschaften ebenfalls einer ungebrochenen Beliebtheit erfreuen.[47]
Auch die Justizgeschichte nutzt dieses Schema des Vorher–Nachher gern. Eine seltene Ausnahme liefert Hans Wrobels erfrischende Abrechnung mit der Gründergeneration der Bundesrepublik,[48] ansonsten stehen auf der einen Seite die Auswüchse des Nationalsozialismus – Volksgerichtshof, Sondergerichte, Militärgerichte, Standgerichte –, auf der anderen steht der Aufbau rechtsstaatlicher Strukturen in der Nachkriegszeit.[49] Wer den Nationalsozialismus untersucht, sucht nach Nationalsozialismus, gerade in der Justiz, und wer die Nachkriegszeit untersucht, sucht nach labiler Rechtsstaatlichkeit, getragen von der Kontinuität nationalsozialistischer Karrieren. Die Beschreibungen kreisen um Gehorsam, Opportunismus und seltene Beispiele von Widerstand und reichen bis hin zu einer fast komischen Zahlenmagie, die berechnet haben will, dass im Zivilrecht vor 1945 «0,58 % der Urteile … durch das nationalsozialistische Rechtsdenken beeinflusst» gewesen seien.[50] Juristische Routinearbeit gerät damit schon in die Nähe von Widerstand; welche Funktion die übrigen 99 Prozent hatten, ob nach 1945 ebenfalls Urteile in diesem Sinne beeinflusst waren und überhaupt, warum nur das Politische politisch sein soll, bleibt ungeklärt.
Wer so argumentiert, marginalisiert die Rolle der Justiz. Dabei sind die massiven Einschränkungen der nationalsozialistischen Justiz durchaus in Rechnung zu stellen; das Strafrecht verrohte immer mehr, das Zivilrecht büßte einige Verfahrensschritte ein, viele Themen konnten aus offiziellen oder informellen Gründen nicht verhandelt werden. Aber dort, wo die Justiz noch etwas zu sagen hatte, wurde ihr die Kompetenz, über Recht und Unrecht letztverbindlich zu entscheiden, nicht ernsthaft bestritten. Die Urteilskritiken waren auf einen winzigen Bruchteil der getroffenen Entscheidungen beschränkt, die denkbar spröden «Richterbriefe» wurden teilweise als willkommene Fingerzeige begrüßt, teilweise ignoriert und im Übrigen nicht zuletzt dafür in Anspruch genommen, die Praxis als zu hart zu kritisieren.[51] Selbst Hitlers berüchtigte Reichstagsrede vom 26. April 1942, in der er seine Stellung als oberster Gerichtsherr brachial erneuerte, mochte im Selbstwertgefühl der Richter Spuren hinterlassen haben; die Geschäftsverteilungspläne blieben davon unangetastet.[52] Im Juli 1943 führte Reichsjustizminister Otto Thierack in einer Rundverfügung Klage darüber, dass auch innerhalb desselben Sondergerichts ähnlich gelagerte Fälle ganz unterschiedlich entschieden würden,[53] und noch im Mai 1944 versprach der Minister seinen Richtern ein neues Gesetz, das ihre Sonderstellung im Staatsapparat endlich angemessen abbilde, da sie Beauftragte des Führers selbst und – anders als die übrigen Beamten – in ihren Entscheidungen unabhängig seien.[54]
Wer aus einer Mietstreitigkeit aus welchen Gründen als Sieger hervorgeht, das war 1945, juristisch gesehen, deshalb so kontingent wie heute. Manche Fälle lagen so und andere lagen anders. Die Justiz war ganz bei sich: Ihre soziale Zusammensetzung verband sie, wie üblich, mit der oberen Mittelschicht. Der Krieg ließ das Durchschnittsalter der Amtsträger ansteigen, was zugleich allfällige revolutionäre Neigungen abschwächte, hatte doch die Generation der vor 1900 Geborenen noch die Stabilität des bürgerlichen Zeitalters erlebt. Die Verwalter des Rechts durften, was auch immer an Konflikten an sie herangetragen wurde, in ein anderes Medium überführen und dort so lange dogmatisch traktieren, bis der politische Gehalt in homöopathische Dosen verdünnt war. Eben dadurch erbrachten sie die ihnen zugedachte Leistung, nämlich Gebrauchswert, Effizienz und Belastbarkeit gesellschaftlicher Strukturen zu steigern; und eben diese Funktion war auch nach 1945 eine gefragte Aufgabe.
Die Politik des nationalsozialistischen Rechts ist deshalb, mit anderen Worten, nicht nur im Politischen zu suchen.[55] Im Gegenteil: Die Suche nach Nationalsozialismus im Nationalsozialismus verspricht nur noch wenig Ertrag. In der Justizgeschichte gibt es keine Legenden mehr, die widerlegt, und keine Verbrechen, die noch bewiesen werden müssten, wie umgekehrt auch die Entdeckung bislang unbekannter Widerstandsnester nicht zu erwarten steht. Der Duktus der Empörung, mit dem nach 1968 über die NS-Zeit aufgeklärt wurde, wirkt mittlerweile wie aus der Zeit gefallen. Die heute praktizierte Aufklärung tut niemandem mehr weh. Die deutsche Justiz verfolgt seit kurzem mit heiligem Ernst die letzten noch lebenden Handwerker und -langer der Todesmaschinerie, die einem Akt der Symboljustiz unterzogen werden, bevor sie der erwartbar nahe Tod holt. Die deutsche Bürokratie hat währenddessen einen Wettbewerb in offiziöser Bußfertigkeit begonnen und versammelt flächendeckend Auftragsforscher in stolz titulierten «Unabhängigen Historikerkommissionen», um die amtlich dekretierte Bestürzung über Verstrickung und Verdrängung der bundesrepublikanischen Institutionen mit den passenden Fußnoten zu versehen. Für die Justiz hat 2016 die «Akte Rosenburg» diese Aufgabe übernommen,[56] das zufriedene Selbstvergewisserungsprodukt der Berliner Republik, die angesichts der Grauen des Dritten Reichs pflichtschuldig den Kopf senkt und mit dumpfer Stimme vom «düstersten Kapitel der deutschen Geschichte» raunt, sobald die Rede auf das Jahr 1933 kommt. Damit können die Akten geschlossen werden. Der Nationalsozialismus ist ins Reich der allgemeinen Geschichte entlassen.
Die Folgen sind, wie immer, ambivalent. Auf der Habenseite steht eine Angleichung an die üblichen Fachgepflogenheiten, die mitunter geradezu befreiend wirkt. Restriktive Archivpolitik und kollusive Netzwerke muss heute keiner mehr fürchten. Die Vorbehalte, die noch Anfang der 1980er-Jahre bis zu dem törichten Vorwurf reichten, wer nicht dabei gewesen sei, könne sich sowieso nicht zum Nationalsozialismus äußern, wirken heute wie Nachrichten von einem anderen Stern; von den Schwierigkeiten der 1950er- und 60er-Jahre ganz zu schweigen. Der Nationalsozialismus durchlebt gewissermaßen eine Säkularisierung. Der Ton wird abgeklärter.
Die narrative Ratlosigkeit sticht dadurch allerdings umso klarer hervor. Das emphatische «Nie wieder!», das die Forschung jahrzehntelang im Hintergrund begleitet hat, ist unüberhörbar müde geworden. Zugleich löst sich der politische Comment, der im Umgang mit rechten Exzessen lange Zeit für An- und Abstand gesorgt hat, langsam auf. Der Leitsatz, dass «Auschwitz» sich nicht wiederholen dürfe, hat etwas Wohlfeiles an sich, wenn er nicht vom Konsens darüber getragen wird, was «Auschwitz» eigentlich war und wo seine Gründe liegen. Der Umgang mit dem Dritten Reich hat mittlerweile das Stadium einer systematischen Ver-Anderung erreicht; der Nationalsozialismus ist das, was wir nicht sind. Die Situation hat etwas durchaus Paradoxes an sich. Die Beweise für die Verbrechen des Regimes sind zugleich Beweise für seine kategoriale Andersartigkeit und deshalb auch dafür, warum man sich heute nicht mehr damit auseinandersetzen muss. «Rechtsperversion», «unsagbares Leid», «ungeheuerliche Verbrechen» sind dann Be- und Entlastungstermini zugleich: Pervers sind immer die anderen. Der Nationalsozialismus rückt in eine nicht unbequeme Ferne. Die Geschichte läuft sich tot.
Geteilte Normalität
Deshalb wurde die Blickrichtung in diesem Buch verschoben. Im Mittelpunkt steht nicht das, was uns vom Nationalsozialismus trennt, sondern das, was wir mit ihm teilen: das Normale. Als Bindeglied zwischen gegenwärtigem und vergangenem Erfahrungshorizont fungieren die Probleme des Alltags, wie sie – damals wie heute – von der Justiz verhandelt werden: Mietrecht, Eherecht, Beleidigungen, leichte Körperverletzungen, Fälle also, die bei Gericht mit einer routinierten Sachlichkeit rechnen dürfen. Die Reproduktion dieser Sachlichkeit durch beständige Wiederholung ist es, die hier als Verwaltung von «Normalität» bezeichnet wird. Im Kern geht es um die Frage, warum es auch unter den Bedingungen des Jahres 1945 noch attraktiv war, Auseinandersetzungen in der Form des Rechts auszutragen. Die Gewalt war allgegenwärtig, und trotzdem wurde immer wieder starrsinnig auf die dünne Macht des Papiers verwiesen. Das Normale verlor auch unter vollkommen unnormalen Umständen nicht seine Anziehungskraft. Warum?
Die Rede von der «Normalität» macht dabei von einer dezidiert unspezifischen Semantik Gebrauch. Sie nährt sich, um mit Hans Magnus Enzensberger zu sprechen, von einem «terminologischen Pudding».[57] Ihre Handlungsfelder lassen sich zunächst vor allem negativ charakterisieren, nämlich dadurch, dass sie von kaum jemandem als spektakulär oder außergewöhnlich wahrgenommen werden. Zur positiven Kennzeichnung bleiben erst einmal nur unbeholfene Synonyma wie Alltag, Durchschnitt oder Banalität. Noch einmal Enzensberger: «Normalität wird einem eingebrockt, man kann sie nur auslöffeln.»[58] Diese relativ freie Wortverwendung hat in der Forschung zum Nationalsozialismus eine gewisse Tradition, die schon mit Hannah Arendts Charakterisierung von Adolf Eichmann begann, spätestens 1993 jedoch den historiografischen Mainstream erreichte, als Christopher Browning mit seiner Studie über die Ordinary Men hinter der Legende vom proletarischen Gewalt-, Exzess- und Krawallmenschen die Sicht auf den «gewöhnlichen» Deutschen als potenziellen NS-Täter freigelegt hat. Die Forschung hat diese Überlegungen mittlerweile um sozialpsychologische und organisationssoziologische Erwägungen erweitert.[59]
Bezieht man diese weiche Rhetorik des Durchschnittlichen auf das Recht, so werden Quellenbestände relevant, die bei der Erforschung des Nationalsozialismus bislang eine eher randständige Rolle gespielt haben: die Akten der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Sie wurden für dieses Buch in möglichst großer Zahl zusammengetragen, um das Funktionieren der Justiz in Endkampf und Wiederaufbau nachzeichnen zu können, wenn möglich, ergänzt um Verwaltungs- und Generalakten, Allgemeinverfügungen, Aktenordnungen und Dienstanweisungen der beteiligten Institutionen sowie Personalakten der wichtigsten Akteure.
Die Kapitulation des Deutschen Reichs bietet auch hier durchaus eine zeitliche Orientierung, etabliert aber keine scharfe erzählerische Grenze. Die Nachwehen des Krieges dauerten vielerorts noch Jahre – in manchen Gebieten Jahrzehnte – an, während umgekehrt die Aufräumarbeiten nicht erst nach der Kapitulation begannen, sondern, je nach militärischem Verlauf, schon lange zuvor. Die äußeren Umstände – Personal, Räume, Inventar, Verpflegung – waren nach dem 8. Mai 1945 meist ungünstiger als zuvor. Die Periodisierung wurde daher so angelegt, dass sie die Überblendungen des juristischen Eigensinns gewissermaßen nachzeichnet. Brüche und Disruptionen sind auch in dieser Anlage möglich, aber sie werden nicht strukturell präskribiert durch eine Beschränkung der behandelten Fälle auf die Jahre des Nationalsozialismus oder auf den historischen Abschnitt des Wiederaufbaus.
Das Buch entnimmt seine Quellen deshalb dem gesamten Zeitraum zwischen Stalingrad und Währungsreform.[60] Zur Jahreswende 1942/43 begann mit der verlorenen Schlacht von Stalingrad das lange Kriegsende, das Jahr 1948 – Trizone, Währungsreform, Berlin-Blockade – markierte den Abschluss der gesamtdeutschen Besatzungszeit. Danach gab man sich im Westen dem Wunschtraum vom Fortbestand des Deutschen Reiches hin, während man sich im Osten als das wahre, neue Deutschland sah. Bis dahin gab es mehr Verbindendes als Trennendes, weshalb die Quellenbestände sämtlichen Besatzungszonen entnommen werden. Bis ins Jahr 1947 hinein war der Austausch zwischen den Zonen rege. Man leistete einander Rechtshilfe bei Verhaftungen, man studierte im Osten Literatur und Rechtsprechung aus dem Westen, man veröffentlichte im Westen Autoren und Rechtsprechung aus der sowjetischen Zone. Die ostdeutsche Gründung der juristischen Zeitschrift Neue Justiz 1947 wurde auch im Westen erfreut registriert: Karl S. Bader, der badische Generalstaatsanwalt und Herausgeber der Deutschen Rechtszeitschrift, sprach von einer «Schwester», Georg August Zinn, damals hessischer Justizminister, von einer «Brücke zwischen Ost und West».[61]
Ohnehin standen sich «Ost» und «West» in den ersten Jahren nach dem Krieg nicht als monolithische Blöcke gegenüber. So war in der französischen Besatzungszone ein Separatismus wohlgelitten, der in den anderen Zonen keine Gefolgschaft fand. Unter den US-Amerikanern pflegte man zunächst eine rigorose Entnazifizierungspolitik, die mit der sowjetischen Praxis mehr Ähnlichkeiten hatte als mit der der westlichen Verbündeten. Innerhalb der sowjetischen Zone wiederum gab es erhebliche Meinungsverschiedenheiten, weil insbesondere Thüringen und Sachsen anfangs hartnäckig an einer bürgerlichen Vorstellung von Rechtsstaatlichkeit festhielten. Unter der Ägide von Eugen Schiffer, dem altgedienten Reichsjustizminister, blieb auch im Osten der bürgerliche Volljurist das Ideal des staatlichen Verwaltungsbeamten, das die neuen Volksrichter noch für einige Jahre auf Distanz halten konnte.[62] Und entsprechend fand man in allen Besatzungszonen im «Positivismus» den passenden Schuldigen, der künftig nur mithilfe der höheren Mächte des Naturrechts bekämpft werden könne; die später sogenannte «Naturrechtsrenaissance» hat in dieser ersten Phase ihre entscheidenden Impulse aus dem Osten bekommen.[63]
Von der rohen Gewalt zu den Akten
Da das Buch erst dann einsetzt, als die systematische Entrechtung ganzer Bevölkerungsgruppen bereits abgeschlossen war, ist der Fokus auf das Normale nicht unangemessen. Dass die Justiz maßgeblich an diesen Ausgrenzungsprozessen beteiligt war, ist seit Jahrzehnten bekannt.[64] Das makabre Nebeneinander von Fürsorge und Mord trat in der Volksgemeinschaft des ausgehenden Zweiten Weltkriegs in aller Deutlichkeit hervor. Carl Schmitts düstere Fantasien von der wahren Demokratie, die von Homogenität und Vernichtung des Heterogenen lebe,[65] hatten sich längst als Maximen staatlichen Handelns etabliert. «Innerhalb der Gemeinschaft gelten Friede, Ordnung und Recht. Außerhalb der Gemeinschaft gelten Macht, Kampf und Vernichtung», so lautete 1940 die berühmte Analyse von Ernst Fraenkel.[66] Die treuen Volksgenossen konnten ihre Streitigkeiten, falls nötig, vor Gericht austragen, ohne mit den unangenehmen Fragen der Politik konfrontiert zu werden; für diese Fragen standen schon lange andere Foren bereit.
Wenn hier das Treiben der ordentlichen Justiz ins Blickfeld rückt, so dient dies der Ergänzung der bereits bekannten Gewaltdarstellungen, nicht deren Ersetzung. Das eine kommt nicht ohne das andere aus. Erst das Normale gab dem Ausnahmezustand Form und Sinn, ohne die Ordnung konnte sich das Außerordentliche nicht entfalten. Dass sich diese juristische Alltagsnormalität tatsächlich belegen lässt, ist bereits ein erstes Ergebnis der Arbeit. Die öffentliche Erinnerung, aber auch die apologetischen Schriften der ersten Nachkriegsjahrzehnte haben die Zeit nach Stalingrad zu einer einzigen, ununterbrochenen Bombennacht verschmolzen, in der für ein normales Rechtsleben weder Voraussetzungen noch Bedarf vorgelegen hätten. Von der Justiz sei nur die Strafjustiz tätig geblieben, freilich in einer derart pervertierten Gestalt, dass man sie im Grunde gar nicht mehr als Justiz bezeichnen könne.[67] Diese Einschätzung ist mehrfach falsch. Schon die Sondergerichte produzierten sehr viel mehr an juristischer Massenware, als ihr Name suggeriert, und selbst am Volksgerichtshof trifft man immer wieder auf eigenartige Residuen der Normalität.[68] Freilich ist die Quellenlage insgesamt nicht günstig. Unterhalb des Reichsgerichts sind vollständige Gerichtsakten, zumal aus den letzten Kriegsmonaten, selten. Sie haben häufiger an der Peripherie als in den Zentren überlebt, sind nicht immer dort abgelegt, wo sie hingehören, und wecken durch ihren Titel Erwartungen, die nach der Lektüre – in positiver wie negativer Hinsicht – oftmals korrigiert werden müssen. Aber zu finden sind sie.
Ein weiteres Quellenproblem, das «Normalität» üblicherweise indiziert, stellt sich hier ebenfalls nicht. Die Erinnerung interessiert sich meistens für das Unnormale, für Unwetter, Kriege, Katastrophen und sonstige Abweichungen vom gewöhnlichen Lauf der Dinge. Dem Alltag dagegen wird im kulturellen Gedächtnis nur wenig Raum zugestanden. Bei Gerichtsakten ist das anders. Das moderne Recht steht unter einem beständigen Protokollierungszwang, der gerade das Unauffällige und Formularmäßige besonders schätzt. Anders als die allgemeine Geschichte hat die Arbeit mit Justizakten deshalb nicht unter einem Mangel an Normalität zu leiden. Schon in der äußeren Form – Urteilsformel, Datum der Hauptverhandlung, Besetzung des Gerichts, Aufbau von Tatbestand und Gründen, Wechsel von Perfekt und Imperfekt usw. – sind die Urteile der damaligen Zeit so aufgebaut, dass sich heutige Juristinnen und Juristen darin mühelos selbst erkennen können, eben: normal.
Eher birgt der Operationsmodus des Rechts die umgekehrte Gefahr, nämlich einer – womöglich nur eingebildeten – Überdosis an Normalität zu erliegen. Seit dem Eintritt in die Neuzeit spielt sich das Recht vorwiegend in Akten ab. Akten jedoch sind ein höchst indifferentes Medium. Sie dokumentieren den Nachbarschaftsstreit genauso wie Freislers Hasstiraden vor dem Volksgerichtshof. Papier erzeugt Distanz, und juristisches Papier ist in dieser Hinsicht besonders dick. Das Schriftgut gehorcht einer Ordnung, die schon die Farben der Aktendeckel zu Signifikanten macht und jeder Stelle des Aktenzeichens – vermittelt durch den Generalaktenplan – eine eigene Bedeutung zuweist. Den Akten liegt das Ideal einer identischen Struktur zugrunde; ein möglichst hoher Grad an Formalisierung soll die behördliche Papierverarbeitung möglichst effizient und rationell gestalten.
Die Arbeitsweise des Rechts besteht deshalb vor allem aus zwei Schritten: Erst wird die rohe Gewalt, die sich in der sogenannten Realität ereignet, in die kühlen Worte der Fachsprache übertragen, dann werden die Worte auf Papier gebannt. Die Papierwelt, die dabei entsteht, absorbiert die Rechtswelt.[69] Dies verleiht juristischen Auseinandersetzungen ein seltsam zivilisiertes Gepräge auch dort, wo es um Leben und Tod geht, zumal im Rückblick. Geräusche und Gerüche, Staub, Schweiß und Schmerzen, aber auch Dramatik, Komik, Langeweile verflüchtigen sich rückstandslos; selbst eine Hinrichtung überdauert die Zeiten nur in Form eines vorgefertigten Protokolls, das dem anwesenden Justizbeamten zur sekundengenauen Abrechnung die Spalten «Zeitpunkt der Vorführung», «Zeitpunkt der Übergabe», «Zeitpunkt der Vollstreckung» anbietet. Die Gefahr ist groß, die Normalität des Rechts für eine Normalität der Welt zu halten, die vornehmen Worte mit dem echten Leben zu verwechseln und aus der sauberen Ordnung der Akten auf eine saubere Wirklichkeit zu schließen. Das Recht zeigt eher zu viel als zu wenig Normalität, eine Gefahr, der sich nur mit den bewährten historischen Hausmitteln von Kontextualisierung und Relativierung begegnen lässt.
Zwischen Chaos und Kosmos
Gerichtsakten protokollieren das Geschehen im Zentrum des Rechts. Trotzdem werden sie hier zu vorwiegend unjuristischen Zwecken verwendet. Ziel ist es, über die Form der institutionalisierten Konfliktbehandlung den Blick auf eine Gesellschaftsgeschichte freizulegen. Der Weg über die Normalität gerade des Rechts ist dabei nicht zwingend. In anderen Bereichen staatlichen und gesellschaftlichen Handelns – Verwaltung, Wissenschaft, Kunst und Kultur, Religion oder Sport – lässt sich ebenfalls bis in den Untergang hinein eine zähe Verteidigung der eigenen Normalität beobachten. Aus der Buchproduktion der deutschen Rechtsgelehrsamkeit: 1945 schenkte die stramm nationalsozialistische Hanseatische Verlagsanstalt den Volksgenossen ein letztes Mal ihre Loseblattsammlung Kriegssachschädenrecht, Gustav von Schmoller gab der interessierten Öffentlichkeit einen letzten Überblick über Das Wirtschaftsrecht in Böhmen und Mähren, Leo Raape brachte seinen Grundriss Deutsches internationales Privatrecht noch einmal auf den neuesten Stand, während das endgültig letzte Lebenszeichen der nationalsozialistischen Jurisprudenz – für die deutsche Honoratiorengelehrsamkeit durchaus sinnfällig – eine Festschrift war: Festschrift für Leopold Wenger. Zu seinem 70. Geburtstag dargebracht von Freunden, Fachgenossen und Schülern. Zweiter Band, das Vorwort geschrieben von Mariano San Nicolò und Artur Steinwenter in München und Graz, April 1945.[70] Beispiele aus dem Rest der Welt: Am 20. April 1945 gab die Deutsche Reichspost in Wien ihre letzten Briefmarken heraus («Parteiformationen SA und SS»), am 21. April bediente die Lufthansa die Strecke Berlin–München ein letztes Mal, am 29. April fand in Hamburg zwischen dem Hamburger Sportverein und Altona 93 ein letztes Freundschaftsspiel statt.
Wenn hier ausgerechnet das Recht als Normalitätsbetrieb untersucht wird, so liegt dem gleichwohl keine zufällige Wahl zugrunde. Normalität und Recht sind eng miteinander verzahnt. Beide sind allgegenwärtig und in der Regel unauffällig, beide erfüllen dabei jedoch grundlegende Funktionen menschlicher Vergesellschaftung. Normalität bietet der Sehnsucht nach Ruhe und Ordnung eine Projektionsfläche; sie verbürgt verlässliche Verfahren und verspricht kalkulierbare Ergebnisse; sie sichert die Korrespondenz von Erfahrung und Erwartung und steht für eine berechenbare Zukunft; sie markiert den Übergang vom Chaos zum Kosmos. Das «Normale» ist die Kulisse vor der Gebrechlichkeit der Welt.
Wesentliche Bauteile für diese Kulisse sind juristischer Provenienz. Auch das Recht liegt zwischen Chaos und Kosmos. Wer den Naturzustand beenden und das Heer von Einzelkämpfern in eine Gesellschaft überführen will, muss das Tor des Rechts durchschreiten. Dieser essenziellen Funktion entspricht es, dass für die Verwaltung von Recht seit dem Beginn der Neuzeit ein professionalisierter Stab bereitsteht, dessen einzige Aufgabe in der rationalen, unvoreingenommenen und verlässlichen Pflege des staatlichen Normenvorrates liegt. Die Praxis, das weiß man, wird diesen Anforderungen nicht immer gerecht. Trotzdem wird das Recht als Hort des Erwartbaren wahrgenommen. Ausreißer sind nicht ausgeschlossen, treten aber auch als solche hervor. Recht verspricht Neutralität, Objektivität, Stabilität, Unaufgeregtheit, Prozeduren der Deeskalation und der sprachlichen Einhegung. Mit anderen Worten: Das Juristische normalisiert.[71]
Recht ist deshalb, zumindest bis zu einem gewissen Grad, immer «normal», jede Störung, jeder Defekt, jede Verwirrung hat ihren Platz auf der juristischen Landkarte. Die Dogmatik des Justitiums zeigt es an: Für das juristische Selbstverständnis ist auch die Kartografierung des rechtsfreien Raums eine juristische Operation. Das Justitium spannt eine Brücke über alle Abgründe des Daseins. Was im Leben geschieht, wird im Recht auf eine Weise abstrahiert, begrifflich zerlegt und formalisiert, die garantiert, dass auch die größten Zumutungen juristisch beherrschbar bleiben. Die juristischen Konstruktionen erzeugen eine zweite Realitätsebene, eine Papierwelt, die von der Lebenswelt aber nicht einfach nur getrennt, sondern dieser auch hierarchisch übergeordnet ist. Das Papier regiert das Leben. Mal verwaltet es stumm dessen reibungslosen Fortgang, mal mildert es dessen Heimsuchungen ab, mal spendet es Trost, und zuletzt sorgt es dafür, dass die Verwerfungen sich wieder glätten und zu Normalnull zurückkehren. Das Recht versteht sich gewissermaßen als die kardanische Lagerung der Welt. Und darin liegt wohl ein Unterschied zu anderen Bereichen des Gesellschaftlichen: Das Recht unterstellt sich selbst eine nachgerade religiöse Omnipräsenz. Eine juristische Kapitulation vor den Gebrechen der Welt ist ausgeschlossen.
Die Analyse von Normalität enthält also kein Stilmittel der moralischen Relativierung, im Gegenteil. Das Recht, das hier beschrieben wurde, ist weder politisch noch gar moralisch normal, aber es baut auf strukturellen und organisatorischen Prinzipien auf, die man heute noch immer als «normal» empfinden würde. Das Etikett der «Normalität» baut Distanz ab. Es entlastet nicht die Vergangenheit, sondern beschreibt die Hypotheken der Gegenwart. Die üblichen Reflexe wie «Rechtsperversion» oder «düsterstes Kapitel» genügen dann nicht mehr, um sich vor dem Nationalsozialismus in Sicherheit zu bringen. Im Gewebe der Normalität rückt uns der Nationalsozialismus näher, als uns lieb sein kann. Die Bühne ist geöffnet.