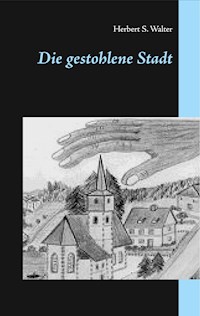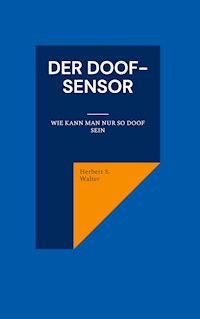
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Wie der Buchtitel vermuten lässt, geht es hier um die Doofheit in der Welt. Gestatten Sie mir eine kurze Frage vorab. Was ist unendlich? Gibt es das nur in der Mathematik oder auch in der Natur? Ist das Weltall unendlich? Die Wissenschaftler haben über Form und Ausdehnung des Universums verschiedene Theorien entwickelt. Nach meiner Meinung ist es endlich, denn wenn es unendlich wäre, bedeutete das unendlich viele Fixsterne und damit unendlich viel Licht. Der Nachthimmel wäre also diffus hell, ist er aber nicht. Und außerdem wissen wir, dass nach dem Urknall das Universum einen endlichen Raum einnahm und sich von da an ausdehnt, also endlich ist. Was aber anscheinend unendlich, grenzenlos ist, das ist die Doofheit der Menschen. In diesem Buch werde ich Fälle von Doof in den verschiedensten Lebensbereichen beschreiben. Es fängt schon in der direkten Umgebung an und endet bei der Doofheit der gesamten Menschheit. Dazwischen finden wir Doof in fast allen Lebensbereichen, in den verschiedensten Lebenssituationen und in allen Gesellschaftsschichten. Ich habe einen Doof-Sensor entwickelt, der spürt Doof in der Gesellschaft auf. Was der genau kann, wie er funktioniert, das erfahren Sie hier in diesem Buch. Lassen Sie sich positiv anstecken und gehen Sie selbst auf die Suche nach Doof. Viel Vergnügen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhalt
Vorwort
Kapitel 1
DOOF im Allgemeinen
1.1 Begriffserklärung: Sensor
1.2 Definition von DOOF
1.3 Die Funktion des DOOF-Sensors
1.4 Allgemeine Fälle von DOOF
1.5 Das Wachstum der Doofheit
Kapitel 2
DOOF in den oberen gesellschaftlichen Schichten
2.1 Vorstand eines Autokonzerns
2.2 Der Aktienhype im „Neuen Markt“
2.3 Greta, die Klimahysteriekindaktivistin
2.4 Die Abschreiber Schavan, zu Guttenberg
Kapitel 3
DOOF in den unteren gesellschaftlichen Schichten
3.1 Auto und Verkehr
3.2 Im Urlaub
3.3 Kinder und Erziehung
3.4 Mensch und Hund
3.5 Laut, primitiv, Sonstiges
Kapitel 4
DOOF in der Politik
4.1 Atomkraftwerke, Kohlekraftwerke
4.2 Asylpolitik
4.3 Heuchelei
4.4 Wohnraummangel
Kapitel 5
DOOF in der Arbeitswelt
5.1 Arbeiter im Park und Bauarbeiter
5.2 Behörden
5.3 Presse, TV, Moderatoren
Kapitel 6
DOOF Junge, DOOF Alte
6.1 DOOF Junge
6.2 DOOF Alte
Kapitel 7
DOOF, die Menschheit allgemein betreffend
7.1 Vermehrung in das eigene Ende hinein
7.2 Verdreckung bis zur eigenen Vergiftung
Fazit:
Anhang:
Vorwort und Einleitung:
Wie der Buchtitel vermuten lässt, geht es hier um die Doofheit in der Welt.
Gestatten Sie mir eine kurze Frage vorab.
Was ist unendlich?
Sie glauben, diese Frage passt überhaupt nicht zum Thema, beziehungsweise zum Buchtitel, dann lassen Sie sich überraschen. Am Ende des Buches werden sie feststellen, dass die Frage berechtigt war.
Also, was ist unendlich?
Gibt es das Unendliche nur in der Mathematik oder auch in der Natur? Ist das Weltall unendlich?
Die Wissenschaftler haben über Form und Ausdehnung des Universums verschiedene Theorien entwickelt, weil man in der Praxis nicht einfach zum Rand des Universums fliegen kann, um sich ein genaues Bild zu machen. Gibt es überhaupt einen Rand?
Nach meiner Meinung ist das Universum endlich, denn wenn es unendlich wäre, bedeutete das unendlich viele Fixsterne und damit unendlich viel Licht. Der Nachthimmel wäre also diffus hell, ist er aber nicht. Und außerdem wissen wir, dass nach dem Urknall erst der Raum überhaupt entstand, das Universum also einen endlichen Raum einnahm und sich von da an ausdehnt, also endlich war und damit endlich ist.
Was aber anscheinend unendlich, also grenzenlos ist, das ist die Doofheit der Menschen.
In jedem Kapitel dieses Buches werde ich Fälle von Doofheit in den verschiedensten Lebensbereichen beschreiben.
Zu meiner Person:
Geboren wurde ich in den fünfziger Jahren. Mein Vater war Arbeiter und meine Mutter war Hausfrau. Als mein Vater im Alter von siebenundzwanzig Jahren an einer Nierenkrankheit starb, war ich gerade vier Jahre alt. Seit ich mich bewusst erinnern kann, ging es mir trotzdem gut, obwohl wir weniger Geld zur Verfügung hatten als andere. In einer Straße, praktisch um die Ecke gelaufen, wie man bei uns sagt, wohnten meine Großeltern. Nach der Schule ging ich gerne da hin, denn dort hatte ich meine Freunde. Als die Schulzeit dann zu Ende war, ging ich in die Lehre, denn ich wollte Fernsehtechniker werden. Ich hatte zwar keine Ahnung, was mich erwartet, aber es hörte sich erst einmal gut an. Mein Chef fragte mich beim ersten Kontakt, was für eine Note ich im Rechnen hätte, mehr nicht. Ich sagte, dass ich die Note „gut“ auf dem Zeugnis hätte. Das war es. Ich durfte die Lehre beginnen. Mein Chef war streng, und ich lernte neben der Fernsehelektronik unter anderem auch Geduld, korrektes Arbeiten, Disziplin und Ordnung. Danach wurde ich zur Bundeswehr eingezogen. Ich kam in eine technische Einheit, es gefiel mir dort gut und deshalb entschied ich mich, Zeitsoldat zu werden. Mit einundzwanzig Jahren heiratete ich meine jetzige Frau und wir bekamen zwei Söhne. Während einer sechzehn Monate dauernden Ausbildung in den USA, bezogen wir dort ein kleines Haus und fühlten uns sehr wohl. Im Anschluss zogen wir nach Niedersachsen an den Standort meiner militärischen Einheit. Auch an diesem Ort hatten wir ein schönes Leben, es gefiel uns gut mit netten Freunden. Nach der Bundeswehr, ich war zwölf Jahre dabei, absolvierte ich ein Studium der Nachrichtentechnik mit Abschluss als Diplom-Ingenieur. Direkt im Anschluss arbeitete ich bei der Deutschen Telekom AG in der Technik und im Qualitätsmanagement bis zu meiner Pensionierung.
Der Anlass für dieses Buch liegt schon einige Jahre zurück. Ich hatte ja jetzt im Ruhestand mehr Zeit und konnte tagsüber bei Einkäufen, bei Spaziergängen, in Unterhaltungen, noch viel mehr von den Menschen des Alltags erfahren und beobachten.
Ich stellte fest, dass viele Menschen (nicht alle natürlich) oberflächlicher geworden waren gegenüber früher. Sie konsumieren heute planlos, sie werfen Konsumgüter schneller weg, sie schonen die erworbenen Artikel weniger, sie achten Werte weniger, und immer mehr Personen leben nach der Devise: „Brot und Spiele“, und so sehen sie dann auch aus.
Tattoos, früher nur bei Seeleuten zu sehen, trägt heute fast jeder, der zu einer bestimmten Schicht dazugehören will.
Fernsehsendungen als Dauerserien, fast rund um die Uhr ausgestrahlt, sollen Personen ganz bestimmter Gruppen mit gezielter Werbung manipulieren und sie zum Konsum animieren. Sie sollen von der Werbung abhängig gemacht werden. Und diese so angesprochenen Personen reagieren tatsächlich.
Viele der von mir beobachteten Handlungsweisen zeugen nicht von einem klugen Handeln, sind nicht der Ausdruck von hoher Bildung, sondern strahlen eher etwas von geistiger Ebbe aus, um es einmal etwas bildlicher zu beschreiben.
Salopp könnte man nach manchen Beobachtungen die Aussage treffen:
Wie kann man nur so doof sein!
Und das nicht als Frage gestellt, und deshalb ohne Fragezeichen.
Der Begriff DOOF kommt so vielseitig und so oft in ganz unterschiedlichen Zusammenhängen in allen Gesellschaftsschichten vor, dass ich mich in diesem Buch diesem alltäglich gebrauchten Wort widmen möchte. Das Buch könnte so viele Seiten haben, dass man mit dem Papier ganz Deutschland komplett und noch mehr abdecken könnte. Hier sind nur einige symbolische Beispiele beschrieben.
Kapitel 1
Begriffserklärungen
1.1 Begriffserklärung: Sensor
Der Buchtitel heißt: Der DOOF-Sensor.
Was ist ein Sensor?
Wir alle kennen die unterschiedlichsten Sensoren aus unserem täglichen Leben, wie beispielsweise das Thermometer, den Belichtungsmesser für den Fotoapparat, den Gassensor in der Heizungsanlage, der den CO-Wert misst, den Bewegungsmelder, um nur einige der vielen Sensoren zu nennen. Allgemein ausgedrückt kann man sagen: Ein Sensor erkennt aus einem gemischten Milieu genau diese Substanz, die Moleküle, die Strahlung, für die der Sensor gezielt entwickelt und konstruiert wurde.
Es gibt biologische Sensoren, die sich im Laufe der Millionen Jahre dauernden Evolution als sinnvoll für das Überleben herausgebildet haben. Ohne diese würde es das Leben auf unserer Erde, ob Pflanze oder Tier oder Mensch, so wie wir es heute kennen, nicht geben.
Und es gibt von Menschen entwickelte technische Sensoren, ohne die unsere moderne Welt nicht funktionieren würde.
Beide Sensortypen und zusätzlich noch einen dritten Typen, möchte ich Ihnen vorstellen und erklären, bevor Sie dann schließlich den DOOF-Sensor kennenlernen.
A) Biologische Sensoren:
Auge:
Das menschliche Auge hat sich im Laufe der Evolution so entwickelt, dass es für das Überleben des Menschen in seiner Umwelt genau das erkennt und bewertet, was für die Nahrungsfindung und Feinderkennung notwendig war, mehr nicht. Dazu muss es aus dem gesamten Lichtspektrum nur ganz bestimmte Wellenlängen aufnehmen können und die an das Gehirn umgewandelt weiterleiten, die von Nutzen sind.
Die langwelligere Wärmestrahlung wird von der Haut aufgespürt und bewertet, genauso wie die ultraviolette Strahlung.
Andere Lebewesen können für ihr Jagd- und für ihr Fressverhalten andere Frequenzen, beziehungsweise andere Wellenlängen als der Mensch aus dem gesamten Frequenzspektrum des Lichtes nutzen.
Ohr:
Das Ohr nimmt Schallwellen (wellenförmige Luftdruckunterschiede) auf, und kann dadurch in der Natur spezielle Geräusche nach Lautstärke und Richtung orten, auswerten und nutzen. Das war und ist zum Beispiel lebenswichtig, um anschleichende Raubtiere, bei Sturm abbrechende Äste, ein nahendes Gewitter oder Warnrufe von anderen Menschen wahrnehmen zu können. Dieses Aufnehmen und Bewerten von Schallwellen nennt man „hören“. Der Sensor Ohr kann aber noch mehr, denn im Ohr befindet sich auch noch das Gleichgewichtsorgan. Auch das ist ein Sensor, der in diesem Fall die Schwerkraft im Allgemeinen und auch die Richtung der Schwerkraft im Speziellen feststellen kann.
Nase:
Die Nase ist als Sensor so aufgebaut, dass sie die verschiedensten Moleküle in der Luft auch identifizieren kann. Auch diese Fähigkeit sicherte uns Menschen das Überleben in der Natur. Durch diese Fähigkeit des Riechens, konnte schnell aufgespürt werden, ob es in der Nähe brannte, weil die Rauchpartikel in der Nase Gefahr signalisierten. Aber die Nase kann noch viel mehr aus der Umwelt wahrnehmen, so kann sie auch Moleküle von bereits verwestem Fleisch aufnehmen und an das Gehirn weiterleiten, um uns so vor dem Verzehr dieses Fleisches zu warnen.
Haut:
Auch die Haut ist ein Sensor, und zwar ein sehr vielseitiger und ein sehr empfindlich reagierender Sensor. Für uns Menschen im Alltag ist das einfach selbstverständlich, was die Haut leistet, weil Sensorprozesse fast alle in unserem Unterbewusstsein ablaufen. An ein paar Beispielen möchte ich die Fähigkeiten unserer Haut einmal verdeutlichen.
Die Thermorezeptoren in unserer Haut empfangen und „messen“ die Außentemperatur, und unser Körper kann dann mit entsprechenden Maßnahmen reagieren, um unsere Körpertemperatur stabil zu halten. So können sich Blutgefäße vergrößern oder verkleinern, um so den Körper situationsbedingt zu wärmen oder zu kühlen.
Die Mechanorezeptoren reagieren auf die physische Verformung der Haut. Sie spüren die feinsten Unebenheiten beim Ertasten von Oberflächen. Diese Fähigkeit hat man sich bei der Blindenschrift zu Nutze gemacht. Beim „Lesen“ der Blindenschrift ertastet man mit den Fingern die minimalen erhabenen Schriftsymbole.
Andere starke Druckauswirkungen können etwa Gefahr bedeuten, dagegen sehr leichte, sanfte Berührungen wie das Streicheln, dagegen Liebe und Geborgenheit bedeuten.
Schmerzrezeptoren reagieren auf mechanische, thermische oder chemische Reize
Zunge.
Die Zunge ist ein Sensor, der die Nahrung daraufhin überprüft, ob sie salzig, süß, bitter oder sauer ist, auch diese sensorische Fähigkeit war für das Überleben von Anfang an wichtig.
Resümee der biologischen Sensoren:
Sie sehen, die Natur hat so einiges an Sensoren zu bieten. Aber alles das, was die Menschen heute noch zusätzlich aus der Umwelt wissen wollen, das können die natürlichen Sensoren nicht erkennen, wie zum Beispiel die radioaktive Strahlung.
B) Technische Sensoren:
Technische Sensoren messen, detektieren, spüren verschiedene definierte physikalische oder chemische Eigenschaften auf, die dann anschließend weitergeleitet werden an die Datenverarbeitungszentrale. Sie ist vergleichbar mit dem Gehirn bei den biologischen Sensoren. Im Rechenprozessor werden dann diese Messwerte mit den dort hinterlegten Sollwerten verglichen und gegebenenfalls einprogrammierte Maßnahmen aktiviert. Eine Maßnahme könnte ein lauter akustischer Alarm sein, eine andere könnte das Aktivieren einer Sprinkleranlage sein. Es gibt mittlerweile eine breite Palette an Sensoren, die für die Sicherheit der Menschen entwickelt worden sind.
Gassensoren für die Feststellung, für das Aufspüren von beispielsweise Ammoniak, Kohlenmonoxid, Kohlendioxid und Stickoxiden. Bewegungsmelder, die Bewegung in der Dunkelheit erkennen und dann als Maßnahme eine Hausbeleuchtung aktivieren.
Helligkeitssensoren, die bei dem Eintritt der Dunkelheit Straßenlaternen einschalten.
Andere Sensoren messen den Flüssigkeitsdruck oder sie sind Rauchmelder oder Luftdrucksensoren.
Wie gesagt, es gibt eine breite Palette für fast alle Arbeitsbereiche. Auch die intelligenten Überwachungskameras sind Sensoren, die technisch immer besser werden, aber dazu später etwas mehr.
C) Mentale Sensoren, Verhaltenssensoren:
Diese Sensoren sind noch nicht voll ausgereift, aber die Entwicklung in der Forschung schreitet schnell voran. Ich habe einen Forschungsbericht gesehen, in dem eine intelligente Kamera in der Lage ist, zwanzig verschiedene Stimmungen, Mimiken, Gefühle in einem Gesicht zu erkennen. Und das ist erst der Anfang. Die Sensoren der Zukunft werden einen Menschen scannen und von diesem dann Daten erfassen, und zwar von seinem Aussehen (Symmetrien, Größen, Gewicht, Anomalien), von seinen Gerüchen (Schweiß, Kot, Urin), von seiner Sprache, von seiner Beweglichkeit, von seiner Gesundheit, von seinem Intellekt und alles das, was einen Menschen noch ausmacht. Diese erfassten Daten werden dann mit einer vorher festgelegten, definierten Referenz-Datenbankperson auf Übereinstimmung verglichen.
Zurzeit, in der Gegenwart, wird diese Fülle an Informationen nur durch unsere biologischen und mentalen Sensoren erfasst, und zwar genau in unserem persönlichen Sinne, also genau nach unserem Charakter gefiltert und bewertet. Gefiltert durch die seit der Kindheit geprägten ganz persönlichen Vorurteile, die jeder Mensch hat. Und um so einen komplexen mentalen Verhaltenssensor geht es unter anderem im Folgenden. Speziell geht es um einen DOOF-Sensor.
Um die Funktion des DOOF-Sensors beschreiben zu können, muss ich vorab den Begriff DOOF erläutern.
1.2 Definition von DOOF
Bevor ich in diesem Buch die unterschiedlichsten Beispiele zu dem Begriff „doof“ aufzeige, möchte ich zuallererst eine gewisse Ordnung herstellen und einige verschiedene Varianten von „doof“ erklären.
„Doof“ wird nämlich so häufig und in so unterschiedlichen Situationen verwendet, dass unbedingt eine Begriffserklärung nötig ist.
Vorab fünf Beispiele, wo und wie „doof“ zur Anwendung kommt. Allein schon an den nur fünf kleinen alltäglichen Aussprüchen können Sie erkennen, wie vielfältig der Ausdruck „doof“ genutzt werden kann.
„Unser Lehrer ist doof.“
„Meine Haare liegen heute ganz doof.“
„Mathe ist doof.“
„Die doofe Ampel hat auf Rot geschaltet.“
„Ich habe mich am doofen Tischbein gestoßen.“
Was sagen uns diese Beispiele?
Zu 1. Ein Lehrer ist mit Sicherheit fachlich und pädagogisch in seinem Studium gut ausgebildet worden. Er ist bestimmt nicht dumm und nicht ungebildet. Und da die Beurteilung, dieser Satz, wahrscheinlich von einem Schüler oder einer Schülerin ausging, der oder die aus Gründen der eigenen Inkompetenz diesbezüglich gar nicht urteilen kann, muss „doof“ hier etwas anderes bedeuten.
„Doof“ bedeutet in diesem Fall wohl, dass der Lehrer zu streng ist, zu viele Hausaufgaben aufgibt oder keinen Spaß aus der Sicht der Kinder versteht. Mit nur einem einzigen Begriff kann also sehr viel ausgesagt werden, und die Kinder untereinander wissen sofort, was in diesem Fall „doof“ bedeutet.
Zu 2. Die Haare können dem sie formenden Kamm folgen und in der gekämmten, gewünschten Weise liegenbleiben. Dann liegen die Haare gut und nicht doof. Die Haare können aber durch statische Aufladung oder wenn sie von Natur aus kraus oder gelockt sind, eben nicht so liegenbleiben, wie der Kamm sie formen wollte. Sie kringeln sich, kräuseln sich oder stehen ab. Sie können aber auch schmutzig sein oder fettig sein und angeklatscht am Kopf anliegen.
Es gibt so viele Möglichkeiten, das Liegen der Haare zu beschreiben. Aber mit dem Satz: „Meine Haare liegen heute ganz doof“, ist einfach alles gesagt. Jeder versteht es.
Der Ausdruck beschreibt hier solche Gefühle, wie beispielsweise „ärgerlich“ oder „unmöglich“, aber bestimmt nicht „dumm“.
Zu 3. Dieser Spruch ist besonders speziell, denn hier geht es nicht um einen Menschen wie den Lehrer oder um einen materiellen Gegenstand wie die Haare, nein, hier geht es um eine Tätigkeit, nämlich das Lernen von mathematischen Regeln, Algorithmen, Sätzen, beziehungsweise um den Mathematikunterricht. Wie kann das alles doof sein nach unserem Verständnis?
Gemeint ist aber damit, dass das Lehrfach Mathematik von manchen Schülern unangenehm, unerfreulich, zu anstrengend, den Spaß verderbend, empfunden wird.
Zu 4. Hier passt der Ausdruck „doof“ im Zusammenhang mit dumm oder unintelligent tatsächlich, jedenfalls vom Prinzip her.
Mittlerweile ist die technische Entwicklung so weit vorangeschritten, dass es tatsächlich intelligente Ampeln gibt. Das sind Ampeln, die durch Sensoren (Achtung: Wieder ein Sensor) gesteuert auf den aktuellen Verkehrsfluss, sowie auf wartende Fußgänger reagieren. Wir nähern uns einer Ampel, und diese schaltet gerade für unsere Richtung auf Rot, weil das Ampelsystem andere Verkehrsbewegungen gegenüber der unseren priorisiert hat.
Mit „doof“ empfinden wir hier, dass die Ampel schwachsinnig, unsinnig, geistlos, eben wie eine dumme Maschine zu unseren Ungunsten auf Rot geschaltet hat. Dem war aber nicht so.
Zu 5. Ein Beispiel, wie es jedem schon einmal ergangen ist, oder fast jedem, mir jedenfalls schon mehrmals.
Wir sind in Eile, bedienen vielleicht unsere Gäste, wollen alles schnell und gut erledigen und plötzlich in unserer Unaufmerksamkeit stoßen wir mit dem Fuß gegen ein Stuhlbein. Natürlich hatten wir in diesem Moment gerade keine Schuhe oder Pantoffeln angezogen. Es schmerzt und wir sind wütend.
Selbstverständlich sind wir nicht schuld. Wir sind nicht ärgerlicherweise, fatalerweise, dummerweise vor das Stuhlbein getreten, nein, schuldig war das „doofe“ Stuhlbein.
Wir sind sowieso nie schuldig.
Synonyme für „doof“:
An dieser Stelle passen aus meiner Sicht ein paar bedeutungsgleiche oder bedeutungsähnliche Begriffe für „doof“, die ich versuche zu ordnen:
Abwertend bis kränkend:
dumm, dämlich, schwachsinnig, idiotisch, hirnverbrannt, dümmlich, einfältig, dämlich, geistlos, hirnlos
abwertend:
töricht, lächerlich, stupide, dusselig, eselhaft, begriffsstutzig, beschränkt
gehobene Sprache:
unerquicklich, unbedarft, misslich, unsinnig, daneben
Unterschichtsprache:
blöd, behämmert, bekloppt, beknackt, bescheuert, beschissen
Eher gut gemeint:
blauäugig, simpel, einfallslos, naiv, gutgläubig, unbeholfenes Verhalten, unüberlegtes Handeln, also Handeln, ohne die Folgen zu bedenken.
Modesprache abwertend:
grenzdebil, geistig unterbelichtet, gehirnamputiert, bildungsresistent.
Der Ausdruck „doof“ wird auch oft im Zusammenhang mit den bekannten Schildbürgern benutzt.
Die so genannten Schildbürgerstreiche:
Das sind erfundene Geschichten, die handeln von Bürgern einer erfundenen Stadt Schilda vor ein paar hundert Jahren, in denen lustig von „schlauen“ Taten der Menschen erzählt wird. Damit Sie ungefähr eine Ahnung haben, worum es geht, hier ein kleiner Auszug:
Um eine wertvolle Glocke vor dem Zugriff des Feindes zu schützen, versenken die Schildbürger sie im See. An der Stelle im See, wo die Glocke abgelassen wird, schnitzen sie in den Bootsrand eine Kerbe ins Holz. Dann rudern sie zufrieden nach Hause. Sie wissen jetzt, an welcher Stelle sie die Glocke versenkt haben. Hahaha.
Zwei Beispiele aus unserer Zeit:
Aussichtsplattformen an Autobahnkreuzen. Dieser Fall wird später noch genauer beschrieben.
Brückenbau ohne Straßenanbindung im freien Feld.
Ein paar Bemerkungen, Beobachtungen, Erkenntnisse von mir:
Ein gebildeter, intelligenter Mensch kann in bestimmten Situationen trotzdem doof handeln, obwohl er nicht dumm ist.
Ein intelligenter, gebildeter Mensch kann sich doof stellen, ein dummer Mensch kann sich nicht so verstellen, dass er als intelligenter Mensch wahrgenommen wird.
Die Doofen machen jeden Trend schnell mit, so, als könnten sie etwas verpassen. Sie geben beispielsweise das letzte Geld für das aktuelle Tattoo aus.
Die Doofen merken gar nicht, wie doof sie sind, weil sie nicht reflektieren können. In deren Lebensumfeld zählt nur der Status in der eigenen, im Horizont geschrumpften Welt.
Die Doofen merken gar nicht, dass sie auf einem niedrigen Niveau verharren, aber gleichzeitig andere an ihnen vorbeiziehen. Sie haben eben andere Wertvorstellungen.
Die Doofen merken gar nicht, dass sie sich durch äußere Signale oder Symbole in die Gruppe der Doofen selbst hinein definieren.
Die Doofen merken gar nicht, dass ihre Zukunft nur in sehr engen Grenzen liegt.
Die Doofen merken gar nicht, dass sie nur benutzt werden, wenn sie auf jede mögliche Art und Weise auf Konsumwerbung reagieren.
Nachrichten werden kritiklos hingenommen, ohne diese zu hinterfragen, oder diese werden überhaupt nicht wahrgenommen.
Die Doofheit streut und vermehrt sich wegen es exponentiellen Wachstums wie ein Krebsgeschwür. Doch dazu unter Punkt 1.5 etwas mehr.
Es gibt DOOF in den oberen gesellschaftlichen Schichten genauso wie in den unteren gesellschaftlichen Schichten.
Es gibt DOOF im Großen genauso wie DOOF im Kleinen.
Aber:
Ist Doofheit immer gleichzusetzen mit Dummheit?
Nein, jedenfalls nicht in jedem Fall, wie ich bereits beschrieb.
In den folgenden Kapiteln, in denen ich selbst beobachtete, gelesene, oder im Fernsehen gesehene Fälle beschreibe, können Sie bitte selbst beurteilen und einordnen, welcher Grad an DOOFHEIT vorlag.
Doch vorher noch eine kleine Geschichte eines Mannes, der zu dem Thema einen Satz geprägt hat, der mir zeitlos gut gefällt.
Fred Endrikat1 (1890 – 1942), prägte den Spruch:
„Das größte Leiden ist zu stillen, nur: Doof bleibt doof, da helfen keine Pillen.“
Das ist die Aussage aus einem Vierzeiler.
Fred Endrikat wuchs als Bergmannssohn mit seinen sechs Geschwistern in Wanne-Eickel auf.
Früh merkte er, dass ihm das Schlosserhandwerk und die Arbeit als Bergmann nicht lagen. Er brach diese Ausbildungen ab und schrieb lieber Gedichte und Sketsche, die er auf einer örtlichen Kleinkunstbühne vortrug. Es waren humoristische, satirische, gesellschaftskritische Gedichte.
Nach dem ersten Weltkrieg erweiterte er seinen Wirkungskreis und kam in vielen Städten mit Lesungen und Kabarettauftritten bei dem Publikum gut an.
Er lebte überwiegend in Süddeutschland und starb mit zweiundfünfzig Jahren.
Eine Straße ist in Wanne-Eickel nach ihm benannt.
Ich habe diesen Mann kurz beschrieben, weil er mit seinem Spruch über die Doofheit genau den Sinn dieses Buches trifft.
Andere Weisheiten von mir unbekannten Menschen:
Die Dummheit ist die sonderbarste aller Krankheiten! Der Kranke leidet nie unter ihr. Die, die leiden, sind die anderen.