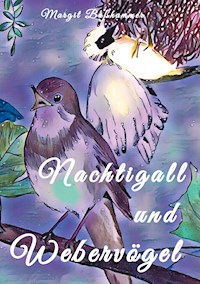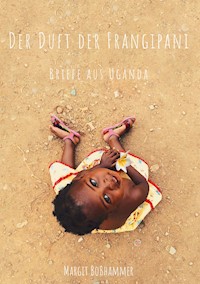
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Es handelt sich hierbei um einen Brief-Roman, der auf tatsächlichen Erfahrungen eines zweieinhalb jährigen Missionseinsatzes in Ostafrika der Autorin beruht. Er eröffnet einen facettenreichen Einblick in das Leben und die Kultur Zentralugandas und handelt unter anderem von der missionsmedizinischen Arbeit unter den widrigen Bedingungen des dortigen Gesundheitssystems und den täglichen Herausforderungen der schwer von Armut betroffenen Bevölkerung. Gleichzeitig ist dies ein Roman, der persönlich wird: Die Leserin/ der Leser begleitet die Missionarin Johanna durch die Briefe, die sie ihrem Freund Marlon regelmäßig aus ihrem Missionseinsatz schreibt durch ein Spannungsfeld aus unbändiger Freude und tiefer Trauer, aus Faszination und Entsetzen, aus Glaube und Zweifel. Sie schreibt in starken Bildern von ihren Erlebnissen als Krankenschwester in einer Gesundheitsstation auf dem Land, vom Leben ohne Elektrizität und Wasserleitungen, von Hühnern im Krankenzimmer, von aufrichtiger Freundschaft und tiefen Begegnungen mit ganz besonderen Menschen. Und dann taucht unvermittelt noch ein Thema auf, dass offensichtlich vor keiner christlichen Denomination Halt macht: Machtmissbrauch gegenüber Schutzbefohlenen oder in Abhängigkeit stehenden Menschen. Zum Schutz von Persönlichkeitsrechten sind die im Buch genannten Namen frei erfunden. Die Frangipaniblüte aus dem Buchtitel steht hier metaphorisch für das Spannungsfeld der Erzählung: Ihr Duft und Anblick sind wunderschön, ihr Saft hingegen ist hochgiftig.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 169
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
Kapitel EINS
Kapitel ZWEI
Kapitel DREI
Kapitel VIER
Kapitel FÜNF
Kapitel SECHS
Kapitel SIEBEN
Kapitel ACHT
Kapitel NEUN
Kapitel ZEHN
Kapitel ELF
Kapitel ZWÖLF
Kapitel DREIZEHN
Kapitel VIERZEHN
Kapitel FÜNFZEHN
Kapitel SECHZEHN
Kapitel SIEBZEHN
Kapitel ACHTZEHN
Kapitel NEUNZEHN
Kapitel ZWANZIG
EINUNDZWANZIG
EPILOG
PROLOG
„Ich bin angekommen! Zumindest körperlich“, schrieb ich in einem meiner ersten Briefe aus Uganda an meinen besten Freund Marlon. Ein Hamburger Pfarrer hat mal sehr treffend den Satz: „Die Seele geht zu Fuß“ formuliert. Denn physisch mag man die etwa sechstausend Kilometer in knappen zwölf Flugstunden überwinden können, es ist jedoch viel mehr, was es zu überwinden gilt, als nur die räumliche Distanz zwischen Frankfurt am Main und Entebbe Flughafen. Die Seele braucht zeitlich doch um Einiges länger, um diesen „Weltenwechsel“ aus der vertrauten Heimat in eine neue fremde Umgebung zu verarbeiten.
Im Februar 2015 flog ich als Kinderkrankenschwester mit einer christlichen Hilfsorganisation nach Uganda. Der ostafrikanische Binnenstaat grenzt im Norden an den Süd Sudan, im Osten an Kenia, im Süden an Tansania, im Südwesten an Ruanda und im Westen an die Demokratische Republik Kongo. „Die Perle Afrikas“ wird Uganda auch genannt. Diesen Namen trägt es aufgrund seiner prächtigen Natur und Fruchtbarkeit, die es wiederum seinen zwei mehrere Wochen anhaltenden Regenzeiten im Jahr verdankt. Es zählt zu den ärmsten Ländern der Welt.
Ich verließ für viele Monate meine Heimat, um Gott und den Menschen in Uganda zu dienen, sowohl in meinem Beruf, den ich über alles liebe, als auch in meiner Rolle als Botschafterin Jesu, den ich auch über alles liebe.
Für die Dauer meines Einsatzes musste ich Einiges loslassen: Die Gemeinschaft mit Freunden und Familie, meine Sprache, meine Kultur und natürlich auch meine Komfortzone. Auch das (vermeintliche) Gefühlt der Sicherheit Deutschlands, so manche eingefahrenen Gewohnheiten und auch meine finanzielle Unabhängigkeit.
Ich durfte allerdings die wundervolle Erfahrung machen, dass im gleichem Augenblick, als ich losließ und meine Hände öffnete, Gott sie ganz neu und überreich füllte. So wurde ich in Uganda nicht nur zu einer gebenden, sondern in ebensolchem Maße zu einer empfangenden und reich beschenkten Frau.
Zum Zeitpunkt meiner Rückkehr hatte ich Erfahrungen in meinem Reisegepäck, die in vielerlei Hinsicht mein weiteres Leben geprägt haben.
In Uganda war ich „anders“ als die Menschen mit denen ich fortan lebte und arbeitete. Ich fiel auf, durch mein Aussehen, meine Hautfarbe, meine Kleidung und meine Lebensgewohnheiten. Ich unterschied mich durch meine gewohnheitsmäßigen Herangehensweisen im Alltagsleben und meinen kulturell verinnerlichten Wertvorstellungen.
Das Geschenk jedoch, das mir in der persönlichen Begegnung mit Ugandern zu Teil wurde, war eine Herzenshaltung, die über all mein „anders“ sein hinweg zu sehen vermochte und mir vermittelte:
„Du bist Willkommen. Es ist schön, dass Du da bist. Ja, Du bist ganz anders als ich, aber ich möchte, dass Du Dich zu Hause fühlst, auf meinem Sessel sitzt und meinen Tee trinkst. Ich wünsche mir, dass wir einander begegnen.“
Ich habe in Uganda eine Offenheit und Herzlichkeit erfahren, die mich tief bewegte, und zugleich vieles von dem aufdeckte, an dem es in meiner eigenen Kultur leider zu oft fehlt: Echte, tiefe und aufrichtige Gastfreundschaft gegenüber den Menschen anderer Kulturkreise.
Die Zeit in Uganda war mir eine Lehrerin, liebevoll aber streng. Unbändige Freude und tiefe Verzweiflung reichten einander manchmal die Hand. Wunder ereigneten sich vor meinen Augen, während Gott in anderen Situationen zu schweigen schien. Licht und Finsternis, Hoffnung und Wut, Glaube und Schmerz bildeten das Spannungsfeld, in dem ich mich von einem Moment auf den anderen bewegen musste. Und ich lernte neue Facetten von diesem unfassbaren Gott kennen, dessen Nähe ich mir in jedem dieser Augenblicke bewusst sein durfte. Auch, und vielleicht sogar ganz besonders, in den schweren.
EINS
15. Februar 2015
Lieber Marlon,
Jetzt bin ich wahrhaftig in Afrika angekommen. Körperlich mag ich nun in Uganda sein, mein Inneres ist jedoch noch am Verarbeiten des Kulturwechsels. Die letzten Wochen waren so sehr von organisatorischen Aufgaben und Vorbereitungen für meine Abreise erfüllt, dass ich nun erst einmal begreifen muss, dass Kurse und theoretische Schulungen für dieses Projekt nun hinter mir, und die realen Aufgaben unmittelbar vor mir liegen.
Ach Marlon, wie kann ich Dir nur beschreiben, welche Eindrücke und Bilder in den Stunden seit meiner Ankunft hier auf mich einwirkten. Wie kann ich Dir vermitteln, wie es sich anfühlte in der Dunkelheit des frühen Morgens aus dem Flugzeug zu steigen und den ersten Atemzug unter ugandischem Himmel zu nehmen? Nachdem ich am Flughafen mein Touristenvisum erhalten, und meinen Koffer am Förderband in Empfang genommen hatte, wurde ich draußen vor dem Ausgang von meiner neuen Kollegin Sara herzlich begrüßt. Sara holte mich in Begleitung eines ugandischen Mitarbeiters namens Mukisa vom Flughafen ab; mit ihr werde ich voraussichtlich den größten Teil meines Missionseinsatzes verbringen. Während sie das Auto sicher durch das Verkehrschaos der nächtlichen Hauptstadt Kampala lenkte, prasselten bereits so vielen Eindrücke auf mich ein, dass ich sie kaum alle gleichzeitig verarbeiten konnte. Am liebsten würde ich Dich mit auf die nun folgende Fahrt mit dem Jeep zur Missionsstation auf den Straßen Ugandas nehmen. Durch den kleinen geöffneten Spalt des Wagenfensters vernahm ich die Gerüche köchelnden Essens, die aus verbeulten Töpfen am Straßenrand aufstiegen und den beißenden Rauch von zahlreichen qualmenden Feuerstellen. Die Autoreifen wirbelten roten Staub auf, während sich viele Menschen auf den Gehsteigen aufhielten. Der Geräuschpegel und die Lebendigkeit der nie schlafenden Stadt waren beeindruckend. Dann war da die laute Musik, die aus großen Lautsprecherboxen mit vibrierendem Bass erschallte und das Geknatter der unzähligen Mopeds, die sich an uns vorbei durch die vollgestopften Verkehrswege quetschten. Ich war froh, als wir diesen Trubel hinter uns ließen. Sara hatte sich so sehr auf das Fahren konzentrieren müssen, dass sich erst jetzt die Gelegenheit für eine Unterhaltung mit ihr und Mukisa bot.
Nachdem wir die Stadt in südwestlicher Richtung verlassen hatten, ging es über einen buckeligen, mit Schlaglöchern durchsetzten Highway ins bergige Hinterland. Wenn Du nur sehen könntest, wie im Morgengrauen die ersten Sonnenstrahlen den Anblick dieser riesigen, tiefgrünen Täler freigaben, über denen noch vereinzelte Nebelschwaden hingen. Ich möchte Dir die meterhohen Papyruspflanzen mit ihren vielstrahlenden Blütendolden und die vollen Bananenstauden zeigen. Auch die Mangobäume, deren Äste sich unter der Last ihrer gelbroten Früchte biegen, hättest Du sehen sollen. Riesengroße Schmetterlinge flatterten zwischen mannshohen Termitenhügeln umher. Der Anblick roter Erde, riesiger Teefelder und Kaffeeplantagen sowie all die Pracht und Schönheit der Natur, die der nahende Tag und die goldene Sonne nach und nach offenbarten, war überwältigend. Vier Stunden später erreichten wir dann unseren Zielort.
Derzeit sind noch zwei weitere Krankenschwestern hier vor Ort, sie werden in wenigen Wochen ihren Einsatz beenden. Auch von den Beiden wurde ich sehr liebevoll empfangen. Es ist schön und beruhigend, dass ich Sara bereits aus den Vorbereitungskursen ein wenig kenne. In all dem Neuen ist es wohltuend, einen bereits vertrauten Menschen um mich zu haben.
Gerne möchte ich Dir nun auch noch beschreiben, wie wir hier leben. Das Wohnhaus für die deutschen Missionare befindet sich in unmittelbarer Nähe des Dorfes und in direkter Nachbarschaft zur anglikanischen Kirche, mit der wir hier als Christliche Hilfsorganisation die Dorfgesundheitsstation führen. Das Haus steht auf einem von einer dichten Hecke und einem großen blauen Metalltor abgegrenzten Gelände, das wir Compound nennen. Wir befinden uns hier auf einem Bergplateau auf 1600 Metern. Stromleitungen wurden bisher noch keine nach hier oben gelegt, von fließendem Wasser ganz zu schweigen. Dennoch leben wir Missionare gegenüber den Dorfbewohnern sehr komfortabel und privilegiert. Eine Solarstromanlage ermöglicht die Inbetriebnahme eines Kühlschrankes, einfacher Beleuchtung und das Laden der Akkus von Laptops und Mobiltelefonen. In mehreren Großwassertanks wird während der Regenzeit Wasser gesammelt. Mithilfe eines Hochtanks und einer Pumpe haben wir im Haus auch fließendes Wasser. Als Toiletten dienen Latrinen außerhalb des Hauses.
Es gibt zwei herzliche einheimische Hausmädchen, die ich vom ersten Augenblick an sehr ins Herz geschlossen habe und die uns tüchtig bei der Alltagsarbeit helfen. Das mag sich erst einmal befremdlich anhören und ich muss mich auch noch an den Gedanken gewöhnen. Es gehört aber wohl zum guten Ton, dass man als Hilfsorganisation so viele Arbeitsplätze wie möglich zur Verfügung stellt und damit die Möglichkeit für Menschen schafft, etwas Geld für ihre Familien zu verdienen. Es würde sogar als Geiz betrachtet werden, wenn wir unsere Wäsche selbst machten und das Haus in Ordnung hielten ohne einer Uganderin die Chance dazu zu geben. Und ganz ehrlich - wenn ich selbst meine Arbeitskleider blitzeweiß waschen, und mit einem gusseisernen Holzkohlebügeleisen glätten müsste, so wären sie in kürzester Zeit unansehnlich und mit Brandflecken durchlöchert. Kleidung ohne Waschmaschine wirklich rein zu waschen ist richtig schwere Arbeit. Was auch unsere Großmütter und Urgroßmütter alles geleistet haben… in mancherlei Hinsicht ist Afrika für mich auch ein Art Zeitreise.
Behati und Nalongo heißen die beiden fröhlichen Frauen, die uns so toll unterstützen.
Dann gibt es noch Mutebi und Kintu, die Hauswächter. Um die Haus- und Gerätetechnik, Wartung, Reparaturen und kleinere Bauprojekte kümmert sich Mukisa. Und dann ist da noch Jona, eigentlich Jonathan, der sich immer mal ein Taschengeld mit kleinen Jobs dazu verdient – aber ganz besonders gerne einfach auf einen Plausch mit den „Muszungus“ vorbeikommt. So viele Namen! Ich bin mir jedoch sicher, dass Dir diese Namen in zukünftigen Briefen immer wieder begegnen werden, leben und arbeiten diese Menschen doch fortan sehr eng an meiner Seite.
Mein kleines Zimmer ist sehr einfach und schlicht, aber behaglich. Eine niedrige, geflochtene Bambuskommode dient mir als Kleiderschrank; darauf stehen eine Handvoll Bücher und eine Box mit all den lieben Briefen, Karten und Segenswünschen, die ich zur Missionsaussendung erhielt. In einer zierlichen Vase auf meinem Nachttischchen steht eine wunderschöne große Blüte, die mir an meinem Ankunftstag vor die Füße fiel. Der Baum, der diese prachtvollen weißgelben Blüten trägt, hatte sie einfach abgeschüttelt, als ich unter ihm hindurchging. Frangipani heißt sie. Ihr Duft ist betörend, ihr Saft hingegen aber giftig.
Ein wackeliger, in die Jahre gekommener dunkelbrauner Schreibtisch mit schwergängigen Schubladen und angelaufenen Beschlägen steht direkt neben meinem Bett vor dem Fenster, davor ein einfacher Stuhl aus Holz. Seit etwa zwanzig Jahren sitzen nun schon Missionarinnen und Missionare in diesem Haus, in diesem Zimmer an diesem Tisch und lesen im Kerzenschein in ihren Bibeln, schreiben Briefe oder wälzen Fachbücher der Tropenmedizin. Auch ich bereite mich in den Abendstunden auf meine Prüfung zur beruflichen Anerkennung beim Gesundheitsministerium in Kampala vor, damit ich meine offizielle Arbeitserlaubnis und ein langfristiges Visum erhalte. Gerade eben habe ich mich durch die Fragensammlung gearbeitet, die in den letzten Jahren bei meinen Vorgängern prüfungsrelevant waren. Sara hat mir den Ordner zur Durchsicht bereitgelegt, damit ich eine ungefähre Idee davon bekäme, worauf ich mich einstellen könne. Jetzt bin ich doch etwas nervös – die tropenmedizinische Ausbildung war so reichhaltig, da brauche ich dringend Gottes Führung, damit ich die richtigen Themen wiederhole und lerne. Bete doch bitte für diese Prüfung und meine Vorbereitung darauf!
Bis ganz Bald!
Deine Johanna.
ZWEI
05.März 2015
Lieber Marlon,
wo fange ich nur an zu erzählen? Vielleicht mit den ersten wertvollen zwischenmenschlichen Begegnungen, die ich haben durfte.
Als ich zum ersten Mal in der Früh den etwa fünfzehn minütigen Fußweg zu meiner zukünftigen Arbeitsstätte antrat, da hielt ich bereits nach wenigen Schritten an jeder Hand zwei kleine feuchte Kinderhändchen. Drei weitere Kinder liefen fröhlich und neugierig neben mir her. Bis dahin wusste ich lediglich, wie man sich auf Luganda, der hier gesprochenen Stammessprache, begrüßt: „Je baleko!“ Ich verstand dennoch schnell, dass die Kinder meinen Namen wissen wollten. Seit meiner Ankunft wurde mir des Öfteren das Wort „Muszungu“ (Weiße) hinterhergerufen, oder in meiner Rolle als Krankenschwester „Sister“ oder „Sissita“. Jetzt bin ich also „Sissita Johanna“.
Die jungen Weggefährten, die mich seither täglich barfuß und in zerschlissenen Hemdchen begleiten, sobald ich das blaue Tor durchschreite, heißen Mali, Ruthi, Sseka, Jenn und Timi. Mali ist mit acht Jahren die Älteste und Timi schätze ich auf höchstens zwei. Er hat immer eine laufende Nase und spricht noch nicht.
Die fröhlichen Geschwister laufen und springen neben mir her und quasseln ohne Punkt und Komma, ganz ungeachtet dessen, dass ich keines ihrer Worte verstehen kann.
Es erscheint mir, als bestünde dieses Dorf nahezu nur aus Kindern. Das ist richtig schön, denn in ihrer unbeschwerten und fröhlichen Art prägen sie ihre Umgebung immens. Uganda gilt als die „Republik der Kinder“, da der Altersdurchschnitt der Bevölkerung nur bei fünfzehn Jahren liegt. In Deutschland hingegen liegt er um die fünfundvierzig.
An meinem Arbeitsplätz, dem Healthcenter (ich werde es in meinen Erzählungen wohl oft einfach mit HC abkürzen), erfuhr ich im Laufe der Woche, dass meine neuen jungen Freunde Teil der mit Abstand ärmsten Familie im Dorf sind. Ihre Mama Naomi hatte keine Schulbildung genossen und war sehr früh mit ihrem ersten Kind schwanger geworden. Sie war seither immer wieder an Männer geraten, die sie ausnutzten, sie schlugen, erneut schwängerten und dann im Stich ließen. So waren inzwischen fünf Kinder zur Welt gekommen – und das sechste ist derzeit auf dem Weg. Ohne jedwede Unterstützung und unter den teilweise verurteilenden Augen der Dorfgemeinschaft, muss Naomi irgendwie für ihre Familie sorgen. Die ganze Familie gilt angeblich als „schlechter Umgang“, und Mama Naomi als moralisch verkommen. In mir löst ihre Geschichte in erster Linie Mitgefühl aus und ich spüre jetzt schon, dass mein Herz zu dieser Familie sehr stark hingezogen wird.
Ein weiterer nachbarschaftlicher Kontakt ist zu Jona entstanden. Er ist noch recht jung, neunzehn oder höchstens zwanzig. Er kommt aber wohl schon seit vielen Jahren regelmäßig zum Haus der Missionare, um über die Bibel zu sprechen. Während meiner Ankunftswoche kam er auch sogleich auf einen Besuch vorbei, um mich in Uganda willkommen zu heißen und kennen zu lernen. Nun waren die meisten meiner Vorgängerinnen und Vorgänger richtig zu Missionaren ausgebildet worden und hatten Jahre in Bibelschulen verbracht. Auf viele von Jonas Fragen hätten sie sicher sehr viel bessere Antworten gehabt als ich, die ich selbst noch so viele Fragen habe. Vielleicht kann ich ihm Jesus auf meine Weise, über die Herzensebene näher bringen, so, wie ich selbst ihn erfahren und kennengelernt habe.
Aber nun wird Dich sicher sehr interessieren, wie es mir mit der Arbeit am HC bisher ergangen ist. Offiziell darf ich bis zum Erhalt meiner Berufserlaubnis erstmal nur an Saras Seite arbeiten.
Ich bin nicht sicher, ob Du in etwa eine Vorstellung vom Gesundheitssystem in Uganda hast, daher fasse ich zum besseren Verständnis noch mal ein paar Infos für Dich zusammen. Bei einem Verhältnis von 0,08 Ärzten pro 1000 Einwohner wird die Basisgesundheitsversorgung in diesem Land stufenweise gewährleistet. So gibt es HCs der Kategorien eins bis vier, Distriktkrankenhäuser und große Privatkrankenhäuser. Du kannst Dir das wie eine Pyramide vorstellen. Die breite Basis bilden die Healthcenter der Kategorien eins bis drei, sie werden komplett ohne Ärztinnen und Ärzte geführt. Da es sehr viele Dörfer gibt, die sich sehr weit vom nächsten Highway, einer Stadt oder einem Krankenhaus entfernt befinden, wird in diesen Orten das niederschwelligste Versorgungslevel von sogenannten Village - Healthworkern gewährleistet. Das sind Frauen oder Männer, die ein mehrtägiges Training absolviert haben, um bei erkrankten Nachbarn und Nachbarskindern „Gefahrenzeichen“ zu identifizieren, wie zum Beispiel Anzeichen von Dehydrierung, Fieber oder andere Symptome, die eine medizinische Behandlung erfordern.
Unser HC hier am Einsatzort hat die Kategorie drei und liegt damit im mittleren Versorgungssegment. Die Spitze bilden dann die Krankenhäuser in den Städten, von denen es eben nur wenige gibt – so wie es eben auch grundsätzlich zu wenige Mediziner im Land gibt.
Meine Arbeitsstätte besteht aus einer OPD (Outpatient- Department), jeweils einer Männer- und einer Frauenstation sowie einer Entbindungseinheit. In der OPD stellen sich die Patienten mit den verschiedensten Erkrankungen oder Verletzungen vor. Dies ist vielleicht am ehesten vergleichbar mit einer Allgemeinarztpraxis bzw. Notaufnahme. Wenn die Indikation zur engmaschigeren Überwachung besteht, dann können unsere Patienten auch stationär aufgenommen werden.
Die medizinische Leitung obliegt einem Medical Officer. Dieses Berufsbild gibt es in Deutschland nicht, die Ausbildung beinhaltet weniger als ein vollständiges Medizinstudium, aber deutlich mehr als die Krankenpflegeausbildung. Ansonsten besteht unser Team aus examinierten einheimischen Krankenschwestern und Hebammen, sowie Pflegehelferinnen. Sollten Patienten unsere medizinischen Behandlungsmöglichkeiten und Kompetenzen überschreiten, erfolgt die Überweisung oder Verlegung in ein HC IV - oder direkt in das nächste Distriktkrankenhaus.
Ich möchte Dir eines meiner ersten Erlebnisse etwas genauer schildern, welches sich vor ein paar Tagen ereignete. Im Wartebereich draußen unter dem Wellblechdach saß still und geduldig eine junge Frau und wartete darauf, an die Reihe zu kommen. Als sie schließlich eintrat, wickelte sie einen vier Wochen alten Säugling aus mehreren Tüchern aus. Ich kann Dir kaum meine tiefe Bestürzung beschreiben, die der Anblick dieses Kindes in mir auslöste. Der kleine Junge hatte nur noch ein zartes Gewicht von 1800 Gramm. Seine Fontanelle war extrem eingesunken und es zeichneten sich die feinen Schädelnähte unter der dünnen Haut ab. Auch ein akuter Sauerstoffmangel war nicht zu übersehen. In die eingesunkene Fontanelle, so übersetzte mir die Pflegehelferin, hatte ein Heiler eine Kräutermischung gestreut. Als das Kind nicht mehr an der Brust trank, so erfuhren wir von der Mutter, hatte sie versucht es mit Kuhmilch zu füttern, was das Kind überhaupt nicht vertrug. Die Körpertemperatur des kleinen Patienten betrug 33 Grad und der Blutzucker war extrem niedrig. Kannst Du Dir vorstellen Marlon, dass eine Mutter mit so einem todkranken Kind demütig und still im Wartebereich sitzt und sich nicht traut zu fragen, ob sie wohl noch vor den anderen Wartenden drankommen könnte? Gerade kommen mir Szenen aus meiner Uni Kinderklinik in Deutschland von ungeduldigen und mitunter auch unfreundlichen Eltern in den Sinn, die mit ihrem Kind dreißig Minuten warten müssen, mit dem sie wegen Ohrenschmerzen oder ähnlichem in der Notaufnahme sitzen. Aber derlei Gedanken führen zu nichts – es ist einfach eine andere Welt aus der ich komme.
Diese Situation mit dem kranken Säugling hat mich gelehrt, zukünftig regelmäßig einen genaueren Blick auf die wartenden Patienten zu werfen, denn in dieser Kultur ist es nicht üblich, sich in den Vordergrund zu drängen, selbst dann nicht, wenn ein Mensch schwer krank ist.
Bei einem so kleinen Kind mit schlechten Kreislaufverhältnissen kostete es uns viel Schweiß, Gebet und Gottes Hilfe einen kleinen Venenkatheter zu legen – die Gefäße kollabierten einfach sobald sie punktiert wurden. Doch schließlich gelang es. So konnten zur Erstversorgung ein paar Milliliter angewärmte Dextrose Lösung, sowie jeweils eine Erstgabe von Gentamycin und Ampicillin verabreicht werden. Der kleine Junge wurde mit einer Spur Sauerstoff und je einer Wärmflasche links und rechts versorgt. Nun galt es zu planen: Dieser Patient gehörte auf allerschnellstem Wege auf eine Neugeborenen-Intensivstation nach Kampala. Als Christy, eine einheimische Schwesternhelferin, mit der Kindesmutter auf Luganda die weiteren Optionen besprach, brach diese verzweifelt in Tränen aus. Eine Verlegung schien bereits an den Transportkosten zu scheitern, geschweige denn wusste die Frau, mit welchen Mitteln sie einen kostspieligen Krankenhausaufenthalt hätte bezahlen sollen.
Denn es ist so, Marlon, in diesem Land gibt es zwar Regierungskrankenhäuser, die offiziell einen kostenlosen Versorgungsauftrag haben. Aber in der Realität funktioniert das System bedauerlicherweise nicht. Entsprechende Gelder für diese Einrichtungen versickern irgendwo und kommen nie dort an. Die Material- und Medizinschränke sind leer und das Personal vor Ort wird entweder gar nicht oder nur sehr unregelmäßig bezahlt. Dies führt dazu, dass diese Mitarbeiter manchmal gar nicht erst vor Ort anzutreffen sind, denn auch sie müssen ja von etwas leben. Daher gehen sie oft noch einer inoffiziellen Nebentätigkeit nach.
Die kirchlichen und privaten Krankenhäuser müssen natürlich solide wirtschaften, um zu funktionieren. Ihr Behandlungsangebot kann sich aber nur ein kleiner, privilegierter Teil der Gesellschaft leisten. Das ist die prekäre Situation in diesem Land und auf nahezu dem ganzen Kontinent. Die Realität schmettert meinem naiven, aber leidenschaftlichen Aktionismus gleich zu Anfang schonungslos entgegen, was für ein kleines Rädchen im Getriebe des Großen und Ganzen wir hier mit unserer Arbeit sind – und wie schnell die Möglichkeiten erschöpft sind. Die menschlichen