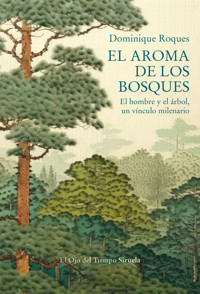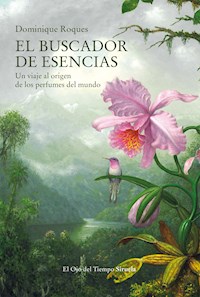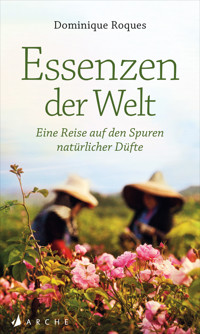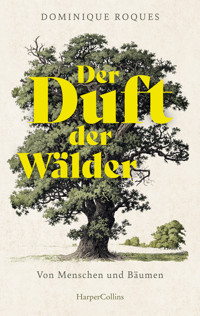
17,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ecco Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Liebeserklärung an die Wälder der Welt
Harze, Humus, Zedernzapfen. Für Dominique Roques, der als Kind eines Holzfällers mit Bäumen aufgewachsen ist, riecht jeder Wald ein wenig anders. Sein Vater hat die Kettensäge als Importeur nach Frankreich gebracht, und so war der Duft, dem Dominique zuerst begegnete, der Geruch frischen Sägemehls. Der Duft der Wälder ist für ihn das Sinnbild ihrer Natürlichkeit, zugleich aber auch ihrer Eroberung durch den Menschen.
Sein Buch nimmt uns mit auf eine Reise zu den außergewöhnlichsten Wäldern der Welt, um der uralten und widersprüchlichen Beziehung zwischen Mensch und Baum näherzukommen: Die mythischen Zedern im Libanon, die zur Errichtung des Tempels Salomons dienten über Ölpalmen auf Borneo bis zu bulgarischen Buchwäldern. Staunend verwebt er Legenden, alte Traditionen und Kuriositäten mit eigenen Erfahrungen. Er berichtet von vergessenen Berufen des Köhlers und Harzsammlers, die sich um den Wald verdient gemacht haben, und erinnert uns an die große Bedeutung des Waldes als letztes Refugium vor dem Lärm und dem Wüten der Menschen.
»Ein Kompendium der Düfte der Wälder, eine Geschichte der Bäume anhand von Menschenporträts und den Geschichten ihrer Ursprünge, mögen sie auch noch so kurz sein.«
Liberation
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 196
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Zum Buch:
"Harze, Humus, Zedernzapfen. Für Dominique Roques, der unter Bäumen aufgewachsen ist, riecht jeder Wald ein wenig anders. Sein Vater hat die Kettensäge als Importeur nach Frankreich gebracht, und so war der Duft, dem Dominique zuerst begegnete, der Geruch frischen Sägemehls. Der Duft der Wälder ist für ihn das Sinnbild ihrer Natürlichkeit, zugleich aber auch ihrer Eroberung durch den Menschen. Dominique Roques, der selbst vom Holzfäller zum Duftsammler für Parfümeure wurde, unternimmt in seinem Buch eine sinnbetörende Wanderung durch die Wälder dieser Welt, um der uralten und widersprüchlichen Beziehung zwischen Mensch und Baum näherzukommen. Staunend verwebt er Legenden, alte Traditionen und Kuriositäten mit eigenen Erfahrungen seiner weltumspannenden Reisen. Er berichtet von vergessenen Berufen des Köhlers und Harzsammlers, die sich um den Wald verdient gemacht haben, und erinnert uns an die große Bedeutung des Waldes als letztes Refugium vor dem Lärm und dem Wüten der Menschen.
»Ein Kompendium der Düfte der Wälder, eine Geschichte der Bäume anhand von Menschenporträts und den Geschichten ihrer Ursprünge, mögen sie auch noch so kurz sein.« Liberation"
Zum Autor:
Dominique Roques, geboren 1952 in Paris, ist als Holzfällerkind in Wäldern aufgewachsen. Nach einem Studium der Betriebswirtschaft gründete er in den 1980er-Jahren eine Destillerie für Zistrosen in Andévalo in Andalusien. Hier begann seine unglaubliche Reise als »Duftscout« für Parfümhersteller, die ihn auf der Suche nach den feinsten Essenzen und Rohstoffen in die außergewöhnlichsten Wälder der Welt, von den Zedernwäldern des Libanon bis zu den Regenwäldern Paraguays, führte. Heute gilt er als gefragter Experte der Parfümindustrie und engagiert sich für den Naturschutz und eine nachhaltige Waldwirtschaft.
Dominique Roques
Der Duft der Wälder
Von Menschen und Bäumen
Aus dem Französischen von Andrea Kunstmann
HarperCollins
Die französische Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel »Le Parfum des Forêts. L’homme et l’arbre, un lien millénaire« bei Éditions Grasset & Fasquelle, Paris.
© 2023 Editions Grasset & Fasquelle
by arrangement with MelseneTimsit & Son, Scouting and Literary Agency
© 2025 für die deutschsprachige Ausgabe
by HarperCollins in der
Verlagsgruppe HarperCollins Deutschland GmbH
Valentinskamp 24 · 20354 Hamburg
Covergestaltung von wilhelm typo grafisch, Zollikon
Coverabbildung von Rawpixel.com / Anna Shkolnaya / Shutterstock.com
Satz und E-Book-Produktion von GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN9783749907601
www.harpercollins.de
Jegliche nicht autorisierte Verwendung dieser Publikation zum Training generativer Technologien der künstlichen Intelligenz (KI) ist ausdrücklich verboten. Die Rechte der Urheber und Urheberinnen und des Verlags bleiben davon unberührt.
Für Catherine & Witou,
die in San Francisco heirateten,
und für Margot und Daphné,
die so gut auf Bäume klettern können.
EinführungDer Baum, der Holzfäller und der Duft
Innerhalb von etwas mehr als einem Jahrhundert hat die Menschheit die Hälfte aller Wälder weltweit gerodet und damit eine Tätigkeit extrem beschleunigt, die sie vor viertausend Jahren begonnen hat. Mit den ersten Äxten aus Bronze wird der Mensch zum Holzfäller. Er erobert die Macht über den Wald, den er aus dem Urgrund der Zeit geerbt hat, indem er den lebenden Baum in einen Baumstamm verwandelt, eine Revolution, deren Folgen noch immer den gesamten Planeten erschüttern. In der gar nicht so bekannten Geschichte des Menschen im Wald mischt sich das Erhabene mit dem Tragischen. Dieses lange Epos handelt von dem über alle Zeiten nie aufgelösten Widerspruch zwischen unserem Angewiesensein auf den lebenden Wald und unserem Holzbedarf. Mein Lebensweg hat mich in einige der außergewöhnlichsten Wälder dieser Welt geführt, und ich bekam Lust, ihre Geschichten zu erzählen. Sie illustrieren die Schwierigkeit, Menschheit und Wald miteinander zu versöhnen, und geben doch auch Anlass zur Hoffnung, dass es möglich sei.
Wälder, Bäume und Holz sind die Bühne, auf der sich meine Kindheit abspielte, ein in meiner Erinnerung nach wie vor lebendiges Szenario. In einer von Fernweh erfüllten Nachkriegszeit gingen meine Eltern nach Amerika, wo mein Vater drei Jahre lang als Holzfäller arbeitete und in dieser Zeit die revolutionären Veränderungen durch die Kettensägen hautnah miterlebte. Ende der 1950er-Jahre machte er daraus einen Beruf: Er importierte amerikanische Modelle und zog durch die Wälder Frankreichs, um Holzfäller davon zu überzeugen, ihre jahrtausendealten Äxte beiseitezulegen und auf die motorisierte Neuheit umzusteigen. Diese Kindheit hat mich mit der Schönheit der Bäume, dem Duft des Waldes und zugleich dem Lärmen der Kettensägen vertraut gemacht. Ich sah darin zusammengehörige Teile einer faszinierenden Welt. Später hatte ich Gelegenheit, eigene Erfahrungen als Holzfäller und Waldarbeiter zu sammeln, bevor ich Einkäufer von natürlichen Essenzen für die Parfümindustrie wurde. Düfte sind immer nah an den Bäumen, sie sind für mich zur Orientierung geworden, Zeugnis des stummen Fortbestands der Wälder. Jeder neue Ausflug in die Wälder dieser Welt hat mich dazu gebracht, ihr Schicksal zu ergründen, von ihrer ursprünglichen Schönheit bis zu dem, was die Menschen daraus gemacht haben. Im Verlauf dieser Geschichte, in der das Gute mit dem Schlimmsten einhergeht, habe ich die Erinnerungen eines Holzfällerkinds sorgsam bewahrt.
Die Begegnung mit Bäumen ist eine Quelle tiefer Freude, ein beständiges und dabei immer neu erfahrenes Glück. Abgesehen von dem, was seit langer Zeit geschrieben, gesungen und erzählt wird, genügt schon ein Spaziergang durch den Wald, um wieder zum ersten Menschen zu werden und sich von den Gefühlen überwältigen zu lassen, die die Stille und die Spuren von tausend geheimen Leben um einen herum wecken. Ich liebe es, mich inmitten von Bäumen aufzuhalten, der Anblick des lebendigen Waldes wird mir nie langweilig, der Wind, der an den Blättern zupft, die Wipfel, die sich sanft im Spiel aus Licht und Schatten bewegen. Das Schauspiel des Waldes wirkt umwerfend, alles ist darauf ausgerichtet, aus der unvergleichlichen Schönheit des Baumes, in der unglaublichen Vielfalt seiner Formen, unter allen klimatischen Bedingungen, die höchste Schöpfung auf Erden zu schaffen.
Alles trennt den Baum und den Menschen, als hätte die Evolution zwei gegensätzliche Ansätze verfolgt, die zu ganz und gar komplementären Lebensformen führten. Eine fundamentale Bruchlinie ist die Zeit. Während Bäume und Wälder für die Ewigkeit programmiert sind, ist der Mensch für den Augenblick gemacht. Was auch geschieht, Wälder können wiederauferstehen: Sie brennen, sie werden abgeholzt, sie keimen von Neuem und wachsen nach. Ein zerstörter Urwald braucht drei bis acht Jahrhunderte, um sich wieder in seinen Anfangszustand zurückzuverwandeln. Der Mensch dagegen verfügt nur über den Bruchteil eines Jahrhunderts, um diesem zeitlupenhaften Ballett beizuwohnen. Ewigkeit versus Flüchtigkeit – damit ist die Zeit der Ausgangspunkt einer radikalen Andersartigkeit. Der mobil konzipierte Mensch macht die Kürze seines Lebens durch Fortbewegung wett. Unermüdlich nutzt er seine Intelligenz für eine ihm eigene Form der Unersättlichkeit, für sein Bedürfnis nach Dominanz, mit der er seinesgleichen und die Natur unterwirft. Der Baum ist unbeweglich, robust und stumm. Er nimmt den Raum in der Vertikale ein, von der Tiefe der Erde, in die er seine Wurzeln versenkt, bis in die Höhe, wo er den Himmel zu berühren scheint, sich hundert Meter emporreckt, um immer neue Blätter der Sonne und dem Wind darzubieten. In seinem Leben findet die Bewegung im Inneren statt, wo er den Saft von seinen Wurzeln bis in die Spitze seiner Zweige transportiert. Er spricht zwar nicht, doch seine Kommunikationsmittel und Methoden zur Unterstützung seiner Nachbarn mittels Wurzeln und Blättern sind noch längst nicht umfassend erforscht. Er beherbergt und nährt alle möglichen Formen des Lebens: Vögel, Nagetiere, Insekten und Pilze. Diese verbreiten seine Samen, die anderswo keimen und ihm so ebenfalls Mobilität ermöglichen. Die fundamentalen Unterschiede zwischen den zwei Lebensformen ziehen unweigerlich eine Konfrontation nach sich, für die ein Mensch zum Symbol wurde: der Holzfäller.
Ich liebe Bäume, ich liebe es, sie zu betrachten, zu pflanzen und ihnen beim Wachsen zuzusehen. Ich liebe die heiligen Bäume, die alten Bergbuchen, alterslose Eichen, Baumdenkmäler in den Tropen, die die Einheimischen niemals fällen würden. Ich habe aber auch gelernt, wie man Bäume fällt: um ihren Nachbarn ein besseres Wachstum zu ermöglichen, weil man ihr Holz möchte, weil es uns normal erscheint, Bäume zu nutzen. All die Fragen rund um den Menschen im Wald, lebende und tote Bäume, den Waldbaum und den Holzbaum begleiten mich bereits ein Leben lang. Kann man gleichzeitig Wälder und Holzfäller lieben? Kann man sich darauf beschränken, nur die richtigen Bäume am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt zu schlagen, ohne sich am System der Entwaldung und Zerstörung zu beteiligen? Die Geschichte der Waldnutzung und die Spuren, die die Holzfäller hinterlassen haben, machen Antworten schwierig und strittig. Dennoch sind auch die Figuren des Holzfällers, des Köhlers oder des Harzsammlers Teil der engen Verbindung, die ich zu Wald, Bäumen und Holz verspüre. Ich habe Respekt vor den Werkzeugen, den Äxten, den Hand- und Motorsägen und dem Holz, das sie formen. Ich liebe die Geschichte der Holzfäller.
Die Menschen sind zwar seit der Ur- und Frühgeschichte zu der beachtlichen Leistung fähig, mit ihren Steinäxten Bäume zu fällen, aber sie scheinen nur dann darauf zurückgegriffen zu haben, wenn es wirklich notwendig war. Drei Jahrtausende vor unserer Zeit hat die Erfindung der Metallurgie dann alles verändert, die Produktion erster Äxte aus Kupfer, dann aus Bronze, war eine Revolution von enormer Tragweite. Sie erlaubte eine bisher unmögliche Verwandlung: Der Baum, den man nun endlich fällen konnte, wechselte seinen Charakter und wurde zur Quelle für Holz: das Material, das zusammen mit Stein die Sesshaftigkeit ermöglichte. Dies kündigte zugleich den Bruch mit der heilen und heiligen Natur an, die Wälder begannen allmählich zu schwinden, Jäger und Sammler wurden zu Menschen, die Bäume fällen.
Im Lauf der Eroberung der unberührten Natur werden die Holzfäller und Köhler sich lange Zeit gegen den unbekannten, gefährlichen, feindseligen, finsteren Wald wehren müssen, der von wilden Tieren bevölkert ist. Im Lauf der Jahrhunderte werden die Menschen des Waldes mit ihren geschwärzten Gesichtern und übermenschlichen Kräften zu ebenso faszinierenden wie erschreckenden Bindegliedern zwischen Wildnis und Siedlung. Eine große Geschichte, auf deren Spuren ich in den unterschiedlichsten Wäldern, in alten und neuen, von Libanon bis Paraguay, gestoßen bin.
Ich habe gelernt, den Duft der Wälder wahrzunehmen und zu lieben. Er ist allgegenwärtig, von den Gebirgen bis in die Tropen verströmt er seine Subtilität und Kraft. Er lädt dazu ein, sich den vielfältigen, wechselnden, starken oder schwachen, warmen oder kalten Nuancen hinzugeben, den Lüften, die kommen und gehen. Die Gerüche beim Durchstreifen eines Waldes, der Humus und das Moos des Waldbodens, Wind, der Eukalyptusblätter oder Piniennadeln mit sich trägt, die Harzgallen in den Stämmen, das Totholz. Der Geruch im Herz des Baums, der Saft, der Balsam, der Gummi. Versteckte Düfte, die sich erst im geschlagenen und gespaltenen Holz offenbaren, frisch oder trocken, harzig oder grün. Der Geruch von Sägemehl, von brennendem oder trocknendem Holz, von Kohle oder Rauch. Für Parfümeure sind die Düfte der rote Faden im Wald, eine Quelle der Inspiration. Sie entstehen nach Fällungen oder Waldbränden bei jedem nachwachsenden Baum wieder neu. Die Wälder sind Horte der Stille und des Lebens. Über ihre Rolle als CO2-Speicher und Sauerstofflieferanten hinaus gewinnt man ständig neue Erkenntnisse über den unglaublichen Reichtum und die Komplexität des Lebens, das sie von der Wurzel bis zur Krone beherbergen. Sie sind sozusagen eine letzte Zuflucht vor dem Lärm und dem Wüten der Menschen.
Der Anfang des Untergangs der Bäume liegt weit zurück in der Antike, im Libanongebirge, im Gilgamesch-Epos. Mit Gilgameschs Sieg über Humbaba, das den Zedernwald bewachende Ungeheuer, beginnt die Zivilisation die Wildnis zu erobern. Eine Begegnung mit den Zedern, die in diesem ersten von Menschen geplünderten Wald überlebt haben, ist wie eine Pilgerfahrt zum Startpunkt der modernen Zeit, eine sehr emotionale Reise.
Im Mittelalter war die Entwaldung bereits so weit fortgeschritten, dass die Menschen sich der Endlichkeit dieser Ressource langsam bewusst wurden. Die Nachfrage nach Metallen für Äxte, Pflüge und andere Geräte beschleunigte die Rodung in der westlichen Welt. Es bedurfte großer Mengen an Holzkohle, um Metall herzustellen, und viel Metall, um den Wald zugunsten von Ackerland zurückzudrängen. Über die Jahrhunderte wird Europa aus schierer Notwendigkeit versuchen, seine Wälder im Sinne einer langfristigen Nutzbarkeit zu bewahren.
Ich habe das Handwerk des Holzfällers in einem Plenterwald in den Bergen erlernt, der aus der Arbeit und Voraussicht von Generationen talentierter Förster hervorgegangen war, an einem Ort, wo die Spuren der Kohlenmeiler noch heiß waren. Bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts bewirtschaftete man den Wald mithilfe von Äxten, Handsägen und Ochsengespannen. Als sich die amerikanischen Holzfäller ab 1850 über die größten Bäume hermachten, die die Schöpfung jemals hervorgebracht hat – die Mammutbäume (Sequoia) im Norden Kaliforniens –, verwendeten sie die gleichen Werkzeuge, die gleichen Techniken wie die Phönizier, die im ersten Jahrtausend vor Christus die Zedern des Libanon fällten. Als dampfgetriebene Winden, Lokomotiven und schließlich Motorsägen in das Heiligtum der Baumriesen eindrangen, war der Weg zur beinahe völligen Zerstörung des schönsten Waldes der Welt gebahnt. Wer heute die einzigartige Kathedrale aus verschont gebliebenen jahrtausendealten Sequoias durchstreift, verspürt unweigerlich Dankbarkeit gegenüber denjenigen, die sich bereits früher für die Bewahrung dieser Urwaldgebiete einsetzten.
Motorsägen, Traktoren, Harvester und Bulldozer – der massive Einsatz von Maschinen hat zugleich zur Geburt der Ökologie beigetragen, zu deren emotionalen Pfeilern der Schutz und die Bewahrung von Bäumen gehören. Der schlimmste Missbrauch findet noch immer in den tropischen Urwäldern statt, wie auf Borneo, wo für den Anbau von Ölpalmen alles niedergebrannt wird. Ein weiteres Beispiel ist der Gran Chaco in Paraguay, im südlichen Amazonasgebiet. Er wird nach und nach in Nutzflächen für die Landwirtschaft umgewandelt und zerstört, obwohl dieser Wald eine ganz besondere Baumart beherbergt, den für die Parfümherstellung unverzichtbaren Guajak, den eine Handvoll engagierter Menschen kommerziell nutzen, um gerade dadurch den Wald insgesamt bewahren zu können.
Nutzung, Bewahrung, Pflanzungen und Schutzmaßnahmen: Auf die damit zusammenhängenden Kontroversen stoße ich bei meinen Reisen überall. Ebenso wie die Tiere und die Meere stehen die Wälder im Zentrum all der Widersprüche unserer Zivilisation, die die Ausplünderung der Natur mit der Notwendigkeit rechtfertigt, acht Milliarden Menschen zu ernähren, zu transportieren und vor Kälte zu schützen. Fünftausend Jahre nach der Erfindung der ersten Äxte haben wir dieses verzwickte Paradox noch immer nicht aufgelöst. Einerseits ist uns die Endlichkeit des unersetzlichen Ökosystems wilder Wälder bewusst, andererseits ist da unser nie gestillter Hunger nach Holz und frischen Ackerflächen. Die weltweite Baumlandschaft, die daraus entsteht, erweist sich als vielfältig und gegensätzlich, sie zeigt sich von der besten wie von der schlechtesten Seite. Die Antwort auf die Zerstörung des tropischen Regenwalds und die Ausbreitung intensiver Anbaumethoden liegt in einer Forstwirtschaft, die Biodiversität berücksichtigt, sowie in aufsehenerregenden neuen Initiativen, die sich von den Wüsten bis in die Innenstädte der Wiederherstellung, dem Schutz und der Wiederaufforstung widmen.
In diesem Buch möchte ich die Geschichte der Bäume und ihrer Nutzung erzählen. Ich möchte andere an meinen Dufterlebnissen in ganz besonderen Wäldern teilhaben lassen und deutlich machen, wie verwundbar sie sind und wie dringend wir handeln müssen – und zugleich der Notwendigkeit Ausdruck verleihen, an eine Versöhnung von Menschen und Bäumen zu glauben. Alte oder neue, wilde oder gezähmte Wälder, gefällte, geschützte oder neu gepflanzte Bäume, Motorsägen, Hölzer oder Duftnoten – auf den folgenden Seiten streue ich wie der kleine Däumling im Märchen zur Orientierung meine Kieselsteine aus.
1.Die Zeit der Wälder
Das fast zwei Meter lange Brett mit seinen unregelmäßigen, rindenbewachsenen Rändern sieht wie direkt aus einem Stamm geschnitten aus. Weil es groß genug ist, um als Tisch zu dienen, habe ich es einfach auf zwei Holzblöcke gelegt. Auf den ersten Blick erinnert alles daran an den Baum, von dem es stammt, die Rinde, die Linien in der Maserung, die Astlöcher. Aber irgendetwas passt nicht, dieses Brett kann nicht aus Holz sein, die Fläche glänzt wie Marmor und schimmert in allen möglichen Farben, Beige und Braun und Dunkelrot mit ein bisschen Schwarz und Elfenbein. Meine Tischplatte ist in Wahrheit versteinertes Holz. Ihre Geschichte beginnt in Madagaskar, einem der wenigen Orte weltweit, an dem man dieses finden kann. Im Westen der Insel, in der Region Majunga, werden Teile von Baumstämmen zutage befördert, deren Alter kaum fassbar ist. Von heftigen Überschwemmungen mitgerissen, in Schlamm-, Ton- und Sandsedimenten voller Vulkanasche gefangen, haben sich diese Baumstämme in einer zeitlupenhaften Alchemie in Siliziumblöcke verwandelt, jede ursprüngliche Ligninzelle ist nach und nach zu Stein geworden und wurde mit der Zeit von verschiedensten Oxiden eingefärbt.
Natürlich fragt man sich angesichts der eigenartigen Schönheit einer solchen Steinplatte, wie lange dieser Vorgang dauert, doch die Antwort hilft kaum weiter: Meine Tischplatte besteht aus einem Stück Araukarie, einer Urform der Nadelbäume, die vor 220 Millionen Jahren existiert hat. Wie soll man sich eine Vorstellung vom Alter dieser Mumie machen? Ich habe das Stück in einer Sägemühle in Madagaskars Hauptstadt Antananarivo entdeckt und dann in einem Container mit Vanilleschoten verschickt. Bis zur Ankunft hatte die Verpackung aus Kiefernholz den Geruch der Vanille angenommen, doch die Platte selbst roch nach nichts, sie begnügte sich damit, achtzig Kilo zu wiegen, das unbegreifliche Konzentrat von zwei Millionen Jahrhunderten, die sie hinter sich gebracht hatte, bevor sie bei mir an der bretonischen Küste landete. Ich betrachte und befühle das wenige Zentimeter dicke Holz, das härter als Granit und fast so schwer zu schneiden wie Diamant ist. Es gefällt mir, dass man in diese aufeinandergeschichteten Jahrhunderte nicht leichter eindringen kann als in einen Edelstein. Es ist die extreme Verdichtung einer Zeitspanne, die uns übersteigt.
Ein anderes Zeitmaß präsentieren die frühesten Botschaften der Wälder. Die Entstehung der Bäume reicht 370 Millionen Jahre zurück, es ist der Beginn einer Welt, die von so weit herkommt, dass wir sie wohl nur als unterwegs zur Ewigkeit auffassen können. Angesichts des Alters und des Durchhaltevermögens dieser großartigen Lebensform spielt sich da etwas ab, das zur Unendlichkeit gehört. In der Zeit, in der meine Araukarie gewachsen ist, besiedelten Bäume diese Erde bereits seit 150 Millionen Jahren. Als maßgebliche Entwicklung des Pflanzenreichs haben sich Bäume als die am besten geeignete Art erwiesen, die entstehenden Landmassen zu erobern. Ihre Vorgänger waren riesige Farne von bis zu dreißig Metern Höhe, mit ihnen war das Konzept Baum bereits geboren: eine kraftvoll in die Vertikale wachsende Pflanze mit festem, widerstandsfähigem Stamm. Im Ozean der Zeit würde der Wald gedeihen und sich durch Diversifikation weiterentwickeln, Tausende unterschiedliche Arten hervorbringen und in der Lage sein, sich an alle umwälzenden Veränderungen des Planeten anzupassen: Vergletscherung und Erderwärmung, Vulkanausbrüche und Brände. Schon vor hundert Millionen Jahren war die Nordhalbkugel mit Magnolien und Mammutbäumen bedeckt. Im Tertiär, also fünfzig Millionen Jahre später, gesellten sich Zypressen und Zedern dazu. Vor fünf Millionen Jahren entstanden Eiche, Ahorn und Kiefer. In den großen Kaltzeiten weichen die Wälder nach Süden aus, doch sobald das Eis sich zurückzieht, kehren sie wieder. In einem kontinuierlichen Anpassungsprozess beweist der Wald seine erstaunliche Akklimatisierungs- und Überlebensfähigkeit und etabliert sich als grundlegendes Ökosystem der Erde, das im Lauf seiner Entwicklung mit dem gesamten Tierreich koexistiert – selbst das Erscheinen und Verschwinden der Dinosaurier tangiert den Wald nicht.
Das Ende der letzten großen Kaltzeit vor etwa 15000 Jahren markiert den Höhepunkt der Herrschaft der Wälder, die damals etwa zwei Drittel der Landmasse bedeckten, wovon heute nur noch die Hälfte übrig ist. Die wichtigsten Bewaldungsarten waren bereits voll etabliert und haben sich seither wenig verändert. Nehmen wir die oft unterschätzte Größe der Wälder und Taigas der Nordhalbkugel: Die endlosen Weiten von Nadel- und Birkenwäldern im Norden Kanadas und Russlands umfasst heute etwa ein Drittel der bewaldeten Landmasse. Etwas weiter südlich hat man es mit den Mischwäldern der gemäßigten Zone zu tun, die nach der Entwicklung der ersten Gesellschaften, die Ackerbau und Viehzucht betrieben, am anfälligsten waren. Und schließlich die Tropenwälder, Heimat einer unvorstellbaren Vielfalt an Pflanzen und Tieren und damit Biodiversitäts-Hotspot. Die großen tropischen Regenwälder in Amazonien, im Kongobecken und in Südostasien beherbergen heute die Hälfte aller weltweit existierenden Arten. In Amazonien wachsen 16000 unterschiedliche Baumarten, in Europa 140, in den borealen Wäldern vielleicht ein Dutzend. Alle Lebewesen reagieren auf das Klima, und mit der Nähe zum Äquator nimmt die Artenvielfalt explosionsartig zu. Zu der Zeit, als die Malereien in den Höhlen von Lascaux entstanden, hatte die Natur bereits Tausende von Baumarten entwickelt, eine außerordentliche Bandbreite angesichts der kleinen Menge uns bekannter Arten. Zuerst die Bäume der gemäßigten und nördlichen Wälder, in denen die Koniferen dominieren, Bäume, die ihre Nadeln in der Regel das ganze Jahr über nicht abwerfen. Fast tausend Arten weltweit umfassen die Familien der Kiefern, Fichten, Tannen, Zedern, Wacholder, Zypressen, Lärchen, Sequoia, Cryptomeria und viele mehr. Die Laubbäume begleiten unsere Jahreszeiten, indem sie jeden Frühling neue Knospen und Blätter erschaffen, die im Herbst fallen und damit Jahr für Jahr nach und nach das Grundmaterial für den Humusaufbau in den Waldböden liefern. Eichen, Buchen, Kastanien, Linden, Ahorn- und Obstbäume, sie alle sind in den Zivilisationen und Traditionen Europas und Nordamerikas omnipräsent. Auf der Südhalbkugel erweist sich die große Familie der Eukalyptusbäume, die ursprünglich aus Australien stammt, als so anpassungsfähig und produktiv, dass man sie zur Papier- und Brennstoffherstellung inzwischen überall anpflanzt. Und die Botanik hat die Identifizierung der unzähligen Baumarten der Tropen noch längst nicht vollendet. Aufgrund der Nutzung von Edelhölzern seit der Kolonialzeit kennen wir davon zumindest eine geringe Zahl: Teak, Mahagoni, Palisander, Rosenholz, Ebenholz, Okoumé, Iroko.
Im Zeitmaßstab des Waldes ist seine Beziehung zum Menschen so jung und kurz wie eine Anekdote. Vor allem aber handelt es sich bei dieser Geschichte um eine Anomalie, um die Ankunft des ersten Räubers von Bäumen aus einer außergewöhnlichen Welt, die wir als vollkommenste Form des Lebens heute gerade erst zu begreifen beginnen.
Ich stelle mir gerne vor, wie die Waldlandschaft aussah, bevor die Menschheit Ackerbau und Viehzucht entdeckte und sich über die Bäume hermachte. Dann sehe ich einen gigantischen Teppich aus Baumriesen, die den größten Teil der Erde bedecken und deren Wachstum nichts hemmt außer das eine oder andere Feuer. Tiefe Schatten, die einer außerordentlich reichen und vielfältigen Tierwelt Schutz bieten, wie man sie sich heute gar nicht mehr vorstellen kann. Überall – in den Tropen, im Gebirge, in den Ebenen der gemäßigten Zonen – eine unendliche Vielfalt an Bäumen, viele davon Jahrhunderte alt, manche völlig alterslos, und ob lebendig, alt oder tot, spielen sie alle eine wichtige Rolle im Lebenszyklus des Waldes. Der geduldige Vorstoß der jungen Exemplare, die manchmal Jahrzehnte auf Sonnenstrahlen warten müssen, bis der Fall eines Riesen eine Lichtung schafft. Leben auf allen Etagen: Humusreiche Böden sind in der Lage, Wasser zu speichern, sie sind vor Sonnenstrahlung geschützt und durchzogen von einem ausgedehnten, tiefen Netz von Wurzeln, der Heimat Tausender Pilze. Unterirdische Fäden des Myzels zersetzen zusammen mit Bakterien und Insekten Totholz und Laub. In allen Breiten schützt und nährt der Wald eine große Zahl von Säugetieren, darunter viele Nager. In den Bäumen der Tropen sind dies unzählige Affen und Lemuren und oben in der Krone Blüten, Früchte, Insekten, unter anderem Schmetterlinge, verschiedenste Vogelarten. Wohl kein Paradies, aber doch ein ursprünglicher Garten Eden, in dem auch die ersten Menschen ihren Platz gefunden hatten.
Sehr lange, Hunderttausende Jahre, lebten primitive Menschen als Gefährten der Tierwelt im Schutz der Wälder, die ihnen Sicherheit und Nahrung boten. Gruppen von im Wald siedelnden Jägern und Sammlern hinterließen dort bereits vor 50000 Jahren ihre Spuren. Ein großer Teil der Populationen unserer Ahnen, der direkten Vorfahren des Homo Sapiens, haben sehr lange mit dem Wald koexistiert. Im Lauf der Jahrtausende lernte die Gattung Homo