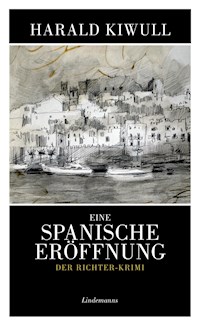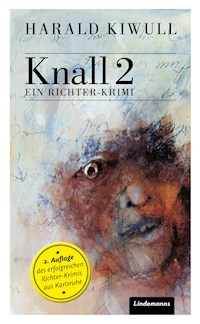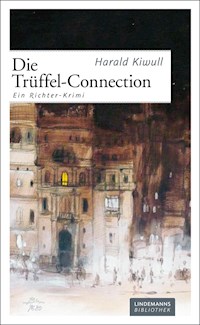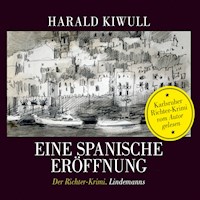Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: INFO Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Lindemanns Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Eine vor Jahren spurlos verschwundene Schöffin taucht überraschend wieder auf und bittet den Strafrichter am Landgericht Karlsruhe Maximilian Knall um Hilfe. Ein nächtlicher Besucher ist unbemerkt in ihr Haus eingedrungen, hat sie fotografiert und eine mysteriöse Nachricht hinterlassen. Knall lässt sich zögernd darauf ein und gerät in einen Strudel von gefährlichen Ereignissen. Er wird verdächtigt, mit dem Tod einer jungen Frau, möglicherweise Opfer eines Gewaltverbrechens, etwas zu tun zu haben. An seinem Wohnort in Ettlingen wird er massiv bedroht und erpresst. Er muss sich wehren. Bei einem Kontakt mit einem Strafgefangenen in der Justizvollzugsanstalt Bruchsal erhält er interessante Informationen. Er taucht ab in den verborgenen Teil des Internets, in die Abgründe des Darknet. In den Ruinen eines Westwall-Bunker in der Nähe macht er erstaunliche Entdeckungen. Eine Spur führt den etwas aus dem Rahmen fallenden Richter in den Norden, nach Hamburg und Stade.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 257
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Harald Kiwull · Der dunkle Gast
Dr. Harald Kiwull, aufgewachsen in einem Dorf in Norddeutschland, Studium der Rechtswissenschaft in Hamburg und Freiburg im Breisgau, war nach Tätigkeit als Zivilrichter lange Jahre Vorsitzender Richter einer Strafkammer am Landgericht Karlsruhe. Deutschlandweit wurde er bekannt als Berufungsrichter im sogenannten „Autobahnraser-Prozess“. Über 20 Jahre stellte er in dem von ihm mitbegründeten Verein „Kunst im Landgericht“ in 40 Ausstellungen Werke von mehr als 100 Künstlern aus. Seit seiner Pensionierung lebt Kiwull in Deutschland und Spanien. „Die Trüffel-Connection“ (2016, inzwischen in der 3. Auflage) war in der Startauflage nach nur wenigen Wochen vergriffen. Es folgten 2017 „Knall 2“ und 2019 „Eine Spanische Eröffnung“, 2020 auch als Hörbuch. Mit „Der Dunkle Gast“ legt er jetzt seinen vierten amüsanten und zugleich spannenden Kriminalroman vor.
Harald Kiwull
Der dunkle Gast
Der Richter-Krimi
Lindemanns
Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen
wären rein zufällig und sind nicht beabsichtigt.
Natürlich wieder für Zottel
1
Die Sonne verschwand gerade hinter den dunklen, hohen Tannen am Schwarzwaldhang gegenüber und tief hängende, unheimliche Wolkentürme zogen vom Westen herauf. Drüben in der schmalen Senke krochen dunkle Nebelschwaden, merkwürdige, bedrohliche Formen bildend, den Hang hinab in die Niederung. Drei tieffliegende, zerzauste Krähen folgten ihnen laut krächzend. Mit der plötzlichen Dämmerung und dem scharfen Wind war es unangenehm kalt geworden. Ein leichter Regen setzte ein.
Eben hatte ich mich noch angenehm entspannt gefühlt, aber jetzt erfasste mich eine unerklärliche, fast bedrohliche Furcht. Mein linkes Bein begann bei jedem Schritt unerträglich zu schmerzen. Vielleicht hatte ich mir mit der Wanderung über den ganzen Nachmittag doch zu viel zugemutet. Aber weiter unten, jenseits der Lichtung und dem angrenzenden Waldstück, leuchteten schon die Lichter von Bad Herrenalb. Ich hielt an und mein Freund Henner, der mir auf dem schmalen Pfad folgte, stolperte in mich hinein. Wir hatten zusammen die wildromantischen Wege hinauf zur sagenumwobenen Teufelsmühle erkundet.
Ein leises, zischendes Geräusch und eine leichte Berührung an meinem linken Ohr ließen mich zusammenfahren. Hinter mir hörte ich, fast gleichzeitig, ein dumpfes Knirschen und einen überraschten, schrillen, gurgelnden Schrei. Bevor ich mich umdrehen konnte, verspürte ich einen Schlag gegen meine rechte Schulter und gleichzeitig einen heftigen Schmerz.
Mit der linken Hand griff ich nach oben und zuckte bei der Berührung mit dem Gegenstand zusammen. Ich fasste vorsichtig zu, blickte zur Seite und erkannte im Dämmerlicht, dass etwas fest in meiner Schulter steckte. Ein länglicher, sehr dünner schwarzer Metallstab mit seitlichen Plastikfedern an seinem Ende. Ein Pfeil. Jemand hatte mit einer Armbrust auf mich geschossen!
Das ist ja absolut abartig, dachte ich entsetzt. Aber ein weiterer Pfeil, der mich nur knapp verfehlte, riss mich aus meiner Erstarrung.
Weiter unten erkannte ich jetzt zwischen den Bäumen eine Gestalt, die mit großen Schritten auf uns zulief. Ein mächtiger Mann, breitschultrig in einem langen, schwarzen, wehenden Mantel. Ich stolperte zurück. Er kam immer näher.
Jetzt war er dicht vor mir. Ich blickte ihn direkt an. Mir war, als würde jemand mit einer eiskalten Hand mein Herz fassen.
Der Mann hatte kein Gesicht! Eine grauenhafte, leere Fläche mit zwei dunklen, unheimlichen Löchern statt der Augen.
Mit einem Aufschrei erwachte ich und fuhr hoch. Ich tastete zitternd nach meiner Nachttischlampe und knipste sie an. Es war halb drei. Mein Puls raste, der Körper war schweißnass. Ich setzte mich auf und lehnte mich gegen das Kopfende des Bettes. Nur langsam kam ich zur Ruhe.
Seit Wochen plagten mich diese fürchterlichen, erschreckenden Träume. Der Anfang immer sehr entspannt, positiv, das Ende grauenhaft. Den Griff zu den Psychotropfen, die mir mein Ettlinger Hausarzt, allerdings mit dem Ratschlag der dezenten Anwendung, verschrieben hatte, ließ ich nach einem Blick in den umfangreichen, etwas verstörenden Beipackzettel bleiben. Aber in der Folgezeit verzögerte ich immer mehr den Abschluss des Abends und den Beginn meiner Nachtruhe, die sich regelmäßig zur Qual entwickelte. Mein Freund Jan, dem ich von meinem Problem erzählte, gab mir die kluge Beurteilung, dass mein Gemütszustand inzwischen auf diesen Ablauf programmiert sei, und ich müsse die Zwangsläufigkeit durchbrechen. Auf die Frage, wie ich das machen könne, wusste er auch keine Antwort.
Natürlich war mir klar, dass der psychische Defekt mit meinen Erlebnissen in Spanien zusammenhing. Ich hatte dort in den Bergen der Pyrenäen einen mysteriösen Motorradunfall erlitten. Aber diese Erkenntnis half mir auch nicht weiter.
Im Gericht hatte man Rücksicht auf dieses ungeklärte, mich immer noch sehr belastende Ereignis und den von mir vor einem Vierteljahr abgewickelten spektakulären Prozess mit einem hochgefährlichen Angeklagten genommen und mich, natürlich mit meinem Einverständnis, in eine andere Kammer versetzt. Weitab vom Hass der Ganoven in der Strafkammer, die ich über Jahre geleitet hatte: als Vorsitzender einer Berufungskammer in Zivilsachen. Mietstreitigkeiten, Vertragsverletzungen, Streit über Baumängel und so weiter. Alles sehr friedlich und fern der Dramatik einer Strafsitzung. Aber in mir rumorte meine Vergangenheit weiter.
Und ich, ich heiße Maximilian Knall. Genauer gesagt Doktor Maximilian Knall. Richter am Landgericht Karlsruhe und das seit vielen Jahren.
Mit meinen ein Meter sechsundneunzig habe ich mir in der Jugend oft den Kopf angeschlagen, bis ich schließlich begriffen hatte, dass ich aufpassen muss. Aber inzwischen verschafft mir das durchaus Respekt, wenn ich den Gerichtssaal zu Strafsitzungen betrete, in denen ich voll gefordert werde. Oft ganz anders als erwartet, manchmal quälend, aber immer wieder mit überraschenden Entwicklungen auch sehr faszinierend.
In meinem geliebten Spanien schaffe ich es in den Tagen und Wochen des Urlaubs, mich nicht nur räumlich von meinem kriminellen Umfeld zu entfernen. Mit dem Bemühen um ihre Sprache bin ich den Menschen nahe gekommen, fühle mich wohl und habe mir dort über die Jahre, auch mit einem internationalen Freundeskreis, fast so etwas wie ein zweites, friedliches Leben aufgebaut. Fern von den Gewalttaten, Einbrüchen, Überfällen, Bedrohungen und Verdächtigungen, die mich hier, auch außerhalb des Gerichtes, tatsächlich immer wieder getroffen haben und gegen die ich mich zur Wehr setzen musste.
Am späten Nachmittag des darauffolgenden Tages setzte ich mich vor der Gaststätte „Salmen“ in einen der bequemen Korbsessel und begann mich nach einigen Schlucken von dem köstlichen Grauburgunder ganz gut zu fühlen und entspannte mich immer mehr.
Der lange, schöne Sommer wich langsam einem kühlen Herbst, aber heute war noch ein überraschend angenehmer Tag. Fast jeder Platz auf dem Ludwigsplatz war besetzt. Man merkte den Menschen an, dass sie die milden Temperaturen genossen, und einige junge Frauen experimentierten sogar damit, ihre sommerbraunen Schultern mit Spaghettiträgern in der späten Sonne zu zeigen. Ein geschätztes Drittel der Karlsruher Bevölkerung hatte offenbar nach den fünf Regentagen beschlossen, die Fahrräder noch mal aus den Kellern zu holen. Auf der Erbprinzen-Fahrradstraße nebenan drängten sie sich, und die wenigen Autofahrer bereuten, dass sie diese Route genommen hatten.
Ich bestellte mir ein Pilzgericht und einen zweiten Wein und allmählich wurde die Erinnerung an die nächtliche Psychoattacke immer mehr in den Hintergrund gedrängt. Auch der anstrengende Arbeitstag im Gericht war dabei eine große Hilfe und Ablenkung gewesen. Ein Vormittag mit fünfzehn, für mich noch ziemlich ungewohnten, Verhandlungen und der Anschluss daran, mit Nachberatungen über Stunden hinweg.
Das Ganze war schon eine große Umstellung für mich. Heraus aus dem Strafrecht mit seinen intensiven und zum Teil aber auch nervenaufreibenden Verhandlungen über den ganzen Tag oder mehrere Tage hinweg zu dieser Fließbandabwicklung. Ein Termin nach dem anderen, und eine Karawane mit Dutzenden von Rechtsanwälten, und das alles in drei Stunden. Verfahren, die natürlich alle schriftlich umfassend vorbereitet und beraten worden und die damit nur noch mit einigen Formalien abzuwickeln waren. Oft zur größten Verblüffung der Parteien, die erwartungsvoll in ihrer Sonntagskleidung erschienen und selbstverständlich erwarteten, dass ihr Problem ausführlich erörtert werden würde. Und die dann schon nach wenigen Minuten wieder von ihrem Anwalt aus dem Gerichtssaal gezogen wurden.
Ich hatte übrigens die sogenannte Bärenkammer übernommen, die so benannt wurde, weil mein Vorgänger, Karl Zipperer, in jeder der vielen Verhandlungen die Ellbogen auf den Richtertisch gestützt und die Hände wedelnd nach beiden Seiten ausgebreitet hatte, eben wie ein Bär, der damit seine Emotionen anzeigt. Dazu fragte er regelmäßig nach links – zum Klägeranwalt – und rechts – zur Beklagtenseite –: „Ist noch etwas vorzutragen?“, ohne eigentlich eine Antwort zu erwarten. Und es hielt sich hartnäckig das Gerücht, dass der Anwalt, den er dabei zuerst ansah, den Prozess verlieren würde. Das wiederum veranlasste einige fast dazu, bei seinem suchenden Blick unter dem Tisch in Deckung zu gehen.
Auf Grund dieser speziellen Verhandlungsstrategie waren die Ärmel seiner Richterrobe an den Ellenbogen mit der Zeit immer dünner geworden und schließlich, ein Jahr vor seiner Pensionierung, auf beiden Seiten endgültig durchgewetzt.
Zipperer erschien es jedoch abwegig, für die paar Monate noch eine neue Robe zu kaufen. Also benutzte er – selbst ist der Mann – seinen Bürotacker, um die Löcher zu verschließen. Das führte dazu, dass bei seinen wedelnden Armbewegungen zunehmend ein geheimnisvolles Klingeln ertönte und eine fast weihevolle Stimmung entstand. Manche Anwälte erschienen dadurch tatsächlich etwas eingeschüchtert.
Von drüben vom Ludwigs winkte mir eine junge Frau aus einer Gruppe heraus zu, und ich erkannte in ihr eine Sozialarbeiterin, bei deren Einstellung in die Bewährungshilfe ich vor Kurzem mitgewirkt hatte. Neben meiner Strafrichtertätigkeit war ich über viele Jahre hinweg als Referent des Präsidenten auch dafür zuständig gewesen. Ich empfand den Kontakt zu dieser Personengruppe als sehr positiv. Kreative, empfindsame Menschen, zu jeder Tages- und Nachtzeit bereit zu unendlichen Diskussionen – aber auch, sich gegen die Ungerechtigkeit in der Welt einzusetzen.
Mehrere junge Kolleginnen und Kollegen, von denen ich nur einen etwas näher kannte, drängten sich von der Erbprinzenstraße her durch den schmalen Gang zwischen den Tischen an mir vorbei. Erfreulicherweise, ohne mich zu beachten.
„Nie und nimmer Werkvertragsrecht!“, blaffte eine von ihnen in einem äußerst hässlichen gelbgrünen Kostüm den dünnen großen Mann neben sich an, der aber nur ein schnaubendes Geräusch von sich gab, die Augenbrauen hochzog und sich nach vorne durchdrängelte. Das hätte mir noch gefehlt: ein Austausch von juristischen Spitzfindigkeiten in der Abenddämmerung nach zwei Glas Wein.
Es wurde langsam etwas kühler. Einige der Ludwigsplatzbesucher hatten sich bereits verzogen. Ich beschloss zu zahlen und den Heimweg anzutreten. Heute Morgen war ich mit der Straßenbahn von Ettlingen aus in die Stadt gefahren, weil mein Auto wieder einmal die übertriebene Anfälligkeit seiner Elektrik gezeigt hatte. Eben ein typisch italienisches Sensibelchen. Trotzdem liebte ich den alten, roten Lancia H.P.Executive natürlich von Herzen.
Kurz bevor ich den Marktplatz und die Straßenbahn S 11 erreichte, überlegte ich es mir anders und bog ab in Richtung Schloss. Inzwischen hatte die Dämmerung eingesetzt. Trotz der nun herbstlichen Temperaturen fühlte ich mich mit meinem ziemlich unrichterlichen Parka ganz wohl.
Als ich durch den Torbogen des Schlosses ging, kam mir eine junge Frau mit grün gefärbten, kurzen Haaren und einem großen silbernen Ring in der Nase entgegen. Sie lächelte mir zu, was ich allerdings nicht erwidern konnte, weil sie zwei aggressiv knurrende Biester mit sich führte, die an ihren Leinen zerrten. Schwarzweiß gesprenkelte Köter, denen die sklavenjagenden Vorfahren aus den dunklen, hasserfüllten Augen sprangen. Ich versuchte, sie nicht anzusehen, weil ich mal gehört hatte, dass man dann verloren war. Fast schon vorbei, warf ich unwillkürlich aber doch einen kurzen Blick zurück, was ich sofort bereute, denn das eine der breitmäuligen Ungeheuer machte einen Satz in meine Richtung und stieß dabei ein grässliches tiefes Knurren aus. Die Frau reagierte zu meinem Glück überraschend kraftvoll und schaffte es tatsächlich, das Tier zurückzuhalten. Vermutlich ein Resultat ständiger Wiederholungen.
Ich dachte darüber nach, dass es sicher hilfreich wäre, die Hundesteuer massiv zu erhöhen, um Menschen zweimal überlegen zu lassen, ob sie sich einen Kampfhund anschaffen. Wenn die Haltung einer solchen Kampfmaschine genauso teuer wäre wie die eines Kleinwagens, wäre der Spuk bald vorbei. Beim Weitergehen überlegte ich mir, dass es vielleicht doch etwas übertriebene strafrichterliche Gedanken waren, die ich da hatte.
Ebenso wie bei dem anderen Vorschlag, den ich mal im Kollegenkreis vertreten hatte. Dass man nämlich die Politessen oder Hilfspolizisten mit kleinen Hämmerchen ausrüsten könnte, mit denen sie den Falschparkern auf den Fahrradwegen oder in zweiter Reihe einen kräftigen Schlag auf den Kotflügel versetzen sollten. Ich war sicher, dass in Nullkommanichts für Disziplin gesorgt wäre. Meine Kollegen fanden mich allerdings keiner Antwort würdig, und ich war damals auch nicht sicher, ob ich diese Überlegungen ernst gemeint hatte.
Gerade hatte ich den kleinen See in der Mitte des Schlossgartens erreicht und setzte mich gemütlich auf eine Bank mit prächtigem Blick auf das nicht weit entfernte Karlsruher Schloss.
Ich lehnte mich zurück. Schloss die Augen. Die Hunde gingen mir nicht aus dem Kopf, und mir fiel eine Wanderung ein, die ich einmal vor Jahren in den Bergen von Spanien gemacht hatte. Ein herrenloser, großer, sehr magerer Hund schloss sich mir an. Es war sehr heiß, und als ich ihm aus einem noch etwas mit Wasser gefüllten Blechfass mit meinen zur Kelle geformten Händen zu trinken gab, war für ihn wohl klar, dass er gerettet war, und er mit mir seine Zukunft verbringen würde.
Wenig später näherten wir uns einem einsamen Gehöft, aus dessen geöffneten Toren zwei riesige, schwarze Hunde unter lautem Gekläff heraus- und auf uns zusprangen. Ich dachte, erfreulicherweise habe ich ja einen Begleiter, der mich verteidigen wird. Dieser aber kniff tatsächlich den Schwanz zwischen die Beine ein und verschanzte sich hinter mir. Die Ungetüme galoppierten weiter auf uns zu, und ich dachte, mein letztes Stündlein hätte geschlagen.
Da fiel mir ein, was mir eine alte Frau Tage vorher auf einer Bank am Meer in Alcossebre erzählt hatte, als einige Hunde an uns vorbeiliefen. Ich müsse nämlich nur, für diese gut erkennbar, Steine vom Boden aufheben und damit drohen. Auch die größten Hunde würden daraufhin Reißaus nehmen. Das Werfen mit Steinen auf herrenlose Hunde sei in Spanien absolut üblich, und die meisten von ihnen hätten schon äußerst schmerzhafte Erfahrungen damit gemacht.
Also bückte ich mich, hob zwei dicke Steine auf und schwenkte sie in Richtung der Angreifer. Diese stoppten tatsächlich abrupt und beschränkten sich auf wütendes Gebell aus der Ferne. Die grenzenlose Bewunderung meines vierbeinigen Begleiters war ihm deutlich anzumerken.
Mein Auto hatte ich in einem Dorf am Rande des Naturparks abgestellt. Als ich dorthin zurückkehrte, drängte sich der Hund immer näher an mich. Ihm schwante Böses, und ich fühlte mich schauderhaft. Es war ausgeschlossen, ihn mitzunehmen. Wirklich unmöglich.
In einem Laden besorgte ich zwei große Dosen Hundefutter, ließ sie öffnen und schüttete sie dem Hund in einer Hofeinfahrt auf den Boden. Er stürzte sich gierig darauf – und ich davon. Stieg hastig in mein Auto und brauste weg.
Über Wochen wurde ich die sehr intensive Erinnerung und mein schlechtes Gewissen nicht los. Auch heute, nach Jahren, denke ich ab und zu an ihn. Aber ich glaube, dass kann nur jemand verstehen, der Tiere liebt.
Es war jetzt fast ganz dunkel geworden. Die Schlosskulisse spiegelte sich aber noch im ruhigen Wasser des Sees. Die riesigen Bäume ragten in den schwarzen Nachthimmel empor. Kein Mensch in der Nähe. Absolute Stille.
Vielleicht durch die Gedanken an meinen spanischen Begleiter fing ich wieder an, darüber nachzudenken, was mir vor Monaten in den Bergen der Pyrenäen passiert war.
Nach dem Unfall war ich mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Barcelona geflogen worden und einige Tage später nach Karlsruhe. Mein Kopf war nach Angaben der Ärzte in Deutschland wieder vollkommen in Ordnung, und auch das Bein konnte ich nach der dreiwöchigen Reha wieder zunehmend normal einsetzen.
Etwas verstört hatte mich die Mitteilung der spanischen Policia, die ich über die Karlsruher Kriminalpolizei erhielt, dass das Motorrad bei der Überführung zur kriminaltechnischen Untersuchung spurlos verschwunden war. Das kam mir immer noch sehr merkwürdig vor, aber es war vielleicht besser, darüber doch nicht nachzudenken.
Langsam wurden die Temperaturen wirklich ziemlich unerfreulich. Ich machte mich auf den Heimweg. Aber erneut bog ich vom Weg zum Marktplatz und meiner Straßenbahn ab. Vielleicht hatte ich einfach Angst, mich meinem Bett und dem nächsten Albtraum zu nähern. Meine Gerichtsverhandlung hatte heute, an einem Freitag, stattgefunden. Das Wochenende lag vor mir, ich konnte mir Zeit lassen.
Eine Viertelstunde später stieg ich die drei Stufen hinunter in meine Lieblingskneipe in der Altstadt. Wie immer fühlte ich mich an diesem Ort sicher davor, irgendeinem Kollegen zu begegnen.
Es schien sich nichts verändert zu haben, seitdem ich vor vielleicht einem Jahr zuletzt hier gewesen war. Die gleichen Gestalten wie immer – die „Wohnsitzlosen“, wie ich sie für mich selbst immer nannte – saßen um die halbkreisförmige Theke herum und begrüßten mich mit Gemurmel, als hätten wir uns erst gestern gesehen. Auch Olga wirkte unverändert, lächelte mir zu und hielt sofort ein Glas für mich unter den Zapfhahn. Nur Karl fehlte auf der Sitzbank gegenüber. Aber sein Mischlingshund Merlin, jetzt allein, saß auf dem gemeinsamen Stammplatz und sah mich traurig an. Offenbar setzte er die langjährige Tradition seines Herrn fort, neben dem er jahrelang hier gesessen hatte, Die Runde akzeptierte ihn ohne seinen Herrn und sorgte offenbar auch für ihn. Im Hintergrund saß im Halbdunkel ein Paar an einem Tisch, das die Köpfe zusammensteckte. Aber auch von ihnen war nichts Nennenswertes zu hören.
Die unaufdringlichen Herrschaften in der Runde taten mir gut. Ich wollte weder über meine berufliche Veränderung philosophieren noch hatte ich Lust, darüber zu brüten, was mir in der Vergangenheit passiert war. Ich wollte einfach nur ein bisschen abschlaffen.
Aber kaum hatte ich ein paar Schlucke aus meinem Bierglas getrunken, war es mit der Ruhe vorbei. Die Eingangstür ging auf und zwei Frauen in lautem Gespräch miteinander kamen herein. Verblüfft über diese hier eher ungewohnten Gäste schaute die ganze Runde misstrauisch zur Tür, und ich erkannte zwei der Bewährungshelferinnen aus der Gruppe vom Ludwigsplatz, darunter die eine, die mir zugewinkt hatte.
Als sie die Ruhe bemerkten, verstummten sie schlagartig und schauten sich etwas irritiert im Gastraum um. Als sie mich erblickten, steuerten sie, ohne zu zögern, auf mich zu.
„Herr Doktor Knall, was machen Sie denn hier?“, erkundigte sich die Ältere. Und, als ich nicht gleich antwortete: „Dürfen wir uns zu Ihnen setzen?“
Ohne meine Reaktion abzuwarten, kletterten die beiden auf die Barhocker rechts und links von mir.
Es war nicht zu übersehen, dass sie ziemlich angeheitert waren. Sie hatten wohl schon angefangen, das Wochenende gebührend einzuläuten. Lena Lautz, groß, schlank, sportlich, legte mir zu meiner Verblüffung ihren Arm um die Schultern und grinste mich an. Ich kannte sie seit vielen Jahren und schätzte sie wegen ihrer vorzüglichen Arbeit. Wir hatten ein ganz gutes Verhältnis zueinander, aber fern von Vertraulichkeiten. Sabine Maiser, klein, fröhlich, etwas rundlich, hatte mich beim Einstellungsgespräch überrascht mit ihrer sehr kreativen Art, an Probleme heranzugehen. Sicher eine Bereicherung für die Bewährungshilfe.
So nett und interessant die beiden waren, so hatte ich mir den abendlichen Ausklang hier nicht vorgestellt. Als meine rechte Nachbarin mich auch noch auf den Unfall in Spanien ansprach und mich dabei neugierig ansah, reichte es mir. Ich zahlte und verabschiedete mich höflich, aber knapp von den beiden, die mir etwas frustriert hinterhersahen.
Als ich langsam die Steigenhohlstraße am Vogelsang hinaufging, hörte ich auf einmal eine schöne, leise Melodie. Hinter hohen Büschen, rechts von mir, konnte ich eine geöffnete Terrassentür sehen, durch die ein schmaler Lichtstreifen auf eine Rasenfläche fiel. Und ich erkannte die melancholische Stimme von Cesária Évora mit ihrem „Cabo Verde“. Einen Augenblick blieb ich stehen, lehnte mich an einen Baum und schloss die Augen. Vielleicht sollte ich das als Zeichen nehmen: Einen Koffer packen und einen Flug auf die Kapverdischen Inseln buchen.
„ ... und die sie verlassen müssen, weinen.“ Die letzten Töne verklangen: Ich ging weiter.
Zu meiner Überraschung war weiter oben die Straßenlaterne in Ordnung gebracht worden und warf den schwarzen Schatten des großen Baumes im Vorgarten auf die weißen Wände und den Eingang des schönen alten Hauses, in das ich vor einiger Zeit eingezogen war. Im Erdgeschoss hatte ich nach meiner Trennung und einer etwas speziellen Phase in einem Hotel eine große, gemütliche Wohnung mit stuckverzierten Decken und einem Wintergarten gefunden. Über mir war lediglich eine weitere Wohnung, deren Mieter ich noch nicht kennengelernt hatte, und der den Herbst in seinem Bungalow in Florida zubrachte. Ich bewohnte das Haus zurzeit allein.
Während ich den schmalen Weg durch den kleinen Garten auf die Haustür zuging, erwischte mich auf einmal die Erinnerung daran, dass ich hier vor einiger Zeit niedergeschlagen worden war. Absolut passend dazu ließ mich ein raschelndes Geräusch hinter mir erschrocken herumfahren. Ich musste erleichtert lachen. Ein kleiner Igel rannte eilig durch die vertrockneten Blätter über den Weg und verschwand unter einem Busch.
„Na, du solltest dich langsam mal um dein Winterquartier kümmern!“, murmelte ich ihm hinterher und zog meine Schlüssel aus der Tasche.
Aber nach zwei Schritten blieb ich erneut abrupt stehen. In der halbgeöffneten Haustür direkt vor mir, ein paar Meter entfernt, stand regungslos eine dunkle, schmale Gestalt, offenbar genauso erschrocken wie ich. Das Gesicht unter einer schwarzen Wollmütze im Schatten kaum zu erkennen.
„Hallo ...“, fasste ich mich und wollte gerade einen Schritt vorgehen.
Doch da sprang dieser Mensch bereits mit einem Satz zur Seite, rannte schnell den mit Kies bestreuten, schmalen Gartenweg neben dem Haus entlang, dann mit einem Satz über den niedrigen Zaun zum Nachbargarten und hinaus auf die Straße.
„He, stopp! Bleib stehen!“, rief ich dem Kerl nach, was den offenbar nicht kümmerte. Ich hatte den Eindruck, dass er noch beschleunigte.
Nur ganz kurz zögerte ich. Aber schon einen Augenblick später rannte ich hinterher.
Mit meiner Größe bin ich nun nicht gerade der Sprinter-Typ, aber durch mein regelmäßiges Lauftraining bin ich ganz gut in Form. Außerdem war ich sicher, dass ich den späten „Besucher“ überwältigen könnte, wenn ich ihn nur zu fassen bekäme, da nur mittelgroß, eher zierliche Gestalt, gewiss kein Athlet, aber tatsächlich ziemlich flott. Ich lief so schnell ich konnte, mobilisierte alle Kräfte.
Ich schaffte es tatsächlich, auf der leicht ansteigenden Straße etwas näher an den Flüchtenden heranzukommen. Aber ich merkte, dass mein Bein wieder anfing zu schmerzen und dass ich das Tempo nicht mehr lange durchhalten würde. Ich schrie ihm hinterher: „Bleib stehen!“
Oben bog er nach links und lief den Vogelsangweg hinunter, sah kurz zu mir zurück und wechselte die Straßenseite, lief jetzt neben der hohen Hecke, der Begrenzung des Friedhofs. Ich folgte, so schnell ich konnte.
Die Gestalt machte einen Schwenker und verschwand im Schatten der hohen Bäume.
Ich sah sie nicht mehr, überlegte und versuchte zu erkennen, wohin sie sich gewendet hatte.
Leider war ich einen kurzen Augenblick unaufmerksam und stieß mit dem rechten Fuß gegen den Bordstein auf der anderen Straßenseite. Ich stolperte einige Schritte vorwärts und konnte gerade noch mit Mühe einen Sturz verhindern.
Ich schaute auf. Der Kerl war verschwunden. Ich lief hinunter zur Durlacher Straße. Rechts und links war niemand zu sehen. Der Mensch war weg. Vollkommen außer Atem lehnte ich mich gegen die kühle Steinwand der Alexiuskapelle im Einmündungsbereich.
Nach einiger Zeit fühlte ich mich wieder einigermaßen und da ich jetzt sowieso nichts mehr ausrichten konnte, betrachtete ich gedankenverloren die massiven Steinkreuze neben der Kapelle. Sühnekreuze für zwölf hingerichtete Ettlinger Ratsherren. Folgen eines Streites über den Geruch eines Schweinestalls. Und die Kapelle hinter mir diente einmal zur Unterbringung von Pestkranken. Mein eigenes Problem schien mir dann doch eher unbedeutend und ich hinkte die Straße hinauf.
Was war das für eine Person gewesen? Der Mieter von oben natürlich nicht. Der wäre nicht davongelaufen. Aber der Typ war ins Haus hineingekommen. Und ich war absolut sicher, dass ich abgeschlossen hatte.
Als ich die Beleuchtung im Hausflur anknipste, bemerkte ich etwas verblüfft ein weißes zusammengeknicktes Stück Papier, das halb unter meiner Wohnungstür steckte. Ich schloss auf, machte das Licht in der Wohnung an und hob das Blatt vom Boden auf.
Ich faltete es auseinander und blickte voller Entsetzen darauf. Mit einem schwarzen Filzstift geschrieben stand da, in feiner, exzellent geschwungener Schrift: „Du bist tot!“
Das Papier fiel mir aus der Hand und schwebte elegant in einem Halbkreis wie ein Segler zu Boden.
2
Erstaunt sah ich auf die Uhr. Es war Viertel nach neun. Ich war in der Nacht nicht ein einziges Mal aufgewacht, kein Nachtmahr, kein gesichtsloser Bogenschütze und keine Verfolgungsjagd hatten mich geplagt. Ich fühlte mich tatsächlich gut ausgeschlafen.
Entspannte Tage und dann nächtliche Geisterjagd, Albtraum am Abend und anschließend eine friedliche Nacht. Die menschliche Psyche bleibt ein Rätsel. Aber vielleicht war es einfach nur ein Anzeichen dafür, dass ich doch ganz schön stabil war.
Diese Überlegung gefiel mir recht gut. Und eigentlich sollte ich mir, nach den vielen Jahren der strafgerichtlichen Tätigkeit und den sich daraus ergebenden Nebeneffekten, ein dickes Fell zugelegt haben. Zwar kam es nie zu direkten körperlichen Angriffen von Verurteilten auf meine Person. Aber Drohgesten, unerfreuliche anonyme Briefe, nächtliche Anrufe oder auch zerstochene Reifen waren auch eine deutliche Sprache. Und im Gerichtssaal selbst bedurfte es manchmal kräftiger Reaktionen, um nicht das Zepter aus der Hand zu geben.
Darüber hinaus war mir in meiner Vergangenheit auch einiges mehr passiert. Es gab Vorfälle, die wohl nichts mit der Tätigkeit am Gericht zu tun hatten. Ich war angegriffen und überfallen worden. Mein Urvertrauen, dass man unversehrt durchs Leben gehen kann, war ziemlich beeinträchtigt.
Die Tür zu meiner Wohnung hatte ich am Abend zuvor nicht nur abgeschlosssen, sondern zusätzlich noch eine kleine Kommode davorgeschoben, was mir jetzt am sonnigen Morgen ein bisschen peinlich war. Eben doch nicht der furchtlose John Wayne.
Auf dem Boden lag immer noch die beklemmende Mitteilung, die ich jetzt in eine Klarsichthülle hineinschob. Aber fast mehr als der Inhalt selbst irritierte mich, dass sie unter meiner Wohnungstür gesteckt hatte. Der Täter war also trotz der verschlossenen Eingangstür ins Haus gekommen.
Mein unbekannter Mitbewohner aus dem Stockwerk über mir war in Amerika. Er war erst vor wenigen Wochen, während meiner Reha, eingezogen und offenbar sogleich verreist. Ein männlicher Single. So hatte es mir mein Vermieter jedenfalls in einer Notiz mitgeteilt.
Ich rief bei der Polizei an und ließ mich mit dem Kriminaldauerdienst verbinden. Man versprach mir, trotz Wochenende, sofort jemand vorbeizuschicken, der das Schloss der Haustür auf Aufbruchsspuren untersuchen und den Zettel mitnehmen würde.
Während ich wartete, dachte ich über die Worte auf dem Zettel nach. Eigentlich gar keine Drohung, eher eine Feststellung. Allerdings eine nicht zutreffende. Also eine unwahre Tatsachenbehauptung, wie man es vielleicht juristisch ausdrücken würde. ,Ist so was strafbar?‘, überlegte ich mir. Na ja, natürlich wollte mir der Autor Angst machen und mir drohen. Aber erwartet man nicht von einer derartigen Kampfansage auch eine kräftige, sozusagen brutale Schrift? Seltsam.
Und bei der Erinnerung an den nächtlichen Sprinter vor mir rumorte irgendein Gedanke in meinem Kopf. Aber ich konnte ihn nicht fassen.
Während die beiden etwas missmutigen Herren von der Kripo mit ihren silbernen Metallkoffern sich mit dem Schloss der Haustür beschäftigten, schaffte ich es, meinen Bekannten Eberhard von der Lancia-Werkstatt zu erreichen und ihn zu überreden, nach meinem Auto zu sehen.
Als ihm im letzten Jahr wegen sich häufenden Überschreitungen der zulässigen Höchstgeschwindigkeit ein Fahrverbot drohte, hatte ich ihm einige Ratschläge gegeben. Natürlich besaß er auch einen Lancia, aber ein extrem sportliches Modell. Und das ließ sich offenbar nur mit entsprechender Geschwindigkeit fahren. Ein bisschen hatte ich ihm helfen können, nachdem er mir aber vorher hoch und heilig versprechen musste, sich in Zukunft einigermaßen angepasst zu verhalten. Er war mir sehr dankbar. Wie er mir erklärte, hätte er einen Monat ohne Auto psychisch nicht überstanden.
Die Schlossexperten zogen mit dem Drohschreiben ab, nachdem sie mir erklärt hatten, es seien keine Einbruchspuren festzustellen, sie hätten aber eine Anzahl von Fingerspuren gesichert. Meine hatten sie mir vorher ebenfalls abgenommen.
„Höchstwahrscheinlich mit einem Originalschlüssel geöffnet“, sagte der eine, und sie würden von sich hören lassen. Ich blieb mit meiner Ratlosigkeit zurück.
Eberhard war erfolgreicher und brachte meinen Italiener dazu, wieder anzuspringen. Er wehrte meinen Fünfzig-Euroschein ab und sprang mit der Bemerkung: „Man liebt sie, oder man liebt sie nicht!“, in seine Sportschüssel und brauste davon.
Ich setzte mich in meinen breiten, bequemen Holzsessel, vor Jahren selbst entworfen und gebaut. Mein Lieblingsplatz neben dem schwarzen Bücherregal über die ganze Wand. Wie sollte ich auf die nächtliche Drohung reagieren? Ich hatte wenig Hoffnung, dass die Herren von der Kripo irgendwelche Feststellungen treffen könnten, die mir weiterhelfen würden. Vielleicht der Einbau eines Panzerriegelschlosses über die gesamte Breite der Wohnungstür? Doch ein bisschen überdimensioniert? Abgesehen davon: Mit der Sicherheit in der Tiefschlafphase war es ja auch nicht getan. Ich lehnte den Kopf zurück und schloss die Augen.
Der Aufenthalt in Spanien hatte meine Erinnerung an die intensiven und belastenden Verhandlungstage und an den arroganten Angeklagten nicht abmildern können. Fast hasserfüllt hatte er mich angesehen, als er gesichert mit Handschellen und Fußfesseln, die nur kleine Schritte zuließen, begleitet von zwei stämmigen Wachtmeistern aus dem Gerichtsaal geführt wurde, nachdem ich ihn zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt hatte. Kristeva, ein äußerst gefährlicher Gewaltverbrecher.
Nicht nur die Gerichtsverhandlung selbst war sehr spannungsvoll und außerordentlich nervenaufreibend gewesen. Auch vorausgegangen waren schon dramatische Ereignisse. Es war mir gelungen, zwei prozessentscheidende Belastungszeugen aus seinem direkten Umfeld zur Aussage zu bewegen, dies bis zum Beginn der Verhandlung zu verheimlichen und damit ihren Boss, den Angeklagten, auszutricksen. Und der hatte fest damit gerechnet, als freier Mann den Gerichtssaal zu verlassen.
Das alles war erst ein paar Monate her. Der Kerl war nicht gut auf mich zu sprechen. Das war klar. Aber wäre ihm eine solche doch eher harmlose Überraschung zuzutrauen?
Jedenfalls würde ich am Montag in der Vollzugsanstalt Bruchsal anrufen, mich nach ihm und nach irgendwelchen Auffälligkeiten erkundigen. Interessant wäre vielleicht auch, ob er schon Besuch empfangen durfte und falls ja, ob und wer bereits dagewesen war. Einen Augenblick überlegte ich, selbst hinzufahren und einen Kontakt herzustellen. Aber, was sollte das bringen? Abgesehen davon, dass er den wahrscheinlich verweigern würde.
Vielleicht wäre es trotzdem nicht falsch, sich mal näher mit dem mysteriösen Mitbewohner des Hauses zu beschäftigen, überlegte ich. Er war nach der Notiz des Vermieters ungefähr vier Wochen nach Abschluss meines großen Verfahrens eingezogen – oder eben doch nicht.
Den Vertrag hatte der zukünftige Mieter mit der Begründung ständiger Reiseverpflichtungen ohne persönlichen Kontakt abgewickelt. Er akzeptierte den recht hohen Mietpreis. Was den Vermieter offenbar veranlasste, sämtliche Bedenken zurückzustellen. Er hatte also einem vollkommen unbekannten Menschen seine Wohnung vermietet. Diese ungewöhnliche Abwicklung machte mich schon etwas nachdenklich. Ich wusste nicht einmal, wie er heißt. Am Eingang neben seiner Klingel steckte immer noch das leere Blatt. Allerdings, auch mein Name war dort nicht zu lesen. Ich wollte verhindern, dass man mich so ohne Weiteres findet. Auch in den Telefonbüchern suchte man mich vergeblich. Ich beschloss, ein bisschen Nachforschungen zu betreiben. Was war das für ein Kerl, und wo steckte er wirklich?