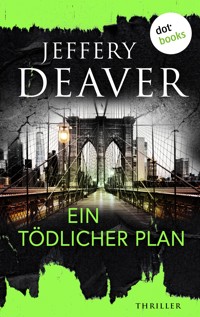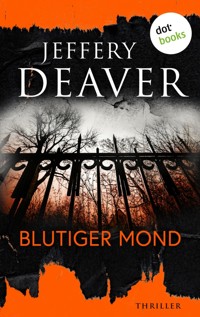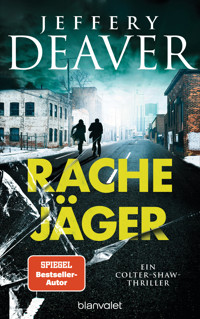10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Lincoln-Rhyme-Thriller
- Sprache: Deutsch
Ein gefährlicher Stalker versetzt ganz New York in Angst und Schrecken – der neue packende Fall für Lincoln Rhyme und Amelia Sachs!
Er kommt nachts in dein Haus. Er beobachtet dich, während du schläfst. Er trinkt deinen Wein. Keine Tür kann ihn draußen halten. Keine Überwachungskamera kann ihn aufzeichnen. Nun ist er auch noch bereit zu töten. Niemand in New York ist mehr sicher. Jetzt liegt es an Lincoln Rhyme, das Netz an Hinweisen zu entwirren und ihn zu stoppen. Doch Rhyme wurde suspendiert, gegen ihn wird wegen vermeintlich gefälschter Beweise in einem anderen Fall ermittelt. Während die Stimmung in der Stadt immer heftiger zu brodeln beginnt, bleibt nicht mehr viel Zeit, um den mörderischen Einbrecher aufzuhalten …
Verpassen Sie nicht die anderen eigenständig lesbaren Lincoln-Rhyme-Fälle wie zum Beispiel »Der Todbringer« oder »Der Komponist«.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 510
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Buch
Er kommt nachts in dein Haus. Er beobachtet dich, während du schläfst. Er trinkt deinen Wein. Er stiehlt wertlose Dinge. Er verbringt Zeit bei dir. Keine Tür kann ihn draußen halten. Keine Überwachungskamera kann ihn aufzeichnen. Und nun ist er auch noch bereit zu töten. Niemand in New York ist mehr sicher. Jetzt liegt es an Lincoln Rhyme, das Netz an Hinweisen zu entwirren und ihn aufzuhalten. Doch Rhyme wurde suspendiert, gegen ihn wird wegen vermeintlich gefälschter Beweise in einem anderen Fall ermittelt. Und während die Stimmung in der Stadt immer heftiger zu brodeln beginnt, bleibt nicht mehr viel Zeit, um den mörderischen Einbrecher aufzuhalten …
Autor
Jeffery Deaver gilt als einer der weltweit besten Autoren intelligenter psychologischer Thriller. Seit seinem ersten großen Erfolg als Schriftsteller hat Jeffery Deaver sich aus seinem Beruf als Rechtsanwalt zurückgezogen und lebt nun abwechselnd in Virginia und Kalifornien. Seine Bücher, die in 25 Sprachen übersetzt werden und in 150 Ländern erscheinen, haben ihm zahlreiche renommierte Auszeichnungen eingebracht. Nach der weltweit erfolgreichen Kinoverfilmung begeisterte auch die TV-Serie um das faszinierende Ermittler- und Liebespaar Lincoln Rhyme und Amelia Sachs die Zuschauer.
Weitere Informationen unter: www.jeffery-deaver.de
Von Jeffery Deaver bereits erschienen (Auswahl)
Der Knochenjäger · Letzter Tanz · Der Insektensammler · Das Gesicht des Drachen · Der faule Henker · Das Teufelsspiel · Der gehetzte Uhrmacher · Der Täuscher · Opferlämmer · Todeszimmer · Der Giftzeichner · Der talentierte Mörder · Der Komponist · Der Todbringer
Jeffery Deaver
Der Eindringling
Thriller
Deutsch von Thomas Haufschild
Die Originalausgabe erschien 2021 unter dem Titel THEMIDNIGHTLOCK bei G.P. Putnam’s Sons, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright der Originalausgabe © 2021 by Gunner Publications, LLC
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2023 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Dr. Rainer Schöttle
Umschlaggestaltung und -motiv: www.buerosued.de
StH · Herstellung: sam
Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck
ISBN 978-3-641-30746-2V001
www.blanvalet.de
Für Andrew, Wendy und Victoria
Im Journalismus kann es kein höheres Gesetz geben, als auf Teufel komm raus die Wahrheit zu sagen.
Walter Lippmann
I Zylindrischer Schlüssel
[26. Mai, 8.00 Uhr]
1
Irgendwas stimmte hier nicht.
Annabelle Talese hätte jedoch nicht zu sagen vermocht, was das wohl sein konnte.
Vielleicht lag es an ihrem Kater, dass sie so verwirrt war und sich vor irgendetwas fürchtete, das sie nicht benennen konnte. Dabei war er nur ein kleines »Kätzchen«, wie Annabelle das zu nennen pflegte – höchstens anderthalb Gläser Sauvignon blanc zu viel. Sie war mit Trish und Gab bei Tito’s gewesen, das zu den merkwürdigsten aller Restaurants an der Upper West Side von Manhattan zählte: eine Fusion von serbischer und Texmex-Küche. Eine der Spezialitäten war gebackener Käse mit Bohnen und Salsa.
Und dazu reichlich Wein.
Annabelle lag auf der Seite, strich sich das kitzelnde, dichte blonde Haar aus dem Gesicht und fragte sich: Was passt nicht ins Bild?
Nun, zunächst mal stand das Fenster einen Spaltbreit offen, und mit der Maibrise drang Manhattans Duft ins Zimmer: Abgase und Asphalt. Sie öffnete es nur selten. Warum also letzte Nacht?
Die Siebenundzwanzigjährige, die es als Fotomodell versucht hatte und sich inzwischen damit begnügte, hinter den Kulissen der Modewelt zu arbeiten, setzte sich auf, richtete ihr verdrehtes Hamilton-T-Shirt, zog es nach unten und rückte ihre seidenen Boxershorts zurecht.
Sie schwang die Füße über die Bettkante und tastete nach ihren Hausschuhen.
Die standen nicht da, wo sie sie eigentlich abgestreift haben musste, bevor sie zu Bett gegangen war.
Okay. Was ist hier los?
Talese hatte keine Phobien oder Zwangsstörungen außer einer, die sich auf die Straßen von New York City bezog. Sie konnte nicht anders, als sich die Schicht aus Keimen und anderen unaussprechlichen Viechern vorzustellen, die auf dem Asphalt der Stadt siedelten – und die in ihre Wohnung geschleppt wurden, sogar wenn Annabelle ihre Schuhe jeden Tag an der Tür in einen Karton stellte und dies auch von all ihren Freunden verlangte.
Sie lief niemals barfuß durch die Zimmer.
Und hier auf dem Boden lag nun statt der Pantoffeln das geblümte Rüschenkleid ausgebreitet, das sie tags zuvor getragen hatte.
Der vordere Saum war hochgeklappt, fast bis zum Ausschnitt, als würde das Kleid sich vor ihr entblößen.
Moment mal … Talese erinnerte sich verschwommen, das Kleid in den Wäschekorb geworfen zu haben, bevor sie ins Bad gegangen war.
Doch das konnte ja offensichtlich nicht sein. Die Hausschuhe standen demnach nicht dort, wo Annabelle nur geglaubt hatte, sie abgestellt zu haben. Und das Kleid lag nicht in dem Wäschekorb, in den sie nur geglaubt hatte, es geworfen zu haben.
Vielleicht war Draco, der Barkeeper, der immer so gern flirtete, etwas großzügiger als üblich gewesen.
Hatte sie womöglich eher zweieinhalb Drinks zu viel gehabt?
Sachte, Mädchen. Du musst das im Auge behalten.
Und nun, wie immer nach dem Aufwachen, das Smartphone.
Sie wandte sich zum Nachttisch um.
Es war nicht da.
Einen Festnetzanschluss hatte sie nicht, ihr Mobiltelefon war nachts die einzige Verbindung zur Außenwelt. Deshalb behielt sie es immer in ihrer Nähe und lud stets den Akku auf. Das Ladegerät steckte auch nach wie vor in der Wandsteckdose, aber das Telefon war weg.
Herrje … Was geht hier vor sich?
Dann sah sie die Hausschuhe. Die rosafarbenen Flauschdinger standen auf der anderen Seite des Zimmers links und rechts von einem kleinen hölzernen Stuhl, der näher an das Bett gerückt worden war, als Talese es normalerweise tat. Die Vorderseiten der Pantoffeln zeigten auf das Möbelstück und ihre Ausrichtung wirkte auf beinahe unheimliche Weise obszön – als hätte die Trägerin die Beine gespreizt und sich jemandem auf den Schoß gesetzt.
»Nein«, keuchte Talese, als sie entdeckte, was neben dem Stuhl auf dem Boden stand: ein Teller mit einem angebissenen Keks darauf.
Ihr Herzschlag beschleunigte sich, ihr Atem wurde flacher. Jemand war letzte Nacht in der Wohnung gewesen, hatte ihre Kleidungsstücke neu angeordnet und ein Stück von dem Keks gegessen.
Keine zwei Meter von ihr entfernt!
Das Telefon, das Telefon … wo ist das gottverdammte Telefon?
Talese griff nach dem Kleid auf dem Boden.
Dann erstarrte sie. Nicht! Er – denn in ihrer Vorstellung konnte es nur ein Mann gewesen sein – hatte es berührt.
Mein Gott … Sie lief zum Schrank, zog eine Jeans und ein NYU-Sweatshirt an und schlüpfte in das erstbeste Paar Turnschuhe, das sie finden konnte.
Raus! Sofort raus hier! Die Nachbarn, die Polizei …
Sie wäre vor lauter Angst am liebsten in Tränen ausgebrochen und wollte soeben das Schlafzimmer verlassen, als sie bemerkte, dass eine Kommodenschublade ein Stück geöffnet war. Dort bewahrte Annabelle ihre Unterwäsche auf. Irgendetwas sehr Buntes war zu sehen.
Sie wagte sich langsam vor, zog die Schublade ganz auf und schaute hinein. Ihr stockte der Atem und dann fing sie doch noch an zu weinen.
Auf ihren Höschen lag eine Seite aus einer Zeitung. Annabelle las diese Zeitung nicht, also musste er das Blatt mitgebracht haben. Darauf waren mit Lippenstift – ihrer Lieblingsfarbe, Fierce Pink – drei Worte geschrieben:
Abrechnung.
Der Schlosser
Annabelle Talese wollte zur Wohnungstür rennen. Nach etwa drei Metern hielt sie abrupt inne.
Ihr waren drei Dinge aufgefallen.
Erstens: In dem Messerblock, der auf der Arbeitsplatte in der kleinen Küche stand, fehlte oben rechts das größte Messer.
Zweitens: Die Tür des Wandschranks im Flur stand offen. Annabelle hielt sie immer geschlossen. Im Rahmen gab es einen automatischen Schalter. Sobald man die Tür öffnete, ging im Innern eine Glühlampe an. Jetzt jedoch war dort alles dunkel. Sie musste daran vorbei, um zum Ausgang zu gelangen.
Drittens: Die beiden Riegel der Wohnungstür waren geschlossen.
Was bedeutete – da der Einbrecher ja keinen Schlüssel besaß –, dass er noch hier war.
2
Der Verteidiger näherte sich dem leeren Zeugenstand, neben dem Lincoln Rhyme in seinem motorisierten Rollstuhl saß, und sagte: »Mr. Rhyme, ich möchte Sie daran erinnern, dass Sie nach wie vor unter Eid stehen.«
Rhyme runzelte die Stirn und musterte den stämmigen schwarzhaarigen Anwalt, der mit Nachnamen Coughlin hieß. Dann setzte er eine nachdenkliche Miene auf. »Mir war gar nicht bewusst, dass der Eid durch etwas beeinträchtigt worden sein könnte.«
Lächelte die Richterin etwa ein wenig? Rhyme konnte es nicht genau sehen. Er befand sich unten im Saal und sie saß ein ganzes Stück höher und seitlich hinter ihm.
Der Eid vor der Aussage war Rhyme schon immer wie theatralisches Gefasel vorgekommen, sogar ohne den Zusatz »so wahr Ihnen Gott helfe«.
Schwören Sie feierlich, die Wahrheit zu sagen, die ganze Wahrheit und nichts als die Wahrheit?
Wieso musste der Schwur feierlich abgelegt werden? Und was sollte nach dem ersten Mal »Wahrheit« diese doppelte Redundanz? Wie wäre es mit: »Schwören Sie, dass Sie nicht lügen werden? Falls doch, nehmen wir Sie fest.«
Viel effizienter.
Er lenkte nun ein. »Ich bestätige, dass ich unter Eid stehe.«
Der Prozess fand vor dem New York Supreme Court statt – der ungeachtet des Namens zu den eher niedrig angesiedelten Gerichtshöfen des Staates zählte. Der Saal war mit verschrammtem Holz vertäfelt und an den Wänden hingen Bilder von früheren Richtern, anscheinend zurück bis in die Zeit der Reconstruction. Der Ablauf der Verhandlung war jedoch absolut zeitgemäß. Auf den Tischen von Anklage und Verteidigung gab es Laptops und Tabletcomputer und auch die Richterin hatte einen schmalen hochauflösenden Monitor vor sich stehen. Im ganzen Raum war kein einziges Gesetzbuch zu sehen.
Die meisten der ungefähr dreißig Zuschauer hatten sich wohl wegen des berüchtigten Angeklagten hier eingefunden, ein paar vielleicht auch wegen Rhyme.
»Ich komme nun zum Kern meines Kreuzverhörs«, sagte Coughlin, den Rhyme auf etwa fünfzig schätzte, und blätterte in seinen Notizen. Auch wenn es hier keine Bücher gab, so mussten die Akten auf den Tischen von Verteidigung und Anklage doch mindestens vierzig Kilo wiegen.
»Danke, Sir«, sagte die Richterin.
Die Arbeit als Kriminalist, als forensischer Wissenschaftler zur Unterstützung strafrechtlicher Ermittlungen, findet nur zum Teil im Labor statt. Der andere Teil der Aufgabe ist die Präsentation. Die Anklage benötigt einen Sachverständigen, der die Erkenntnisse gut verständlich darlegt und dann geduldig und wirksam die Einwände der Verteidigung pariert. Sollte ein Zeuge durch den Verteidiger auseinandergenommen werden, kann ein guter Staatsanwalt ihn mit einer ergänzenden Befragung bisweilen rehabilitieren, aber es ist besser, gar nicht erst in eine solch missliche Lage zu geraten. Lincoln Rhyme war von Natur aus zurückhaltend und fühlte sich im Labor bei Weitem am wohlsten, aber er war nicht völlig in sich gekehrt. Die Selbstdarstellung vor den Geschworenen und das Rededuell mit dem Anwalt des Angeklagten machten ihm durchaus Spaß.
»Sie haben ausgesagt, dass am Schauplatz von Leon Murphys Ermordung keine Fingerabdrücke meines Mandanten hinterlassen wurden, korrekt?«
»Nein, habe ich nicht.«
Coughlin legte die Stirn in Falten und zog einen großen Schreibblock zurate, der präzise Notizen enthalten mochte – oder Kritzeleien oder ein Rezept für Rinderbrust. Rhyme hatte nämlich Hunger. Es war zehn Uhr vormittags und er hatte sein Frühstück verpasst.
Coughlin warf einen kurzen Blick auf seinen Mandanten. Viktor Antony Buryak, zweiundfünfzig. Dunkelhaarig wie sein Anwalt, aber kräftiger und mit blasser Haut. Er trug einen maßgeschneiderten dunkelgrauen Anzug und eine burgunderrote Weste. Seltsamerweise wirkte Buryaks Gesicht überhaupt nicht bedrohlich. Rhyme konnte ihn sich gut dabei vorstellen, wie er bei einem kirchlichen Wohltätigkeitsbasar am Pfannkuchenstand arbeitete, die Namen aller Eltern kannte und den Kindern einen Extraspritzer Ahornsirup spendierte.
»Soll ich Ihnen Ihre Aussage vorlesen lassen?« Coughlin, der sich Rhyme genähert hatte wie ein Hai seiner Beute, hob eine Hand.
»Nicht nötig. Ich kann mich daran erinnern. Ich habe ausgesagt – unter Eid, nur zu Ihrer Beruhigung –, dass von den am Schauplatz von Leon Murphys Ermordung gesicherten Fingerabdrücken keiner Ihrem Mandanten zugeordnet werden konnte.«
»Was genau ist der Unterschied?«
»Sie sagten, ich hätte behauptet, Ihr Mandant habe am Tatort keine Fingerabdrücke hinterlassen. Er kann aber eine Million Fingerabdrücke hinterlassen haben. Das Team der Spurensicherung hat schlicht keinen davon gefunden.«
Coughlin verdrehte die Augen. »Beantrage Streichung.«
Richterin Williams wandte sich an die Geschworenen. »Sie werden Mr. Rhymes Antwort außer Acht lassen. Aber versuchen Sie es erneut, Mr. Coughlin.«
Der Anwalt wirkte verärgert. »Mr. Rhyme, an dem Tatort, an dem der verurteilte Schwerverbrecher Leon Murphy erschossen wurde, wurden keine Fingerabdrücke meines Mandanten entdeckt, richtig?«
»Das kann ich nicht beantworten, denn ich weiß nicht, ob das Opfer ein verurteilter Schwerverbrecher war oder nicht.«
Coughlin seufzte.
Die Richterin räusperte sich.
»Aber das mit dem ›nicht entdeckt‹ kann ich bestätigen«, sagte Rhyme.
Coughlin und Buryak sahen sich an. Der Mandant blieb insgesamt ruhiger als sein Anwalt. Letzterer kehrte zu seinem Tisch zurück und schaute nach unten.
Rhyme stellte fest, dass einige der Geschworenen ihn anstarrten. Mutmaßlich wegen seiner Verfassung. Er hatte gehört, dass manche Verteidiger sich insgeheim über seine Anwesenheit beschwerten, denn als Querschnittsgelähmter im Rollstuhl, so glaubten sie, würde er indirekt Sympathien für die Anklage generieren.
Doch was sollte er machen? Er war nun mal auf den Rollstuhl angewiesen und von Beruf Kriminalist.
Rhymes Augen richteten sich auf den Angeklagten. In der Geschichte des hiesigen organisierten Verbrechens war Buryak eine einzigartige Figur. Ihm gehörten in der Stadt mehrere Unternehmen, aber den größten Teil seines Geldes verdiente er auf andere Weise, nämlich mit einer ungewöhnlichen Dienstleistung für die Unterwelt. Er war dadurch vermutlich für mehr Tote verantwortlich als irgendeine andere Verbrecherbande in der diesbezüglich sehr reichhaltigen Kriminalgeschichte New Yorks.
Das Volk des Staates New York gegen Viktor Buryak hatte jedoch nichts damit zu tun. Hier ging es nur um einen einzigen Vorfall, ein einziges Verbrechen, einen einzigen Mord.
Leon Murphy war erschossen worden und zwar ungefähr eine Woche nachdem er sich mit dem Leiter eines Lagerhauses getroffen hatte, das Buryak gehörte. Murphy war ein psychotischer Möchtegerngangster, der sich als eine Art Nachfahre der Westies empfand, jener brutalen irischen Bande, die einst über Hell’s Kitchen in Manhattan geherrscht hatte. Und dem Leiter des Lagerhauses hatte er nachdrücklich seinen Schutz angeboten.
Es erwies sich als eine wirklich schlechte Geschäftsidee, ausgerechnet dieses Produkt an ausgerechnet diesen Kunden verkaufen zu wollen.
»Haben Sie bei Leon Murphys Leichnam Fußspuren gefunden?«, fragte Coughlin. »Oder neben der Stelle, an der die Patronenhülse gefunden wurde?«
»Der Leichnam lag im Gras, sodass keine Fußabdrücke gesichert werden konnten. In der Nähe der Patronenhülse wurden von den Technikern hingegen Fußspuren entdeckt, aber aufgrund eines Regengusses kurz vorher ließ sich die Art des Schuhs nicht mehr feststellen.«
»Sie können demnach nicht aussagen, dass die Fußabdrücke meines Mandanten am Tatort gefunden wurden?«
»Meinen Sie nicht, dass sich das von selbst aus meinen Ausführungen ergibt?«, fragte Rhyme sarkastisch. Er hatte gelernt, dass man Anwälte ungestraft piesacken durfte. Das war in ihrem Honorar inbegriffen.
»Mr. Rhyme, sichert die Spurensicherung des NYPD routinemäßig DNS an Tatorten?«
»Ja.«
»Und haben Sie am Schauplatz von Leon Murphys Ermordung irgendwelche DNS-Spuren meines Mandanten gefunden?«
»Nein.«
»Mr. Rhyme, Sie haben das Projektil analysiert, von dem Mr. Murhpy getötet wurde, korrekt? Ein Bleigeschoss?«
»Ja.«
»Und Sie haben auch die Patronenhülse untersucht?«
»Das ist korrekt.«
»Und um welches Kaliber hat es sich gehandelt?«
»Neun Millimeter Parabellum.«
»Und Sie haben ausgesagt, dass die Felder und Züge, also die Spuren des Laufs, darauf hindeuten, dass die Waffe eine Glock siebzehn war.«
»Es war definitiv eine Glock und das Modell siebzehn ist am wahrscheinlichsten.«
»Mr. Rhyme, haben Sie oder einer der Ermittler, mit denen Sie zusammengearbeitet haben, die relevanten staatlichen und bundesweiten Waffendatenbanken auf Einträge meines Mandanten überprüft?«
»Ja.«
»Und hat er jemals eine Glock besessen, speziell das Modell siebzehn?«
»Keine Ahnung.«
»Bitte erläutern Sie das, Mr. Rhyme.«
»Er könnte ein Dutzend davon besitzen.«
»Euer Ehren«, sagte Coughlin. Er klang leicht gekränkt darüber, dass Rhyme ihn so unfair behandelte.
Hätte Viktor Buryak etwa beinahe gelächelt?
»Mr. Rhyme.« Die Geduld der Richterin war allmählich erschöpft.
»Er hat gefragt, ob sein Mandant jemals eine Glock besessen hat, und ich habe wahrheitsgemäß geantwortet, ich hätte keine Ahnung. Stimmt ja auch. Ich kann nur aussagen, dass sein Mandant im Staat New York laut den Unterlagen keine legal registrierten Glocks besitzt.«
»Euer Ehren«, warf der stellvertretende Bezirksstaatsanwalt Sellars ein, »die Verteidigung weicht von Captain Rhymes Beitrag zu dem Fall ab, denn der bestand nicht in der Überprüfung von Waffenverkäufen. Seine Expertise liegt auf dem Gebiet der Spurenanalyse.«
»Ich möchte auf etwas Bestimmtes hinaus, Euer Ehren«, sagte Coughlin. »Bitte räumen Sie mir etwas Spielraum ein.«
Rhyme achtete auf die wachen Augen des Mannes und fragte sich, worauf er wohl abzielte.
»Fahren Sie fort … vorläufig.«
»Mr. Rhyme, um es zusammenzufassen: Können Sie bestätigen, dass die DNS meines Mandanten weder am Fundort des Leichnams noch dem der Patronenhülse entdeckt wurde?«
»Korrekt.«
»Und auch nicht auf dem Leichnam oder der Hülse?«
»Das ist richtig.«
»Und seine Fuß- und Fingerabdrücke wurden an beiden Orten ebenfalls nicht gefunden?«
»Korrekt.«
»Und es wurden dort auch keine Fasern oder Haare gesichert, die sich auf ihn zurückführen ließen?«
»Korrekt.«
»Und laut den staatlichen und landesweiten Datenbanken besitzt er keine halbautomatische Glock-Pistole und hat auch nie eine besessen?«
»Korrekt.«
»In Wahrheit besteht also die einzige forensische Verbindung zwischen der Ermordung Leon Murphys und meinem Mandanten aus einigen Sandkörnchen an der Stelle, an der das Opfer gefunden wurde.«
»Sechs«, erwiderte Rhyme. »Wenn wir schon präzise sein wollen.«
Coughlin lächelte – es war an die Geschworenen gerichtet. »Sechs Körnchen Sand. Mr. Rhyme, bitte erklären Sie noch einmal, wie dieser Sand meinen Mandanten mit dem Mord in Verbindung bringt.«
»Der Sand hatte eine ungewöhnliche Zusammensetzung. Er bestand aus Calciumsulfat-Dihydrat, Siliziumdioxid und einer weiteren Substanz, C12H24, ungefähr drei Viertel gesättigte Kohlenwasserstoffe und ein Viertel aromatische Kohlenwasserstoffe.«
»Diese andere Substanz, wie Sie sie nennen. Könnten Sie uns die bitte erläutern?«
»Es ist eine bestimmte Art Dieseltreibstoff.«
»Und wieso verbindet dies meinen Mandanten mit dem Tatort?«
»Weil vor seiner Auffahrt in Forest Hills, Queens, Proben genommen wurden, in denen sich die gleiche Art Sand befand. Kontrollproben vom Fundort der Leiche wiesen keinen solchen Sand auf.«
»Stimmt der Sand, der vor dem Haus meines Mandanten gefunden wurde, mit dem am Schauplatz des Mordes an Leon Murphy gefundenen überein?«
Rhyme zögerte. »In der forensischen Wissenschaft heißt ›Übereinstimmung‹, dass etwas identisch ist. Fingerabdrücke stimmen überein. DNS stimmt überein. Manche chemischen Mischungen sind dermaßen komplex, dass man auch bei ihnen von Übereinstimmung ausgehen könnte. In allen anderen Zusammenhängen ist in der Forensik von ›Entsprechungen‹ die Rede. Man könnte auch sagen ›sehr, sehr ähnlich‹.«
»›Sehr, sehr …‹«, wiederholte Coughlin. »Ich verstehe. Sie können also nicht bestätigen, dass die Sandkörner beim Haus meines Mandanten mit den Sandkörnern am Tatort übereingestimmt haben.«
»Wie ich gerade erklärt habe …«
Der Anwalt unterbrach ihn barsch. »Können Sie sagen, dass die Sandkörner vom Haus meines Mandanten mit den sechs Sandkörnern vom Tatort übereingestimmt haben?«
Es verging ein langer Moment. »Nein, kann ich nicht«, sagte Rhyme dann.
Coughlin fuhr sich mit der Hand durch das kräftige Haar. »Wir sind fast fertig, Mr. Rhyme. Bevor Sie den Zeugenstand verlassen, möchte ich Ihnen nur noch ein paar letzte Fragen stellen.« Ein schneller Blick zu den Geschworenen und wieder zurück. »Und die beziehen sich auf Ihre Person.«
3
Wird es ein Mord sein oder nicht?
Werde ich das blutige Ende eines Menschen miterleben?
Die Lichtung ist von üppigem Grün umgeben und jenseits davon folgen sandige Felder. Im fernen Dunst wölben sich Hügel wie Kamelhöcker. Der Kondensstreifen eines Düsenflugzeugs durchschneidet weit, weit oben den Himmel. Eine wallende Sturmfront zieht auf und es wird bald regnen.
Ich recke den Kopf und schaue genau hin. Da sind zwei Männer, beide sehnig, schwarzhaarig. Sie tragen graue Hosen und T-Shirts mit Bildern und Schrift.
Ich selbst bin ganz ähnlich gekleidet, wenngleich meine Hose beigefarben ist und mein T-Shirt schwarz, ohne Aufdruck.
Wir alle tragen Laufschuhe.
Der Mann mit dem Messer steckt in einem AC/DC-T-Shirt. Der Mann vor ihm, dessen Hände auf den Rücken gefesselt sind, trägt ein ausgeblichenes gelb-grünes T-Shirt. Ich glaube, da war mal das Logo einer Sportmannschaft auf der Brust, aber nach zahllosen Waschgängen ist es nicht mehr da. Vielleicht ein brasilianisches Fußballtrikot.
AC/DC spricht laut, auf Spanisch. Das Messer bewegt sich, aber nicht bedrohlich. Der Mann gestikuliert nur. Macht seinen Standpunkt klar, betont etwas. Seine Körpersprache legt nahe, dass er sich über etwas aufregt. Die schneidenden Worte kommen ihm in abgehackten Salven über die Lippen.
Der Mann, dessen Hände mit einem langen Seil nachlässig zusammengebunden wurden, wirkt gleichermaßen verwirrt wie verängstigt.
Der Redner hebt nun das Messer in die Luft. Die untere Kante der Klinge ist glatt, die obere wie eine Säge.
Die Frage bleibt: Wird es ein Mord sein?
Womöglich geht es nur um eine Botschaft. Um nichts als eindringliche Worte. Zur Einschüchterung.
Wenn Menschen den Tod vor Augen haben, werden sie nicht etwa verzweifelt und versuchen, sich zu wehren oder wegzulaufen. Sie bleiben passiv, weinen eventuell oder fragen: »Warum, warum, warum?«, aber kaum mehr als das. Manchmal bieten sie etwas an, versprechen Geld oder Sex. Geloben, sich zu ändern. Murmeln ihr Bedauern.
Aber sie betteln nie um Gnade. Was ich interessant finde.
AC/DCs Redeschwall scheint abzuebben. Die Bewegungen des Messers werden langsamer. Der Gefesselte weint.
Und natürlich überlege ich, was ich tun sollte.
Gott zu spielen heißt, harte Entscheidungen zu treffen.
Ich sitze gespannt vorgebeugt da, behalte dieses heftige Messer im Auge, an dem getrocknetes Blut zu kleben scheint, und frage mich: Was wird es sein?
4
»Mr. Rhyme«, sagte Coughlin, »Sie analysieren die Spuren in Ihrem Privathaus, ist das korrekt?«
»In einem Labor in meinem Haus, ja.«
»Da haben Sie es ja nicht weit zur Arbeit«, warf der Mann salopp ein und lächelte. Mehrere der Geschworenen schlossen sich an.
Rhyme nickte kurz als Reaktion auf den müden Scherz.
»Welche Vorkehrungen treffen Sie, um sicherzustellen, dass die am Tatort gesammelten Beweise nicht durch Substanzen im Haus verunreinigt werden?«
»Wir befolgen zu einhundert Prozent die einschlägigen Richtlinien des American Forensic Institute.«
»Wie haben wir uns das vorzustellen?«
»Das Labor wird dreimal am Tag gründlich mit Desinfektionsmitteln gereinigt. Es ist vom Rest des Hauses durch eine vom Boden bis zur Decke reichende Trennwand aus Glas abgeteilt und im Innern herrscht Überdruck, sodass keine Substanzen von außen eindringen können. Niemand betritt das Labor ohne Schutzkleidung – Haube, Füßlinge, Maske und Kittel. Außerdem Handschuhe. So sind sowohl die Personen als auch die Beweise vor Kontamination geschützt.«
»Füßlinge, sagten Sie.«
»Wie Chirurgen sie tragen.«
»Bei allem Respekt für Ihren Zustand, Mr. Rhyme, Sie können doch keine Füßlinge über Ihre Räder ziehen.«
»Ich überwache zumeist die Laborarbeit der anderen.«
»Fahren Sie denn jemals in den – nennt man das ›sterilen Bereich‹?«
Rhyme zögerte erneut. Er schaute zum Staatsanwalt. Sellars wirkte leicht verunsichert. »Ja, steriler Bereich. Und ich halte mich gelegentlich dort auf, um Spuren zu analysieren. Dabei trage ich all die soeben erwähnte Schutzkleidung und …«
»Es geht mir um die Räder Ihres Rollstuhls. Wie verhindern Sie dort eine mögliche Verunreinigung?«
»Die Räder werden von meinem Betreuer sorgfältig gesäubert, bevor ich in den Bereich fahre. Mit Bürste und Putzlappen.«
Coughlin betrachtete den Rollstuhl. Es war ein Modell von Invacare mit großen Rädern in der Mitte und je zwei kleinen vorn und hinten. Rhyme konnte sich damit in jede gewünschte Richtung drehen, ohne vorwärts oder rückwärts fahren zu müssen.
»Ist dies der Stuhl, den Sie auch bei sich im Labor nutzen?«
»Ja, aber lassen …«
»›Ja‹ reicht aus, Sir. Was sind das denn für Reifen?«
»Das kann ich Ihnen nicht sagen.«
»Die Standardbereifung wäre der vierzehn Zoll große Invacare 3.00 – 8 mit Schaumfüllung. Er ist pannensicher.«
»Ich glaube, das stimmt.« Tja, der Mann hatte offenbar seine Hausaufgaben gemacht. Und wann hatte der Privatdetektiv des Anwalts ihn ausspioniert?
»Und Invacare ist bekannt für seine hochwertige Medizintechnik, richtig?«
»Einspruch«, sagte Sellars. »Der Zeuge ist kein Fachmann für den Ruf einer Firma. Was soll zudem der Zweck dieser Fragen sein?«
»Ich ziehe die Frage über die Produktqualität zurück, Euer Ehren, und komme jetzt zum Punkt.«
»Sehr gut. Und zwar mit Vivace, wenn ich bitten darf.« Die Richterin war als Opernliebhaberin bekannt.
»Selbstverständlich, Euer Ehren. Mr. Rhyme, funktionieren die Reifen an diesem Rollstuhl zu Ihrer Zufriedenheit?«
»Äh, ja.«
»Einschließlich einer guten Bodenhaftung?«
»Ja.«
»Glauben Sie, das liegt an dem tiefen Profil?«
»Einspruch.«
»Mr. Coughlin, falls Sie die Räder als Beweismittel anführen möchten, dann stellen Sie Ihren Antrag.«
»Das wird nicht nötig sein, Euer Ehren.«
Natürlich nicht. Die Geschworenen hatten das Reifenprofil ausgiebig begutachten können und es war tief. Der Anwalt hatte sein Argument vorgebracht.
»Mr. Rhyme, wie lange, schätzen Sie, benötigt Ihr Betreuer, um dieses Profil zu säubern?«
»Etwa zwanzig Minuten.«
»Für beide Reifen?«
»Ja.«
»Zehn Minuten pro Stück.«
»Zu diesem Ergebnis kommt jedenfalls die Mathematik.« Was auch ihm das eine oder andere Lächeln einbrachte.
»Ich habe Ihre Abhandlungen gelesen, Mr. Rhyme. Sie haben geschrieben, dass Spurenpartikel wie Klebstoff an Händen, Füßen und Haaren anhaften. Und dass diese Partikel so klein sein können, dass man sie ohne besondere Geräte wie leistungsfähige Mikroskope praktisch nicht aufspüren kann. Ist das korrekt? Das sind Ihre Worte, nicht wahr?«
»Ja, aber …«
»Sie haben die Richtlinien des American Forensic Institute erwähnt. Trifft es nicht zu, dass diese Richtlinien sich ausschließlich auf DNS-Verunreinigungen beziehen?«
Rhyme hielt inne. Er und der Staatsanwalt sahen sich an. »Das ist korrekt.«
»In ihnen steht nichts über andere Substanzen?«
»Nein, aber durch ihre Befolgung …«
»Mr. Rhyme, bitte. Die Richtlinien sagen nichts über andere Spurenpartikel aus, die in einem Labor analysiert werden. Ist das eine wahrheitsgemäße Aussage?«
»Ist es«, murmelte Rhyme.
Coughlins Augen leuchteten auf. »Wenn Ihnen bewusst war, dass die Richtlinien sich nur auf DNS beziehen, wieso führen Sie sie als Beweis für Ihre Gewissenhaftigkeit beim Umgang mit den Spuren an, die angeblich meinen Mandanten belasten?«
»Das ist mir gar nicht in den Sinn gekommen.«
»Könnte es sein, dass Sie versuchen wollten, die eigene Glaubwürdigkeit zu betonen, weil Sie in Wahrheit nicht allzu überzeugt von den Beweisen für die Tat sind, die meinem Mandanten zur Last gelegt wird?«
»Einspruch.«
»Stattgegeben.«
Doch natürlich konnte man das Gedächtnis der Geschworenen nicht löschen. Sie hatten gerade mitangehört, dass Rhyme bisweilen trickste.
»Mr. Rhyme, haben Sie sich im sterilen Bereich Ihres Labors aufgehalten, als dieser Sand analysiert wurde?«
Rhyme verstummte. Er schaute zu Thom, der hinten im Gerichtssaal saß. Der adrette Betreuer trug heute einen makellosen dunkelblauen Anzug, ein gebrochen weißes Hemd und eine dunkelgraue Krawatte.
»Mr. Rhyme?«, hakte Coughlin nach.
»Ja, habe ich.«
»Und bevor Sie hineingefahren sind, hat Ihr Betreuer da das Profil dieser Reifen gesäubert?«
»Ja.«
»Wie?«
»Mit Putztüchern und Bleiche.«
»Ist er mit einem Wattestäbchen oder vergleichbarem Gegenstand in die Rillen des Profils eingedrungen?«
»Nein, er hat Tücher benutzt.«
»Und das für nur zehn Minuten pro Rad.«
»Einspruch.«
Coughlin zog das »nur« zurück und fragte: »Und das jeweils zehn Minuten pro Rad?«
»So ungefähr, ja.«
»Mr. Rhyme, Sie müssen in Ihrem Labor über viele Geräte verfügen. Chromatografen, Elektronenmikroskope, Trocknungsschränke … eine typische forensische Ausstattung.«
»Das ist richtig.«
»Und produzieren diese Geräte eine nennenswerte Abwärme?«
»Wenn sie laufen, ja.«
»Gibt es in dem Labor Ventilatoren?«
Rhyme schwieg für einen Moment. »Ja.«
»Und ein Ventilator könnte theoretisch Spurenpartikel herumpusten? Sodass Fremdstoffe, die in das Labor gelangen, eine Bodenprobe kontaminieren könnten?«
»Einspruch.«
»Er ist Sachverständiger«, sagte die Richterin. »Ich lasse die hypothetische Frage zu. Mr. Rhyme, bitte antworten Sie.«
»Theoretisch.«
»Mr. Rhyme, im Beweismittelbericht steht, Ihr Labor habe die Bodenproben vom Tatort des Mordes und vom Grundstück meines Mandanten am zwanzigsten April analysiert. Ist das korrekt?«
»Das kommt hin.«
»Und haben Sie sich an dem Tag aus welchem Grund auch immer außerhalb Ihres Hauses aufgehalten?«
»Das weiß ich nicht mehr.«
»Nun, dann lassen Sie mich Ihr Gedächtnis auffrischen. Sie haben an dem Tag einen Vortrag an der Manhattan School of Criminal Justice in der Siebenundvierzigsten Straße West gehalten. Um zehn Uhr vormittags.«
»Da müsste ich in meinem Terminkalender nachsehen.«
»Ihr Vortrag ist auf YouTube hochgeladen worden. Mit Zeitstempel.«
»Dann muss die Antwort wohl Ja lauten«, sagte Rhyme steif.
»Euer Ehren«, sagte Coughlin, nahm ein weiteres Dokument und ging zur Richterbank. »Ich lege hiermit Beweisstück eins der Verteidigung vor.« Er reichte der Gerichtsdienerin zwei Exemplare; sie gab eines der Richterin und das andere dem Staatsanwalt. Sellars überflog es und sah dann stirnrunzelnd Rhyme an.
Nachdem auch sie ihr Exemplar quergelesen hatte, fragte die Richterin: »Mr. Sellars?«
Er seufzte. »Keine Einwände.«
Coughlin ging zu Rhyme und legte ein aufgeschlagenes Exemplar vor ihn hin. »Mr. Rhyme, dies ist ein Bericht von Albrecht and Tanner Forensic Services. Ist Ihnen diese Firma ein Begriff?«
»Ja.«
»Würden Sie dem Gericht bitte schildern, um wen es sich handelt?«
»Um ein privates forensisches Labor. Es ist auf Honorarbasis hauptsächlich für die Baubranche und für Produktionsbetriebe tätig.«
»Genießt Albrecht and Tanner einen guten Ruf?«
»Ja.«
»Dieser Bericht wurde von meiner Kanzlei in Auftrag gegeben und ich füge zur Offenlegung hinzu, dass wir dafür die normalen Gebühren der Firma bezahlt haben. Ich zitiere aus diesem Bericht: ›Unsere Techniker haben von Gehwegen, Gärten, Pflanzbeeten und öffentlichen Baustellen vierundachtzig Bodenproben genommen. Diese Proben wurden in sterilen Behältern aufbewahrt und zur Analyse in unser Labor gebracht. Unsere Techniker waren angewiesen, nach dem Vorkommen von Calciumsulfat-Dihydrat plus Siliziumdioxid in Kombination mit C12H24 zu suchen – gesättigten Kohlenwasserstoffen (fünfundsiebzig Prozent) und aromatischen Kohlenwasserstoffen (fünfundzwanzig Prozent). Unsere Analytiker haben signifikante Mengen der genannten Substanzen gefunden.‹«
Nach einem theatralischen Blick zu den Geschworenen wandte Coughlin sich wieder seinem Zeugen zu. »Mr. Rhyme, dieser Bericht beschreibt eine bestimmte Sorte Sand vermischt mit Dieseltreibstoff, korrekt?«
»Ja.«
»Sehen Sie die prozentualen Anteile der Chemikalien in den besagten Proben?«
Rhyme schaute nach unten auf das Dokument.
»Ja.«
»Und sind diese Anteile identisch mit der Verteilung in den sechs Sandkörnern, die die Staatsanwaltschaft als Beweismittel dafür vorgelegt hat, dass mein Mandant am Schauplatz des Mordes gewesen sein soll?«
Rhyme sah kurz zu Sellars. »Ja.«
Coughlin kehrte zu dem Bericht zurück. »Unter der Überschrift ›Orte der Probennahme‹ steht hier: ›Diese Sandproben stammen von einer Baustelle auf der Westseite des Central Parks, im Dreihunderter-Block.‹ Mr. Rhyme.« Coughlin hob den Kopf. »Liegt Ihr Privathaus, in dem sich Ihr Labor befindet, im Dreihunderter-Block am Central Park West?«
Rhyme räusperte sich. »Ja.«
»Ist es möglich, Mr. Rhyme, dass diese sechs Sandkörner, von denen Sie behaupten, dass sie das Haus meines Mandanten mit dem Schauplatz des Mordes an Leon Murphy in Verbindung bringen, von keinem dieser beiden Orte stammen, sondern aus Ihrer unmittelbaren Nachbarschaft, und dass sie im Reifenprofil Ihres Rollstuhls in das Labor gelangt sind, was bedeuten würde, dass keinerlei Spurenpartikel existieren, die eine Schuld meines Mandanten nahelegen würden?«
Rhymes Lippen wurden schmal.
»Euer Ehren?«, fragte Coughlin.
»Mr. Rhyme, bitte antworten Sie.«
Rhyme räusperte sich erneut. »Was Sie beschreiben, ist möglich.«
»Keine weiteren Fragen.«
5
Ich sehe, dass es sich nicht um eine Einschüchterungstaktik handelt.
Das hier wird ein Mord. Da gibt es kein Vertun.
Es wird Blut fließen.
Und zwar reichlich.
AC/DC, der mit dem Messer, packt das Opfer mit seiner linken Hand an den Haaren, zieht dessen Kopf in den Nacken und fährt mit dem Messer einmal fast ganz um den Hals, so wie man die Folienhaube oben auf einer Flasche Whisky durchtrennt. Das Opfer kreischt kurz vor Überraschung auf und dann sprudelt die leuchtend rote Flüssigkeit hervor. Oh, wie das spritzt. Er sinkt auf die Seite. Der Messermann sägt und sägt – die Klinge sah offenbar nur scharf aus – und trennt am Ende den Kopf ab. Verächtlich wirft er ihn beiseite und setzt dann seine Tirade fort. Der Leichnam zuckt nicht mal mehr. Er liegt völlig regungslos da.
Und nun zu meiner Beteiligung an dieser Sache.
Meiner Entscheidung.
Ich drücke die Leertaste, um das Video anzuhalten. Dann trinke ich einen Schluck koffeinfreie Cola und merke, dass sie während der letzten Stunde warm und schal geworden ist; ich war so in diese Videos versunken, dass ich völlig die Zeit vergessen habe.
Ich setze mich etwas gerader hin und hebe erst eine Schulter, dann die andere. Ein Knochen knackt. Der Stuhl an meiner Werkbank ist zwar gepolstert, aber nicht für langes Sitzen gedacht. Ich will mir schon ewig einen neuen besorgen und das werde ich auch bald. Ich habe da so ein Tausend-Dollar-Sondermodell im Auge.
Ich lese auf dem Bildschirm die Kommentare unter dem angehaltenen Video.
Wahnsinn!!!!
Los Zetas sollten zusammengetrieben und erschossen werden.
Der Täter war ein mexikanischer Cop, die Kartelle haben die ALLEINDERTASCHE.
Nicht so gut wie das von letzter Woche. Wieso keine Nahaufnahmen??
Warum haben die nicht auch seine Freundin erledigt?
Ja, warum nicht? Ich überlege. Das war tatsächlich ein wenig enttäuschend.
Also, Zeit für die Entscheidung.
Ich tippe etwas ein und drücke die Eingabetaste.
Der Bildschirm wird schwarz und es erscheinen die Worte:
Dieses Video wurde entfernt, weil es gegen die Richtlinien unserer Gemeinschaft verstößt.
Viele unserer Zuschauer werden deswegen stinksauer sein. Ich lese manchmal Kommentare, in denen die Löschung eines Videos beklagt wird. Die Leute schreien: Zensur! Wie können wir nur dermaßen gegen den Ersten Zusatzartikel verstoßen?
Doch Zuschauer in den sozialen Medien sind selten Verfassungsgelehrte und übersehen den bedeutenden Umstand, dass der Erste Zusatzartikel eine Zensur seitens der Regierung verbietet. Meine Firma – ViewNow – kann genau wie YouTube, Instagram und all die anderen nach Herzenslust löschen, was sie will. Völlig legal. Wenn dir das nicht gefällt, tipp eine andere Internetadresse ein und surfe dort weiter.
Ich hatte eine abweichende Vorgehensweise erwogen. Anstatt das Video zu löschen, hätte ich es hinter eine Zugangsseite stecken können. Wenn dann ein Zuschauer auf den Titel »Gerechtigkeit nach Art der Kartelle« geklickt hätte, wäre ein Dialogfenster aufgepoppt.
Nur für Erwachsene. Bitte loggen Sie sich ein, um Ihr Alter zu bestätigen.
Aber das Video war, wie meistens heutzutage, hochauflösend. Das Blut sprudelte heftig und im Übermaß und der Todesschrei – das letzte Geräusch, das das Opfer je von sich geben würde – war klar und deutlich zu vernehmen. Also musste die Exekution komplett gestrichen werden.
Meine Aufgabe als Inhaltsmoderator besteht darin, die Interessen meines Arbeitgebers zu vertreten. Und das heißt, ich muss ein heikles Gleichgewicht erzielen – zwischen einerseits aufregenden, schockierenden und abstoßenden Bildern und andererseits den niedlichen, lustigen und anregenden Beiträgen. Ich vermute allerdings, den Wunderkindern in der Chefetage der Silicon-Valley-Zentrale von ViewNow ist es letztlich scheißegal, ob sie positive Inhalte vermitteln; sie fürchten lediglich, ihre Anzeigenkunden zu verprellen, falls die Videos zu drastisch ausfallen sollten (wenngleich ich es echt witzig fand, als unter der Los-Zetas-Enthauptung eine Bannerwerbung der Lebensversicherung Family Pride eingeblendet wurde).
Und es bleibt noch eine weitere Frage: Soll ich den Account des Users aufgrund dieses Verstoßes löschen?
Bisher hat er Szenen aus den Videospielen Grand Theft Auto und Red Dead Redemption hochgeladen, zwar sehr brutal, aber computergeneriert. Bei der Produktion dieser Spiele sind keine echten Einwohner von San Andreas oder Siedler des Wilden Westens zu Tode gekommen.
Ich sehe aber seinen Weg. Von diesen Spielen und gewalttätigen japanischen Animes ist er dazu übergegangen, mehr und mehr echte Szenen von Blut und Tod zu posten, die er auf anderen Seiten gefunden hat, von Opfern diverser Genozide und Massenmorde – aufgenommen nach den jeweiligen Taten.
Die heutige Kartell-Enthauptung ist der erste Mord in Echtzeit, den er gepostet hat.
Wird ihm eines Tages auch das nicht mehr ausreichen? Will er dann nicht nur Beobachter, sondern Teilnehmer sein?
Man lässt sich von der Lust leicht hinreißen.
Ich spreche da aus Erfahrung.
Löschen oder nicht?
Ich bin Gott. Ich kann tun, was ich will.
Mein Finger schwebt über den Tasten.
Ach, soll er doch sein kleines Hobby behalten.
Sobald ich das Enthauptungsvideo gelöscht habe, poppt sofort ein anderes auf. Ein hilfreicher Algorithmus trägt dafür Sorge.
Es stammt von dem Verschwörungstheoretiker namens Verum, der mehrmals pro Woche etwas hochlädt. Wir halten auch nach politisch aufrührerischem Material Ausschau, nicht nur nach Blut und Sex. Und der anonyme Verum balanciert da zweifellos auf einem schmalen Grat.
Die bis zur Unkenntlichkeit verpixelte Gestalt sitzt an einem Schreibtisch. Der Raum ist weiß und der Vorhang vor einem großen Fenster ist geschlossen. In den Wänden stecken Haken, an denen offenbar Gemälde hängen, wenn die Kamera nicht läuft.
Verum ist besessen von Geheimhaltung.
Aus gutem Grund.
Die tiefe Stimme ist ebenfalls verzerrt und wirkt dadurch nur umso unheimlicher.
»Freunde: Ich bin in den Besitz eines als geheim eingestuften Berichts gelangt. Es geht darin um ein Programm der Verborgenen, das in Los Angeles, Chicago und New York durchgeführt wird. Das Kitabi-Projekt ist eine geheime Maßnahme, um jeden einzelnen Schüler per Gesichtserkennung im System zu erfassen – von der Kita bis zum Abi, daher der Name. Die Daten sollen dazu genutzt werden, die Bewegungen der Kinder und ihrer Eltern zu protokollieren und zu analysieren, um dadurch im Laufe der Zeit politische, religiöse und ökonomische Profile zu erstellen, die präziser sind als alles, was wir bisher kennen.
Die Verborgenen werden vor nichts zurückschrecken, um unsere Privatsphäre zu vernichten! In den Kommentaren unter diesem Video findet ihr die Namen und Anschriften der Direktoren der betroffenen Schulen. Lasst nicht zu, dass sie unsere Kinder zum Kanonenfutter dieses Krieges machen!
Sprecht eure Gebete und haltet euch bereit!
Mein Name ist Verum, lateinisch für ›wahr‹. Denn das ist meine Botschaft. Was ihr damit macht, liegt bei euch.«
Darunter steht die Adresse einer Seite im Darknet, auf der man Geld für den Kampf gegen die Verborgenen spenden kann, die von Verum heftig attackiert werden, ohne dass er sie je genau definiert hätte. Die eingeblendeten Werbeanzeigen sind zielgerichtet: Überlebensausrüstung, Waffen, Bücher von anderen Verschwörungstheoretikern.
Man könnte Verums Beiträge blockieren, weil ihre vermeintlichen Fakten »unzutreffend« sind oder »nicht überprüft werden können«.
Oder man nimmt wieder die nützliche Standardbegründung und beruft sich pauschal auf die Richtlinien unserer Gemeinschaft.
Manche seiner Beiträge rufen zur Gewalt auf. Wir gegen die Verborgenen.
Ich sperre es nicht.
Dann stehe ich auf und gehe quer über den hundertfünfzig Jahre alten Werkstattboden, die abgenutzten und ungleichmäßigen Eichendielen, und hole mir eine kalte Cola.
Der Raum ist nicht groß. Er hat Deckenbalken, Ziegelmauern und hölzerne Stützpfeiler. Die Fenster sind durch stählerne Läden gesichert. Die wurden vor hundertzwanzig Jahren dort angebracht, damit niemand in die Sebastiano Company für Bäckereibedarf einbrechen und etwas stehlen konnte. Auch für meine Zwecke sind sie gut geeignet. Ich möchte hier wirklich keine Eindringlinge haben, wenngleich ich mir weniger über Diebe als über andere ungebetene Besucher Sorgen mache.
Der Raum ist immer hell erleuchtet, denn andernfalls erinnert er mich an das Konsequenzzimmer und ich werde wütend.
Mein Blick fällt auf eine nackte Backsteinwand, in die ich lange Nägel gehauen habe, an denen meine gesammelten Schlösser hängen. Einhundertzweiundvierzig an der Zahl. Außerdem Netzbeutel voller Schlüssel, von denen ich mindestens tausend besitze.
Davon abgesehen sind die Wände der Werkstatt schmucklos, denn wenn man Schlösser und Schlüssel hat, was braucht man da noch für andere Kunstwerke?
Ich schaue auf meinem Telefon die Uhrzeit nach.
Dann logge ich mich aus und im selben Moment sind die Los-Zetas-Enthauptungen und Copyright-Verstöße und Verums anarchische Phrasen vergessen.
Ich muss Pläne schmieden.
Der nächtliche Besuch bei Annabelle Talese war eine Herausforderung. Aber kein Vergleich zu meinem nächsten.
Denn der wird beträchtlich mehr Raffinesse erfordern.
6
Die Ermittler der Strafverfolgungsbehörden bezeichnen einen potenziellen Verdächtigen als »Person von Interesse«.
Lincoln Rhyme hatte als Gegenstück dazu aus Sicht des forensischen Wissenschaftlers den Begriff »Substanz von Interesse« geprägt. Er meinte damit Materialien, die irgendwie aus der Reihe fielen, beispielsweise an einem Tatort auftauchten, obwohl es keinen erkennbaren Grund dafür gab.
Als Ron Pulaski, der junge Streifenbeamte, der Rhyme und Amelia Sachs oft assistierte, zum ersten Mal diese Beschreibung hörte, hatte er gesagt: »Ach ja, wie in den Kinderbüchern. Welches Ding gehört nicht zu den anderen? Sie wissen schon, etwa ein Hai, der in einem Baum nistet.« Er war Vater von zwei Kindern.
Im ersten Moment hatte Rhyme sich über diesen Vergleich lustig machen wollen. Dann hatte er kurz überlegt und eingeräumt: »Ganz genau.«
Im vorliegenden Fall war es die Substanz NaClO2, besser bekannt unter ihrem Spitznamen Natriumchlorit.
Die Partikel waren am Schauplatz eines Mordes gesichert worden, im Garten einer bescheidenen Villa in einem vornehmen Teil von Queens. Alekos Gregorios, der wohlhabende Eigentümer einer Kette von gewerblichen Waschsalons, war erstochen und ausgeraubt worden. Zwei Detectives vom 112. Revier an der Austin Street – Tye Kelly und Crystal Wilson – untersuchten den Fall, und da das Hauptlabor der New Yorker Spurensicherung zurzeit stark ausgelastet war, hatten sie Rhyme gebeten, ihnen auf dem kurzen Dienstweg behilflich zu sein und einen Blick auf die Spuren zu werfen. Man sei für jede Unterstützung dankbar.
Er hatte eingewilligt.
Gregorios, ein Witwer, hatte allein gelebt. Seine Nachbarn gaben an, rund um den Zeitpunkt des Mordes nichts Verdächtiges bemerkt zu haben, doch sein erwachsener Sohn, der an jenem Tag mit ihm zu Abend gegessen hatte, behauptete, sein Vater sei einige Stunden zuvor mit einem Obdachlosen aneinandergeraten. Der Mann habe sich am Tor des umzäunten Gartens zu schaffen gemacht und Gregorios habe ihn verjagt, woraufhin der Obdachlose wilde Drohungen ausgestoßen habe, die von Gregorios aber nicht ernst genommen worden seien.
Der Sohn konnte als Beschreibung des Mannes lediglich die Angaben seines Vaters wiederholen: weiß, mit struppigem, ungewaschenem braunem Haar, bekleidet mit einem verdreckten Regenmantel.
Keine näheren Details.
In New York City gab es ungefähr fünfzigtausend Obdachlose, weshalb eine allgemeine Überprüfung der Straßen und Notunterkünfte wenig Erfolg versprach. Die Detectives hofften, Rhyme könne die Suche für sie etwas eingrenzen.
So kam NaClO2 ins Spiel, die Substanz von Interesse, die Rhyme isoliert hatte.
Er war zurück in seinem Stadthaus am Central Park West – an genau dem Ort, der in der Verhandlung gegen Viktor Buryak zum Thema geworden war.
Das stattliche Anwesen stammte aus der Zeit, als Königin Victoria über England herrschte und Boss Tweed über New York, jeweils mit unangefochtener Macht in den zugehörigen Einflusssphären, die sich gar nicht so sehr voneinander unterschieden, außer in ihren geografischen Ausmaßen.
Abgesehen von den vertäfelten Wänden, dem prächtigen Eichenboden und der verputzten Decke sah im Salon allerdings nichts mehr so aus wie vor anderthalb Jahrhunderten. Während es auf einer Seite des Flurs ein zeitgenössisches Wohnzimmer mit Sesseln, Tischen und Bücherregalen gab, entsprach die andere Seite der Beschreibung, die Rhyme dem Anwalt Coughlin gegeben hatte: ein gut ausgestattetes forensisches Labor, auf das jede kleine bis mittelgroße Polizei- oder Sheriff-Behörde neidisch gewesen wäre. Rund um die Arbeitsplätze standen Funkenemissions- und Fluoreszenzspektrometer, Trocknungsschränke, ein Bedampfungskasten für Fingerabdrücke, ein Hyperspektralbild-Analysator, ein automatisierter DNS-Sequenzierer, ein Hämatologie-Analysator, Flüssigkeits- und Gaschromatografen sowie ein Tiefkühlschrank, wie es ihn auch in jeder Küche hätte geben können.
In einer der Ecken befanden sich die Mikroskope – binokular, stereo, konfokal und Rasterelektronen – sowie die zahllosen Handinstrumente, die zum Alltag eines forensischen Wissenschaftlers gehören.
Das Labor hatte eine entschieden gewerbliche Anmutung, doch für Lincoln Rhyme gab es nur eine einzige zutreffende Beschreibung dafür: »gemütlich«.
Er dachte kurz zurück an die Verhandlung und fragte sich, wie die Beratung der Geschworenen wohl derzeit laufen mochte.
Er selbst hatte noch nie in einer solchen Jury gesessen. Kriminalisten, die als Berater für das NYPD und das FBI tätig sind, fliegen nach spätestens sechzig Sekunden aus der Vorauswahl.
Rhyme musterte nun die weiße Tafel, auf der gewisse Aspekte des Mordfalls Gregorios festgehalten waren. Da er die Ermittlungen lediglich unterstützend begleitete, wurden hier nur einige Grundzüge notiert oder als Dokument aufgehängt, nicht alle Einzelheiten: eine kurze Beschreibung des Verdächtigen, der Todeszeitpunkt (circa 21.00 Uhr), etwaige Überwachungskameras (mehrere in der Gegend vorhanden, aber nicht auf den Tatort gerichtet), die zwei unterschiedlichen Schuhe des Täters (bei Obdachlosen nicht unüblich) und ein schlichtes Foto der drei Stichverletzungen im Torso des Opfers. Die Abwesenheit anderer Wunden ließ darauf schließen, dass der Täter sich auf dem Grundstück versteckt und Gregorios überrascht hatte. In manchen Bundesstaaten, zum Beispiel in Kalifornien, hätte man dies als »Auflauern« eingestuft, wodurch die Tat automatisch zu einem Kapitalverbrechen wurde. In New York existierte dieser gesonderte Straftatbestand nicht, aber das Verhalten des Täters würde es der Staatsanwaltschaft erleichtern, einen Tatvorsatz nachzuweisen.
Die Fotos vom Tatort zeigten den geschundenen Leichnam und die an einen Rorschachtest erinnernde Blutlache auf dem breiten Pfad aus weißen und beigefarbenen Kieseln.
Und es gab Partikelspuren.
An der Gesäßtasche des Opfers, in der mutmaßlich die Geldbörse gesteckt hatte, wurde von den Technikern eine Probe genommen, die NaClO2 enthielt, dazu Zitronensäure und Kirschsirup.
Rhyme hatte für die Detectives des 112. Reviers ein Memo diktiert, das ausgedruckt auch hier an der Tafel hing.
Mischt man Natriumchlorit und Zitronensäure, ergibt sich Chlordioxid (ClO2), ein verbreitetes Desinfektions- und Reinigungsmittel. ClO2wird jedoch auch betrügerisch als vermeintliches Allheilmittel gegen diverse Krankheiten eingesetzt, darunter Aids und Krebs. In diesen Fällen wird ClO2meistens ein Geschmacksstoff hinzugefügt, etwa Zitronen-, Zimt- oder, wie hier, Kirschsirup.
Sollte eine Person von Interesse ClO2mit Kirschgeschmack in ihrem Besitz haben, erscheint es ratsam, ihren Aufenthaltsort zum Zeitpunkt des Mordes zu ermitteln und, sofern ein entsprechender Beschluss erwirkt werden kann, weitere Spuren und Beweise zu sichern, die den Verdächtigen mit dem Tatort in Verbindung bringen könnten.
Die bald darauf eingetroffene Antwort stammte von Detective Tye Kelly:
Alle Achtung, Captain Rhyme. Wir schulden Ihnen eine Flasche von was auch immer Sie trinken, bis hin zu und einschließlich Johnnie Walker Blue.
Rhyme hörte nun, wie die Haustür sich öffnete und die Geräusche des dichten Verkehrs entlang des Central Park West kurz lauter wurden.
»Wie ist es gelaufen?«, fragte Amelia Sachs, die vom Flur in den Salon trat. Sie meinte nicht den Fall Gregorios, wusste Rhyme, sondern seine Aussage im Prozess gegen Buryak.
»So halbwegs«, sagte er zu seiner Frau und zuckte die Achseln, eine der wenigen Gesten, zu denen er fähig war. »Wir müssen abwarten.«
Amelia Sachs, hochgewachsen und schlank, strich sich das lange rote Haar aus dem Gesicht. Sie bückte sich und küsste ihn auf den Mund. Er roch das süßsaure Aroma von Pulverrückständen.
»Du siehst irgendwie besorgt aus«, stellte sie fest.
Er verzog das Gesicht. »Der Verteidiger. Ich weiß nicht so recht. War er gut oder nicht? Keine Ahnung.«
»Dann frage ich wohl lieber nicht, wie lange die Jury sich deiner Meinung nach beraten wird.«
Sachs, eine erfahrene Beamtin des NYPD, hatte selbst schon in Hunderten von Prozessen ausgesagt. Sie wusste, wie sinnlos diese Frage war.
»Und wie war es bei dir?«, fragte er.
Sachs nahm an dynamischen Schießwettbewerben teil, bei denen man von Station zu Station wechselte und auf Papier- oder Stahlziele feuerte. Man erhielt Punkte für Zielsicherheit, Geschwindigkeit und Trefferwirkung. Die Schützen feuerten aus liegender, knieender und stehender Position und wussten vorher meistens nicht, wie die Stationen konfiguriert sein oder wo die Ziele auftauchen würden. Bei dieser Art Wettbewerb wurde viel improvisiert.
Sachs hatte Spaß am Schießen, auch wenn es nur ums reguläre Training auf der Schießbahn ging. Genauso gern war sie mit ihrem kastanienbraunen Muscle Car, einem Ford Torino Cobra, auf der Rennstrecke oder im Stadtverkehr unterwegs.
»Nicht so toll«, erwiderte sie auf Rhymes Frage.
»Das heißt?«
»Zweiter Platz.« Ihr Achselzucken ahmte seines nach.
»Gab es nicht insgesamt fünfzig Teilnehmer?«
Ihre Schultern hoben sich erneut.
Sachs ging stets hart mit sich ins Gericht, räumte aber immerhin ein: »Der Typ, der gewonnen hat, macht das hauptberuflich.«
Rhyme hatte von ihr erfahren, dass geübte Schützen im Umfeld der Wettbewerbe gut verdienen konnten – nicht an den Preisgeldern, sondern durch Sponsoren und indem sie Schießunterricht gaben.
Thom brachte ihnen Kaffee und einen Teller mit Keksen.
Rhyme hatte im Moment jedoch keinen Durst – jedenfalls nicht auf Kaffee.
»Nein«, sagte Thom.
Rhyme runzelte die Stirn. »Ich habe doch gar nichts gesagt.«
»Dein Mund nicht, aber deine Augen.«
»Du glaubst, ich habe zu dem Single Malt geschaut? Habe ich aber nicht.«
Hatte er doch.
»Es ist zu früh.«
Rhyme hatte noch keine medizinische Aussage darüber gehört, dass ein Querschnittsgelähmter seinen Alkoholkonsum minimieren sollte, und falls derartige Studien existierten, hätte er sie ohnehin ignoriert.
»Es war ein schwieriger Morgen. Du hast doch selbst in der Verhandlung gesessen.«
»Zu früh«, wiederholte Thom nachdrücklich und stellte den Becher Kaffee auf den Tisch neben Rhyme und dessen Rollstuhl. »Und übrigens, ich fand, du hast dich gut gehalten. Im Zeugenstand.«
Ein Seufzen – zu melodramatisch laut, musste Rhyme gestehen. Er sah zu der Flasche, die der Betreuer zwar im Salon gelassen hatte, aber zu hoch für Rhymes Reichweite. Verdammt! Sachs hätte sie natürlich mühelos holen können, aber in Hinblick auf Rhymes Gesundheit hielt sie sich an Thoms Anweisungen – zumindest meistens. Und der heutige Vormittag würde anscheinend keine Ausnahme darstellen.
Rhyme nahm den Becher, trank einen Schluck und musste widerwillig einräumen, dass der Kaffee wirklich gut schmeckte. Dann stellte er den Becher wieder ab, ohne einen Tropfen zu verschütten. Dank einer Operation und unermüdlicher Physiotherapie besaß er inzwischen nahezu vollständige Kontrolle über seinen rechten Arm und die Hand. Die Behandlung von Patienten mit Rückenmarksverletzungen hatte in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht und laut Rhymes diversen Ärzten würde er seinen Zustand sogar noch weiter verbessern können. Er stand dem nicht ablehnend gegenüber, wusste aber, dass er es hassen würde, so viel wertvolle Arbeitszeit durch die Eingriffe und nachfolgenden Genesungsphasen zu verlieren.
Vorläufig war er mit dem aktuellen Stand zufrieden – zumal er, so wollte es eine Laune des Schicksals, auch seinen linken Ringfinger benutzen konnte. Das klang nach wenig, aber er konnte damit meisterhaft seinen Rollstuhl steuern. Und die rechte Hand blieb frei, um ein Beweisstück zu halten … oder ein Glas zwölf Jahre alten Scotch Whisky.
Wenngleich nicht heute.
Er zog in Erwägung, Staatsanwalt Sellars anzurufen. Aber wieso eigentlich? Der Mann würde sich melden, sobald er etwas hörte.
Rhymes Telefon summte. Er erteilte den Sprachbefehl zum Abheben.
»Lon.«
»Ich hab hier einen seltsamen Fall und könnte etwas Hilfe gebrauchen, Linc«, grummelte die Stimme. »Amelia?«
»Ich bin auch hier, Lon.«
In Lincoln Rhymes Haus waren die Telefone grundsätzlich auf den Lautsprecher geschaltet.
»Habt ihr beide Zeit?«
»Definiere erst ›seltsam‹«, verlangte Rhyme.
»Ach, das mache ich lieber persönlich. Ich bin sowieso schon vor der Tür.«
7
Upper East Side.
Ich komme von der U-Bahn-Station, nicht zu schnell, nicht zu langsam. Mit dem Strom der Passanten bewege ich mich in Richtung Norden.
Für einen beiläufigen Beobachter sehe ich ganz normal aus: dichtes dunkles Haar, ziemlich lang, eher widerspenstig als lockig. Mein Körper ist schlank, schlaksig. Meine Finger sind lang und meine Ohren größer, als mir gefällt. Ich glaube, deshalb gehe ich so selten zum Friseur; ich will den Makel verdecken. Ich trage auch oft Wollmützen. In New York City fällt diese Art von Kopfbedeckung fast das ganze Jahr lang nicht auf. Sofern du dreißig Jahre oder jünger bist, wie ich. (Ein Unterschied: Meine Mütze lässt sich zu einer Skimaske herunterziehen.)
Ich trage die Laufschuhe, die denen von Los Zetas ähneln. Sie wurden in China hergestellt und sind eine Billigmarke. Aber sie sind bequem. Hauptsächlich trage ich sie, weil ich gehört habe, dass die Polizei manchmal eine Datenbank mit Sohlenprofilen hat, und da ließe eine bekannte Marke sich viel leichter identifizieren und zurückverfolgen. Vielleicht ist das auch nur Einbildung, aber es kann ja nicht schaden.
Im Moment trage ich eine blaue Jeans und unter einem schwarzen Anorak ein rosafarbenes Anzughemd, wirklich hübsch. Eine Freundin, mittlerweile Ex, hat es mir geschenkt. Das lässt mich an Aleksandra denken. Die ist keine Ex, sondern sehr präsent. Zufälligerweise hat sie vor Kurzem mal erwähnt, dass Rosa ihre Lieblingsfarbe ist.
Während einer meiner Sitzungen fand Dr. Patricia es vielversprechend, als ich auf ihre Frage nach einer aktuellen Freundin mit Ja antwortete und von Aleksandra erzählte. »Sie ist hübsch, eine Russin, eine professionelle Maskenbildnerin. Sie hat die Figur einer Tänzerin. Das war sie auch mal, als kleines Mädchen.«
Von Aleksandra habe ich erfahren, dass alle russischen Mädchen entweder Tänzerinnen oder Turnerinnen sind. »Und zwar ohne Ausnahme«, verkündete sie mit liebenswert professoraler Miene.
Ich biege in die 97. Straße ein und als niemand hinsieht, schlüpfe ich durch einen Maschendrahtzaun und in ein halb abgerissenes Gebäude, in dem es nach Moder, Ziegelstaub und Urin riecht.
Es hat früher mal einem gewissen Bechtel oder einer Familie diesen Namens gehört, wer auch immer die gewesen sein mögen. Jedenfalls ist der Name unter der Dachkante eingemeißelt.
Dieser Ort ist ziemlich abstoßend, aber wie gemacht für meine Zwecke: Man hat von hier aus den Seiteneingang des Apartmenthauses im Blick, das ich heute Nacht zu besuchen gedenke.
Der östliche Teil der Neunziger-Straßen befindet sich im Umbruch. Es ist recht dunkel hier, mir kommt es trostlos vor. Das liegt daran, dass die Sonne nicht bis hierhin vordringt, nur reflektiertes Licht. Der Begriff »verwässert« fällt mir ein.
Ich habe das Gebäude vorsichtig betreten und halte nach etwaigen Bewohnern Ausschau. Falls es welche gibt, sind sie wahrscheinlich auf Meth, Heroin oder Crack, sofern überhaupt jemand noch Crack nimmt, aber das bedeutet ja nicht, dass sie keine Zeugen sein können. Ich habe natürlich mein Messer dabei, möchte es aber nicht benutzen – wer braucht schon all den Ärger?
Doch es ist niemand hier, wie auch bereits bei meinen letzten beiden Besuchen. Das überrascht mich nicht. Das Haus sieht aus, als könnte jeden Moment auch der Rest einstürzen.
Der viele Müll gibt mir allerdings zu denken. Der chinesische Schuh mag ja anonym sein, aber ich weiß nicht, wie wirksam die Gummisohle vor dreckigen Injektionsnadeln schützt.
Ich schaue hinaus, mustere die vereinzelten Passanten. Ich bin ein Experte im Beobachten von Leuten und deshalb merke ich auch sofort, wenn ich selbst beobachtet werde. Im Augenblick werde ich das nicht. Ich bin hinter den Fensterscheiben verborgen, so wie ich auch für die Leute auf ViewNow verborgen bleibe – unsichtbar, doch stets aufmerksam.
Nun betrachte ich ihr Gebäude: graubrauner Stein, Fenstereinfassungen aus Aluminium, ein verwitterter grüner Baldachin, der zur Straße führt. Zehn Etagen. Hier wohnen nicht viele junge Leute und auch nur wenige Rentner. Dieser Teil der Stadt – obwohl blass und nichtssagend, architektonisch langweilig – ist teuer.
Aber Carrie Noelle kann es sich leisten. Nach allem, was man so hört, ist sie erfolgreich im Geschäft.
Mein Aufenthalt hier gehört zu der Methode, mit der ich meine Besuche vorbereite. Gute Planung ist ein Muss.
Es gibt zwei Arten, ein Schloss zu knacken. Der grobe Ansatz beinhaltet entweder den Einsatz einer Dietrich-Pistole – die man in den Schließzylinder steckt und so oft den Abzug drückt, bis das Schloss sich öffnet – oder eines Hammers, mit dem man einen Schlüsselrohling ins Schloss treibt, bis es nachgibt. Der zweite Ansatz ist das Raking – der subtile, künstlerische Ansatz. Mein Ansatz.
Desgleichen gibt es zwei Ansätze für einen Einbruch. Manche Einbrecher improvisieren. Sie tauchen bei dem Haus auf und warten einfach ab, was passiert.
Dazu bin ich nicht in der Lage. Meine Besuche erfordern ausgiebige Vorbereitungen. Ich muss über die Sicherheitsmaßnahmen im Haus Bescheid wissen, über die Vordertür, den Seiteneingang, etwaige Kameras in Lobbys und Fluren oder draußen, Pförtner, Aussichtspunkte, Obdachlose oder Junkies in der Nähe, die high, verrückt oder betrunken sein mögen, aber vielleicht trotzdem über ein so gutes Gedächtnis verfügen, dass sie mich haargenau beschreiben könnten.
Interessanterweise habe ich vor einer Weile gelernt, dass auch Serienmörder in zwei Kategorien fallen: planlose und organisierte Täter.
Ich stelle nun fest, dass sich nichts geändert hat. Es gibt keine neuen Kameras in oder an Carries Haus. In den benachbarten Eingängen hat kein Obdachloser Unterschlupf gesucht. Der Seiteneingang ist mit einem schlichten Webb-Miller ausgestattet. Das zählt eigentlich kaum. Schlösser wie dieses sind für mich nicht mehr als ein Schluckauf.
Nun bleibt nur noch eines zu überprüfen.
Und ich muss dafür nur einen kurzen Moment warten. Miss Carrie Noelle höchstpersönlich kommt in Sicht, auf dem Rückweg von einem Mittagessen, zu dem sie, wie ich wusste, verabredet war.
Sie ist groß, Mitte dreißig. Heute trägt sie Jeans und Lederjacke. Dazu Laufschuhe, orangefarben und modisch, nicht grell. Ihr kastanienbraunes Haar ist zu einem Pferdeschwanz nach hinten gebunden. Sie ist nicht wunderschön wie ein Fotomodell, aber doch ziemlich hübsch. Die Frau geht mit geschmeidigen Schritten. Sie hat etwas Athletisches an sich. Katzengleich. Sie ähnelt meiner hinreißenden Aleksandra nicht nur äußerlich, sondern bewegt sich auch genauso elegant.
Jedes russische Mädchen, sie ist Turnerin oder Tänzerin während Kindheit …
Carrie geht auf dem Bürgersteig vor dem Bechtel-Gebäude entlang. Sie kommt an dem Fenster vorbei, keine drei Meter entfernt, aber sie schaut nicht hinein.
Und das letzte Element der Vorbereitungen: Ich vergewissere mich, dass sie allein ist. Carrie kommt nicht in männlicher Begleitung, was meinen Besuch verkomplizieren würde. (Es könnte von mir aus auch gern eine weibliche Begleitung sein, aber ich weiß, dass sie hetero ist.)
Natürlich könnte auch erst heute Abend jemand zu Besuch kommen, aber das sähe ihr nicht ähnlich.
Sie ist gern für sich.
Nun erreicht sie ihr Haus. Sie grüßt einen Nachbarn, offenbar ein Rentner. Auch er geht auf den Eingang zu. Beide lächeln – ihres ist strahlend – und wechseln ein paar Worte. Er öffnet mit seinem Schlüssel die Tür (ein albernes Henderson-Sicherheitsschloss).
Carrie trägt schwere Einkaufstüten und er, anscheinend ganz der Gentleman, bietet an, ihr zu helfen. Sie gibt ihm eine der Tüten. Als er sie nimmt, wirft er einen Blick hinein, lächelt erneut und zieht beeindruckt eine Augenbraue hoch.
Was mir verrät, dass der Empfänger des wie auch immer gearteten Inhalts entzückt sein wird. Andererseits, unter Berücksichtigung des Firmenlogos auf der Tüte, sind Kinder denn nicht immer außer sich vor Freude, wenn ihre Eltern ihnen dieses ganz besondere neue Spielzeug in die kleinen Hände drücken?
8
»Zerknittert« war das übliche Wort, um Lon Sellitto zu beschreiben, den Detective First Grade mittleren Alters, der früher mal Lincoln Rhymes Partner gewesen war, bevor dieser zur Spurensicherung wechselte und später sogar Leiter der NYPD Investigation and Resources Division wurde, der forensischen Abteilung der New Yorker Polizei, zu der auch die Spurensicherung gehörte.
Der stämmige Mann mit dem schütteren Haar, dessen Farbe sich am ehesten als braungrau definieren ließ, betrat nun mit seinem Mobiltelefon am Ohr den Salon, nickte zum Gruß Rhyme und Sachs zu und steuerte direkt die Kekse an. Er klemmte sich das Telefon zwischen Wange und Schulter, brach einen der Kekse vorsichtig durch, legte dann den größeren Teil zurück auf den Teller, um schließlich seine vermeintliche Willenskraft Lügen zu strafen, indem er das andere Stück gierig verschlang.
Er war anscheinend in der Warteschleife. »Haferflocken. Rosinen«, sagte er zu niemandem. »Verflucht, kann dieser Mann backen!« Er sah zu Sachs. »Backen Sie auch hin und wieder?«
Sie wirkte verblüfft, als hätte ihr jemand diese alte Frage über Engel auf einer Nadelspitze gestellt, wie immer die auch ging. »Einmal, glaube ich. Nein, das war was anderes.«
»Wie ist die Verhandlung gelaufen?«, fragte Sellitto.
»Ich hab nicht die leiseste Ahnung«, murrte Rhyme. »Es liegt jetzt alles in den Händen der Geschworenen.« Man hörte ihm an, dass er nicht über den Prozess nachdenken, geschweige denn darüber diskutieren wollte. »›Seltsam‹?«, fragte er nun. »Du hast von ›seltsam‹ geredet.« Das Herz des Kriminalisten schlug ein wenig schneller – was man, wie immer, an seiner Schläfe ablesen konnte. Lincoln Rhyme lebte für »seltsam« ebenso wie für »ungewöhnlich« und »herausfordernd«. Und für »unerklärlich«. Ein Fall, in dem Bandit A seinen Konkurrenten Bandit B erschießt und zehn Minuten später mit der Mordwaffe erwischt wird, war uninteressant. Rhymes schlimmster Feind war nicht etwa ein psychotischer Killer, sondern die Langeweile. Schon vor dem Unfall, genau wie danach, hatte Langweilen sich für ihn stets so angefühlt, als würde er ein bisschen sterben.
Amelia Sachs sah dem Besucher ebenfalls mit einer gewissen Vorfreude entgegen, so schien es. Sie war der Abteilung für Kapitalverbrechen zugeteilt, in der Sellitto als leitender Lieutenant fungierte. Und obwohl Sachs für jeden Vorgesetzten dort tätig war, der sie anforderte, arbeitete sie am häufigsten für Sellitto – und bei ausnahmslos jedem Fall, zu dem Rhyme als Berater hinzugezogen wurde.
Der Detective sprach nun mit der Person am anderen Ende der Leitung. »Jawohl, Sir … Wir sind an der Sache dran … Okay … Gut.« Er ging zu der makellosen Glaswand, die den nicht sterilen Teil des Salons vom Labor trennte, und klopfte geistesabwesend gegen die Scheibe. Dann nickte er, wie jemand es am Ende einer Unterredung tun würde, auch wenn der Gesprächspartner sich meilenweit entfernt aufhielt. »Jawohl, Sir.« Er steckte das Telefon in eine Tasche seines braunen Anzugs. Der Mann hatte auch andersfarbige Kleidung, aber wenn Rhyme an Sellitto dachte, dann automatisch an Braun.
Thom brachte einen weiteren dampfenden Becher. »Bitte sehr, Lon. Wie geht es Ihnen? Was macht Rachel? Haben Sie sich eigentlich den Hund zugelegt, von dem Sie erzählt haben?«
»Lenk ihn nicht ab, Thom. Er ist hier, um uns eine interessante Geschichte zu erzählen, nicht wahr, Lon? Über etwas Seltsames.«
»Ihr Kaffee ist wirklich der beste.«
»Danke schön.«
»Ist in den Keksen Zuckersirup drin?«
»Nicht zu viel. Sonst überdeckt er alles.«
»Nicht ablenken, hab ich gesagt«, warf Rhyme langsam und frostig ein.
»Rachel backt auch gern«, sagte Sellitto. »Neulich hat sie Scones gemacht. Ich weiß nicht mal genau, was das ist. Irgendwie trocken. Aber lecker mit Butter. Okay, okay, Linc. Zwei Uniformierte hier vom Zwanzigsten wurden zu einem Einsatz gerufen.«