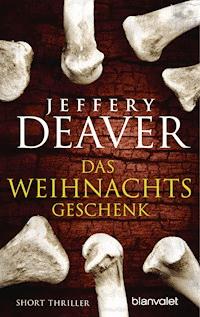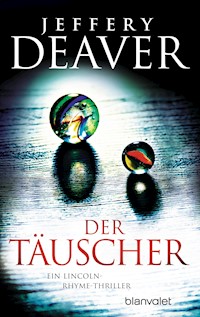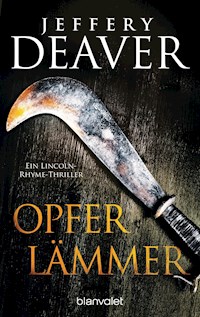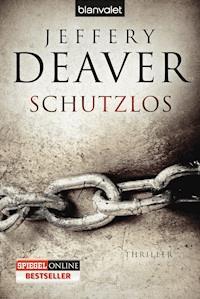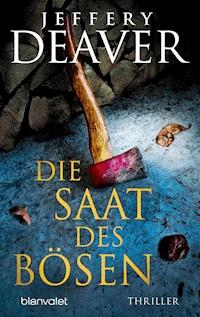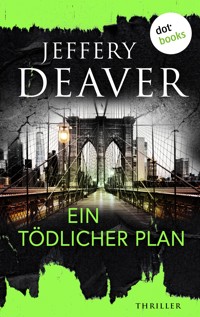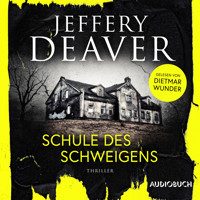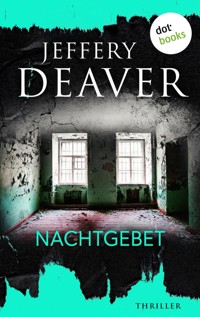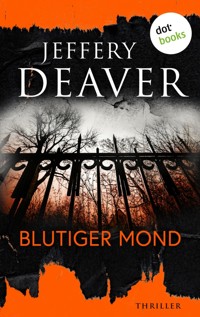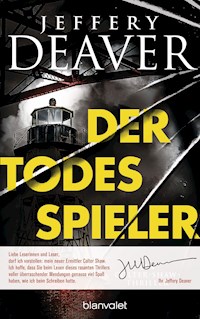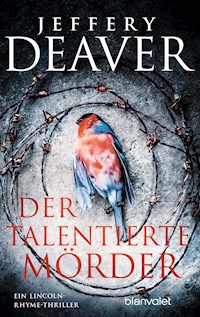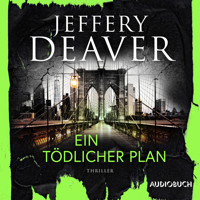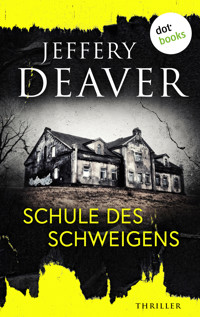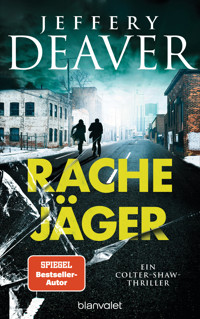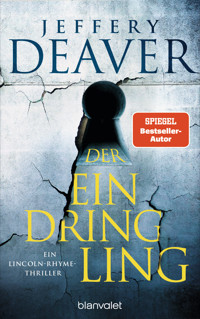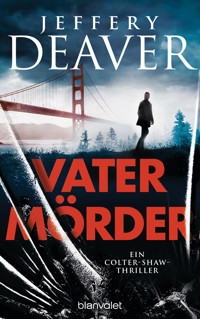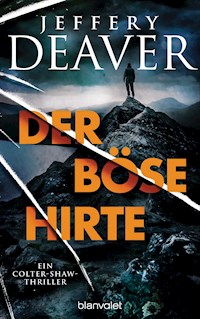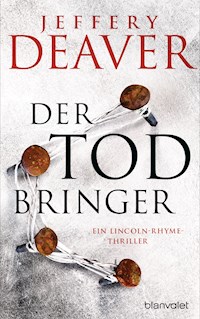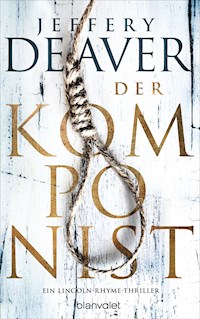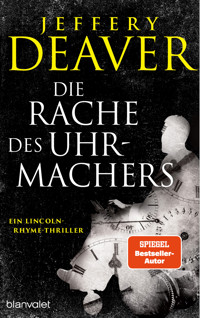
16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Lincoln-Rhyme-Reihe
- Sprache: Deutsch
Rhymes Erzfeind kehrt zurück, während Terroristen New York in Panik versetzen – ein neuer nervenzerreißender Einsatz für das Ermittlerduo Rhyme und Sachs!
Mitten in New York stürzt ein Baukran auf mysteriöse Weise ein, verursacht massiven Schaden und tötet eine Person. Eine politische Gruppe bekennt sich zur Sabotage und droht mit weiteren Anschlägen in 24 Stunden. Die Uhr tickt für den querschnittsgelähmten Rhyme und seine Partnerin. Sie müssen die Terroristen stoppen, um Menschenleben zu retten. Doch auch Rhymes Leben steht auf dem Spiel. Denn sein größter Widersacher – der Uhrmacher – ist in die Stadt zurückgekehrt. Und er will endlich seine Drohung wahr machen: Rhyme zu vernichten. Es kommt zum großen Showdown!
Sie wollen noch mehr Lincoln-Rhyme-Action? Dann lesen Sie »Der Eindringling«, »Vatermörder« oder »Der böse Hirte«.
Kennen Sie auch die Reihe um Colter Shaw? Ein Muss für alle Deaver- und Thrillerfans!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 500
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Buch
Mitten in New York stürzt ein Baukran auf mysteriöse Weise ein, verursacht massiven Schaden und tötet eine Person. Eine politisch motivierte Gruppe bekennt sich zur Sabotage und droht mit weiteren Anschlägen in 24 Stunden. Die Uhr tickt für den querschnittsgelähmten Forensiker Lincoln Rhyme und seine Partnerin Amelia Sachs. Sie müssen die Terroristen stoppen, um Menschenleben zu retten. Doch auch Rhymes Leben steht auf dem Spiel. Denn sein größter Widersacher – der Uhrmacher – ist in die Stadt zurückgekehrt. Und er will endlich seine Drohung wahr machen: Rhyme zu vernichten. Es kommt zum großen Showdown!
Autor
Jeffery Deaver gilt als einer der weltweit besten Autoren intelligenter psychologischer Thriller. Seit seinem ersten großen Erfolg als Schriftsteller hat Jeffery Deaver sich aus seinem Beruf als Rechtsanwalt zurückgezogen und lebt nun abwechselnd in Virginia und Kalifornien. Seine Bücher, die in 25 Sprachen übersetzt werden und in 150 Ländern erscheinen, haben ihm zahlreiche renommierte Auszeichnungen eingebracht. Nach der weltweit erfolgreichen Kinoverfilmung begeisterte auch die TV-Serie um das faszinierende Ermittler- und Liebespaar Lincoln Rhyme und Amelia Sachs die Zuschauer.
Weitere Informationen unter: www.jeffery-deaver.de
Von Jeffery Deaver bereits erschienen (Auswahl)
Der Knochenjäger · Letzter Tanz · Der Insektensammler · Das Gesicht des Drachen · Der faule Henker · Das Teufelsspiel · Der gehetzte Uhrmacher · Der Täuscher · Opferlämmer · Todeszimmer · Der Giftzeichner · Der talentierte Mörder · Der Komponist · Der Todbringer · Der Eindringling · Die Rache des Uhrmachers
Jeffery Deaver
Die Rache des Uhrmachers
Thriller
Deutsch von Thomas Haufschild
Die Originalausgabe erschien 2023 unter dem Titel The Watchmaker’s Hand bei G.P. Putnam’s Sons, New York 2023.
Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Copyright der Originalausgabe © 2023 by Gunner Publications, LLC
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2025 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
(Vorstehende Angaben sind zugleich Pflichtinformationen nach GPSR)
Redaktion: Dr. Rainer Schöttle
Umschlaggestaltung: © Getty Images (Ogphoto, Huntstock, David Wall); www.buerosued.de
StH · Herstellung: CS
Satz und E-Book Produktion: Satzwerk Huber, Germering
ISBN 978-3-641-32624-1V002
www.blanvalet.de
Für Jerry Sussman, Patriot, Familienmensch und Freund
e5ccebd2f80138b22ab8c840a6c5a9277d53bcff0c66b8033525dc8f6cbfd648
Hashwert eines Computer-Algorithmus für:
»Zeit ist eine Illusion.«
Albert Einstein
I
VERDACHTSFALL
1
Sein Blick schweifte über das majestätische Panorama von Manhattan, sechsundsechzig Meter weiter unten. Da unterbrach ihn der Alarm.
Bei der Arbeit war ihm dieser hartnäckig pulsierende elektronische Warnton noch nie untergekommen, nur damals in der Ausbildung, als er den Sicherheitsschein gemacht hatte. Dank seiner Berufserfahrung und der technischen Ausgereiftheit der Millionen Dollar teuren Maschine unter seinem Hintern war ihm das schrille Geräusch in der kleinen Kabine bisher erspart geblieben.
Er zog die fünfundzwanzig mal zwanzig Zentimeter großen Monitore vor ihm zurate … ja, da blinkte jetzt ein rotes Licht.
Doch es musste sich um einen Fehlalarm handeln, war Garry Helprin überzeugt, völlig ungeachtet der hektischen Elektronik. Wahrscheinlich ein Sensor.
Und siehe da, wenige Sekunden später erlosch das Licht. Und das Geräusch hörte auf.
Er betätigte behutsam die Steuerung und ließ die achtzehn Tonnen schwere Last emporsteigen. Seine Gedanken kehrten zu der Frage von gerade eben zurück.
Dem Namen des Babys. Sein Vater hoffte auf William, und die Mutter seiner Frau wünschte sich Natalia, aber die würden es nicht werden. An den Namen gab es eigentlich nichts auszusetzen, doch Peggy und ihm schwebte für ihren Sohn oder ihre Tochter etwas anderes vor. Er hatte angeregt, sich mit den zukünftigen Großeltern einen Spaß zu erlauben. Und daher hatten sie am Ende beschlossen: Kierkegaard, falls es ein Junge wurde. Und Bashilda, falls sie eine Tochter bekamen.
»Du meinst Batseba«, hatte Garry gesagt, als Peggy den Vorschlag machte. »Aus der Bibel.«
»Nein. Bashilda. Mein imaginäres Pony, als ich zehn Jahre alt war.«
Kierkegaard und Bashilda, würden sie nun also behaupten und dann sofort das Thema wechseln. Die entsetzten Gesichter wären …
Der Alarm plärrte wieder los, und das Licht blinkte. Auf dem Bildschirm gesellte sich ein Warnfenster hinzu: die Lastmomentanzeige. Die Nadel wies nach links, darunter das Wort: Ungleichgewicht.
Unmöglich.
Der Computer kannte das Gewicht beider Ausleger haargenau: das des vorderen, der so lang wie eine Boeing 777 war, und das des hinteren, der die Kontergewichte aus Beton trug. In die Berechnung flossen dann sowohl die zu hebende Last ein als auch ihr Abstand von der Mitte des Krans, in dessen Führerhaus Garry saß.
»Komm schon, Big Blue. Echt jetzt?«
Garry redete oft mit den Maschinen, die er bediente. Manche von ihnen schienen darauf zu antworten. Dieser spezielle Baylor HT-4200 war eigentlich ziemlich geschwätzig.
Heute aber blieb er stumm, mal abgesehen von dem Warnsignal.
Und wenn hier oben der Alarm schrillte, dann gleichzeitig auch im Container der Bauleitung.
Das Funkgerät erwachte scheppernd zum Leben. »Garry, was ist da los?«, hörte er in seinem Kopfhörer.
»Einer der Lastmomentsensoren scheint zu spinnen«, erwiderte er. »Da vor fünf Minuten noch alles in Ordnung war, gibt es auch jetzt kein Problem. Es hat sich ja nichts geändert.«
»Vielleicht der Wind?«
»Nein, es liegt am Sensor, da bin ich …« Er verstummte abrupt.
Denn er spürte die Neigung.
»Verdammt«, rief er. »Es ist doch das Lastmoment. Der vordere Ausleger weicht null Komma drei neun Grad nach unten ab. Halt, jetzt null Komma vier.«
Rutschte die Last von ganz allein allmählich auf das Ende des blau lackierten Gitterauslegers zu? Hatte die Laufkatze sich von den Antriebskabeln gelöst?
Garry hatte noch nie von so etwas gehört.
Er sah nach vorn. Konnte nichts Ungewöhnliches entdecken.
Nun minus null Komma fünf.
Auf einer Baustelle ist nichts so umfassenden Vorschriften und regelmäßigen Kontrollen unterworfen wie die Stabilität eines Turmkrans, vor allem eines dermaßen hoch aufragenden, in dessen Radius sich ein halbes Dutzend Gebäude und Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Personen befinden. Die Last – in diesem Fall fünfzehn mal zehn Zentimeter große Flanschträger von insgesamt achtzehntausend Kilogramm – wird peinlich genau berechnet und mit den vorhandenen Gegengewichten abgeglichen, um sicherzustellen, dass dieser bestimmte Kran diese bestimmte Ladung heben und umsetzen kann. Sobald das gewährleistet ist, übernimmt der Computer und hält wie durch Zauberhand alles im Gleichgewicht, indem er die hinteren Betonplatten minutiös vor und zurück verschiebt, sodass die Nadel stets auf null zeigt.
Das Lastmoment …
Minus null Komma fünf eins.
Er schaute unwillkürlich nach hinten zu den Kontergewichten, obwohl er nicht mal wusste, was er zu sehen erwartete.
Folglich gab es auch nichts zu entdecken.
Minus null Komma fünf zwei.
Der Warnton schrillte weiter.
Minus null Komma fünf vier.
Er schaltete den Alarm aus. Die zugehörige Warnleuchte blinkte allerdings immer noch, und die Abweichung des Lastmoments wurde weiterhin angezeigt.
Minus null Komma fünf fünf.
»Das Diagnoseprogramm zeigt keine Sensorprobleme an«, meldete der Bauleiter.
»Vergiss die Sensoren«, sagte Garry. »Der Kran neigt sich.«
Minus null Komma fünf acht.
»Ich gehe auf Handsteuerung.« Er drückte den entsprechenden Knopf. Seit fünfzehn Jahren saß er für Moynahan Construction im Führerhaus eines Turmkrans, und davor hatte er als Pionier in der Armee gedient. Die digitale Unterstützung machte die Arbeit leichter und sicherer, aber ursprünglich hatte Garry alles von Hand erledigt, mit Tabellen und Diagrammen und einem am Oberschenkel befestigten Schreibblock, auf dem er seine Berechnungen vornahm – sowie natürlich einer Neigungsanzeige, deren Nadel ihm als Referenz diente. Nun betätigte er den Joystick und zog die Laufkatze etwas näher an die Mitte heran.
Dann schaltete er auf die Gegengewichte um und rückte sie ein Stück vom Turm weg.
Sein Blick blieb dabei beharrlich auf die Instrumente gerichtet, die immer noch eine Verlagerung nach vorn belegten.
Er schob die Gewichte, die insgesamt einhundert Tonnen wogen, noch weiter nach außen.
Das musste sich auf das Lastmoment auswirken.
Es ging gar nicht anders.
Falsch gedacht.
Zurück zum vorderen Ausleger.
Garry holte die Laufkatze dichter ans Zentrum. Die Flanschträger pendelten hin und her. Das war etwas zu schwungvoll gewesen.
Er schaute zu seinem Kaffee.
Sein bequem gepolsterter Stuhl war nicht mit einem Becherhalter ausgestattet, doch Garry, der Kaffee in allen Variationen liebte, hatte stattdessen einen an der Wand befestigt – natürlich weit weg von jeglicher Elektronik.
Die braune Flüssigkeit stand waagerecht; der Becher nicht.
Ein weiterer Blick auf die Lastmomentanzeige.
Volle zwei Grad Neigung nach vorn.
Er zog die Laufkatze mit den Flanschträgern noch näher heran.
Ah, na endlich.
Das Warnlicht ging aus, und die Neigungsanzeige wanderte allmählich zurück auf minus null Komma fünf, dann auf null, dann auf eins und langsam weiter, weil die Gegengewichte ganz außen hingen. Garry holte sie so weit wie möglich nach vorn.
Die Lastmomentanzeige verharrte bei eins Komma zwei.
Das war normal. Kräne sind so konstruiert, dass sie sich leicht nach hinten lehnen, wenn am vorderen Ausleger keine Last hängt, und zwar um ungefähr ein Grad. Ihre Standfestigkeit basiert hauptsächlich auf dem massiven Betonfundament – so bleiben sie senkrecht, wenn gerade nichts Schweres im Gleichgewicht gehalten werden soll.
»Geschafft, Danny«, meldete er über Funk. »Wir sind stabil. Aber das muss gleich mal überprüft werden. Wahrscheinlich irgendwas mit den Kontergewichten.«
»Alles klar. Ich glaube, Will ist aus der Pause zurück.«
Garry lehnte sich zurück, trank einen Schluck Kaffee, stellte den Becher wieder ab und lauschte dem Wind. Es würde eine Weile dauern, bis der Mechaniker hier eintraf. Um von unten zum Führerhaus zu gelangen, gab es nur eine einzige Möglichkeit.
Man musste den Turm emporklettern.
Aber die Kabine befand sich zweiundzwanzig Stockwerke über dem Boden. Was mindestens eine fünfminütige Ruhepause beim Aufstieg bedeutete, vielleicht sogar zwei.
Manche der anderen Bauarbeiter hielten Kranführer für untrainierte Weicheier, die vermeintlich den ganzen Tag auf ihrem Hintern saßen. Da hatten sie aber nicht an den Aufstieg gedacht.
Weil Garry gerade weder eine Last abliefern noch den Haken vorsichtig wieder nach unten lassen musste, konnte er den unbeschreiblichen Ausblick genießen. Dabei hätte er den größten Teil des Panoramas auch genauer benennen können: die fünf Bezirke der Stadt, ein beachtliches Stück von New Jersey, einen schmalen Streifen von Westchester und einen von Long Island.
Doch Ortsangaben wie diese interessierten ihn nicht.
Ihn faszinierten die Braun-, Grau- und Grüntöne, die weißen Wolken und das endlose Blau – allesamt viel satter und kräftiger als aus der Perspektive eines Fußgängers.
Schon als Junge hatte Garry Wolkenkratzer errichten wollen, hatte sie mit seinen Legosteinen gebaut und seine Eltern angefleht, sie mit ihm zu besichtigen, auch wenn die beiden sich auf den Aussichtsplattformen alles andere als wohlfühlten. Ihm aber gefielen nur die Orte ohne zusätzliche Absperrungen. »Weißt du«, hatte sein Vater mal gesagt, »manche Leute drehen hier oben durch und springen einfach in die Tiefe. Aus lauter Panik.«
Das kaufte Garry ihm nicht ab. Wie konnte jemand Höhenangst haben? Er selbst wurde umso ruhiger, je weiter oben er sich aufhielt. Ob beim Felsklettern, Bergsteigen oder dem Bau von Wolkenkratzern, die Höhe hatte für ihn etwas Tröstliches.
Er befand sich dann im wahrsten Sinne des Wortes »im Himmel«, hatte er Peggy erzählt.
Was ihn wieder an die Babynamen denken ließ.
Kierkegaard, Bashilda …
Wofür würden sie sich wirklich entscheiden? Jedenfalls nicht für einen Junior. Und einen der derzeit angesagten Namen wollten sie auch nicht; es gab im Supermarkt sogar winzige Büchlein mit entsprechenden Listen.
Er griff nach seinem Kaffee.
Nein!
Die Neigung hatte sich schon wieder verändert. Der vordere Ausleger sackte erneut ab.
Minus null Komma vier.
Und im nächsten Moment ging auch prompt der Alarm los, mit Blinklicht, Warnfenster und dem wieder eingeschalteten Signalton.
Die Lastmomentanzeige sprang auf minus eins Komma zwei.
Garry drückte den Sendeknopf am Funkgerät. »Dan. Der Turm spinnt schon wieder. Ziemlich heftig.«
»Scheiße. Was ist denn da los?«
»Ich kann die Ladung nicht noch weiter einholen. Ich muss sie abwerfen. Lass den Bereich räumen und sag mir Bescheid.«
»Ja, geht klar.«
Er konnte es von hier oben zwar nicht hören, aber zwischen seinen Beinen gab das Plexiglas die Sicht senkrecht nach unten frei. Auf Anweisung des Vorarbeiters rannten dort die Kollegen nun in alle Richtungen davon.
»Abwerfen« war natürlich nicht wörtlich gemeint – Garry hatte nicht vor, achtzehn Tonnen Stahl im freien Fall zu Boden donnern zu lassen. Aber er ließ die Ladung so schnell wie möglich nach unten. Sowohl die Höhenanzeige als auch der Blick durch den Kabinenboden verrieten ihm dabei jeweils die exakte Position. Ungefähr zehn Meter über dem Boden bremste er ab und setzte das Bündel dann hart auf den Beton auf. Vielleicht kam es zu ein paar Schäden.
So ein Pech aber auch.
Garry passte die Gegengewichte an, öffnete den Haken und gab die Last damit vollends frei.
Ohne Effekt.
Dazu fiel ihm wieder nur das Wort »unmöglich« ein.
Ein weiteres Mal fuhr er die Kontergewichte aus.
Das musste die Vorwärtsneigung beenden.
Vorn hatte er nun keine Ladung mehr, und hinten waren die Betonplatten am äußersten Ende des Auslegers angelangt.
Und doch …
»Dan«, funkte er, »wir sind bei fünf Grad Vorwärtsneigung, mit den Gegengewichten am hintersten Anschlag.«
Minus sechs Komma eins.
Ein Kran ist nicht für mehr als fünf Grad Neigung gebaut. Ab diesem Punkt verzieht und verbiegt sich das komplizierte Geflecht aus Stahlrohren, Verbindungsstangen und Metallplatten. Das Drehwerk – die große Vorrichtung für die Horizontalbewegungen der Ausleger – ächzte vernehmlich.
Garry hörte ein fernes, aber lautes Knacken. Dann noch eines.
Minus sieben.
»Ich kann nichts mehr tun, Dan«, funkte er. »Schalt die Sirene ein.«
Gleich darauf ertönte das ohrenbetäubende Notsignal. Es war nicht spezifisch für Probleme mit dem Kran gedacht, sondern warnte lediglich vor unmittelbar drohender Gefahr. Nähere Anweisungen würden über Lautsprecher und Funk erfolgen.
»Garry, raus da. Komm sofort runter.«
»Gleich …«
Falls Big Blue umstürzte, sollte der Kran dabei so wenig Schaden wie möglich anrichten.
Garry ließ den Blick in die Runde schweifen. Es standen praktisch überall Häuser.
Doch fünfzehn Meter rechts vom Ausleger gab es eine Lücke zwischen dem Bürogebäude vor ihm und einem Apartmentkomplex. Dahinter konnte Garry eine Straße und einen Park ausmachen. Bei so milden Temperaturen wie heute würden sich zwar Leute dort aufhalten, aber höchstwahrscheinlich die Sirene hören und den sich neigenden Kran bemerken.
Und was war mit Fahrzeugen und ihren geschlossenen Fenstern?
»Ich drehe den Kran von den Gebäuden weg. Lasst diesen Park an der Neunundachtzigsten räumen. Und haltet den Straßenverkehr an.«
»Garry, hau ab, solange du noch kannst!«
»Den Park! Räumt den Park!«
Knarren, Ächzen, der Wind …
Und jäh das nächste laute Knacken.
Garry wollte den Kran rotieren lassen. Das Drehwerk jaulte auf, weil die Lager nicht mehr frei laufen konnten. Der Elektromotor mühte sich ab. Dann setzte der Ausleger sich doch noch langsam in Bewegung.
»Komm schon, komm schon …«
Noch neun Meter bis zu der Lücke.
Gleich war es so weit. Er konnte es fühlen. Gleich würde der Kran kippen.
Es fuhren weiterhin jede Menge Autos vorbei.
Seine Entscheidung war logisch, traf ihn aber trotzdem mitten ins Herz.
Seinetwegen würden Menschen sterben. Vielleicht weniger als ohne die Rotation des Auslegers, aber dennoch …
Hektisch schossen ihm die Zahlen durch den Kopf.
Abstand zur Lücke: sechs Meter.
Neigung: minus acht Komma zwei.
»Komm schon«, flüsterte er.
»Garry …«
»Räumt diesen Scheißpark! Und die Straße!« Er riss sich das Headset herunter, als würden die Funksprüche irgendwie zusätzlich den Mechanismus verlangsamen.
Noch dreieinhalb Meter bis zu der Lücke. Bei neun Grad Neigung.
Der Joystick war rechts am Anschlag, und der Ausleger hätte zügig rotieren müssen. Aber das klemmende Drehwerk kam nur im Schneckentempo voran.
Immerhin.
Ein plötzliches Kreischen. Wie Fingernägel auf einer Schultafel …
Garry verzog unwillkürlich das Gesicht.
Noch drei Meter bei zehn Grad Neigung.
Zweieinhalb Meter bis zu der Lücke.
Bitte … nur noch ein kleines Stück …
Fast geschafft. Doch falls Big Blue jetzt blockierte, würde der Ausleger vier oder fünf Etagen des weitläufig gestalteten Bürogebäudes aufschlitzen, in dem Hunderte von Menschen gerade an ihren Schreibtischen saßen, eine Kaffeepause machten oder an Besprechungen teilnahmen. Er konnte sie sehen. Einige waren aufgestanden und starrten den sich neigenden Turm an. Niemand rannte weg. Sie filmten das Ganze mit ihren Smartphones. Um Gottes willen …
Zwei Meter.
Die Bewegung des Krans hielt kurz inne und ging dann weiter, unter umso lauterem Kreischen und Knirschen.
Garry bewegte den Joystick leicht nach links, woraufhin der Ausleger mühelos einen halben Meter zurückschwenkte. Dann drückte er die Steuerung hart nach rechts. Das Drehwerk gehorchte und überwand die Engstelle mit einem Ruck.
Anderthalb Meter bis zur Lücke, zwölf Grad Neigung …
Peng …
Das laute Geräusch hinter ihm ließ ihn zusammenzucken.
Was war das?
Ach, na klar.
Die Zugangsklappe im Boden, die zu der Leiter nach unten und damit in Sicherheit führte, hatte sich verbogen. Garry stand kurz auf und zog an dem Griff. Vergebens.
Es gab noch einen anderen Ausstieg, und zwar über ihm. Aber von dort aus gelangte man nicht in den Turm.
Egal. Noch etwas mehr als einen Meter, und es ist geschafft.
Der Ausleger neigte sich immer noch weiter, aber die Lastmomentanzeige war bei minus dreizehn stehen geblieben. Die Konstrukteure hatten natürlich gewusst, dass es müßig wäre, die Messung fortzuführen. Kein Ausleger würde sich jemals so weit nach vorn neigen.
Kurz vor der lebensrettenden Lücke kippte der Turm jäh ein ganzes Stück nach vorn. Garry rutschte aus dem Sitz und landete bäuchlings in der Plexiglaskanzel. Sein Blick fiel zweiundzwanzig Stockwerke senkrecht nach unten auf die Baustelle. Er atmete einmal tief durch. Das Glas vor ihm beschlug, seltsamerweise nahezu in Herzform.
Er dachte an seine Frau.
Und an ihr Kind, das bald geboren werden würde.
Kierkegaard oder Bashilda …
2
Ein ungeklärter Kriminalfall überschreitet irgendwann eine unsichtbare Grenze und wird vorläufig zu den Akten gelegt. Wann genau? Manche Cops würden sagen, nach einem Jahr, andere vielleicht, nach einem Jahrzehnt. Lincoln Rhyme mochte die Bezeichnung Cold Case nicht. Sie legte nämlich die Vermutung nahe, dass nun Podcaster und die Produzenten von Fernsehdokus sich des Verbrechens annehmen würden, um daraus die allseits beliebte Geschichte vom Übeltäter zu stricken, der sich seiner gerechten Strafe entzog. Am beliebtesten dabei waren selbstverständlich Mordfälle. Der spurlos verschwundene Ehepartner, der Mafiaspitzel, der prügelnde Vater, der »keinen Schimmer« hat, wo sein kleiner Sohn abgeblieben sein könnte. Ungelöste Diebstähle interessierten weit weniger, es sei denn, sie waren besonders spektakulär: der Diamantenraub, der Überfall auf den Geldtransporter, der Fallschirmsprung aus einer Boeing 727 mit zweihunderttausend Dollar Lösegeld (was ist denn letztlich aus dir geworden, D. B. Cooper?).
Für Rhyme war ein offener Fall nichts weiter als ein offener Fall, ob nun seit vierundzwanzig Stunden oder seit hundert Jahren. Und die Ermittlungen mussten natürlich abgeschlossen werden, auch bei Diebstählen. Ein solcher nahm gegenwärtig einen großen Teil von Rhymes Zeit in Anspruch.
Die Tat lag nun einige Monate zurück, und der ausbleibende Ermittlungserfolg gab Rhyme – sowie dem NYPD und der Homeland Security – allmählich wirklich Grund zur Sorge.
Eine Person, die sie »Täter 212« getauft hatten, war am 12. Februar (daher der Spitzname) in das New Yorker Bauamt eingebrochen und hatte eine Vielzahl von digitalen Dokumenten zur Infrastruktur heruntergeladen: Grundrisse, technische Zeichnungen, Tiefbaukarten, Bebauungspläne, Bauanträge – allesamt winzige Teile der Maschinerie, die einem so gigantischen Organismus wie New York City bei Wachstum und Anpassung half. Um womöglich auf Nummer sicher zu gehen, hatte der Täter außerdem Hunderte von Ausdrucken sowohl derselben als auch zusätzlicher Unterlagen mitgenommen. Vielleicht befürchtete er, manche der Dateien könnten verschlüsselt sein.
Zum Zeitpunkt des Diebstahls hatten alle sofort an Terrorismus gedacht, weil es das nächstliegende Motiv einer solchen Tat war. Jemand wollte Bomben legen, U-Bahnen kapern, Gebäude mit Raketen oder Flugzeugen angreifen.
Rhyme, der erfahrene Kriminalist, und Amelia Sachs, seine Ehefrau und zugleich auch beruflich seine Partnerin, waren hinzugezogen worden, um bei der Identifizierung des Täters zu helfen. Doch obwohl der Mann versehentlich einen Alarm ausgelöst hatte, seine Einbruchswerkzeuge zurücklassen musste und geflohen war, ergaben sich keine konkreten Anhaltspunkte. Die Stadt blieb eine Weile in höchster Alarmbereitschaft, aber es folgten keinerlei Terroranschläge.
Aus diesem Grund war der Diebstahl von Täter 212 auch weiterhin ein offener Fall, und der Spitzname des Unbekannten stand als Überschrift auf einer der weißen Rolltafeln in der Ecke von Rhymes Labor. Dieses war in dem einstigen Salon des Stadthauses aus dem neunzehnten Jahrhundert untergebracht, und Rhyme und Sachs arbeiteten von hier aus an ihren Aufträgen – sie als Detective des NYPD, er als beratender forensischer Wissenschaftler. Bei der Polizei hießen derartige Tafeln umgangssprachlich »Mordbretter«, wenngleich es diesmal um ein Eigentumsdelikt ging; bei der Tat war niemand verletzt oder gar getötet worden. Rhyme und Sachs hatten zwischenzeitlich andere Prioritäten gehabt – zwei dringende Fälle von organisierter Kriminalität –, doch diese waren nun abgeschlossen. Zu einem späteren Zeitpunkt würden sie als Sachverständige im Prozess dazu aussagen – selbstverständlich pro Fall jeweils einzeln, niemals als Duo. Die Verteidigung würde ansonsten genüsslich den Beziehungsstatus des Ehepaars bis ins letzte Detail vor Gericht ausbreiten. Zwar gab es von rechtlicher Seite keinen Grund, der eine gemeinsame Aussage verhindert hätte, doch in Strafprozessen sind vor allem vier Dinge wichtig: der Anschein, der Anschein, der Anschein … und dann erst das Gesetz.
Nun also widmeten sie sich wieder dem offenen Fall – nicht dem »Cold Case« – von Täter 212.
Rhyme fuhr mit seinem motorisierten Rollstuhl zu der Tafel. Ein Unfall an einem Tatort hatte ihm, dem ehemaligen Leiter der New Yorker Spurensicherung, vor vielen Jahren eine Querschnittslähmung beschert. Seitdem hielt er konstant Ausschau nach medizinischen Fortschritten, die seinen Zustand verbessern könnten. Bislang gab es keine Möglichkeit, dass er unterhalb des Halses je wieder etwas spüren würde, doch dank komplizierter Eingriffe, prothetischer Unterstützung und regelmäßigen Trainings besaß er inzwischen die nahezu vollständige Kontrolle über seinen rechten Arm und die Hand. Seinen Rollstuhl, Garant für ein »Maximum an Mobilität«, so die Firmenwerbung, steuerte Rhyme geschickt mit dem linken Ringfinger, dem einzigen Körperglied, das durch den katastrophalen Schicksalsschlag nichts an Beweglichkeit eingebüßt hatte.
Der menschliche Körper mochte ein echtes Wunderwerk sein, doch etwas Glück konnte bisweilen nicht schaden.
Sachs las gerade einen Bericht des Detectives, der bei der Abteilung für Kapitalverbrechen die 212-Ermittlungen leitete. »Unter den städtischen Angestellten findet sich kein Verdachtsfall«, sagte sie und erklärte, der Kollege habe die Bauamtsmitarbeiter vernommen. Wenn digitale Daten entwendet werden, ohne dass es einen Hackerangriff gibt, ist häufig ein Insider dafür verantwortlich. Die Aufzeichnung einer Überwachungskamera belegte, dass der Täter die Tür zum Serverraum aufgebrochen und die Dateien auf eine Festplatte heruntergeladen hatte. Keine schlechte Idee: Heutzutage traf man zwar zumeist Vorkehrungen gegen brillante und gelangweilte osteuropäische und chinesische Computerkriminelle, aber die Geräte vor Ort wurden nur nachlässig geschützt.
Auf einem anderen Video sah man den Täter aus dem Gebäude kommen. Diese Bilder stammten aus dem Domain Awareness System des New York Police Department.
Oder, wie manche Bürgerrechtler es nannten, Big Brother.
Gemeint war ein Netzwerk aus stadtweit zwanzigtausend Überwachungskameras. Das System sammelte und speicherte zudem Bilder und Daten aus einer Vielzahl von Quellen: erfassten Nummernschildern, gerichtlichen Vorladungen, Aufzeichnungen von Notrufen, Beschwerden, Polizeiberichten, Haftbefehlen und Festnahmevermerken. Insgesamt handelte es sich um Milliarden von Datensätzen.
Eine der DAS-Kameras hatte Täter 212 beim Verlassen des Bauamts gefilmt, bis er um die nächste Ecke bog und verschwand. Trotz der laut heulenden Alarmsirene bewegte er sich mit normaler Geschwindigkeit, um keine Aufmerksamkeit zu erregen.
Und wie hilfreich war dieses Video? Das stand auf einem anderen Blatt. Man sah dunkle Kleidung, einen Hut, und natürlich hielt der Mann den Kopf gesenkt.
Rhymes Einschätzung: Weitgehend nutzlos; es verriet ihnen lediglich den Körperbau des Unbekannten. Doch da der Kerl von mittlerer Statur war, half ihnen das in Wahrheit kein Stück weiter.
Er schaute in den westlichen Teil des Salons, der durch eine raumhohe Glaswand hermetisch abgetrennt war. Dort lag das eigentliche Labor. Jenseits der Instrumente und Arbeitsplätze – die einer kleinen bis mittelgroßen Polizeibehörde zur Ehre gereicht hätten – standen braune Regale mit registrierten Beweismitteln. Rhyme musterte den kleinen Werkzeugkoffer aus rotem Kunststoff, den Täter 212 zurückgelassen hatte, als er nach dem Diebstahl die Flucht ergreifen musste.
Als der leitende Detective den Koffer brachte, hatten sie ihn sofort und überaus gründlich untersucht. Doch zu Rhymes Verärgerung hatten sie weder Fingerabdrücke noch DNS oder andere Partikelspuren gefunden. Das war eine echte Überraschung. Überstürzt zurückgelassene Gegenstände waren nämlich normalerweise die ergiebigsten von allen, denn es blieb dem Täter ja keine Zeit, um zum Beispiel Abdrücke abzuwischen.
Sachs, die eine straff sitzende schwarze Jeans trug, stemmte nun die Hände in die Hüften, neigte den Kopf und ließ das lange dunkelrote Haar senkrecht nach unten hängen. »Was hat er da gewollt?«, stellte sie die Kardinalfrage.
Für die Anklageerhebung ist das Motiv irrelevant, und auch Rhyme legte während der Ermittlungen keinen gesteigerten Wert darauf, weil Beweismittel nun mal der deutlichste Hinweispfeil waren, der auf einen Täter zeigte. Dennoch musste auch er als Skeptiker einräumen, dass in Ermangelung solider forensischer Spuren ein Motiv eventuell an einen bestimmten Ort oder gar zum Täter selbst führen konnte. In seinen Seminaren wählte er dafür folgendes Bild: Das Motiv führt dich in die richtige Gegend und die forensische Analyse dann an die richtige Tür, hinter der du das blutige Messer oder die kürzlich abgefeuerte, wenn nicht sogar noch rauchende Pistole findest.
Ein wenig umständlich, aber er mochte es irgendwie.
Im 212-Fall konnten sich jedoch weder die beteiligten Ermittler noch die Angehörigen der Stadtverwaltung erklären, weshalb der Täter das Verbrechen begangen hatte. Ja, er hatte sich eine Vielzahl von Unterlagen zur Infrastruktur, zu Verkehrstunneln, Brücken und den unterirdischen Verbindungsgängen besorgt, die unter den fünf Stadtbezirken ein regelrechtes Netzwerk bildeten. Doch inwiefern half das bei den Vorbereitungen auf einen Anschlag? Sogar die dümmsten Terroristen konnten in dieser an möglichen Zielen so reichen Stadt einen geeigneten Ort finden, ohne auf Tunnelkarten oder technische Zeichnungen zurückgreifen zu müssen.
Aus dem entwendeten Material ging auch hervor, welche Passagen unter Banken, Juwelierläden oder Pelzlagern verliefen. Aber dass jemand sich per selbst gegrabenem Schacht Zugang zu einem Tresorraum verschaffte, um ihn auszurauben, kam höchstens in alten Fernsehkrimis vor, hatte Amelia Sachs angemerkt. Und der Diebstahl von Bargeld war zwecklos. Die Seriennummern aller im Umlauf befindlichen Zwanzig-, Fünfzig- und Hundertdollarscheine passten auf einen einzelnen Fünfzig-Gigabyte-USB-Stick, und Scanner, die nach registrierten Banknoten Ausschau hielten, waren überall in Gebrauch.
Die gute alte Zeit existierte einfach nicht mehr.
»Hm«, machte Rhyme. Es klang halb wie ein Ächzen. Als er dann sprach, war das mehr oder weniger an ihn selbst gerichtet. »Wir haben keinen ersichtlichen Anlass für den Einbruch. Aber die Daten wurden gestohlen. Und es war riskant.« Er fuhr näher an die Tafel heran. »Es. Gibt. Einen. Grund. Aber welchen?«
Frustriert schaute er zu der Flasche Glenmorangie, die hoch oben auf einem Regal stand. Rhyme konnte seinen rechten Arm und die Hand weitgehend benutzen, ja, und er hätte die Flasche Scotch mühelos halten und öffnen können, um sich ein Glas einzuschenken.
Leider konnte er nicht aufstehen, um sie sich von da oben zu holen, wo seine Glucke sie hingestellt hatte. Und wie aufs Stichwort betrat die Person – sein Betreuer, Thom Reston – in genau diesem Moment den Salon und bemerkte Rhymes Blick. »Es ist noch früh am Tag«, sagte er.
»Ich weiß, wie spät es ist, vielen Dank.«
Rhyme wandte die Augen nicht von dem farbenfrohen Etikett ab.
»Nein«, betonte Thom.
Der Mann war so tadellos gekleidet wie immer. Sandfarbene Stoffhose, hellblaues Hemd, Krawatte mit Blumenmuster. Er war schlank, aber kräftig. Seine Muskeln verdankte er allerdings weder schweren Hanteln noch ausgefeilten Trainingsmaschinen, sondern im Wesentlichen der Arbeit mit Rhyme. Es war Thom, der ihn in oder aus Rollstuhl, Bett oder Badewanne hob.
Ein weiteres Ächzen, ein finsterer Blick auf den Whisky.
Es war noch früh, kein Zweifel, aber das Konzept der »Cocktailstunde« hatte Lincoln Rhyme noch nie so ganz überzeugt.
Er schaute zurück zu der Tafel des 212-Falls. Noch bevor er sich wieder in ergebnislosen Grübeleien verlieren konnte, klingelte es an der Tür.
Rhyme blickte auf. Es war Lon Sellitto, sein ehemaliger Partner aus der Zeit vor dem Unfall. Heute arbeitete er in leitender Funktion für die Abteilung für Kapitalverbrechen, in der auch Amelia Sachs tätig war, und wurde so häufig wie kein anderer Detective als Verbindungsbeamter eingesetzt, wenn das NYPD Rhyme als Berater hinzuzog.
»Er scheint ja richtig unter Strom zu stehen«, stellte Rhyme fest und betätigte den Türöffner.
Der stämmige Mann mit der schütteren Frisur trat ein, zog den braunen Regenmantel aus und hängte ihn auf. Nicht dass es Rhyme gekümmert hätte, aber Sellitto schien stets die hässlichsten aller Kleidungsstücke von der Stange zu kaufen. Und es gab andere Farben außer schlammigem Kamelbraun, oder? Außerdem waren Sellittos Sachen oft auch noch zerknittert, so wie heute, wozu die rundliche Statur des Mannes beitrug, vermutete Rhyme. Die meisten Hersteller dürften jedenfalls Wert auf Stoffe legen, die im Grundzustand glatt waren.
Doch was wusste Rhyme schon? Thom und Sachs kauften für ihn ein – zum Beispiel die taubengraue Hose, die er gerade trug, das schwarze Polohemd und die waldgrüne Strickjacke. Jemand hatte mal angemerkt, Rhymes Kleidung sehe bequem aus, woraufhin Thoms eindringlicher Blick Rhyme dazu veranlasst hatte, sich die beabsichtigte Erwiderung – »Keine Ahnung, woher soll ich das wissen?« – zu verkneifen und stattdessen ein falsches Lächeln aufzusetzen.
Sellitto nickte allen im Raum kurz zu. Dann runzelte er die Stirn und wies auf einen übergroßen Sony-Fernseher, der in einer der Ecken hing. »Wieso laufen denn nicht die Nachrichten?«
»Lon.«
»Ist das da die Fernbedienung? Nein. Wo ist die Fernbedienung?«
Thom nahm sie aus einem Regal und schaltete das Gerät ein.
»Warum erzählst du es uns nicht einfach, anstatt auf den Sprechroboter im Fernsehstudio zu warten?«, fragte Rhyme.
»Es gab einen Zwischenfall«, sagte Sellitto, ohne das näher zu erläutern. Er nahm die Fernbedienung und schaltete auf einen der landesweiten Sender um. Eine Eilmeldung! lief am unteren Rand durchs Bild, aber Rhyme war zu weit weg, um sie lesen zu können. Man sah Aufnahmen vom Unfall auf einer Baustelle. Eine weitere Nachricht wurde eingeblendet: 89. Straße Ost, New York City. Gefolgt von: Ein Toter, sechs Verletzte beim Einsturz eines Krans.
Sellitto schaute von Sachs zu Rhyme. »Das war kein Unfall, sondern Absicht. Jemand hat der Stadt eine Liste mit Forderungen geschickt. Und falls diesen Forderungen nicht nachgekommen wird, gibt es in vierundzwanzig Stunden das nächste Unglück.«
3
Der Bürgermeister hatte eine E-Mail mit dem Link zu einem privaten Chatroom des anonymen Forums 13Chan erhalten.
Sellitto öffnete eine Datei auf dem Computerbildschirm in der Mitte der Salonwand. Rhyme las den Text laut vor:
Fast 50 Millionen Amerikaner zahlen Mieten, die sie sich nicht leisten können. 600 000 haben sogar gar keine Wohnung, und zu einem Drittel sind das Familien mit Kindern. Trotzdem unterstützt New York die privaten Bauunternehmer auch weiterhin dabei, Luxus-Hochhäuser zu errichten, wie schon seit dem frühen zwanzigsten Jahrhundert.
Die Stadt ist der größte Grundbesitzer der Region. Ihr gehören knapp dreieinhalbtausend Hektar Bauland, und es sit regelrecht obzön, wie wenig davon für erschwinglichen Wohnraum verwant wird. Gewaltige Flächen bleiben gänzlich ungenutzt und werden nicht zur Erschließung freigegeben. Wir wissen dies, weil wir die Liegenschaftsinformationen einsehen konnten.
Wir fordern Folgendes: Die Stadt wird ein gemeinnütziges Unternehmen gründen; an dieses Unternehmen wird die Stadt die unten aufgelisteten Liegenschaften übertragen und in bezahlbaren Wohnraum umwandeln.
Wir werden die Fortschritte anhand der behördlichen Beurkundung überwachen.
Solange dieses Unternehmen nicht gegründet ist und die Liegenschaften nicht übertragen werden, wird New York City alle vierundzwanzig Stunden einen verheerenden Unglücksfall erleiden.
Die Zeit läuft.
Das Kommunalka-Projekt
Auf der nächsten Seite folgte eine Liste von Grundstücken in allen fünf Bezirken. Manche der Parzellen schienen unbebaut zu sein, aber auf den meisten standen – mutmaßlich inzwischen ungenutzte – Gebäude: Schulen, ein Hochhaus mit Sozialwohnungen, ein ehemaliger Steg samt Hubschrauberlandeplatz in Brooklyn, der dem Verteidigungsministerium abgekauft worden war, ein früheres Forschungslabor der Gesundheitsbehörde, das man an die City University von New York übertragen hatte, mehrere Lagerhäuser, die an den Bundesstaat vermietet worden waren, um dort Unterlagen zur Volkszählung aufzubewahren, sowie ein einstiges Waffenlager der Nationalgarde.
»Was hat der Name der Gruppe zu bedeuten?«, fragte Sachs.
Das ließ sich schnell klären.
Eine kurze Suche ergab, dass »Kommunalka« eine aus der Not geborene Wohnform bezeichnete, wie sie in der Sowjetunion üblich gewesen war. Das Prinzip ähnelte heutigen Wohngemeinschaften; mehrere Parteien nutzten die Küche und die sanitären Einrichtungen einer Wohnung gemeinsam, hatten aber jeweils eigene Zimmer.
Sachs überflog die Artikel. »Ich frage mich, ob die Täter ihre Hausaufgaben gemacht haben. Die meisten der sowjetischen Häuser wurden längst abgerissen und durch – dreimal dürft ihr raten – teure Apartments ersetzt.«
Rhyme war fasziniert. Aus forensischer Sicht war ein Fall von Sabotage nicht interessanter als seine aktuellen Ermittlungen rund um den Diebstahl der technischen Dokumente. Die gesetzte Frist und das damit verbundene Risiko weiterer Todesfälle ließen Täter 212 aber nun ein Stück in den Hintergrund treten.
»Wie hat er das angestellt?«, fragte Rhyme. »Mit einem Sprengsatz?«
»Niemand hat eine Explosion gehört«, antwortete Sellitto. »Offenbar wurden die Gegengewichte des Krans irgendwie manipuliert. Der Bauleiter kann es sich nicht erklären. Jedenfalls geriet der Turm dadurch aus der Balance und ist umgestürzt. Ach, und du dürftest gleich einen …«
Rhymes Telefon klingelte. Er erteilte den Sprachbefehl zum Abheben.
»Ja?«, fragte er dann.
»Captain Rhyme?«, meldete sich eine gestresst klingende Frau.
»Ganz recht.«
»Ich verbinde mit Bürgermeister Harrison.«
Gleich darauf erklang die weiche Stimme des Mannes. »Captain Rhyme.«
»Bürgermeister.«
Da Rhyme sich nicht um übliche Gepflogenheiten scherte, ergriff Sachs die Initiative: »Sie sind auf den Lautsprecher gelegt. Anwesend sind außerdem die Detectives Sachs und Sellitto.«
»Lon, Sie sind schon da.«
»Ich war gerade dabei, Lincoln und Amelia ins Bild zu setzen.«
»Ich möchte Ihnen mitteilen, dass wir der Forderung nicht nachkommen werden. Sie kennen unsere Prinzipien.«
Die Stadt zahlte weder Lösegeld noch ließ sie sich erpressen.
»Wir könnten deren Wünsche sowieso nicht erfüllen. Wer auch immer dahintersteckt, hat keine Ahnung von den Modalitäten. Wir müssten zahllose Dokumente erstellen. Ein gemeinnütziges Unternehmen erfordert einen dreiköpfigen Vorstand, einen Leiter, seinen Vize, ein Sekretariat, einen Schatzmeister, einen offiziellen Zustellungsbevollmächtigten und, meine Güte, eine Million Genehmigungen. Die Finanzbehörde hat ein Wörtchen mitzureden und der Umweltschutz genauso. Ach ja, und es braucht ein Budget. Das irgendwie finanziert werden muss. Bevor nicht all das erledigt ist, kann kein einziges Grundstück übertragen werden. Und es würde Wochen oder Monate dauern …«
»Lässt die Frist sich nicht verlängern?«, fragte Sachs.
»Es gibt ja diesen Chatroom bei 13Chan. Die Öffentlichkeit hat keinen Zutritt, aber wir können dort posten. Ich habe geschrieben, dass wir mehr Zeit benötigen.«
»Kam eine Antwort?«
»Zwei Worte. ›Siehe oben.‹ Warten Sie, ich zeige es Ihnen.« Er nannte ihr eine komplizierte Internetadresse, und Sachs tippte den Link in einen der Computer. Die Seite öffnete sich, gefolgt von dem Fenster einer privaten Nachricht mit einer Strichzeichnung:
COUNTDOWN: 24 STUNDEN
»Das war alles«, sagte der Bürgermeister.
»Ist dies das erste Mal, dass jemand die Stadt zwingen will, günstigen Wohnraum zu schaffen?«, fragte Sachs.
»Wir erleben immer mal wieder Protestaktionen, aber nur friedliche. Die Leute ketten sich an Baustellenzäune oder werfen mit Eiern. Gewalt hat es dabei noch nie gegeben.«
Rhymes Blick war auf die Bilder der Unglücksstelle gerichtet. Aus der Entfernung sah der Kran zerbrechlich aus. Aber die Nahaufnahmen zeigten dicke Stahlstangen und massive Verbindungsplatten.
Doch war das Kommunalka-Projekt überhaupt dafür verantwortlich?
»Was ist mit dem Timing?«, fragte er.
Eine Pause. »Wie meinen Sie das, Captain?«
»Ist die Forderung vor oder nach dem Einsturz des Krans eingetroffen?«
»Ach, Sie glauben, es könnte ein Unfall gewesen sein, und diese Gruppe nutzt die Gunst der Stunde. Nein, die Nachricht kam zehn Minuten vor dem Einsturz.«
Damit war die Frage beantwortet.
»Bei uns laufen gerade die Nachrichten«, sagte Sachs. »Der Erpresserbrief wird nicht erwähnt.«
»Nein, wir halten das geheim, um keine Panik auszulösen. Ich habe angeordnet, dass alle Hochhausbaustellen vorläufig geschlossen werden, und wir schicken Beamte zu jedem Turmkran.«
»Wird das nicht Verdacht erregen?«, fragte Sachs.
»Ach was, ich schiebe es auf irgendeine Bundesmaßnahme oder so«, winkte Harrison ab. »Einen Moment, bitte.«
Man hörte im Hintergrund mehrere dringliche Stimmen.
»Ich muss auflegen, Captain, Detectives. Bitte tun Sie, was Sie können. Die Ressourcen der Stadt stehen zu Ihrer Verfügung. Und stimmen Sie sich mit dem FBI und der Homeland Security ab.«
Er trennte die Verbindung.
Ein weiterer Blick auf die Unglücksstelle. Der Kran war leuchtend blau lackiert. Aus Gründen der Sicherheit? War das die typische Farbe der Herstellerfirma? Oder ging es bloß um gutes Aussehen?
Sellitto schenkte sich einen Kaffee aus der Kanne ein, die Thom gebracht hatte. Er ging zu dem Computerbildschirm an der Wand und las mit verkniffener Miene die Erpressernachricht.
»Die Sorgfältigsten sind sie offenbar nicht«, stellte er fest. »Vielleicht können wir das nutzen.«
»Was meinst du?«, fragte Rhyme.
»Die Rechtschreibfehler – ›obzön‹. Und der Buchstabendreher bei ›ist‹.«
Rhyme schnalzte mit der Zunge. »Das war Absicht, damit wir genau das denken. Die sind nicht dumm.«
»Ja?«
»Wortwahl, Grammatik und Zeichensetzung sind ansonsten korrekt. Und zwar bis ins Detail.«
»Bist du bei den Texten deiner Studenten eigentlich auch so anspruchsvoll, Linc?«
Rhyme runzelte die Stirn. »Selbstverständlich. Wer nicht richtig schreiben kann, bekommt eine Sechs.« Er nickte in Richtung des Monitors. »Der Chatroom ist anonym. Aber wer hat die ursprüngliche E-Mail geschickt? Und woher?«
»Die kam von einer öffentlichen IP-Adresse«, sagte Lon. »Aus einem Café in Brooklyn, ohne Überwachungskameras. Unsere Computerleute glauben, dass der Täter nicht mal vor Ort gewesen ist, sondern sich von draußen in den Router eingeklinkt hat.«
»Wir halten also fest: Die kennen sich mit Computern aus. Oder arbeiten mit einem entsprechenden Fachmann zusammen.« Er überlegte. »Ich finde, der Bürgermeister sollte die Öffentlichkeit informieren, und zwar rechtzeitig vor morgen früh, damit die Leute einen Bogen um alle Baustellen machen können.«
»Aber Harrison hat recht, das gäbe eine Panik«, wandte Sellitto ein. »Und wahrscheinlich befürchtet er auch Nachahmer.«
Rhyme musterte weiterhin die Bilder des verdrehten Stahlgerippes und der Verheerungen, die der Einsturz angerichtet hatte. Der Kran war nach vorn gekippt, nicht zur Seite. Sein langer Turm und der Ausleger hatten auf ihrem Betonsockel in der Mitte der Baustelle zwischen zwei hohen Gebäuden aufgeragt. Beide waren knapp verfehlt worden; stattdessen hatte es einen Park auf der anderen Seite der nächstgelegenen Querstraße getroffen. Nur wenige Meter weiter rechts oder links und es hätte die Glasfassaden der Hochhäuser erwischt, mit weitaus mehr Todesopfern.
»Wie viele Kräne gibt es derzeit in der Stadt?«
Sachs nahm ihr Smartphone und rief die Information ab. Sie kniff die Augen zusammen und las vor. »Insgesamt sechsundzwanzig in allen fünf Bezirken. Damit steht New York weit unten auf der Liste. In Toronto sind es aktuell mehr als hundert und in Los Angeles ungefähr fünfzig.«
Das war alles? Sechsundzwanzig? Rhyme hätte mit mehr gerechnet. Er war zwar nicht oft unterwegs, aber wenn er doch mal das Haus verließ, schienen die imposanten Türme mit ihren fragil wirkenden Auslegern praktisch überall emporzuwachsen.
»Ich ziehe Mel hinzu«, sagte Rhyme. »Was macht Pulaski gerade?«
»Das Morddezernat hat ihn angefordert«, antwortete Sachs. »Er untersucht einen Tatort in Midtown.«
»Wenn er damit fertig ist, soll er herkommen«, sagte Rhyme.
»Ich regle das«, erklärte Sellitto.
»Und lasst uns eine Tabelle anlegen.«
Sachs schob die Aufzeichnungen des 212-Falls ein Stück beiseite, beließ sie aber in der vorderen Reihe. Der leitende Detective war auf dem Weg hierher, um Rhyme auf den neuesten Stand zu bringen.
An die freie Stelle zog Sachs eine frische Tafel und zückte einen Stift. »Benennen wir ihn nach der Straße? Täter?«
»Passt perfekt«, stimmte Rhyme zu.
Sachs schrieb es in ihrer eleganten Handschrift an den oberen Rand der Tafel.
»Hat es was mit Russen zu tun? Mit einer Terrorzelle?«, fragte Sellitto. »Wegen dieses Namens. Kommunawasauchimmer?«
Rhyme schüttelte den Kopf und musste an eine Geschichtsvorlesung denken, die er sich vor vielen Jahren mal angetan hatte. Dort hatte es geheißen, dass die linksgerichteten Bewegungen im Amerika der 60er- und 70er-Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts sich oftmals sowjetischer Begriffe bedienten: Agitprop, Kompromat, Intelligenzija.
»Eher nicht. Die Russen mögen zwar weiterhin daran interessiert sein, unsere Demokratie zu unterwandern, aber sie würden New York wohl kaum zwingen wollen, Wohnraum für das Proletariat zu schaffen. Das ist übrigens ein Begriff aus dem alten Rom. Marx hat ihn nur geklaut. Aber der Bürgermeister hat recht. Wir müssen uns mit den Bundesbehörden abstimmen. Vielleicht kann Lyle das ja übernehmen.«
Lyle Spencer zählte noch nicht lange zu den Detectives des NYPD und hatte zuvor als Sicherheitschef eines Medienkonzerns gearbeitet. Er wurde selten laut, brachte Verdächtige aber trotzdem meistens zum Reden, denn er besaß die imposante Statur eines Bodybuilders und einen bohrenden Blick. Rhyme hatte ihn nur ein einziges Mal lächeln gesehen, glaubte er jedenfalls. Sicher war er sich nicht.
Sachs hinterließ dem Detective eine Nachricht, umriss kurz die Situation und trug ihm auf, was zu tun war.
Sellitto öffnete seine Aktentasche und zog einen dicken Stapel Dokumente heraus. »Das haben wir von dem Bauleiter an der Neunundachtzigsten bekommen: Baupläne, Grundrisse, Speicherkarten aus einigen Überwachungskameras und noch ein paar Dinge, die uns weiterhelfen könnten.«
Sachs zog einen Tisch in die Mitte des nicht sterilen Teils des Salons, und Sellitto breitete das Material darauf aus. Amelia fischte einen Lageplan der Baustelle aus dem Papiermeer und klebte ihn an eine Tafel. Die Draufsicht umfasste den Kran sowie den Neubau, der dort gerade errichtet wurde. Die umliegenden Gebäude waren nur grob skizziert.
Sachs schaute zum Fernseher und zeichnete einen Pfeil auf die Tafel. »In diese Richtung ist er umgestürzt. Zwischen diesen Häusern … So, dann mache ich mich am besten mal auf den Weg zum Ort des Geschehens. Wer weiß, vielleicht finden wir ja eine Quittung des chinesischen Restaurants in Queens, in dem die russischen Möchtegernrevoluzzer sich jeden Mittwoch treffen.«
Sellitto lachte sarkastisch auf. »Von wegen.«
»Oh, so was passiert tatsächlich.« Rhyme sah stirnrunzelnd Sachs an. »Wie hieß er doch gleich? Dieser Serienmörder. Auf Staten Island. Dudley …?«
»Smits. Dudley Smits.« Ihr Blick richtete sich auf Sellitto. »Ihm ist beim Verlassen eines Tatorts die Visitenkarte einer Frau aus der Tasche gefallen. Mit seinen Fingerabdrücken darauf. Wir haben uns in ihrer Wohnung auf die Lauer gelegt und einfach abgewartet. Zehn Stunden später ist er mit einem Messer und einer Rolle Klebeband dort aufgetaucht. Sein Gesichtsausdruck war unbezahlbar. Das Warten hat sich wirklich gelohnt.«
4
Kein Ort in New York City zieht Vogelbeobachter stärker an als der Central Park. Im Umland der Stadt gibt es zwar ausgedehnte Waldschutzgebiete, aber das leuchtend grüne Rechteck in Manhattan kann mit einer größeren Populationsdichte pro Hektar aufwarten.
Der Mann mit dem Nikon-Fernglas verharrte reglos und betrachtete eine Schwarzkopfmeise. Dies war nicht sein erster Besuch, und er wusste, dass sich angesichts der üppigen Vogelpopulation auch die umfangreichsten Suchlisten nach und nach abhaken ließen.
Seine Kleidung war leger – schwarze Spätfrühlingshose und dunkelblauer Anorak – und seine Statur schlank und sportlich. Das schüttere Haar war zur Hälfte ergraut, aber gepflegt und ordentlich gekämmt.
Nach einem Moment flog der Vogel davon, und der Mann schrieb etwas in ein kleines Notizbuch. Dann ließ er den Blick langsam von Süden nach Norden schweifen.
»Und, Glück gehabt?«
Die Frau meinte ihn. Er drehte sich um. Auch sie hatte ein Fernglas und wies nun auf das Notizbuch des Mannes. Ihr birnenförmiger Körper steckte in einem rot-gelben Aufzug, als wolle sie nachdrücklich betonen, dass es beim Vogelbeobachten nicht unbedingt auf Tarnung ankam.
»Heute war ein Pieperwaldsänger dabei.«
»Nein!«
»Doch, wirklich.«
»Haben Sie das schon auf eBird gepostet?«
Eine Internetseite, die unter anderem auf seltene Sichtungen hinwies.
»Noch nicht. Und wie war’s bei Ihnen?«
Sie zuckte die Achseln. »Kaum der Rede wert. Ich bin gerade erst angekommen. Es soll hier einen Höckerschwan geben. Ich schaue später mal bei den Teichen und beim Reservoir vorbei. Und wo war der Pieperwaldsänger?«
»In der Nähe des Museums.«
Sie schaute zum Metropolitan Museum, das auf der anderen Seite des Parks lag, so als könne der zweisilbig Zwitschernde in genau diesem Augenblick von dort angeflogen kommen. Dann drehte sie sich wieder zu dem Mann um und nahm ihn in Augenschein. Er sah nicht besonders attraktiv aus, das wusste er. Und er war bereits um die fünfzig Jahre alt. Aber er war durchtrainiert und besaß einen allseits beliebten Vorzug: einen nackten Ringfinger.
»Ich habe beim Bootshaus eine Pfeifente gesehen«, sagte sie.
»Oh, gut.«
Sie schwiegen beide. Dann fügte die Frau urplötzlich hinzu: »Also, falls ich ein Vogel wäre, dann so einer.« Sie präzisierte: »Ein Wasservogel, meine ich. Ente, Schwan, Gans. Die haben so was Friedliches. Aber kein Pelikan. Das sind Ärsche. Ich heiße übrigens Carol.«
»David.« Er hielt in einer Hand das Notizbuch, in der anderen das Fernglas, daher nickten sie sich nur zu.
Eine Pause. »Ich glaube, ich habe Sie hier noch nie gesehen«, sagte sie.
Vogelbeobachter waren eine verschworene Gemeinschaft. Vor allem in Manhattan.
»Ich bin erst vor Kurzem hergezogen.« Der Mann las auf seinem Telefon die Uhrzeit ab.
»Und von wo?«
»San Diego.«
»Oh, da ist es wunderschön. Ich liebe die Stadt.«
Ihm war klar, dass die Frau noch nie da gewesen war.
Wieder eine Pause. »Ich muss los«, sagte er. »Ich hab ’ne Verabredung.«
»Es hat mich gefreut. Und ich werde nach dem Pieperwaldsänger Ausschau halten. Vielleicht trifft man sich mal wieder.«
»Das hoffe ich doch«, sagte er lächelnd, wandte sich nach Westen und folgte dem Weg zu einem Gebüsch, wie es sie hier am Rand des Parks überall gab. Vor dort aus blickte er ohne sein Fernglas über die Sträucher hinweg zu einem der typischen Sandsteinhäuser auf der anderen Straßenseite.
Ein schlanker Mann mit schütterem Haar ging soeben darauf zu. Er trug einen locker geschnittenen dunklen Anzug und am Gürtel eine goldene Detective-Dienstmarke des NYPD, stieg nun die Stufen empor, klingelte und blickte in die Überwachungskamera. Gleich darauf öffnete sich die Tür.
Ah, da ist er ja …
Der Mann im Park konnte an dem Polizisten vorbei in den halbdunklen Flur sehen und entdeckte dort etwas wesentlich Aufregenderes als irgendwelche Vögel – die ihn ohnehin nicht interessierten, sondern ihm nur als Vorwand für das Fernglas dienten.
Die Person, die er erkannte, bevor die Tür sich wieder schloss, interessierte ihn hingegen so sehr, dass es fast schon an Besessenheit grenzte: Lincoln Rhyme. Und der vermeintliche Vogelbeobachter, Charles Vespasian Hale, auch bekannt als der Uhrmacher, war nach New York gekommen, um ihn zu töten.
5
Na los. Beeil dich.
Es ist noch nicht zu spät, aber die Uhr tickt.
Der Streifenbeamte Ron Pulaski musste daran denken, dass immer mal wieder von »den ersten achtundvierzig« die Rede war. Gemeint waren die ersten beiden Tage nach einem Mord. Sofern es während dieser Frist nicht gelang, einen handfesten Anhaltspunkt zu finden, wurde es angeblich immer schwieriger, den Fall aufzuklären. Aber das war bloß irgendein Blödsinn aus dem Fernsehen, wie jeder Cop wusste. In Wahrheit kam es auf die ersten achtundvierzig Minuten an. Danach zersetzten sich allmählich die Spuren und verblassten die Erinnerungen der Zeugen.
Dieser Todesfall hatte das Zeitlimit längst überschritten und lag ironischerweise ungefähr zwei Tage zurück, also genau auf Linie des Klischees.
Und deshalb musste Pulaski sich beeilen.
Adrett und blond und glatt rasiert, allerdings derzeit in einen Tyvek-Overall der Spurensicherung gekleidet und mit einer Maske vor dem Gesicht, ließ der Beamte den Tatort auf sich wirken: ein Betonboden, fleckig und schartig und rissig von irgendwelchen alten, seit Langem demontierten Industriemaschinen, deren Aussehen und Funktion sich aus den Abnutzungserscheinungen des Bodens nicht unmittelbar erschloss. Wasser in flachen Pfützen mit schillernd blaurotem Ölfilm. Mauern aus Betonblöcken, aus denen Metallstangen und Rohre ragten. Leere Regalreihen, deren einstiger Anstrich fast vollständig dem Rost gewichen war. Und jede Menge Schimmel.
Hoch oben in den Wänden gab es schmale horizontale Fensterschlitze, wie sie für derartige Kellerräume typisch waren. Sie starrten zwar vor Dreck, ließen aber dennoch etwas Tageslicht ins Innere fallen.
An einem Ende des Raumes stand ein großer stillgelegter Heizkessel aus feuerverzinktem Stahl.
Aber war auch die eine entscheidende Spur, die zum Täter führen würde, noch hier? Oder hatte sie sich inzwischen verflüchtigt, war von Ratten gefressen worden oder in eine Milliarde Moleküle undefinierbarer Materie zerfallen?
Denn es hatte sie auf jeden Fall gegeben. Zum Zeitpunkt des Mordes. Sie hatte eindeutig existiert.
Jedenfalls laut einem 1966 verstorbenen Franzosen.
Edmond Locard war als Ermittler für die Polizei von Lyon tätig und begründete dort das erste forensische Kriminallabor der Welt. Seine berühmteste Erkenntnis ist so schlicht wie bis heute unverwandt gültig: Ein Verbrecher hinterlässt bei seiner Tat zwangsläufig Spuren – entweder am Opfer oder am Schauplatz.
Ron Pulaski hatte diese Worte schon hundertmal gehört – und zwar aus dem Mund seines Mentors Lincoln Rhyme. Die Erfahrung hatte ihn gelehrt, dass sie zutrafen.
Daher wusste er auch, dass es hier irgendwo Hinweise auf die Person gegeben hatte, die verantwortlich dafür war, dass Pulaski nun in diesem feuchten Keller eines Lagerhauses an der East Side von Manhattan über einem Toten stand. Vielleicht gab es sie immer noch.
Dieses eine Wort war wichtig.
Vielleicht …
Denn nach so langer Zeit – eben jenen berüchtigten achtundvierzig Stunden – konnten sie sich durchaus aufgelöst oder bis zur Unkenntlichkeit verändert haben.
Pulaski wusste zudem, dass ein solcher etwaiger Hinweis nichts Offensichtliches wie ein Fingerabdruck, ein Blutstropfen des Täters oder eine verräterische Patronenhülse sein würde. Denn die gab es hier eindeutig allesamt nicht.
Blieb also noch der »Staub«, Locards charmante Bezeichnung für Partikelspuren.
Pulaski schaute erneut zu dem Opfer. Fletcher Dalton.
Er lag in seinem grauen Anzug, dem weißen Hemd und der dunklen Krawatte auf dem Rücken und starrte aus toten Augen an die schwarze Decke. Der Zweiunddreißigjährige hatte als Broker für eine Wertpapierfirma an der Wall Street gearbeitet und im Haus Nummer 845 der Achtundfünfzigsten Straße Ost gewohnt. Er war am Vortag weder zur Arbeit erschienen noch in seiner Single-Wohnung angetroffen worden, daher hatte die Polizei mit Namen und Foto nach ihm gesucht. Vor zwei Stunden war dann einem Streifenbeamten die nur angelehnte Tür des leer stehenden und zum Abriss vorgesehenen Lagerhauses aufgefallen. Als ihm der stechende Geruch in die Nase stieg, wusste der Mann sofort Bescheid und verständigte das Morddezernat.
Pulaski arbeitete zwar meistens mit Rhyme und Amelia Sachs zusammen, hatte sich durch seine Sachverständigenauftritte vor Gericht und seine Tatortberichte aber bereits einen eigenen Namen gemacht und wurde in letzter Zeit vermehrt als eigenständiger forensischer Ermittler angefordert.
Dass er diese Gelegenheit bekam, freute ihn. Er hatte nun schon eine Reihe von Jahren als Rhymes und Sachs’ Assistent fungiert, und beide bestärkten ihn darin, sich mehr zuzutrauen. Die Arbeit als Forensiker war wesentlich interessanter als der alltägliche Streifendienst – wenngleich er offiziell immer noch der Patrol Division angehörte. Ein weiterer Vorteil: Es machte Jenny glücklicher. Die Gefahr, dass sie zur Witwe wurde, sank enorm, wenn ihr Ehemann mit einer Pinzette Härchen aufsammelte, anstatt sich von Meth benebelten Gangstern entgegenzustellen.
Und noch etwas: Die Tatortarbeit lag ihm.
Plus das Sahnehäubchen: Er hatte Spaß daran.
Was für ein seltener Glücksfall es doch war, ausgerechnet die Tätigkeit am liebsten zu mögen, die man besonders gut beherrschte.
Rhyme hatte zu ihm gesagt, manche Leute seien für die Tatortarbeit geboren, andere hingegen würden dort einfach nur eine Tätigkeit verrichten.
Erstere gingen beflügelt zu Werke, Letztere bloß zweckmäßig.
Künstler oder Handwerker.
Der Kriminalist sprach zwar nicht aus, zu welcher Kategorie er Pulaski zählte, aber das war eigentlich auch gar nicht nötig; bei Lincoln Rhyme stand immer viel zwischen den Zeilen, und der jüngere Beamte wusste ihn zu lesen.
Ein weiterer Rundblick durch den zwölf mal fünfzehn Meter großen Raum. Der Ablauf der Tat schien klar zu sein. Dalton war draußen auf dem Gehweg erschossen und in den Keller gezerrt worden – nachdem der Mörder die Tür eingetreten hatte. Und es handelte sich um nur einen Täter, das zeigten die Spuren auf dem schmutzigen Boden.
Er hatte sein Opfer geradewegs zur Ablagestelle gezogen, ohne Umschweife – doch Pulaski untersuchte natürlich trotzdem den gesamten Schauplatz.
Dabei ging er nach einem eigenen Schema vor: in Form einer Spirale, die im Zentrum des Verbrechens ihren Anfang nahm und in immer größeren Kreisen verlief. Dann legte er den Weg in umgekehrter Reihenfolge und immer engeren Bahnen zurück. Lincoln bevorzugte ein Gitternetz; man schritt den Tatort hin und her ab, als würde man einen Rasen mähen. Dann folgte ein zweiter Durchgang im rechten Winkel zur ursprünglichen Richtung, um dieselben Stellen aus anderer Perspektive zu begutachten.
Pulaski wusste das Gitternetz durchaus zu schätzen, aber seine eigene Methode gefiel ihm besser. Seine Frau hatte ihn darauf gebracht, als sie ihn bat, für Thanksgiving einen Spiralschinken zu besorgen.
Das grelle Licht der sechs starken Halogenstrahler, die auf ihren Stativen strategisch günstig im Raum verteilt standen, ließ ihn die Augen zusammenkneifen.
Es ist hier irgendwo …
Denn das muss es, nicht wahr, Mr. Locard?
Aber wo?
Beeil dich, ermahnte er sich.
Die Uhr tickt …
Seine Spiralschinkensuche lag bereits hinter ihm, und er konzentrierte sich nun auf die wichtigsten Stellen des Tatorts: auf den Weg von der Tür zum Ablageort und auf den Leichnam.
Und dort, auf Daltons Revers, wurde er fündig.
Er stieß auf etwas, das in die wichtigste Spurenkategorie an einem Tatort fiel: ein Ding, das anders war als alles sonst hier.
Es handelte sich um eine dunkelblaue Faser. Ein synthetisches Polymer. Aus diesem Grund – und wegen ihrer Länge – musste sie entweder von einem Schal oder einer Mütze stammen. Pulaski wusste dies, weil er viele Stunden damit zugebracht hatte, Schals und Mützen zu studieren (und übrigens auch die meisten anderen Textilien), damit er bei deren Vorkommen an einem Tatort hoffentlich in der Lage sein würde, sie anhand der Fasern direkt dort zu identifizieren und nicht erst später im Labor, was zwar am Resultat nichts änderte, wohl aber an dem erforderlichen Zeitaufwand.
Na los. Beeil dich.
Draußen streifte Pulaski flink den Overall ab, wies die Techniker der Spurensicherung an, das gesammelte Material ins Hauptlabor nach Queens zu bringen, und gab den Leichnam für den zuständigen Gerichtsmediziner frei.
Dann ging er vom Schauplatz des Mordes zu der dreieinhalb Blocks entfernt gelegenen U-Bahn-Station, an der Dalton – in dessen Tasche eine MetroCard steckte – höchstwahrscheinlich am Abend seines Todes auf dem Heimweg ausgestiegen war (denn niemand fuhr mit dem Bus von der Wall Street an die Upper East Side).
Und tatsächlich fand Pulaski, worauf er gehofft hatte.
Vor einigen Lagerhäusern und Geschäftsgebäuden hing an einem der Laternenmasten eine Kamera des Domain Awareness Systems.
Pulaski rief in der Zentrale an und ließ sich zu einem der DAS-Beamten durchstellen, der mit mehreren Dutzend Kollegen vor zahllosen Reihen von Monitoren saß und unterstützt durch diverse Algorithmen nach Bösewichten und Missetaten Ausschau hielt.
Pulaski identifizierte sich, gab den Standort der Kamera an und nannte Datum und Uhrzeit von Daltons mutmaßlicher Erfassung.
»Okay«, sagte der Mann. »Wollen Sie’s gleich?«
»Ja, an meine Nummer, bitte.«
Sie beendeten das Gespräch. Gleich darauf summte sein Telefon. Er ging aus der Sonne, um das Display besser erkennen zu können, und rief die Videodatei auf.
Ah, da.
Ein schlanker Mann mit auffälligem Schnurrbart kam ins Bild. Er trug eine schwarze Hose und Jacke sowie eine dunkelblaue Mütze, die genau zu der von Pulaski gefundenen Faser passte.
Während der Unbekannte nach Osten ging, war sein Blick auf die nicht von der Kamera erfasste andere Straßenseite und damit womöglich auf Dalton gerichtet.
Die Hand des Mannes verharrte an seiner Seite, und bei einer Gelegenheit klopfte er sich auf die Jackentasche. Dafür konnte es eine Vielzahl von Erklärungen geben, und eine davon war ein Kontrollgriff zur Waffe.
Dann verschwand er außer Sicht. Fünfzehn Minuten später kehrte er schnellen Schrittes zurück, und Pulaski stellte eine Hypothese über den möglichen Fortgang der Ereignisse auf: Irgendwo entlang dieser Straße hatte Dalton etwas gesehen. Es konnte kein offensichtliches Verbrechen gewesen sein, sonst hätte der Trader die Polizei verständigt. Pulaski hatte das überprüft. Die einzigen Notrufe aus dieser Gegend waren an jenem Tag zwei Herzinfarkte und ein schlimmer Sturz gewesen.
Worum auch immer es ging, Blaumütze konnte nicht riskieren, Dalton am Leben zu lassen.
Pulaski rief erneut beim DAS an und fragte nach weiteren Kameras in der näheren Umgebung.
Es gab keine.
Dann hatte er eine Idee. Er wollte etwas versuchen, das bestimmt nicht funktionieren würde.
Er machte es trotzdem.
Pulaski nannte dem DAS-Beamten den genauen Zeitstempel des Moments, in dem Blaumützes Gesicht während der Aufzeichnung am deutlichsten zu erkennen war. Er bat ihn, ein Bildschirmfoto davon anzufertigen und an eine andere Abteilung des NYPD weiterzuleiten.
Die FIS, die Facial Identification Section, geht bei Weitem nicht so invasiv vor, wie die meisten Leute annehmen. Ihre Aufgabe besteht darin, die Bilder möglicher Verdächtiger, die von Überwachungskameras und vereinzelt auch von leichtfertig geposteten Selfies geliefert werden, mit bestehenden Fahndungsfotos abzugleichen.
Pulaski hatte es im Laufe der Jahre mit ungefähr sechzig Personen versucht und noch nie einen Treffer gelandet.
Bis jetzt.
»Tja, Ron, halten Sie sich fest«, sagte der Mann am anderen Ende der Leitung. »Wir haben hier eine zweiundneunzigprozentige Übereinstimmung.«
»Ist das gut?«
»Zweiundneunzig? Das ist praktisch ein Volltreffer.« Der Mann lachte. »Und jetzt kommt noch etwas. Sie werden nicht glauben, wer Ihr Verdächtiger ist. Sitzen Sie?«
***
»Guten Morgen. Hier ist WKDP mit einer brandaktuellen Meldung. Viele Anleger haben die Hosen gestrichen voll, seit heute früh auf einer Baustelle an Manhattans Upper East Side ein Kran umgestürzt ist. Dabei kam ein Arbeiter ums Leben und sechs weitere wurden verletzt. Die Bauträger des achtundsiebzig Stockwerke aufragenden Luxushochhauses, dessen Wohnungspreise bei fünf Millionen Dollar anfangen werden, sind Evans Development und Moynahan Construction. Laut Angaben der städtischen Behörden verfügen die derzeit in New York betriebenen Turmkräne sämtlich über gültige Inspektionsnachweise, aber die Bundesaufsicht drängt nun darauf, alle betroffenen Baustellen vorläufig stillzulegen, bis das Baudezernat und das Bundesamt für Eich– und Vermessungswesen, unser National Institute of Standards and Technology, explizite Freigaben erteilen. Das NIST war nach dem elften September bereits an der Untersuchung der Anschlagsorte World Trade Center und Pentagon beteiligt sowie später auch an den Ermittlungen nach dem teilweisen Einsturz des Champlain Towers South in Miami. Der Aktienkurs des börsennotierten Unternehmens Evans Development fiel auf ein Allzeittief.«
6
Die Lichter ließen wenig Zweifel daran, wo das Unglück geschehen war.
Sie blinkten zu Hunderten, weiße, blaue, rote.
Sachs näherte sich dem makabren Spektakel in ihrem alten kastanienbraunen Ford Torino mit hohem Tempo auf einer Querstraße und schlängelte sich im Zickzackkurs durch den Verkehr. Als einige Transporter ihr nicht gleich Platz machen wollten, wäre sie beinahe auf den Bürgersteig ausgewichen. An der Dritten Avenue führte ihr hartnäckiges Hupen zu einem ausgestreckten Mittelfinger, der sich jedoch sofort in ein freundliches Winken verwandelte, als der Mann das Blaulicht und die NYPD-Plakette hinter der Windschutzscheibe bemerkte.
Endlich tat sich eine Lücke auf, weil die uniformierte Polizei den Verkehr allmählich umleiten konnte. Sachs gab Gas und erreichte mit quietschenden Reifen ihr Ziel, den Rand der riesigen Baustelle an der 89. Straße Ost.
Die Fernsehbilder hatten das ganze Ausmaß der Katastrophe nicht mal annähernd wiedergegeben. Der Kran – dessen blaue Streben weitaus dicker waren, als es von Weitem den Anschein hatte – lag zwischen zwei Gebäuden, die nur knapp verfehlt worden waren. Die Spur aus Trümmern und Verwüstung erstreckte sich von der Basis – einem dicken Betonsockel – bis zu dem Park, wo die Spitze des Auslegers sich tief in die Erde gebohrt hatte. Alles unter dem Kran war platt. Der Streifen der Zerstörung erwies sich als ein Durcheinander aus Rohren, Metallteilen, Papieren, Zementplatten, Maschinen, Tragbalken, Betonstaub, Plastikstücken, Drähten und Kabeln, verbogenen Leitern, Treppen und Podesten. Anscheinend stieg man bei einem Kran nicht in gerader Linie nach oben, sondern über etwa sechs Meter lange Leiterstücke, die abwechselnd nach links und nach rechts wiesen, sodass man bei einem Sturz immer nur bis zur nächsten kleinen Plattform fiel, was allenfalls Verletzungen, aber nicht den Tod bedeuten würde.
Sachs musterte die Kabine, das verformte Metall und geborstene Glas. Der Kranführer musste sofort tot gewesen sein, denn die Aufprallgeschwindigkeit dürfte mehr als hundertfünfzig Kilometer pro Stunde betragen haben – aber welch furchtbare letzte Sekunden hatte er wohl durchlitten, als er durch die großen Fenster sein unausweichliches Ende auf sich zurasen sah?
Es stieg Rauch auf, obwohl es anscheinend keinen Brand gegeben hatte.
Wie alle New Yorker hatte Sachs schon Hunderte von Baukränen in der Stadt gesehen, ihnen bisher aber kaum Beachtung geschenkt. Unfälle beim Einsatz dieser Maschinen kamen zwar vor, aber nur sehr selten. Für Amelia waren Kräne im Wesentlichen weithin sichtbare Signale für Baustellen und die damit verbundenen Fahrbahnverengungen, die den ohnehin stets stockenden Verkehr noch weiter verlangsamten.
Von Berufs wegen wusste sie außerdem, dass in Kreisen des organisierten Verbrechens Kräne bisweilen als »Grabsteine« bezeichnet wurden, denn sie ragten an genau den Stellen auf, an denen so manches Opfer in den frisch gegossenen Betonfundamenten verschwand.