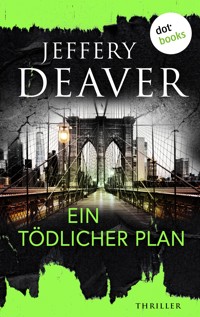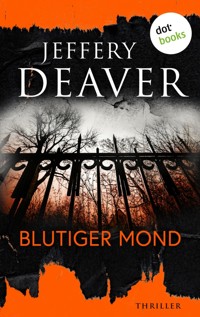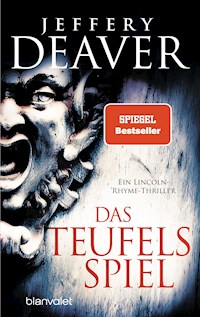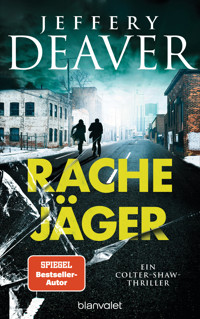
10,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Die Colter-Shaw-Reihe
- Sprache: Deutsch
Eine Frau auf der Flucht. Sie bangt um ihr Leben. Denn ihr vor Wut rasender Ex-Mann sinnt auf Rache – der hoch spannende 4. Band der erfolgreichen Thrillerreihe um Colter Shaw
Allison Parker ist mit ihrer Tochter Hannah auf der Flucht vor ihrem gewalttätigen Ex-Mann. Die brillante Ingenieurin, die revolutionäre Technologien entwickelt, nutzt all ihre Fähigkeiten, um nicht entdeckt zu werden. Colter Shaw, Experte im Aufspüren vermisster Personen, wird von ihrem Chef engagiert, um sie ausfindig zu machen und zu retten. Seine Suche führt ihn vom trostlosen Rust Belt in die abgelegene Wildnis des Mittleren Westens. Als er Allison schließlich in einer Hütte fern jeglicher Zivilisation findet, ist plötzlich alles anders, als es scheint, und er wird selbst zum Gejagten …
Verpassen Sie nicht die anderen eigenständig lesbaren Colter-Shaw-Fälle »Vatermörder«, »Der böse Hirte« und »Der Todesspieler«.
Kennen Sie auch die Lincoln-Rhyme-Thriller? Ein Muss für alle Fans knallharter Spannung!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Buch
Allison Parker ist mit ihrer Tochter Hannah auf der Flucht vor ihrem gewalttätigen Ex-Mann. Colter Shaw, Experte im Aufspüren vermisster Personen, wurde von ihrem Chef beauftragt, sie zu finden. Doch in der brillanten Ingenieurin hat er seine Meisterin gefunden. Allison, die revolutionäre Technologien entwickelt, nutzt all ihre Fähigkeiten, um nicht entdeckt zu werden. Aber auch zwei Killer sind ihr auf den Fersen und die Zeit drängt. Seine Suche führt Shaw vom trostlosen Rust Belt in die abgelegene Wildnis des Mittleren Westens. Als er Allison schließlich in einer Hütte fern jeglicher Zivilisation aufstöbert, wird er ebenfalls zum Gejagten …
Autor
Jeffery Deaver gilt als einer der weltweit besten Autoren intelligenter psychologischer Thriller. Seit seinem ersten großen Erfolg als Schriftsteller hat Jeffery Deaver sich aus seinem Beruf als Rechtsanwalt zurückgezogen und lebt nun abwechselnd in Virginia und Kalifornien. Seine Bücher, die in 25 Sprachen übersetzt werden und in 150 Ländern erscheinen, haben ihm zahlreiche renommierte Auszeichnungen eingebracht.
Weitere Informationen unter: www.jeffery-deaver.de
Von Jeffery Deaver bereits erschienen (Auswahl)
Der Todesspieler · Der böse Hirte · Vatermörder · Rachejäger
JEFFERY DEAVER
RACHEJÄGER
Thriller
Deutsch von Thomas Haufschild
Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel Hunting Time bei G.P. Putnam’s Sons, New York.Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright der Originalausgabe © 2022 by Gunner Publications LLC
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2024 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Redaktion: Dr. Rainer Schöttle
Umschlaggestaltung: © www.buerosued.de
Umschlagmotiv: © Elisabeth Ansley / Trevillion Images; www.buerosued.de
StH · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-31635-8V002
www.blanvalet.de
All meinen Freunden im Kastens Hotel Luisenhof in Hannover, für die große Liebenswürdigkeit und Gastfreundschaft während meiner jüngsten Deutschlandreise. Danke schön!
Mensch sein heißt Ingenieur sein.
Billy Vaughn Koen, Discussion of the Method
ERSTER TEIL DIE TASCHENSONNE
Dienstag, 20. September
1
Die Falle war ganz simpel konstruiert.
Und genau deswegen funktionierte sie auch tadellos.
Colter Shaw schlich durch die schon ewig nicht mehr genutzte Werkstatt im dritten Stock von Welbourne & Sons Fabricators, zwischen verstaubten hölzernen Gestellen voller rostiger Tanks und Metallfässern. Sechs Meter vor ihm endeten die Regale an einer großen Freifläche mit alten Arbeitstischen aus Mahagoni, verschrammt, fleckig, von Schimmel befallen und weitgehend verrottet.
Dort standen drei Männer in dunklen Anzügen und sprachen miteinander. Ihre lebhaften Gesten und der sorglose Tonfall ließen erkennen, dass sie sich unbeobachtet glaubten.
Shaw hielt im Schutz einer Regalreihe inne und zog eine kleine Videokamera aus der Tasche. Sie sah aus wie ein beliebiges Modell von Amazon oder aus einem Elektronikmarkt, nur dass sie kein herkömmliches Objektiv besaß, sondern eine winzige Linse am Ende eines etwa fünfundvierzig Zentimeter langen flexiblen Stängels. Diesen bog Shaw nun im Neunzig-Grad-Winkel zurecht, schob das Ende um die Ecke des Regals und drückte die Aufnahmetaste.
Als die Männer ihm nach einigen Minuten alle den Rücken zuwandten, verließ er sein Versteck und wagte sich bis hinter die letzte Regalreihe vor.
Wodurch er die Falle auslöste.
Sein Schuh verfing sich an einem Stolperdraht, der wiederum einen Haltebolzen aus dem nächstgelegenen Regal zog und eine Lawine aus Tanks, Kanistern und Fässern bewirkte. Shaw rollte sich nach vorn ab, um den größten Exemplaren zu entgehen, wurde aber mehrmals hart an den Schultern getroffen.
Die drei Männer fuhren herum. Zwei von ihnen stammten ersichtlich aus dem Nahen Osten – aus Saudi-Arabien, wusste Shaw. Der andere war ein Weißer und wirkte im Vergleich regelrecht blass. Der Größere der Saudis – ein gewisser Rass – hielt eine Pistole, die er bei Shaws unbeholfenem Auftritt blitzschnell gezogen hatte. Die drei bauten sich nun vor dem Eindringling auf, während dieser sich noch vom verdreckten Boden erhob. Sie begutachteten ihren Fang: einen athletischen blonden Mann Anfang dreißig in blauer Jeans, schwarzem T-Shirt und einer Lederjacke. Shaw massierte sich mit der rechten Hand die linke Schulter und verzog das Gesicht.
Rass nahm die Spionagekamera, musterte sie kurz, schaltete sie aus und steckte sie ein. Shaw verabschiedete sich im Stillen von den zwölfhundert Dollar. Aber das war jetzt nicht so wichtig.
Ahmad, der andere Saudi, seufzte. »Ach, herrje.«
Der dritte Mann, der Paul LeClaire hieß, setzte nach dem ersten Schreck eine weinerliche Miene auf.
Shaws blaue Augen streiften verärgert das eingestürzte Regal. Er wich ein Stück vor einigen der Fässer zurück, aus denen stechend riechende Chemikalien sickerten.
Eine simple Konstruktion …
»Moment mal!« LeClaire runzelte die Stirn. »Den kenne ich doch! Er arbeitet für Mr. Harmon, und zwar in der Personalabteilung. Hat er jedenfalls behauptet. Aber das kann ja wohl nicht stimmen. Scheiße!« Seine Stimme überschlug sich fast.
Gleich fängt er an zu heulen, dachte Shaw.
»Ein Bulle?«, fragte Ahmad.
»Keine Ahnung«, erwiderte LeClaire. »Woher soll ich das wissen?«
»Ich bin nicht von der Polizei, sondern ermittle privat«, sagte Shaw und fixierte LeClaire mit ernstem Blick. »Man hat mich beauftragt, Harmons Judas zu finden.«
Ahmad ging zu einem der Fenster und schaute hinunter auf die Gasse. »Sind Sie allein?« Das galt Shaw.
»Ja.«
Als Nächstes steuerte der Mann den Eingang der Werkstatt an. Unter seinem edlen grauen Anzug schienen trainierte Muskeln zu stecken. Er öffnete langsam die Tür, blickte hinaus auf den Flur, schloss sie dann wieder und kehrte zu den anderen zurück. »Filzen Sie ihn«, wies er LeClaire an. »Nach Waffen und allem, was er sonst noch in den Taschen hat.«
»Ich?«
»Uns ist niemand gefolgt«, behauptete Ahmad. »Sie haben nicht aufgepasst.«
»Doch. Hab ich. Ehrlich. Da bin ich mir sicher.«
Ahmad hob eine Hand: Wir bezahlen Sie nicht fürs Winseln.
LeClaire, der zusehends bestürzter wirkte, trat vor und tastete Shaw widerwillig ab. Dabei ging er alles andere als gründlich zu Werke, und falls Shaw bewaffnet gewesen wäre, was er nicht war, hätte LeClaire die Halbautomatik an seiner Hüfte übersehen.
Immerhin aber leerte der Mann nun Shaws Taschen aus und legte Mobiltelefon, Bargeld, Klappmesser und Brieftasche auf einem der staubigen Tische ab.
Shaw knetete sich weiterhin die Schulter, während Rass ihn schweigend und mit geneigtem Kopf keine Sekunde aus den Augen ließ. Der Finger des Mannes lag nicht um den Abzug gekrümmt. Er wusste eindeutig, was er tat. Andererseits wirkte die glänzend verchromte Pistole protzig. Kein echter Profi würde so ein Modell tragen.
Errege mit deiner Waffe niemals unnötige Aufmerksamkeit …
LeClaire schaute zu einem offenen Aktenkoffer. Darin lag eine graue Metallkassette von fünfunddreißig mal fünfundzwanzig mal fünf Zentimetern. Aus ihr entsprangen ein halbes Dutzend unterschiedlich gefärbter Kabel. »Weiß er Bescheid?«, fragte er Shaw. »Über mich? Weiß Mr. Harmon Bescheid?«
Colter Shaw reagierte für gewöhnlich nicht auf Fragen, deren Antworten auf der Hand lagen.
Und manchmal hielt man auch einfach nur den Mund, um weiter Druck auf den anderen auszuüben. Der Geschäftsmann rieb Daumen und Zeigefinger aneinander. An beiden Händen. Kurioserweise in völlig synchroner Bewegung. Sein Unbehagen nahm immer mehr zu.
»Die PIN«, verlangte Ahmad mit Blick auf Shaws Telefon.
Rass hob die Waffe.
Es wäre einem Überlebensexperten niemals in den Sinn gekommen, sich wegen so etwas erschießen zu lassen. Shaw nannte ihm den Code.
Ahmad scrollte durch das Display. »Er schreibt, er würde in der Fabrik etwas überprüfen wollen. Die Nachricht ging an eine Nummer hier in der Stadt. Er kennt unsere Namen.« Ein Blick zu LeClaire. »Ihren auch.«
»O mein Gott …«
»Er ist Ihnen schon eine Weile auf der Spur, Paul.« Ahmad scrollte noch etwas weiter und warf das Telefon dann auf einen der Tische. »Doch es besteht keine unmittelbare Gefahr. Wir halten uns an den Plan. Aber wir sollten uns beeilen.« Er zog einen dicken Umschlag aus der Jackentasche und reichte ihn LeClaire, der das Geld einsteckte, ohne vorher nachzuzählen.
»Und was wird aus ihm?«, fragte der Mann mit schriller Stimme.
Ahmad überlegte kurz. Dann bedeutete er Shaw, sich vor eine der Wände zu stellen.
Shaw ging los und massierte dabei immer noch seine Schulter. Die Schmerzen strahlten nach unten aus, als würden sie der Schwerkraft folgen.
Ahmad nahm die Brieftasche, sichtete den Inhalt und steckte das Geld ein. »Also gut. Ich weiß nun, wer Sie sind und wo ich Sie finde. Ich schätze, das bereitet Ihnen keine großen Sorgen.« Er musterte Shaw von oben bis unten. »Sie können offenbar ganz gut auf sich aufpassen. Aber ich kenne jetzt auch alle Kontakte auf Ihrer Notfallliste. Sie werden Harmon daher mitteilen, dass Sie dem Dieb hierher gefolgt sind, bei Ihrer Ankunft in der Fabrik aber niemanden mehr vorgefunden haben.«
»Er weiß doch, wer ich bin!«, protestierte LeClaire.
Ahmad und Rass schienen das Gejammere ebenso leid zu sein wie Shaw.
»Sind wir uns einig?«
»Voll und ganz.« Shaw sah Paul LeClaire an. »Ich will Sie mal was fragen: Haben Sie denn überhaupt kein Gewissen? Immerhin ruinieren Sie das Leben von weltweit etwa zwei Millionen Menschen.«
»Halten Sie die Klappe!«
Mehr fiel dem Kerl nicht dazu ein?
Stille machte sich breit … Jedenfalls fast, denn es blieb ein beunruhigendes weißes Rauschen, als höre man das eigene Blut durch den Kopf strömen.
Shaw sah sich an, wo die Männer standen, und begriff, dass die Untersuchung der Brieftasche und die Drohung mit der Kontaktliste dazu gedient hatten, ihn an eine bestimmte Stelle im Raum zu lotsen, weg von den Fässern, die dank der Falle zu Boden gestürzt waren. Ahmad hatte keineswegs vor, ihn gehen zu lassen. Er wollte lediglich nicht riskieren, dass sein Partner in Richtung der Kanister schoss, die womöglich brennbare Chemikalien enthielten.
Ihn zu erschießen, würde ihnen Zeit verschaffen. Bis man Shaws Leiche entdeckte, hätten die Saudis längst das Land verlassen. Und LeClaire hatte seine Schuldigkeit getan, also war egal, was aus ihm wurde. Vielleicht sollte er sogar als Sündenbock für den Mord herhalten.
Ahmads dunkle Augen richteten sich auf Rass und dessen glänzende Pistole.
»Halt!«, rief Shaw. »Da ist etwas, das ich …«
2
Du bist ein richtiger Glückspilz, Merritt.«
Der bleiche Insasse, ausgezehrt und unrasiert, sah fragend den uniformierten Wärter an.
Der Aufseher schaute auf Merritts schütteres Haupt, als würde ihm gerade bewusst werden, dass der Mann zu Beginn seiner Haft noch wesentlich mehr Haare gehabt hatte. Und nur ein knappes Jahr später …
Die Männer, beide harte Kerle, beide müde, sahen sich durch eine mehr als einen Zentimeter dicke Scheibe aus schusssicherem Glas an, so milchig verschmiert, wie die Wände verschrammt waren. Der Entlassungsraum der achtzig Jahre alten Haftanstalt von Trevor County brauchte nicht hübsch zu sein, nur zweckmäßig.
Der schlanke, hochgewachsene Jon Merritt trug einen tiefdunklen blauen Anzug, als wolle er zu einem Bewerbungsgespräch oder einer Beerdigung. Das Ding war ihm eine Nummer zu groß und das zugehörige weiße Hemd hatte schon bessere Tage gesehen. Zuletzt getragen hatte Merritt die Sachen vor mehr als zehn Monaten. Dann leuchtend orangefarbene Kleidung, allerdings unfreiwillig.
»Du siehst spitzenmäßig aus«, sagte der Wärter. Larkin war ein massiger Schwarzer und seine Uniform hatte fast die gleiche Farbe wie Merritts Anzug.
»O ja, ich bin echt unwiderstehlich, nicht wahr?«
Der Aufseher stutzte, als sei er unschlüssig, wie sarkastisch das gemeint sein mochte. »Hier, bitte.«
Merritt nahm den Umschlag, in dem Brieftasche, Armbanduhr und Ehering lagen. Den Ring steckte er ein, die Uhr legte er an. Die Batterie funktionierte noch, es war neun Uhr zwei.
Dann inspizierte er die Brieftasche. Die Scheine – hundertundvierzig Dollar – waren noch da, die Münzen nicht mehr. Dafür aber seine Kredit- und die Bankkarte. Er war überrascht.
»Ich hatte außerdem ein Telefon, ein Taschenbuch, ein Paar Socken und einen Kugelschreiber.«
Mit dem Stift hatte er seinem Rechtsbeistand während der Anhörung kurze Notizen verfasst. Es war ein hübsches Exemplar mit einer Mine zum Wechseln, kein Wegwerfding.
Larkin sah in einigen anderen Umschlägen und einem Pappkarton nach. »Mehr ist hier nicht.« Er hob eine riesige Pranke. »Das Zeug kriegt Beine. Du weißt schon.«
Etwas anderes war Merritt noch wichtiger: »Was ist mit meinen Sachen aus der Werkstatt? William hat gesagt, ich könne sie mitnehmen.«
Der Wärter sah auf einer Liste nach. »Vor der Tür steht ein Karton im Regal. Da du den Kram nicht mitgebracht hast, brauchst du auch nicht dafür zu unterschreiben.« Er blätterte in weiteren Unterlagen, suchte noch zwei große Umschläge heraus und schob sie durch den Schlitz.
»Was ist das?«
»Die Entlassungspapiere. Du musst den Empfang quittieren.«
Merritt tat, wie geheißen, und steckte die Umschläge ein. Er wollte den Inhalt jetzt nicht lesen, sonst würde er vielleicht einen Fehler bemerken, der Aufseher könnte Wind davon kriegen und zack, wäre die Entlassung erst mal abgeblasen.
»Und die hier.« Er schob Merritt eine Visitenkarte herüber. »Dein Bewährungshelfer. Du musst dich innerhalb von vierundzwanzig Stunden bei ihm melden. Unbedingt.« Dann folgte noch eine Karte. Sie erinnerte an einen Arzttermin. Heute um elf Uhr.
»Pass auf dich auf, Merritt. Und lass dich nicht wieder hier blicken.«
Der Häftling drehte sich wortlos um, der Summer ertönte, und die dicke Metalltür schwang auf. Merritt ging hindurch. Auf der anderen Seite stand das Regal, das Larkin erwähnt hatte, darin ein Karton von etwa dreißig mal sechzig Zentimetern, versehen mit der Aufschrift J. Merritt. Er nahm die Box und ging zu dem Tor im Maschendrahtzaun. Rasselnd glitt es gemächlich beiseite.
Dann stand Jon Merritt draußen auf dem Bürgersteig und war frei.
Er fühlte sich seltsam, irgendwie desorientiert und benommen. Aber das dauerte nur kurz. Es erinnerte ihn an den Angelausflug mit ein paar Freunden von der Polizei, als er sich erst mal an das schwankende Boot gewöhnen musste.
Nun fing er sich und ging in Richtung Süden. Er atmete tief durch. Schmeckte die Luft hier draußen anders als dadrinnen? Er konnte es nicht sagen.
Ihm taten bereits die Füße weh. Merritt hatte genug Geld, um sich neue Schuhe zu kaufen – jedenfalls sofern seine Karten noch funktionierten –, aber es würde einfacher und billiger sein, den gemieteten Lagerraum aufzusuchen, in dem seine Habe untergebracht war.
Hoffentlich.
Die Ampel sprang um, und Merritt überquerte die Fahrbahn, mit hängenden Schultern, zu engen Schuhen und seinem ausgebeulten dunklen Anzug. Auf dem Weg zu einem Bewerbungsgespräch.
Oder zu einer Beerdigung.
3
Halt! Da ist etwas, das ich …«
Colter Shaw wurde durch einen lauten Knall unterbrochen – von einem der Fässer, die zu Boden gestürzt waren. Eine große, dichte gelbe Gaswolke breitete sich im gesamten Raum aus. Binnen weniger Sekunden konnte man kaum noch die Hand vor Augen erkennen und die Männer rangen nach Luft.
»Vorsicht!«
»Was ist das für ein Zeug?«
»Irgendein giftiger Scheiß aus der Fabrik!«
Es folgte allgemeines Husten.
»Der Kerl … Er darf nicht entkommen. Halt ihn auf! Schnell!« Das kam von Ahmad.
Rass konnte aber nicht feuern, denn ihm fehlte die Sicht.
Shaw hatte sich im Schutz der Wolke weggeduckt und beschrieb einen weiten Bogen.
»Wo steckt er denn?«
»Da! Da drüben! Er will zum Fenster.«
»Wir sind im dritten Stock. Soll er doch springen.« Das war wieder Ahmad.
»Nein, er geht in die andere Richtung«, rief LeClaire panisch und mit schriller Stimme.
»Das Zeug bringt uns noch um! Raus hier. Sofort!«
Hustend und fluchend eilten die drei Männer zur Tür.
Shaw tastete sich zwischen den Regalen zu dem Fenster zurück, durch das er in die Fabrik eingedrungen war. Nach Atem ringend stieg er die Feuertreppe bis zu einem verfallenen Steg hinab, der in den Fluss ragte. Dort eilte er im Laufschritt über die ungleichmäßigen, mit Kreosot geschwärzten Bohlen, die vom uralten Öl immer noch rutschig waren, und gelangte in eine Gasse, die neben der Fabrik verlief und vom Fluss zur Manufacturers Row führte.
Bei dem Müllcontainer auf halber Strecke hielt Shaw inne, um die Lunge frei zu bekommen, krächzte, spuckte, atmete tief durch. Der Hustenreiz legte sich, aber ansonsten roch es hier kaum besser als in der Giftwolke. Aus dem gelblich braunen Kenoah River stiegen beißende Dämpfe auf, die Shaw mittlerweile ziemlich gut kannte, hing dieser charakteristische säuerliche Geruch doch über weiten Teilen der Stadt Ferrington.
Shaw sah sich um und konnte niemanden entdecken. Dann holte er sein graues Blackhawk-Polymerholster aus dem offenen Container und steckte sich die Glock 42 innen an den Hosenbund. Danach nahm er eine Literflasche Wasser, spülte sich mehrmals hintereinander den Mund aus und trank schließlich die Hälfte des verbliebenen Inhalts. Zuletzt nahm er seine persönlichen Habseligkeiten wieder an sich.
Mit der Hand an der Waffe schaute er sich ein weiteres Mal um.
Keine Spur von Rass und seiner kleinen silbernen Pistole oder den anderen beiden Männern. Suchten sie überhaupt nach ihm?
Shaw ging zur Mündung der Gasse und konnte sich die Frage selbst beantworten. Nein, die drei ergriffen soeben die Flucht. Ahmad hielt den Aktenkoffer umklammert und stieg mit Rass in einen Mercedes, LeClaire hingegen setzte sich in seinen Toyota. Dann rasten die Fahrzeuge in unterschiedliche Richtungen davon.
Shaw kehrte zu dem Müllcontainer zurück und zog daraus einen Rucksack hervor.
In diesem verstaute er die graue Metallkassette, die oben in dem Aktenkoffer gelegen hatte. Er hängte sich den Rucksack über die Schulter, trat aus der Gasse auf die düstere Manufacturers Row, bog nach rechts ab, nahm sein Smartphone und verschickte mehrere Textnachrichten.
Dann steuerte er zu Fuß die Innenstadt von Ferrington an.
Er musste an die Falle denken.
An ihre Schlichtheit und Effizienz. Immerhin hatte Shaw sie konstruiert und nicht etwa einer der drei Männer in dem Raum.
Ein Firmenchef hatte ihn kürzlich damit beauftragt, den Diebstahl eines bahnbrechenden technischen Bauteils zu verhindern, entwickelt von der fähigsten Ingenieurin des Unternehmens. Shaw hatte die Liste der Verdächtigen auf LeClaire eingrenzen können. Der dürre, nervöse IT-Mann – ein zwanghafter und glückloser Spieler – war an die saudischen Kaufinteressenten herangetreten. Und die Übergabe sollte am heutigen Morgen in dieser Fabrik stattfinden.
Während der Auftraggeber lediglich wollte, dass das Gerät – bekannt unter dem Akronym S.N.A. – zurückgeholt und der Dieb enttarnt wurde, entschied Shaw sich dafür, die Box gegen eine Attrappe mit GPS-Peilsender auszutauschen, um so nicht nur den Zielort, sondern mit etwas Glück auch die Identität des Käufers in Erfahrung zu bringen.
Shaws Privatermittlerin aus Washington D.C. hatte in Ferrington einen Berufskollegen namens Lenny Caster aufgetan, der diverse Werkzeuge, Überwachungstechnik und weitere Utensilien beisteuern konnte. In der vergangenen Nacht hatten die beiden Männer dann die Stolperfalle in der Werkstatt von Welbourne & Sons vorbereitet und eines der großen Fässer mit einer Rauchbombe präpariert, wie sie so ähnlich auch vom Militär genutzt wurde.
Außerdem installierten sie eine Wanze, sodass Caster die Ereignisse von einem in der Nähe geparkten Van aus verfolgen konnte. Als der vereinbarte Code – »Halt! Da ist etwas, das ich …« – ertönte, zündete er die Ladung und setzte dadurch den dichten Rauch frei, dessen Rezeptur Shaw und seine Geschwister von ihrem Vater gelernt hatten, als einen weiteren Aspekt der Kunst und Wissenschaft des Überlebens. Shaw hatte die Mischung eigenhändig angerührt, mit einem Kaliumchlorat-Oxidator, Milchzucker als Hauptbestandteil sowie Chinolingelb A und einer Prise Natriumbikarbonat, um die Temperatur der Reaktion zu senken. Unbefugtes Betreten war das eine, Brandstiftung etwas völlig anderes.
Sobald der Raum in Rauchschwaden gehüllt war, nahm Shaw die Attrappe aus der Schublade eines der Arbeitstische, wo er sie letzte Nacht versteckt hatte, und tauschte sie gegen das Original aus. Dann eilte er zum Fenster und ließ die echte S.N.A. in den Müllcontainer fallen, zwölf Meter weiter unten.
Nun ging er durch das schattige, verrußte Tal aus Ziegelmauern einstiger Fabriken und Lagerhäuser.
Briscow Werkzeugmacher
Martin and Sons Eisenhütte
Johnson Container
Vereinigte Vergaserwerke
Nach vierhundert Metern ging dieser Industriefriedhof in eine Vielzahl riesiger, von Unkraut überwucherter Brachflächen über – mindestens zehn Hektar groß. Es waren ehemalige Firmengelände, auf denen nach dem Abriss nur noch vereinzelte Betonbrocken, Backsteine, Rohre sowie der Müll herumlagen, den die Leute über den Maschendrahtzaun warfen. Die sanfte Herbstbrise ließ Werbezettel, Zeitungspapier und zerfetzte Styroporbecher aufwirbeln.
Angeblich existierte ein neuer Nutzungsplan für das Viertel. Aber Shaws Zeit in Ferrington hatte ihn gelehrt, dass etwaige Sanierungsvorhaben vermutlich noch in weiter Ferne lagen. Falls es überhaupt welche gab.
Der Bürgersteig beschrieb nun einen Bogen nach rechts und traf auf den Uferweg des Kenoah River.
Das Trio, das von Shaw soeben an der Nase herumgeführt worden war, musste den Austausch irgendwann bemerken. Würden die Männer sich dann an seinen Notfallkontakten rächen wollen? Das konnten sie sich sparen. Mack McKenzie, seine Privatdetektivin, hatte ihm eine Tarnidentität verschafft. Die schmale lederne Brieftasche, die LeClaire ihm aus der Jacke gezogen hatte, enthielt eine umfassende Ausstattung samt Führerschein, Kreditkarten und sogar Treuekarten einiger Supermärkte (neu für Shaw; er hatte noch nie eine genutzt). Dank Photoshop gab es zudem ein vermeintliches Familienfoto. Shaw war demnach mit einer bildhübschen Latina verheiratet und hatte zwei manierliche, fotogene Kinder.
Die Wahrscheinlichkeit, dass Rass oder Ahmad nach Anchorage, Alaska, reisen würde, dem vorgeblichen Wohnort von Shaw, schätzte er auf weniger als ein Prozent. Und den erfundenen Carter Stone und seine fiktive Familie gab es dort ohnehin nicht.
Er schaute nach vorn auf sein Ziel, ein zehngeschossiges Gebäude aus roten Backsteinen, so wie die meisten Häuser der Innenstadt. Auf dem Dach gab es ein großes Firmenschild. Der untere Teil der Abbildung war dunkelrot und änderte sich mit einem Farbverlauf nach oben hin bis zu einem hellen Gelb, wie Sonnenschein an einem wolkenlosen Tag. Vor diesem Hintergrund stand ein Schriftzug:
Harmon Energietechnik
Vorreiter für eine bessere und sauberere Zukunft
Shaw ließ den Blick in die Runde schweifen. Es gab in dieser Gegend wenig von Interesse und auf den Straßen war kaum etwas los. Ein paar hagere Halbwüchsige in Kapuzenpullovern und weiten Jeans lehnten an oder hockten vor Mauern voller Graffiti, vielleicht weil sie Crack, Meth oder Heroin im Angebot hatten oder kaufen wollten. Ein Obdachloser unbestimmten Alters saß mit grauem Gesicht in mehrere Decken gehüllt, trotz der für die Jahreszeit untypischen Wärme. Hinter ihm ragte ein Unterschlupf aus Pappe auf, mit einer Gipskartonplatte als Türersatz. Auf eine Bettelschale verzichtete er. Eine Prostituierte tippte rauchend auf ihrem Smartphone herum und sah dabei genauso lethargisch aus wie die anderen.
Niemand sprach Colter Shaw an, denn er wirkte wie ein Polizist.
Fünfzig Meter vor ihm stand ein hochgewachsener Mann mit wirrem blonden Haar an einer ein Meter zwanzig hohen Betonmauer, die den Gehweg vom Fluss trennte. Der Unbekannte schaute aufs Wasser hinaus und schrieb eine Textnachricht auf seinem Telefon. Eine Uferböschung gab es nicht; der Kenoah River verlief weit unterhalb in einem künstlich angelegten Kanal zwischen den Gebäuden.
Während Shaw sich näherte, fielen ihm zwei Dinge auf. Ob der Mann nun gerade einen Text schrieb oder nicht, er benutzte das Smartphone definitiv auch als Spiegel, um den Bürgersteig und speziell Shaw im Auge zu behalten.
Und außerdem war der Kerl bewaffnet.
Achte niemals auf die Hüfte, wenn jemand eine Pistole trägt; achte auf die Hände …
Shaw hängte seinen Rucksack von der rechten auf die linke Schulter und öffnete den Reißverschluss seiner Jacke. Als er den Mann fast erreicht hatte, steckte dieser das Telefon ein, drehte sich um und lächelte breit.
»Ah, ah, hier ist Mr. Colter Shaw!« Mit leichtem Akzent. Russisch, ukrainisch, belarussisch. »Kein Anlass für Sorge. Ich habe Hintergrund beobachtet, während Sie spazieren gehen. Sie nicht werden verfolgt. Obwohl drei Leute bestimmt gern würden Sie besuchen kommen.«
4
Werde niemals unvorsichtig, auch wenn du überrascht bist …
Shaw registrierte, dass die Straße weiterhin fast menschenleer blieb.
Der Slawe griff nicht nach seiner Waffe.
Kein Fahrzeug hielt genau auf ihn zu, weder von vorn noch von hinten.
Erst nachdem er die Bedrohungslage als minimal – also bei weniger als zehn Prozent – eingeschätzt hatte, wandte er sich dem Mann vollständig zu. Der Fremde hatte ein ausgesprochen kantiges Gesicht, mit hohen Wangenknochen und spitzem Kinn. Und trotz der blonden Haare waren seine Augen überraschenderweise tiefschwarz. Shaw wusste, dass Gene durchaus launisch sein konnten.
Auch der Mann schaute sich um. »Ihnen etwa gefällt dieses Dreckskaff? Aber was ich sage? Woher ich komme, es gibt viele verseuchte Städte. Danke, Großer Anführer! Ich hier umhergegangen. Ist hier irgendwo ein Ort, der nicht stinkt? Ich ihn jedenfalls nicht gefunden! Okay, okay, ich jetzt Klartext rede, bevor wird zu langweilig.«
Der Slawe schnalzte mit der Zunge und auf seinem Gesicht zeichnete sich Bewunderung ab. »Schlau, schlau, was Sie getan, Mr. Colter Shaw. Haben Dieb gefangen wie Maus in Falle. Knapp vor mir, um Breite von Haar. Ich war dicht am armen, traurigen Mr. Paul LeClaire. Aber Sie sind gewesen schneller. Ihre Wanze war besser als meine Wanze.« Er zuckte die Achseln. »Passiert manchmal. Also, was Sie gemacht, Mr. Colter Shaw? Sie auswechseln gegen Kopie und die Leute bleiben ohne Ahnung.« Er beugte sich vor und Shaw spannte sich an, aber der Mann atmete lediglich ein. »Nebeltarnung … Sehr schlau von Ihnen, sehr schlau. Araberjungs fahren nach Hause, schließen S.N.A. an und bekommen Tschernobyl! Ha! Ich finde toll.«
»Wer ist Ihr Käufer?«, fragte Shaw.
»Ach, Mr. Sowieso. Oder vielleicht Miss Sowieso. Was Sie glauben, Mr. Colter Shaw?« Er wurde ernst. »Sie glauben, Frauen ziehen Sie bei Geschäft mehr über Tisch als Männer? Ich das glaube. Nun wir reden. Es gibt diese Ausdruck.« Er blickte über den Fluss. »Reden … was? Wie heißt Wort? Klingt so komisch.«
»Es gibt nichts zu besprechen. Sie wissen, dass ich nicht verkaufen werde.«
»Ah. Jetzt ich weiß wieder: reden Tacheles! Wie viel Sie bekommen für diese Job?«
Es waren zwanzigtausend Dollar.
Marty Harmon galt nach hiesigem Maßstab als wohlhabender Mann, aber seine Firma war ein Start-up und schrieb noch keine schwarzen Zahlen. Da die Produktpalette des Unternehmens hauptsächlich darauf abzielte, die Lebensbedingungen der Dritten Welt zu verbessern, hatte Shaw den Auftrag angenommen. Außerdem reizte ihn die Herausforderung.
Er sagte nichts.
»Ich verrate Ihnen, was ich gebe. Fünfzigtausend. Sie wollen lieber Gold, Bitcoin oder Dogecoin? Eine Mischung davon? Oder sogar grünes Geld? Aber wer ist heutzutage noch so dämlich?« Er runzelte die Stirn. »Rubel. Oh, ich Sie mache zum Rubelmillionär. Oder Gazprom-Aktien? Die immer gut.« Ein breites Lächeln, dann wieder die ernste Miene. »Ein. Hundert. Tausend.« Bei jedem Wort hob und senkte sich sein Zeigefinger.
Sein Auftraggeber saß demnach vermutlich in Moskau, nicht in Minsk oder Kiew. Wegen der Rubel.
»Wie heißen Sie?«, fragte Shaw.
»Wie ich heiße? Mein Name?« Er lachte schallend. »Mein Name John F. Kennedy. Nein, war gelogen. Ist Abraham Lincoln. So. Das mein Name! Hundertfünfzig. Mehr geht nicht.«
»Nun, Abe, dann hören Sie mir gut zu«, sagte Shaw. »Es steht nicht zum Verkauf.«
»Ich gerechnet mit dieser Antwort. War mir sicher. Doch keine Angst, nein, nein.« Er hob beide Hände. »Kein Duell zwischen uns. Ich weiß, Sie haben Pistole. Ich gesehen, habe geschaut. Kleines Ding – malen’kiy pistolet.«
Ja, russisch.
»Okay«, sagte der Mann. »Zweihundert.«
Mehr ging also doch.
»Nein.«
»Scheißmist!«
Diese Variation kannte Shaw noch nicht und dabei waren ihm bei seiner Arbeit schon jede Menge Flüche und Beschimpfungen untergekommen.
Der Slawe erkannte, dass er mit Worten nicht weiterkam. Seine Augen verengten sich. »Sehr schade. Sehr schade für Sie. Verlieren all das Geld.« Er tippte sich gegen die Schläfe. »Ich muss mir ausdenken was Klügeres.«
Es klang nicht wie eine Drohung, obwohl es eine war.
Shaw hielt dagegen, und zwar weniger subtil. »Abe, folgen Sie mir lieber nicht. Wir sind nicht allein.«
Die Augen wurden zu noch schmaleren Schlitzen. Dann sah der Mann sich um. Schließlich grinste er. »Ich? Wieso sollte ich? Ich nur ein Tourist! He, haben Sie besichtigt berühmte Wasseruhr?«
»Nein.«
»Oh, muss man haben gesehen, Mr. Colter Shaw. Muss. Man. Haben. Gesehen.«
Shaw ging an ihm vorbei und weiter die Straße hinauf. Würde der Slawe trotz seiner gegenteiligen Behauptung die Waffe ziehen und es tatsächlich auf ein Duell ankommen lassen?
Die Chance lag bei etwa fünf Prozent. Abe Lincoln war nicht dumm.
Er stand aber unter Druck.
Scheißmist …
Na gut, vielleicht zehn Prozent.
5
Endlich. Seine maßgefertigten Arbeitsschuhe.
Jon Merritt schloss die Augen und seufzte erleichtert auf. Es fühlte sich an wie früher während eines Jobs. Schwarzes Leder, verstärkter Schaft, Schnürung. Und Stahlkappen. Die waren bisweilen nötig.
Er stand in dem winzigen Lagerraum und musterte die Plastiktonne mit seinen wahllos hineingeworfenen Sachen.
Dann nahm er einen Rucksack mit dem verblichenen Logo einer Footballmannschaft und verstaute etwas Kleidung darin, einige Toilettenartikel und den Karton mit dem Projekt aus der Metallwerkstatt – die er sich während seiner Haft als Betätigungsfeld ausgesucht hatte.
Er ging den Rest der Sachen durch. Irgendwas von Bedeutung? Von sentimentalem Wert?
Nein.
Er fand einen Beutel mit Gegenständen aus seiner einstigen Tätigkeit. Es war sogar regelrecht ein Müllbeutel, denn er enthielt unter anderem eine zerdrückte Getränkedose, eine leere Flasche Nagellack und eine steinharte, ein Jahr alte Scheibe Brot, die das Schimmelstadium längst hinter sich gelassen hatte. Merritt untersuchte den Rest des Inhalts und nahm ein paar Dinge an sich, die sich als nützlich erweisen könnten.
Er schloss das Wellblechtor, verriegelte es und verließ das Mietlager. Dann fuhr er mit dem Bus quer durch die Stadt, den Kopf gegen die Scheibe gelehnt, sodass er die Vibrationen des Motors und die ächzende Federung auf dem verwitterten Asphalt spürte. Die Schlaglöcher und Risse waren noch dieselben wie bei seinem Haftantritt. Ferringtons Etat für Infrastruktur würde binnen eines so kurzen Zeitraums wohl kaum auf wundersame Weise anwachsen. Und selbst wenn – wie viel von dem Geld wäre wohl abgeschöpft worden, um in die Taschen der Amtsträger zu fließen?
Ein beachtlicher Anteil, wusste Jon Merritt nur allzu gut.
Er stieg aus, ging drei Blocks und betrat die kleine, süßlich nach Öl riechende Büroecke der weitläufigen Autowerkstatt.
»Ebb.«
Der Eigentümer erstarrte vor Schreck. Er war ein Bär von einem Mann, überall dicht behaart und mit dickem Bauch. Die Überraschung war ihm deutlich anzusehen. Er trat vom Motor eines großen roten Sattelschleppers zurück und ließ den Schraubenschlüssel sinken. »He. Jon. Du bist …«
Merritt wies nach draußen. »Sonderlich gepflegt hast du ihn nicht.« Der weiße F-150-Pick-up war von klebrigem Staub überzogen, die Frontscheibe milchig gelb von Pollen des letzten Frühlings. Auf Haube und Dach lagen einige Zweige und Blätter, auf der Ladefläche sogar als dicke Schicht, weil der Wind sie dort nicht wegwehen konnte.
Nach Merritts Erinnerung hatten sie vereinbart, dass der Wagen in der Halle abgestellt werden sollte, aber er war sich nicht sicher. Er hatte bei dem Gespräch nämlich reichlich Alkohol im Blut gehabt. Damals, am Tag seiner Verurteilung.
Vielleicht hatte Ebb geglaubt oder gehofft, Merritt würde im Knast draufgehen und er könne den Pick-up irgendwie behalten. Die Karre hatte erst knapp 250 000 Kilometer auf dem Buckel. Das war fast gar nichts.
Der Mann registrierte Merritts verdrießliche Miene und bekam ein wenig Angst, denn er wusste, weshalb der Kerl hinter Gittern gesessen hatte. »Ehrlich, Jon, hätte ich’s vorher gewusst, wäre dein Wagen blitzblank gewesen …« Er legte nach: »Du hast ja für zwei weitere Jahre bezahlt. Ich erstatte dir den Rest natürlich zurück. Lass mir deine Adresse da und ich schicke dir sofort einen Scheck.«
»Ich habe keine. Wo ist der Schlauch?«
»Ich würde dir zur Hand gehen, aber Tom Ehrlich braucht seinen Truck.«
»Der Schlauch?« Merritt hatte schon vor langer Zeit gelernt, dass eine leise Stimme viel bedrohlicher wirkt als eine laute.
»Na klar, Jon. Da drüben. Möchtest du Shampoo und Politur? Lass mir einen Tag Zeit und dein Pick-up sieht wie neu aus.«
»Der Schlüssel.«
Merritt nahm ihn entgegen.
Als der Ford sauber genug war, um keine Aufmerksamkeit zu erregen, ließ Jon den Motor an. Der Wagen lief etwas unrund, aber auch nicht schlimmer als vor einem Jahr.
Merritt bog auf die Straße ein und fuhr eine Viertelstunde umher, bevor er bei einem Elektronikgeschäft anhielt. Dort kaufte er ein Wegwerftelefon. Es freizuschalten war nicht ganz so einfach, wie es im Kino wirkte. Das wusste er aus eigener Erfahrung. Ja, man konnte so ein Gerät ohne Kreditkarte oder echte Anschrift erwerben. Doch es musste eine E-Mail mit einem Bestätigungslink verschickt werden. Der Verkäufer, ein bulliger junger Kerl mit beeindruckenden, aber bedeutungslosen Tätowierungen, war ihm behilflich, und am Ende war das Ding aktiviert.
Als Merritt wieder hinter dem Steuer saß, starrte er das Telefon lange Zeit an. Dann wählte er eine Nummer. Es ertönten drei ansteigende Töne, gefolgt von der Durchsage, der Anschluss sei nicht länger vergeben.
Was wenig überraschend war, wenn man bedachte, dass die Nummer seiner Ex-Frau gehört hatte, der Belastungszeugin – genauer gesagt dem Opfer – in dem Fall, der zu seiner Verhaftung wegen Mordversuchs und Angriffs mit einer tödlichen Waffe geführt hatte, was aber mindestens als schwere Körperverletzung zu werten sei, wie es am Ende in der Anklageschrift hieß, und zwar mit einer Theatralik, die man in so einem Dokument gar nicht erwarten würde.
6
Colter Shaw näherte sich dem Gelände von Harmon Energietechnik und schaute zurück zum Ufer.
Abe Lincoln war verschwunden.
Ein dunkelgrauer Mercedes Metris näherte sich. Der Van hielt am Bordstein und ein schlanker Mann mit schwarzer Jacke und ebensolcher Hose stieg aus. Er hatte den Kragen aufgestellt und seine taktische Kleidung verfügte über zahlreiche Taschen. Seine Haut war kaum heller als der Stoff und sein Kopf war rasiert. In den dunklen polierten Schuhen hätte man sich spiegeln können.
Shaw blieb stehen und nickte Lenny Caster zu, dem Privatdetektiv, der ihm bei der Falle geholfen hatte.
»Lenny.«
»Colter. Alles klar?«
»Bis auf meinen Besucher.«
Caster war Shaw von der Fabrik aus gefolgt, nur für den Fall, dass die drei Männer die Täuschung bemerkt hätten und umgekehrt wären.
Wir sind nicht allein …
»Haben Sie ihn erwischt?«, fragte Shaw.
Caster nickte. »Die Fotos sind gut geworden. Hab sie gleich an Mack geschickt.«
Die Frau kannte ein paar erstklassige Fachleute für Gesichtserkennung.
Caster zückte sein Smartphone und las aus der Antwort vor: »›Sergej Lemerow. Früher beim GRU.‹«
Der militärische Nachrichtendienst Russlands.
»Ist mit einem Geschäftsvisum eingereist. Wurde wegen diverser Schweinereien aus Deutschland ausgewiesen. War mutmaßlich in die Ermordung eines Oligarchen in London und eines Aktivisten in Belarus verwickelt.«
Er blickte auf. »Näheres zu seinem Auftauchen ließ sich nicht ermitteln. Er kann in privatem Auftrag hier sein oder für die Regierung.«
»Sein bestes Angebot waren zweihunderttausend«, sagte Shaw.
»Peanuts«, stellte Caster fest.
Regierungsoperationen gingen zumeist mit einem ziemlich kleinen Budget einher. Würde ein kommerzieller Konkurrent die gestohlene S.N.A. erwerben wollen, wäre schon das Anfangsgebot deutlich sechsstellig gewesen.
»Mack hat gesagt, sie will versuchen, ihn im Auge zu behalten. Sobald sie etwas findet, schickt sie es direkt an Sie und Harmon.«
»Ich setze ihn in Kenntnis. Und unser Trio?« Er wies in Richtung der Fabrik.
Caster öffnete eine App auf seinem Telefon. »Die Saudis fahren auf der Fünfundfünfzig nach Norden. Wahrscheinlich zum Granton Executive Airport. Dort steht bestimmt eine aufgetankte G700 oder irgendwas anderes mit entsprechender Reichweite bereit. LeClaire hat erst seine Wohnung angesteuert, ist dann aber nach Süden abgebogen. Er fährt jetzt auf der Stadtumgehung.« Caster hatte in den Radkästen der Fahrzeuge jeweils einen Peilsender angebracht.
Die Männer reichten sich die Hand. »Das war eine angenehme Zusammenarbeit, Lenny. Sind Sie auch überregional tätig? Ich könnte hin und wieder etwas Unterstützung gebrauchen.«
»Ich bleibe meistens in der Gegend«, sagte Caster. »Bin hier geboren und aufgewachsen. Für das Basketballteam meines Sohnes und die Fußballmannschaft meiner Tochter mache ich den Trainer. Aber mal für ein, zwei Tage? Das ginge schon. Und wie ich Sie so einschätze, dürften Ihre Fälle ziemlich … interessant sein. Denken Sie ruhig an mich.«
»Werde ich.«
»Ach, und übrigens … was den Oligarchen und den Aktivisten angeht, die Lemerow beseitigt hat. Laut Mack wurden sie mit Polonium vergiftet. Das ist kein angenehmer Tod. Wenn ich Sie wäre, Colter, würde ich hier in der Stadt nichts trinken, dessen Flasche ich nicht eigenhändig geöffnet habe.«
7
Jon Merritt hatte seinen Arzttermin wahrgenommen und verließ das Gebäude der Trevor County Medical Services.
Ein nichtssagendes Haus in einem nichtssagenden Teil von Ferrington. Das dringend eine Renovierung und einen neuen Anstrich vertragen konnte. Es wirkte wie der minimal besser gestellte Cousin der Haftanstalt, nur dass es hier keinen Klingendraht auf der Umzäunung gab.
In dem Zentrum arbeiteten ungefähr vierzig Ärzte mit vielen verschiedenen Fachgebieten. Die Behandlungen hier umfassten alle möglichen Leiden, von Sehstörungen über Bauchschmerzen und Knochenbrüche bis hin zu Falten, sofern man die als Krankheit betrachtete.
Merritt stand vor der Liste der Praxen und bemerkte eines der größeren Schilder.
Psychiatrische Klinik Ferrington
Er dachte an einen Mediziner, mit dem er in letzter Zeit häufiger zu tun gehabt hatte, speziell an ihr erstes Zusammentreffen.
Der bieder aussehende Arzt von etwa vierzig Jahren trägt einen braunen Anzug. Keine Krawatte. Das steht bestimmt in irgendeinem Handbuch. Wegen des Strangulationsrisikos. Seine Schuhe sind Slipper, ohne Schnürsenkel. Sein Haar ähnelt dem seines Patienten – soll heißen, es ist irgendwie blond und nicht allzu üppig, höflich ausgedrückt.
Er riecht komisch. Merritt kann nicht genau sagen, wonach. Nun beugt Dr. Evans sich auf seinem Stuhl vor, genau gegenüber von Merritt. Er hat zuvor erklärt, er werde stets außerhalb von Merritts »persönlicher Distanzzone« bleiben.
Das ist wohl so eine Art Psychotrick, um zu demonstrieren, dass der Arzt dem Patienten zwar seine Aufmerksamkeit widmet, ihn aber nicht bedrängt.
Persönliche Distanzzone …
Merritt hätte einfach von »Freiraum« gesprochen, aber er hatte ja auch nicht Medizin studiert.
Der Abstand zwischen den beiden ist außerdem eine Sicherheitsmaßnahme, wenn man berücksichtigt, weswegen viele von Dr. Evans’ Patienten hier sind.
Mord.
Versuchter Mord.
Schwere Körperverletzung …
Der Raum hat wenig Ähnlichkeit mit einer herkömmlichen Therapeutenpraxis. Keine Couch, kein Lehnsessel, keine Box mit Taschentüchern, keine Diplome, keine gerahmten Fotos oder Poster, die gezielt dafür ausgewählt worden waren, den Patienten kein Unbehagen zu verursachen.
Der Arzt hält seine Notizen auf einem Tabletcomputer fest, er hat weder Kugelschreiber noch Bleistift dabei. Offenbar gab es vor ein paar Jahren einen Zwischenfall – wenngleich der Chirurg in der Notaufnahme ein Stück den Gang entlang es damals zum Glück geschafft hat, ein Auge des Psychiaters zu retten.
Neben Dr. Evans liegt ein drahtloser Alarmknopf auf dem Tisch. Allerdings kein roter. Merritt hat sich gefragt, wie viele Dämonen sich wohl auf ihn stürzen werden, falls der Doc draufdrückt.
Ist das schon jemals passiert?
»Lassen Sie uns einfach ein wenig plaudern, Jon, ja?« Der Mann ist nur halb anwesend. Abgelenkt.
Und was ist das für ein Geruch?
Merritt lächelt und ist kooperativ. »Klar, wieso nicht? Worüber denn?«
»Über alles Mögliche. Zum Beispiel darüber, wie Sie sich dabei fühlen, heute hier zu sein.«
Allen Ernstes?
Doch er lächelt weiter.
»Oder über Ihre Kindheit.«
»Oh, sicher.«
Merritt will es nur möglichst schnell hinter sich bringen und fängt an, weitschweifig von seiner Jugend in Ferrington zu erzählen. Gute und schlechte Anekdoten, traumatische und erbauliche Geschichten. Manche davon sind sogar wahr.
Er achtet jedoch genau darauf, was er sagt. Der neugierige Dr. Evans mag scharfsinniger sein, als er aussieht, und hält womöglich nach verräterischen Anzeichen Ausschau wie ein Gedankenleser auf dem Jahrmarkt. Und es gibt durchaus Geheimnisse, die Jon Merritt keineswegs preisgeben möchte.
Vor allem ein ganz bestimmtes Geheimnis.
Während er also drauflosplappert und einen großen, großen Bogen um jenes Geheimnis macht, fällt ihm auf, dass der Blick des Arztes durch den Raum schweift und immer wieder auf das Fenster fällt. Jenseits der dicken Scheibe liegt der Hof. Aber dies ist ein Gefängnis; es gibt hier keine schöne Aussicht.
Merritt fragt sich, ob die Geistesabwesenheit des Arztes wohl darauf beruht, dass der Mann angestrengt über all die Diagnosen und Behandlungspläne grübelt, um seinen inhaftierten Schützlingen bestmöglich helfen zu können.
Oder ob sie alle dem Kerl scheißegal sind und er sich gerade nach Patientinnen aus dem Garden District sehnt, nach ihren Hausfrauendepressionen oder Verklemmtheiten anstatt all der Soziopathen und Mörder.
Jon Merritt ließ das Ärztezentrum nun hinter sich zurück und stakste hastig über den Parkplatz. Er war einen Meter achtundachtzig groß und neigte dazu, vornübergebeugt zu gehen, wodurch er wie ein Raubtier auf Beutefang wirkte. Dann stieg er in seinen großen Ford. Zwanzig Minuten später fuhr er durch eine Einkaufsstraße südlich der Innenstadt.
In dieser Gegend kannte er sich gut aus, hatte früher viel Zeit hier verbracht. Hier wurden Finger- und Zehennägel in kleine Kunstwerke verwandelt, Autos repariert, Haare verlängert oder kahle Stellen kaschiert. In den Läden gab es elektronische Geräte, Spielwaren, diversen Kleinkram, Wegwerftelefone, gebrauchte Möbel sowie Haushaltstechnik aller Arten und Größen, zumeist von Billigmarken mit kurzer Lebensspanne.
Man konnte sich für ein oder zwei Stunden außerdem ein Mädchen, einen Jungen oder eine Mischung aus beidem mieten. Auch solche Dienstleistungen hatte Merritt bereits in Anspruch genommen.
Er fuhr in Richtung des Flusses, bis er das River View Motel erreichte, eine für Ferrington typische Absteige – ebenerdig, pastellfarben, dringend renovierungsbedürftig, die Neonreklamen teils schadhaft, die Stellplätze voller Unkraut. Und die Münzautomaten waren kugelsicher.
Das Motel wurde immerhin seinem Namen gerecht, zumindest von einigen der Zimmer aus, und auch die Lobby bot einen Ausblick auf ein zugewuchertes Stück Stadtpark, das abschüssig zum Wasser hin verlief. Sonderlich anziehend wirkte das Ganze jedoch nicht, vor allem, wenn dann noch der Geruch hinzukam.
Merritt nahm sich ein Zimmer, dämmrig und beengt, verstaute dort seine Habseligkeiten, zog die Vorhänge zu und schaltete den Fernseher ein, damit es wirkte, als wäre jemand anwesend. Dann verließ er den Raum, hängte das Bitte-nicht-stören-Schild an den Türknauf und ging zu einem Mini-Markt, der ihm auf der Fahrt hierher aufgefallen war. Dort kaufte er ein paar Toilettenartikel, zwei belegte Baguettebrötchen, Sodawasser und Barbecue Chips.
Danach steuerte er sein wichtigstes Ziel an: ein Spirituosengeschäft.
Drinnen roch es auf charakteristische Weise süßlich, so wie in jedem der vielen, vielen Alkoholläden, die Merritt in seinem Leben kennengelernt hatte. Ging gelegentlich eine der Flaschen zu Bruch? Oder war das der Klebstoff, mit dem die Etiketten auf dem Glas befestigt wurden? Womöglich auch die Kartons.
Merritts Herz jedenfalls tat einen kleinen Hüpfer, als ihm der Duft in die Nase stieg und er die Regale voller Flaschen sah.
Seine Freunde.
Er entschied sich für eine Dreiviertelliterflasche Bulleit Bourbon. Der Verkäufer, ein dürrer Mann undefinierbarer Abstammung, wirkte kurz überrascht. In dieser Gegend gingen wahrscheinlich eher kleinere Mengen über den Ladentisch, wie auch das Inventar sie größtenteils widerspiegelte: halbe Liter, Viertelliter oder gar Miniaturflaschen. Zudem war es vermutlich Monate her, dass jemand eine so teure Marke gewählt hatte.
Merritts letzter Bulleit? Am Tag seiner Verurteilung. Sein Anwalt war angesichts des betrunkenen Mandanten alles andere als begeistert gewesen. Der Richter auch nicht.
Auf dem Rückweg zum Motel nahm er nun links von sich eine Bewegung wahr. Merritt blieb stehen und beobachtete, wie ein langer rostiger Frachtkahn mit verblichenem grünen Anstrich von einem Schleppboot nach Westen gezogen wurde. Die Ladung bestand aus Frachtcontainern, hauptsächlich himmelblau und von Maersk. Heutzutage war Ferrington nur noch ein Punkt auf der Landkarte, eine Zwischenstation auf der Ost-West-Route. Früher hatten hier täglich Dutzende Schiffe angelegt, um von Hafenarbeitern entladen und mit neuer Fracht beschickt zu werden. Meistens wurden Eisenbarren angeliefert und fertige Metallprodukte abtransportiert. Und jedes Schulkind hier wusste damals, dass sogar der Name der Stadt sich von Fe ableitete, dem chemischen Symbol für Eisen.
Der Kahn verschwand nun außer Sicht und Merritt kehrte zu seinem Zimmer zurück. Innen legte er die Kette vor und klemmte einen Stuhl unter den Türknauf. Einbrüche waren hier keine Seltenheit. Er schaltete die Klimaanlage ein. Dann stellte er die Lebensmittel und den Bourbon auf dem Nachttisch ab. Er setzte sich aufs Bett und schlang das verspätete Mittagessen hungrig herunter. Auf jeden Bissen folgte ein Schluck.
Dann lehnte er sich zurück und schloss die Augen. In seinem Magen rumorte es.
Vielleicht hätte er es lieber etwas langsamer angehen sollen.
Dann wurde ihm schlagartig übel.
Merritt sprang auf, lief ins Bad, fiel auf die Knie und übergab sich heftig in die Toilettenschüssel.
Er spülte sich den Mund aus, ging zurück zum Bett und legte sich diesmal ausgestreckt hin. Nach einer Weile setzte er sich auf, zog den Rucksack zu sich heran und nahm die beiden Umschläge heraus, die der Wärter ihm gegeben hatte.
Einer enthielt die Entlassungspapiere. Nichts von Interesse. Jede Menge Verhaltensvorschriften und Juristenlatein. Merritt öffnete den zweiten Umschlag und zog vier zusammengeheftete Seiten heraus. Er las sie gründlich, steckte sie zurück in den Umschlag und diesen dann in den Rucksack.
Jon Merritt leerte sein Glas, schaltete abermals vorsorglich den Fernseher ein, ging hinaus und schloss ab. Dann nahm er sein Telefon und wählte eine Nummer. Es überraschte ihn, dass er sie immer noch auswendig wusste.
8
VIER TAGE ZUVOR …
Ich habe ein Problem. Ein gravierendes. Ich brauche Hilfe.«
Der Mann war klein und stämmig, sein Haar braun gelockt. Er trug eine sandfarbene Stoffhose und dazu ein blaues Anzughemd, jedoch ohne Krawatte und mit hochgekrempelten Ärmeln. Hinter der Tür des Büros, in dem er und Colter Shaw saßen, hing ein schwarz-weiß kariertes Sakko ohne Bügel an einem Haken. Die Joggingschuhe des Mittvierzigers leuchteten orangefarben.
Shaw kannte Marty Harmon erst seit wenigen Minuten und hatte ihn doch schon als jovial, gereizt und hoch konzentriert erlebt. Die Übergänge waren fließend.
Sie musterten einander über einen verschrammten Schreibtisch voller Akten hinweg.
»Und Sie sind so etwas wie ein Privatdetektiv?«
Shaw umriss seine Tätigkeit.
Harmon nickte interessiert. »Prämiensuche … das höre ich zum ersten Mal.«
Colter Shaw war allerdings nicht in seiner üblichen Funktion hier, sondern um eventuell eine andere Art Auftrag zu übernehmen. Ein Freund – Tom Pepper, ehemals FBI-Agent – hatte ihn angerufen und erklärt, der Leiter eines Regionalbüros des FBI im Mittleren Westen habe sich außerstande gesehen, in einem bestimmten Fall zu ermitteln. Ob womöglich Colter daran interessiert sei?
Da gerade keine Prämienjagd anstand, hatte Shaw sich gedacht: Wieso nicht?
Harmon stand nun auf, ging zu einer Weißwandtafel, nahm einen Stift und fing an zu zeichnen. »Zunächst was zum Hintergrund.«
Shaw hörte interessiert zu und erhielt Einblick in ein ihm bislang völlig fremdes Gebiet: Es gab tatsächlich so etwas wie Miniaturkernkraftwerke.
Die offizielle Bezeichnung lautete SMR für »Small Modular Reactor«, also kleiner modularer Reaktor.
Das Adjektiv war dabei ein wenig irreführend, denn ein durchschnittlicher SMR wog ungefähr sechzig Tonnen, wie es schien. Es handelte sich aber um komplett vorgefertigte Anlagen, die am Stück zu ihrem jeweiligen Zielort transportiert werden konnten und dort binnen kurzer Zeit einsatzbereit waren.
Harmon Energietechnik hatte sich für sein Modell den cleveren Markennamen »Taschensonne« ausgedacht.
Der Mann zeichnete derweil immer weiter. Es entstand ein Schnittbild eines solchen Reaktors.
Shaw saß auf einem Lehnsessel, der schon bessere Tage gesehen hatte. Die Federn waren ausgeleiert, das Leder rissig und an den Armlehnen und der Sitzfläche abgewetzt. Es gab auch eine Couch, halb bedeckt mit Papieren und diversen Gegenständen, darunter Metallteile, Kabel und bestückte Platinen. Das hier war nicht das schicke Vorzeigebüro eines Start-ups im Silicon Valley, sondern die funktionale Kommandozentrale eines hart arbeitenden Unternehmers an der Spitze eines Betriebs der produzierenden Industrie.
Der einzige Zierrat hier waren ein Foto des Mannes und seiner etwa gleichaltrigen dunkelhaarigen Frau sowie ein großes Poster des Periodensystems der Elemente. In dessen unterster Reihe hatte jemand um eine der Substanzen ein leuchtend rotes Herz gemalt. Es war der Buchstabe U.
Uran.
Das Poster war außerdem von zahlreichen Leuten unterschrieben worden, wahrscheinlich den Angestellten. Es stand vermutlich für irgendein bedeutendes Ereignis der Firmengeschichte.
An den Wänden hingen weder Diplome noch Bescheinigungen oder Urkunden, die Rückschlüsse auf den Lebenslauf des Chefs zugelassen hätten. Dank seiner Ermittlerin wusste Shaw jedoch in groben Zügen Bescheid. Harmon hatte an einer kleineren staatlichen Universität einen Abschluss in Ingenieurwesen erworben und bereits mehrere Firmen gegründet, geleitet und wieder verkauft – auf dem Niedrigtechnologiesektor. Vorwiegend in der Energiebranche, teils auch mit dem Schwerpunkt Infrastruktur. Der Mann hielt Abstand zur Presse und hatte einst zu einem Reporter gesagt, er habe keine Zeit für dieses »Zeug« – wobei er einen etwas schrofferen Begriff verwendete. Dennoch hatte Mack ein paar Artikel über ihn gefunden, die ihn als Workaholic und kompromisslosen Wegbereiter und Geschäftsmann darstellten. Er besaß ein Dutzend eigener Patente für technische Konstruktionen, deren Funktion sich Shaw auch nach Macks Bericht nicht erschloss.
Harmon zeichnete weiter und setzte den Vortrag fort. »So, Mr. Shaw, und nun stellen Sie sich mal die Möglichkeiten vor! Mit unseren SMRs können Entwicklungsländer zuverlässig ihre Kältetechnik betreiben, ihre Beleuchtung, ihr Telefonnetz … Und natürlich ihre Computer! Das Internet. Ihr Gesundheitswesen. In Schwarzafrika leben manche Völker noch im neunzehnten Jahrhundert und die Taschensonnen können sie in die Moderne transportieren. Vorurteile und idiotische Ideen – über Hautfarben, Aids, Covid oder Geschlechtskrankheiten – existieren nur im Vakuum der Unwissenheit. Gibt man den Menschen zuverlässige Energiequellen, geht ihnen nicht nur im wörtlichen, sondern auch im übertragenen Sinn ein Licht auf.«
Eine Art Verkaufspräsentation, aber gar nicht mal so schlecht.
»Es gibt unbestreitbar ein Problem«, sagte Harmon und wandte sich von der Tafel ab. »Die Kernkraftbranche redet nicht gern darüber, aber jemand könnte den Brennstoff stehlen und als Waffe benutzen. Man nennt das auch ›Proliferation‹. Klingt irgendwie harmlos und sauber, nicht wahr?«
Da SMRs wie die Taschensonnen häufig in Ländern aufgestellt wurden, in denen es weniger Schutzmaßnahmen und Sicherheitspersonal gab, bestand das Risiko, dass jemand sich an dem Uran vergriff oder sogar die gesamte Anlage in seinen Besitz brachte.
Die Taschensonnen liefen mit dem gleichen Treibstoff wie die meisten Reaktoren – U-235, angereichert auf ungefähr fünf Prozent, gemäß den behördlichen Vorgaben. »Um daraus eine Bombe zu bauen, bräuchte man eine Menge von der Größe eines ausgewachsenen Elefanten«, sagte Harmon. »Aber reichert man es auf fünfundvierzig Prozent an, benötigt man nur noch sechsunddreißig Kilo. Das entspricht der Größe eines Schäferhundes. Sehen Sie.« Er kratzte sich an der Nase und deutete auf sein Schaubild, das wie eine Glasglocke aussah, in der es mehrere Gruppen schmaler vertikaler Röhren gab, die jeweils in einem kleinen Kasten endeten. Auf einen davon zeigte er nun. »Das ist die S.N.A. oder ›Sicherheitsnotabschaltung‹, eine Idee meiner brillantesten Ingenieurin. Falls jemand unbefugt eine Taschensonne bewegt oder versucht, die Brennkammer zu öffnen, werden die Uranpellets durch die S.N.A. pulverisiert und mit einer Substanz geflutet, die ich entwickelt habe, ein mesoporöses Nanomaterial. Es verbindet sich mit dem Uran und macht es für die Nutzung als Waffe unbrauchbar. Kein anderer SMR-Hersteller hat etwas Vergleichbares zu bieten.«
Die joviale Miene verschwand jäh und Harmons andere, verärgerte Seite kam zum Vorschein.
Er beugte sich ein Stück vor und bekräftigte die folgenden Worte mit ausgestrecktem Zeigefinger. »Wir überprüfen stichprobenartig unsere Bestände. Vor einigen Tagen wurde festgestellt, dass einige Teile verschwunden sind, außerdem etwas von dem mesoporösen Material. Jemand hier baut eine eigene S.N.A., wahrscheinlich, um sie an die Konkurrenz zu verkaufen. Der- oder diejenige muss aufgehalten werden. Agent Pepper hat gesagt, Sie wären für so etwas der geeignete Kandidat. Zwanzigtausend, wenn Sie die Person erwischen und das Gerät sicherstellen, Mr. Shaw. Plus Spesen.«
Shaw überlegte. »Sie befürchten, es geht um einen Rivalen aus Übersee. Einen einheimischen Mitbewerber könnten Sie einfach wegen des Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen und Patentverletzung verklagen. Mit einem guten Anwalt könnten Sie sogar bewirken, dass der andere Betrieb dichtgemacht wird.«
Shaw hatte nach dem College für eine Weile in einer kalifornischen Anwaltskanzlei gearbeitet. Er mochte die intellektuelle Herausforderung des Juristenberufs, hatte letztlich aber erkannt, dass ein Bürojob nicht das Richtige für jemanden war, dessen Spitzname »der Rastlose« lautete.
»Ganz genau«, bestätigte Harmon. »Ich kenne die Konkurrenten hier in den Staaten. Die sind es nicht. Wissen Sie, wir sind ein kleiner Laden, ohne große Ressourcen. Die S.N.A. ist einer der wenigen Punkte, die uns von den Mitbewerbern unterscheiden. Und ein gewaltiges Verkaufsargument. Falls jemand anders sie in die Finger bekommt und unseren Preis unterbietet, sind wir weg vom Fenster. Und ich bin der einzige Hersteller, der Anlagen in die Dritte Welt liefern will. Okay, machen wir uns nichts vor. Ich will dabei natürlich auch Geld verdienen. Heutzutage entschuldigen sich zu viele Leute für den Kapitalismus. Schwachsinn. Ich erziele Gewinne, investiere sie in mein nächstes großes Projekt, schaffe Arbeitsplätze, stelle Produkte her, die den Menschen …« Er hielt inne und winkte ab, als ginge der Vortrag sogar ihm selbst auf die Nerven.
»Tom Pepper hat gesagt, das FBI hier vor Ort könne sich nicht darum kümmern.«
Harmon verzog das Gesicht. »Die ersticken in Arbeit. Und die hiesige Polizei hat kürzlich ihr Personal halbiert. Ich habe mit einer großzügigen Spende für deren Unterstützungsfonds gewunken. Aber die sind mit all den Drogen, Morden und Fällen von häuslicher Gewalt schon mehr als ausgelastet. Ein verschwundenes technisches Gerät taucht nicht mal auf deren Radar auf.«
»Ich übernehme den Auftrag«, sagte Shaw.
Der Mann trat vor und drückte ihm die Hand, und zwar überraschend kräftig, trotz der geringen Körpergröße.
Dann kehrte Harmon an seinen Schreibtisch zurück und bat per Telefon zwei Leute zu sich ins Büro.
Nach höchstens fünf Sekunden öffnete sich die Tür und eine hochgewachsene Frau trat ein. Ihr langes schwarzes Haar war im Nacken mit einem blauen Tuch zusammengefasst, das farblich zu ihrem sachlichen Brillengestell passte. Hohe Wangenknochen, volle Lippen. Sie trug ein maßgeschneidertes Kostüm. Shaw fragte sich, ob sie wohl mal als Mannequin gearbeitet hatte.
Harmon stellte ihn nun seiner Assistentin vor, Marianne Keller. »Mr. Shaw wird uns bei der Notabschaltung zur Hand gehen.«
»Ah, sehr gut, Marty.« Sie atmete erleichtert auf. Shaw nahm an, dass in einer Firma wie dieser ein großes, nahezu familiäres Zusammengehörigkeitsgefühl herrschte und ein Verrat allen zu schaffen machte.
»Seine Spesen sind hiermit unbegrenzt genehmigt.« Dann runzelte Harmon die Stirn. »Aber bitte keine Privatjets, ja?«
»Kein Thema«, versicherte Shaw.
»Jawohl, Sir«, bestätigte Keller. Shaw reichte ihr eine Visitenkarte, auf der nur sein Name und die Nummer seines aktuellen Wegwerftelefons stand. Und er notierte sich ihre Durchwahl.
Als sie den Raum verließ, kam eine andere Frau herein, ebenso groß wie Keller, aber blond, mit sorgsam geflochtenem und am Hinterkopf festgestecktem Haar. Auch sie war auffallend hübsch. Angesichts ihrer sportlichen Figur konnte sie durchaus eine Marathonläuferin sein.
Wie es schien, war Sonja Nilsson die Sicherheitschefin von Harmon Energietechnik.
»Mr. Shaw«, sagte sie und drückte ihm ebenfalls fest die Hand. »Freut mich, Sie kennenzulernen.«
Er hatte mit einem Akzent gerechnet und bekam tatsächlich einen zu hören. Allerdings keinen aus Stockholm, sondern eher aus der Gegend von Birmingham, Alabama.
»Colter«, bot er an.
»Marty hat mir von Ihnen erzählt«, sagte sie. »Ich habe ein paar Nachforschungen angestellt. Sie verdienen Ihren Lebensunterhalt mit Prämien?«
»Ja, ich bekomme nur im Erfolgsfall Geld.«
Die Frau saß kerzengerade da und bewegte ihre Hände und Arme nur sparsam, hielt zwar ein Tablet, fummelte aber nicht daran herum. Sie trug eine komplizierte analoge Armbanduhr und keinen Schmuck außer einem Ring am rechten Zeigefinger. Anscheinend in Schlangenform; er konnte es nicht genau erkennen. Und Shaw gelangte zu einer weiteren Schlussfolgerung: Sie war eine Veteranin mit Kampferfahrung. Ihr Blick – aus grünen Augen, was selten war – blieb absolut ruhig.
»Ich bin auf der Suche nach dem Dieb so weit gegangen, wie ich konnte«, sagte Nilsson. »Ohne Erfolg. Wir brauchen einen neuen Ansatz.«
Shaw klappte ein Notizbuch auf, dreizehn mal achtzehn Zentimeter, und zog seinen Füllfederhalter aus der Jackentasche, einen schwarzen Delta Titanio Galassia mit drei orangefarbenen Ringen zur Spitze hin. Er wusste, dass manche Leute ein solch teures Schreibgerät für prätentiös halten würden, aber Shaw musste sich während seiner Arbeit oft umfangreiche Notizen machen, und eine hochwertige Feder war nun mal sanfter zu seiner Hand als ein Kugelschreiber. Außerdem machte das Schreiben ihm so mehr Freude.
Während die Frau nun schilderte, was im Einzelnen vorgefallen war, hielt Shaw die Angaben in seiner präzisen Handschrift fest, perfekt waagerecht, trotz des unlinierten Papiers. Diese Fähigkeit hatte er nicht erlernt, sondern schlicht von seinem Vater geerbt. Sie waren beide Kalligrafen und Künstler.
Als er der Ansicht war, vorläufig genug erfahren zu haben, sagte er: »Ich möchte gern sehen, wann die RFID-Dienstausweise der Mitarbeiter jeweils vom Zeiterfassungssystem registriert worden sind. Und die Aufnahmen der Überwachungskameras.«
»Das habe ich alles schon zusammengestellt«, sagte Nilsson.
Sie standen auf und reichten sich erneut die Hände. Harmon bedankte sich überschwänglich. Shaw nahm es mit einem Nicken zur Kenntnis und hoffte, dass der Mann ihn nicht auch noch umarmen wollte.
9
Seltsamerweise war Sonja Nilssons Büro nicht nur größer, sondern auch hochwertiger eingerichtet als das Büro ihres Chefs. Und es gab etwas Wandschmuck, vornehmlich Landschaftsfotos. Shaw fragte sich, ob die Frau sie wohl selbst geschossen hatte.
Sie saßen auf einem Sofa an einem langen gläsernen Couchtisch, auf dem ordentlich gestapelte braune Dokumentenmappen lagen, und gingen gemeinsam die Personalakten sowie die Daten der digitalen Zeiterfassung durch. Shaw machte sich dabei einige Notizen. Nilsson legte einen Laptop auf die Akten, schaltete ihn ein und legitimierte sich sowohl mit ihrem Fingerabdruck als auch mit einem Passwort. Dann öffnete sie auf dem Gerät die Aufzeichnungen der Überwachungskameras in den Gängen des Gebäudeteils, in dem die S.N.A.-Komponenten gelagert wurden. Auch mit schnellem Vorlauf dauerte die Sichtung eine gute Stunde.
»Noch mal«, sagte Shaw, kaum dass sie fertig waren.
Und auf halber Strecke dieses zweiten Durchgangs entdeckte Shaw die Fliege.
Er spulte zurück und sah sich die Stelle ein weiteres Mal an.
»Schauen Sie.«
Das Video zeigte den Zugangskorridor der fraglichen Abteilung. Zwischen dem Feierabend um siebzehn Uhr dreißig und dem Arbeitsbeginn am nächsten Morgen um acht sah man niemanden kommen oder gehen.
Er stoppte das Bild und zeigte auf das Insekt an der Wand.
»Okay, ich sehe das kleine Viech«, sagte Nilsson.
»Und nun der nächste Tag.«
Er spulte bis zu dem Timecode vor, den er sich gemerkt hatte.
Dieselbe Fliege landete an derselben Stelle.
»Oh, Mist«, flüsterte Nilsson.
Jemand hatte einen Abschnitt der Überwachungsvideos mit einer älteren Aufnahme überspielt. Auf diese Weise konnte der Dieb sich an zwei Abenden unbeobachtet dort bewegen.
Wer auch immer dahintersteckte, verfügte über profundes technisches Wissen. Shaw war sich sicher, dass auch die Zugangsprotokolle der betreffenden Räume geändert worden waren. Ebenso die RFID-Informationen über das Betreten und Verlassen des Gebäudes.
»Das ist ein ziemlich gründlicher Hack«, stellte er fest. »Konzentrieren wir uns auf Ihre IT-Leute.«
Dann schlug er eine verdeckte Ermittlung vor. Marianne Keller setzte eine Reihe von Mitarbeitergesprächen zwischen der IT-Abteilung und einem von Harmon beauftragten externen Berater an, vermeintlich wegen der geplanten Eröffnung einer Unternehmensfiliale an der Westküste. Shaw schlüpfte in den einzigen Geschäftsanzug, der in seinem Winnebago hing, und damit in die Rolle von Carter Stone, inklusive einer Brille mit Fensterglas.
»Sehe ich seriös genug aus?«, fragte er Nilsson.
»Wie die geborene mittlere Führungskraft«, erwiderte sie.
Er saß also in einem schmucklosen Büro, vor sich einen großen Schreibblock, und die Angestellten kamen einer nach dem anderen zu ihm. Shaw erwähnte zunächst nichts von der geplanten Zweigstelle, sondern ließ die Leute einige Minuten lang absichtlich über seine Rolle im Unklaren. Derweil erkundigte er sich nach ihrer beruflichen Laufbahn einschließlich früherer Arbeitgeber und ihrer aktuellen Zufriedenheit. Nur wenn er Argwohn spürte, brachte er die angebliche Filiale zur Sprache. Er notierte sich die Antworten, bedankte sich und rief dann die nächste Person herein.
Während der ganzen Zeit achtete er auf die Reaktionen seiner Gegenüber.
Ein Mann fühlte sich sichtlich unwohl, mit eindeutiger Körpersprache: Schuldgefühle und Angst. Shaw kam sofort auf die Zweigstelle zu sprechen und Paul LeClaire beruhigte sich schnell. Dann führte »Carter Stone« das Gespräch zu Ende und schickte den Mann mit professionellem Lächeln und festem Handschlag seiner Wege.
Er verständigte Nilsson. »Wir haben ihn. Nun müssen wir noch die Notabschaltung finden.«
»Indem wir ihn beschatten«, sagte sie.
»Ganz genau.«
Im Verlauf der folgenden beiden Tage überwachten sie LeClaire, belauschten im Gebäude seine Gespräche und lasen alle seine E-Mails, was laut seinem Arbeitsvertrag gestattet war. Auch sein Smartphone wurde von der Firma gestellt, doch sie konnten es nur anpeilen, nicht abhören.
Shaw und Nilsson folgten ihm auch zu Treffen mit zwei Unbekannten in einem Motel außerhalb der Stadt. Dank eines Richtmikrofons erfuhren sie die Namen der Männer: Ahmad und Rass, Geschäftsleute aus Saudi-Arabien, tätig in der Energiebranche. Und sie wussten nun, wann und wo die Übergabe stattfinden sollte: in einer verlassenen Fabrik am Kenoah River.
Daraufhin setzten Sonja Nilsson und Shaw ihren Chef in Kenntnis. Marty Harmon war gleichermaßen bestürzt und verärgert. »Paul? Im Ernst? Der kann sich über sein Gehalt doch nun wirklich nicht beklagen … Verdammt! Aber wie dem auch sei, wir haben einen Namen, und Sie haben die nötigen Beweise gesammelt. Nun müssen das FBI und die Polizei tätig werden.«
»Sind Sie sicher, dass Sie das wollen?«, fragte Shaw.
»Ich verstehe nicht ganz.«
»Colter und ich haben das besprochen«, sagte Nilsson.
Shaw übernahm und legte den Plan dar. »Ich glaube, wir sollten die echte S.N.A. gegen eine Kopie mit GPS-Chip austauschen.«
Nilsson nickte. »Wir lassen das Treffen stattfinden, und der Peilsender wird uns am Ende verraten, wer der eigentliche Käufer ist.«