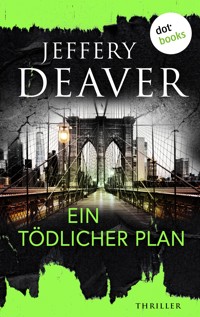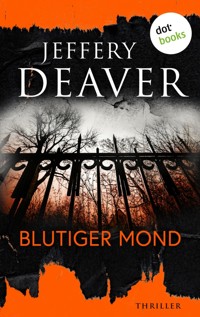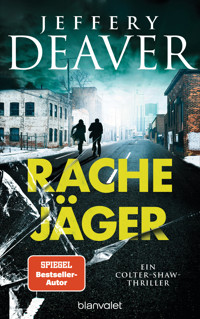3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein atemberaubendes Duell auf Leben und Tod
Sein Name ist Corte, und er ist ein »Hirte«. Im Auftrag des Staates übernimmt er die Fälle, bei denen normale Bodyguards nichts ausrichten können. Als er erfährt, dass die Familie Kessler von Henry Loving – einem berüchtigten Entführer und Folterer – bedroht wird, ist er sofort bereit, ihren Schutz zu übernehmen. Zwischen Corte und Loving ist noch eine alte Rechnung offen. Um den Kesslers wirklichen Schutz bieten zu können, muss Corte allerdings erst einmal herausfinden, worauf Loving es eigentlich abgesehen hat. Denn in dieser Familie ist niemand, was er auf den ersten Blick zu sein scheint …
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 633
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Buch
Sein Name ist Corte, und er ist ein »Schäfer«. Seine Arbeit unterliegt der höchsten Geheimhaltungsstufe. Er ist verantwortlich für die Sicherheit von Kronzeugen und anderen, denen große Gefahr droht – eine Gefahr, vor der gewöhnliche Bodyguards sie nicht schützen könnten.
Als er erfährt, dass die Familie Kessler von Henry Loving – einem berüchtigten Entführer und Folterer – bedroht wird, ist er sofort bereit, den Auftrag zu übernehmen. Aber Corte handelt nicht nur aus beruflichen Gründen, sondern verfolgt auch ganz persönliche Interessen. Denn zwischen ihm und Loving ist noch eine alte Rechnung offen, die seit sechs Jahren darauf wartet, beglichen zu werden.
Um die Kesslers beschützen zu können, muss Corte jedoch erst einmal herausfinden, worauf Loving es wirklich abgesehen hat. Denn in dieser Familie ist keiner, was er auf den ersten Blick zu sein scheint …
Autor
Jeffery Deaver gilt als einer der weltweit besten Autoren intelligenter psychologischer Thriller. Seit seinem ersten großen Erfolg als Schriftsteller hat er sich aus seinem Beruf als Rechtsanwalt zurückgezogen und lebt nun abwechselnd in Virginia und Kalifornien. Seine Bücher wurden in 25 Sprachen übersetzt und haben ihm bereits zahlreiche renommierte Auszeichnungen eingebracht.
Inhaltsverzeichnis
Für Shea, Sabrina und Brynn
Juni 2004
DIE SPIELREGELN
Der Mann, der die junge Frau auf dem Beifahrersitz neben mir töten wollte, befand sich gut eine Meile hinter uns, während wir an diesem schwülen Vormittag durch eine idyllische Landschaft mit Tabak- und Baumwollfeldern fuhren.
Ein Blick in den Rückspiegel zeigte eine Teilansicht des Wagens, der ohne Hast im Verkehr mitschwamm, gesteuert von einem Mann, der sich in seinem Aussehen kaum von hundert anderen Fahrern auf diesem kürzlich neu asphaltierten, geteilten Highway unterschied.
»Officer Fallow?«, begann Alissa, ehe ihr einfiel, wozu ich sie seit einer Woche bereits drängte: »Abe?«
»Ja.«
»Ist er noch da?« Sie hatte meinen Blick bemerkt.
»Ja. Genau wie unser Mann, der ihn beschattet.« Mein Lieblingsschüler war zwei, drei Wagenlängen hinter dem Killer. Und er war nicht der Einzige aus unserer Organisation, der im Einsatz war.
»Okay«, flüsterte Alissa. Die Mittdreißigerin war Zeugin gegen ein Unternehmen, das im Regierungsauftrag viel Arbeit für die Armee erledigte. Die Firma beharrte darauf, nichts falsch gemacht zu haben, und begrüßte offiziell eine Untersuchung. Doch vor einer Woche hatte es einen Anschlag auf Alissas Leben gegeben, und nachdem ich mit einem hochrangigen Kommandeur von Fort Bragg zusammen in der Armee gewesen war, hatte mich das Verteidigungsministerium zu ihrem Schutz angefordert. Als Chef der Organisation mache ich nicht mehr viele Außeneinsätze, aber ehrlich gesagt war ich froh, einmal rauszukommen. Mein typischer Arbeitstag bestand aus zehn Stunden Schreibtischtätigkeit in meinem Büro in Alexandria. Und im letzten Monat waren es eher zwölf oder vierzehn gewesen, da wir den Schutz von fünf hochkarätigen Informanten koordinierten, die in Prozessen gegen das organisierte Verbrechen aussagten, ehe wir sie in das Zeugenschutzprogramm entließen.
Es tat gut, mal wieder im Sattel zu sitzen, und sei es auch nur für rund eine Woche.
Ich drückte eine Kurzwahltaste und rief meinen Ziehsohn an. »Wo ist er jetzt?«
»Sagen wir eine halbe Meile hinter euch. Er kommt langsam näher.«
Der Killer, dessen Identität wir nicht kannten, fuhr einen unauffälligen grauen Hyundai.
Ich folgte einem Siebeneinhalbtonner, auf dessen Seitenwänden Geflügelverarbeitung Carolina aufgemalt war. Er war leer und wurde von einem unserer Fahrer gesteuert. Vor ihm fuhr ein Wagen, der mit meinem identisch war.
»Wir haben noch etwa zwei Meilen bis zum Tausch«, sagte ich.
Vier Stimmen bestätigten es über vier verschlüsselte Funkgeräte.
Ich löste die Verbindung.
»Alles wird gut«, sagte ich zu Alissa, ohne sie anzusehen.
»Ich bin nur …«, sagte sie im Flüsterton. »Ach, ich weiß nicht.« Sie verstummte und blickte in den Außenspiegel, als wäre der Mann, der sie töten wollte, direkt hinter uns.
Wenn sich unschuldige Menschen in Situationen wiederfinden, in denen sie von Leuten wie mir beschützt werden müssen, reagieren sie meist mit ebenso viel Verwunderung wie Angst. Die eigene Sterblichkeit ist schwer zu verarbeiten.
Doch für Sicherheit zu sorgen und Menschen am Leben zu erhalten ist ein Geschäft wie jedes andere. Das habe ich meinem Ziehsohn und den anderen in der Dienststelle immer wieder gesagt und sie wahrscheinlich maßlos genervt damit. Aber ich habe es beharrlich wiederholt, weil man es nie vergessen darf. Es ist ein Geschäft mit starren Arbeitsabläufen, die wir so studieren, wie ein Chirurg lernt, präzise in Fleisch zu schneiden, wie ein Pilot lernt, Tonnen von Metall sicher in der Luft zu halten. Diese Techniken wurden über die Jahre immer weiter verfeinert, und sie funktionieren.
Geschäft …
Natürlich stimmte es auch, dass der Auftragskiller, der in diesem Moment hinter uns fuhr und fest entschlossen war, die Frau neben mir zu töten, aus seiner Sicht ebenfalls nur einem Geschäft nachging. Es war ihm so ernst wie mir, er hatte genauso sorgfältig seine Verfahrensweisen studiert wie ich die meinen, er war schlau, lebensklug und gerissen, und er hatte mir gegenüber einen Vorteil: Seine Regeln unterlagen nicht denselben Beschränkungen wie meine – etwa der Verfassung und den Gesetzen.
Dennoch bin ich davon überzeugt, dass es ein Vorteil ist, im Recht zu sein. In all den Jahren meiner Tätigkeit habe ich nicht einen Mandanten verloren. Und ich hatte nicht vor, Alissa zu verlieren.
Ein Geschäft … Was bedeutete, ruhig wie ein Chirurg, wie ein Pilot zu bleiben.
Natürlich war Alissa nicht ruhig. Sie atmete schwer und nestelte an ihrem Ärmel herum, während wir an einer wild wuchernden Magnolie vorbeifuhren, dann an einem Walnuss- oder Kastanienwald, der wiederum an ein riesiges Baumwollfeld mit prallen Büscheln grenzte. Sie drehte unruhig ein dünnes Diamantenkettchen an ihrem Handgelenk, das sie sich selbst zu einem ihrer letzten Geburtstage geschenkt hatte, blickte auf den Schmuck und dann auf ihre schwitzenden Handflächen. Sie legte die Hände auf ihren dunkelblauen Rock. Unter meiner Obhut hatte Alissa ausschließlich dunkle Sachen getragen. Es war eine Tarnung, aber nicht, weil sie das Ziel eines Profikillers war; es ging um ihr Gewicht, mit dem sie seit ihrer Pubertät zu kämpfen hatte. Ich wusste das, weil wir gemeinsam die Mahlzeiten einnahmen und ich den Kampf aus der Nähe beobachten konnte. Sie hatte außerdem ziemlich viel über ihre Gewichtsprobleme gesprochen. Manche Mandanten brauchen oder wollen keine Kameradschaft. Für andere wie Alissa müssen wir Freunde sein. Ich bin nicht sehr gut in dieser Rolle, aber ich gebe mir Mühe, und im Allgemeinen kriege ich es hin.
Wir kamen an einem Schild vorbei. Noch eineinhalb Meilen bis zur Ausfahrt.
Ein Geschäft erfordert einfache, kluge Planung. Man darf bei so einer Tätigkeit nicht nur reagieren, und obwohl ich das Wort »proaktiv« hasse (im Gegensatz wozu? – »antiaktiv«?), ist die Idee dahinter von entscheidender Bedeutung für unser Handeln. Das in diesem Fall darin bestand, Alissa gesund und wohlbehalten beim Staatsanwalt abzuliefern, damit sie ihre Aussagen machen konnte. Ich musste den Killer im Spiel lassen. Da ihm mein geschäftlicher Ziehsohn seit Stunden folgte, wussten wir, wo er war, und hätten ihn jederzeit ausschalten können. Aber in diesem Fall hätte sein unbekannter Auftraggeber schlicht jemand anderen für den Job angeheuert. Ich wollte, dass der Killer den größten Teil des Tages auf der Straße verbrachte – bis Alissa im Büro des Staatsanwalts gewesen war und diesem per eidlicher Aussage so viele Informationen hatte zukommen lassen, dass sie nicht mehr in Gefahr war. Sobald eine Aussage niedergeschrieben ist, hat der Killer keinen Anlass mehr, einen Zeugen auszuschalten.
Der Plan, den ich mir mit Hilfe meines Ziehsohns ausgedacht hatte, sah vor, dass ich den Geflügellaster überholte und mich vor ihm wieder einreihte. Der Killer würde Gas geben, damit wir in Sichtweite für ihn blieben, aber ehe er nahe genug kam, würden der Lkw und ich gleichzeitig den Highway verlassen. Wegen der Biegung der Straße und der besonderen Ausfahrt, die ich mir ausgesucht hatte, würde der Killer meinen Wagen nicht sehen können und von da ab unserem Double folgen. Ich würde dann mit Alissa über eine komplizierte Route zu einem Hotel in Raleigh fahren, wo der Staatsanwalt wartete, während unser Double schließlich im drei Stunden entfernten Charlotte vor dem Gerichtsgebäude halten würde. Bis der Killer erkannte, dass er einem falschen Ziel gefolgt war, würde es zu spät sein. Er würde seinen Auftraggeber anrufen, und höchstwahrscheinlich würden sie den versuchten Anschlag aufgeben. Dann würden wir einschreiten, den Killer verhaften und versuchen, ihn zu seinem Auftraggeber zurückzuverfolgen.
Wir hatten uns der Ausfahrt auf etwa eine Meile genähert. Ein Blick in den Rückspiegel – der graue Hyundai hielt seine Position. Der Geflügellaster war zehn Meter vor uns.
Ich sah zu Alissa hinüber, die jetzt mit einem Halsband aus Gold und Amethyst spielte. Ihre Mutter hatte es ihr zum siebzehnten Geburtstag geschenkt, es hatte mehr gekostet, als sich die Familie leisten konnte, war jedoch ein unausgesprochener Trostpreis für das Ausbleiben einer Einladung zum Abschlussball der Highschool gewesen. Die Leute neigen dazu, ihren Lebensrettern ziemlich viel zu erzählen.
Mein Telefon läutete. Ich nahm das Gespräch an.
»Das Subjekt hat ein bisschen aufgeholt«, berichtete mein Ziehsohn. »Er ist etwa zweihundert Meter hinter dem Lkw.«
»Wir sind fast da«, sagte ich. »Dann wollen wir mal.«
Ich überholte den Geflügellaster zügig und scherte hinter unserem Double wieder ein – dicht hinter ihm. Der Wagen wurde von einem Mann aus unserer Organisation gesteuert, die Beifahrerin war eine FBI-Agentin, die Alissa ähnelte. Die Auswahl des Mitarbeiters, der meine Rolle spielte, hatte für einige Heiterkeit im Büro gesorgt. Ich habe einen rundlichen Kopf und Ohren, die eine Idee weiter abstehen, als mir lieb ist, habe borstiges, rotes Haar und bin nicht sehr groß. Und so verbrachten sie im Büro offenbar ein, zwei Stunden bei einem improvisierten Casting, um den koboldähnlichsten Mitarbeiter zu finden, der mich darstellen sollte.
»Status?«, fragte ich ins Telefon.
»Er hat die Spur gewechselt und beschleunigt ein wenig.«
Es gefiel ihm wohl nicht, dass er mich nicht mehr sah.
»Warte …«, hörte ich. »Warte …«
Ich würde meinen Protegé daran erinnern müssen, auf unnötige Kommunikation zu verzichten; zwar wurden unsere Worte von einer Sprachsoftware zerhackt, aber die Tatsache, dass ein Gespräch stattgefunden hatte, konnte entdeckt werden. Er würde die Lektion schnell lernen und behalten.
»Ich komme zur Ausfahrt. Okay … und tschüs.«
Mit immer noch gut neunzig Stundenkilometern wechselte ich auf die Ausfahrtspur und bog um die Kurve, die dicht von Bäumen gesäumt war. Der Geflügellaster klebte an meiner Stoßstange.
»Gut«, berichtete mein Ziehsohn. »Subjekt hat nicht einmal in eure Richtung geschaut. Er hat das Double in Sicht und geht wieder auf das Tempolimit zurück.«
Ich hielt an der roten Ampel, wo die Ausfahrt in die Route 18 mündet, und bog dann rechts ab. Der Geflügellaster nahm die andere Richtung.
»Subjekt setzt seine Fahrt fort«, meldete sich die Stimme meines Ziehsohns. »Scheint alles gut zu klappen.« Seine Stimme war ruhig und gelassen. Ich bin selbst ziemlich distanziert bei Operationen, aber er übertrifft mich noch. Er lächelt selten und scherzt nie, und in Wahrheit weiß ich kaum etwas über ihn, obwohl wir seit mehreren Jahren teilweise sehr eng zusammenarbeiten. Ich würde dieses Düstere an ihm gern ändern; nicht wegen des Jobs – da ist er wirklich sehr, sehr gut –, sondern einfach, weil ich wünschte, er hätte mehr Freude bei unserer Arbeit. Die Aufgabe, Menschen zu schützen, kann sehr befriedigend sein, sogar Spaß machen. Vor allem, wenn es um den Schutz von Familien geht, wie es häufig der Fall ist.
Ich wies ihn an, mich auf dem Laufenden zu halten, und wir trennten die Verbindung.
»Dann sind wir also sicher?«, fragte Alissa.
»Wir sind sicher«, antwortete ich und beschleunigte auf achtzig, wo siebzig erlaubt war. Fünfzehn Minuten später näherten wir uns über Umwege den Außenbezirken von Raleigh, wo wir den Staatsanwalt wegen der eidlichen Aussagen treffen würden.
Der Himmel war bewölkt, und die Gegend ringsum sah wahrscheinlich seit Jahrzehnten gleich aus: Bauernhäuser im Bungalowstil, Scheunen, Anhänger und Motorfahrzeuge im Endstadium, die aber immer noch funktionierten, wenn man sie richtig pflegte und dazu noch etwas Glück hatte. Eine Tankstelle bot eine Benzinmarke an, von der ich noch nie gehört hatte. Hunde bissen träge nach Flöhen in ihrem Fell. Frauen in straff sitzenden Jeans beaufsichtigten ihren Nachwuchs. Männer mit bierschlanken Gesichtern und ausladenden Bäuchen saßen auf Veranden und warteten auf nichts. Wahrscheinlich wunderten sie sich über unseren Wagen – mit Insassen, wie man sie in dieser Gegend nicht häufig sah: einem Mann im dunklen Anzug mit weißem Hemd und Krawatte und eine Frau mit Kurzhaarschnitt.
Dann ließen wir die Wohnhäuser hinter uns und fuhren auf einer Straße, die weitere Felder zerschnitt. Ich bemerkte die Baumwollpflanzen mit ihrem an Popcorn erinnernden Bewuchs, und ich dachte daran, dass dieses Land vor hundertfünfzig Jahren von genau derselben Frucht bedeckt gewesen war; der Bürgerkrieg und die Menschen, für die man ihn ausgetragen hatte, waren im Süden nie weit entfernt.
Mein Telefon läutete, und ich meldete mich.
Die Stimme meines Ziehsohns klang dringlich. »Abe.«
»Hat er den Highway verlassen?«, fragte ich angespannt. Ich war nicht allzu besorgt; wir waren vor mehr als einer halben Stunde abgebogen. Der Killer war inzwischen wohl an die vierzig Meilen entfernt.
»Nein, er folgt immer noch dem Double. Aber gerade ist etwas passiert. Er hat einen Anruf von seinem Handy gemacht. Als er auflegte, hat er sich so merkwürdig übers Gesicht gewischt. Ich bin auf zwei Wagenlängen herangefahren. Es sah aus, als würde er weinen.«
Mein Atem ging schnell, als ich überlegte, welche Gründe es dafür geben konnte. Schließlich zeichnete sich ein plausibles und beunruhigendes Szenario ab: Was, wenn der Killer vorausgeahnt hatte, dass wir ein Double einsetzen würden, und seinerseits ebenfalls eins benutzt hatte? Er hatte jemanden, der ihm ähnlich sah, gezwungen, uns zu folgen – so wie es der Kobold-Typ in unserem Wagen tat. Das Telefongespräch, dessen Zeuge mein Ziehsohn eben geworden war, könnte zwischen dem Fahrer und dem echten Täter, der wahrscheinlich Frau oder Kinder des Mannes als Geiseln hielt, geführt worden sein.
Aber dies bedeutete dann, dass der echte Killer woanders sein konnte, und …
Etwas Weißes blitzte in der Einfahrt einer verfallenen, aufgegebenen Tankstelle links von mir auf, und ein weißer Ford Pick-up raste über die Straße auf uns zu. Das Fahrzeug, dessen Front mit einem Metallgitter geschützt war, krachte in unsere Fahrerseite und schob uns problemlos durch ein hohes Unkrautgestrüpp in einen flachen Graben. Alissa schrie; ich stöhnte vor Schmerz und hörte, wie mein Ziehsohn am Telefon meinen Namen schrie, dann flogen das Handy und das schnurlose Headset durch den Wagen, angetrieben von dem explodierenden Airbag.
Wir stürzten eine anderthalb Meter tiefe Böschung hinunter und kamen unspektakulär auf dem sumpfigen Grund eines seichten Bachs zu liegen.
Ach, er hatte seinen Angriff perfekt geplant. Bevor ich auch nur meinen Sicherheitsgurt lösen konnte, um an meine Waffe heranzukommen, hatte er einen Hammer durch das Fahrerfenster geschwungen, dieses zertrümmert und mich mit demselben Schlag halb betäubt. Meine Glock wurde mir vom Gürtel gerissen und eingesteckt. Schulter ausgekugelt, dachte ich, nicht viel Blut. Ich spuckte Glasscherben aus und sah zu Alissa hinüber. Auch sie war benommen, schien aber nicht schwer verletzt zu sein. Der Killer hatte keine Schusswaffe in der Hand, nur den Hammer, und ich dachte, wenn sie sofort floh, könnte sie eine Chance haben, ins Unterholz zu entkommen. Keine große Chance, aber besser als nichts. Sie würde sich allerdings beeilen müssen. »Lauf, Alissa! Nach links! Sofort!«
Sie drückte die Tür auf und rollte sich aus dem Wagen.
Ich blickte zur Straße zurück. Alles, was ich sah, war der weiße Pick-up, der auf dem Bankett neben einem Bachlauf stand. Er versperrte perfekt die Sicht von der Straße her. Genau wie ich vorhin einen Lkw benutzt hatte, um mich aus dem Staub zu machen, dachte ich grimmig.
Der Killer langte jetzt durchs Fenster, um meine Tür zu entriegeln. Ich kniff vor Schmerzen die Augen zusammen, dankbar dafür, dass sich der Mann so viel Zeit ließ. Es verschaffte Alissa mehr Vorsprung. Meine Leute konnten unsere exakte Position per GPS feststellen, und in fünfzehn, zwanzig Minuten würde vielleicht schon Polizei zur Stelle sein. Alissa konnte es schaffen. Bitte, dachte ich und wandte den Kopf in Richtung ihres Fluchtwegs, den schmalen Bachlauf entlang.
Nur dass sie nirgendwohin lief.
Sie stand mit gesenktem Kopf und verschränkten Armen neben dem Wagen, und die Tränen liefen ihr über die Wangen. War sie schlimmer verletzt, als ich gedacht hatte?
Meine Tür wurde geöffnet, der Killer zerrte mich aus dem Wagen und legte mir sachkundig Nylonfesseln an den Händen an. Er ließ mich los, und ich sackte in den säuerlich riechenden Schlamm neben laut zirpende Grillen.
Fesseln?, wunderte ich mich. Ich sah Alissa wieder an, die jetzt am Wagen lehnte und es nicht fertigbrachte, in meine Richtung zu blicken. »Bitte«, wandte sie sich an unseren Angreifer. »Meine Mutter?«
Nein, sie war nicht benommen, und sie war nicht schwer verletzt, und ich begriff, warum sie nicht weglief: Sie hatte keinen Grund dazu.
Sie war nicht das Ziel.
Das war ich.
Die ganze schreckliche Wahrheit wurde mir klar. Der Mann, der über mir stand, hatte sich vor Wochen irgendwie an Alissa herangemacht und sie mit der Androhung, ihrer Mutter etwas anzutun, gezwungen, eine Geschichte über Korruption bei dem für den Staat tätigen Unternehmen zu erfinden. Da ein Armeestützpunkt dabei eine Rolle spielte, dessen Kommandeur ich kannte, hatte der Täter darauf gesetzt, dass man mich zu ihrer Bewachung heranziehen würde. Im Lauf der letzten Woche hatte Alissa diesem Mann Einzelheiten über unsere Sicherheitsmaßnahmen verraten. Er war kein Killer; er war ein sogenannter Lifter, dazu angeheuert, Informationen aus mir herauszuholen. Natürlich – über den Fall des organisierten Verbrechens, an dem ich gerade gearbeitet hatte. Ich kannte die neuen Identitäten der fünf Zeugen, die in dem Prozess ausgesagt hatten. Ich wusste, wo das Zeugenschutzprogramm sie untergebracht hatte.
Alissa rang schluchzend um Atem und sagte: »Bitte, Sie haben gesagt …«
Aber der Lifter ignorierte sie. Er sah auf die Uhr und versuchte, mit seinem Handy zu telefonieren – mit dem Mann in dem vermeintlichen Täterwagen, dem mein Ziehsohn gefolgt war, wie ich annahm. Er kam nicht durch. Das Double war vermutlich von unseren Leuten angehalten worden, sobald mein Unfall über das Handy zu hören gewesen war.
Das bedeutete, der Lifter hatte nicht so viel Zeit, wie er gern gehabt hätte. Ich fragte mich, wie lange ich die Folter würde durchhalten können.
»Bitte …«, flüsterte Alissa wieder. »Meine Mutter. Sie haben gesagt, wenn ich tue, was Sie verlangen… Bitte, geht es ihr gut?«
Der Lifter warf ihr einen Blick zu, und gerade so, als wäre es ihm nachträglich erst eingefallen, zog er eine Pistole aus dem Gürtel und schoss ihr zweimal in den Kopf.
Ich verzog das Gesicht und spürte den Stachel der Verzweiflung.
Er holte einen zerknitterten braunen Umschlag aus der Innentasche seiner Jacke und öffnete ihn; dann kniete er neben mir nieder und schüttelte den Inhalt des Kuverts auf den Boden. Ich konnte nicht sehen, was es war. Er zog mir Schuhe und Socken aus.
»Sie kennen die Informationen, die ich brauche?«, sagte er mit leiser Stimme.
Ich nickte.
»Verraten Sie sie mir?«
Wenn ich fünfzehn Minuten durchhielt, bestand die Chance, dass Polizei aus der Gegend eintraf, solange ich noch am Leben war. Ich schüttelte den Kopf.
Teilnahmslos, als sei meine Antwort weder gut noch schlecht für ihn, machte er sich an die Arbeit.
Halt zwanzig Minuten durch, sagte ich mir.
Dreißig Sekunden später stieß ich meinen ersten Schrei aus. Ein zweiter folgte kurz darauf, und von da an war jedes Ausatmen ein schriller Schrei. Tränen flossen, und der Schmerz wütete wie ein Brand in meinem gesamten Körper.
Dreizehn Minuten, dachte ich. Zwölf…
Ich konnte es nicht genau sagen, aber nach wahrscheinlich nicht mehr als sechs, sieben Minuten rief ich: »Stopp! Stopp!« Er hörte auf. Und ich sagte ihm alles, was er wissen wollte.
Er notierte die Informationen und stand auf. Die Schlüssel für den Pick-up baumelten in seiner linken Hand. In der rechten hielt er die Pistole. Er richtete sie mitten auf meine Stirn, und was ich empfand, war hauptsächlich Erleichterung, weil zumindest der Schmerz aufhören würde.
Der Mann trat einen Schritt zurück und kniff die Augen in Erwartung des Knalls zusammen, und im selben Moment wurde es …
SAMSTAG
September 2010
Ziel des Spiels ist es, die gegnerische Burg zu besetzen oder das gegnerische Königshaus (König, Prinz, Herzog) gefangen zu nehmen.
AUS DER SPIELANLEITUNG DES BRETTSPIELS FEUDAL
1
»Wir haben da einen üblen Fall, Corte.«
»Schießen Sie los«, sagte ich in das Stabmikro. Ich saß mit einem schnurlosen Headset an meinem Schreibtisch. Den alten, handschriftlichen Bericht, in dem ich gelesen hatte, legte ich beiseite.
»Der Mandant und seine Familie befinden sich in Fairfax. Sie haben einem Lifter grünes Licht gegeben, und wie es aussieht, steht er unter Zeitdruck.«
»Wie lange?«
»Ein paar Tage.«
»Sie wissen, wer ihn angeheuert hat?«
»Negativ, mein Sohn.«
Es war Samstagmorgen. In diesem Geschäft arbeiten wir zu merkwürdigen Zeiten, und die Arbeitswochen sind unterschiedlich lang. Meine hatte erst vor ein paar Tagen begonnen, und ich hatte am Freitagnachmittag einen kleinen Auftrag abgeschlossen. Ich sollte den ganzen Tag Papierkram erledigen, was ich genieße, aber in meiner Organisation stehen wir durchgehend auf Abruf bereit.
»Erzählen Sie weiter, Freddy.« Etwas an seinem Tonfall hatte mich aufmerksam gemacht. Wenn man seit zehn Jahren mit jemandem arbeitet, wenn auch immer nur sporadisch, dann fällt einem in unserem Beruf alles auf.
Der FBI-Agent, der sonst nicht lange fackelte, zögerte jetzt. »Okay, Corte«, sagte er schließlich. »Die Sache ist die …«
»Ja?«
»Der Lifter ist Henry Loving … Ich weiß, ich weiß. Aber es ist bestätigt.«
Nach einem Augenblick, in dem ich nur mein Herz schlagen und mein Blut in den Ohren rauschen hörte, antwortete ich so mechanisch wie sinnlos: »Er ist tot. In Rhode Island.«
»War tot. War angeblich tot.«
Ich blickte auf Bäume vor meinem Fenster, deren Blätter und Zweige sich in der leichten Septemberbrise regten, dann schaute ich über meinen Schreibtisch hinweg. Er war aufgeräumt, aber klein und billig. Mehrere Papiere lagen darauf, die alle in verschiedenem Maß meine Aufmerksamkeit forderten, sowie ein Päckchen, das am Morgen zu meinem nur wenige Blocks vom Büro entfernten Stadthaus geliefert worden war. Es enthielt einen eBay-Kauf, auf den ich mich schon gefreut hatte. Ich hatte vorgehabt, seinen Inhalt in meiner Mittagspause zu inspizieren. Jetzt schob ich es zur Seite.
»Weiter.«
»In Providence – da war noch jemand anders im Gebäude.« Freddy lieferte dieses fehlende Puzzleteil, auch wenn ich fast augenblicklich – und offenbar richtig – gefolgert hatte, was passiert sein musste. Vor zwei Jahren war das Lagerhaus, in dem sich Henry Loving versteckt gehalten hatte, nachdem er aus einer von mir gestellten Falle entkommen war, bis auf die Grundmauern abgebrannt. Die Spurensicherung hatte eine eindeutige DNA-Übereinstimmung bei der darin gefundenen Leiche ausgemacht. Selbst bei einem übel verbrannten Körper bleiben etwa zehn Millionen Proben dieser unvermeidlichen Desoxyribonukleinsäure übrig, die man nicht verstecken oder zerstören kann, weshalb es auch keinen Sinn hat, es zu versuchen.
Was man aber tun kann, ist, hinterher zu den Labortechnikern gehen und sie zwingen zu lügen – zu bestätigen, dass es sich bei der Leiche um deine gehandelt hat.
Loving war der Typ, der meine Falle vorausgeahnt haben könnte. Ehe er sich an meinen Mandanten herangemacht hatte, dürfte er sich einen Notfallplan ausgedacht haben. Er wird einen Obdachlosen oder Ausreißer entführt und in dem Lagerhaus verstaut haben, nur für den Fall, dass er würde fliehen müssen. Einen Labortechniker zu bedrohen war ein schlauer Einfall und nicht so weit hergeholt, wenn man bedachte, dass Henry Lovings einzigartige Kunst darin bestand, Menschen Dinge tun zu lassen, die sie nicht tun wollten.
So war also ein Mann, über dessen Feuertod viele Leute erfreut – ich würde fast sagen: glücklich – gewesen waren, plötzlich wieder sehr lebendig.
Ein Schatten in der Tür. Es war Aaron Ellis, der Leiter unserer Organisation und mein direkter Vorgesetzter. Blond, mit extrem breiten Schultern. Sein schmaler Mund teilte sich. Er merkte nicht, dass ich telefonierte. »Haben Sie schon gehört? Rhode Island – das war doch nicht Loving.«
»Ich spreche gerade mit Freddy darüber«, sagte ich und deutete auf mein Headset.
»In zehn Minuten in meinem Büro?«
»Sicher.«
Er entschwand mit schnellen Schritten in quastengeschmückten braunen Lederschuhen, die nicht zu seiner hellblauen Hose passten.
»Das war Aaron«, sagte ich zu dem FBI-Agenten in seinem rund zehn Meilen entfernten Büro.
»Ich weiß«, erwiderte Freddy. »Mein Boss hat Ihren Boss benachrichtigt. Ich benachrichtige Sie. Wir werden die Sache gemeinsam bearbeiten, mein Sohn. Rufen Sie mich an, wenn Sie Zeit haben.«
»Warten Sie«, sagte ich. »Die Mandanten in Fairfax – haben Sie denen Agenten als Babysitter geschickt?«
»Noch nicht. Das Ganze ist eben erst aufgetaucht.«
»Schicken Sie sofort jemanden hin.«
»Loving ist offenbar nicht in der Nähe.«
»Tun Sie es trotzdem.«
»Also, ich …«
»Tun Sie es trotzdem.«
»Ihr Wunsch ist mir … Sie wissen schon.«
Freddy legte auf, ehe ich noch etwas sagen konnte.
Henry Loving …
Ich saß einen Moment da und starrte wieder aus dem Fenster im nicht beschilderten Hauptquartier meiner Organisation in der Altstadt von Alexandria, einem aggressiv hässlichen Gebäude, neunzehnsiebziger-hässlich. Ich sah auf einen Streifen Gras, einen Antiquitätenladen, ein Starbucks und ein paar Büsche an einem Parkstreifen. Die Büsche führten versetzt angeordnet zum Masonic Temple der Freimaurer, als hätte eine Figur aus einem Dan-Brown-Roman sie gepflanzt, um eine Nachricht per Landschaftsarchitektur zu verschicken, statt eine E-Mail zu schreiben.
Mein Blick ging zu dem Päckchen und den Papieren auf meinem Schreibtisch zurück.
Der geklammerte Papierstapel war der Mietvertrag für ein sicheres Haus in der Nähe von Silver Spring, Maryland. Ich würde die Miete herunterhandeln und zu diesem Zweck eine Tarnidentität annehmen müssen.
Ein anderes Dokument war eine Freigabebescheinigung für den Mandanten, den ich gestern erfolgreich an zwei ernste Herren in gleichermaßen ernsten Anzügen übergeben hatte, deren Büros sich in Langley, Virginia, befanden. Ich unterschrieb die Order und legte sie in mein Postausgangsfach.
Das letzte Papier, das ich gerade gelesen hatte, als Freddy anrief, hatte ich unabsichtlich mit ins Büro gebracht. Ich hatte gestern Abend im Stadthaus ein Brettspiel entdeckt, dessen Spielanleitung ich noch einmal lesen wollte, und als ich die Schachtel öffnete, fand ich dieses Blatt – eine alte To-do-Liste für ein Fest, mit den Namen der Gäste, die anzurufen waren, den Lebensmitteln und Dekorationsartikeln, die gekauft werden mussten. Ich hatte das vergilbte Dokument geistesabwesend in meine Tasche gesteckt und heute Morgen entdeckt. Die Party hatte vor Jahren stattgefunden. Sie war das Letzte, woran ich im Augenblick erinnert werden wollte.
Ich blickte auf die Handschrift auf dem verblassten Stück Papier und steckte es in den Reißwolf, der es zu Konfetti verarbeitete.
Das Päckchen legte ich in den Safe hinter meinem Schreibtisch – nichts Tolles, keine Iriserkennung, nur ein klickendes Zahlenschloss –, dann stand ich auf. Ich zog ein dunkles Sakko über das weiße Hemd, meine übliche Arbeitskluft, selbst wenn ich samstags im Büro war, und machte mich auf den Weg zum Büro meines Bosses. Sonnenlicht, das blass durch die verspiegelten, kugelsicheren Fenster fiel, zeichnete Streifen auf den grauen Teppich im Korridor. Meine Gedanken waren nicht mehr bei Immobilienpreisen in Maryland, erhaltenen Päckchen oder unerwünschten Erinnerungen an die Vergangenheit. Sie waren einzig auf das Wiederauftauchen von Henry Loving gerichtet – den Mann, der sechs Jahre zuvor meinen Mentor und guten Freund Abe Fallow in einem Graben neben einem Baumwollfeld in North Carolina gefoltert und ermordet hatte, während ich seine Schreie über das nicht abgeschaltete Handy mit anhören musste.
Sieben Minuten Schreie bis zum erlösenden Schuss, der nicht aus Barmherzigkeit abgegeben wurde, sondern nur aus Gründen professioneller Effizienz.
2
Ich saß in einem der abgenutzten Sessel unseres Direktors neben einem Mann, der mich offenbar kannte, da er mir bei meinem Eintreten mit einiger Vertrautheit zugenickt hatte. Ich konnte ihn jedoch nirgends unterbringen, wusste nur, dass er Staatsanwalt war. Etwa mein Alter – vierzig – und klein, ein bisschen teigig, mit Haar, das einen Schnitt nötig hatte. Fuchsaugen.
Aaron Ellis bemerkte meinen Blick. »Du erinnerst dich an Jason Westerfield von der Staatsanwaltschaft?«
Ich täuschte kein Wiedererkennen vor und gab ihm nur die Hand.
»Freddy hat mich schon informiert.«
»Agent Fredericks?«, fragte Westerfield.
»Richtig. Er sagte, es ginge um einen Mandanten in Fairfax und einen Lifter, der in den nächsten Tagen Informationen brauchen wird.«
Westerfields Stimme war hoch und irritierend spielerisch. »Worauf Sie wetten können. Soweit wir hören, jedenfalls. Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht viel mehr, als dass der Lifter eindeutig einen Startbefehl erhalten hat. Jemand braucht bis Montagabend Informationen von dem Mann, sonst ist der Teufel los. Wir haben allerdings keine Ahnung, worum sich die ganze Scheiße dreht, pardonnez-moi.«
Während ich wie ein Staatsanwalt für einen Auftritt vor Gericht gekleidet war, trug Westerfield Freizeitkleidung – eine Kleidung, mit der man am Wochenende nicht ins Büro ging, sondern zum Campen. Chinos, ein kariertes Hemd und eine Windjacke. Ungewöhnlich für Washington, wo Bürostunden am Samstag und Sonntag keine Seltenheit waren. Vielleicht ist er ein Cowboy, kam mir in den Sinn. Ich bemerkte auch, dass er auf der Sesselkante saß und Akten mit seinen Stummelfingern umklammerte. Nicht weil er nervös gewesen wäre – er sah nicht wie der Typ aus, der überhaupt nervös wurde –, sondern weil er angespannt und voller Tatendrang war. Ein Feuer brannte in ihm.
Hinter uns ertönte eine weibliche Stimme. »Entschuldigen Sie bitte die Verspätung.«
Eine Frau von etwa dreißig stieß zu uns. Eine bestimmte Art von Nicken, und mir war klar: Sie war Westerfields Assistentin. Straff frisiertes Haar, das an den Schultern endete, blond. Neue oder frisch aus der Reinigung kommende Blue Jeans, ein weißer Pullover unter einer braunen Sportjacke und ein Halsband mit eindrucksvollen, cremefarbenen Perlen. Ihre Ohrringe waren ebenfalls Perlen, begleitet von gleichermaßen fesselnden Diamanten. Trotz ihrer Jugend trug sie eine Brille mit drei verschiedenen Brennweiten, dunkel gerahmt – ich sah es an der Art, wie ihr Kopf leicht auf und ab ging, als sie das Büro und mich in Augenschein nahm. Ein Schäfer muss die Konsumgewohnheiten seiner Mandanten kennen – es trägt viel dazu bei, sie zu verstehen. Und ich bemerkte instinktiv Chanel, Coach und Cartier. Ein reiches Mädchen und wahrscheinlich eine der Jahrgangsbesten an der juristischen Fakultät von Yale oder Harvard.
»Das ist die stellvertretende US-Staatsanwältin Chris Teasley«, sagte Westerfield.
Sie gab mir die Hand und begrüßte Ellis.
»Ich erkläre ihnen gerade die Lage der Kesslers.« Dann, an uns gewandt: »Chris wird mit uns an der Sache arbeiten.«
»Lassen Sie uns die Einzelheiten hören«, sagte ich und nahm wahr, dass Chris die Luft mit einem dezenten Blumenduft würzte. Sie ließ ihre Aktentasche lautstark aufschnappen und gab ihrem Boss einen Ordner. Während er den Inhalt überflog, bemerkte ich eine Zeichnung an Ellis’ Wand. Sein Eckbüro war nicht groß, aber mit einer Reihe von Bildern geschmückt, einige Poster aus dem Einkaufszentrum, einige persönliche Fotos und Kunstwerke seiner Kinder. Ich betrachtete ein Aquarellbild von einem Haus auf einem Hügel; es war nicht schlecht gemacht.
An meinen Bürowänden hing nichts außer Telefonlisten.
»Die Lage ist folgende«, wandte sich Westerfield an Ellis und mich. »Das FBI-Büro in Charleston, West Virginia, hat sich heute Morgen bei mir gemeldet. Um es kurz zu machen: Die Polizei des Bundesstaats hat irgendwo in der Provinz eine Drogenrazzia durchgeführt und ist dabei über ein paar Fingerabdrücke auf einem Münztelefon gestolpert, die sich als die von Henry Loving herausstellten. Aus irgendeinem Grund waren der Haftbefehl und die Überwachungsanordnung gegen ihn nach seinem Tod nicht gelöscht worden. Nach seinem angeblichen Tod, wie es aussieht. Die Polizisten riefen unsere Leute an, und wir nahmen die Sache in die Hand und fanden heraus, dass Loving unter falschem Namen und mit falschen Papieren vor einer Woche in Charleston gelandet ist. Schließlich konnten sie ihn heute Vormittag zu einem Motel in Winfield zurückverfolgen. Aber er war bereits abgereist, wenige Stunden zuvor, gegen halb neun. Mit unbekanntem Ziel natürlich.«
Auf ein Nicken ihres Chefs hin fuhr Teasley fort. »Die richterliche Anordnung seiner Überwachung ist technisch gesehen noch in Kraft; deshalb haben die Agenten die E-Mails im Motel überprüft. Er hat eine bekommen und eine abgeschickt: der Startbefehl und seine Bestätigung.«
»Was treibt er in West Virginia?«, fragte Ellis.
Ich kannte Loving besser als irgendwer sonst im Raum. »Er hat meist mit einem Partner gearbeitet«, sagte ich. »Vielleicht holt er jemanden dort ab. Und Waffen. Er hat sie sicher nicht mit ins Flugzeug genommen. So oder so wird er die Flughäfen in der Nähe von Washington meiden. Viele Leute hier erinnern sich noch an sein Aussehen nach… nach dem Vorfall vor ein paar Jahren. Gibt es eine E-Mail-Adresse des Absenders?«
»Über Proxys umgeleitet. Nicht zurückzuverfolgen.«
»Anrufe von oder zu seinem Zimmer im Motel?«
»Mais non.«
Das Französisch nervte. War Westerfield gerade von einem Pauschalurlaub zurückgekehrt, oder paukte er es, weil er einen algerischen Terroristen verfolgte?
»Was genau stand in der E-Mail, Jason?«, fragte ich geduldig.
Auf ein Nicken von ihm übernahm Teasley. »Wie Sie sagten, wurde nur grünes Licht gegeben. Sie müssen die Einzelheiten also bereits in früheren Gesprächen festgelegt haben.«
»Weiter«, bat ich.
Die Frau las vor: »›Loving – Betr.: Kessler. Start frei. Brauche Einzelheiten, gemäß Absprache, bis Montag Mitternacht, sonst nicht hinnehmbare Folgen, wie erklärt. Sobald Sie die Information haben, muss Subjekt eliminiert werden.‹ Ende des Zitats. Eine Adresse in Fairfax wird genannt.«
Nicht hinnehmbare Folgen … ist der Teufel los.
»Keine Audiodatei?«
»Nein.«
Ich war enttäuscht. Stimmanalyse kann eine Menge über den Anrufer verraten: Geschlecht, meistens nationale und regionale Wurzeln, Krankheiten, selbst über die Form von Nase, Mund und Kehle lassen sich vernünftige morphologische Schlussfolgerungen anstellen. Aber wenigstens hatten wir eine bestätigte Schreibweise des Namens unseres Mandanten, was ein Plus war.
»Kessler ist Polizist in Washington, D. C. Ryan Kessler, Detective«, erklärte Westerfield.
»Lovings Antwort?«
»›Bestätigt.‹ Sonst nichts.«
»Der Auftraggeber will die ›Einzelheiten‹« – Westerfield malte Anführungszeichen in die Luft – »bis Montagabend. Einzelheiten …«
Ich bat darum, den Ausdruck sehen zu dürfen. Bemerkte ein leichtes Zögern bei Teasley, die das Blatt erst an mich weiterreichte, als Westerfield keine Reaktion zeigte.
Ich las den kurzen Absatz durch. »Grammatik, Rechtschreibung und Interpunktion sind gut. ›Gemäß‹ wird heute eher selten gebraucht und ist korrekt benutzt.« Teasley runzelte die Stirn über diese Beobachtung. »Und passende Kommas um die Apposition nach ›Einzelheiten‹, was man selten sieht.«
Jetzt starrten mich alle an. Ich hatte vor langer Zeit Linguistik studiert. Ein bisschen Philologie ebenfalls, das Studium von Sprachen durch Analyse von Texten. Ich hatte es hauptsächlich zum Zeitvertreib getan, aber hin und wieder erwies es sich als ganz nützlich.
Ellis zupfte an seinem Kragen. Er war im College in der Ringermannschaft gewesen, betrieb meines Wissens aber jetzt nicht mehr viel Sport. Er war trotzdem immer noch gebaut wie ein eisernes Dreieck. »Loving ist heute Morgen um halb neun aufgebrochen. Er ist wahrscheinlich bewaffnet, also wird er nicht geflogen sein … und er will nicht riskieren, in einem Flughafen hier in der Gegend gesehen zu werden, wie Sie gesagt haben, Corte. Damit ist er noch etwa vier Stunden entfernt.«
»Sein Fahrzeug?«, fragte ich.
»Nichts bisher. Ein FBI-Team klappert die Motels und Restaurants in der Stadt ab.«
»Was weiß dieser Kessler, woran der Auftraggeber so ungemein interessiert ist?«, wollte mein Boss wissen.
»Keine Ahnung«, sagte Westerfield.
»Wer genau ist dieser Kessler?«, fragte ich.
»Ich habe ein paar Einzelheiten«, sagte Teasley.
Während die junge Anwältin in einer Akte blätterte, fragte ich mich, warum Westerfield zu uns gekommen war. Wir sind als die Bodyguards bekannt, an die man sich wendet, wenn alle Stricke reißen (zumindest bezeichnet uns Aaron Ellis bei Etat-Anhörungen so, was ich ein bisschen peinlich finde, aber in Kongress und Senat kommt es offenbar gut an). Die Diplomatic Security des Außenministeriums und der Secret Service bewachen amerikanische Regierungsvertreter und ausländische Staatsoberhäupter. Das Zeugenschutzprogramm stattet edelmütig wie niederträchtig Gesinnte mit neuen Identitäten aus und lässt sie auf die Welt los. Wir dagegen greifen nur ein, wenn es eine unmittelbar bevorstehende, glaubhafte Bedrohung gegen einen bekannten Mandanten gibt. Man hat uns auch schon die »Notaufnahme des Personenschutzes« genannt.
Das Kriterium ist zwar nicht exakt umrissen, aber angesichts der begrenzten Ressourcen neigen wir dazu, einen Fall nur anzunehmen, wenn der Mandant in Angelegenheiten der nationalen Sicherheit – wie der Spion, den ich tags zuvor bei den Herren der CIA abgeliefert hatte – oder der öffentlichen Gesundheit verwickelt ist, wie letztes Jahr, als wir einen Informanten in einem Prozess wegen verunreinigter Medikamente bewachten.
Alles wurde jedoch klar, als Teasley den Lebenslauf des Polizisten vorlas. »Detective Ryan Kessler, 42, verheiratet, ein Kind. Arbeitet in der Abteilung für Finanzkriminalität in D. C., seit fünfzehn Jahren dabei, hoch dekoriert… Sie haben vielleicht von ihm gehört.«
Ich sah meinen Boss an, der für uns beide den Kopf schüttelte.
»Er ist ein Held. Die Medien haben vor ein paar Jahren viel über ihn berichtet. Er hat verdeckt in D. C. gearbeitet und ist in einen Raubüberfall in einem Delikatessenladen in North West gestolpert. Er hat die Kunden im Laden gerettet, aber selbst eine Kugel abbekommen. War in den Nachrichten, und eine dieser Polizeiserien im Discovery Channel hat eine Folge über ihn gebracht.«
Ich sah nicht viel fern. Aber ich verstand die Zusammenhänge jetzt. Ein als Held dekorierter Polizist, der von einem Lifter wie Henry Loving ins Visier genommen wird … Westerfield sah eine Chance, selbst zum Helden zu werden, wenn er eine Anklage gegen den Auftraggeber zusammenzimmerte; vermutlich ging es um irgendeinen Finanzbetrug, den Kessler untersuchte. Selbst wenn der zugrunde liegende Fall nicht groß war – obwohl er natürlich auch riesig sein konnte –, reichte der Umstand, dass ein Held der Polizei von D. C. aufs Korn genommen wurde, aus, damit Westerfield den Fall an sich zog. Ich achtete ihn deshalb nicht geringer – in Washington geht es immer und überall nur um persönliche wie öffentliche Machenschaften und Schachzüge. Es interessierte mich nicht, ob die Annahme dieses Falls Westerfields Karriere diente. Für mich zählte nur, dass die Kesslers am Leben blieben.
Und dass dieser spezielle Lifter mit der Sache zu tun hatte.
»Alors«, sagte Westerfield. »Da haben wir es. Kessler hat son nez in Dinge gesteckt, die ihn nichts angingen. Wir müssen herausfinden, wo, was, wer, wann, warum… Also lassen Sie uns Kessler schleunigst ins Kittchen schaffen und dann weitermachen.«
»Ins Kittchen?«, fragte ich.
»Jawohl«, antwortete Teasley. »Wir haben an die Haftanstalt Hanson in D. C. gedacht. Ich habe ein wenig recherchiert und herausgefunden, dass sie soeben ihre Alarmsysteme überarbeitet haben. Außerdem habe ich die Personalakten aller Wächter durchgesehen, die in dem in Frage kommenden Flügel Dienst tun. Es ist eine gute Wahl.«
»C’est vrai.«
»Ein Knast wäre nicht ratsam«, sagte ich.
»Ach nein?«, wunderte sich Westerfield.
Schutzhaft in einem abgeschlossenen Teil einer Vollzugsanstalt ist in manchen Fällen sinnvoll, aber wie ich erklärte, gehörte dieser nicht dazu.
»Hm«, sagte der Staatsanwalt. »Wir dachten, Sie könnten einen Ihrer Leute mit den Kesslers reingehen lassen, non? Wäre sehr ökonomisch. Agent Fredericks und Sie könnten ihn anschließend befragen. Sie würden gute Informationen erhalten, das garantiere ich Ihnen. In einem Knast neigen Zeugen dazu, sich an Dinge zu erinnern, die ihnen anderenfalls nicht einfallen würden.«
»Das entspricht ganz und gar nicht meinen Erfahrungen in ähnlichen Umständen.«
»Nein?«
»Sicher, wenn Sie jemanden in ein Gefängnis stecken, dann kommt ein Lifter von außen normalerweise nicht hinein. Und …« – ein Kopfnicken in Richtung Teasley, um ihre gründliche Arbeit zu würdigen – »das Personal wurde ohne Frage auf Herz und Nieren geprüft. Bei jedem anderen Lifter würde ich zustimmen. Aber wir haben es hier mit Henry Loving zu tun. Ich weiß, wie er arbeitet. Wenn wir die Kesslers einbuchten, wird er einen Ansatzpunkt bei einem der Wächter finden. Die meisten von ihnen sind junge Männer. Wenn ich Loving wäre, würde ich mir einen mit einer schwangeren Frau suchen – das erste Kind, wenn möglich – und ihr einen Besuch abstatten.« Teasley blinzelte bei meinem nüchternen Tonfall. »Der Wachmann würde tun, was Loving verlangt. Und wenn die Familie im Knast ist, gibt es keine Fluchtroute. Sie würden in der Falle sitzen.«
»Wie petits lapins«, sagte Westerfield, allerdings nicht so sarkastisch, wie ich es erwartet hatte. Er dachte über meine Argumente nach.
»Abgesehen davon ist Kessler Polizist in D. C. Es dürfte uns schwerfallen, seine Zustimmung zu gewinnen. Im Gefängnis von Hanson könnten ein halbes Dutzend Leute einsitzen, die er hinter Gitter gebracht hat.«
»Wo würden Sie die Familie unterbringen?«, fragte Westerfield.
»Das weiß ich noch nicht«, erwiderte ich. »Ich muss darüber nachdenken.«
Westerfield blickte ebenfalls zur Wand hinauf, ich hätte jedoch nicht sagen können, auf welches Bild oder Diplom. Schließlich wandte er sich an Teasley. »Geben Sie ihm die Adresse der Kesslers.«
Die junge Frau notierte sie in einer Handschrift, die sehr viel besser lesbar war als die ihres Chefs. Als sie mir den Zettel gab, traf mich ein weiterer Hauch ihres Parfüms.
Ich nahm das Papier und dankte ihnen beiden. Ich bin ein ehrgeiziger Spieler – alle Arten von Spielen –, und ich habe gelernt, bescheiden und großzügig im Sieg zu sein, was ich auf mein Berufsleben übertragen habe. Es ist natürlich eine Frage der Höflichkeit, aber ich habe außerdem festgestellt, dass man als guter Gewinner einen leichten psychologischen Vorteil hat, wenn man später wieder einmal gegen denselben Gegner spielt.
Die beiden erhoben sich. »Also gut«, sagte der Staatsanwalt. »Tun Sie, was Sie können – finden Sie heraus, wer Loving angeheuert hat und warum.«
»Es wird unsere oberste Priorität sein«, versicherte ich ihm, obwohl es nicht stimmte.
»Au revoir …« Westerfield und Teasley schwebten aus dem Zimmer, wobei der Staatsanwalt ihr mit gedämpfter Stimme Befehle erteilte.
Ich stand ebenfalls auf. Ich musste noch im Stadthaus vorbeischauen und ein paar Dinge für den Auftrag einpacken.
»Ich melde mich, wenn ich dort bin«, sagte ich.
»Corte?«
Ich blieb an der Tür stehen und blickte zurück.
»Die Kesslers nicht in den Knast zu schicken … das ist sinnvoll, oder? Sie schaffen sie lieber in ein sicheres Haus und bearbeiten den Fall von dort, ja?« Er hatte mir Rückendeckung gegeben – Aaron Ellis stand ausnahmslos hinter seinen Leuten – und würde meinem Sachverstand in dieser Frage folgen. Aber er hatte in Wahrheit gar nicht gefragt, ob es von der Vorgehensweise her vernünftig war, sie nicht in Schutzhaft zu nehmen.
Was er tatsächlich fragte, war dies: Traf er die richtige Entscheidung, wenn er mir und nicht jemand anderem den Auftrag gab, Mandanten vor Henry Loving zu beschützen? Kurz gesagt, konnte ich unvoreingenommen bleiben, wenn der Täter der Mann war, der meinen Mentor ermordet hatte und der offenbar aus der Falle entkommen war, die ich ihm vor Jahren gestellt hatte?
»Ein sicheres Haus ist die wirkungsvollste Vorgehensweise«, beteuerte ich. Auf dem Weg zurück in mein Büro fischte ich den Schlüssel für die Schreibtischschublade heraus, in der ich meine Waffe aufbewahrte.
3
Viele Regierungsorganisationen halten sich an Initialen oder Akronyme, um ihre Angestellten oder Abteilungen zu beschreiben, aber bei uns sind aus irgendeinem Grund Spitznamen angesagt, so wie »Lifter«.
Die einfachen Leibwächter in unserer Organisation nennen wir »Klone«, weil sie ihren Mandanten wie ein Schatten folgen sollen. Unsere Abteilung für Technischen Support und Kommunikation ist mit »Zauberern« besetzt. Es gibt die »Straßenfeger« – unsere Beamten für Verteidigungsanalyse und Taktik, die einen Scharfschützen auf eine Meile Entfernung und eine im Handy des Mandanten versteckte Bombe entdecken können. Die bei uns für Überwachung zuständigen Leute werden, wenig überraschend, »Spione« genannt.
Ich bin in der Abteilung Strategischer Schutz und dort der ranghöchste der acht Mitarbeiter. Wir sind diejenigen, die sich einen Plan zum Schutz der uns zugeteilten Mandanten ausdenken und ihn umsetzen. Aufgrund der Natur unseres Auftrags werden wir die »Schäfer« genannt.
Eine Abteilung, die keinen Spitznamen hat, ist der Recherche-Support, für mich die wichtigste unserer Hilfstruppen. Ein Schäfer kann einen Personenschutzauftrag ohne gute investigative Recherche nicht durchführen. Wie oft habe ich unseren Nachwuchsleuten gepredigt, dass gründliche Recherche am Anfang den Einsatz von taktischer Feuerkraft später weniger wahrscheinlich macht.
Und ich hatte das Glück, dass die Person, die ich für die beste in der Abteilung hielt, mein besonderer Schützling dort war.
Ich rief sie jetzt an.
Nach einmal Läuten kam es »DuBois« aus meinem Ohrstöpsel.
Ich hatte sie auf ihrem sicheren Handy angerufen; deshalb meldete sie sich mit ihrer dienstlichen Begrüßung. Wegen des französischen Ursprungs hätte man erwartet, dass der Name »Dü-buah« ausgesprochen worden wäre, aber ihre Familie nannte sich »Du-boys«.
»Claire. Es ist etwas passiert.«
»Ja?«, fragte sie knapp.
»Loving lebt noch.«
Sie verarbeitete die Information. »Er lebt? … Ich verstehe nicht, wie das möglich sein kann.«
»Tja, es ist aber so.«
»Ich überlege gerade«, sagte sie, halb zu sich selbst. »Das Gebäude hat gebrannt … Es gab eine Übereinstimmung bei der DNA. Ich erinnere mich an den Bericht. Er enthielt einige Tippfehler, wissen Sie noch?« Claire DuBois war älter als ihr jugendlicher Tonfall erahnen ließ, wenn auch nicht viel. Kurzes brünettes Haar, ein herzförmiges, fein geschnittenes, hübsches Gesicht, eine wahrscheinlich sehr gute Figur – und ich war so neugierig diesbezüglich, wie es jeder Mann gewesen wäre –, die aber für gewöhnlich in zweckmäßigen Hosenanzügen verborgen war.
»Egal. Sind Sie in der Stadt? Ich brauche Sie.«
»Sie meinen, ob ich übers Wochenende weggefahren bin? Nein. Hab meine Pläne geändert. Soll ich reinkommen?«, fragte sie in ihrem forschen Singsang. Ich stellte mir vor, wie sie im Licht des Septembermorgens frühstückte, das schräg durch das Fenster ihres ruhigen Stadthauses in Arlington, Virginia, fiel. Sie hatte vielleicht einen Trainingsanzug oder einen aufreizenden Morgenmantel an, aber beides konnte ich mir unmöglich bildhaft vorstellen. Möglicherweise saß sie einem stoppelbärtigen jungen Mann gegenüber, der sie neugierig über die Washington Post hinweg anblickte. Auch das ein Bild, das sich nicht einstellen wollte.
»Er ist hinter einem Mandanten in Fairfax her. Die Einzelheiten kenne ich nicht. Knapper Zeitrahmen.«
»Alles klar. Ich muss nur rasch ein paar Sachen regeln.« Ich hörte einige kurze Klicks – sie konnte schneller tippen als irgendwer auf dieser Welt. »Mrs. Glotsky von nebenan …« hörte ich sie murmeln. »Dann das Wasser … Okay, ich bin in zwanzig Minuten da.«
Ich hatte den Verdacht, dass DuBois unter einer leichten hyperaktiven Störung litt, aber das wirkte sich meist zu meinen Gunsten aus.
»Ich werde mit den Mandanten unterwegs sein, aber ich rufe Sie an wegen der Aufträge, die ich für Sie habe.«
Wir legten auf. Ich trug mich für einen Nissan Armada aus unserem Fuhrpark ein und holte ihn aus der riesigen Tiefgarage unter unserem Gebäude. Ich fuhr die King Street hinauf und dann durch die malerischen schmalen Straßen der Altstadt von Alexandria am Potomac, auf der Virginia-Seite, nicht weit von Washington D. C. entfernt.
Der SUV war nicht verräterisch schwarz, sondern hellgrau, verstaubt und schmutzig. Autos spielen eine große Rolle im Personenschutzgeschäft, und wie alle unsere Fahrzeuge war dieser Nissan für unsere Zwecke modifiziert worden – mit kugelsicherem Glas, gepanzerten Türen, schusssicheren Reifen und einem mit Schaumstoff verkleideten Benzintank. Billy, unser Fuhrparkleiter, hatte den Schwerpunkt tiefer gelegt, damit man schneller um Kurven fahren konnte, und den Kühlergrill mit einer Panzerplatte zum Schutz des Motors ausgestattet, die er als Suspensorium bezeichnete.
Ich parkte in zweiter Reihe und lief in das aus rötlich braunem Sandstein errichtete Stadthaus, das immer noch nach dem Kaffee roch, den ich eine Stunde zuvor gekocht hatte. Ich suchte rasch die wichtigsten Sachen zusammen und packte sie in eine große Sporttasche. Anders als in meinem Büro waren die Wände hier von Zeugnissen meiner Vergangenheit bedeckt: Diplome, Bescheinigungen von Fortbildungskursen, Anerkennungsschreiben früherer Arbeitgeber und zufriedener Kunden: Außenministerium, CIA, FBI und ATF. Auch vom britischen MI5. Außerdem ein paar Bilder aus meinen früheren Jahren, aus Gegenden wie Virginia, Ohio, Texas.
Ich wusste nicht, wozu ich all diesen Krimskrams an die Wand hängte. Selten nur warf ich einen Blick darauf, und nie hatte ich Gäste. Ich erinnerte mich, dass ich vor ein paar Jahren dachte, es würde von einem erwartet, wenn man allein ein geräumiges Stadthaus bezog.
Ich zog mich um: Jeans, schwarzes Polohemd und eine Windjacke. Dann stellte ich die beiden Alarmanlagen an, schloss ab und kehrte zum Wagen zurück. Ich raste in Richtung Stadtautobahn, wählte eine Nummer und stöpselte meinen Kopfhörer ein.
Nach dreißig Minuten war ich beim Haus meiner Mandanten.
Fairfax, Virginia, ist ein angenehmer Vorort mit einem breit gestreuten Angebot an Wohnhäusern, von kleinen Bungalows und Stadthäusern bis zu üppigen, fünf Hektar großen Grundstücken mit baumbestandenen entmilitarisierten Zonen zwischen den einzelnen Anwesen. Das Haus der Kesslers lag zwischen diesen Extremen, es stand auf einem halben Hektar Grund, halb kahl und halb voller Bäume, deren Blätter gerade ihre sommerliche Lebenskraft verloren – Bäume wie geschaffen dafür, einen Scharfschützen zu verbergen, der Loving unterstützte.
Ich wendete, parkte den Armada in der Einfahrt und stieg aus. Ich kannte die FBI-Agenten auf der anderen Straßenseite nicht persönlich, aber ich hatte ihre Bilder gesehen, die mir Freddys Assistentin auf den Computer geladen hatte. Ich ging zu dem Wagen. Sie mussten meine Beschreibung ebenfalls haben, aber ich behielt die Hände an der Seite, bis sie sahen, wer ich war. Wir zückten unsere Ausweise.
»Niemand hat vor dem Haus gehalten, seit wir hier sind.«
Ich steckte mein Ausweisetui weg. »Irgendwelche Nummernschilder von außerhalb?«
»Wir haben keine bemerkt.«
Nicht dieselbe Antwort wie »Nein.«
Einer der Agenten zeigte auf eine breite, vierspurige Straße in der Nähe. »Wir haben ein paar SUVs da drüben gesehen, richtig große. Sie wurden langsamer, die Fahrer haben in unsere Richtung geschaut und sind dann weitergefahren.«
»Sind sie in Richtung Norden gefahren?«, fragte ich.
»Ja.«
»Einen halben Block entfernt ist eine Schule. Heute haben die Schüler Fußballwettkämpfe. Die Saison hat gerade angefangen, deshalb vermute ich, es waren Eltern, die noch nie beim Fußballplatz waren und nicht genau wussten, wo sie abbiegen müssen.«
Die beiden schienen überrascht, dass ich das wusste. Claire DuBois hatte mich darüber informiert, während ich unterwegs war, nachdem ich sie nach Veranstaltungen in der Nachbarschaft gefragt hatte.
»Aber sagen Sie mir sofort Bescheid, wenn Sie die Fahrzeuge noch einmal sehen.«
Weiter oben in der Straße sah ich Hausbesitzer spätes Gras mähen und frühes Laub harken. Der Tag war warm, die Luft klar. Ich suchte die gesamte Gegend zweimal mit den Augen ab. Man bezeichnet mich oft als paranoid, und wahrscheinlich bin ich es. Aber unser Gegner hier war Henry Loving, ein Experte darin, sich unsichtbar zu machen … bis zum letzten Augenblick natürlich, in dem er nur allzu präsent wird. Ich musste wieder an Rhode Island vor zwei Jahren denken, als er wie aus dem Nichts bewaffnet aus einem Wagen gekommen war, in dem er schlicht unmöglich gewesen sein konnte.
Und in dem er trotzdem gewesen war.
Ich schob meine Umhängetasche höher und kehrte zu dem Nissan zurück. Ich sah mein Spiegelbild in der Scheibe. Da Ryan Kessler ein Detective war, hatte ich mir gedacht, ich würde sein Vertrauen leichter gewinnen, wenn ich mehr wie ein Undercover-Polizist aussah als wie der humorlose Bundesbeamte, der ich so ziemlich bin. Mit meiner Freizeitkleidung, meinem sauber geschnittenen, bräunlichen und schon leicht schütteren Haar und dem glatt rasierten Gesicht sah ich wahrscheinlich aus wie einer der zwei Dutzend Geschäftsmänner und Väter, die ihre Söhne oder Töchter in diesem Moment bei dem Fußballspiel ein Stück weiter in der Straße anfeuerten.
Ich telefonierte über mein sicheres Handy.
»Sind Sie das?«, fragte Freddy.
»Ich bin hier, bei Kessler.«
»Sehen Sie meine Leute?«
»Ja. Sie sind nicht zu übersehen.«
»Was sollen sie machen? Sich hinter den Gartenzwergen verstecken? Wir sind hier in den Suburbs, mein Sohn.«
Die Originalausgabe erschien unter dem Titel »Edge« bei Simon & Schuster, Inc., New York.
1. Auflage Deutsche Erstausgabe April 2012 bei Blanvalet, einem Unternehmen der Verlagsgruppe Random House GmbH, München
Copyright © der Originalausgabe 2010 by Jeffery Deaver
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2012 by Blanvalet Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH Umschlaggestaltung: © Johannes Frick, Neusäß/Augsburg Umschlagmotiv: © LOOK-foto/age fotostock Redaktion: Rainer Schöttle Lektorat: Urban Hofstetter Herstellung: sam Satz: KompetenzCenter, Mönchengladbach
eISBN 978-3-641-10465-8
www.blanvalet.de
www.randomhouse.de
Leseprobe