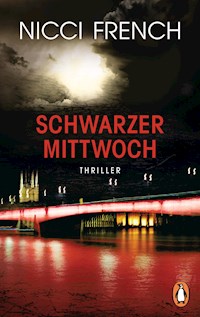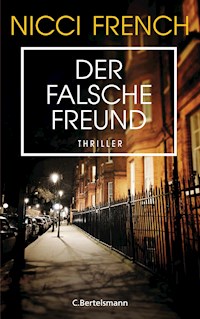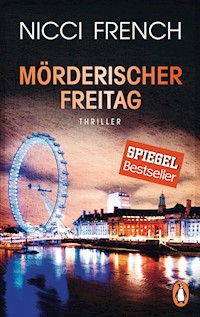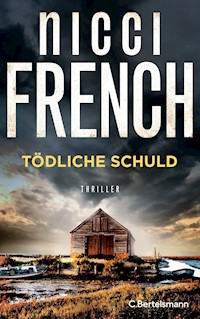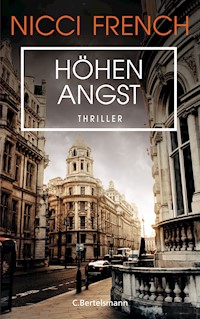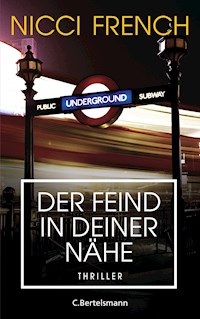
6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein packender Psychothriller: himmlisch, höllisch, mörderisch ...
Holly Kraus ist eine erfolgreiche Frau. Und in ihrer überschäumenden Art schlägt sie gerne über die Stränge. Doch damit macht sie sich nicht überall beliebt. Übertreibt sie es nicht etwas? Kann es sein, dass sie damit sogar Mordgelüste weckt? Denn plötzlich findet sie sich in einem tödlichen Albtraum wieder ... Der Roman von Nicci French ist nicht nur ein »außergewöhnlich überzeugender Thriller«, wie der Independent schrieb, sondern auch eine anrührende Geschichte einer Frauenfreundschaft.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 465
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Buch
Alle sind fasziniert von der Powerfrau Holly Kraus. Zusammen mit ihrer Freundin Meg baut sie ein Event-Unternehmen auf, arbeitet fast ohne Pause und lässt keine Party aus. Immer öfter findet sich Holly nach durchfeierten Nächten in fremden Betten wieder, häuft Spielschulden an und tätigt unüberlegte Spontankäufe. Während Meg mit zunehmender Sorge die Eskapaden ihrer Freundin beobachtet, kann sich Hollys Ehemann Charlie des wachsenden Ekels vor seiner Frau kaum noch erwehren. Als ein kurzzeitiger Liebhaber sie verfolgt und bedroht, als die Schulden ihr über den Kopf wachsen und ständig neue Katastrophen auf sie einstürzen, bricht Holly zusammen. In ihrer Verzweiflung sieht sie keinen anderen Ausweg, als sich das Leben zu nehmen. Gerade noch rechtzeitig wird sie nach der Einnahme einer Überdosis Medikamente ins Krankenhaus eingeliefert und kann gerettet werden. Nach diesem Erlebnis setzt Holly nun alles daran, ihre Chance zu nutzen und ihr Leben grundlegend zu ändern. Ihre Freundin Meg steht ihr dabei aufopferungsvoll zur Seite. Und auch mit Charlie, auf dessen Unterstützung und Nähe sie nun angewiesen ist, möchte sie sich versöhnen. Doch die Wunden, die sie ihm mit ihrer Blindheit gegenüber seinen Gefühlen und ihrer Selbstsucht beigebracht hat, sind zu tief. Jetzt schlägt Charlies Stunde, und für Holly beginnt ein tödlicher Albtraum, aus dem es kein Entrinnen mehr zu geben scheint…
Nicci French
Der Feind in deiner Nähe
Roman
Deutsch von Birgit Moosmüller
Die Originalausgabe erschien 2005
unter dem Titel »Catch Me When I Fall« bei Michael Joseph,
an imprint of Penguin Books, London Verlagsgruppe Random House
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
1. Auflage Taschenbuchausgabe April 2008
Wilhelm Goldmann Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Copyright © der Originalausgabe 2005 by Joined-Up Writing Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2006 by C. Bertelsmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH
Umschlaggestaltung: Design Team München Umschlagfoto: Corbis / Pawel Libera IK · Herstellung: st
ISBN: 978-3-641-24603-7V001
www.goldmann-verlag.de
Ich bin zweimal gestorben.
Das erste Mal sehnte ich mich danach, tot zu sein. Ich dachte an den Tod als einen Ort, an dem der Schmerz aufhören würde und ich endlich keine Angst mehr zu haben brauchte.
Das zweite Mal wollte ich nicht sterben. Trotz des Schmerzes und der Angst war ich zu dem Schluss gekommen, dass der Ort, an den ich gehörte, das Leben war: das chaotische, beängstigende, ermüdende, wunderbare, schmerzhafte Leben mit all seinem Scheitern und seiner Traurigkeit, all seinen plötzlichen und unerwarteten kleinen Freuden, die einen die Augen schließen und denken lassen: Halte das gut fest, bewahre es in deinem Gedächtnis. Schöne Erinnerungen können einen retten. Eine durchtanzte Nacht, ein Sonnenaufgang, ein Spaziergang durch die Stadt, verloren in einer Menschenmenge, ein Blick in deine lächelnden Augen. Du hast mich gerettet, als ich mich nicht mehr selbst retten konnte. Du hast mich gefunden, als ich verloren war.
Ich wollte nicht sterben, aber andere wünschten sich meinen Tod. Sie gaben sich die größte Mühe, meinem Leben ein Ende zu setzen. Ich bin anscheinend ein Mensch, den die Leute entweder lieben oder hassen. Manchmal war beides schwer voneinander zu unterscheiden. Selbst jetzt, da alles vorbei ist und ich darauf zurückblicken kann wie auf eine Landschaft, die ich durchwandert und hinter mir gelassen habe, sind mir gewisse Dinge immer noch ein Rätsel – Geheimnisse, die ich nicht ergründen kann.
Wenn man stirbt, gelangt man an einen anderen Ort. Ganz allein überschreitet man eine Grenze, und niemand kann einem dorthin folgen. Als mein Vater starb, war ich sechzehn Jahre alt. Ich erinnere mich an den Frühlingsnachmittag, an dem er beerdigt wurde. Meine Mutter versuchte mich dazu zu bringen, Trauerkleidung zu tragen, aber mein Vater hatte Schwarz immer gehasst, und deswegen zog ich mein rosa Kleid an, legte meinen knalligsten Lippenstift auf und schlüpfte in hochhackige Schuhe, deren Absätze in der weichen Erde versanken. Ich wollte aussehen wie eine Schlampe. Wie eine Nutte. Ich schmierte mir blauen Lidschatten auf die Augenlider. Und ich erinnere mich noch an die Worte des Pfarrers – »Asche zu Asche, Staub zu Staub« – und daran, dass die Leute weinten und sich gegenseitig festhielten. Ich wusste, dass sie sich auch von mir Tränen gewünscht hätten, denn dann hätten sie einen Arm um mich legen und mich trösten können, aber meinem Vater waren weinende Menschen zuwider gewesen. Er wollte immer, dass wir der Welt ein glückliches Gesicht zeigten. Also lächelte ich während der ganzen Beisetzung, ich glaube, ein paarmal lachte ich sogar ein bisschen, weil alle mich so komisch ansahen. Als der Sarg in die Erde hinuntergelassen wurde, legte meine Mutter, wie es üblich ist, eine einzelne weiße Rose darauf. Ich nahm meine Armbänder ab und warf sie ins Grab, sodass das Ganze ein paar Sekunden lang mehr von einem heidnischen Begräbnis als von einer respektablen englischen Beisetzung hatte. Eines der Armbänder riss, und seine bunten Plastikperlen kullerten wie wild auf dem billigen Holzdeckel herum. Rat-a-tat-tatt, direkt über dem Gesicht meines Vaters.
Eine Weile glaubte ich, vor Einsamkeit und Zorn wahnsinnig zu werden, auch wenn ich das nie jemandem erzählte, weil mir die Worte fehlten. Zehn Jahre lang versuchte ich zu ihm zurückzufinden. Voller Verzweiflung. Voller Liebe. Voller Empörung, voller Ausgelassenheit, voller Abscheu und Rachsucht.
Ich bin zweimal gestorben. Nur zweimal. Aber dank meiner rasenden Bemühungen hätte ich es durchaus ein bisschen öfter schaffen können.
Hier sind sie nun also. Die Menschen, die mich geliebt und gehasst haben. Diejenigen, die wollten, dass ich lebe, und diejenigen, die sich meinen Tod wünschten. Die mich zu retten versuchten und die mich losließen. Sie machen alle einen glücklichen Eindruck. Hand in Hand stehen sie da und blicken einander in die Augen. Ein paar von ihnen küssen sich. Ich sehe ihnen an, dass sie sich gerade versprechen, das vor ihnen liegende Leben gemeinsam zu meistern. Jene große und geheimnisvolle Reise.
Nur einer fehlt.
MEIN ERSTES STERBEN
1
Gefahr zieht mich magisch an«, sagte er. »Schon seit jeher. Was darf ich euch beiden bringen?«
Ich überlegte einen Moment. Es war bereits eine Stunde her, seit Meg und ich das Büro verlassen hatten, aber ich fühlte mich immer noch ganz aufgedreht. Überdreht. Ich musste an einen früheren Freund denken, einen Schauspieler. Er hatte mir erzählt, dass er nach der Vorstellung immer Stunden brauchte, bis er wieder zur Ruhe kam, was ein kleines Problem darstellte, wenn der Vorhang um halb elf fiel und man den Ehrgeiz hatte, so zu leben wie der Rest der Welt. Am Ende musste er feststellen, dass er hauptsächlich so lebte wie andere Schauspieler, denn das waren die einzigen Leute, die erst um elf zum Abendessen aufbrachen und jeden Tag bis Mittag schliefen.
Eine Collegefreundin ist Langstreckenläuferin. Ihre Leistungen sind so beeindruckend, dass sie fast einmal an olympischen Spielen teilgenommen hätte. Sie rennt unglaublich schnell und weit, um ihren Körper überhaupt in Schwung zu bringen. Anschließend läuft sie eine richtig lange Strecke und quält sich extreme Steigungen hinauf. Danach hat sie Schwierigkeiten, ihren Körper auf einen normalen Level zurückzufahren, weswegen sie einfach weiterläuft. Hinterher kühlt sie ihre Muskeln und Gelenke mit Eis. Das könnte mir auch nicht schaden. Manchmal würde ich am liebsten meinen ganzen Kopf in eine klirrend kalte Tonne voll Eis stecken.
»Das ist doch keine so schwierige Entscheidung«, sagte er. »Meg hat schon einen Weißwein in Auftrag gegeben.« »Was?«, fragte ich.
Für einen Moment hatte ich vergessen, wo ich mich befand. Ich musste mich erst umsehen, um es mir wieder ins Gedächtnis zu rufen. Es war wundervoll. Obwohl wir schon Herbst hatten, war es ein heißer Abend, und die Gäste der Bar in Soho standen bis hinaus zur Straße. Man hatte das Gefühl, als würde der Sommer nie enden, der Winter niemals kommen, nie wieder Regen fallen. Draußen auf dem Land brauchten die Felder dringend Wasser, Flüsse waren ausgetrocknet, und die Ernte verdorrte allmählich, aber mitten in London kam man sich vor wie am Mittelmeer.
»Was möchten Sie trinken?«
Ich bat um einen Weißwein und ein Glas Wasser. Dann legte ich einen Arm um Megs Schultern und murmelte ihr ins Ohr:
»Hast du mit Deborah gesprochen?«
Ihr Blick wirkte leicht gequält. Demnach also nicht.
»Noch nicht«, sagte sie.
»Wir müssen drüber reden. Morgen, ja?«
»Mit oder ohne Kohlensäure?«, fragte der Mann.
»Leitungswasser«, antwortete ich. »Gleich in der Früh, Meg, vor allem anderen.«
»In Ordnung«, sagte sie. »Dann also um neun.«
Ich sah sie an, während ihr Blick dem Mann folgte, der zur Bar schlenderte. Er hatte ein nettes, offenes Gesicht. Wie hieß er gleich noch mal? Ach ja, Todd. Wir waren alle zusammen nach einem harten Tag aus dem Büro herübergekommen. Inzwischen hatte sich die Gruppe jedoch aufgelöst und in der Menge verteilt. Überall entdeckte ich vertraute Gesichter. Todd, einer unserer Kunden, hatte vorbeigeschaut, um sich über unser Angebot zu informieren, und war anschließend mit in die Kneipe gegangen. Nun versuchte er gerade, an der belagerten Bar unsere Getränke zu bestellen. Dabei gab’s Probleme, weil eine der Barfrauen gerade von einem unhöflichen Gast angeschrien wurde. Sie war Ausländerin – Indonesierin oder so was Ähnliches –, und der ungehobelte Gast brüllte, sie habe ihm den falschen Drink gegeben. Sie hatte ihn offensichtlich nicht verstanden. »Sehen Sie mich an, wenn ich mit Ihnen rede!«, rief er.
Todd kam mit unseren Getränken zurück. »Sie wollten mir kein Leitungswasser geben«, erklärte er. »Es ist aus der Flasche.« Ich nahm einen Schluck.
»So so, Sie begeben sich also gern in Gefahr«, sagte ich.
»Das hört sich an, als fänden Sie es albern, aber ja, irgendwie schon.«
Todd begann uns voller Stolz von einer Urlaubsreise in das südliche Afrika zu erzählen, wo er mit ein paar Freunden eine Reihe gefährlicher Sportarten ausprobiert hatte: in Sambia Wildwasser-Rafting, in Botswana eine Kanufahrt vorbei an Flusspferden, dann Bungeejumping aus einer Seilbahn, die den Tafelberg hinauffuhr, und zum Schluss Sporttauchen zwischen großen weißen Haien.
»Klingt beeindruckend«, meinte Meg. »Ich glaube nicht, dass ich mich das trauen würde.«
»Es war sehr aufregend«, sagte er. »Aber auch beängstigend. Ich glaube, so richtig gefallen hat es mir erst im Nachhinein.« »Ist jemand gefressen worden?«, fragte ich.
»Man wird in Käfigen hinuntergelassen«, erklärte er, »und wir haben keine zu Gesicht bekommen.«
»In Käfigen?« Ich verzog das Gesicht. »Ich dachte, Sie mögen die Gefahr.«
Er wirkte leicht irritiert. »Soll das ein Witz sein?«, antwortete er. »Ich möchte Sie mal sehen, wenn Sie, nur mit einem Gummiband gesichert, Hunderte von Metern aus einer Seilbahn springen.«
Ich lachte, wenn auch hoffentlich nicht allzu spöttisch. »Kennen Sie unseren Prospekt nicht?«, fragte ich. »Wir haben selbst schon solche Bungeejumping-Events veranstaltet. Haben eine Risikobeurteilung gemacht und die nötigen Versicherungen organisiert. Glauben Sie mir, es ist weniger gefährlich, als die Straße zu überqueren.«
»Trotzdem bekommt man dabei einen ganz schönen Adrenalinstoß«, meinte Todd.
»Adrenalin kann man auch im Supermarkt kaufen«, gab ich zurück. Würde er jetzt beleidigt reagieren oder lächeln?
Er zuckte selbstironisch mit den Schultern und lächelte. »Was verstehen denn Sie dann unter Gefahr?«
Ich überlegte einen Moment. »Echte Herausforderungen. An Orten, wo es wirklich um etwas geht. Nach Minen zu suchen und sie zu entschärfen. Im Bergbau zu arbeiten – aber nicht hier in Großbritannien. Ich meine, in Russland oder der Dritten Welt.«
»Was macht Ihnen am meisten Angst?«
»Viele Dinge. Fahrstühle, Stiere, große Höhen, schlimme Träume. Fast alles, was mit meinem Beruf zu tun hat. Zu versagen. Vor Publikum zu sprechen.«
Todd lachte. »Das glaube ich nicht«, sagte er. »Ihre Präsentation heute war gut.«
»Ich bin vorher immer schrecklich aufgeregt.«
»Dann sind wir ja doch einer Meinung. Sie mögen Herausforderungen.«
Ich schüttelte den Kopf. »Ihr Bungeespringen und Kanufahren vorbei an Flusspferden, das war doch alles aus dem Katalog. Sie wussten, wie es ausgehen würde.« Hinter mir wurde es laut, und ich drehte mich um. Der unhöfliche Mann schimpfte wieder mit der Barfrau, diesmal noch heftiger als zuvor. Sie versuchte ihm etwas zu erklären und war den Tränen nahe.
»Und Sie?«, wandte sich Todd an Meg. Sie lächelte ihn schüchtern an und war im Begriff zu antworten, aber ich kam ihr zuvor.
»Sie sagen also, Sie mögen die Gefahr?«, fragte ich.
»Ja.«
»Adrenalin?«
»Ich denke schon.«
»Wollen Sie es mir beweisen?«
»Holly!«, mischte Meg sich nervös ein.
Todds Blick wanderte rasch von einer Seite zur anderen. Ich entdeckte darin eine Spur von Faszination, aber auch Nervosität. Was würde jetzt kommen?
»Wie meinen Sie das?«
»Sehen Sie den Mann drüben an der Bar, der gerade mit dem Mädchen schimpft?«
»Ja.«
»Finden Sie ihn rüpelhaft?«
»Ich glaube schon. Ja.«
»Dann gehen Sie doch rüber, und sagen Sie ihm, dass er aufhören und sich für sein Verhalten entschuldigen soll.«
Todd wollte etwas antworten, begann aber stattdessen zu husten. »Seien Sie nicht albern!«, stieß er schließlich hervor.
»Befürchten Sie, dass er Ihnen eine verpasst?«, fragte ich. »Ich dachte, Sie mögen die Gefahr.«
Todds Miene wurde hart. Das war nicht mehr lustig. Er hatte soeben aufgehört, mich nett zu finden. »Das ist doch bloß was für Angeber«, sagte er.
»Sie haben Angst davor.«
»Natürlich habe ich Angst.«
»Wenn Sie Angst davor haben, dann können Sie dieses Gefühl nur loswerden, indem Sie es tun. Das ist wie Sporttauchen zwischen Haien. Aber ohne den Käfig.«
»Nein.«
Ich stellte meine beiden Gläser auf einem Tisch ab. »Na gut«, sagte ich. »Dann mache ich es eben.«
»Nein, Holly, nicht …«, widersprachen Meg und Todd gleichzeitig.
Das war genau die Ermutigung, die ich noch gebraucht hatte. Ich ging zu dem Mann an der Bar. Er trug einen Anzug. Alle Männer im Raum trugen Anzüge. Er war etwa Mitte dreißig, und sein Haar begann sich bereits zu lichten. Sein Gesicht sah rot aus. Erst jetzt erkannte ich, wie groß er war. Sein Jackett spannte über seinen breiten Schultern. Außerdem befand er sich in Begleitung zweier anderer Männer. Gerade sagte er wieder etwas mehr oder weniger Unverständliches zu der Frau.
»Was läuft hier ab?«, fragte ich.
Überrascht drehte er sich um. »Wer, zum Teufel, sind Sie?« Seine Stimme klang wütend.
»Sie sollten sich bei dieser Frau entschuldigen«, erklärte ich.
»Was?«
»So redet man nicht mit einem anderen Menschen. Sie sollten sich entschuldigen.«
»Verpissen Sie sich.«
Er sagte das mit besonderer Betonung auf dem P, sodass zwischen den ersten beiden Silben eine kleine Pause entstand. Bildete er sich ein, dass ich wieder gehen würde? Dass ich in Tränen ausbrechen würde? Ich griff nach seinem Glas auf dem Tresen. Es war ein Whiskyglas. Ich schwang es in seine Richtung und hielt erst ganz knapp vor seinem Kinn inne. Ich hätte jetzt gerne gesagt, dass der ganze Raum verstummte wie in einem alten Western, aber nur in unserer unmittelbaren Nähe erregte das Ganze ein wenig Aufmerksamkeit. Der Mann starrte auf das Glas hinunter, als versuchte er den Knoten seiner etwas gelockerten Krawatte in Augenschein zu nehmen. Man sah ihm an, dass er rasch überlegte: Ist diese Frau verrückt? Wird sie mir wirklich ein Glas ins Gesicht knallen? Wegen dieser Lappalie? Und mir selbst hätte eigentlich etwas ganz Ähnliches durch den Kopf gehen müssen: Wenn er fähig war, eine x-beliebige Barfrau zu beleidigen und anzuschreien, weil sie ihm das falsche Getränk serviert hatte, was würde er dann mit mir machen, nachdem ich ihn physisch bedroht hatte? Außerdem hätte mir der Gedanke kommen können, der Todd wahrscheinlich nervös gemacht hatte: dass dieser Mann womöglich gerade aus dem Gefängnis entlassen worden war. Dass er vielleicht einen Hang zur Gewalttätigkeit hatte. Unter Umständen machte es ihm besonderen Spaß, auf Frauen loszugehen. Aber das alles kam mir gar nicht in den Sinn. Ich starrte ihn einfach nur an. Spürte das Blut in meinem Hals pulsieren. Empfand das schwindelerregende Gefühl, nicht zu wissen, was in den nächsten fünf Minuten geschehen würde.
Plötzlich entspannte sich das Gesicht des Mannes, und er lächelte. »Meinetwegen«, sagte er. Vorsichtig nahm er mir das Glas aus der Hand, als könnte es explodieren. Er leerte es in einem Zug. »Unter einer Bedingung.«
»Und die wäre?«
»Ich darf Sie auf einen Drink einladen.«
Mein erster Impuls war, Nein zu sagen, aber als ich mich nach Todd und Meg umsah, stellte ich fest, dass sie verschwunden waren. Hatten sie Angst vor dem gehabt, was vielleicht passieren würde? Oder waren sie erst gegangen, nachdem sie gesehen hatten, was tatsächlich passierte? Ich zuckte mit den Achseln. »Nur zu«, sagte ich.
Er machte jetzt richtig auf Gentleman. Nachdem er die nervöse Barfrau herbeigewinkt hatte, nickte er in meine Richtung.
»Diese Frau – wie heißen Sie?« »Holly Krauss«, antwortete ich.
»Miss Holly Krauss hat mich darauf hingewiesen, dass ich grob zu Ihnen war und mich entschuldigen sollte. Nach reiflicher Überlegung bin ich zu dem Schluss gekommen, dass sie Recht hat. Ich bitte also vielmals um Entschuldigung.« Der Blick der Frau wanderte erst zu mir und dann wieder zu ihm.
Ich glaube nicht, dass sie wirklich begriff, was vor sich ging. Der Mann, der Jim hieß, bestellte mir einen doppelten Gin Tonic und einen weiteren für sich selbst.
»Cheers«, sagte er. »Ach, und übrigens ist sie wirklich eine beschissene Barfrau.«
Ich kippte meinen Drink hinunter, woraufhin er mir noch einen bestellte. Von da an lief der Abend in immer schnellerem Tempo ab. Es war, als wäre ich den ganzen Tag lang auf dem Rücken eines großen Vogels zu einem Berggipfel hinaufgeflogen und genau in dem Moment, als ich Jim das Glas unters Kinn hielt, am höchsten Punkt angekommen, wo sich der Vogel für einen Moment ausruhte und dann im Sturzflug talwärts sauste. In der Kneipe kam ich mir allmählich vor wie auf einer Party, wo ich ziemlich viele Leute kannte oder kennen lernen wollte oder sie mich kennen lernen wollten. Ich plauderte mit Jim und seinen Freunden, die die Geschichte mit dem Glas sehr lustig fanden.
Später unterhielt ich mich mit einem Mann, der in dem Büro uns gegenüber arbeitete. Als er dann mit ein paar Freunden aufbrach, um in einem privaten Klub zu Abend zu essen, fragte er mich, ob ich Lust hätte mitzukommen, und ich sagte Ja. Ab da geschahen die Dinge in schneller Abfolge, wie eine Serie von Schnappschüssen, als würden einzelne Momente von einem blitzenden Stroboskop beleuchtet. Der Klub befand sich in einem Haus aus dem achtzehnten Jahrhundert, wo alles aus abgewetzter Holzvertäfelung und nackten Dielen bestand. Es war ein Abend, an dem alles ganz einfach schien, alles machbar und möglich. Einer der Männer am Tisch, an dem wir aßen, war der Direktor des Klubs, was zur Folge hatte, dass er ständig mit dem Ober scherzte und uns besondere Köstlichkeiten servieren ließ. Ich führte ein langes, intensives Gespräch mit einer Frau, die für eine ganz tolle Firma arbeitete, eine Film- oder Fotogesellschaft oder Zeitschrift, auch wenn ich mich später an kein einziges Wort unserer Unterhaltung erinnern konnte. Das Einzige, was mir im Gedächtnis haften blieb, war die Tatsache, dass sie mich, als sie aufstand und ging, mitten auf den Mund küsste, sodass ich ihren Lippenstift schmecken konnte.
Jemand schlug vor, tanzen zu gehen. Ganz in der Nähe habe etwas Neues aufgemacht, wo es jetzt wahrscheinlich gerade losgehe. Ich warf einen Blick auf meine Uhr und stellte fest, dass es bereits nach Mitternacht und ich schon seit halb sechs Uhr morgens auf den Beinen war. Aber das spielte keine Rolle.
Wir, eine Gruppe von etwa zehn Leuten, die bis vor etwa einer Stunde noch Fremde gewesen waren, marschierten gemeinsam dorthin. Ein Mann legte unterwegs den Arm um mich und begann auf Spanisch oder Portugiesisch zu singen. Er hatte eine sehr schöne, sonore Stimme. Als ich hochblickte, sah ich, dass am Himmel die Sterne funkelten. Sie leuchteten so hell und nah, dass ich fast das Gefühl hatte, sie berühren zu können, wenn ich den Arm ausstreckte. Ich begann ebenfalls zu singen. Was, weiß ich nicht mehr, aber alle stimmten ein. Lachend hielten wir einander fest. Unsere Zigaretten glühten in der Dunkelheit.
Am Ende landeten wir wieder ganz in der Nähe des Büros. Ich weiß noch, dass mir durch den Kopf ging, wie sich der Kreis doch manchmal schloss und ich jetzt weniger müde war als zu Beginn des Abends. Ich tanzte mit dem Mann, der auf Spanisch gesungen hatte, dann mit einem anderen, der mir sagte, er heiße Jay, und plötzlich befand ich mich auf der Damentoilette, wo mir jemand eine Linie Koks spendierte. Der Klub war klein und gerammelt voll. Ein Schwarzer mit sanften Augen streichelte mein Haar und flüsterte, ich sei wundervoll. Eine Frau – ich glaube, sie hieß Julia – tauchte neben mir auf und erklärte, sie fahre jetzt nach Hause, und vielleicht sollte ich das auch tun, bevor etwas passiere. Sie schlug vor, mit mir zusammen ein Taxi zu nehmen, aber ich lehnte ab. Ich wollte ja, dass etwas passierte. Dass alles Mögliche passierte. Ich wollte nicht, dass der Abend schon endete. Ich wollte das Licht noch nicht ausschalten. Also tanzte ich weiter und fühlte mich dabei so leicht, als würde ich fliegen. Ich tanzte, bis mir der Schweiß übers Gesicht lief und in meinen Augen brannte, mein Haar feucht war und mir die Bluse am Körper klebte.
Dann gingen wir. Jay war dabei, glaube ich, und vielleicht auch der Sänger, und eine Frau mit wundervollem schwarzem Haar, die nach Patschuli roch, und andere Leute, die ich nur als Silhouetten vor dem Nachthimmel in Erinnerung habe. Es war so schön kühl draußen. Ich sog die Luft in meine Lungen und spürte, wie der Schweiß auf meiner Haut trocknete. Wir setzten uns an den Fluss, der schwarz und tief aussah. Man konnte die Wellen leise ans Ufer klatschen hören. Am liebsten wäre ich ins Wasser gesprungen und hätte mich von seiner Strömung bis zum Meer spülen lassen, an einen Ort, wohin mir niemand folgen konnte. Ich warf eine Hand voll Münzen, von denen aber nur ein paar ins Wasser fielen, und forderte die anderen auf, sich etwas zu wünschen.
»Und was wünschst du dir, Holly?«
»Dass es immer so ist wie heute«, antwortete ich.
Ich schob mir eine Zigarette zwischen die Lippen, und einer der Männer beugte sich zu mir herüber, um mir Feuer zu geben, wobei er die freie Hand schützend um das Feuerzeug legte. Ein anderer nahm mir die Zigarette wieder aus dem Mund und küsste mich. Ich zog ihn zu mir heran und erwiderte seinen Kuss, die Hände in seinem Haar. Dann küsste mich plötzlich noch einer, ich spürte seine Lippen an meinem Hals. Ich legte den Kopf zurück und ließ ihn gewähren. Alle liebten mich, und ich liebte alle. Sie hatten alle zärtliche, glänzende Augen. Ich verkündete, dass die Welt ein magischerer Ort sei, als wir meinten. Dann stand ich auf und lief über die Brücke.
Bei jedem Schritt hatte ich das Gefühl, vielleicht nie wieder auf dem Boden aufzukommen, hörte aber gleichzeitig das Geräusch meiner Schritte wie ein Echo um mich herum, und dann das Geräusch anderer Schritte, die mir folgten, mich aber nicht einholen konnten. Stimmen riefen meinen Namen. Sie klangen wie Eulenrufe. »Holly, Holly!« Ich lachte in mich hinein. Ein Wagen brauste vorüber, hielt mich einen Moment im Licht seiner Scheinwerfer fest.
In der Nähe einer Arkade mit Geschäften blieb ich schließlich stehen, um Luft zu holen, und dort fanden sie mich. Zwei von ihnen, glaube ich. Vielleicht waren es auch drei. Einer packte mich an den Schultern, drückte mich gegen eine Wand und sagte, endlich habe er mich, und nun werde er mich nicht mehr loslassen. Er sagte, ich sei wild, aber er könne auch wild sein. Er griff nach einem Stein. Sein Arm schwang nach hinten, und gleich darauf sah ich den Stein durch die Luft segeln. Es krachte laut, in der Bleiglasscheibe vor uns breitete sich ein gezackter Stern aus, und in einem Regal stürzte eine Pyramide aus Blechdosen in sich zusammen. Eine Sekunde lang war es, als würden wir gleich durch den Stern in eine andere Welt treten, wo ich ein völlig neuer Mensch sein konnte. Neu und frisch und heil.
Dann ging der Alarm los, ein hohes Kreischen, das aus jeder Richtung zu kommen schien, und der Mann packte mich am Handgelenk. »Los!«
Gemeinsam begannen wir zu rennen. Ich glaube, wir waren zu dem Zeitpunkt noch zu dritt, vielleicht aber auch nur noch zu zweit. Unsere Füße schienen sich synchron zu bewegen. Ich weiß nicht, warum wir zu laufen aufhörten, aber ich weiß, dass wir irgendwann in einem Taxi saßen und durch leere Straßen fuhren, vorbei an Läden mit Metalljalousien und dunklen Häusern. Ein Fuchs verharrte mitten in der Bewegung, als er das Taxi kommen sah. Still stand er einen Moment unter den Straßenlampen, ehe er in einen Garten glitt und in der Dunkelheit verschwand.
Danach geschahen ein paar Dinge, an die ich mich gleichzeitig erinnern und nicht erinnern kann, als wäre das alles einer anderen passiert, in einem Film oder Traum, von dem man weiß, dass man ihn hat, aus dem man aber nicht erwachen kann. Oder als wäre es mir passiert, während ich eine andere war: ich und doch nicht ich selbst. Ich war eine Frau, die lachend vor dem Mann die Treppe hinaufging und oben in einen Raum trat, der von einem schwachen Licht erhellt wurde. Auf einem alten Sofa türmte sich ein Berg Kissen, und von der Decke hing ein Käfig mit einem türkisfarbenen Wellensittich. Zwitscherte da wirklich ein Vogel vor sich hin und blickte mit seinen wissenden Augen auf die Frau hinunter, oder war das eine seltsame Halluzination? Jedenfalls schaute diese Frau aus dem Fenster auf Dächer und nächtliche Gärten, die sie noch nie zuvor gesehen hatte.
»Wo, zum Teufel, bin ich?«, fragte sie, während sie ihre Jacke zu Boden gleiten ließ. Dabei wollte sie die Antwort gar nicht wirklich hören. »Wer, zum Teufel, bist du?«, fragte sie als Nächstes, aber auch das wollte sie gar nicht wissen. Es spielte überhaupt keine Rolle. Außerdem lachte er sowieso nur. Nachdem er die Vorhänge zugezogen hatte, zündete er sich eine Zigarette an und reichte sie an sie weiter, oder vielleicht war es auch ein Joint. Während sie sich zurück in die Kissen sinken ließ, ihre Schuhe in eine Ecke schleuderte und die Beine unter den Körper zog, stieg ein wildes Verlangen in ihr auf.
»Was machen wir jetzt?«, fragte sie, aber natürlich wusste sie, was sie jetzt machen würden. Sie begann ihre Bluse aufzuknöpfen, und er beobachtete sie dabei. Auch der Wellensittich sah ihr zu. Aus seinem Schnabel drangen freche, hohe Trillerlaute. Sie trank etwas Klares, Feuriges und spürte die Hitze des Alkohols durch ihren Körper schießen, bis sie in ihrem Innersten geschmolzen war. Sie hörte Musik, aber es fühlte sich an, als käme sie aus ihrem Kopf. Sie konnte nicht unterscheiden zwischen dem Rhythmus ihrer Gefühle und den Tönen des Songs. Alles hatte sich mit allem anderen verbunden.
Eine Weile war sie mit der Musik allein im Raum, aber dann war sie es plötzlich nicht mehr. Ich war nicht mehr allein. Während ich mich zurücklehnte und mir von ihm den Rock ausziehen ließ, fühlte ich mich sanft und weich wie der Fluss, an dem wir gesessen hatten. Erst lagen wir auf dem Sofa, dann auf dem Boden. Finger machten sich an Knöpfen zu schaffen. Wenn ich die Augen schloss, blitzten hinter meinen Lidern Lichter auf, und es war, als befände sich dort eine ganz eigene, seltsame Welt, über die ich keine Kontrolle hatte und die gleich in meinem Gehirn explodieren würde. Deswegen hielt ich die Augen offen und versuchte mich auf die reale Welt zu konzentrieren, aber ich weiß nicht mehr, was ich sah. Risse in der Decke, das Bein eines Stuhls, eine Wand, die nur wenige Zentimeter von mir entfernt war, ein Gesicht, das sich auf das meine senkte, die Kontur eines Mundes. Ich schmeckte Blut und fuhr mir mit der Zunge über die Lippen. Mein Blut: gut. Der raue Teppich schürfte meine Haut auf: gut. Harte Finger bewegten sich über meine Arme, meinen Körper, gruben sich in mich. Mich und doch nicht mich. Mich und diese andere Frau, die gerade ihre Bluse auszog. Abgerissene Knöpfe landeten auf dem Boden, während sich die Frau auf ein Bett fallen ließ, das Haar auf dem Kissen ausgebreitet. Hände streckten sich ihr entgegen und zogen ihr den BH aus. Ein Gewicht legte sich auf sie. Als sie schließlich doch die Augen schloss, fand sie sich in einer hell erleuchteten Welt wieder, einer Welt voller explodierender Farben und rauschender Dunkelheit.
»Das ist so seltsam«, sagte sie. Sagte ich. »Hör nicht auf.«
2
Irgendetwas krabbelte mir über die Wange. Eine Fliege, unterwegs zu meinem Mundwinkel. Ohne die Augen aufzuschlagen, fegte ich sie mit der Hand weg. Träge brummte sie davon. Auch ohne sie zu sehen, wusste ich, dass es sich um eine jener fetten Spätsommerfliegen handelte, die voll gesogen waren mit Blut und Verfall. Hätte ich sie erschlagen, wäre ein rötlichbrauner Fleck zurückgeblieben.
Obwohl ich weiter reglos dalag, wusste ich, dass etwas nicht stimmte. Als ich es schließlich schaffte, ein Auge einen Spalt weit zu öffnen, bahnte sich sofort ein stechender Schmerz den Weg in mein Gehirn. Vorsichtig fuhr ich mir mit meiner ausgetrockneten Zunge über die Lippen. Sie fühlten sich geschwollen und rissig an. Außerdem hatte ich einen schrecklichen Geschmack im Mund: nach Schmutz und Fett und kaltem Rauch. Die leuchtenden Farben waren inzwischen verschwunden. Ich starrte durch einen düsteren Raum auf eine Tür, an der ein schmuddelig grauer Bademantel hing. Ich wandte den Blick nach links, wo durch die dünnen Vorhänge das schwache Dämmerlicht des frühen Morgens hereindrang. Ich hielt die Luft an und blieb reglos liegen. Hinter mir hörte ich ein gleichmäßiges Atemgeräusch. Ich schloss die Augen wieder und wartete, bis sich meine Träume vollends aufgelöst hatten und ich mich schließlich mit diesem Tag und dieser Person, die ich war, auseinander setzen musste. Ich berührte mein Gesicht, das sich taub und gummiartig anfühlte, fast wie eine Maske. Lautlos zählte ich bis fünfzig, dann öffnete ich beide Augen und wandte vorsichtig den Kopf. Ich spürte, wie sich hinter meiner Stirn ein dumpfer Schmerz ausbreitete und in meine Schläfen flutete.
Erst nach einer Weile begann ich meine Umgebung richtig wahrzunehmen. Ich lag auf der linken Seite eines Doppelbetts unter einer verdrehten hellen Bettdecke, deren Bezug in der Mitte einen großen, L-förmigen Riss aufwies. Im Raum gab es nur ein einziges, ziemlich hoch liegendes Fenster. Darunter stand ein Heimtrainer, über den eine Jeans und ein BH drapiert waren. Neben der Tür lag eine Sporttasche aus Nylon, darauf ein Squashschläger. Ein Schrank stand halb offen, ein paar auf Bügeln hängende Hemden waren zu sehen. In der Ecke türmte sich ein Zeitschriftenstapel, an dem eine Weinflasche lehnte. Unter dem Bett ragte die Spitze eines Sportschuhs heraus, flankiert von einem zusammengeknüllten Papiertaschentuch. Nur wenige Zentimeter von meinem Gesicht entfernt stand ein überquellender Aschenbecher, ein Teil der Asche war auf gestreiften Boxershorts gelandet. Ein Digitalwecker mit scheußlich grünen Leuchtziffern zeigte 4:46. Während ich mich langsam in eine sitzende Position manövrierte, entdeckte ich auf dem Laken ein paar Blutflecken, die aussahen, als wären sie mit zarten Pinselstrichen aufgemalt worden. Den Blick starr geradeaus gerichtet, schwang ich vorsichtig die Beine aus dem Bett. Als ich aufstand, schien der Boden unter mir zu schwanken. Ich befahl mir, mich nicht umzudrehen, aber es war, als würde mein Kopf an einem unsichtbaren Draht hängen, sodass ich einfach nicht anders konnte, als einen kurzen Blick auf die Gestalt im Bett zu werfen. Ich sah haarige Beine, die unter der Bettdecke herausragten, einen dunklen Haarschopf, einen Arm über den Augen, einen leicht offen stehenden Mund. Das war alles. Rasch wandte ich mich wieder ab. Ich wusste nicht, wer er war, wollte es auch gar nicht wissen. Durfte es nicht wissen.
Da ich dringend pinkeln musste, schlich ich zur Tür und zog sie vorsichtig auf. Trotzdem gab sie ein leises Ächzen von sich, das mich erschrocken zusammenzucken ließ. Über sandige Holzdielen huschte ich auf eine weitere Tür zu, die direkt gegenüberlag, doch als ich sie aufschob, musste ich feststellen, dass sie nicht wie erwartet ins Badezimmer führte. In dem Raum gab es einen Teppich, ein Bett und eine Gestalt, die sich umdrehte, den Kopf hob und schlaftrunken irgendetwas murmelte. Erschrocken zog ich die Tür wieder zu.
Mir war plötzlich kalt und übel.
Als ich die winzige Toilette endlich gefunden hatte, ließ ich mich zitternd auf der Klobrille nieder. Mein klammer, klebriger Körper fühlte sich an, als würde er mir gar nicht gehören, und es kostete mich gewaltige Anstrengung, wieder aufzustehen und mich ins Wohnzimmer zu schleppen. Dort schlug mir ein penetranter Geruch entgegen: Es stank nach Schweiß wie im Umkleideraum einer Turnhalle und gleichzeitig nach Rauch und Bier wie spätabends in einem Pub. Überall lagen Klamotten herum – seine und meine. Der Tisch war umgekippt, daneben lag eine zerbrochene Tasse. Zwischen verstreuten Kippen stand ein weiterer Aschenbecher. Meine Füße stießen gegen eingedrückte Bierdosen, unter denen ich eine umgefallene Schnapsflasche entdeckte. Ein grellbuntes Bild hing völlig schief an der Wand, und daneben prangte ein rötlicher, verschmierter Fleck. Auf dem Boden bemerkte ich außerdem einen seltsamen Kreis, der aus so etwas wie braunem Reis zu bestehen schien. Plötzlich fiel mir der Wellensittich wieder ein. Ich blickte hoch und sah seinen Käfig über den heruntergefallenen Samenkörnern hängen. Der Vogel schlief.
Leise zog ich meinen Rock hinter dem Sofa hervor. Meine Bluse fand ich völlig verknittert in einer Ecke des Raums. Sie hatte nur noch einen einzigen Knopf und war unter dem Arm aufgerissen. Einer meiner Schuhe lag unter dem Tisch. Als ich ihn aufhob, stellte ich fest, dass der Absatz wackelte. Nach ein paar Minuten hektischen Suchens entdeckte ich den zweiten draußen auf dem Gang vor dem Badezimmer. Mit angehaltenem Atem schlich ich zurück ins Schlafzimmer und zog meinen BH vom Trimmrad. Er roch stark nach Alkohol – wahrscheinlich Schnaps. Plötzlich spürte ich unter der Fußsohle etwas Klebriges und schaute nach unten. Ich stand auf einem benutzten Kondom. Vorsichtig zog ich es von meiner Haut und ließ es zurück auf den Boden fallen.
Ich konnte meinen Slip nicht finden. Entnervt ging ich in die Knie und spähte unters Bett, aber da war er auch nicht. Ich kehrte ein weiteres Mal auf den Gang zurück, wo meine Suche ebenfalls erfolglos blieb. Mir würde wohl nichts anderes übrig bleiben, als ohne zu gehen. Auf jeden Fall musste ich hier raus, bevor der Mann oder die Person im anderen Raum – oder gar der Vogel – aufwachte und mich entdeckte. Rasch schlüpfte ich in Rock und BH, streifte die dünne, zerrissene Bluse über, die ich mangels Knöpfen vorne zu einem Knoten zusammenband, und zwängte meine wunden Füße in die wackeligen Schuhe. Oben drüber kam die Jacke, aber leider handelte es sich um so ein dämliches Kleidungsstück, das nur einen einzigen dekorativen Knopf besaß und deswegen die Bescherung darunter kaum verhüllte. Ich sehnte mich danach, in einem warmen Flanellpyjama unter einer sauberen Bettdecke zu liegen, frisch geduscht, den Pfefferminzgeschmack von Zahnpasta im Mund … meine Tasche, wo war meine Tasche? Ich fand sie gleich neben der Eingangstür. Nachdem ich ihren halb herausgefallenen Inhalt wieder hineingestopft hatte, verließ ich rasch die Wohnung, zog die Tür leise hinter mir zu und eilte die Treppe hinunter. Erst als ich draußen auf der Straße stand, wurde mir bewusst, wie müde und erschöpft ich war. Einen Moment lang musste ich mich vornüberbeugen, um wieder zu Atem zu kommen.
Wo war ich? Ich ging bis zu dem Schild am Ende der Straße. Northingley Avenue, SE7. Wo war das? In welche Richtung musste ich mich wenden, um möglichst schnell von hier wegzukommen? Laut meiner Uhr – die sich wie durch ein Wunder noch an meinem Handgelenk befand – war es inzwischen zehn nach fünf. Ich ließ den Blick die Straße entlangschweifen, als bestünde die Hoffnung, dass plötzlich ein Taxi auftauchen würde. Dann holte ich tief Luft und marschierte aufs Geratewohl los. Ich hatte das Gefühl, überhaupt nicht voranzukommen. Alles schien noch genauso weit entfernt zu sein wie vorher. Es war kalt und noch nicht ganz hell. Ich kroch wie eine Schnecke an den unbeleuchteten Häusern vorbei.
Schließlich erreichte ich eine Straße, in der es ein paar Geschäfte gab, und eines davon, ein Zeitungsladen, öffnete gerade. Ich tauchte unter dem halb hochgezogenen Gitter hindurch und trat auf die Ladentheke zu, hinter der ein Mann damit beschäftigt war, Zeitungen zu stapeln. Als er von seiner Arbeit hochblickte, riss er erschrocken die Augen auf.
»Was …?«, stotterte er. »Sind Sie überfallen …?«
»Können Sie mir bitte sagen, wie ich zur nächsten U-Bahn Station komme?«, fiel ich ihm ins Wort.
Aus seinem Blick sprach plötzlich so etwas wie Ekel. Ich versuchte meine Jacke weiter zuzuziehen und dabei möglichst lässig dreinzublicken.
»Sie brauchen nur in diese Richtung weiterzugehen. Etwa siebenhundert Meter.«
Ich erstand eine Flasche Wasser und ein Päckchen Taschentücher.
»Danke«, sagte ich, nachdem ich das Geld aus der Tasche gefischt hatte. Der Mann starrte mich bloß an. Ich versuchte zu lächeln, aber es gelang mir nicht. Es war, als wäre mein Mund zu verkrampft, um sich zu bewegen.
Am frühen Morgen fahren seltsame Leute mit der U-Bahn. Diejenigen, die nach einer langen Nacht nach Hause wanken, treffen mit jenen zusammen, die bereits – wenn auch noch etwas schlaftrunken – in den neuen Tag starten.
Während ich am Bahnhof auf den ersten Zug wartete, ließ sich neben mir ein Typ mit wundervollen langen Dreadlocks nieder und begann auf seiner Mundharmonika zu spielen. Ich wollte ihm ein bisschen Kleingeld geben, aber er erklärte mir, er sei kein Bettler, sondern ein wandernder Musikant, und ich sei ganz offensichtlich eine Dame in Not. So überließ ich ihm meine Zigaretten, wofür er sich mit einem Handkuss bedankte. Meine Fingerknöchel waren aufgeschürft, meine Nägel dreckig.
Als ich schließlich im Zug saß, schüttete ich ein wenig Wasser auf ein paar Papiertaschentücher und tupfte damit in meinem Gesicht herum. Wimperntusche, Blut. Ich versuchte im Fenster einen Blick auf mein Spiegelbild zu erhaschen, sah aber nur einen blassen, verschwommenen Fleck. Ich kämmte mich noch rasch und stieg dann in die Northern Line um.
Um zehn vor sechs traf ich vor meiner dunkelgrünen Haustür ein. Ich fühlte mich, als wäre ich einen hohen Berg hinaufgestiegen und anschließend noch einen Marathon gelaufen, um an mein Ziel zu gelangen. Zitternd schloss ich auf, trat in die Diele und ließ meine Tasche neben der Metallstaffelei und den noch ungeöffneten Farbdosen fallen. Nachdem ich meine Schuhe in eine Ecke gekickt hatte, ging ich in die Küche und trank dort gierig zwei Gläser Wasser. Dann zog ich meine Bluse aus und stopfte sie so tief in den Abfalleimer, dass sie vollständig von Blechdosen und Kaffeesatz bedeckt war.
Die Treppe kam mir an diesem Tag so steil vor, dass ich sie auf allen vieren hinaufkriechen musste. Im Badezimmer angekommen, entledigte ich mich meiner restlichen Klamotten, die ich unter die anderen Sachen im Wäschekorb schob. Als ich schließlich einen Blick in den Spiegel warf, musste ich an mich halten, um nicht vor Schreck laut aufzuschreien: Mir starrte eine erschöpfte, schmuddelige, blutverschmierte Frau mit geschwollenen Lippen, roten Augen und verfilztem Haar entgegen. Ich sah aus wie ein Stück Müll.
Ich drehte die Dusche so heiß auf, dass ich es gerade noch ertragen konnte, und wusch mir die Haare, bis meine Kopfhaut brannte. Dann seifte ich mich von oben bis unten ein und schrubbte meine Haut, als könnte ich eine ganze Schicht wegrubbeln und als völlig neuer, reiner Mensch aus dieser Prozedur hervorgehen. Ich putzte mir die Zähne, bis mein Gaumen blutete, gurgelte hinterher noch mehrfach mit Mundwasser, massierte mir Creme ins Gesicht, rieb mich mit Körperlotion ein und verteilte Deo unter den Achseln.
Als ich schließlich ins Schlafzimmer ging, zeigte der Wecker sechs Uhr elf. Nachdem ich mich davon überzeugt hatte, dass er wie üblich auf sieben Uhr zehn gestellt war, glitt ich unter die Bettdecke und schlang die Arme um die Knie. »Holly?«, murmelte Charlie. »Wie spät ist es?« »Schhh. Schlaf weiter. Es ist alles in Ordnung.«
Während ich einschlief, ging mir durch den Kopf, dass ich vergessen hatte, meinen Ehering wieder anzustecken.
3
Holly. Holly, ich hab dir Kaffee gebracht. Es ist zwanzig nach sieben.«
Einen Moment lang blieb ich mit einem Arm über den Augen liegen, weil mir vor dem grellen Morgenlicht graute. Meine Gliedmaßen fühlten sich an wie Blei, mein Mund war ausgetrocknet, in meinem Kopf pochte es, und mein Hals schmerzte. Ich konnte dem Tag nicht ins Gesicht blicken. Ich konnte Charlie nicht ins Gesicht blicken.
»Holly«, wiederholte er.
Schließlich schaffte ich es doch, den Arm wegzunehmen, die Augen zu öffnen und in sein nettes Gesicht zu sehen, seine braunen Augen, in denen ich keine Spur von Abscheu oder Überraschung entdecken konnte. »Guten Morgen, Charlie. Du bist heute aber schon früh auf.«
Auf eine lässige, gemütliche Art strahlte er Wärme und Verlässlichkeit aus. Er arbeitete zu Hause, deswegen brauchte er keinen Anzug anzuziehen und keine öffentliche Maske aufzusetzen, wie ich es jeden Tag tue, wenn ich morgens vor dem Spiegel stehe und mich schminke. Lächeln, Holly, immer schön lächeln. Charlie hingegen trug einfach seine alte graue Cordhose und ein langärmeliges senffarbenes Hemd, bei dem der Kragen schon ein wenig ausfranste.
Ich stützte mich auf einen Ellbogen und nahm einen Schluck von dem Kaffee. Er war stark, heiß und schwarz.
»Spät geworden gestern?«, fragte er.
»Irgendwie nahm es mal wieder kein Ende.«
»Ich hab dich gar nicht kommen gehört.«
»Du hast geschlafen wie ein Murmeltier. Mein Gott, ist es wirklich schon so spät? Anscheinend habe ich das Läuten des Weckers nicht gehört. Ich komme gleich runter.«
Während ich noch einmal die Augen schloss, hörte ich ihn den Raum verlassen. Ich hatte gerade mal eine gute Stunde geschlafen, und nun blieben mir noch ungefähr drei Minuten, ehe ich wieder ein Mensch werden musste, um zu all den anderen zu passen, die ebenfalls so taten, als wären sie Menschen. Ich zog mir die Bettdecke über den Kopf und zwang mich, über die Ereignisse des Vorabends nachzudenken. Allerdings fühlte es sich nicht wirklich wie Nachdenken an, sondern eher wie die Schläge eines Boxers, der seine Fäuste gezielt in die weichen Stellen meines Körpers platzierte, wo sie keine Spuren hinterlassen würden. Das Atmen fiel mir schwer. Ich keuchte und hustete, als wäre ich gerade von einer großen Welle an den Strand gespült worden. Ich musste daran denken, wie die Frau – ich – letzte Nacht gelacht und geflirtet hatte. Leichtsinnig jeder Versuchung nachgebend. Nein, nicht nachgebend, eher schon nachjagend. Die Königin der Party. Nun schien sie nur noch eine abgewrackte Langweilerin zu sein. Ich stellte mir vor, wie ich in jenem Raum gelegen hatte, jenem anderen Bett, mit dem fremden Mann – wer auch immer er gewesen sein mochte.
Das ist das Problem mit Liebe und Sex: Die Leute schreiben Lieder und Gedichte oder machen Filme darüber, und wir alle schwärmen und träumen davon, wollen es genauso erleben oder wenigstens besser, als wir es gewöhnt sind. Wenn es dann aber so weit ist – wenn wir den Klub verlassen und unsere Klamotten ausgezogen haben –, läuft es am Ende doch nur auf einen pickeligen Rücken und ein fleckiges Laken hinaus, eine schreckliche Wohnung irgendwo in einem miesen Stadtteil von London, wo man noch nie gewesen ist, und ein glitschiges Kondom auf dem Teppich, bei dessen Anblick man am liebsten kotzen würde. Ich dachte daran, in die Küche hinunterzugehen, mich zu Charlie zu setzen und ihm zu sagen, was in der Nacht zuvor geschehen war, während er friedlich in unserem Bett geschlafen hatte. Wie dumm und widerlich das gewesen war. Wie überflüssig. Ich stellte mir vor, wie sein Gesichtsausdruck sich verändern würde, während ich es ihm erzählte. Voller Scham verkroch ich mich noch tiefer unter meine Bettdecke und stöhnte laut. Was ich getan hatte, erfüllte mich selbst mit Ekel. Ach, könnte ich doch nur die Uhr zurückdrehen und gemeinsam mit Meg aus der Kneipe verschwinden … Den Lärm, das Licht und das Lachen hinter mir lassen und zu meinem Mann heimfahren, um unter einer sauberen Bettdecke neben ihm einzuschlafen und an diesem Morgen mit reinem Gewissen aufzuwachen … Ach, könnte ich doch nur, ach, könnte ich doch nur …
Ein Teil von mir wusste nur allzu gut, dass sich dadurch mein Leben verändert hatte. Eine kleine Stimme in meinem Kopf flüsterte mir ständig zu: »Du hast Ehebruch begangen.« Ich konnte mich an den Religionsunterricht in der Schule erinnern, an Bruchstücke aus der Bibel, in denen es darum ging, dass man Ehebruch auch im Herzen begehen konnte, indem man jemanden einfach nur lustvoll ansah. Ich aber hatte den Ehebruch weder in meinem Herzen noch in meinem Kopf begangen, sondern mit meinem Körper. Charlie durfte nichts davon erfahren. Es würde ihn zu sehr verletzen und außerdem wie ein großer, sich ausbreitender Fleck alles in unserem Leben beschmutzen.
Ich bin eine gute Lügnerin, schon immer gewesen. Seit jenem wundervoll stürmischen, viel versprechenden Herbsttag, an dem ich ihn aufs Standesamt schleifte, gefolgt von den zwei verblüfften, leicht verlegenen Trauzeugen, die wir uns einfach von der Straße schnappten, ist es mehrfach vorgekommen, dass ich ihm gegenüber nicht ganz ehrlich war, ihn irgendwie beschummelte oder hinterging, aber niemals so wie letzte Nacht. Das war das erste Mal.
Ich hörte unten Geschirr klappern und die Post durch den Briefschlitz auf den blanken Holzboden in der Diele fallen. Langsam zog ich die Bettdecke von meinem Gesicht und blinzelte ins Licht. Meine Beine schmerzten, meine Augen brannten, und die Drüsen an meinem Hals waren geschwollen. Vielleicht bekam ich ja die Grippe, dachte ich voller Hoffnung. Dann hätte ich wenigstens einen Grund, mich noch ein wenig länger vor der Welt zu verstecken. Aber ich wusste, dass es keine Grippe war, sondern nur ein Kater und ein schlechtes Gewissen.
»Raus aus den Federn, Holly!«, befahl ich mir selbst, und wie ein Roboter, der jede Anweisung seines Meisters befolgt, setzte ich mich trotz des Schmerzes, der in meinem Kopf zu pochen begann, auf und schwang die Füße auf den Boden. Ich wartete, bis der Raum zu schwanken aufhörte, und schlurfte dann ins Bad, wo ich mir mit kaltem Wasser das Gesicht wusch. Benommen betrachtete ich mich im Spiegel: das dunkelblonde Haar, von dem Charlie immer sagte, es sehe aus wie eine Löwenmähne, die grauen Augen, die mir unter dichten Brauen offen entgegenblickten, den breiten Mund, der mich so strahlend anlächelte. Wie konnte es sein, dass mein Geist von einer dicken schwarzen Schmutzschicht überzogen war, während mein Gesicht so frisch und fröhlich wirkte?
»Mir kannst du nichts vormachen!«, zischte ich mein Spiegelbild an und verzog dabei das Gesicht zu einem hässlichen Grinsen. »Ich kenne dich, Holly Krauss. Mich kannst du nicht zum Narren halten!«
*
»Fängst du heute um die übliche Zeit an?« Charlie öffnete einen Brief, warf einen Blick darauf und knüllte ihn dann zusammen.
»Mir bleibt nichts anderes übrig. Ich habe um neun einen Termin mit Meg. Und vorher muss ich noch jemandem auf die Finger schauen.«
Charlie drehte sich zu mir um. »Das klingt aber nicht gut.«
»Ich weiß«, antwortete ich. »Und dann werden wir schuften wie verrückt, alles für kommendes Wochenende vorbereiten. Das wird ein Alptraum. Von wem war denn der Brief?« »Kommendes Wochenende? Davon weiß ich ja gar nichts. Worum geht’s?«
»Das hab ich dir doch erzählt. Zwölf Manager, die auf einem Floß einen Teich überqueren. Damit sie mehr Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln. Was liegt bei dir denn heute an?« »Ach, alles Mögliche. Möchtest du was zum Frühstück?« »Mal sehen«, antwortete ich unentschlossen.
Beim Aufwachen war ich sicher gewesen, mein ganzes Leben lang niemals wieder etwas zu mir nehmen zu können, außer vielleicht Kaffee, aber nun überfiel mich schlagartig ein solcher Heißhunger, dass ich ganz zittrig davon wurde und schon befürchtete, vor Schwäche in Ohnmacht zu fallen. Hatte ich gestern überhaupt etwas gegessen? Ich ließ den Abend vor meinem geistigen Augen Revue passieren, als würde ich ein Video abspulen. Wir hatten viel geredet, getrunken und geraucht. Hin und wieder tauchte in meinem internen Video auch etwas Essbares auf, aber ich hatte es hauptsächlich auf meinem Teller herumgeschoben. Ich ging den Tag noch ein Stück weiter zurück. Das Mittagessen hatte ich ausfallen lassen und das Frühstück aller Wahrscheinlichkeit nach auch, obwohl ich schon um halb sechs aufgestanden war. Hatte ich mich womöglich in irgendeine neue Spezies Mensch verwandelt, die weder Schlaf noch Nahrung brauchte?
Ich stöberte im Kühlschrank herum, fand ein Stück Schweinepastete, an dem ich ein wenig herumknabberte, und öffnete anschließend einen Joghurt. Es schmeckte alles wie Kreide, und die Kombination von zwei so unterschiedlichen Speisen machte es nur noch schlimmer. Was für eine seltsame Angewohnheit, dachte ich, Dinge aus der uns umgebenden Welt in den Mund zu nehmen, dort zu zerkauen und dann hinunterzuschlucken, um uns auf diese Weise zu erhalten. Allein schon der Gedanke hätte mir den Appetit verderben müssen, wäre da nicht dieses unbändige Verlangen in meinem Magen gewesen. Dabei handelte es sich eigentlich gar nicht so sehr um Appetit, sondern eher so etwas wie das Signal eines Roboters, das dieser aussendet, wenn sein Akku aufgeladen werden muss.
Charlie musterte mich prüfend. »Hier, trink noch eine Tasse Kaffee. Ich kann dir auch was Anständiges machen, wenn du möchtest.«
»Kaffee ist schon in Ordnung.«
»Eier und Speck, ein Omelett, ein paar Würstchen, ach nein, Würstchen haben wir keine, und Speck auch nicht, wenn ich’s mir recht überlege, und was die Eier betrifft, bin ich mir auch nicht so sicher. Aber Brot ist da.«
»Nein, nein, schon gut«, sagte ich lachend – oder versuchte zumindest zu lachen. Es war, als würde ich gleichzeitig im Publikum sitzen und auf der Bühne stehen, mich selbst bei dem Versuch beobachten, eine normale Frau zu spielen.
»Was sind denn deine Pläne für gestern Abend?«
Charlie starrte mich verblüfft an. »Hast du gerade gestern Abend gesagt?«, fragte er.
»Nein. Oder etwa doch?«
»Gestern Abend war ich zu Hause. Heute Abend weiß ich noch nicht. Und du, hast du schon was vor?«
»Wir könnten was zusammen unternehmen oder es uns einfach gemütlich machen. Das wäre schön.« Ich ging zu ihm, fuhr mit den Händen in sein dichtes Haar und beugte mich hinunter, um seine angenehme morgendliche Frische zu riechen und einen Kuss auf seine Wange zu drücken. »Charlie?«
»Mmmm?«
»Ach, nichts.«
Ich wollte nach meiner Kaffeetasse greifen, stellte mich dabei aber so ungeschickt an, dass sie auf dem Boden landete und der Kaffee sich vor meinen Füßen ergoss.
»Lass nur«, sagte Charlie. »Ich mache das schon.« Er kauerte sich auf den Boden, sammelte die Bruchstücke ein und wischte den verschütteten Kaffee mit einer Küchenrolle auf.
»Ausgerechnet die Tasse, die wir in der Töpferei bei Brighton zusammen gekauft haben!« Ich war den Tränen nahe.
»Das kann ich reparieren.«
»Nein, kannst du nicht. Es tut mir so Leid!«
»Es ist doch nur der Griff, Holly. Schau. Wenn ich es geklebt habe, wirst du gar nicht mehr sehen, wo es gebrochen war. Lass mich nur machen.«
Ich starrte ihn an und dachte: Jetzt. Sag es ihm jetzt sofort. Hetze nicht los in die Arbeit. Nimm stattdessen seine Hand und sieh ihm ins Gesicht. Rede ein einziges Mal in deinem dämlichen Leben offen und ehrlich mit ihm. Aber in dem Moment klopfte es laut an der Tür.
»Ich gehe schon«, sagte ich.
Es war Naomi von nebenan. Sie war Anfang des Jahres eingezogen und unsere einzige Freundin in der Straße. Sie sah ungekämmt aus. Ihre dunklen Locken standen wild vom Kopf ab, und sie trug Hausschuhe. »Ich komme zum Schnorren«, erklärte sie, während sie in die Diele trat. »Mir ist der Kaffee ausgegangen.«
»Wir haben jede Menge, und in der Kanne ist auch noch welcher. Trink doch gleich hier eine Tasse.«
Ihr Blick wanderte nervös zwischen mir und Charlie hin und her. »Wenn ihr wirklich meint …«
»Ich bin gerade am Gehen, aber Charlie bleibt da.«
Ich ließ die beiden in der Küche zurück und trat erleichtert auf die Straße hinaus, wo mich niemand kannte.
Eigentlich mag ich unrealisierbare Projekte, weil die Leute dann dankbar sind, wenn man überhaupt etwas zustande bringt. Bei einer solchen Gelegenheit sind Meg und ich uns vor knapp fünf Jahren begegnet, auch wenn es mir manchmal vorkommt, als würden wir uns schon ein Leben lang kennen. Wir hatten damals beide unseren ersten Job, und zwar als Mädchen für alles in einer schrecklich chaotischen Firma. Eines Tages erschien eine Frau, um sich nach dem genauen Programm für den nächsten Tag zu erkundigen, aber wie sich herausstellte, hatte unser Chef Derek den Auftrag völlig vergessen. Und als wäre das nicht schon genug, verzog er sich auch noch in sein Büro. Nach etwa einer Stunde ging ich, ohne anzuklopfen, hinein und fand ihn weinend vor. Noch heute kann ich mich genau an sein unglückliches, verquollenes Gesicht und seine roten Augen erinnern. Er machte einen derart verzweifelten Eindruck, dass ich zu ihm sagte, er solle sich keine Sorgen machen, wir würden das schon irgendwie regeln. Daraufhin nahm er meine Hand und eröffnete mir, seine Frau sei mit ihrem Raumausstatter durchgebrannt.
Meg und ich hatten nichts zu verlieren. Wir waren erst zweiundzwanzig, und alles schien möglich. Als Erstes riefen wir die Frau an und ließen uns von ihr ein paar Einzelheiten über die Firma erzählen. Dann suchten wir uns ein geeignetes Hotel und dachten uns anhand von Anregungen, die wir uns bei verschiedenen Leuten im Büro holten, ein paar Aktivitäten aus. Wir blieben die ganze Nacht auf und bereiteten Kärtchen und kleine Ansprachen vor. Was am nächsten Tag dabei herauskam, war zwar nicht gerade der tollste Betriebsausflug aller Zeiten, aber Meg und ich hatten das Fiasko abgewendet. Meg ist die Geradlinige in unserem Zweierteam, und Flirten ist nicht ihre Sache. Wenn ihr ein Mann gefällt, wird sie linkisch und hektisch, lacht an den falschen Stellen und errötet ständig. Außerdem gibt sie niemals an. Das ist bei mir ganz anders, und wenn ich es tue, mustert sie mich immer mit einem seltsamen Blick, einer Mischung aus Nachsicht und leichter Nervosität.
Jedenfalls standen wir den ganzen Tag unter Strom, und am Abend ging es in einer Bar weiter. Kurz nach Mitternacht erschien die Frau, von der wir den Auftrag hatten, und umarmte uns. Sie bedankte sich überschwänglich und meinte, ohne uns hätte sie ihren Job verloren. Am nächsten Tag war Derek so gerührt, dass er wieder in Tränen ausbrach. Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage saß ich ihm gegenüber, sprach beruhigend auf ihn ein und musterte ihn dabei verstohlen. Ich weiß noch, dass es mir kalt den Rücken hinunterlief. Wir befanden uns beide auf einem Hochseil und taten, als wäre alles ganz einfach. Dabei reichte womöglich ein einziger Blick nach unten – die Erkenntnis, dass es kein Sicherheitsnetz gab –, um das Gleichgewicht zu verlieren und zu fallen.
Und trotzdem war das Ganze zugleich der absolute Höhepunkt meines bisherigen Lebens. Ich habe schon öfter Leute sagen hören, sie würden träumen, auf einer Bühne zu stehen und plötzlich ihren Text nicht mehr zu können. Seit jenem Tag weiß ich, dass das keineswegs mein größter Alptraum ist. Ganz im Gegenteil: Ich suche mir solche Situationen bewusst aus. Mein Alptraum beginnt erst, wenn die Show vorüber ist.
Ein paar Monate später beschlossen Meg und ich, den Alleingang zu wagen. Ich hatte noch nie einen Menschen kennen gelernt, den ich so mochte wie sie. Ich glaube, sie war mehr oder weniger die erste Person in meinem Erwachsenenleben, bei der ich nicht das Gefühl hatte, eine Rolle spielen zu müssen. Meg brauchte ich nichts vorzumachen, und ich musste sie auch nicht beeindrucken. Mir war von Anfang an klar, dass sie ein gutes Herz besaß, und auf eine ganz merkwürdige Art fühlte ich mich in ihrer Gegenwart immer wie ein besserer Mensch – oder zumindest ein nicht ganz so schlechter.