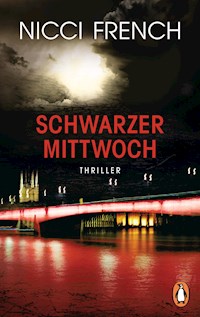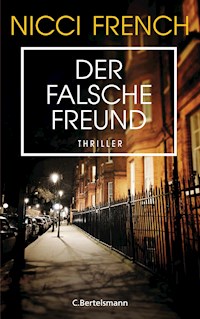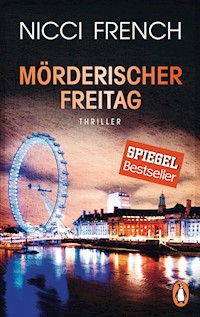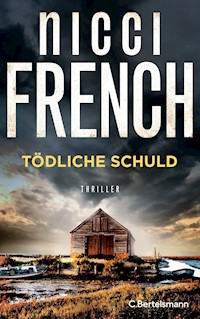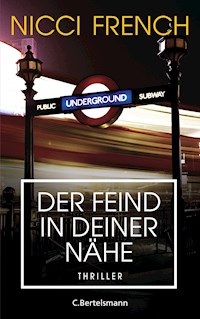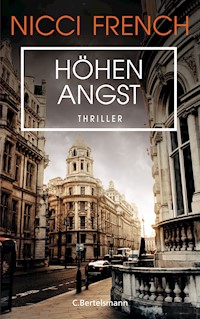3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: C. Bertelsmann Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Verstrickt im Dickicht von Lügen und Verrat
Was tun, wenn der Ehemann mit einer Unbekannten auf dem Beifahrersitz tödlich verunglückt ist? Wird die Liebe von den Lügen zerfressen? Nicci French entwirft das genaue Porträt einer Frau zwischen Trauer und Zweifel, zwischen Vertrauen und Verrat, deren Wunsch, die Wahrheit zu erfahren, größer ist als jede Angst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Nicci French
Seit er tot ist
Psychothriller
Deutsch von Birgit Moosmüller
Buch
Ellie ist gerade dabei, das Abendessen vorzubereiten, als es an der Tür klingelt. Zwei Polizistinnen überbringen ihr die schreckliche Nachricht:
Ihr Mann Greg hatte einen tödlichen Autounfall, den auch die Unbekannte auf dem Beifahrersitz nicht überlebt hat. Ihr Leben liegt in Trümmern und doch kann Ellie nicht glauben, dass die Frau Gregs Geliebte war.
Besessen davon, die Wahrheit ans Licht zu bringen, stürzt sich Ellie in ein Dickicht aus Lügen und Verrat, das auch ihr zum Verhängnis zu werden droht …
Autoren
Nicci French – hinter diesem Namen verbirgt sich das Ehepaar Nicci Gerrard und Sean French. Seit über 20 Jahren sorgen sie mit ihren außergewöhnlichen Psychothrillern international für Furore und verkauften weltweit über 8 Mio. Exemplare. Besonders beliebt sind die Bände der Frieda-Klein-Serie. Die beiden leben in Südengland. »Nicci French schreibt brillante Psychothriller, die unter die Haut gehen.« Cosmopolitan
Die Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel »What to Do When Someone Dies« bei Michael Joseph (Penguin Books), London.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 2008 by Joint-Up Writing Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2009 beim C. Bertelsmann Verlag, in der Verlagsgruppe Random House, Neumarkter Str. 28, 81673 München Umschlag: buerosued, München unter Verwendung eines Motivs von Arcangel.com/Paul Bucknall Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-24600-6V002
www.cbertelsmann.de
www.randomhouse.de
Für Rachel, Callum, Jack,Martha, Toby und Cleo
Inhaltsverzeichnis
1
Sekunden, in denen sich dein Leben verändert: Es gibt immer ein Davor und ein Danach, und dazwischen ein Klopfen an der Tür. Ich war beim Kochen unterbrochen worden. Vorher hatte ich aufgeräumt, die Zeitungen von gestern, alte Briefumschläge und eine Menge anderen Papierkram in den Kamin gestopft, um nach dem Abendessen Feuer zu machen. Der Reis stand bereits auf dem Herd, er hatte gerade schön zu blubbern begonnen. Mein erster Gedanke war, dass Greg seinen Schlüssel vergessen hatte, aber dann fiel mir ein, dass das nicht sein konnte, weil er an dem Tag mit dem Auto gefahren war. Vielleicht ein Freund, ein Nachbar, ein Zeuge Jehovas oder der unangemeldete Besuch eines verzweifelten jungen Mannes, der von Tür zu Tür ging, um Staubtücher und Kleiderhaken zu verkaufen. Ich wandte mich vom Herd ab und eilte durch die Diele zur Haustür. Als ich sie öffnete, schlug mir ein Schwall kalter Luft entgegen.
Es war nicht Greg, und auch kein Freund, kein Nachbar, kein Fremder, der mir seine Religion oder etwas für den Haushalt andrehen wollte. Stattdessen standen zwei Polizistinnen vor mir. Die eine wirkte wie ein Schulmädchen, sie hatte einen dicken Pony, der ihr kerzengerade über die Augenbrauen fiel, und abstehende Ohren. Die andere, schon ziemlich ergraute, sah mit ihrem kantigen Kinn und der maskulinen Kurzhaarfrisur aus wie ihre Lehrerin.
»Ja?« War ich zu schnell gefahren? Oder hatte ich irgendwo Müll herumliegen lassen? Doch dann bemerkte ich den verunsicherten, fast schon überraschten Blick der beiden und spürte plötzlich einen ersten kleinen Stich in der Brust. Das verhieß nichts Gutes.
»Mrs. Manning?«
»Ich heiße Eleanor Falkner«, erklärte ich, »aber ich bin mit Greg Manning verheiratet, bin also mehr oder weniger …« Ich sprach den Satz nicht zu Ende. »Worum geht es?«
»Dürfen wir hereinkommen?«
Ich führte sie in unser kleines Wohnzimmer.
»Sie sind die Ehefrau von Mr. Gregory Manning?«
»Ja.«
Ich hörte alles, registrierte jedes Detail. Ich sah, wie die jüngere Frau zu der älteren aufblickte, während diese die Worte aussprach, und ich bemerkte, dass sie eine Laufmasche in ihrer schwarzen Strumpfhose hatte. Die ältere bewegte die ganze Zeit die Lippen, doch die Worte, die dabei herauskamen, schienen nicht zu den Bewegungen zu passen, sodass ich Mühe hatte, ihren Sinn zu verstehen. Aus der Küche stieg mir der feuchte Geruch von Reis in die Nase. Mir fiel ein, dass ich die Platte nicht ausgeschaltet hatte, was bedeutete, dass er zu einer matschigen Pampe verkochen würde. Dann wurde mir dumpf bewusst, dass es natürlich ganz egal war, ob er verkochte oder nicht: Es würde ihn sowieso niemand mehr essen. Hinter mir hörte ich, wie der Wind ein paar trockene Blätter gegen das Erkerfenster wehte. Draußen war es dunkel – stockdunkel und kalt. Bald würde die Zeit umgestellt werden, und in ein paar Monaten war Weihnachten.
»Es tut mir sehr leid«, sagte sie, »aber Ihr Mann hatte einen tödlichen Unfall.«
»Ich verstehe nicht.« Dabei verstand ich sehr wohl. Die Worte ergaben durchaus einen Sinn: tödlicher Unfall. Meine Beine fühlten sich an, als wüssten sie nicht mehr, wie sie mich aufrecht halten sollten.
»Können wir Ihnen irgendwas bringen? Ein Glas Wasser vielleicht?«
»Sie sagen …«
»Der Wagen Ihres Mannes ist von der Straße abgekommen«, erklärte sie langsam und geduldig. Ihr Mund ging auf und wieder zu.
»Er ist tot?«
»Es tut mir sehr leid.«
»Der Wagen hat Feuer gefangen.« Das war das Erste, was die jüngere Frau sagte.
Ich blickte in ihr rundes, bleiches Gesicht. Sie hatte braune Augen, und unter dem einen war ihre Wimperntusche leicht verschmiert. Kontaktlinsenträgerin, ging mir durch den Kopf.
»Haben Sie mich verstanden, Mrs. Falkner?«
»Ja.«
»Ihr Mann war nicht allein.«
»Wie bitte?«
»Es saß noch jemand im Wagen. Eine Frau. Wir dachten … nun ja, wir haben befürchtet, das wären Sie.«
Ich starrte sie benommen an. Erwartete sie jetzt von mir, dass ich mich auswies?
»Wissen Sie, um wen es sich handeln könnte?«, fuhr sie fort.
»Ich habe uns gerade etwas zum Abendessen gekocht. Inzwischen müsste er eigentlich hier sein.«
»Ich meine seine Beifahrerin.«
»Keine Ahnung.« Ich rieb mir übers Gesicht. »Hatte sie denn keine Tasche oder sonst was bei sich?«
»Es gab nicht viel sicherzustellen. Wegen des Brandes.«
Ich legte eine Hand an die Brust und spürte mein Herz heftig schlagen. »Sind Sie sicher, dass es Greg war? Vielleicht liegt eine Verwechslung vor.«
»Er hat einen roten Citroën Saxo gefahren.« Sie warf einen Blick in ihr Notizbuch und las das Kennzeichen vor. »Ihr Mann ist als Fahrzeughalter eingetragen.«
»Ja.« Das Sprechen fiel mir schwer. »Vielleicht jemand aus der Arbeit. Er hat manchmal eine Kollegin mitgenommen, wenn er zu Kunden fuhr. Tania.« Noch während ich das sagte, wurde mir bewusst, dass es mich in dem Moment überhaupt nicht interessierte, ob Tania ebenfalls tot war oder nicht. Vermutlich würde mir das später zu schaffen machen.
»Tania?«
»Tania Lott. Aus seinem Büro.«
»Haben Sie ihre Privatnummer?«
Ich überlegte einen Moment. Die Nummer war mit Sicherheit in Gregs Handy gespeichert, doch das hatte er immer bei sich. Ich schluckte.
»Ich glaube nicht. Vielleicht. Soll ich nachsehen?«
»Wir finden sie bestimmt auch anders heraus.«
»Sie dürfen mich nicht für unhöflich halten, aber es wäre mir recht, wenn Sie jetzt gehen würden.«
»Haben Sie jemanden, den Sie anrufen können? Verwandte oder Freunde?«
»Was?«
»Sie sollten jetzt nicht allein sein.«
»Ich will aber allein sein«, entgegnete ich.
»Vielleicht möchten Sie doch mit jemandem reden.« Die jüngere Frau zog ein Blatt aus der Tasche. Offenbar hatte sie es auf dem Polizeirevier eingesteckt, bevor sie gemeinsam aufgebrochen waren. Alles vorbereitet. Ich fragte mich, wie viele Male im Jahr sie das machten. Wahrscheinlich gewöhnten sie sich irgendwann daran, bei Regen, Schnee oder Sonnenschein mit mitfühlender Miene vor jemandes Tür zu stehen. »Das sind Telefonnummern von Fachleuten, die Ihnen helfen können.«
»Danke.« Ich nahm das Blatt, das sie mir hinhielt, und legte es auf den Tisch. Zusätzlich reichte sie mir noch eine Karte.
»Falls Sie irgendwas brauchen.«
»Danke.«
»Kommen Sie klar?«
»Ja«, antwortete ich lauter als beabsichtigt. »Sie müssen entschuldigen, aber ich fürchte, mein Reis brennt gerade an. Ich sollte ihn schleunigst vom Herd nehmen. Finden Sie selbst hinaus?«
Ich verließ den Raum, während die beiden Frauen noch verlegen dastanden, und eilte in die Küche, wo ich die Pfanne von der Platte nahm und mit einem Holzlöffel in der klebrigen Masse aus angebranntem Reis herumstocherte. Ich hatte Risotto machen wollen. Greg isst für sein Leben gern Risotto. Es war das erste Gericht, das er für mich gekocht hatte: Risotto mit Rotwein und grünem Salat. Plötzlich sah ich ihn ganz deutlich vor mir, wie er in seinen abgetragenen Hausklamotten am Küchentisch saß und mir lächelnd zuprostete. Rasch wandte ich den Kopf, weil ich irgendwie hoffte, dass er noch da sein würde, wenn ich mich nur schnell genug umdrehte.
Herzliches Beileid.
Tödlicher Unfall.
Das ist nicht meine Welt. Irgendetwas ist schiefgelaufen, aus den Fugen geraten an diesem Montagabend im Oktober. Ich bin Ellie Falkner, vierunddreißig Jahre alt und mit Greg Manning verheiratet. Obwohl gerade zwei Polizeibeamtinnen bei mir vor der Tür gestanden und mir eröffnet haben, er sei tot, weiß ich, dass das nicht stimmen kann, weil so etwas nur anderen Leuten passiert.
Ich ließ mich am Küchentisch nieder und wartete – worauf, weiß ich nicht. Vielleicht darauf, dass ich etwas empfinden würde. Wenn ein geliebter Mensch stirbt, dann muss man doch weinen, oder etwa nicht? Man heult und schluchzt, und es laufen einem Tränen über die Wangen. Dass Greg mein Liebster war, mein Schatz, stand außer Frage. Trotzdem war mir noch nie weniger nach Weinen zumute gewesen. Meine Augen fühlten sich trocken und heiß an, und mein Hals schmerzte ein wenig, als hätte ich mich erkältet. Mein Magen schmerzte ebenfalls, sodass ich für einen Moment die Hand auf den Bauch legte und die Augen schloss. Mit der anderen Hand strich ich über die Tischplatte, auf der noch die Brösel vom Frühstück lagen. Toast mit Marmelade. Und Kaffee.
Was hatte er gesagt, als er gegangen war? Ich konnte mich nicht erinnern. Es war ein ganz normaler Montagmorgen gewesen, mit einem grauen Himmel und Pfützen auf dem Gehsteig. Wann hatte er mich das letzte Mal geküsst? Auf die Wange oder den Mund? Am Nachmittag, also erst wenige Stunden früher, hatten wir am Telefon einen ganz blöden Streit gehabt. Es war um die Frage gegangen, wann er nach Hause kommen würde. Waren das unsere letzten Worte gewesen? Knappe, zänkische Sätze vor dem großen Schweigen? Einen Moment lang konnte ich mich nicht mal mehr an sein Gesicht erinnern, doch dann tauchte es wieder vor mir auf: sein lockiges Haar, die dunklen Augen und die Art, wie er lächelt. Lächelte. Seine starken, geschickten Hände, seine wunderbare Wärme. Es konnte sich nur um einen Irrtum handeln.
Ich stand auf, nahm das Telefon aus dem Halter an der Wand und tippte Gregs Handynummer. Gleich würde ich seine Stimme hören. Nach ein paar Minuten vergeblichen Wartens steckte ich das Telefon vorsichtig zurück an seinen Platz, ging zum Fenster hinüber und presste das Gesicht an die Scheibe. Eine Katze schlich die Gartenmauer entlang, ich konnte ihre Augen leuchten sehen. Ich beobachtete sie, bis sie verschwunden war, dann trat ich wieder an den Herd.
Ich schob mir eine Gabel voll Reis in den Mund. Er schmeckte nach gar nichts. Vielleicht sollte ich mir lieber ein Glas Whisky einschenken. Das tun doch Menschen, die unter Schock stehen, oder nicht? Ich stand bestimmt unter Schock. Allerdings befürchtete ich, dass wir keinen Whisky im Haus hatten. Ich öffnete den Schrank, in dem sich unsere Hausbar befand, und inspizierte den Inhalt: eine Flasche Gin, von der noch etwa ein Drittel übrig war, eine Flasche Pimms für träge, heiße Sommerabende, die jetzt in weiter Ferne lagen, außerdem eine kleine Flasche Schnaps. Ich drehte den Deckel ab und nahm einen vorsichtigen Schluck. Sofort spürte ich ein leichtes Brennen im Hals.
Feuer. Flammen.
Ich versuchte krampfhaft, mir nicht vorzustellen, wie sein Gesicht brannte, sein Körper von den Flammen verzehrt wurde. Während ich mir die Handballen in die Augenhöhlen drückte, stieß ich ein leises Wimmern aus. Ansonsten war es ganz still im Haus, sämtliche Geräusche kamen von draußen: der Wind in den Bäumen, vorbeifahrende Autos, das Knallen von Türen, die Stimmen von Leuten, die normal weiterlebten.
Ich weiß nicht, wie lange ich so dastand, aber irgendwann setzte ich mich in Bewegung und stieg die Treppe hinauf. Die Hand am Geländer, hievte ich mich Stufe für Stufe nach oben und fühlte mich dabei wie eine alte Frau. Ich war jetzt Witwe. Wer würde von nun an den Videorekorder für mich einstellen? Wer würde mir Gesellschaft leisten, wenn ich sonntags mal wieder am Kreuzworträtsel scheiterte? Wer würde mich nachts wärmen, mich im Arm halten, mich beschützen? Diese Gedanken gingen mir zwar durch den Kopf, doch ich fühlte nichts dabei. Minutenlang stand ich in unserem Schlafzimmer und blickte mich im Raum um, ehe ich mich schließlich schwerfällig aufs Bett sinken ließ – auf meine Seite, um ja nicht Gregs Bereich zu stören. Mein Blick fiel auf den Reisebericht, den er gerade las: Er wollte mit mir nach Indien fahren. In dem Buch steckte ein Lesezeichen, er war erst zu einem Drittel durch. Sein Morgenmantel – grau-blau gestreift – hing an dem Haken an der Tür, seine Hausschuhe lagen mit den Sohlen nach oben unter dem alten Holzstuhl. Auf dem Stuhl die Jeans, die er gestern getragen hatte, und ein alter blauer Pullover. Ich ging hinüber, griff nach dem Pulli und vergrub das Gesicht in der Wolle, die so vertraut roch. Dann zog ich meinen eigenen Pulli aus und streifte mir den von Greg über den Kopf. Er war an einem Ellbogen völlig abgewetzt, und am Saum begann er schon auszufransen.
Benommen wanderte ich in den kleinen Raum hinüber, der an unser Schlafzimmer angrenzte und vorerst als Rumpelkammer diente, auch wenn wir ihm eigentlich eine andere Verwendung zugedacht hatten. Obwohl es nun schon über ein Jahr her war, dass wir das Haus bezogen hatten, standen dort immer noch Kisten voller Bücher und Krimskrams, außerdem eine altmodische Badewanne mit Klauenfüßen und gesprungenen Messinghähnen, die mir auf einem Flohmarkt untergekommen war und die ich in unser Bad stellen wollte, sobald ich etwas wegen der Hähne unternommen hatte. Ich musste daran denken, wie wir damals bei dem Versuch, sie in den ersten Stock zu tragen, auf der Treppe stecken geblieben waren und weder vor- noch zurückkamen, während Gregs Mutter uns von unten aus der Diele nutzlose Anweisungen zurief.
Seine Mutter. Ich musste seine Eltern anrufen und ihnen sagen, dass ihr ältester Sohn tot war. Plötzlich fiel mir das Atmen schwer, und ich musste mich gegen den Türrahmen lehnen. Wie bringt man jemandem eine solche Nachricht bei? Ich kehrte ins Schlafzimmer zurück, ließ mich erneut auf dem Bett nieder und griff nach dem Telefon auf meinem Nachttisch. Einen Moment lang konnte ich mich nicht mehr an ihre Nummer erinnern, und als sie mir dann wieder einfiel, bereitete es mir Probleme, die Tasten zu drücken. Meine Finger funktionierten nicht richtig.
Ich hoffte, dass niemand rangehen würde, doch schon nach wenigen Sekunden hörte ich die hohe Stimme seiner Mutter. Sie klang entrüstet über die späte Störung.
»Kitty.« Ich drückte den Hörer fest an mein Ohr und schloss die Augen. »Ich bin’s, Ellie.«
»Ellie, wie …«
»Ich habe schlechte Nachrichten«, unterbrach ich sie. Bevor sie Luft holen und etwas sagen konnte, fügte ich hinzu: »Greg ist tot.« Am anderen Ende der Leitung herrschte völlige Stille, als hätte sie gleich wieder aufgelegt. »Kitty?«
»Hallo«, sagte sie. Ihre Stimme klang schwach und sehr weit entfernt. »Ich habe dich nicht richtig verstanden.«
»Greg ist tot«, wiederholte ich, »er ist bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Ich habe es gerade erst erfahren.«
»Entschuldige«, antwortete Kitty, »einen Moment bitte.«
Ich wartete, bis sich schließlich eine andere Stimme meldete. Gregs Vater klang barsch, als wollte er sich solchen Unsinn verbitten. »Ellie, hier spricht Paul. Was sagst du da?«
Ich wiederholte, was ich gesagt hatte. Die Worte erschienen mir immer irrealer.
Paul Manning stieß ein kurzes, nervöses Husten aus. »Tot, sagst du?« Im Hintergrund hörte ich lautes Schluchzen.
»Ja.«
»Aber er ist doch erst achtunddreißig.«
»Er hatte einen Unfall.«
»Mit dem Wagen?«
»Ja.«
»Wo?«
»Das weiß ich nicht. Vielleicht haben sie es mir gesagt, ich kann mich nicht erinnern. Ich habe es erst gar nicht richtig begriffen.«
Er stellte mir weitere Fragen, wollte Einzelheiten wissen, doch ich kannte die Antworten nicht. Es kam mir vor, als bräuchte er möglichst viele Informationen, um mit der Neuigkeit besser fertig zu werden.
Anschließend rief ich meine Eltern an. So macht man das doch, oder? Selbst wenn man sich nicht nahesteht, ist das die richtige Reihenfolge: erst seine Eltern, dann meine. Die wichtigsten Trauernden. Aber es ging niemand ran, und mir fiel ein, dass montags ihr Pub-Abend war. Da blieben sie immer bis zur Sperrstunde. Ich drückte auf die Taste und lauschte noch ein paar Sekunden dem Freizeichen. Der Wecker auf Gregs Nachttisch sagte mir, dass es erst dreizehn Minuten nach neun war. So viele Stunden bis zum Morgen. Was sollte ich bis dahin tun? Leute anrufen und ihnen nach der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit die Neuigkeit mitteilen? So machte man es nach der Geburt eines Babys – aber galt das auch für den Tod eines Ehemanns? Und mit wem sollte ich beginnen?
Dann fiel es mir ein.
Ich fand ihre Nummer in Gregs altem Adressbuch. Das Telefon klingelte mehrmals, vier, fünf, sechs Mal. Es kam mir vor wie ein schreckliches Spiel. Geh ans Telefon, dann bist du noch am Leben. Geh nicht ran, dann bist du tot. Oder vielleicht nur unterwegs.
»Hallo.«
»Oh.« Einen Moment lang fehlten mir die Worte. »Tania?«, stieß ich schließlich hervor, obwohl ich sie schon an der Stimme erkannt hatte.
»Ja. Mit wem spreche ich?«
»Hier ist Ellie.«
»Ellie. Hallo.«
Sie wartete. Wahrscheinlich rechnete sie mit einer Einladung. Ich holte tief Luft und sprach dann ein weiteres Mal die unsinnigen Worte aus. »Greg ist tot. Er hatte einen Unfall.« Ich ließ ihr keine Zeit, ihrem Entsetzen Ausdruck zu verleihen. »Ich rufe dich an, weil ich … nun ja, weil ich dachte, dass du vielleicht bei ihm warst. Im Wagen.«
»Ich? Wie meinst du das?«
»Er hatte jemanden dabei. Eine Frau. Ich bin davon ausgegangen, dass es jemand aus dem Büro war, deswegen dachte ich …«
»Es sind zwei Leute gestorben?«
»Ja.«
»Lieber Himmel!«
»Ja.«
»Ellie, das ist ja schrecklich! Mein Gott, ich kann es noch gar nicht richtig fassen. Es tut mir so unglaublich …«
»Hast du eine Ahnung, wer es gewesen sein könnte, Tania?«
»Nein.«
»Er war nicht in Begleitung, als er aufgebrochen ist?«, fragte ich. »Oder auf dem Weg zu einer Kundin?«
»Nein. Er ist gegen halb sechs los. Ich weiß noch, dass er irgendwann im Lauf des Nachmittags gesagt hat, er wolle endlich mal pünktlich nach Hause.«
»Er wollte direkt nach Hause?«
»Davon bin ich ausgegangen. Aber, Ellie …«
»Was?«
»Vielleicht ist es gar nicht das, was du denkst.«
»Was denke ich denn?«
»Vergiss es. Hör zu, wenn es irgendetwas gibt, irgendetwas, das ich tun kann, brauchst du es nur zu …«
»Danke«, fiel ich ihr ins Wort und legte auf.
Was hatte sie gemeint? Was glaubte sie, dass ich dachte? Ich hatte keine Ahnung. Ich wusste nur, dass es draußen kalt war, dass die Zeit im Schneckentempo dahinkroch und ich nichts tun konnte, damit sie schneller verging. Ich schleppte mich nach unten, ließ mich im Wohnzimmer auf dem Sofa nieder und zog mir Gregs Pulli bis über die Knie. So wartete ich darauf, dass es endlich Morgen wurde.
2
Die Zeitung klatschte auf die Fußmatte, und ein paar Minuten später wurde ein Bündel Briefe durch den Türschlitz geschoben. Diese Geräusche erinnerten mich daran, dass die Welt draußen versuchte, zu mir vorzudringen. Bald gab es für mich eine Menge zu erledigen, Pflichten zu erfüllen, Dinge zu beachten. Doch zuerst rief ich noch einmal Tania an.
»Entschuldige die frühe Störung«, sagte ich, »aber ich wollte dich erwischen, bevor du zur Arbeit aufbrichst.«
»Es ist mir die ganze Nacht im Kopf herumgegangen«, antwortete sie. »Ich habe kaum ein Auge zugetan. Ich kann es noch immer nicht fassen.«
»Wenn du im Büro bist, könntest du dann für mich nachsehen, mit wem Greg sich gestern getroffen hat?«
»Er hat den ganzen Tag an seinem Schreibtisch verbracht und ist dann direkt nach Hause aufgebrochen.«
»Vielleicht hat er auf dem Heimweg noch bei einem Kunden vorbeigeschaut, um etwas abzugeben oder so. Ich wäre dir wirklich dankbar, wenn du einen Blick in seinen Terminkalender werfen könntest.«
»Ich mache alles, was du willst, Ellie«, versicherte mir Tania, »aber wonach soll ich suchen?«
»Frag Joe, ob Greg gestern irgendwas zu ihm gesagt hat.«
»Joe war gestern nicht im Büro, er hatte einen Außentermin.«
»Es war eine Frau.«
»Ja, ich weiß. Ich werde tun, was ich kann.«
Ich dankte ihr und legte auf. Sofort begann das Telefon zu klingeln. Es war Gregs Vater, der weitere Einzelheiten von mir wissen wollte. Seine Worte klangen steif und wie einstudiert, als hätte er sich die einzelnen Punkte vorher notiert. Ich konnte keine seiner Fragen beantworten. Ich hatte ihm schon alles gesagt, was ich wusste. Während er berichtete, dass Kitty die ganze Nacht nicht geschlafen habe, fragte ich mich, ob er damit klarstellen wollte, wer von uns am meisten trauerte. Hinterher hatte ich das Gefühl, bei einem Test versagt zu haben. Offenbar verhielt ich mich nicht wie eine gute Ehefrau. Witwe. Das Wort brachte mich fast zum Lachen. Es war nicht für jemanden wie mich gedacht, sondern für alte Frauen mit Kopftüchern, die Einkaufstrolleys hinter sich herzogen – Frauen, die damit rechnen mussten, Witwe zu werden, und daher Zeit hatten, sich darauf vorzubereiten und es zu akzeptieren.
Ich spielte im Geist noch einmal den genauen Moment durch, in dem die Polizistin mir von Gregs Tod berichtet hatte, jenen Moment des Übergangs. Die Nachricht kam mir vor wie eine Trennlinie, ein Strich mitten durch mein Leben. Danach war nichts mehr so wie vorher.
Obwohl ich weder Hunger noch Durst hatte, beschloss ich, etwas zu mir zu nehmen. Ich ging in die Küche, wo mich der Anblick von Gregs Lederjacke, die dort über einem Stuhl hing, so heftig traf, dass ich kaum noch Luft bekam. Ich hatte mich immer über diese Angewohnheit von ihm beschwert. Warum konnte er die Jacke nicht an einen Haken hängen, damit sie aus dem Weg war? Jetzt beugte ich mich zu ihr hinunter, weil ich hoffte, dass sie nach ihm roch. Es würde nun viele solche Momente geben. Während ich mir eine Tasse Kaffee machte, erlebte ich schon die nächsten: Der Kaffee kam aus Brasilien, eine Sorte, die Greg immer kaufte, und die Tasse, die ich aus dem Schrank nahm, stammte aus dem Andenkenladen eines Atomkraftwerks, wo Greg sie zum Spaß für mich erstanden hatte. Als ich die Kühlschranktür öffnete, sah ich mich mit weiteren Erinnerungen konfrontiert: Sachen, die er eingekauft oder ich für ihn gekauft hatte, entsprechend seiner Vorlieben und Abneigungen.
Mir wurde klar, dass das Haus noch nahezu so war, wie er es verlassen hatte, aber dass ich mit jedem Griff, den ich tat, jeder Tür, die ich öffnete, jedem Gegenstand, den ich benutzte oder bewegte, seine Präsenz nach und nach auslöschte, ihn ein klein wenig mehr sterben ließ. Andererseits, was spielte das für eine Rolle? Er war tot. Ich nahm seine Jacke und hängte sie an den Haken in der Diele, wie ich es immer nörgelnd von ihm verlangt hatte.
Dabei kam mir mein Handy unter, das dort im Regal lag, und ich sah, dass ich eine Textnachricht bekommen hatte. Dann sah ich, dass sie von Greg war. Für einen Moment fühlte mein Herz sich an, als hätte jemand es mit beiden Händen gepackt und wie einen Waschlappen ausgewrungen. Mit steifen Fingern rief ich die Nachricht auf. Sie war gestern abgeschickt worden, kurz nachdem ich mich so darüber aufgeregt hatte, dass er später als versprochen aus dem Büro nach Hause kommen würde. Der Text war nicht sehr lang: »Sorry sorry sorry sorry sorry. Ich bin ein Vollidiot.« Nachdem ich eine Weile auf die Worte hinuntergestarrt hatte, drückte ich das Handy für einen Moment an meine Wange, als steckte in der Nachricht ein klein wenig von ihm, das ich in mich aufsaugen konnte.
Dann griff ich nach seinem und meinem Adressbuch sowie einem Notizblock, kehrte in die Küche zurück und ließ mich mit meiner Kaffeetasse am Tisch nieder, um mir Gedanken darüber zu machen, wen ich anrufen sollte. Sofort musste ich an die Party denken, die wir dieses Jahr gegeben hatten, genau zwischen unseren beiden Geburtstagen. Es waren dieselben Adressbücher, derselbe Tisch und mehr oder weniger auch dieselbe Art von Entscheidungen. Wen mussten wir auf jeden Fall einladen? Wen wollten wir dabeihaben, wen nicht? Wenn wir X einluden, durfte Y nicht fehlen. Wenn wir uns für A entschieden, mussten wir B von der Liste streichen. Ich hatte das Gefühl, dass mein Kopf nicht richtig funktionierte. Am besten, ich machte mir Notizen, damit ich keinen vergaß oder zweimal anrief. Unsere engsten Freunde musste ich unbedingt erwischen, bevor sie zur Arbeit aufbrachen. Zuerst aber rief ich noch einmal bei meinen Eltern an. Obwohl ich mich vor dem Gespräch fürchtete, wusste ich, dass sie so früh am Morgen beide zu Hause waren. Mein Vater ging ran und rief sofort meine Mutter dazu, sodass ich sie beide an der Strippe hatte. Sie fingen gleich an, mir von einem Freund von ihnen zu erzählen, ich könne mich bestimmt an Tony erinnern, die Ärzte hätten gerade Diabetes bei ihm festgestellt, und zwar nur, weil er zu viel aß, es sei doch wirklich lächerlich, wie wenig die Leute ihr Leben im Griff hätten. Nach mehreren vergeblichen Versuchen, sie zu unterbrechen, schaffte ich es schließlich, zwischen zwei Sätzen ein lautes »Bitte!« einzuschieben, und stieß dann alles hervor.
Zunächst folgte ein Schwall von entsetzten Ausrufen, dann bombardierten sie mich mit Fragen: Wann war das passiert? Ging es mir gut? Brauchte ich Hilfe? Sollten sie beide zu mir kommen? Oder nur Mutter? Hatte ich es meiner Schwester schon gesagt, oder sollten sie das für mich übernehmen? Und was war mit Tante Caroline, musste sie es nicht auch erfahren? Ich erklärte meiner Mutter, ich müsse jetzt aufhören, ich würde mich später noch einmal bei ihr melden, aber jetzt hätte ich weitere Anrufe und jede Menge andere Dinge zu erledigen. Nachdem ich aufgelegt hatte, dachte ich über meine Worte nach. Was für Dinge hatte ich eigentlich zu erledigen? Es galt Formulare zu unterschreiben, Testamente zu lesen, ein Begräbnis zu organisieren. War ich dafür verantwortlich, oder lief das alles ganz automatisch?
Ich musste mit Joe sprechen, Gregs Geschäftspartner und engem Freund, doch ich erreichte nur seinen Anrufbeantworter und brachte es nicht übers Herz, ihm die Nachricht auf diese Weise zu übermitteln. Ich stellte mir sein Gesicht vor, wenn er es erfahren würde, seine leuchtend blauen Augen. Bestimmt war er in der Lage, die Tränen zu weinen, die ich im Moment offenbar nicht weinen konnte. Ich musste Tania bitten, es ihm statt meiner zu sagen. Bestimmt hatte sie nichts dagegen. Sie war neu in der Firma und himmelte Joe an.
Ich ging sowohl Gregs als auch mein eigenes Adressbuch durch und erstellte eine Liste mit dreiundvierzig Leuten. Es war eine erlesenere Gruppe als bei unserem Fest. Damals hatten wir viele eingeladen, die wir seit der Party im Vorjahr nicht mehr gesehen hatten, außerdem ein paar Nachbarn und Leute, zu denen wir langsam den Kontakt verloren. Die würden durch Klatsch und Tratsch davon hören, oder wenn sie sich mal wieder bei mir meldeten. Vielleicht würden es einige auch nie erfahren. Sie würden sich hin und wieder fragen, was wohl aus dem alten Greg und seiner Ellie geworden war, und dann an etwas anderes denken.
Ich griff nach dem Telefon und begann die Leute auf meiner Liste anzurufen, und zwar mehr oder weniger in der Reihenfolge, wie ich sie aus unseren Adressbüchern herausgeschrieben hatte. Die Erste war Gwen Abbott, eine meiner ältesten Freundinnen, und als Letzter kam Ollie Wilkes an die Reihe, der einzige Cousin, mit dem Greg in engem Kontakt geblieben war. Bei dem ersten Anruf schaffte ich es fast nicht, die Nummer zu tippen, so sehr zitterten meine Hände. Als ich es Gwen sagte und sie vor Schreck und Entsetzen aufschrie, hatte ich das Gefühl, das Ganze von vorne zu durchleben, mit dem einzigen Unterschied, dass es nun noch schlimmer war, weil der Schlag auf die Wunden und blauen Flecken vom ersten Mal traf. Nachdem ich aufgelegt hatte, saß ich eine Weile einfach nur da. Das Atmen fiel mir schwer, als befände ich mich in großer Höhe, wo die Luft ganz dünn war. Ich befürchtete, dass ich es nicht schaffen würde, weiterzumachen und den schrecklichen Augenblick durch andere Menschen immer wieder zu erleben.
Aber es wurde leichter. Ich fand Formulierungen, die ich ertragen konnte, und übte sie ein, bevor ich mit den Anrufen fortfuhr. »Hallo, hier spricht Ellie, ich habe schlimme Neuigkeiten …« Nach ein paar weiteren Telefonaten wurde ich sogar richtig ruhig. Es gelang mir, jedes Gespräch zu steuern und zu einem einigermaßen schnellen Ende zu bringen. Ich hatte mir ein paar Phrasen zurechtgelegt. »Ich habe so viel zu erledigen.« »Es tut mir leid, aber ich kann im Moment noch nicht über ihn sprechen.« »Das ist sehr lieb von dir.« Am schlimmsten war es bei seinem besten Freund Fergus, der Greg schon viel länger liebte als ich. Er war sein Joggingpartner gewesen, sein Vertrauter, sein Ersatzbruder, sein Trauzeuge. »Was sollen wir bloß ohne ihn machen, Ellie?«, fragte er mich. Ich hörte seine belegte, zittrige Stimme und dachte: Das Gleiche empfinde ich auch, ich weiß es nur noch nicht. Es war, als würde mein Schmerz in irgendeinem Versteck kauern, wo ich ihn nicht sehen konnte. Wahrscheinlich wartete er nur darauf, hervorzuspringen und über mich herzufallen, wenn ich es am wenigsten erwartete.
Als ich die Liste etwa zur Hälfte durch hatte, wurde ich durch heftiges Klopfen unterbrochen. Es war Joe. Er trug einen Anzug und die vertraute schlanke Aktentasche, wegen der Greg ihn immer aufzog. Laut Greg war die Tasche grundsätzlich leer und reine Show.
Obwohl Joe keine Blutergüsse oder Verletzungen aufwies, sah er aus, als hätte er bei einer Schlägerei den Kürzeren gezogen. Schwankend, bleich und mit glasigen Augen stand er vor mir. Ehe ich etwas sagen konnte, kam er herein und riss mich in seine Arme. Mir ging durch den Kopf, wie anders er sich anfühlte als Greg, größer und breiter. Er roch auch anders, nach Seife und Leder.
Am liebsten wäre ich zusammengebrochen und hätte in seinen Armen geweint, doch irgendwie konnte ich das nicht. Stattdessen weinte Joe. Während er zu mir sagte, wie wundervoll mein Mann gewesen sei, und was für ein Glück er gehabt habe, mir zu begegnen, liefen ihm die Tränen übers Gesicht. Er erklärte, für ihn gehörte ich zur Familie, und er wolle mir in den nächsten Wochen eine starke Schulter zum Anlehnen sein. Dann küsste er mich auf beide Wangen, nahm meine Hände in seine und verkündete feierlich, ich bräuchte nicht stark zu sein. Anschließend scheuerte er die Pfanne, in der mir der Reis angebrannt war, wischte den Küchentisch sauber und trug den Müll hinaus. Er fing sogar an, ein bisschen Ordnung zu machen, indem er Papierstapel hochhob und auf eine wirre, völlig unsystematische Weise Bücher in Regalfächer schob, bis ich ihn bat, damit aufzuhören. Dann ging er, und ich fuhr mit meiner Aufgabe fort.
Jedes Mal, wenn ich jemanden informiert hatte, hakte ich den Namen auf meinem Zettel ab. In einigen Fällen meldete sich ein Kind oder ein Partner, den ich nicht gut genug kannte. Ich hinterließ dann keine Nachricht, nannte nicht mal meinen Namen. Bei Gregs Teil der Liste hatte ich ohnehin weniger Erfolg, denn bis ich mich so weit vorgearbeitet hatte, waren die meisten schon zur Arbeit aufgebrochen. Handynummern rief ich keine an. Ich konnte die Vorstellung nicht ertragen, mit den Leuten zu reden, während sie im Zug saßen und gezwungen waren, leise zu sprechen, oder sich womöglich schämten, wenn irgendwelche Fremden Zeuge ihrer Reaktion wurden.
Außerdem kam ich immer langsamer voran, weil inzwischen ständig das Telefon klingelte. Leute, die von mir bereits informiert worden waren, hatten die Nachricht verdaut und wollten mir noch etwas sagen oder Fragen stellen. Freunde hatten andere Freunde angerufen, und einige dieser anderen Freunde griffen sofort zum Hörer. Diejenigen, die auf dem Festnetz nicht durchkamen, versuchten es auf dem Handy, das ich wohlweislich ausgeschaltet hatte. Später stellte ich fest, dass mir die meisten, die mich übers Handy auch nicht erreichten, eine E-Mail schickten. Viele jedoch kamen durch, und einer nach dem anderen brachte seinen Kummer zum Ausdruck, bis ihre Stimmen schließlich zu einem ununterbrochenen Klagegeschrei zu verschmelzen schienen. Nach jedem Gespräch notierte ich den Namen unten auf der Liste, damit ich die betreffende Person nicht aus Versehen noch einmal anrief. Einer der Anrufe kam nicht aus unserem Familien- oder Freundeskreis, sondern von Woman Police Constable Darby, einer der beiden Beamtinnen, die mir die Nachricht überbracht hatten. Als sie mich fragte, wie es mir gehe, wusste ich nicht so recht, was ich antworten sollte.
»Ich störe Sie nur ungern«, erklärte sie, »aber hatten wir schon über die Identifizierung der Leiche gesprochen?«
»Ich kann mich nicht daran erinnern.«
»Mir ist klar, dass der Zeitpunkt sehr ungünstig ist.« Sie schwieg einen Moment.
»Oh«, sagte ich. »Sie wollen, dass ich die … dass ich meinen Mann identifiziere? Aber Sie waren doch hier, Sie selbst haben mir die Nachricht überbracht. Sie wissen doch schon Bescheid.«
»Das Gesetz verlangt es so«, erklärte sie. »Falls es bei Ihnen nicht geht, besteht die Möglichkeit, ein anderes Familienmitglied zu beauftragen. Einen Bruder oder einen Elternteil.«
»Nein«, entgegnete ich rasch. Der Gedanke war mir unerträglich. Am Tag unserer Hochzeit war Greg mein Mann geworden. Ich würde nicht zulassen, dass seine Familie ihn nun zurückforderte. »Ich mache das. Heute noch?«
»Wenn möglich.«
»Wo ist er?«
Ich hörte Papier rascheln.
»In der Leichenhalle des King George V Hospital. Kennen Sie es? Haben Sie jemanden, der Sie hinbringt?«
Ich rief Gwen an. Sie erklärte sich bereit, mich zum Krankenhaus zu fahren, obwohl das für sie bedeutete, dass sie sich den Tag krankmelden musste. Nachdem ich aufgelegt hatte, blickte ich an mir hinunter und stellte fest, dass ich immer noch die Sachen vom Vortag trug. Greg hatte gesehen, wie ich sie anzog, auch wenn er vielleicht nicht richtig darauf geachtet hatte. Er war zu sehr an mich gewöhnt und morgens selbst zu beschäftigt, um gemütlich dazusitzen und mir zuzusehen, doch zumindest war er im Raum umhergewuselt, während ich mich anzog. Ich schlüpfte aus den Sachen und streifte damit ein weiteres Stück meines Lebens mit Greg ab, ehe ich unter die Dusche trat und mit geschlossenen Augen den Kopf in den heißen Wasserstrahl hielt. Ich drehte das Wasser noch heißer, als könnte es meine Gefühle wegbrennen. Hinterher zog ich mich rasch an, warf einen Blick in den Spiegel und stellte fest, dass ich unbewusst lauter schwarze Sachen gewählt hatte. Ich zog meinen Pulli wieder aus und ersetzte ihn durch einen rostbraunen. Nun sah ich zwar immer noch düster aus, aber wenigstens nicht mehr wie eine alte italienische Witwe.
Manche Menschen wissen instinktiv, wie sie am besten auf die Stimmung ihres Gegenübers reagieren. Gwen ist so ein Mensch. Greg und ich führten mal eine Unterhaltung darüber, wer aus unserem Freundeskreis uns nie auf die Nerven ging, und Gwen war die Einzige, bei der wir das beide übereinstimmend fanden. Sie spürt, wann es an der Zeit ist, einen Schritt zurückzutreten und sich sachlich oder sogar kritisch zu äußern, und wann der andere das Bedürfnis nach Nähe hat, nach einer Umarmung, nach Liebe und körperlicher Zuwendung. Mary und ich stritten uns regelmäßig, allerdings gerät Mary mit den meisten Leuten hin und wieder aneinander, fast schon um des Streitens willen. Man entdeckt plötzlich einen trotzigen Funken in ihren Augen, der einem sagt, dass sie mal wieder ihre nervösen, kampflustigen, emotional explosiven fünf Minuten hat. Dann kann man nichts machen, außer das Gewitter über sich ergehen lassen – oder den Raum verlassen. Ich verlasse für gewöhnlich den Raum. Gwen dagegen – Gwen mit ihren sanften grauen Augen und dem Schopf aus weichem goldenem Haar, ihrem dezenten Kleidungsstil und ihrer ruhigen, nachdenklichen Art – erhebt nicht gern die Stimme. An der Uni nannten viele sie »die Diplomatin«, was durchaus bewundernd, manchmal aber auch ein wenig vorwurfsvoll gemeint war, weil die Leute das Gefühl hatten, dass sie niemanden ganz an sich heranließ. Ich jedoch wusste ihre Zurückhaltung stets zu schätzen und empfand es als Privileg, Aufnahme in ihren kleinen Freundeskreis zu finden. Als ich ihr nun die Tür öffnete, breitete sie nicht gleich die Arme aus, damit ich in Tränen ausbrechen und mich von ihr trösten lassen konnte. Stattdessen bedachte sie mich mit einem ernsten, aber liebevollen Blick und legte mir eine Hand auf die Schulter. Auf diese Weise blieb es mir selbst überlassen, ob ich zusammenbrechen wollte oder nicht. Wie sich herausstellte, wollte ich nicht. Ich hatte vielmehr den Wunsch – oder das Bedürfnis –, mich zusammenzureißen.
Während sie mich zu dem Krankenhaus in King’s Cross chauffierte, sagte sie kein Wort, was mir die Möglichkeit gab, ebenfalls zu schweigen. Ich starrte durchs Fenster zu den Leuten auf dem Gehsteig hinaus, plötzlich fasziniert von dem Gedanken, dass es Menschen gab, die an diesem Tag tatsächlich das taten, was sie sich am Vortag vorgenommen hatten. Begriffen sie denn nicht, dass alles vergänglich war? Es mag vielleicht zunächst so aussehen, als würde alles glattlaufen, doch irgendwann, vielleicht schon morgen oder übermorgen oder in fünfzig Jahren, wird die ganze Scharade schlagartig ein Ende haben.
Als wir am Krankenhaus eintrafen, stellten wir fest, dass wir fürs Parken bezahlen mussten. Plötzlich empfand ich eine heftige, sinnlose Wut.
»Wenn unser Ziel ein Supermarkt wäre und keine Leichenhalle, müssten wir bestimmt nichts zahlen.«
»Keine Sorge«, meinte Gwen, »ich habe genug Kleingeld dabei.«
»Und was machen Leute, die jeden Tag herkommen?«, fragte ich. »Leute, deren Angehörige im Sterben liegen?«
»Für solche Fälle gibt es wahrscheinlich eine Ermäßigung«, mutmaßte Gwen.
»Darauf würde ich nicht wetten«, gab ich zurück, hielt dann aber abrupt inne. Ich hatte plötzlich das Gefühl, mich schon genauso aufzuführen wie die seltsamen Gestalten, die manchmal auf der Straße herumschrien, weil sie mit Stimmen in ihrem Kopf stritten.
Ich erlebte das Krankenhaus hauptsächlich als eine Abfolge von Gerüchen. Im Eingangsbereich gab es ein Stehcafé, wie man es in jedem Einkaufszentrum und an jeder Hauptstraße findet. Ich hörte das zischende Geräusch, mit dem die Milch für die Cappuccinos aufgeschäumt wurde. Zusätzlich gab es auch noch ein größeres Café. Während wir weitergingen, wurde der Duft von gebratenem Schinken immer schwächer. Stattdessen roch es zunehmend nach Bohnerwachs und Raumspray, und dann nach scharfen Reinigern, Säuren und Bleichmitteln, deren stechender Geruch etwas anderes, Scheußliches überlagerte.
Ich hatte von der Wegbeschreibung, die uns die Dame am Empfang gegeben hatte, nicht viel mitbekommen, doch Gwen führte mich durch lange Gänge und dann in einen Lift, mit dem wir ins Tiefgeschoss fuhren und dort in einen weiteren, allerdings unbesetzten Empfangsbereich gelangten.
»Wahrscheinlich gibt es eine Klingel oder so was«, mutmaßte Gwen.
Fehlanzeige. Gwen sah mich an und zog ein Gesicht.
»Hallo?«, rief sie.
Wir hörten Schritte, und kurz darauf trat ein Mann aus einem Büro hinter dem Empfang. Mit seinem grünen Mantel hätte er eher hinter die Ladentheke einer Eisenwarenhandlung gepasst. Er war extrem blass, als würde er seine gesamte Zeit hier unter der Erde verbringen, wo ihn kein Sonnenstrahl erreichte. An seinem Kinn standen rechts ein paar lange Bartstoppeln hervor, offenbar hatte er beim Rasieren einen Fleck übersehen. Ich musste daran denken, wie Greg immer seine Nase festhielt, wenn er den Bereich direkt unter den Nasenlöchern rasierte. Der Mann sah uns fragend an.
»Meine Freundin ist hier, um eine Leiche zu identifizieren«, erklärte Gwen.
Der Mann nickte zustimmend.
»Ich bin Dr. Kyriacou«, stellte er sich vor, »und für diese Abteilung zuständig. Sind Sie eine Verwandte?«
»Er ist mein Mann.« Ich brachte es noch nicht fertig, die Vergangenheitsform zu verwenden.
»Mein herzliches Beileid«, sagte er, und für einen Moment kam es mir vor, als empfände er tatsächlich Mitgefühl – soweit das überhaupt möglich war, wenn man ständig jemandem sein Beileid aussprach, außer am Wochenende und im Urlaub.
»Brauchen Sie meinen Namen?«, fragte ich. »Oder seinen?«
»Erst mal den des Verstorbenen«, antwortete Dr. Kyriacou.
»Er heißt Gregory Manning.«
Dr. Kyriacou wandte sich einem Metalltablett mit ein paar Akten zu, das vor ihm auf der Theke stand. Nach kurzem Suchen fischte er die richtige heraus, schlug sie auf und studierte die abgehefteten Unterlagen.
»Können Sie sich irgendwie ausweisen?«, fragte er. »Sie müssen entschuldigen, aber das ist Vorschrift.«
Ich reichte ihm meinen Führerschein. Er nahm ihn entgegen und schrieb etwas auf sein Formular. Dann runzelte er die Stirn.
»Die Leiche Ihres Mannes weist starke Verbrennungen auf«, erklärte er, »das wird Ihnen bestimmt zu schaffen machen. Trotzdem möchte ich Ihnen sagen, dass es meiner Erfahrung nach besser ist, sich die Leiche anzusehen, als darauf zu verzichten.«
Am liebsten hätte ich ihn gefragt, ob das auch dann zutraf, wenn jemand bei einem Flugzeugabsturz oder Zugunglück ums Leben gekommen war, brachte jedoch kein Wort heraus.
»Soll ich mitkommen?«, fragte Gwen.
Ich schüttelte den Kopf, weil ich plötzlich eine Art Besitzanspruch hatte. Ich wollte die Erfahrung mit niemandem teilen. Gwen ließ sich auf einem Stuhl nieder, und Dr. Kyriacou führte mich den Gang entlang in einen Raum, der aussah, als stünde er voller Aktenschränke mit besonders großen Schubladen. Die Griffe erinnerten allerdings eher an altmodische Kühlschränke. Nachdem Dr. Kyriacou einen Blick auf das Klemmbrett geworfen hatte, das er in der Hand trug, trat er an einen der Schränke und wandte sich mir zu.
»Sind Sie bereit?«, fragte er.
Als ich nickte, öffnete er die Tür, woraufhin ein Schwall kalter Luft in den ohnehin schon kalten Raum strömte. Mit einer energischen Bewegung zog er ein Schubfach heraus. Die Leiche war mit einem Tuch bedeckt. Ohne zu zögern hob er eine Ecke hoch. Gegen meinen Willen rang ich laut nach Luft, denn nun wusste ich endgültig, dass keine Verwechslung vorlag und er tatsächlich tot war – mein Liebling Greg, den ich das letzte Mal gesehen hatte, als er mit einem Stück Toast zwischen den Zähnen aus dem Haus stürmte, weshalb wir uns nicht einmal mehr einen letzten Abschiedskuss gegeben hatten.