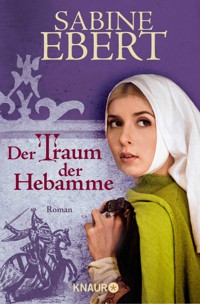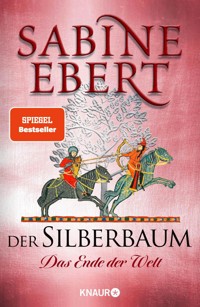9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Knaur eBook
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Die Hebammen-Saga
- Sprache: Deutsch
Freiberg 1189: Fast fünf Jahre sind seit Christians Tod vergangen. Marthe und Lukas leiden immer noch unter dem Verlust des Geliebten und Freundes und müssen ihre Gefühle füreinander neu bestimmen. Doch das ist nicht die einzige Sorge, die ihr Leben überschattet, denn es naht der Tag, an dem der grausame Albrecht, der älteste Sohn des Markgrafen Otto, die Regentschaft über die Mark Meißen übernehmen wird. Marthe und Lukas können nicht fliehen: Sie müssen Christians Vermächtnis erfüllen – und sich um die mittlerweile fast erwachsenen Kinder kümmern. Die sechzehnjährige Clara soll heiraten, obwohl sie heimlich in den jüngeren Sohn des Markgrafen verliebt ist, und Thomas träumt davon, sich Kaiser Barbarossas Kreuzzug ins Heilige Land anzuschließen … Der Fluch der Hebamme von Sabine Ebert: Historische Romane in den Knaur eBooks!
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 943
Veröffentlichungsjahr: 2010
Ähnliche
Sabine Ebert
Der Fluch der Hebamme
Roman
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Freiberg 1189: Fast fünf Jahre sind seit Christians Tod vergangen. Marthe und Lukas leiden immer noch unter dem Verlust des Geliebten und Freundes und müssen ihre Gefühle füreinander neu bestimmen. Doch das ist nicht die einzige Sorge, die ihr Leben überschattet, denn es naht der Tag, an dem der grausame Albrecht, der älteste Sohn des Markgrafen Otto, die Regentschaft über die Mark Meißen übernehmen wird. Marthe und Lukas können nicht fliehen: Sie müssen Christians Vermächtnis erfüllen – und sich um die mittlerweile fast erwachsenen Kinder kümmern. Die sechzehnjährige Clara soll heiraten, obwohl sie heimlich in den jüngeren Sohn des Markgrafen verliebt ist, und Thomas träumt davon, sich Kaiser Barbarossas Kreuzzug ins Heilige Land anzuschließen …
Inhaltsübersicht
Dramatis Personae
Landkarte
Prolog
ERSTER TEIL
Mai 1189 in Freiberg
Auf der Freiberger Burg
Zur gleichen Zeit auf dem Burgberg in Meißen
Der alte Markgraf
Brautwerbung
In der Falle
Enthüllungen
Familienbande
Im Dunkeln
Unerwarteter Besuch
Siegesfeier
Die Hütte des Wilden Mannes
Große Pläne
Unterwegs
Vorbereitungen
Albrechts Ankunft
Herausforderung
Hochzeitsvorbereitungen
Geheime Begegnungen
Kraftprobe
Böse Überraschungen
ZWEITER TEIL
Ende Mai 1189 in Pressburg
König und Kaiser
Freund und Feind
Schwertleite
Der Befehl des Königs
Die Drohung
Ottos Rückkehr
Wiedersehen
Begegnungen
Berechtigte Ängste
Juli 1189 hinter der Nordgrenze des Byzantinischen Reiches
Byzantinische Wirren
Gesandtschaften
Die Entfesselung des Heeres
Oktober 1189 in Merseburg
Notfälle
Heimkehr
Vorsichtsmaßnahmen
November 1189, Byzantinisches Reich
Im königlichen Feldlager vor Braunschweig
Sühne
Alpträume
Hedwigs Pläne
Februar 1190 in Konstantinopel
DRITTER TEIL
März 1190 in Freiberg
Der Klosterschatz
Der Fluch
Daniels Entscheidung
Glühende Eisen
Marthes Verhör
Der neue Hauptmann für Freiberg
Unter Verbündeten
Mai 1190 im anatolischen Hochland
Wasser und Blut
Kampf um Ikonium
18. Mai 1190, irgendwo zwischen den königlichen Gärten und den Mauern von Ikonium
10. Juni 1190, nahe Seleukeia an der kilikischen Küste
Sommer 1190 in der Mark Meißen
Neuigkeiten aus Freiberg
Ohne Hoffnung
Wiedersehen
In Antiochia
Die Seuche
Im Schlamm vor Akkon
20. Januar 1191 vor Akkon
Der Fall Akkons
Epilog
Nachbemerkungen
Zeittafel
Glossar
Bonusmaterial
Dramatis Personae
Aufstellung der wichtigsten handelnden Personen. Historische Persönlichkeiten sind mit einem * gekennzeichnet.
Marthe, eine Hebamme und Kräuterkundige
Lukas, ihr Mann, Ritter in Diensten des Markgrafen von Meißen
Thomas, Clara und Daniel, Marthes Kinder aus ihrer Ehe mit Christian
Paul, Lukas und Konrad, Söhne von Lukas
Johanna, ebenfalls heilkundige Stieftochter von Marthe
Kuno, Johannas Mann, und Bertram, Wachen auf der Burg
Heinrich*, Burgvogt
Ida, seine Frau
Reinhard, markgräflicher Ritter auf der Freiberger Burg
Jonas, ein Schmied und Ratsherr, und seine Frau Emma
Johann und Guntram, ihre ältesten Söhne
Karl, Schmied und Stiefsohn Marthes
Sebastian, Pfarrer
Anselm, Gewandschneider und Bürgermeister von Freiberg
Hans und Friedrich, ehemals Salzfuhrleute aus Halle
Peter, Großknecht in Marthes und Lukas’ Haushalt und Anführer einer Bande junger Männer
Christian, Stallbursche, das erste in Christiansdorf geborene Kind
Anna, seine Frau, Peters Schwester
Elfrieda, Witwe aus dem Bergmannsviertel
Otto von Wettin*, Markgraf von Meißen
Hedwig*, Gemahlin von Otto
Albrecht*, erstgeborener Sohn von Otto und Hedwig
Sophia von Böhmen*, seine Gemahlin
Susanne, Magd im Dienste Hedwigs
Hartmut, Lehrmeister der Knappen an Ottos Hof
Elmar, Ritter und Vertrauter Albrechts
Rutger, Knappe und Ziehsohn Elmars
Giselbert, Ritter
Gerald, Ritter und Bruder von Lukas’ verstorbener erster Frau
Lucardis, seine Frau
Dittrich von Kittlitz*, Dompropst und späterer Bischof von Meißen
Kaiser Friedrich von Staufen*, genannt Barbarossa
Heinrich*, König und Sohn Friedrichs
Friedrich von Schwaben*, weiterer Sohn Friedrichs
Dietrich von Weißenfels*, jüngerer Sohn des Meißner Markgrafen Otto von Wettin
Richard Löwenherz*, König von England
Philipp August II.*, König von Frankreich
Salah ad-Din Yusuf ibn Ayyub, genannt Saladin*, Herrscher über Ägypten und Syrien und Anführer der muslimischen Streitkräfte
Guido von Lusignan*, ehemals König von Jerusalem
Konrad von Montferrat*, Markgraf von Montferrat und Herr von Tyros
Bohemund III.*, Fürst von Antiochia
Bela III.*, König von Ungarn
Isaak II. Angelos von Konstantinopel*, Kaiser von Byzanz
Kilidsch Arslan II.*, Sultan von Ikonium
Leopold V.*, Herzog von Österreich
Heinrich von Kalden*, kaiserlicher Marschall
Martin*, Bischof von Meißen
Ludwig der Fromme*, Landgraf von Thüringen
Hermann*, sein Bruder, Pfalzgraf von Sachsen
Bernhard von Aschersleben*, Herzog von Sachsen, Bruder der Meißner Markgräfin Hedwig
Dedo, Graf von Groitzsch*, Bruder des Meißner Markgrafen und Markgraf der Ostmark
Konrad*, sein ältester Sohn
Raimund, Ritter im Dienste Markgraf Ottos
Elisabeth, seine Frau
Roland, ihr Sohn
Ludmillus, ein Spielmann
Jakob, Ritter, Bruder von Lukas
Peter, Abt des Klosters Marienzell
Berthold*, Herr von Bertholdsdorf nahe Freiberg
Wiprecht von Starkau, Lanzenführer unter dem Kommando Dietrichs von Weißenfels
Humfried von Auenweiler, Ritter
Notker, ein junger Benediktinermönch
Rupert, Knappe
Prolog
Auf der Suche nach Frieden und einem besseren Leben waren sie in ein fernes, kaum bewohntes Land gezogen.
Doch bald wurde dort Silber gefunden, und ein großes Berggeschrei begann. Von überall strömten Glückssucher in den Weiler im Dunklen Wald. Blutiger Streit flammte auf, die Hoffnung auf Ruhe und Frieden erlosch.
Und als sei dies nicht schon Unheil genug, brachen plötzlich auch noch die Unruhen der großen Welt in die kleine Welt der Siedler und Bergleute. Prediger zogen durchs Land und verbreiteten Schreckensnachrichten vom Fall der Stadt Jerusalem. Priester riefen in den Kirchen zu einem Heiligen Krieg auf, um das Wahre Kreuz aus den Händen der Ungläubigen zu befreien.
Viel zu spät erst begriff mancher: Die wirklichen Feinde trifft man nicht in der Fremde. Und kein Krieg ist heilig.
ERSTER TEIL
Familienaffären
Mai 1189 in Freiberg
Reglos und mit halb geschlossenen Augen beobachtete Lukas, wie sich seine Frau aus dem Bett stahl, obwohl der Tag kaum angebrochen war. Ohne zu ihm zu sehen, zog sie sich ihr Kleid über, flocht das Haar, bedeckte es mit einer schlichten Bundhaube und ging leise hinaus.
Er wusste, was sie vorhatte, und er wusste auch, dass sie dabei allein sein wollte. Heute war der Namenstag ihres früheren Mannes, seines besten Freundes.
Obwohl Christians Opfertod schon fast fünf Jahre zurücklag, trauerten sie beide noch um ihn, wenn auch auf sehr verschiedene Weise.
Marthe würde nun in der Kapelle für ihn beten. Christian war die Liebe ihres Lebens gewesen, und es verging kein Tag seit ihrer aus der Not heraus geborenen Heirat, an dem sich Lukas nicht fragte, ob der Geist des toten Freundes nicht unsichtbar zwischen ihnen im Bett lag.
Dabei machte Christians Tod auch ihn immer noch so wütend und verzweifelt, dass es ihm die Kehle zuschnürte. Manchmal rechnete er sogar damit, den Freund bei den Ställen oder im Haus vorzufinden. Oder auf der Burg, wo Christian über die rasch gewachsene Bergmannssiedlung wachte, bis ihn seine Feinde auf Befehl des ältesten Sohnes des Meißner Markgrafen ermorden ließen.
Er, Lukas, hatte Marthe schon geliebt, lange bevor sie Christians Frau wurde. Doch ihre Hochzeit verlief unter Umständen, wie er sie sich nie gewünscht hätte. Ein alter und einflussreicher Feind – der Hauptmann der Leibwache des Meißner Markgrafen Otto von Wettin – hatte Marthe am Tag der Beerdigung von Christians Grab entführt und mit Gewalt zu seiner Frau gemacht. Als Lukas sie endlich fand, tötete er den anderen in maßlosem Zorn. Der einzige Weg, sich und seine Mitstreiter vor dem Todesurteil und Marthe vor dem Kloster zu retten, war die sofortige Heirat.
Als Marthes vorsichtige Schritte die Treppe hinab verklungen waren, stand Lukas auf, zog sich an und ging ebenfalls in das Erdgeschoss des Steinhauses, in dem sie wohnten. Fast alle schienen noch zu schlafen. Nur Anna, die junge Magd, war schon auf und schürte das Feuer. Sie grüßte ihn ehrfürchtig und bot ihm Bier und kalten Brei an.
»Wenn meine Frau zurückkommt, richte ihr aus, dass ich oben auf sie warte«, wies er sie an und stieg wieder in die Kammer. Dort setzte er sich an den Tisch und stützte die Stirn auf die verschränkten Hände, während dunkle Gedanken in ihm wühlten.
Christians Tod war bis heute nicht gerächt, sah man davon ab, dass Lukas dem künftigen Markgrafen unmittelbar nach der Bluttat den Kopf des Mannes vor die Füße geworfen hatte, der den todbringenden Pfeil abgeschossen hatte. Doch derjenige, der den Befehl zu dem Mord gab, lebte weiter unbehelligt und würde in naher Zeit die Regentschaft über das Land übernehmen.
Und auf der Freiberger Burg herrschte nun ein launenhafter, unerbittlicher Mann.
Das war einer der Gründe, weshalb er und Marthe die junge Stadt nicht längst verlassen hatten. Eigentlich sollte er sich jetzt auch besser auf den Weg zur Burg begeben, um seinen Dienst als Kommandant der Wachmannschaft anzutreten. Aber diesmal würde er die Strafe für sein Zuspätkommen hinnehmen. Es gab Dinge, die ihm heute wichtiger waren als die gute oder schlechte Laune des Burgvogtes.
Lukas hätte nicht sagen können, wie viel Zeit verstrichen war, als Marthe eintrat. Trauer umwehte ihre zierliche Gestalt wie flirrender Wind, auch wenn sie sich Mühe gegeben hatte, die Spuren ihrer Tränen zu beseitigen. Jetzt lächelte sie ihm sogar zu, etwas gequält.
»Müsstest du nicht längst auf der Burg sein?«
Er beantwortete die Frage nicht, streckte stattdessen eine Hand aus und sah ihr in die Augen.
»Komm her!«
Entgegen ihrer Art wich sie seinem Blick aus, während sie auf ihn zuging, leicht verwundert über sein Ansinnen und in Gedanken wohl immer noch bei Christian.
Lukas zog sie an sich und setzte eine gespielt strenge Miene auf. »Es wird Zeit, Weib, dass du deinem Gemahl wieder einmal deinen Gehorsam erweist.«
Zu anderer Zeit hätte sie wohl gelacht oder wenigstens gelächelt; Lukas war ein spöttischer Geist und scherzte oft. Aber diesmal, das spürte sie, lag Ernst hinter den ironisch vorgebrachten Worten.
Um keinen Zweifel an der Art des Gehorsams aufkommen zu lassen, den er erwartete, schob er ihr den Rock hoch und strich mit seinen Händen begehrlich über ihre schlanken Schenkel.
Lukas spürte, wie sie für einen Augenblick erstarrte. Doch er wollte ihr erst gar keine Zeit zum Nachdenken geben. Er musste es schaffen, Marthes Gedanken von Christians Grab loszureißen.
Seine Hände wanderten höher, umfassten ihre Hüften und zogen sie mit unnachgiebiger Kraft an sich, während er den Kopf senkte und jene Stelle mit Küssen bedeckte, wo Hals und Schulter ineinander übergingen – etwas, dem sie kaum widerstehen konnte, wie er wusste.
»Du musst auf die Burg, und jeden Moment kann jemand hereinkommen«, wandte sie halbherzig gegen sein für diese Tageszeit ungewöhnliches Vorhaben ein.
»Ich habe angewiesen, dass niemand uns stören soll«, murmelte er, zog ihr die Haube vom Kopf und strich durch ihr kastanienbraunes Haar.
Dann presste er mit der Linken ihren Leib gegen seinen, damit sie seine Erregung spüren konnte. Die Rechte legte er um ihren Nacken und küsste sie; nicht sanft und verspielt wie sonst meistens, sondern hart und fordernd.
Mittlerweile brachte ihn sein Begehren fast um den Verstand, und er spürte, dass auch sie vor Verlangen erschauderte.
Er zog sie zum Bett und nahm sich nicht erst die Zeit, ihr Untergewand und Bliaut auszuziehen; von seiner eigenen Kleidung löste er lediglich den Gürtel, der die Bruche hielt.
Sein aufgerichtetes Glied reckte sich ihr groß und begehrlich entgegen.
Marthe ließ Lukas nicht aus den Augen, während sie sich wortlos hinlegte, den Rock hochzog und die Beine leicht öffnete.
Er verharrte einen Moment, um das Bild in sich aufzunehmen. Dann kniete er sich über sie und glitt in sie hinein. Bereitwillig, wenngleich immer noch verwundert, nahm sie ihn in sich auf.
Sie hatten oft genug miteinander das Bett geteilt, um den anderen zu kennen; ihre Liebesnächte waren trotz der schrecklichen Umstände, die zu ihrer Ehe geführt hatten, voller Zärtlichkeit und Erfüllung gewesen. Doch diesmal war es anders.
Hart und besitzergreifend stieß Lukas in sie hinein, und bei jedem Stoß dachte er: Vergiss Christian! Vergiss ihn wenigstens, solange ich in dir bin! Du bist jetzt meine Frau!
Bald konnte er auch das nicht mehr denken, sondern nur noch fühlen, mit jedem winzigen Stück, das er tiefer in sie eindrang: Du … bist … mein …
Er musste sie dazu bringen, aus der Vergangenheit zum Jetzt und Hier zurückzukehren, vom Tod ins Leben, von dem Toten zu ihm.
Immer schneller, kräftiger pflügte er sie, hörte mit grimmiger Befriedigung, dass nun auch sie ihre Lust herausschrie, spürte, wie sein Höhepunkt nahte, und holte noch einmal weit aus, bis er sich befreit aufstöhnend in sie ergoss.
Schweißnass ließ er sich auf sie sinken.
Flüchtig huschte ihm der Gedanke durch den Kopf, dass er sich vielleicht doch besser vorher hätte ausziehen sollen. Die Bruche und die daran festgenestelten Beinlinge hingen ihm irgendwo zwischen den Knöcheln, was unweigerlich ein lächerliches Bild abgeben würde, wenn er aufstand. Er streifte beides mit einer Fußbewegung ab.
Still lag er zwischen ihren Schenkeln, genoss es, noch in ihr zu verharren, während er langsam erschlaffte, und fühlte sich geborgen, zufrieden und müde. Am liebsten würde er für den Rest des Tages so liegen bleiben.
Marthe riss ihn aus der Trägheit. Sanft strich sie mit ihrer schmalen Hand über sein vertrautes Gesicht, bis er ihr in die Augen sah. Ihr Blick sagte ihm, dass sie verstanden hatte – und ihm verzieh.
Nur mit Mühe widerstand Marthe der Versuchung, sich der Müdigkeit hinzugeben. Sie wusste, wenn sie jetzt die Augen schließen würde, schliefe sie ein. Und dabei war so viel zu tun!
Ein halbes Dutzend Kranke wartete auf sie; vor allem aber musste sie ihren Mann dazu bringen, sich schleunigst auf seinen Posten zu begeben. Burgvogt Heinrich, der jede Gelegenheit nutzte, ihm etwas anzukreiden, schnaubte gewiss schon vor Wut.
Doch das eben Erlebte hing immer noch unsichtbar zwischen ihnen und ließ sie zögern.
Er hat recht, dachte sie und sah mit wehmütigem Blick auf Lukas. Ich darf nicht länger in der Vergangenheit verweilen. Christian ist tot, unabwendbar, auch wenn ich ihn noch so sehr vermisse. Aber Lukas lebt, und er verdient meine Liebe.
Sie hob die Hand, die ihr bleiern vorkam, und strich damit erneut über Lukas’ Wangen. Ein paar blonde Locken hingen ihm ins Gesicht, der sorgfältig gestutzte Bart, den er sich seit einiger Zeit stehenließ, fühlte sich weich unter ihren Händen an.
Abermals sah er sie an, und ein Blick in seine blauen Augen holte sie endlich in die Gegenwart zurück, in die Arme des Mannes, der sie liebte, ihr Schutz und Geborgenheit gab.
Sie lächelte, diesmal ganz ohne Wehmut.
Von draußen hörten sie Vogelgezwitscher, das Plappern der Mägde, weiter weg gackerten ein paar Hühner, ein Pferd wieherte.
Wenn man in ihre Augen blickt, ist es, als würde man versinken, dachte Lukas nicht zum ersten Mal. Ihre graugrünen Augen und das kastanienfarbene Haar hatten ihn von Anfang an betört. Und je öfter er in diese Augen sah, umso mehr entdeckte er darin: uraltes, verborgenes Wissen, weitergereicht über Generationen weiser Frauen.
Er gehörte zu den wenigen, die wussten, dass seine Frau nicht nur eine erfahrene Heilerin und Wehmutter war, sondern gelegentlich auch von Vorahnungen heimgesucht wurde, die man besser ernst nahm.
Doch jetzt verriet nichts in ihren Zügen etwas von einer schrecklichen Vision.
Was wohl heißt, dass es beim Burgvogt so schlimm nicht werden wird, dachte er mit neu erwachter Spottlust. Aber dafür sollte ich ihn nicht noch länger warten lassen.
Marthe schien das Gleiche zu denken, denn ihr Blick richtete sich gerade auf den Gambeson, der auf einer der Stangen in der Kammer hing.
»Lass mich dir helfen«, bot sie an und richtete sich auf. »Ist heute nicht das Treffen mit den Ratsherren?«
»Bei allen Heiligen!«, stöhnte Lukas auf. »Das hätte ich fast vergessen.«
Seinem Befehl unterstanden die Bogenschützen, die städtischen Wachen und alle sonstigen Kämpfer, die nicht dem Ritterstand angehörten. Auch weil er sich als einer der ersten Christiansdorfer und Vertrauter des Dorfgründers unter den Stadtbewohnern gut auskannte, rief ihn der Vogt oft hinzu, wenn Angelegenheiten mit dem Rat zu besprechen waren.
Schon war er aus dem Bett, lehnte sich aus der Fensterluke und pfiff gellend auf zwei Fingern.
»Peter soll mein Pferd satteln!«, rief er hinab, bekam eine kurze Bestätigung des Befehls und wandte sich grinsend wieder Marthe zu.
»Irgendwelche Schreckensvisionen? Wird Heinrich mir den Kopf abreißen? Ein Dämon auf dem Weg zur Burg auflauern?«, fragte er mit gespielter Leichtigkeit.
Lächelnd schüttelte sie den Kopf, während sie ihm in den Gambeson half.
»Ich bin sicher, diesen Tag überstehst du lebend«, antwortete sie ebenso leichthin, während er sein Wehrgehänge gürtete.
Nachdem Lukas mit raschen Schritten die Treppe heruntergelaufen war, ließ sich Marthe auf die Bettkante sinken. Müde strich sie sich mit den Händen über die Augen, dann sah sie zum Fenster. Ihr war zumute, als senkten sich die grauen Wolken wie Blei auf ihre Schultern.
Christian hätte die Düsternis verstanden, die sie erfüllte, denn auch er hatte finstere Zeiten durchleben müssen. Doch mit Lukas darüber zu sprechen, scheute sie sich. Er war leichtlebiger, manchmal schon fast leichtsinnig. Vielleicht würde er ihr nur mit einer spöttischen Bemerkung antworten.
Man musste nicht über die Gabe des zweiten Gesichts verfügen oder den Wanderpredigern zugehört haben, um zu befürchten, dass Unheil nahte, schlechte Zeiten für alle, die einst treu zu Christian gestanden hatten. Es würde schwierig für sie werden, wenn der alte Markgraf starb, der nun schon fast siebzig Jahre zählte.
Ein nicht mehr zu bezwingendes Gefühl sagte Marthe, dass diese schlechten Zeiten in greifbare Nähe rückten, mit jedem Tag mehr.
Auf der Freiberger Burg
Das ist eine Unverschämtheit!«, tobte der Burgvogt. »Ich sollte euch alle mit Hunden vom Hof hetzen lassen!«
Vogt Heinrich – stiernackig, kahl und in der ganzen Stadt für seine Unerbittlichkeit gefürchtet – war vom Stuhl aufgesprungen und blickte wutentbrannt auf die drei Ratsherren. Er hatte sie auf deren Bitte hin empfangen, weil sie ein schwieriges Anliegen vorbringen wollten. Wie sich nun herausstellte, bestand dieses schwierige Anliegen darin, einen Ritter der Notzucht zu beschuldigen.
Die unverheiratete Tochter eines Häuers behauptete, dieser Mann habe ihr Gewalt angetan, als sie zwischen den Halden nach einer entlaufenen Ziege gesucht hatte.
»Das Mädchen wagte es nicht, darüber zu reden, bis die Schwangerschaft offensichtlich war«, erklärte der aufsässigste unter den Ratsherren, ein Schmied namens Jonas, beherrscht. »Es ist natürlich zu spät, um Klage zu erheben. Aber vielleicht könnt Ihr dafür sorgen, dass ihr Vater ein Wergeld bekommt. Und mäßigend auf Eure Ritter einwirken. Es häufen sich Beschwerden über ein paar unschöne Zwischenfälle an den Brotbänken, und zwei Eurer Männer haben eine Bademagd grün und blau geschlagen.«
Am liebsten wäre der Vogt dem dreisten Schwarzschmied für diese Worte an die Kehle gegangen. Noch lieber hätte er ihm mit einem einzigen Streich den Kopf von den Schultern geschlagen.
Er konnte förmlich spüren, wie seine Galle überlief. Mühsam rang er nach Luft, während ihm das Blut in den müden Venen pochte. Wenn er sich nicht schnellstens beruhigte, traf ihn noch der Schlag. In Gedanken hörte er schon seine Frau, zu deren Tugenden nicht gerade Schweigsamkeit zählte, wie sie ihm wortreich die üblichen Vorhaltungen machte, er solle mehr auf seine Gesundheit und die Ausgeglichenheit seiner Säfte achten. Im schlimmsten Fall würde sie den Bader kommen lassen. Oder noch übler: das Weib seines Vorgängers, damit sie ihn kurierte, diese Marthe. Die war ihm erst recht nicht geheuer.
Schwitzend strich sich Heinrich über den kahlen Schädel und ließ die Hand kurz im fleischigen Nacken ruhen. Dann stützte er die Fingerknöchel auf die Tischplatte und beugte sich vor, um dem Schmied drohend in die Augen zu sehen.
»Die Bademägde sind Huren, die sich für derlei Dienste gut bezahlen lassen!«, fuhr er ihn an. »Und was diese Häuerstochter angeht: Suchte sie gleich nach der angeblichen Missetat einen Richter auf und erhob Klage mit zerzaustem Haar und zerrissenem Kleid, wie es das Gesetz vorschreibt? Anscheinend nicht, sonst wüsste ich davon. Also hat sie das Balg von wer weiß wem und erdreistet sich jetzt herumzuschreien, um ihre Unzucht nicht eingestehen zu müssen.«
Immer noch kochend vor Wut ließ er sich wieder auf seinen Platz sinken. War denn die ganze Welt aus den Fugen?
Vor kaum mehr als zwanzig Jahren waren die hier noch Knechte gewesen, Siedlergesindel, das auf allen vieren durch den Wald gekrochen kam, um nicht vor Hunger zu verrecken. Die hatten zu roden und zu säen und das Maul zu halten und höchstens von weitem und auf Knien einen ehrfürchtigen Blick auf Männer von Stand zu werfen!
Aber weil hier durch Zufall Silbererz gefunden worden war, wuchs das entlegene Rodungsdorf mitten im Dunklen Wald geradezu unheimlich schnell. Und wenn auch der alte Markgraf von Meißen ein entschlossener und weitsichtiger Mann war, der die Erzförderung mit kühnen Befehlen schnell vorantrieb – in einem hatte sich der sonst so unnachgiebige Otto von Wettin Heinrichs Meinung nach beschwatzen lassen: als er den Christiansdorfern vor vier Jahren das Stadtrecht gewährte.
Mit den Folgen musste er, Heinrich, sich nun als Vogt auf der Freiberger Burg herumschlagen. Statt vor ihm im Staub zu kriechen, wählten die Ortsansässigen neuerdings Ratsherren, die glaubten, ihm in seine Angelegenheiten hineinreden zu können.
Er hatte es schlichtweg abgelehnt, ins Dinghaus zu gehen und sich dort mit dem gesamten Rat zu treffen. So weit kam es noch! Also hatten die drei vor seiner Tür gewartet und um Einlass gebeten, als Bittsteller, wie es sich gehörte.
Der Tucher und der Gewandschneider hatten schon wieder den Schwanz eingezogen wie räudige Hunde. Doch da war noch dieser aufsässige Schwarzschmied, der schlimmste von allen! Seit wann waren Schmiede eigentlich ratswürdig, ausgenommen Gold- und Silberschmiede natürlich und vielleicht noch Waffenschmiede? Aber in diesem Rat versammelte sich wirklich das merkwürdigste Volk: Fassmacher, Wagener … sogar ein Fuhrmann!
Da, schon wieder setzte dieser Jonas zu einer Entgegnung an. Heinrich konnte sich bereits denken, was als Nächstes kommen würde.
»Der Vater des Mädchens ist arm. Er kann es sich nicht leisten, die Ziege zu töten, die bei der Untat zugegen war, wie es das Gesetz vorschreibt.«
Ja, dazu ist das Gesetz da!, dachte Heinrich. Damit nicht jeder Knecht es wagt, einen Herrn vor Gericht zu beschuldigen.
»Arm, ja? Erzählt man sich nicht im ganzen Land die unglaublichsten Geschichten vom Reichtum der jungen Silberstadt Freiberg und ihrer Bewohner?«, höhnte er. »Gesetz ist Gesetz. Wenn ihr wirklich widerfahren wäre, was hier Ungeheuerliches behauptet wird, hätte sie sich an den Richter wenden sollen, wie es sich gehört. An den Vogt. An mich. Sie sollte froh und dankbar sein, wenn ich ihr nicht wegen Verleumdung die lügnerische Zunge herausreißen und sie aus der Stadt jagen lasse!«
Jonas sah hilfesuchend zu Lukas, der ebenso wie der hochfahrend blickende, reich gekleidete Ritter neben ihm bisher kein Wort zu dieser Unterredung beigetragen hatte.
Doch der sonst nicht gerade für Schweigsamkeit und Zurückhaltung bekannte Lukas zuckte nur bedauernd mit den Schultern.
Da das Mädchen nicht auf der Stelle Anklage erhoben hatte, konnte sie es nun auch nicht mehr tun. Ihr war wohl klar gewesen, dass sie kaum recht bekommen würde gegen einen Ritter, der bloß ein paar Eideshelfer brauchte, die beteuerten, dass er dergleichen niemals tun würde. Um das Seelenheil nicht zu gefährden, würden sie für den Meineid jemanden mit einer Wallfahrt an ihrer statt beauftragen.
Sie hatte wohl einfach – und leider vergeblich – gehofft, dass ihr eine Schwangerschaft erspart bliebe.
»Wir werden die Ritter ermahnen, sich gegenüber den Frauen zu verhalten, wie es sich geziemt«, meinte Lukas nur und fing sich dafür einen wütenden Blick des Vogtes ein.
Das kümmerte ihn wenig. Er musste mit Marthe darüber reden. Sie würden das Mädchen als Magd in ihre Dienste nehmen, falls ihr Vater sie verstieß. Mehr konnte er nicht tun.
Dennoch betraf ihn die Sache sehr persönlich. Es ging gegen seine Ehre als Ritter, wenn sich Männer seines Standes dermaßen schändlich benahmen. Vor allem aber, weil Marthe einst selbst Opfer eines solchen Überfalls geworden war. Damals, als sie noch ein blutjunges Ding in zerlumpten Kleidern gewesen war, das mit den Siedlern vor einem grausamen Burgherrn hatte fliehen müssen. Auch sie konnte nicht Klage erheben gegen denjenigen, der ihr das angetan hatte.
Lukas hatte Marthe bis heute in dem Glauben gelassen, er wisse nichts davon. Genau wusste er es auch nicht, hatte es sich aber aus verschiedenen Beobachtungen zusammengereimt. Und später, kurz nach Christians Tod, hatte er ihren zerschundenen Körper gesehen, als er sie aus den Klauen Ekkeharts befreit hatte. Ein Anblick, der in ihm tief eingebrannt war und der ihn auch jetzt noch mit hilflosem Zorn erfüllte, obwohl er den Übeltäter auf der Stelle getötet hatte.
Warnend sah er zu dem Schmied, den er kannte, seit er vor mehr als zwanzig Jahren zusammen mit Christian die ersten Siedler aus Franken in die Mark Meißen geführt hatte. Ratsherr hin oder her, Jonas sollte jetzt lieber den Mund halten. Jedes weitere Wort würde nur noch mehr den Zorn des Burgvogtes heraufbeschwören. Der sah ohnehin schon aus, als platzte er im nächsten Augenblick vor Wut.
Mit Mühe unterdrückte Lukas ein Grinsen.
Das hier war kein Spaß, und er selbst würde wohl auch noch seinen Teil von der Wut des Vogtes abbekommen, wenn die drei Ratsherren erst gegangen waren. So gern Heinrich herumbrüllte – er achtete streng darauf, seine Ritter niemals vor Niederrangigen zurechtzuweisen.
Es machte Lukas wenig aus, sich für eine Weile das Toben des Burgvogtes anzuhören. Und dass er in nächster Zeit ein paar unbeliebte Botendienste übernehmen musste – hauptsächlich an Regentagen und in Gegenden, in die es niemanden zog –, damit hatte er sich bereits abgefunden, als er vorhin seinen Dienst zu spät antrat. Aber wenn Jonas jetzt nicht schwieg, würde sich Heinrich noch ein paar Boshaftigkeiten ausdenken, unter denen die halbe Stadt zu leiden hatte.
Wie sich herausstellte, hatte er das bereits.
»Da ihr nun eure Beschwerden vorgetragen habt«, begann der Vogt und beugte sich leicht vor, während seine Augen triumphierend aufleuchteten, »will ich dem Rat auch meine mitteilen. Es häufen sich Klagen unter meinen Männern, dass immer mehr Beutelschneider in der Stadt umgehen. Da der Rat offensichtlich nicht in der Lage ist, des Diebesgesindels Herr zu werden, werde ich mich dieser Sache selbst annehmen. Noch ein solcher Zwischenfall, und ich verhänge verschärftes Recht über Freiberg.«
Lukas sah, wie die drei Ratsherren erbleichten. Der Tucher, der bis eben geschwiegen hatte, schnappte nach Luft und zerrte am Halsausschnitt seines mit gewebten Borten verzierten Bliauts. Der Gewandschneider, vor einem halben Jahr zum Bürgermeister gewählt, begann zu stammeln.
»Das … Herr, der Fürst hat uns Stadtrecht nach Magdeburger Recht zugebilligt … Seid versichert, wir werden alles tun …«
Doch der Vogt ließ ihn nicht ausreden.
»Ich sorge hier für Recht und Gesetz, da ihr offensichtlich nicht fähig dazu seid«, sagte er so schroff, dass der Bürgermeister jäh verstummte.
Lukas entschied, dass es Zeit war, einzugreifen. »Wenn Ihr erlaubt, werde ich der Sache mit den Beutelschneidern nachgehen. Gebt mir zwei Wochen, und wenn ich bis dahin nichts herausfinde, können wir zusammen beraten, was zu tun ist.«
Es erschien ihm mehr als fragwürdig, dass sich Diebe an die Ritter heranwagen sollten. Bürger, Handwerker, ihre Frauen und Mägde an den Brot- oder Fleischbänken oder bei anderen Besorgungen zu bestehlen, war nicht nur viel weniger gefährlich, sondern auch aussichtsreicher. Ritter waren es nicht gewohnt, zu bezahlen, und führten oft kein Geld bei sich, höchstens ein paar Hälflinge im Almosenbeutel für den Kirchgang.
Er würde Peter auf die Sache ansetzen, seinen Großknecht. Peter hatte als Kind unter Dieben aufwachsen müssen, bis sich Christian seiner annahm. Niemand war besser geeignet als er, andere Diebe zu erkennen und zu überführen. Außerdem war er der Anführer einer ganzen Gruppe junger Männer, allen voran die Söhne des Schmiedes Jonas, die mit ihrem mutigen und listenreichen Einsatz in Christiansdorfs schlimmsten Zeiten schon mehrfach Menschenleben gerettet hatten.
Dem Vogt schien dieser Vorschlag wenig zu gefallen. Doch unübersehbar war Heinrichs Geduld erschöpft.
»Damit wäre wohl alles gesagt«, verkündete er und wedelte mit der Hand zum Zeichen dafür, dass die Unterredung beendet war.
Stumm erhoben sich die drei Ratsherren, verneigten sich tief und verließen den Raum. Das Gespräch hatte nichts von den gewünschten Ergebnissen gebracht; im Gegenteil, nun hatten sie noch mehr Schwierigkeiten am Hals.
Kaum waren die drei zur Tür hinaus, wandte sich Heinrich Lukas zu, erneut vor Wut schnaubend.
»Euch habe ich nicht hinzugerufen, damit Ihr Euch für dieses Gesindel einsetzt!«, schnauzte er ihn an. »Überlegt nächstes Mal besser, auf wessen Seite Ihr steht und welchem Stand Eure Ergebenheit gehört!«
Darauf hätte Lukas eine Menge erwidern können, doch er verbiss sich jedes Widerwort. Damit hätte er jenen nur geschadet, die er schützen wollte.
»Ich dachte, es sei in Eurem Sinne, die Diebe aufzuspüren«, entgegnete er und setzte die harmloseste Miene auf, zu der er fähig war.
Der Vogt kniff die Augen zusammen und sah ihn grimmig an.
»Denkt ja nicht, ich falle auf Eure Spiele herein!«, fauchte er. »Ihr werdet mir binnen zehn Tagen die Diebe ausliefern, damit ich sie hängen kann! Oder ich lasse mir etwas Besonderes einfallen, das weder Euch noch Euren dahergelaufenen Freunden gefallen wird.«
»Gewiss«, meinte Lukas vieldeutig mit einem kühlen, höflichen Lächeln.
Vielleicht sollte er sich zusammen mit Peter, diesem gerissenen Schelm, und seiner Bande auch etwas Besonderes für den Burgvogt einfallen lassen. Allmählich wurde der ihm mit seiner Großmäuligkeit und schlechten Laune lästig.
»Ich frage mich, wie sich jemand aus einem so ehrwürdigen und alteingesessenen Geschlecht mit diesem Gesindel verbünden kann«, meinte Heinrich abfällig. »Jetzt verstehe ich, warum Euer Vater Euch enterbt hat.«
Mit diesen Worten hatte der Vogt bei Lukas eine Grenze überschritten. Weshalb er kein Land besaß, sondern seinem jüngeren Bruder Jakob das Familienerbe zugesprochen wurde, ging Heinrich nun wirklich nichts an.
»Ihr wirkt angegriffen, Herr. Soll ich meine Gemahlin auf die Burg schicken, damit sie Euch einen heilenden Trank zubereitet?«, fragte er mit kaum verborgener Häme.
»Danke, das wird nicht nötig sein«, wehrte der Vogt erwartungsgemäß ab, plötzlich aus der Fassung gebracht.
Er schickte Lukas und den reich gekleideten, dunkelhaarigen Ritter hinaus, der die ganze Zeit kein einziges Wort von sich gegeben hatte, dessen Haltung und Miene aber unmissverständlich die herablassende Überlegenheit seines Standes ausdrückten.
Kaum waren die beiden außer Hörweite, rief Heinrich einen Diener zu sich. »Hol den Bader, er soll mich zur Ader lassen«, befahl er schroff.
Ihm war, als könnte er schon spüren, wie die schlechten Säfte seinen Körper vergifteten. Aber um nichts in der Welt würde er sich in die Hände dieser Kräuterhexe begeben, diesem unheimlichen Weib seines Vorgängers, das seiner Meinung nach unter Edelfreien nichts zu suchen hatte.
Rasch schlug er ein Kreuz und ließ sich am Tisch nieder, um auf den Bader zu warten.
Zur gleichen Zeit auf dem Burgberg in Meißen
Du und du, tretet vor!«
Der Waffenmeister, ein grauhaariger Ritter namens Hartmut, deutete auf diejenigen unter den ältesten Knappen, die am weitesten voneinander entfernt standen, und tat so, als würde er das jäh einsetzende Raunen unter den anderen nicht bemerken.
»Holt euch jeder einen Buckler und zeigt den jungen Dachsen, was ihr gelernt habt! Und ich muss euch nicht erst daran erinnern: Sollte einer von euch vergessen, dass dies ein Übungskampf ist, wird er sich zurück in den Mutterschoß wünschen, noch bevor ich mit ihm fertig bin.«
Die beiden Neunzehnjährigen, an die diese Ansprache gerichtet war – einer mit schwarzen Haaren, der andere mit flammend roten –, traten mit eisigen Mienen aufeinander zu. Keiner von ihnen ließ auch nur durch einen Blick aus dem Augenwinkel erkennen, dass er die Drohung des Waffenmeisters verstanden hatte.
»Wollen wir wetten?«, flüsterte einer der jüngeren Knappen in der hinteren Reihe zu seinem Nebenmann, der dem Dunkelhaarigen unter den aufgerufenen Kämpfern unverkennbar ähnlich sah. »Du musst natürlich auf Thomas setzen, weil er dein Bruder ist, oder? Familienehre und so …«
»Ich würde auch auf ihn setzen, wenn er nicht mein Bruder wäre«, meinte Daniel und gab sich gelassen. »Behalte dein Geld.«
»Sie sind beide gut. Obwohl: Rutger ist größer, das verschafft ihm einen Vorteil«, wisperte sein Freund Johannes. »Aber keinesfalls würde ich darauf wetten, dass beide lebend vom Platz gehen …«
Daniel wagte nicht mehr zu antworten, denn der Waffenmeister blickte schon warnend zu ihnen. Dem Alten schien auch nichts zu entgehen. Hartmut war unter den Knappen ebenso verhasst wie gefürchtet, weil er sie gnadenlos schliff, damit sie später in Kämpfen einmal eine Aussicht zu überleben hatten. Doch Thomas und Daniel hatten einen zusätzlichen Grund, den alten Waffenmeister zu hassen: Er war einst mit Fürst Albrecht nach Christiansdorf gekommen und hatte ihren Vater im Kerker bewacht, bevor er ermordet wurde.
Und jetzt hetzte er diesen Bastard Rutger auf Thomas!
Daniel gestand es sich ungern ein, aber Rutger war seinem Bruder von allen hier noch am ehesten ebenbürtig. Beide galten mit Abstand als die besten Schwertkämpfer unter den Knappen auf dem Meißner Burgberg. Und sie würden einander nichts schenken, denn sie waren bereits seit dem Tag verfeindet, als Rutger von seinem Ziehvater Elmar, dem Anführer der Leibwache des Markgrafen, als Knappe auf den Burgberg gebracht worden war.
Dass sie mit Schwert und Buckler statt mit den großen lederbespannten Holzschilden gegeneinander antreten sollten, erhöhte die Spannung noch, denn um sich mit dem kleinen runden Metallschild zu behaupten, musste man schnell und erfahren sein.
Noch umkreisten sich die Gegner, die Schwerter fest in der Rechten, in der Linken den Buckler, ohne den Blick vom anderen zu lassen.
Beide waren schlank und geschmeidig, voll kaum zu zügelnder Kraft. Rutgers vor Hass verzerrtes Gesicht war inzwischen fast so rot wie sein Haar. Thomas dagegen wirkte beim Anblick seines Kontrahenten völlig gelangweilt, sogar etwas belustigt. Doch Daniel wusste, dass das gespielt war. Sein Bruder – wie er selbst auch – hasste den Widersacher nicht nur, weil ihre Väter Todfeinde gewesen waren, sondern er verachtete ihn auch wegen seiner Heimtücke.
Und er würde sich vor ihm in Acht nehmen.
Zumindest hoffte das Daniel. Sonst kann ich gleich mein Bündel schnüren, dachte er entmutigt. Eigentlich hätte er erst in einem halben Jahr vom Pagen zum Knappen ernannt werden dürfen. Nur wegen des Rufes seines Vaters und seines Bruders war er schon eher in den Kreis der künftigen Ritter aufgenommen worden. Doch der Jüngste unter lauter angehenden Kämpfern zu sein, war kein leichtes Los. Zum Glück hatten Thomas und dessen Freunde ihm heimlich dies und jenes beigebracht, sonst wäre er noch öfter von den Älteren verprügelt worden.
Ein lautes Klirren eröffnete den Zweikampf. Rutger hatte als Erster zugeschlagen. Sein Gegner riss den kleinen Metallschild hoch und fing den Oberhau damit ab. Dann ließ er ihn durch ein leichtes Kippen des Bucklers abgleiten, während er rasch einen halben Schritt zur Seite trat und seinerseits den Gegner mit einem Mittelhau attackierte, der im letzten Moment abgewehrt wurde.
Über fünf oder sechs blitzschnelle Angriffe und Abwehrparaden wogte der Kampf hin und her, bis sich schließlich Rutger mit einem Wutschrei auf den Gegner stürzte. Daniels Freund Johannes bedauerte schon, nicht auf den Rothaarigen gewettet zu haben. Doch Thomas schien vorausgesehen zu haben, was kam, und wich zur Seite. Er umfing die Arme des Gegners mit seinen Händen, die Schwert und Buckler hielten, und umklammerte sie. Nun blieb Rutger nur noch eine einzige Möglichkeit, sich zu befreien: Schild und Schwert zu Boden fallen zu lassen und die Arme herauszuziehen.
Damit war er entwaffnet, der Kampf für ihn verloren.
Die Zuschauer hatten allesamt den Atem angehalten – nicht nur wegen der Schnelligkeit und des Geschicks der Kämpfer, sondern auch, weil sie wussten, dass dies keiner der normalen Übungskämpfe war, nach dem sich die Beteiligten lachend auf die Schulter klopften und den anderen zum Sieg beglückwünschten. Es war nicht zu übersehen, dass jeder der beiden den anderen am liebsten getötet hätte.
Rutger schoss das Blut ins Gesicht vor Hass und Zorn.
Der Waffenmeister schien das nicht zu bemerken – und wenn er es doch tat, so gab er sich blind. Schließlich hatte er klargestellt, welches Verhalten er von seinen Schülern erwartete. Sie waren alt genug, um zu wissen, dass ernsthafte Raufereien untereinander streng geahndet wurden.
»Gut!«, lobte er die Vorführung, als wüsste er nicht, dass hier eine seit Jahren gehegte Feindschaft ausgetragen wurde, die ihren Ursprung in der Blutfehde ihrer Väter hatte.
Natürlich wusste er es wie jeder auf dem Meißner Burgberg. Aber er weigerte sich, darauf Rücksicht zu nehmen. Die beiden Burschen hatten zu gehorchen und zu lernen, was er ihnen befahl, solange sie noch keine Ritter waren. Danach sollte sich gefälligst der Markgraf um die Streitereien unter seinen Männern kümmern.
Deshalb gab der Waffenmeister auch ungerührt den nächsten Befehl, wenngleich er wusste, dass er damit weiter Öl ins Feuer dieser Feindschaft gießen würde.
»Das letzte Vorgehen noch einmal langsam, so dass jeder es mitbekommt. Und dann übt ihr das paarweise«, wandte er sich erst an die Kämpfer, dann an die Jüngeren.
Es schien Rutger alle Beherrschung zu kosten, seine Niederlage noch einmal in aller Ausführlichkeit vorzuführen.
»Ich töte dich, ich schwör’s! Dann ist mein Vater gerächt!«, zischte er seinem Gegner ins Ohr, während er sich – wie befohlen – erneut von Thomas in die Zwangslage bringen ließ, aus der ihm nur der Verzicht auf seine Waffen wieder Bewegungsfreiheit schenkte.
»Dein liebster Traum, ich weiß«, gab Thomas leise zurück, und sein spöttisches Lächeln brachte den anderen noch mehr auf.
Die Verbeugung, mit der sie den Kampf auf Weisung ihres Lehrmeisters beendeten, hätte knapper nicht ausfallen können. Rutger voll unverhohlener Wut, Thomas mit nur mäßig verborgener Belustigung, gingen nun daran, mit den Jüngeren den genauen Ablauf des Abwehrmanövers einzustudieren, das den Kampf unblutig entschieden hatte.
Erst als die Dämmerung einsetzte und die Zeit für die Abendmahlzeit nahte, wies der Waffenmeister an, die Übungen zu beenden, was vor allem den Jüngeren unter den Knappen ein verstohlenes Aufatmen entlockte.
Während die Knappen die Waffen einsammelten, trat ein junger Ritter mit lockigem, braunem Haar zu Thomas.
»Wenn ihr nicht schon seit Jahren Todfeinde wärt – spätestens heute hättest du dir einen gemacht«, bemerkte er treffend. Roland war ein Jahr älter als Thomas, hatte seine Schwertleite bereits hinter sich und stand nun als Ritter in Diensten des Meißner Markgrafen, ebenso wie sein Vater Raimund.
Normalerweise hatte Roland bei den Waffenübungen der Knappen nichts mehr zu suchen. Doch Thomas ahnte, dass sein Freund nicht nur gekommen war, um ihn im Zweikampf mit Rutger zu beobachten.
»Das Leben wäre langweilig ohne Feinde«, antwortete er grinsend.
Roland blickte sich kurz um, bevor er mit gedämpfter Stimme warnte: »Ich sage dir das nicht zum ersten Mal: Irgendwann wird er dich mit seiner Heimtücke überrumpeln! Mit seinen Lügen und Ränken hat er dich schon viel zu oft in Schwierigkeiten gebracht.«
»Ja, aber jetzt wird mich niemand mehr verprügeln, nur weil Rutger mich verpfiffen oder verleumdet hat. Jetzt muss er mich schon selbst besiegen, und dazu ist er einfach zu langsam und zu dumm. Muskeln wie ein Bär, Hirn wie ein Spatz.«
»Darf ich dich daran erinnern, dass mehr Leute von Bären gefressen wurden als von Spatzen?«
Missbilligend schüttelte Roland den Kopf. »Es wird noch ein schlimmes Ende mit dir nehmen bei so viel Leichtfertigkeit.«
Thomas hielt mitten im Laufen inne und sah den Freund aufgebracht an. »Mein Vater hat seinen Vater im ehrlichen Zweikampf besiegt und getötet – in einem Gottesurteil. Randolf hatte also den Tod verdient! Und genau so werde ich mit Gottes Hilfe diesen rothaarigen Bastard töten, wenn der Tag gekommen ist.«
Roland verdrehte die Augen. Sie waren befreundet wie einst ihre Väter, seit ihrer Pagenzeit auf dem Burgberg gemeinsam aufgewachsen, und sie führten dieses Gespräch nicht zum ersten Mal. Deshalb verzichtete er darauf, seine Warnung zu vertiefen. Außerdem hatte er etwas Besonderes auf dem Herzen, das er keinen Tag länger aufschieben wollte.
»Reiten wir noch ein Stück?«, fragte er, nachdem die Schilde und Übungsschwerter in die Waffenkammer geräumt waren.
Der Jüngere begriff, dass der Freund etwas mit ihm bereden wollte, das keine Zuhörer duldete, und nickte zustimmend. So versäumten sie zwar das Mahl in der Halle, aber sicher würde er den Küchenmägden noch etwas abschwatzen können.
Roland übernahm es, den Waffenmeister um die Erlaubnis zu einem Ausritt zu bitten. Mürrisch musterte Hartmut die beiden.
»Ich verbürge mich für ihn«, versuchte der junge Ritter, den Älteren höflich zu überzeugen.
»Das ist, als erkläre sich die Ziege bereit, auf den Kohlkopf aufzupassen«, murrte der Waffenmeister. »Ich hoffe, du findest ein paar eindringliche Worte, um deinem jungen Freund klarzumachen, dass alle, die ich hier ausbilde, ihrem Ungeschick und ihrer Faulheit zum Trotz, einmal auf einer Seite kämpfen werden – für Otto und später für seinen Erben!«
Hartmut sah Thomas scharf an. Der murmelte zwar »Ja, Herr!«, aber die widerspenstigen Gedanken schienen ihm auf die Stirn geschrieben.
»Ich war dabei, Bursche, als dein Vater starb, und du warst es auch!«, blaffte er den angehenden Ritter an. »Also solltest du dich daran erinnern, dass es nicht Rutger war und dein Stiefvater die Mörder gefasst und getötet hat. Lass die alten Geschichten endlich ruhen und Gott für Gerechtigkeit sorgen, wenn du meinst, sie sei noch nicht gewährt. Der Markgraf kennt keine Gnade, wenn er erfährt, dass sich seine eigenen Ritter untereinander bekriegen.«
»Ja, Herr«, wiederholte Thomas und gab sich alle Mühe, seine Ungeduld zu verbergen. Diese Predigt hatte er schon oft zu hören bekommen und hätte einiges dagegenzuhalten. Zum Beispiel, dass sein Vater erst gerächt war, wenn der Mann starb, der den Befehl zu seiner Ermordung gegeben hatte. Dass der Hass und die Durchtriebenheit, mit der ihm Rutger vom ersten Tag an begegnet war, jegliche Freundschaft oder wenigstens eine Zusammengehörigkeit als Waffengefährten unmöglich machten. Und dass die vielen Feindseligkeiten unter Ottos Rittern ihn anwiderten und seine Achtung vor dem Stand, dem er bald angehören würde, ernsthaft auf die Probe stellten.
Doch das behielt er klugerweise für sich.
Hartmut warf ihm einen letzten mahnenden Blick zu, dann wandte er sich wieder Roland zu und ordnete an: »Keine Dummheiten, keine Streiche, keine Raufereien! Vor Einbruch der Nacht seid ihr zurück, um die Pferde kümmert ihr euch selbst.«
Erleichtert bedankten sich die beiden jungen Männer für die gnädig gewährte Erlaubnis. Noch vor ein paar Jahren hätte ihnen allein die Frage eine schallende Ohrfeige und zusätzliche Arbeit eingebracht. Aber nun, da Roland seine Schwertleite schon hinter sich hatte und die von Thomas wohl noch dieses Jahr stattfinden würde, wurden ihnen ein paar mehr Freiheiten zugestanden. Vermutlich dachte Hartmut, sie wollten ins Hurenhaus in der Stadt gehen.
»Morgen bei Sonnenaufgang sehe ich euch voll gerüstet im Sattel«, knurrte Hartmut, bevor er sie entließ. »Ihr gehört zur Geleitmannschaft, wenn der Markgraf nach Döben reitet, um den Burggrafen aufzusuchen.«
Kurz darauf gingen die beiden jungen Männer zu den Ställen, versorgt mit einem halben Laib Brot und einem Stück Schinken, wofür Roland eine der Mägde mit einem Lächeln und einem Hälfling bezahlt hatte. Er überlegte, immer noch in sich hineingrinsend, was wohl den Ausschlag gegeben hatte.
Mit tausendfach geübten Griffen sattelten sie ihre Pferde; beides Hengste aus dem Gestüt von Rolands Vater Raimund, der auf seinem Landgut im Muldental Pferde und Schafe züchtete.
Thomas ritt einen schnellen, aber äußerlich unauffälligen Braunen, weil es ihm als Knappen nicht zustand, edlere Pferde als die Ritter zu besitzen. Roland hatte zu seiner Schwertleite von seinem Vater einen kostbaren Rappen geschenkt bekommen – ein Nachfahre des Tieres, das Thomas’ Vater Christian einst geritten hatte.
Von neugierigen Blicken verfolgt, passierten die jungen Männer das Tor und lenkten ihre Pferde die engen, gewundenen Gassen Meißens hinab, bis sie Stadt und Burgberg ein Stück hinter sich gelassen hatten.
Über das Ziel für ihren Ausritt mussten sie sich nicht lange verständigen: ein Stück an der Elbe entlang und dann einen Hügel hinauf, von dem aus sich ein atemberaubender Blick auf den Fluss, die Stadt und den Burgberg bot. Thomas kannte die Stelle schon aus der Zeit, als sein Vater noch lebte. Dies war einer seiner Lieblingsplätze gewesen, wenn er hier in Meißen war.
Sie saßen ab und ließen die Pferde grasen. Es war ein warmer Frühlingstag. Nach dem langen Winter schien es, als sei die Natur in den letzten paar Tagen mit aller Macht wiedererwacht. Die schon tiefstehende Sonne brachte frisches Grün und gelbe Blüten auf den Wiesen zum Leuchten und wärmte die Gesichter der beiden jungen Reiter.
Ungeduldig wartete Thomas, dass sein sonst so gesprächiger Freund endlich mit dem Grund für diesen Ausritt herausrücken würde. Um das Schweigen zu überbrücken, holte er das Brot aus dem Beutel und brach es in zwei Hälften.
Roland – ungewohnt verlegen – nahm dankend eine entgegen und holte tief Luft.
»Was meinst du … was wohl dein Stiefvater sagen würde, wenn ich ihn um die Hand deiner Schwester bitte?«
Thomas starrte den Freund für einen Moment verblüfft an, doch dieser Gesichtsausdruck wich rasch einem freudigen Strahlen.
»Du und Clara? Ich kann mir zwar nicht vorstellen, dass du es irgendwie schaffst, mein Schwesterherz dazu zu bringen, dir zu gehorchen … Aber eigentlich hatte ich schon immer darauf gehofft, dass du mich das fragst.«
Lachend hieb er dem anderen auf die Schulter. »Wir werden Schwäger!«
»Beschrei es nicht, das bringt Unglück!«, wehrte Roland ab. »Ich habe schon mit meinem Vater darüber geredet. Doch er meint, ich sei noch zu jung, um zu heiraten und einen Hausstand zu gründen. Aber Lukas – ich meine, dein Stiefvater – wird wohl nicht mehr lange warten wollen, bis er deine Schwester unter die Haube bringt. Sie wird bald siebzehn, nicht wahr? Ich habe Glück, dass mir nicht längst jemand zuvorgekommen ist. Oder weißt du etwas von ernstzunehmenden Bewerbern?«
Thomas grinste frech. »Ich glaube nicht, dass mein Stiefvater in dieser Angelegenheit das letzte Wort hat.«
Roland wusste, worauf der Freund anspielte. In dessen Familie liefen die Dinge in vielerlei Hinsicht etwas anders als üblich. Und das aus gutem Grund.
»Aber ich denke nicht, dass er dir das abschlagen wird«, fuhr Thomas fort. »Dein Vater, mein Vater und Lukas waren doch immer die besten Freunde.«
»Und deine Mutter hat meiner beigestanden, als ich geboren wurde, sie hat mich auf die Welt geholt«, sprach sich Roland selbst Mut zu. Er atmete tief durch und sagte, verlegen nach Worten suchend: »Weißt du, ich kenne deine Schwester, seit sie ganz klein war. Ich mochte sie immer. Aber irgendwann, als ich sie letztens sah, war mir, als sähe ich sie zum ersten Mal – als Frau, verstehst du? Als hätte mich der Blitz getroffen …«
»Also …«
Betont langsam ließ Thomas das letzte Stückchen Brot sinken, statt es sich in den Mund zu stecken. »Wenn du willst, dass ich ein gutes Wort für dich einlege, solltest du jetzt vielleicht besser nicht weiterreden. Wenn ich mir vorstelle, dass du und meine Schwester … Andererseits: Was soll’s, besser du als irgendwer sonst!«
Er zuckte mit den Schultern, aß sein Brot auf und schob sich ein Stück Schinken zwischen die Zähne.
»Ich würde sogar mit ihr durchbrennen, wenn mein Vater mir nicht erlaubt, jetzt schon zu heiraten«, gestand Roland mit vagem Lächeln. »Aber natürlich nicht ohne den Segen deiner Eltern«, fügte er rasch an.
Thomas grinste erneut. »Ich fürchte, du wirst sie selbst fragen müssen, ob sie mit dir durchbrennen würde«, bremste er den Überschwang seines Freundes. »Bisher hat sie wenig Begeisterung gezeigt angesichts der Vorstellung, verheiratet zu werden. Aber vielleicht wartet sie insgeheim darauf, dass du um sie anhältst. Lange kann sie es sowieso nicht mehr hinauszögern, ohne als alte Jungfer zu gelten.«
Er wischte sich die Hände im Gras ab und stand auf.
»Bald wird es stockfinster sein. Wir müssen zurück, wenn wir nicht gewaltigen Ärger bekommen wollen.«
»Und du legst ja größten Wert darauf, Ärger zu vermeiden«, spottete sein Freund.
»Im Rahmen meiner Möglichkeiten«, gab Thomas im gleichen Tonfall zurück. »Und die sind begrenzt.«
»Weißt du, ob dein Stiefvater demnächst nach Meißen kommt?«, fragte der Ältere, während er zu seinem Rappen ging. »Vielleicht sogar mit Clara und deiner Mutter? Sonst muss ich um Erlaubnis bitten, mich vom Dienst entfernen zu dürfen, und in aller Form bei euch in Freiberg um ihre Hand anhalten. Gütiger Gott, mein Vater schlägt mich tot, wenn er davon hört! Und natürlich wird Lukas ihm das sofort erzählen …«
Er strich seine braunen Locken zurück, die ihm der Wind ins Gesicht wehte. »Früher dachte ich immer, Heiraten sei eine leichte Sache, wenn erst einmal die Brautgabe ausgehandelt ist. Jetzt ist mir die Brautgabe völlig gleichgültig, ich würde deine Schwester auch ohne nehmen, aber ich sehe Hindernisse über Hindernisse …«
Thomas stieg in den Sattel und wog in Gedanken ab, was dafür und dagegen sprach, dass Lukas bald auf den Burgberg käme. »Sofern unser gnädigster Fürst nicht wieder meine Mutter anfordert, damit sie einen seiner Gichtanfälle behandelt, wird mein Stiefvater Clara wohl kaum an den Hof mitbringen. Du weißt ja, er hält sie fern von hier, so lange es geht …«
Dafür gab es gute Gründe. Niemand von ihnen wollte, dass Clara durch ihr Heilwissen einmal in ähnliche Gefahr geriet wie ihre Mutter, der Feinde heidnischen Aberglauben und Schadenszauber vorgeworfen hatten.
»Du wirst wohl nach Freiberg reiten müssen, wenn wir aus Döben zurück sind.«
»Willst du dir nicht endlich einmal ein ehrbares Mädchen suchen, dem du dein Herz schenkst und um das du freist?«, wollte Roland wissen, bevor er aufsaß. »Ewig kann das doch nicht gutgehen …«
Roland wusste als Einziger, dass Thomas ein Verhältnis mit der neuen, jungen und gelangweilten Frau des alten Haushofmeisters hatte. Als sie mit dem Hofstaat des Markgrafen unterwegs waren, hatte sie ihn eines Abends zu seiner eigenen Überraschung verführt. Seitdem trafen sie sich heimlich bei jeder sich bietenden Gelegenheit, und jeder halbherzige Versuch von Thomas, die sündige Liebschaft zu beenden, war von ihr mit Küssen und sehr überzeugenden Vertraulichkeiten abgewehrt worden.
Thomas zuckte mit den Schultern, dann klopfte er seinem Braunen aufmunternd auf den Hals. »Du hast recht, ich sollte die Finger von ihr lassen. Aber ich kann hier keine Familie gründen. Wenn erst Albrecht Markgraf wird – und das kann jeden Tag geschehen angesichts von Ottos Alter –, muss ich schleunigst von hier verschwinden. Wahrscheinlich mein Stiefvater und meine Mutter auch … Insofern wäre es doppelt gut zu wissen, dass Clara bei dir in Sicherheit ist …«
Sie saßen beide schon in den Sätteln, als Thomas mit gespielter Beiläufigkeit sagte: »Ich hoffe nur, dass ich meine Schwertleite schon hinter mir habe, wenn es so weit ist. Dann kann ich in Graf Dietrichs Dienste treten. Er würde mich bestimmt aufnehmen.«
Roland stieß vor Überraschung einen leisen Pfiff aus. Über diesen Plan hatte sein Freund noch nie mit ihm gesprochen. Dietrich von Weißenfels war Markgraf Ottos jüngerer Sohn und lebte auf wettinischem Besitz an der Saale. Während seiner Knappenzeit war Thomas’ Vater Christian sein Lehrmeister gewesen.
»Klingt vernünftig«, meinte Roland bedächtig. »Aber Dietrich hat das Kreuz genommen, er will den Kaiser auf den Kriegszug ins Heilige Land begleiten. Wahrscheinlich ist er schon unterwegs dahin. Dann wirst du ihm folgen müssen … bis zum Mittelpunkt der Welt!«
Rolands Stimme klang nun schwärmerisch, beinahe neidisch. »Ruhm und Ehre und ewiges Seelenheil! Vergebung aller Sünden!«
Thomas gab sich alle Mühe, gelassen zu wirken. So neugierig er auch auf fremde Länder war, von denen die Leute die unglaublichsten Dinge erzählten – er wusste auch, dass man bis ins Heilige Land durch unwirtliches Gebiet ziehen musste, über unberechenbare Gewässer, einem Feind entgegen, von dem es hieß, er sei ihnen an Waffen und Zahl überlegen und könne auch in sengender Hitze überleben.
»Mein Vater meint, der letzte Kriegszug ins Heilige Land sei eine vollkommene Niederlage gewesen«, sprach Roland weiter, aufgewühlt von der Vorstellung, sein jüngerer Freund könnte sich auf dieses Abenteuer einlassen. »Die meisten Kämpfer sind gar nicht erst angekommen, sondern unterwegs verdurstet, an Krankheiten gestorben oder wurden bei Angriffen während des Marsches getötet. Aber diesmal soll alles anders sein: nur im Kampf ausgebildete Männer von Stand, die ihre Truppen auch verpflegen können, kein Lumpenpack und keine Huren. Es heißt, unser Kaiser habe das größte christliche Heer aufgestellt, das je unter Führung eines Königs oder Kaisers aufgebrochen ist. Wenn es einer schafft, Jerusalem zurückzuerobern, dann er!«
Thomas lachte auf. »Fünfzehntausend bewaffnete Männer und keine Huren? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.«
Doch dann wurde er ernst. »So wie deine Eltern nicht wollen, dass du schon heiratest, halten meine nichts davon, auf diesen Kriegszug zu gehen. Als ich einmal die Rede darauf brachte, fragten sie nur, ob es hier nicht genug für mich zu kämpfen gebe. Aber weißt du, was mich dorthin lockt – abgesehen von dem Gedanken, dass mir so vielleicht auch mein sündiges Verhältnis mit einer verheirateten Frau vergeben wird? Die Vorstellung, dass all diese Männer eine verschworene Gemeinschaft bilden für ihr heiliges Ziel! Dass sie wirklich zusammenstehen, statt sich wie Ottos Ritter hier zu streiten und gegenseitig zu bekriegen!«
Jetzt war es Roland, der lachte. »Fünfzehntausend Männer und keine Streitigkeiten um Ansehen, Rang und Beute? Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen!«
Thomas zog verächtlich die Augenbrauen hoch, bevor er seinem Hengst die Sporen gab. »Ganz gleich, was die Wallfahrer erwartet – schlimmer als hier kann es nirgendwo sein, wenn erst Albrecht Herr der Mark Meißen ist.«
Der alte Markgraf
Lasst uns allein!«, befahl der Markgraf von Meißen barsch.
Sofort erstarrten sämtliche Bediensteten mitten in der Bewegung, um sich dann hastig vor dem Fürsten und seiner Gemahlin zu verneigen und so geräuschlos wie möglich aus der prachtvollsten Kammer des markgräflichen Palas zu huschen.
Otto von Wettin war noch nie ein geduldiger Mann gewesen. Und je älter er wurde und je stärker ihn die Gicht plagte, umso weniger ratsam war es, sich sein Missfallen zuzuziehen.
Hedwig, die Markgräfin, die auf einer der Fensterbänke saß, blickte von dem prachtvoll illuminierten Psalter auf, den sie in den Händen hielt. Trotz ihrer fast fünfzig Jahre war sie immer noch eine schöne Frau. Durch nichts ließ sie erkennen, dass der Befehl ihres Mannes sie verwunderte. Noch weniger ließ sie sich etwas von der Anspannung anmerken, die sie überkam, wenn sie über die Gründe für diesen Befehl nachsann. Es gab genug Angelegenheiten, die unter vier Augen zu bereden wären, und keine davon war erfreulich.
Sie zog sich den pelzverbrämten Umhang enger um die Schultern, der sie gegen die Kühle des Gemäuers schützte, und wartete.
In all den langen, endlos scheinenden Jahren ihrer Ehe hatte sie vor allem eines gelernt: ihren Gemahl behutsam zu lenken. Anfangs, indem sie seine Lust schürte, später allein durch ihren scharfen Verstand. Doch dabei musste sie bedacht vorgehen. Otto zu bedrängen, würde nur dazu führen, dass er in seinen schnell aufflammenden Wutausbrüchen das Gegenteil von dem tat, was gut für ihn und die Mark Meißen war.
Der Markgraf schwieg immer noch. Der Satz, das Eingeständnis, mit dem er dieses Gespräch würde eröffnen müssen, fiel ihm unendlich schwer. Doch er konnte es nicht länger hinauszögern.
Sein einst dunkles Haar war schlohweiß geworden, im Winter hatte er den letzten Zahn eingebüßt, die Gicht ließ jede Bewegung zur Qual werden. In jüngster Zeit verspürte er häufig übergroße Müdigkeit. War dies das Zeichen, dass der Herr ihn bald zu sich rufen würde?
Natürlich durfte er sich nichts davon anmerken lassen. Noch immer zitterte jedermann, wenn er nur die buschigen Augenbrauen zusammenzog und finster dreinblickte.
Er, Otto von Wettin, Markgraf von Meißen, einer der reichsten Fürsten landauf, landab!
Und den größten Teil seines Reichtums und seiner Macht hatte er nicht ererbt oder vom Kaiser zugesprochen bekommen wie die meisten anderen Herrscher, sondern durch kluges Handeln errungen.
Lediglich einen Teil des wettinischen Besitzes hatte ihm sein Vater hinterlassen, kaum bewohnt und überwiegend von Urwald bedeckt, in dem wilde Tiere und wer weiß welche unheimlichen Wesen sonst noch hausten.
Er, Otto, hatte es geschafft, aus dieser Einöde ein blühendes Land zu machen! Er hatte Siedler in die Mark geholt, die mit ihren Axtschlägen der Wildnis Stück um Stück abrangen, die rodeten und säten, die aus dem Urwald fruchtbare Äcker machten und Dörfer errichteten.
Aus Wohlgefallen über dieses mühselige Werk hatte der Allmächtige Herrscher im Himmel ihn und seine Mark Meißen auf besondere Art gesegnet: Er hatte Silber unter der Erde wachsen lassen, reich und rein, wie man zuvor noch keines gesehen hatte.
So dankbar Otto für diesen göttlichen Gunstbeweis war, so überzeugt war er auch, es sich als sein eigenes Verdienst anzurechnen, etwas daraus gemacht zu haben.
Selbstzufrieden ließ er die müden Augen über das Kleid seiner Frau streichen, das unter dem pelzverbrämten Umhang hervorblitzte: kostbare Seide aus dem Morgenland, mit farbenprächtigen Stickereien geschmückt. Das Schapel war aus getriebenem Silber, mit eingelegtem Gold und Granatsteinen verziert, einer Königin würdig. Mit solchem Prunk konnte er sie nun überhäufen und dafür entschädigen, dass sie, die Tochter eines mächtigen Fürsten, einem damals vergleichsweise unbedeutenden Markgrafensohn als Frau zugesprochen wurde. Doch das war lange her. Inzwischen war er dank seiner Klugheit – und auch ihrer, wie er in diesem Moment durchaus einzugestehen bereit war – zu einem der reichsten Fürsten aufgestiegen.
Ja, er hatte dafür gesorgt, dass aus dem rohen, unscheinbaren Erz Unmengen von Silber wurden, das seine Truhen füllte. Er hatte aus dem unscheinbaren Weiler Christiansdorf mitten im Dunklen Wald eine erblühende Stadt gemacht – mit einer Burg, vier Kirchen, einem Handwerkerviertel, der Bergmannssiedlung, dem bekanntermaßen besten Hurenhaus der Mark und sogar einer Judensiedlung, von der aus Handel bis ins Morgenland getrieben wurde.
Das alles war sein Verdienst.
Und jene, die einst geringschätzig auf ihn herabgesehen hatten, weil er nur über ein kleines, kaum erschlossenes Gebiet weitab im Osten herrschte, die platzten fast vor Neid, wenn sie sahen, in welch prachtvolle Gewänder er seine Frau und seine Ritter zu den Hoftagen des Kaisers hüllen konnte und wie gut befestigt er die markgräfliche Burg von Meißen inzwischen hatte.
Nur eines schmälerte seinen Triumph, abgesehen von der Gicht, die ihn so plagte …
Kaum vorstellbar, dass der Kaiser, der auch schon fast siebzig Jahre zählte, tatsächlich noch zu einem Kriegszug bis nach Jerusalem reiten wollte, um die Heilige Stadt zurückzuerobern, die vor zwei Jahren den Ungläubigen in die Hände gefallen war. Allein die Vorstellung, solch eine weite Strecke im Sattel zurückzulegen, ließ Otto erschauern. Ganz zu schweigen von den Entbehrungen, die die Wallfahrer erwarteten: sengende Hitze, gefährliche Überfahrten, Seuchen, Überfälle von Sarazenen … alles schon, bevor der eigentliche Kampf begann. Entweder hatte Friedrich von Staufen den Verstand verloren, oder er musste bei beneidenswerter Gesundheit sein.
Andererseits – er war der Kaiser. Von Gott gesalbt. Vielleicht quälte einen von Gott Berührten nicht so etwas Alltägliches wie die Gicht.
Ich schweife schon wieder ab, rief sich Otto zur Ordnung.
Wenn ihn auch sein Körper immer öfter schmählich im Stich ließ, sein Verstand war glasklar, sofern nicht blanke Wut ihn packte. Und so gestand er sich ein, dass all das, was ihm bisher durch den Kopf gegangen war, nur als Vorwand diente, um das Unvermeidliche aufzuschieben.
Glücklicherweise ließ sich seine Gemahlin trotz seines andauernden Schweigens keinerlei Neugier anmerken.
Wie er sie kannte, wusste sie wohl längst, worum es in diesem Gespräch gehen würde. Schließlich hatte sie in dieser betrüblichen Angelegenheit jahrelang auf ihn einzuwirken versucht, bis er mit unendlichem Entsetzen begriff, dass sie recht hatte und ihre Warnungen nicht nur weiblichen Grillen entsprangen.
Trotz der vielen hässlichen Streitereien in all den Ehejahren sollte er Gott wohl danken, ihm ein so kluges und taktvolles Weib an die Seite gestellt zu haben – Eigenschaften, die er jetzt erst zu schätzen gelernt hatte.
Ich kann es nicht länger hinauszögern, dachte der alte Markgraf und räusperte sich. Auch wenn es ihm unendlich schwerfiel, gestand er leise: »Ich brauche deinen Rat und deine Hilfe.«
Hedwig sah auf und musterte ihren Mann wortlos. Als Otto erneut zögerte, war sie gänzlich sicher, worum es nun gehen würde.
Am liebsten wäre sie aufgestanden, um nachzusehen, ob niemand vor der Tür stand und lauschte. Doch dies wäre ein zu beschämendes Verhalten gewesen – auf solche Art den Verdacht einzugestehen, dass sie in ihrer eigenen Kammer, auf ihrer Burg belauscht wurden.
Selbstverständlich waren sie von unzähligen heimlichen Kundschaftern umgeben: Handlanger des Bischofs und des kaiserlichen Burggrafen, die ebenfalls ihren Sitz auf dem Meißner Burgberg hatten, des Landgrafen von Thüringen, mit dem sie seit dessen Herrschaftsantritt in Streit lagen, des Kaisers, der wissen wollte, was in seinem Reich vor sich ging, während er zum Kriegszug rüstete, des böhmischen Königs, der ein Auge auf die Mark Meißen geworfen hatte, und von wer weiß wem noch. Es wäre einfältig, nicht davon auszugehen, dass womöglich die Hälfte ihrer Bediensteten Auskünfte über das Geschehen im Palas des Markgrafen von Meißen an jeden erdenklichen Interessenten verkaufte.
Nicht nur Ottos Reichtum lockte, sondern auch der Gedanke, dass der Wettinerfürst alt war und jeden Tag zu Gott gerufen werden konnte. Dann würde ein Hauen und Stechen um die Markgrafschaft einsetzen, wie es seinesgleichen suchen musste.
Das war eben der Alltag eines Herrschers. Nichts davon könnte sie beide überraschen oder gar erschrecken. Wenn man es wusste und in seine Überlegungen einbezog, ließen sich nützliche falsche Hinweise an den richtigen Stellen verbreiten.