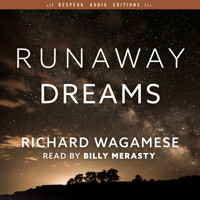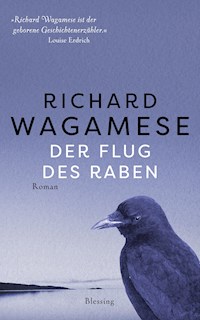
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Karl Blessing Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Garnet Raven ist drei Jahre alt, als er seinem Zuhause in einem Ojibway-Reservat entrissen und von den Behörden in Obhut genommen wird. Er wächst in verschiedenen Pflegefamilien auf, bis er als Teenager die erstbeste Möglichkeit nutzt, um sich aus dem Staub zu machen. Er flieht in die Großstadt, gerät auf die schiefe Bahn und landet schließlich im Gefängnis. Zu seiner großen Überraschung erhält er dort einen Brief seiner längst vergessenen Ursprungsfamilie.
Als er nach seiner Entlassung ins Reservat seiner frühesten Kindheit zurückkehrt und beschließt, dort zu bleiben, bis er neue Pläne für seine Zukunft entwickelt hat, ändert sich sein Leben von Grund auf: Keeper, ein Freund seines Großvaters und der letzte Hüter der Weisheit der Ojibway, macht ihn mit den Traditionen und Riten seines Stammes vertraut. Garnet entdeckt nach und nach die Bedeutung des Ortes, seine Herkunft und sich selbst.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 412
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Das Buch
Toronto, Ende der 1970er-Jahre. Der junge Garnet Raven trägt einen Afro, dazu am liebsten knallige Schlaghosen und bunte Hemden, und sein größtes Idol ist James Brown. An seine Herkunft kann er sich nur vage erinnern – er war drei Jahre alt, als er seinem Zuhause in einem Ojibwe-Reservat entrissen und an eine Pflegefamilie gegeben wurde. Als Teenager nutzte er dann die erstbeste Chance, um sich aus dem Staub zu machen und in die Großstadt zu flüchten.
Um sich über Wasser zu halten, handelt Garnet mit Drogen und landet schließlich im Gefängnis. Zu seiner Überraschung erhält er dort einen Brief seiner ursprünglichen Familie, und so beschließt er, nach seiner Entlassung in den Norden Ontarios zu fahren, um sie zu besuchen.
Im Reservat wird er zwar herzlich in Empfang genommen, aber das abgeschiedene Leben dort ist ihm sehr fremd. Doch dann macht ein alter Mann namens Keeper, der letzte Hüter der Weisheit der Ojibwe, Garnet mit den Traditionen und Riten seines Stammes vertraut. Und nach und nach entdeckt Garnet die Bedeutung dieses Ortes, die Verbundenheit der Ojibwe mit der Natur und das Geheimnis seiner Herkunft – und sein Leben verändert sich von Grund auf.
Das Erstlingswerk des großen kanadischen Schriftstellers Richard Wagamese – ein berührender Roman über das Erwachen von Kanadas First Nations, ein Buch voller Weisheit und Humor.
Der Autor
Richard Wagamese, geboren 1955 im Nordwesten Ontarios, gehört zu den bedeutendsten Schriftstellern Kanadas und indigenen Stimmen der First Nations. Er veröffentlichte fünfzehn Bücher, für die er vielfach ausgezeichnet wurde. Aufgewachsen in Heimen und bei Pflegefamilien, die ihm eine Beziehung zu seinen indigenen Wurzeln verboten, wurde Wagamese erst im Alter von dreiundzwanzig Jahren wieder mit seiner Familie vereint. 2010 wurde dem Autor von der Thompson Rivers University die Ehrendoktorwürde verliehen. Richard Wagamese starb im Jahr 2017. Bei Blessing erschienen bisher seine Romane »Das weite Herz des Landes« (2020) und »Der gefrorene Himmel« (2021), der unter Mitwirkung von Clint Eastwood verfilmt wurde und zahlreiche Preise erhielt.
Der Übersetzer
Ingo Herzke, geboren 1966, hat Klassische Philologie, Anglistik und Geschichte studiert. Seit 1999 lebt er mit seiner Familie in Hamburg und übersetzt unter anderem A.L. Kennedy, Alan Bennett, Gary Shteyngart und Nick Hornby.
RICHARD WAGAMESE
DER FLUG
DES RABEN
Aus dem kanadischen Englisch
von Ingo Herzke
Blessing
Das Buch erscheint unter dem Titel
KEEPER ’N ME
bei Penguin Random House Canada, Toronto
Der Übersetzer bedankt sich für die Förderung dieser Arbeit beim Deutschen Übersetzerfonds.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © 1994 by Richard Wagamese
Copyright © 2021 der deutschen Ausgabe und der Übersetzung
by Karl Blessing Verlag, München,
in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Umschlaggestaltung: Bauer+Möhring, Berlin
Umschlagabbildung: © plainpicture/Hanka Steidle; © istock
Satz: Leingärtner, Nabburg
ISBN 978-3-641-28259-2V001
www.blessing-verlag.de
Für meine Mutter Marjorie Nabish,
weil sie mir die Gabe der Geschichten schenkte,
und meinen Bruder Charles Wagamese,
den besten Schriftsteller, den ich kenne.
Manche glauben, die Wurzel unseres ursprünglichen Glaubens liege im Reich der Magie und der Mystik. Der Flug des Raben zeigt, dass diese Wurzeln vielmehr sanftere Haltungen wie Respekt, Ehre, Freundlichkeit, Teilen und sehr, sehr viel Liebe sind. Dies sind die Indianer, die ich kennengelernt und gekannt und mit denen ich geteilt habe …
RICHARDWAGAMESE 1993
ERSTES BUCH
BIH’KEE’-YAN,
BIH’KEE’-YAN,
BIH’KEE’-YAN
Keeper: Ein Prolog
Kommen inzwischen ’ne MengeTouristen her. War früher nicht so. Als ich klein war, da war dies Land noch Ojibwe-Land. Anishinabek haben wir uns selbst genannt. Reichlich Wild zum Jagen und Fallenstellen, reichlich Fisch in den Flüssen. Nicht wie heute. Überall dicke teure Hütten zum Jagen und Angeln für reiche Amerikaner, die einen guten Hecht nicht von ’nem schlechten unterscheiden können. Angeln bloß fürs Foto. Wir, wir haben alles verbraucht, alles von allem. Jetzt kommen sie das ganze Jahr hier rauf, mit Flinten und Ruten und Rollen, mit großen Booten und Kameras, machen jede Menge Krach und nerven alle.
Mir egal, ich bin jetzt ein alter Mann. Ich spiele einfach den dummen Indianer, und sie lassen mich in Ruhe. Aber für die Jüngeren ist es hart. Irgendwie sitzen die zwischen den Stühlen. Wollen die großen Boote, die großen Gewehre, das große Geld und auch unsere Kultur. Ist manchmal schwer, im Leben seinen Weg zu finden. Ich bin bloß ein alter Mann, der viele Pfade gegangen ist. Wie sagen sie immer in den Filmen? Wo lauter Mexikaner Indianer spielen? Ich habe viele Winter gelebt? Hehehe. Kann schon sein, aber ich rede nicht mehr so romantischen Blödsinn; außer so ein reicher Amerikaner lässt was springen, damit ein echter Indianer von den alten Zeiten erzählt.
Das Komische ist, wie ich dem Jungen schon gesagt habe, die alten Zeiten sind eigentlich gar nicht vorbei. Nicht für uns. Die Welt draußen spielt die ganze Zeit verrückt, findet neue Wege, alte Sachen zu machen, vergisst die Lehren der eigenen Ältesten. Aber wir, wir hören die ganze Zeit zu. Alten, wie ich einer bin. Die reden sowieso die ganze Zeit, da kann man auch zuhören, was? Hehehe.
Was ich sagen will: Wir hatten immer unsere Geschichtenerzähler. Sie kommen und hören den alten Männern und Frauen zu, wenn sie erzählen. Hören gut zu, nehmen die Geschichten in sich auf, erzählen dann allen anderen dasselbe. Deshalb sind die alten Zeiten für uns nie weg, versteht ihr? Gibt immer einen Geschichtenerzähler, der die alten Lehren weitergibt. Klappt bestens, solange es Alte wie mich gibt. Und wir haben’s gut. Die Jungen bringen uns frischen Fisch, frisches Fleisch, fahren uns hierhin und dahin, machen alle möglichen Arbeiten und hängen die ganze Zeit um uns rum. Nicht bloß die reichen Amerikaner haben Angestellte, was? Hehehe. Nee. Wir Alten sind ihnen da ein Stück voraus. Die Anishinabek haben ein gutes Wort, dem niemand je widerspricht, Indianer oder nicht, das macht alles richtig und in Ordnung. Wir sagen: TRA-DI-ZJON. Hehehe. Sollen die Weißen dir glauben, was du erzählst? Sag, das ist TRA-DI-ZJON. Das Gleiche gilt für die Jüngeren hier. Das müsst ihr tun, sagen wir, das ist TRA-DI-ZJON. Ist ein gutes Wort. Macht das Leben leicht.
Kümmert euch nicht um mich. Wenn man so lange da ist wie ich, dann geht es im Kopf ein bisschen durcheinander, man redet alles Mögliche auf einmal. Aber zuhören müsst ihr – das ist TRA-DI-ZJON! Hehehe.
Der Junge will ein paar Geschichten erzählen. Geschichten über das Reservat, über dieses Land, unser Volk, darüber, wie es sich anfühlt, ein Tourist zu sein. Jemanden zu brauchen, der dir den Weg zeigt. Wir sind alle Touristen. Wir alle. Das ist meine Theorie. Wir, wir jammern und maulen die ganze Zeit über diese amerikanischen Touristen, die regelmäßig in unser Land einfallen. Aber in allem steckt eine Lehre. Sie kommen zu unseren Anlegern, unseren Lagern, manchmal kommen sie direkt ins Reservat, weil sie Führer suchen, die ihnen zeigen, was sie finden wollen. Fisch, Bär, Elch, alles. Wenn sie einen finden, sind sie glücklich, und wenn sie kriegen, was sie wollen, sind sie noch glücklicher. Wie im Leben, sage ich, sogar für uns Indianer. Gerade für die Jüngeren. Gerade jetzt, in dieser Welt, in dieser Zeit. Darum habe ich dem Jungen gesagt, dass wir alle Touristen sind. Jeder von uns. Alle das Gleiche. Indianer oder nicht, wir suchen alle nach Führung, damit wir unseren Weg finden. Das ist schwer. Dauert manchmal lange, und viele finden auch gar keinen, der ihnen weiterhilft. Aber wer einen findet, der hat hinterher was zu sagen.
Wisst ihr, die Dinge haben sich zu schnell geändert, und wir gehen anders mit der Zeit um. Wir hatten nie Stechuhren wie die Weißen, wir hatten nie so was wie »Zeitmanagement«, wovon ich mal gehört habe, nichts dergleichen hatten wir. Wir, wir haben mit den Jahreszeiten gelebt. Wussten immer, was wann im Jahr getan werden muss, aber nicht zu welcher Tageszeit. Haben immer alles erledigt, immer überlebt. So war es hier lange Zeit.
Aber die Weißen erfinden schon seit Langem alle möglichen Sachen. Irgendwie haben sie sich dran gewöhnt, dass ihre Welt mit jeder Erfindung immer noch schneller und schneller wird. Haben sich dran gewöhnt, anders mit der Zeit umzugehen, auch wenn sie früher mal genauso waren wie wir. Haben den Kontakt verloren mit dem Rhythmus der Erde, ihre Trommeln vor langer Zeit abgelegt, ihre alten Lieder und ihre alten Lehren vergessen, sich im Tempo der Dinge verloren. Aber als sie hierherkamen, haben die Anishinabek immer noch auf die alte Art gelebt. Mein Vater hat im selben Gebiet Fallen gestellt, wie meine Familie es schon seit sehr langer Zeit getan hat. Sah irgendwie so aus, als ob der Rest des Landes früher als wir vom Fortschritt der Weißen mitgezogen würde. Aber hier gibt es eigentlich erst seit fünfzig Jahren so was wie richtige Veränderungen, und vielleicht ist’s noch gar nicht so lange, dass die jungen Leute sich irgendwie so verloren fühlen. Jetzt müssen sie sich zwischen den Welten entscheiden. Vielleicht wollen sie lieber diese Rap-Tanzmusik hören statt der Pow-Wow-Trommel, lieber fernsehen als Geschichten erzählt kriegen, lieber selbst entscheiden, als sich Lehren anhören. Ist schon schwer. Zu der einen Welt gehören wollen, weil sie so glitzert und so schnell ist, aber Angst haben, die andere Welt ganz loszulassen, die langsamer und vertrauter ist. Ist nicht ihre Schuld. Wir Indianer mochten schon immer glitzernde Sachen.
Der weiße Mann hat auch ’ne Menge gute Sachen hierhergebracht wie Schule und Arbeit, aber die Jungen brauchen trotzdem noch Führung, um sie dahin zu bringen, wo sie hinwollen. Sie suchen immer nach dem Zeichen, kaufen alle möglichen Karten, gehen hierhin und dahin. Kribbelt ihnen ständig in den Füßen. Immer unterwegs, immer auf der Suche. Rennen mit großen Augen rum und wollen irgendwas finden.
Der Junge weiß das. Ist selbst vor nicht allzu langer Zeit hergekommen und hat was gesucht. Da sah er richtig komisch aus. Frisch aus der Stadt, wusste nicht mal so richtig, dass er Indianer, und erst recht nicht, dass er ein Anishinabe war. Hat aber jede Menge gelernt. Der wäre sogar in der Badewanne verloren gegangen. Hehehe. Aber er hat gelernt, und darum hab ich ihm auch gesagt, er soll das hier alles aufschreiben. Ein Geschichtenerzähler werden. Jeder Idiot kann Aufmerksamkeit erregen, aber die Leute bei der Stange halten, dazu braucht es einen Geschichtenerzähler. Gibt ’ne Menge Leute da draußen, die wissen sollten, was passiert ist, wie du deinen Weg gefunden hast und was dazugehört, heutzutage Indianer zu sein. Richtiger Indianer, nicht so einer aus Hollywood. Das hab ich ihm gesagt. Er ist ein guter Junge, ihr werdet schon sehen. Ich komme bloß mit und passe auf, dass er es richtig macht. Außerdem ist vieles davon auch meine Geschichte, und wenn ihr richtig zuhört, gut aufpasst, dann seht ihr, dass es auch eure Geschichten sind. So geht das bei allen unseren Geschichten. Das ist TRA-DI-ZJON. Hehehe.
Man muss auf dieser verdammt holprigen Straße meilenweit fahren, bis man nach White Dog kommt. Man fährt ein paar Kilometer hinter Kenora vom Trans-Canada Highway ab und weiter Richtung Norden. Auf dem Weg zur kleinen Eisenbahnstadt Minaki fährt man einen kleinen, kurvigen, asphaltierten Highway entlang, bis man zur Abzweigung nach White Dog kommt, und ab da lässt man Häuschen, Verkehrsschilder, Picknickplätze und die Zivilisation hinter sich. Von da an ist es ein Waschbrettweg, im Sommer so hart wie staubiger Stahl, im Herbst so suppig wie schlechter Eintopf und im Winter so aalglatt wie das Amt für Indianerangelegenheiten. Selbst nach White-Dog-Maßstäben lässt es sich kaum Straße nennen, aber es ist der einzige Weg, es sei denn, man will ungefähr hundert Kilometer mit dem Boot den Winnipeg River raufschippern. Das Einzige, was die Fahrt erträglich macht, ist das Land. Was für eine Landschaft. Die Bäume stehen manchmal bis direkt an den Straßenrand und sind so groß und grün, dass man blinzeln muss, und wenn man sich grade dran gewöhnt hat, kommt ein großer See in Sicht, der im Sonnenlicht wie ein riesiger Teller aus Quecksilber glänzt. Am besten gefällt mir, wenn die Sonne an Sommertagen die breiten Schattenstreifen dieser Bäume über die Straße wirft und ich hindurchfahre, immer Licht und Schatten, das ist, als sähe man die Welt im Stroboskoplicht. Jedenfalls kommt ungefähr auf halber Strecke so eine riesige Klippe, sieht aus, als wäre sie fast kilometerhoch, und neigt sich über die Straße. Die Alten sind zum Beten dorthin gegangen, und ich habe mich immer gefragt, wie sie es da raufgeschafft haben. Mein Bruder Stanley und ich sind einmal raufgeklettert und haben dafür den ganzen Vormittag und sämtliche Willenskraft gebraucht, die wir in uns hatten. Aber wenn man oben ist, hat man einen fantastischen Blick. In allen Richtungen sieht man meilenweit Grün, gesprenkelt mit blauen Flecken, wo die Seen sind. Wie ein riesiger grüner Teppich, der sich in Wellen ausbreitet, so weit das Auge reicht. Von der Straße kann man das nicht sehen, aber wenn man über eine Hügelkuppe fährt, kriegt man immerhin eine Ahnung davon, wie groß das alles ist.
Aber je weiter man in dieses Land reinfährt, desto mehr umgibt einen so eine geheimnisvolle Ahnung. Als wäre die Klippe ein Wegweiser in eine andere Welt, und vielleicht ist sie das ja auch. Nicht Eine andere Welt wie die Seifenoper, die meine Ma sich immer anguckt, wenn wir in Winnipeg sind, obwohl es auch hier so ein paar Folgen gab, die man sich gut mal anschauen könnte – sondern eher eine andere Welt, in der die Zeit und Bewegung und das Leben selbst anders sind. Ist eher so ein Gefühl. Nichts, was man anfassen oder festmachen kann, aber wenn man auch nur ein bisschen hier herumläuft, merkt man, wie es einem in die Knochen kriecht. Wenn man gut aufpasst, spürt man es schon bei der Fahrt hierherauf durchs Autofenster reinziehen. Die Menschen, die hier leben, gewöhnen sich an das Gefühl von Magie und Geheimnis, aber es kommen nicht viele Leute von draußen rauf nach White Dog, wenn sie hier nicht irgendwas zu tun haben, und ehrlich gesagt finden wir das auch gut so. Vielleicht ist es einfach der reine, wilde Geist des Landes, der langsam heraussickert, aber es ist jedenfalls um Längen besser als alles, was ich bisher gesehen oder gefühlt habe. Ab und zu sieht man einen Elch irgendwo in den Sümpfen oder einen Bären, der zwischen den Beerensträuchern verschwindet, und Keeper und ich haben auch mal einen Puma gesehen. Bloß so ein kurzes Aufblitzen wie gut gegerbtes Hirschleder zwischen den Bäumen, und weg war er. Kein Wunder, dass die Ojibwe Pumas Buschgeister genannt haben. Sie gehören auch zum Geheimnis.
White Dog ist die Heimat eines kleinen Clans von Ojibwe, die nach den Worten meiner Ma seit ein paar Hundert Jahren hier leben. Inzwischen ist es auch mein Zuhause, aber ich war sehr lange weg, irgendwie verloren gegangen in der Welt draußen. Die meisten Leute haben noch nie von den Ojibwe gehört. Wahrscheinlich, weil wir nie Wagentrecks überfallen haben oder John Wayne uns von den Pferden geschossen hat. Die größte Tat der Ojibwe liegt schon ein paar Jahrhunderte zurück, als wir die Sioux aus Minnesota gejagt haben. Gab da irgendeinen Streit um Jagdgebiete, und am Ende haben wir sie in die Flucht geschlagen und auf die Ebenen getrieben, wo sie dann Wagentrecks überfallen haben und John Wayne sie vom Pferd geschossen hat. Aus dem Niemandsland direkt auf die Leinwand. Man sollte meinen, dass sie dankbar dafür wären, aber sie sind immer noch angepisst deswegen. Ab und zu erzählt ein Ojibwa bei einem Pow-Wow einem Sioux, dass er seine Leute nur von hinten erkennen kann. Oder man erzählt sich abends am Lagerfeuer Jagdgeschichten, und ein Ojibwa beschreibt einen Hirsch, der schneller durchs Gebüsch verschwindet als der Hintern eines Sioux. Ist alles nur Spaß, und niemand ist wirklich beleidigt, aber die Sioux sind mächtig stolz auf ihre Kriegertradition und reden nicht mehr so gern über ihre Zeit im Wald. Kein Mensch hat je von diesem Gebietsstreit gehört, weil das nämlich passiert ist, bevor die Weißen hier waren. Das Komische bei den weißen Historikern ist, dass sie immer denken, die nordamerikanische Geschichte habe angefangen, als Kolumbus landete. Wir wissen das besser. Die Ojibwe sind schon seit Ewigkeiten Waldindianer und haben sich schon im Norden Ontarios niedergelassen, bevor Kolumbus irgendwas von Kolumbus wusste.
Die Soziologen nennen uns ein Jäger- und Sammlervolk. Oder nördliches Waldvolk oder so was in der Art. Wir selbst, wir nennen uns Anishinabek. Das bedeutet in Ojibwe »die guten Menschen«. Unsere Geschichtsschreibung beschäftigt sich hauptsächlich mit Fischen, Jagen und Fallenstellen, weil das nun einmal unsere Beschäftigung ist. Oder war, vor der »Besiedlung Nordamerikas«, wie das in den Büchern genannt wird. Heutzutage wird das immer noch sehr viel gemacht, aber niemand lebt noch wirklich davon. Meistens nur von Sozialhilfe. Ab und zu überrascht die Regierung uns alle total und gibt uns Arbeit – Unterholz schneiden oder so was. Manchmal schafft auch der Stammesrat ein paar Stellen, und amerikanische Touristen fliegen ein und heuern Jagdführer an, aber größtenteils ist es ein armes Reservat, wo es nicht viel zu tun gibt für jemanden, der an das Tempo der Außenwelt gewöhnt ist. Hat lange gedauert, bis ich mich dran gewöhnt hatte, im Winter morgens zum Steg hinter dem Haus meiner Ma runterzulaufen, ein Loch ins Eis zu hacken und das Wasser für den Tag im Zwanzig-Liter-Eimer rauszuholen. Oder auch nur meine Wollsocken zum Trocknen über das Abgasrohr des Kanonenofens zu hängen, mit dem das ganze Haus geheizt wird, oder, noch schlimmer, im strömenden Regen die vierzig Meter bis zum Plumpsklo draußen zu rennen. Aber hier draußen gehört so was einfach zum Leben, und du gewöhnst dich dran, und bald merkst du, dass du sowieso lieber so leben möchtest. Ma sagt, sie hat zu viele Familien gesehen, die von der »elektrischen Invasion« zerrissen wurden, wie sie das nennt. Stimmt. Ich bin jetzt fünf Jahre hier und habe mehr gelernt über alles Mögliche, als wenn wir Strom und Fernsehen hätten. Man lernt einander ziemlich gut kennen, wenn man sich gegenseitig die einzige Unterhaltung ist. Das ist wahrscheinlich die große Stärke dieses Reservats. Wir sind zwar arm, aber wir haben immer noch Seele und Herz, und wir passen aufeinander auf. Das kann man nicht von vielen anderen Orten sagen.
Ich heiße Garnet Raven. Die Raven-Familie gehört zum White-Dog-Reservat, seit der Vertrag Drei für den nordwestlichen Teil von Ontario in den 1870ern geschlossen wurde. Raven, also der Rabe, ist auch einer der Boten unseres Volkes in der Tierwelt, also muss es schon irgendwie passen, dass der alte Keeper mir gesagt hat, ich solle so eine Art Geschichtenerzähler sein. Keine Ahnung. Aber seit ich hierhergekommen bin, höre ich mir an, was der Alte mir zu erzählen hat, und versuche, so ziemlich zu machen, was er sagt, und bisher ist alles gut gelaufen. Was soll ich also dagegen sagen?
Ich lebe hier mit meiner Ma zusammen. Wir haben eine kleine Hütte am westlichen Ende der Siedlung. Das Reservat liegt am Ufer des White Dog Lake und ist genauso felsig und bewaldet, wie man es in dieser Gegend erwarten kann. Darum sind die Häuser alle weit verstreut und stehen auf felsigen kleinen Hügeln. Es sind aber keine Häuser, wie sie Stadtmenschen gewohnt sind, sondern bloß so kleine einstöckige Schuppen mit vielleicht vier Zimmern, die alle von einem Raum in der Mitte, wo der Ofen steht, abgehen. Schlecht isoliert sind die Häuser allesamt, und manche von den ärmeren Leuten haben immer noch Fenster aus durchsichtigem Plastik statt aus Glas. Nur ein kleiner Teil sieht tatsächlich nach einer Siedlung aus, nämlich der einzige flache freie Platz in der Gegend, um den sich das Reservatsbüro, die Schule, die Krankenstation, der Laden und die Autowerkstatt drängen. Da steht ungefähr ein halbes Dutzend Häuser, und nur da gibt es Strom und Telefonanschlüsse. Dort leben auch der Häuptling und ein paar aus dem Stammesrat, außerdem die weißen Lehrerinnen und Lehrer von der Schule und Doc Tacknyk und Mrs. Tacknyk, unser ukrainisches Medizinteam. Es gibt ein Baseballfeld, das im Sommer vier Tage lang als Pow-Wow-Platz dient, eine Eisfläche mit Bande und ein paar wackligen Lichtmasten drum herum zum Hockeyspielen und so einen kleinen Alu-Wohnwagen, in dem die Beamten von der Ontario Provincial Police sitzen und Kaffee trinken, wenn sie denn mal hier raufkommen. Mas Hütte steht am Ende des Feldwegs, der die Hauptstraße hierher darstellt. Hinter uns kommen bloß noch Waldwege zu den anderen Häusern, die tiefer in der Wildnis Richtung Shotgun Bay liegen.
Wir sitzen gern hinterm Haus, wo der Pfad runterführt zum Steg, an dem mein Boot liegt. Mein Onkel Archie hat mir das Boot von dem Geld gekauft, das er vorletzten Sommer beim großen Bingo-Turnier in Winnipeg gewonnen hat. Es ist ein vier Meter langes Aluminiumboot mit einem 35-PS-Außenborder, schönen wasserfesten Sitzpolstern und einer eingebauten Kühlbox für die Fische. Ma und ich fahren abends oft mit dem Boot rum, und sie zeigt mir Stellen am Ufer, wo sich große Dinge ereignet haben, entweder für unsere Familie oder für unser Volk. Wenn ich über mein jetziges Leben nachdenke, sehe ich meistens Mas zerfurchtes braunes Gesicht vorn im Boot, wie sie in den Wind blinzelt, lächelt, mit dem Finger zeigt und quatscht, wie ihre Stimme sich senkt und hebt über die Geräusche von Eistauchern und Enten und Wind. Aber manchmal sitzen wir auch bis spätabends draußen und betrachten das Land. Wenn man da lange genug sitzt, während die Sonne hinter den Hügeln untergeht, kann man sehen, wie die Hügel sich bewegen, das schwöre ich. Als würden sie atmen. Ist bloß eine optische Täuschung. Liegt an der Entfernung und der Zeit und einer leisen Sehnsucht nach Magie, die wir alle in uns haben. Das sagt jedenfalls Ma. Sie sagt, der Zauber entsteht aus dem Land, und solche Menschen bringen es weit im Leben, die sich Zeit nehmen, diesen Zauber in sich aufzunehmen. Nur ganz still dazusitzen, zu schauen, zu lauschen, zu lernen. So sickert der Zauber ein. Anishinabek sind ganz groß in solcher Magie. Nicht so ein Zauber wie Kaninchen aus dem Hut ziehen, sondern eher Lehren ziehen, aus allem um sie herum. Ein allgemeiner, gemeinsamer Zauber, der uns lehrt, miteinander zu leben. Die Hügel atmen zu sehen und daran zu glauben, heißt, sich diesem Zauber zu öffnen. Sozusagen die Tür in sich drin offen zu halten, sagt sie.
Wir betrachten also im Dämmerlicht das Land und warten auf das erste Zucken des Nordlichts, ehe wir reingehen, den Kopf voller Träume über dieses Land, unser Volk, einen Ort namens White Dog und einen bestimmten Zauber, der aus all dem entsteht, was uns zusammengebracht hat.
Als ich drei Jahre alt war, bin ich verschwunden. In Heime und Pflegefamilien verschwunden und erst mit fünfundzwanzig zurückgekehrt. Jetzt bin ich dreißig, seit fünf Jahren hier, aber es fühlt sich viel länger an, weil so viel passiert ist.
Wisst ihr, als ich geboren wurde, hat meine Familie noch nach alter Art gelebt. Es gab einen kleinen Clan der Ravens, der auf der anderen Seite der Shotgun Bay in ein paar Armeezelten lebte, wo die Fallen meines Großvaters standen. Meine Ma, mein Pa, meine zwei Brüder und eine Schwester lebten zusammen mit meinen Großeltern und ein paar Tanten, Onkeln, Cousins und Cousinen. Wir stellten Fallen, jagten und angelten und lebten mehr oder weniger von dem, was das Land uns darbot, so, wie es unser Volk seit Jahrhunderten getan hatte, und alle sagen, dass wir ein ziemlich glücklicher Clan waren. Meine ersten Worte waren auf Ojibwe, und die ersten Geräusche, die ich nach meiner Geburt hörte, waren das Rauschen des Windes in den Bäumen, das Plätschern von Wasser und das Murmeln von Ojibwe-Stimmen um mich herum.
Ma sagt, sie hätten schon ziemlich früh gemerkt, dass ich eher so ein Wandervogel sei. Ich war wohl ein wildes Kind und bin ziemlich viel herumgekrabbelt. Ich war irgendwann so gut darin, dass ich direkt aus dem Zelt und in den Wald krabbelte, um meinen Vater und meinen Großvater zu suchen, sodass meine Ma oder Großmutter rausstürzen und mich wieder einfangen mussten. Das ist anscheinend so oft passiert, dass meine Großmutter irgendwann genug davon hatte, mir hinterherzurennen, und mir ein kleines Geschirr aus Elchleder genäht hat, das sie dann mit einer Dreimeterleine an einen Baum gebunden haben. So konnte ich weniger anstellen, aber verschwunden bin ich trotzdem.
Eines Tages kamen nämlich ein paar Typen vom Energieunternehmen Ontario Hydro mit einem dicken Stapel Papiere. Sie sagten meiner Familie, sie hätten vor, weiter unten am Fluss einen großen Staudamm zu bauen, und der Stausee dahinter würde unser traditionelles Fallengebiet überschwemmen. Die Ravens stellten ihre Fallen zwar schon seit vielen Generationen in der Gegend auf, aber niemand hatte ihnen je was von Eigentum oder Grundbesitz erzählt. Das Gebiet lag außerhalb des Reservatlandes, das uns laut Vertrag zustand, und gehörte tatsächlich dem Stromversorger. Also musste meine Familie umziehen, und da zu der Zeit in White Dog weder Häuser noch Arbeit zu kriegen waren, konnten sie nur nach Minaki, in die nächstgelegene Stadt, gehen.
Nach Mas Erzählungen war es viel schwerer, nach der Uhr zu leben als nach Sonne und Jahreszeiten, wie sie es vorher gewohnt waren. Arbeit zu finden war auch hart. Ihr müsst verstehen, im nördlichen Ontario ging es in den Fünfzigern stockkonservativ und rassistisch zu, und Ojibwe waren nicht gerade beliebt. Ma und Pa waren also ziemlich oft weg von der kleinen Hütte am Rand der Stadt, in der wir lebten, und wir Kinder blieben in der Obhut unserer Großmutter zurück, die damals so fünfundsechzig gewesen sein muss.
Also, Indianer haben eine ganz andere Einstellung zu Familie und so. Wenn du hier Kind bist, nehmen dich immer alle auf den Arm, füttern dich, kümmern sich ganz allgemein um dich. Soziologen nennen das Konzept Großfamilie. Wenn du geboren wirst, hast du gleich automatisch eine Großfamilie, die aus allen um dich herum besteht. Für meine Eltern war es also ganz normal, uns bei der alten Dame zu lassen, während sie versuchten, unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Aber die Children’s Aid Society von Ontario fand das gar nicht gut, die sah bloß einen Haufen wilder kleiner Indianerkinder, die eine gebeugte alte Frau terrorisierten. Wer auch nur ein bisschen was über Indianer weiß, dem ist klar: Wenn hier jemand terrorisierte, dann die alte Frau. Wir hatten eine gute Kindheit, aber es dauerte nicht lange, dann tauchten sie bei uns auf und hatten einen Plan für uns alle.
Nach Aussage meiner Schwester Jane, der Ältesten von uns, die noch am meisten Erinnerungen an diese Zeiten hat, kamen sie eines Nachmittags, eine junge Frau und ein älterer weißhaariger Mann. Sie fuhren vor, als wir Kinder gerade Fangen spielten oder an einem alten Reifen schaukelten, der von einem Baum vor dem Haus baumelte. Meine Großmutter hatte irgendwas hinter dem Haus zu tun. Jedenfalls riefen sie uns zu so einem großen grünen Kombi und verteilten Schokolade an alle. Für wilde kleine Indianerkinder, mit Fladenbrot und Biberfleisch aufgewachsen, war Schokolade geradezu himmlisch, als sie uns also mehr davon anboten, wenn wir ins Auto stiegen, zwängten wir uns alle hinein.
Wir landeten in einer Gruppenunterkunft auf einer Farm außerhalb von Kenora in der Obhut der Children’s Aid Society.
Ungefähr ein Jahr später wurde ich von meinen Geschwistern getrennt und allein in ein anderes Heim gesteckt. Jane erzählt die Geschichte so: Also, in dieser Unterbringung auf der Farm waren außer uns noch sechs andere Kinder in Pflege. Wir schliefen alle in Stockbetten in so einer Art Schlafsaal im dritten Stock des Hauses, und wir mussten auf der Farm mitarbeiten. Die Leute da waren aber nicht besonders herzlich oder freundlich zu uns. Während ihre eigenen Kinder zu Weihnachten im Wohnzimmer feierten, mussten wir Pflegekinder an einem langen Tisch draußen auf der Veranda sitzen. Geschenke gab es für uns nicht. Aber meine Geschwister hatten irgendwie ein bisschen Kleingeld zusammengekratzt und mir zu Weihnachten einen Spielzeuglaster gekauft. Sie hatten ihn in braunes Packpapier gewickelt und neben mein Kissen gelegt, damit ich ihn am Weihnachtsmorgen finden würde.
Es war bloß so ein kleiner Plastiklaster, nicht so ein Riesending wie die Tonka-Laster heute, auf denen die Kinder rumfahren können, bloß so ein kleiner rot-blauer Blechlaster, an dem ein Rad fehlte. Aber Jane sagt, ich liebte diesen Laster. Ich nahm ihn mit ins Bett und überallhin. Es war mir offenbar völlig egal, dass ein Rad fehlte. Ich pflasterte Straßen, jagte Bösewichter und baute überall auf dem Hof Städte mit dem kleinen Laster.
Und eines Morgens spielte ich mit meinem Laster in der Sandkiste, als der Schulbus kam, um die anderen Kinder abzuholen. Ich nehme an, meinen Geschwistern hatte man schon am Abend vorher erzählt, dass ich weggeschickt würde, und Jane sagte, sie hätten alle gemeint, es wäre besser, es einfach geschehen zu lassen und mir nichts zu verraten. Ich spielte also am Morgen draußen, und Jane kam und zog mich hoch und nahm mich ganz fest und warm in den Arm und hielt mich lange, sehr lange fest. Ich war wohl ein bisschen genervt, und schließlich schob ich sie weg und spielte weiter.
»Meine Güte, Jane«, sagte ich bloß.
Sie sagt, das waren die letzten Worte, die sie von mir hörte, und zum letzten Mal für die nächsten zwanzig Jahre sah sie mich aus dem Rückfenster des Schulbusses. Ein kleiner Ojibwe-Junge, zusammengekauert in einer Sandkiste, spielt mit einem Laster, dem ein Rad fehlt, und wird immer kleiner und kleiner, bis es so aussieht, als hätte das Land mich einfach verschluckt. Als sie abends nach Hause kam, war die Sandkiste leer bis auf den kleinen rot-blauen Laster, den der Wind schon halb im Sand begraben hatte. Als wir uns zwanzig Jahre später wiedersahen, packte sie mich wieder und nahm mich ganz fest und warm in den Arm und hielt mich lange, sehr lange fest.
Als ich wieder hierherkam, hatte ich mich verirrt. Mit fünfundzwanzig hätte ich mich nie für einen Indianer gehalten. Ich hatte keinerlei Erinnerung mehr an mein früheres Leben, und als ich allein in die Pflegefamilien verschwand, da verschwand ich auch vollständig aus der indianischen Welt. Überall, wo ich hingebracht wurde, war ich der einzige Indianer, und niemand machte sich die Mühe, mir zu erklären, wer ich war, woher ich kam oder was überhaupt passierte. Sicher, ich stammte aus einer nomadischen Kultur, aber ein Kind zwölf Jahre lang ständig herumzureichen ist einfach lächerlich. Ich bin in mehr Häuser rein und wieder raus als ein durchschnittlicher Einbrecher.
Jedenfalls verlor ich sehr schnell den Kontakt mit meiner Herkunft. Ich wuchs in rein weißen Familien auf, ging auf rein weiße Schulen, spielte nur mit weißen Kindern, und da fängst du nach einer Weile selbst an, ganz weiß zu denken und zu reagieren. Weil mir niemand irgendwelche Informationen gab, hielt ich mich schließlich einfach für einen braunen Weißen.
Denn Anfang der Sechziger gab es nur wenige Möglichkeiten, etwas über Indianer zu erfahren, es sei denn, du kanntest ein paar, und ich kannte keinen. Das war für die Weißen genau das Gleiche wie für uns, die wir weiß sein wollten. Die beliebteste Informationsquelle war das Fernsehen. Mann, ich erinnere mich gut an die Samstagvormittage, wenn ich diese Westernserien anschaute und wie verrückt die Cowboys anfeuerte, genau wie alle anderen, und mir ganz flau wurde, wenn die Wilden bedrohlich wurden, und die Angst zu spüren, die wir alle spüren sollten, wenn ihre Trommeln mitten in der Nacht zu hören waren. Indianer. Rothäute. Gruselige Teufel. Heiden. Tauchten plötzlich auf einem Hügelkamm auf, nahmen Skalps, klauten Pferde, redeten dummes Englisch und ritten immer, immer geradewegs ins Gewehrfeuer der Pioniere. Wir stürzten besser vom Pferd als irgendwer sonst, und das war eigentlich auch schon alles, was man Gutes über uns sagen konnte. Es war peinlich, das zu sehen.
Und dann die Bücher. Indianer wurden in keinem einzigen Schulbuch erwähnt – außer als Führer für die tapferen Entdecker, die das Land erkundeten. Ich habe nie verstanden, wie man sich Entdecker nennen kann, wenn man einen Führer braucht, um etwas zu finden. Aber Indianer spielten immer die zweite Geige hinter den Forschern und Entdeckern, welche die wahre Geschichte Nordamerikas schrieben. Die Indianer in Comicheften und Romanen waren schlichtweg Kopien aus den Schulbüchern, aus Film und Fernsehen. Wir waren entweder heidnische Teufel, die rumliefen und Leute umbrachten, oder sehr schlichte Wilde, die unbedingt Hilfe von Missionaren brauchten, um was auf die Reihe zu kriegen und wie richtige Menschen zu leben. Andere Geschichten gab es nicht.
Natürlich übernahmen alle diese Botschaften, und bald bekam ich das Übliche zu hören. Indianer waren faule, unzuverlässige, saufende Gammler, die von Sozialhilfe lebten, an Straßenecken Kleingeld schnorrten und dringend Führung brauchten. Wären die Weißen nicht hergekommen, wären wir alle gestorben.
Ich weiß noch, wie ich einmal in einer meiner Pflegefamilien gegen die Regeln verstoßen hatte und der Familienvater mich daraufhin in das Indianerviertel der Stadt fuhr. Er fuhr ganz langsam, zeigte auf Betrunkene und schmutzige Gestalten, die auf den Bürgersteigen herumtorkelten oder zusammengekrümmt in den Gassen schliefen.
Dann sagte er: »Siehst du. Das sind Indianer. Schau sie dir an. Wenn du dich nicht am Riemen reißt und tust, was man dir sagt, dann wirst du genauso enden!«
Und die Kinder, mit denen ich spielte, waren im Grunde auch so – wie Kinder halt so sind. Sie nervten mich ständig mit dem üblichen »Uff-Howgh-Tonto«-Quatsch, den sie aus dem Fernsehen, von ihren Eltern oder von beiden gelernt hatten. Ständig fragten sie mich so Sachen wie Von welchem Stamm bist du, wie heißt das-und-das auf Indianisch, wie schmeckt Hundefleisch, typischer Kinderkram.
Einmal spielte ich mit den Nachbarskindern Cowboys und Indianer. Bloß hieß es damals bei uns »Cowboys und Blödianer« – weil Kinder nun mal so sind. Und weil ich natürlich der einzige Blödianer in der Runde war, kriegte ich meine Rolle schnell zugeteilt. Kein Mensch verstand damals, wieso ich in Tränen ausbrach. Kein Mensch verstand, wieso ich meine Spielzeugpistolen und den Halfter hinwarf, ins Haus und rauf in mein Zimmer rannte, und ich wiederum konnte nicht verstehen, wieso abends am Esstisch alle in schallendes Gelächter ausbrachen, als ich danach gefragt wurde und erklärte: »Weil ich nicht weiß, wie man Indianer ist!«
So war das in meiner Kindheit. Es war mir peinlich, Indianer zu sein, und ich fürchtete, würde ich je einen echten treffen, hätte ich keine Ahnung, was ich tun oder sagen sollte. Also versuchte ich, mich so gut es ging in die Welt der Weißen einzufügen. Ich wollte unbedingt lernen, alles andere zu sein als das, was ich war. Ich wollte nicht mit einem der Bilder verglichen werden, die ich von meinem Volk, von mir selbst hatte. Aber meine braune Haut war für die meisten Menschen ein deutlicher Hinweis, dass da wohl ein oder zwei Rothäute ums Haus meiner Mama geschlichen waren.
Zu verschiedenen Zeiten war ich also Hawaiianer, Polynesier, Mexikaner oder Chinese. Alles, nur kein Indianer. Diese verwahrlosten Menschen auf der Straße damals verfolgten mich immer noch. Trieb man mich mit Indizien in die Ecke, wurde ich einer der vier berühmten Arten von Indianer: Apache, Sioux, Cherokee oder Comanche. Von diesen Indianern hatten alle schon mal gehört. Ich meine, wenn ich schon unbedingt Indianer sein musste, dann wenigstens einer, von dem alle schon gehört hatten. Weil mir das alles schon peinlich genug war, wollte ich ganz bestimmt kein Passamaquoddy, Flathead, Dogrib oder Ojibwa sein. Sondern lieber ein Indianer mit romantisch klingendem Namen.
In den Blues verliebte ich mich mit zwanzig. Irgendwas an dieser Musik stieß irgendwas anderes tief in mir drinnen an und setzte es in Bewegung. Vielleicht war es die eingebaute Einsamkeit oder das Herumziehen, Suchen, Verlieren und Kämpfen ums Überleben, das gute Bluessänger hinter sich bringen müssen, bevor sie wirklich was zu sagen haben. Ich weiß nicht genau, was es war, aber nachdem ich es zum ersten Mal gehört hatte, hatte es mich gepackt. Ich liebe den Klang des Blues immer noch, spät am Abend oder in der Nacht. Passt irgendwie zu den Klängen des Nordens. Dieses ganze Stöhnen und Jammern und Klagen verträgt sich gut mit finsterer Nacht, wenn der Wind durch die Bäume heult und in der Hütte ein schönes Feuer brennt. Gibt inzwischen sogar ein paar Leute in White Dog, denen der Blues gefällt. Die meisten Leute hier oben stehen eher so auf alte Bluegrass-Stücke mit Fiedel und Mandoline, wie »The Red River Jig« oder »Maple Sugar«, oder auf die Pow-Wow-Songs, die sie während der Pow-Wow-Feiern aufnehmen, aber manche schauen abends gern mal vorbei, sitzen auf der Veranda und hören sich auf unserem batteriebetriebenen Kassettenrekorder Bluesmusik an. Wahrscheinlich haben wir Indianer doch eine Menge mit unseren schwarzen Brüdern und Schwestern gemeinsam, wenn es um Kummer und Leid des Blues geht.
Wally Red Sky allerdings macht die Musik nur runter. Wally ist fest entschlossen, als der beste indianische Country- und Western-Sänger aller Zeiten berühmt zu werden. Hat zu oft die alten Countryplatten seines Vaters gehört, und jetzt schmiert er sich Pomade in die Haare und kämmt sie nach hinten, trägt Westernhemden mit Fransen dran und riecht nach Old Spice. Er meint, Indianer stehen dem Country näher, weil sie enger mit dem Land verbunden sind, und weite Ebenen und Pferde sind indianischer, als sich zu betrinken und über abgehauene Frauen zu weinen. Ich versuchte, ihm klarzumachen, dass es bei den meisten Countrysongs um genau das Gleiche geht, aber er grinst bloß und geht weg und schüttelt dabei seinen glänzenden Kopf ganz traurig.
»Eines Tages wirst du es begreifen, Garnet«, sagt er. »Eines Tages wirst du ›I Saw The Light‹ singen und nicht mehr ›Goin’ Down That Road Feelin’ Bad‹.«
Ehrlich gesagt bin ich ziemlich oft ziemlich viele Straßen langgelaufen und habe mich richtig schlecht gefühlt. Als ich den Blues hörte, da passte er einfach genau in meinen Kopf, und das war im Grunde der erste Schritt auf meinem Weg hierher. Schon komisch, wie so unbedeutende kleine Augenblicke am Ende zur größten Sache in deinem Leben werden, wenn du es eine Weile gelebt hast. Wer wäre darauf gekommen, dass eine schwarze Bluesband in einer Spelunke in Downtown Toronto der erste Schritt auf meinem Weg zurück nach White Dog sein würde. Komisch, aber so ist es gekommen.
Wisst ihr, mit sechzehn bin ich aus den Pflegefamilien abgehauen und auf Wanderschaft gegangen. Ich bin durchs ganze Land getrampt und habe was zu tun gesucht, oder auch einfach einen Ort zum Bleiben. Bin ziemlich rumgekommen und habe in den nächsten vier Jahren eine Menge vom Land gesehen, aber ich habe es nicht geschafft, irgendwo sesshaft zu werden. Mein Freund Keeper nennt das »rutschige Füße haben«. Also, ich hatte in meinem Leben so richtig rutschige Füße, bis ich ’77 nach Toronto kam.
Damals zog ich jede Menge Nummern für die Leute ab, mit denen ich zu tun hatte. Ich war auch deshalb so viel auf Achse, weil meine Spielchen eigentlich ziemlich leicht zu durchschauen waren, und ich machte mich immer aus dem Staub, kurz bevor meine Lügengeschichten aufflogen. Ich wollte immer noch nicht als Indianer gelten. Vor allem, weil die Indianer, die ich in diesen Jahren zu sehen kriegte, im Grunde alle von der Sorte waren, die mir der Pflegevater an jenem Tag vom Auto aus gezeigt hatte. Gruselige, schmuddelige, besoffene Gestalten, die sich auf der Straße prügelten oder bewusstlos in den Gassen lagen, und mit denen wollte ich ganz sicher nicht in einen Topf geworfen werden. Wenn ich also in eine Stadt kam und Leute kennenlernte, war ich irgendwer von irgendwo.
In Niagara Falls war ich eine Weile ein obdachloser Hawaiianer. Im Laden der Heilsarmee hatte ich geblümte Hemden gefunden, eine verspiegelte Sonnenbrille hängte ich mir an einem Bindfaden um den Hals, die Haare ließ ich mir bürstenkurz schneiden, und bei einem Pfandleiher besorgte ich mir sogar eine zerschrammte alte Ukulele. Wenn wir im Park Wein tranken, brachte ich den Leuten ausgedachtes Hawaiianisch bei und sang alberne Lieder zur Ukulele. Herzzerreißende Songs für die Damen wie »KahmonIwannalayya«, »NookieNookieNow« oder »The Best Leis Are Hawaiian«. Ich weiß bis heute nicht, wie ich mit dem bescheuerten Zeug durchgekommen bin, lag wahrscheinlich eher am Wein, aber eine Weile konnte ich da den hawaiianischen Exilanten geben.
Ein anderes Mal, nachdem ich ein paar Folgen von »Kung Fu« im Fernsehen gesehen hatte, wurde ich ein Halbchinese, der überall in Nordamerika nach seinem Vater sucht. Das war angeblich ein kanadischer Geschäftsmann, der auf einer Reise nach Asien meine Mutter geschwängert hatte, die kleine Wing Fei. Dann ließ er mich und Ma in bitterer Armut in Shanghai zurück. Ich würde meine beachtlichen Kung-Fu-Künste gegen ihn einsetzen, wenn ich ihn fand, und so den Tod von Wing Fei rächen, die schließlich der Malaria erlegen war, nachdem sie mich noch zur Lehre in irgendeinen Mönchstempel in den Bergen geschickt hatte. In ein paar Städten zog die Story ganz gut, bis ich einmal in Sudbury zu viel trank und einem großen, kräftigen Biker namens Cow Pie einen traditionellen chinesischen Namen verpasste. Hat ihm wohl nicht so gefallen, Sum Dum Fuk genannt zu werden. Meine Kung-Fu-Kenntnisse ließen mich komplett im Stich.
Dann hatte ich noch eine Phase, wo ich als Pancho Santilla herumzog, ein Boxer, halb mexikanisch, halb Apache, der die Handschuhe an den Nagel gehängt hatte, nachdem er bei einer Kneipenschlägerei in Taos einen Typen getötet hatte. Den Namen Taos hatte ich bei der Fernsehserie McCloud aufgeschnappt, und ich fand, er klang echt cool. Taos. Rollte richtig gut von der Zunge und machte jede Geschichte irgendwie schöner und glaubhafter, fand ich. Es war auch cool, halber Apache zu sein, weil es in Kanada keine Apachen gab und ich sehr wahrscheinlich nie einem begegnen würde, und außerdem standen Apachen ziemlich weit oben auf der Männlichkeitsskala der Mehrheitsgesellschaft. Wenn ich schon Indianer sein musste, wenn also keine andere Masche funktionierte, dann wenigstens einer der erstklassigen Spitzenindianer aus dem Hauptprogramm. Diese Geschichte holte ich nicht allzu oft raus, aber ein paar Bier irgendwo war der gute alte Pancho Santilla immer wert.
Kein Indianer zu sein war eine Vollzeitbeschäftigung, und vielleicht ist es jetzt auch gar nicht so schwer zu verstehen, dass ich mich zum Geschichtenerzähler entwickelt habe. Einige meiner Legenden damals waren echt wild, aber wenn Leute sagen, das Leben schreibt die besten Geschichten, dann haben sie bestimmt an meins gedacht.
Als ich den Blues entdeckte, war ich im Grunde für alles offen. Ich war gerade zurück von ein paar Monaten Arbeit mit einer Eisenbahnkolonne, die überall im südlichen Ontario die Gleisbetten verdichtete. Ich kam also mit einem Haufen Geld in der Tasche nach Toronto zurück und dachte mir, ein paar neue Klamotten und eine Freundin würden mir eine Weile das Leben versüßen. Ich fand ein Wohnheimzimmer in der Nähe der Innenstadt, und ich weiß noch, wie ich dachte, das Leben sei doch gar nicht so schlecht. Ich war inzwischen so eine Art Stammgast in Toronto geworden, schaute regelmäßig für ein paar Monate vorbei. Eines Abends zog ich mir nach dem Essen meine neuen Klamotten an, um durch die Läden zu ziehen. Ich wusste gar nicht genau, wo ich hinwollte, wohin ich nicht wollte, war klar, nämlich keinesfalls in die Nähe des Warwick Hotel oder des Silver Dollar, wo die ganzen Indianer abhingen. Aber irgendwas Großes hing in der Luft, und als ich loszog, wusste ich einfach, diese Nacht würde in die Geschichte eingehen.
Das war die Nacht, in der ich Lonnie Flowers kennenlernte.
Lonnie Flowers war ein großer, schlaksiger Schwarzer, der Downtown unterwegs war, Gras verkaufte und Billard spielte. Ich hatte schon hie und da auf der Straße von ihm gehört, aber bis zu dem Abend hatte ich nie was mit ihm zu tun gehabt. Wenn man sich auf der Straße rumtreibt, hört man jede Menge Namen, bleibt aber meist dann doch mit denen zusammen, die man kennt, und die Kreise sind da ziemlich beschränkt. Wie sich dann aber herausstellte, hatten wir beide schon voneinander gehört, bloß hatten sich unsere Wege nie gekreuzt.
Ich ging die Yonge Street runter und überlegte, ob ich mir in der Zanzibar ein paar Stripperinnen ansehen sollte. Ich war in Gedanken ganz weit weg, als ich eine Stimme hörte, die mich ansprach.
»Hey, Mann, sag an, wie sieht’s aus? Brauchst du was?«
Er stand in einem Hauseingang, hatte einen riesigen Superfly-Hut aus lila Seide auf dem Kopf, einen orangen Anzug mit Schlaghosen und Riesenrevers und solche Plateauschuhe an, die damals Mode waren. Er hatte einen Fu-Manchu-Schnauzer, unter dem Hut quoll ein Afro hervor, und er lächelte. Ein gut aussehender Mann, der aber gleichzeitig ausstrahlte, dass mit ihm nicht zu spaßen war.
»Hm?«, sagte ich mit der Coolness eines Downtown-Profis.
»Was, bist du taub, Alter?«, fragte er und neigte sich zu mir. »Du brauchst ganz dringend Hilfe, Mann. Schieb deinen mageren Hintern mal hier rüber.«
»Hm?«, sagte ich noch mal und fragte mich, wo zum Teufel dieser Typ hergekommen war.
»Scheiße, Mann. Du bist mal ein Downtown-Typ, was? Da hab ich ja ein richtiges Landei vor mir. Komm her.«
Mir blieb keine Wahl, also schob ich mich neben ihn in den Hauseingang. Ich bin über eins achtzig, aber Lonnie Flowers war auch ohne Plateauschuhe einen guten Kopf größer als ich. Außerdem gefiel mir, wie er redete, so schnell und immer in Bewegung, Hände und Füße immer im Rhythmus seiner Worte. Wir standen einen Augenblick nebeneinander, und er bot mir eine Zigarette an. Ich rauche nicht, nahm aber trotzdem eine und steckte sie hinters Ohr, so, wie viele meiner Bekannten es machten. Er sah mich an, lächelte mit den Augen und schüttelte den Kopf.
»Verdammt, Mann, diesen James-Dean-Scheiß hast du ja richtig drauf. Wo kommst du her? Buffalo?« Er lachte über seinen eigenen Witz, und das war so ein lautes, volles Lachen, bei dem sich jeder gleich wohlfühlt. »Nichts für ungut, Mann. Ich nehm dich bloß ein bisschen auf den Arm. Im Ernst, wie heißt du?«
»Huey«, sagte ich und war froh, dass ich mal was Cooleres rausbekam als Hm?. »Huey Kolahey.«
»Kolahey? Ach du Scheiße. Das klingt wie Junkfood für Kühe oder so was. Wo kommst du her, Kolahey?«
»Hawaii.«
Er krümmte sich vor Lachen und schlug sich ein bisschen auf die Schenkel. Ein paar Köpfe drehten sich nach uns um, und auf einmal wünschte ich mir, ganz woanders zu sein.
»Verdammt. Du bist dieser Typ, der immer diese King-Kahmaymaya-Nummer abzieht. Guck dich bloß mal an, Mann. Du hast total auffällige Wangenknochen, schmale kleine Kung-Fu-Augen und einen halben Quadratmeter Hosenstoff übrig, wo dein Hintern sitzen sollte. Musst dir mal ’ne Brieftasche oder so was besorgen, um die Arschbacken ein bisschen aufzupolstern. Echt jetzt: Dass du eine Rothaut bist, sieht man auf den ersten Blick. Aber du erzählst den Leuten, du kommst aus Hawaii? Für wen hältst du dich? Don-Arapa-HO? Scheiße, Mann.«
Zum ersten Mal wurde ich mit meiner Verlogenheit konfrontiert, und ich wollte bloß noch weg, so schnell wie möglich. Noch lachte er, aber ich hatte oft genug gesehen, wie große, kräftige Schwarze auf einmal richtig fies wurden.
»Hey, hör mal, Mann«, sagte ich, »ich, ähm, ich muss los. Ich treffe mich gleich mit jemandem ein Stück weiter die Straße runter, und, äh, ich bin schon ein bisschen spät dran.«
»Verdammt, Brother, der Einzige, den du treffen musst, das bist du selber. Wem willst du denn was vormachen? Den Typen von Hawaii-Fünf-Null? Scheiße. Wo willst du wirklich hin?«
»Mann, das weiß ich selbst nicht, okay?«, sagte ich, wurde ein bisschen genervt und zugleich niedergeschlagen und ängstlich. »Ich kümmere mich einfach um meinen Kram, okay? Man sieht sich.«
»Warte, warte, warte«, sagte er und streckte die Hand aus. »Du hast ja recht. Ich mach dich hier total runter, und du weißt nicht mal, wie ich heiße. Das ist doch nicht korrekt. Ich bin Lonnie, Mann. Lonnie Flowers. Wie läuft’s?«
Wir schüttelten die Hände und klatschten uns ab, und so langsam fühlte ich mich ein bisschen wohler mit diesem komischen Typen im Hauseingang. Wir standen nebeneinander, die Arme untergeschlagen, und schauten auf die Straße, wippten auf den Zehen auf und ab, wackelten mit den Köpfen und sagten nichts.
»Mein richtiger Name ist Garnet. Garnet Raven, und ich, ähm, na ja, ich komme jetzt wohl von hier, Mann.«
»Hey, das ist doch schon besser, Mann. Garnet Raven ist echt cool. Steckt irgendwie so unheimlicher Indianerkram drin, verstehst du?«
»Stimmt, so hab ich das noch nie gesehen. Jedenfalls besser als der beschissene Tonto.«
Wir lachten beide, und ich weiß noch, dass ich dachte: das erste Mal, dass ich mit jemandem richtig gut klarkomme, ohne ihm was vorzumachen. Schien Lonnie Flowers gar nichts auszumachen, dass ich Indianer war, und mir machte es erst recht nichts aus, dass er ein Schwarzer war. Wenn überhaupt, dann wünschte ich mir fast, selbst einer zu sein.
»Hey, Mann, hör mal her«, sagte er. »Ich bin gleich mit jemandem verabredet in so einem Club, dauert bloß eine Minute; aber hast du Lust, danach ein oder zwei Runden Pool zu spielen? Natürlich nur, wenn dein voller Terminkalender es zulässt.«
»Klar. Billard ist zwar nicht so mein Ding, aber schieß dir gern ein paar Kugeln um die Ohren.«
»Verdammt. Da will einer gleich auf einen armen Schwarzen schießen, den er noch nie gesehen hat. Ich sag dir, ist echt kein Spaß mehr, schwarz zu sein!«, sagte er lachend, schlug sich wieder auf die Schenkel und zog mich aus dem Eingang auf die Straße. »Mir nach, Arapa-HO. Schwing deinen mageren Hintern in diese Richtung, du Hula-Hoop-Rothaut!«