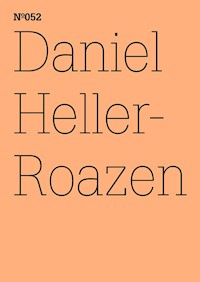12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Was sich der Harmonie der Welt nicht fügen mag Es heißt, dass Pythagoras die Harmonielehre erfand, als er bei einem Schmied den Klang von fünf Hämmern hörte. Vier Hammerschläge konnte er in ein wohlgeordnetes Verhältnis setzen. Der fünfte Hammer jedoch klang dissonant. Pythagoras musste ihn aus seiner Theorie ausschließen. In seiner Studie untersucht der bekannte Philosoph Daniel Heller-Roazen das Konzept der Harmonie in einem weiten Sinn: Seit der Antike dient es als Paradigma für das wissenschaftliche Verstehen der wahrnehmbaren Welt. Doch immer wieder gibt es etwas Dissonantes, das sich gegen die Harmonie wehrt. Von der Musik über Metaphysik, Ästhetik und Astronomie, von Platon bis Kant untersucht ›Der fünfte Hammer‹, wie die wissenschaftliche Ordnung der Welt eine Realität suggeriert, die jedoch weder in Noten noch Buchstaben völlig erfasst werden kann. Ein fünfter Hammer klingt hartnäckig durch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 307
Ähnliche
Daniel Heller-Roazen
Der fünfte Hammer
Pythagoras und die Disharmonie der Welt
Aus dem Amerikanischen von Horst Brühmann
FISCHER E-Books
Inhalt
Abb. 1. Der pythagoreische Hammer, anonyme Illustration aus dem 11. Jahrhundert. Aus: Barbara Münxelaus, Pythagoras Musicus, Bonn 1976, Abb. 11
»OCTAVE«, s.f. – La première des consonances dans l’ordre de leur génération. L’octave est la plus parfaite des consonances; elle est, après l’unisson, celui de tous les accords dont le rapport est le plus simple: l’unisson est en raison d’égalité, c’est-à-dire comme 1 est à 1: l’octave est en raison double, c’est-à-dire comme 1 est à 2; les harmoniques des deux sons dans l’un et dans l’autre s’accordent tous sans exception, ce qui n’a lieu dans aucun autre intervalle. Enfin ces deux accords ont tant de conformité, qu’ils se confondent souvent dans la mélodie, et que dans l’harmonie même, on les prend presque indifféremment l’un pour l’autre.
Cet intervalle s’appelle octave, parce que, pour marcher diatoniquement d’un de ces termes à l’autre, il faut passer par sept degrés, et faire entendre huit sons différents.
Jean-Jacques Rousseau, Dictionnaire de musique (1768)
OKTAVE, subst. f. – Die erste der Konsonanzen in der Reihenfolge ihrer Erzeugung. Die Oktave ist die vollkommenste der Konsonanzen; nach dem Gleichklang ist sie von allen Akkorden derjenige, dessen Verhältnis das einfachste ist: Der Gleichklang steht im Verhältnis der Gleichheit, das heißt wie die 1 zur 1; die Oktave steht im Verhältnis der Verdopplung, das heißt wie die 1 zur 2. Die Harmonien der beiden Töne stimmen ausnahmslos zusammen, was bei keinem anderen Intervall der Fall ist. Schließlich haben die beiden Akkorde so viel Übereinstimmung, dass sie sich in der Melodie oft vermischen und dass man in der Harmonie oft sogar unterschiedslos einen für den anderen nimmt.
Dieses Intervall heißt Oktave, weil man, um diatonisch von einem Ende zum anderen zu schreiten, über sieben Stufen gehen und acht verschiedene Töne erklingen lassen muss.
Vorwort
Einer langen Tradition zufolge war Pythagoras der Erfinder der Harmonie, verstanden in einem doppelten Sinne: als Beschreibung einer begrenzten Menge musikalischer Klänge und, in erweiterter Bedeutung, als Lehre von der fundamentalen Intelligibilität der natürlichen Welt. Dieses Buch untersucht beide Aspekte der Pythagoras zugeschriebenen Erfindung. Es versucht zu zeigen, wie von der Antike über das Mittelalter bis zur Neuzeit die Analyse von Klängen in quantitativen Begriffen ein Modell für die kosmologische Forschung liefert. Diese Forschung, die vielleicht das erste Beispiel für eine Wissenschaft war, wie wir sie kennen, beruht auf einem einfachen Verfahren: der Transkription der Welt in Einheiten der Mathematik. So verstanden, ist das pythagoreische Projekt eines von Lektüre und Notation, das darauf abzielt, die Zeichen, die das große und oftmals wirre Buch der Natur enthält, zu entziffern und zu transkribieren. Man könnte sagen, dass die Vorstellung, auf der eine solche Praxis der Repräsentation beruht, der »Buchstabe« ist, wenn man diesen Begriff in seinem alten Sinne nimmt, als kleinstes Element der Intelligibilität, und wenn man hinzufügt, dass solche kleinsten Elemente ihrer Natur nach quantitativ sind. Die Welt ist entzifferbar, wenn sie sich in solche elementaren Buchstaben auflösen lässt; das wäre eine Art, eine lange währende pythagoreische Wette auszudrücken.
Seit vorsokratischer Zeit, während des ganzen Mittelalters und in der Epoche der modernen Wissenschaft stößt die pythagoreische Notation jedoch auf eine Grenze. Etwas widersteht der Aufzeichnung in irgendwelchen quantitativen Einheiten, seien es Noten, Zahlen, Linien oder Figuren. Für die Hartnäckigkeit dieser Grenze gibt es zumindest zwei fundamentale Gründe. Zunächst einmal können Buchstaben der ganzen Welt, die sie aufzuzeichnen trachten, unangemessen sein. Es ist aber auch vorstellbar, dass die ganze Welt letzten Endes nicht als Ganzes erfassbar ist. Diese beiden Möglichkeiten lassen sich unabhängig voneinander oder zusammen betrachten; darüber hinaus können je nach Autor und Epoche die Bedeutungen von »Buchstabe« und »Welt« variieren. Disharmonie tritt in vielerlei Arten auf. Doch in zwei grundlegend verschiedenen epistemologischen und metaphysischen Paradigmata – vor und nach dem Bruch, den man traditionell mit der galileischen Wissenschaft verbindet – stießen die Denker, welche die natürliche Welt vermittels quantitativer Elemente zu ordnen versuchten, auf etwas, das sich zwar hören, aber nicht aufzeichnen ließ.
Aus Gründen, die der Leser rasch ersehen wird, bezeichnet »der fünfte Hammer« in diesem Buch jenen beunruhigenden Teil, der die pythagoreische Musiktheorie und Kosmologie stört. Seine hartnäckige Wiederkehr in unterschiedlicher Gestalt bildet das Thema der folgenden Kapitel.
Erstes Kapitel In der Schmiede
Pythagoras verstand es, seinen Ohren zu misstrauen. Als Weiser und Wissenschaftler wusste er, dass die Wahrnehmungsorgane manche Wahrheiten offenbaren können, doch wusste er auch, dass sie ihn stets in die Irre zu führen vermochten. In seinen De institutione musica libri quinque berichtet Boethius, dass Pythagoras »nicht den menschlichen Ohren traute«, da sie wie alle anderen Teile des Körpers ständiger Veränderung unterliegen.[1] Manchmal wandeln sie sich aufgrund äußerer und zufälliger Umstände; manchmal beginnen sie sich mit Notwendigkeit zu verändern, etwa mit zunehmendem Alter. Kaum mehr erwartete Pythagoras von menschengemachten akustischen Hilfsmitteln. Musikalische Instrumente waren für ihn die Quelle »grosse[r] Veränderung und Unbeständigkeit«.[2] Mehr als einmal hatte er die Natur der Saiten untersucht. Ihre Töne können sich aus Gründen verändern, die zu zahlreich sind, um sich vollständig aufzählen zu lassen. Je nach ihrer Beschaffenheit, abhängig von ihrer Länge und Dicke, von der Feuchtigkeit der umgebenden Luft und der Kraft, mit der sie angeschlagen werden, werden Sehnen unvermeidlich unterschiedliche Töne geben. Pythagoras hatte beobachtet, dass andere Instrumente ihnen darin gleichen. Sicher war nur, dass ihre »vorher bestehende Beschaffenheit« und infolgedessen auch ihre Töne sich früher oder später veränderten. Da ihm die Implikationen dieser Tatsache bewusst waren, hatte Pythagoras beschlossen, sich und seine Forschungen, so gut es ging, von den verwirrenden Konsequenzen der Sinnesgegenstände zu befreien. Er wollte die Gesetze des Klangs studieren, ohne ihnen in ihrer körperlichen Gestalt begegnen zu müssen, und wollte Erkenntnis von den Eigenschaften der hörbaren Dinge einzig mit Hilfe der Vernunft erlangen.
Der Plan war kühn entworfen, sollte jedoch nie vollendet werden. Eben als Pythagoras darüber nachsann, welchen Lauf seine weiteren Forschungen nehmen sollten, wurde er plötzlich abgelenkt. »Durch göttliche Eingebung geleitet«, fand sich der Denker vom Ort seiner gewöhnlichen Kalkulationen hinausgeführt in die Welt. Wie verzaubert wanderte er zu einer Schmiedewerkstatt. Aus der Schmiede kam das Geräusch zahlreicher Hämmer, und er hörte, »wie aus den verschiedenen Tönen nur eine Harmonie hervortönte«. Staunend begann Pythagoras zu verstehen, was er entdeckt hatte. »So also zu dem, was er lange suchte, durch Zufall hingeführt, schritt er zum Werk […].«[3]
Das Staunen wich bald vernunftgeleiteter Überlegung. Diese Töne entstanden nicht von selbst; sie entsprangen der Tätigkeit von Menschen und wurden mit Werkzeugen in einer bestimmten Umgebung ausgeführt. Pythagoras versuchte den Grund für die Kongruenz der Töne in Erfahrung zu bringen. Doch das war keine leichte Aufgabe. Wie waren die Schmiede von der Schmiedewerkstatt, die Hämmernden von den Hämmern zu unterscheiden? Als Erstes prüfte er eine Hypothese. Er »ließ […] die Schmiede die Hämmer unter einander vertauschen«, und sie begannen erneut mit ihrer Arbeit. Die verblüffende Konsonanz blieb. Wenigstens eine unbezweifelbare Folgerung ließ sich nun ziehen: »Die Eigenschaft der Töne hing […] nicht von den Armen der Männer ab, sondern begleitete die vertauschten Hämmer.« Die Konkordanz, recht definiert, hatte sich also nicht verschoben. Ihr Ort lag fest: unbestreitbar nicht bei den Arbeitern, sondern in den Werkzeugen. Genauer gesagt, die Konsonanz lag in einer der zahlreichen sinnlichen Eigenschaften der Hämmer. Es war eine Eigenschaft, die für deren Zweckdienlichkeit vielleicht durchaus nebensächlich war: nämlich dass sie eine Masse besaßen, die präzise messbar war. Pythagoras begriff diesen Punkt rasch: Die einfache Konsonanz ergab sich aus den Relationen zwischen den Gewichten der Hämmer, die eine Reihe von wohllautenden Tönen verursachten. Für Boethius, einen Denker der Spätantike, ließen sich die Gewichtsrelationen der verschiedenen Hämmer natürlich am besten in der Terminologie der griechisch-lateinischen Arithmetik ausdrücken. Er schreibt:
Da es nun 5 Hämmer waren, so fand er zwei, die in doppeltem Gewicht zu einander standen; diese ertönten in der Consonanz der Octave (diapason). Von diesen beiden stand der, welcher das doppelte Gewicht hatte, zu einem andern im Sesquiterz und ertönte mit diesem in der Konsonanz der Quarte (diatesseron). Zu einem anderen stand der doppelte im Verhältnisse des Sesquialter und ertönte also mit diesem in der Quinte (diapente). Diese beiden aber, zu denen der erste im doppelten Sesquiterz und Sesquialter stand, bewahren zu einander wechselseitig eine Sesquioctave.[4]
Diese Zusammenfassung, räumt Boethius ein, ließe sich auch einfacher formulieren. »Um das Gesagte deutlicher zu machen, so nehmen wir an, die vier Gewichte seien in Zahlen ausgedrückt diese: 12, 9, 8, 6.«[5]
Pythagoras erkannte sofort die Bedeutung seiner Entdeckung. Rasch kehrte er nach Hause zurück und wiederholte das Experiment mit neuen Mitteln. Zuerst, berichtet Boethius, »übertrug [er] die Gewichte auf die Saiten und beurtheilte die Consonanzen derselben mit dem Ohre. Jetzt stellte er auch in Bezug auf die Länge der Pfeifen das Doppelte und die Mitte her und richtete die übrigen Proportionen ein.« Als Nächstes »stellte er für das Maass der Spannungen die Cyathen der gleichen Gewichte mit den Acetabulen zur Vergleichung zusammen. Auch freute er sich gefunden zu haben, dass es in nichts verschieden sei, ob er mit einem ehernen oder eisernen Stabe die durch verschiedene Gewichte gebildeten Acetabulen schlage.«[6] Schließlich »gelangte er auch dahin, die Länge und Dicke der Saiten gegen einander abzuwägen«.
Er kam zu einer Reihe von Befunden, die sich am einfachsten an einem simplen Instrument demonstrieren lassen: dem Monochord. Dieses besteht aus einer einzelnen Saite, die über einen Resonanzkasten gespannt und an beiden Enden befestigt wird; ihre Länge wird von einem beliebig verschiebbaren Steg geteilt. Wird die Sehne gezupft oder angeschlagen, gibt sie einen einzelnen Ton von sich. Wird die Länge der Sehne allmählich verkürzt, wird der Ton immer höher. Doch in Wahrheit hatte Pythagoras, den Klang der Schmiedewerkstatt im Ohr, noch weit mehr begriffen. Zwischen den Längen- und den Tonveränderungen ließen sich Gesetzmäßigkeiten beobachten; es waren also Korrelationen zwischen geometrischen und klanglichen Phänomenen festzustellen. Besonders drei Äquivalenzen fielen sofort auf. Eine offene Saite erzeugt einen Ton. Wird sie halbiert, so erzeugt sie einen anderen, exakt eine Oktave höheren. Die Sehne wird dann das den Alten als diapason bekannte Intervall von sich geben. Wird die Saite dagegen in drei Abschnitte unterteilt, von denen zwei angeschlagen werden, so wird ein neues Intervall zu hören sein: die Quinte, welche die Griechen und Römer als diapente kannten. Wird die Saite schließlich in vier Abschnitte unterteilt, von denen drei angeschlagen werden, so wird sie einen Ton geben, der um eine Quarte höher ist als die offene Saite; somit wird das Instrument das diatesseron erklingen lassen.
Plötzlich gewann die scheinbar endlose Verschiedenheit der Töne eine neue Einfachheit. Akustische Intervalle waren nun als arithmetische Relationen ausdrückbar. Der Beweis lag in der Reduktion des Klangs der Oktave auf die Relation zwei zu eins (2:1); des Klangs der Quinte auf die Relation drei zu zwei (3:2); des Klangs der Quarte auf die Relation vier zu drei (4:3). Kurz, die natürliche Welt ließ sich transkribieren – zwar nicht mit den Buchstaben von Alphabeten, die sich gemäß der Verschiedenheit menschlicher Idiome voneinander unterscheiden, sondern mit Hilfe von »Zahlen«, die die Alten als Anzahlen der Eins auffassten. Die Folgen dieser Tatsache für das Verständnis der physikalischen Welt waren gewaltig. In sinnlichen Dingen konnte man das Intelligible entdecken, im Veränderlichen das Unwandelbare. Durch die Analyse des Tons hatte Pythagoras die Grundlage seiner Metaphysik erreicht. Es war dies eine Lehre, die Aristoteles mit wenigen lapidaren Sätze referierte: »Die Dinge selbst seien Zahlen« (ἀριθμοὺϚ εἶναι αὐτα τὰ πράγματα);[7] »die Dinge existierten kraft der Nachahmung der Zahlen« (μιμήσει τὰ ὄντα φασὶν εἶναι τῶν ἀριθμῶν);[8] die Zahl sei »ein Prinzip [auch] im Sinne der Materie für die Dinge« (τὰ τῶν ἀριθμῶν στοιχεῖα τῶν ὄντων στοιχεῖα πάντων ὑπέλαβον εἶναι).[9] Solche Sätze deuten unterschiedliche, möglicherweise konfligierende Positionen an.[10] Doch trotz ihrer Unterschiedlichkeit schreiben sie Pythagoras und seinen Nachfolgern ein ganz bestimmtes Programm zu: in der Idee der Zahl einen Schlüssel zum Verständnis der natürlichen Welt zu finden.
Dieses Verständnis konnte weit voranschreiten, doch letztlich musste es stocken. Man kann die Entdeckungen in der Schmiede als Illustration des Projekts und seiner Grenzen betrachten. Pythagoras entwickelte eine arithmetische Lehre, die auf einer Serie von vier Termen beruhte, die den vier jeweiligen Gewichten der konsonanten Hämmer entsprachen: zwölf; neun; acht und sechs. Allein mit diesen ganzen Zahlen konnte Pythagoras die numerischen Relationen ausdrücken, die auf einem Monochord die Oktave (12:6), die Quinte (9:6 oder 12:8) und die Quarte (8:6 oder 12:9) ergeben. Doch diese Relationen spiegelten noch einfachere Proportionen. »Zwölf zu sechs« lässt sich als »zwei zu eins« schreiben; »neun zu sechs« oder »zwölf zu acht« als »drei zu zwei«; »acht zu sechs« oder »zwölf zu neun« als »vier zu drei«. Kurz, alle drei grundlegenden akustischen Intervalle ließen sich durch die Relationen der ersten vier natürlichen Zahlen ausdrücken; diese Terme genügten, um die Konkordanz in der Schmiede zu analysieren. Später vollzogen Pythagoras’ Anhänger einen weiteren Schritt. Die ersten vier Zahlen wurden für sie zu den Einheiten einer kosmologischen »Vierergruppe« (τετρακτύϚ).[11] Ihre arithmetische Summe ergab die Einheit zehn, also die Grundlage für alles weitere Zählen. Sie wurde in der »Rechenstein-Figur« geometrisch als vollkommenes Dreieck dargestellt[12] – das heißt als ein gleichseitiges Dreieck, das entsteht, wenn man über vier Steinen, die in einer Reihe liegen, eine Reihe mit drei, dann mit zwei und dann mit einem Stein anordnet. Denker in dieser Tradition schrieben jedem dieser arithmetischen Elemente verschiedene und weitreichende Bedeutungen zu. Speusipp zum Beispiel lehrte, dass der Punkt eins sei, die Linie zwei, das Dreieck drei und die Pyramide vier.[13] Eine Quelle gibt an, dass das Prinzip bei den Pythagoreern Gegenstand eines heiligen Schwurs war: »Nein, ich schwöre bei dem, der unserer Seele die Vierheit gab / In welcher die Quelle und Wurzel der ewigen Natur liegt.«[14]
Doch in Wahrheit wies diese Vierheit von Anfang an einen Mangel auf. Die Transkription in der Schmiede war entschieden unvollständig. Ein Element wurde nicht mitgezählt. Bei der Beschreibung der Werkzeuge, die die Konsonanz der Töne ergaben, bemerkt Boethius: »Da es nun 5 Hämmer waren …« Die relativen Gewichte von allen außer einem konnten mit Hilfe der ersten vier Zahlen perfekt notiert werden. Doch es gab noch einen fünften Hammer. Boethius widmet dem Schicksal dieses höchst unmusikalischen Instruments nicht mehr als einen Satz: »Der 5te«, schreibt er im Vorübergehen, »wurde verworfen, welcher allen inconsonirend war« (Quintus vero est reiectus, qui cunctis erat inconsonans).[15] Diese abrupte, entschlossene und offenbar unwiderrufliche »Verwerfung« wäre einiger Überlegung wert. Was war mit diesem fünften Hammer, wenn Pythagoras ihn so entschieden verwarf? Boethius gibt nur die blasse Andeutung einer Antwort, und sie ist nicht leicht zu verstehen. Er schreibt, der fünfte Hammer sei »allen inconsonirend« gewesen. Doch dieser Satz beinhaltet eine Frage: Was bedeutet dieses »alle«, wenn etwas – und wäre es nur ein einziges – in krasser Dissonanz dazu tönt?
Die Präsenz des fünften Hammers scheint die Totalität der Vierheit Lügen zu strafen. Das war jedoch auf mindestens zwei Arten möglich, die unterschiedliche und in der Tat widersprüchliche Deutungen des letzten Schlaginstruments nahelegen. Boethius’ Publikum wird gefolgert haben, dass die Präsenz des fünften Hammers einen Fehler verriet, der nicht Pythagoras, sondern unserer niederen Welt zuzuschreiben ist. Eine solche Erklärung war mit den Kanons des antiken Wissens durchaus vereinbar. Es sei daran erinnert, dass die klassischen Denker in der Regel Naturprinzipien zu erfassen versuchten, die definitionsgemäß ewig, unwandelbar und notwendig gelten sollten, und dass sie lehrten, Einzeldinge seien ihrem Wesen nach vergänglich, veränderlich und daher ungewiss. Die frühen Leser von Boethius’ Werk werden den fünften Hammer in diesem Sinne verstanden haben: Für sie mochte der Missklang auf die Beschränktheit der sublunaren Sphäre hindeuten, in der die Naturwissenschaft, selbst in ihren entwickeltsten Formen, kein physikalisches Ereignis mit Gewissheit vorhersagen kann. Erst jenseits des Mondes, in den nobleren Regionen, die diese vergängliche Welt umschließen, können mathematische Prinzipien und Deduktionen ihre exakte Anwendung finden. Heute jedoch gibt es natürlich eine näherliegende Lösung für das Problem des lärmenden Elements. Man kann mit dem Finger auf den primitiven, wenngleich geistreichen Theoretiker deuten und einfach den Schluss ziehen, dass im Kalkül des Pythagoras etwas verkehrt war. Es konnte ein Irrtum gewesen sein – sei’s in der Beobachtung oder in der Prognose, in der Messung oder in der Methode –, der Pythagoras daran hinderte, in seinem System der Proportionen einen Platz für das Werkzeug zu finden. Wäre seine Analyse korrekt gewesen – so könnte man argumentieren –, hätte sie keinen Rest übriggelassen, denn eine wissenschaftliche Untersuchung duldet gewiss keine Ausnahmen. Solche Lösungen sind sicherlich vorstellbar, verhüllen aber in Wahrheit eine Dunkelheit. Wie war die Welt des antiken Wissens beschaffen, wenn sie einen Ton zuließ – und vielleicht forderte –, der mit »allen anderen« dissonant war? Und was ist das Universum der modernen Wissenschaft, wenn es im Kontrast dazu den Lärm eines einzelnen dissonanten Teils nicht dulden kann?
Über die Gründe für die Dissonanz des fünften Instruments kann man nur spekulieren. Doch so viel ist kaum zu bestreiten: Obwohl Pythagoras den letzten Hammer in seine Äquivalenzen zwischen Lärm und Zahl nicht aufnehmen wollte, nahm er ihn gleichwohl wahr. Wie gebannt vor der Schmiede stehend, »in langer Betrachtung versunken«, hörte der Weise, »wie aus den verschiedenen Tönen nur eine Harmonie hervortönte«. Also aus dem Schlagen des fünften nicht minder als den übrigen vier. Vielleicht fühlte sich Pythagoras in seiner momentanen Zerstreuung gerade zu diesem Instrument hingezogen: dem Hammer ohne Zahl und ohne Meister, irgendwie – doch unmöglich – in »nur eine[r] Harmonie« und zugleich in Dissonanz mit »allen«. Man fragt sich, ob nicht die »göttliche Eingebung«, die den Denker veranlasst hatte, den Raum seiner abgeschirmten Kontemplation zu verlassen, ebenfalls einen Part in diesem mysteriösen Quintett gespielt haben musste. Der Geist, der Pythagoras von seiner theoretischen Forschung abhielt, mag auch derjenige gewesen sein, der ihn auf die Sinnesorgane zurückverwies, denen er niemals trauen wollte. Zweifellos war diese Entmächtigung nur eine vorübergehende, doch ihre Folgen hielten an. Pythagoras mochte wohl zu seiner Forschungsarbeit zurückkehren; er mochte wohl alle Instrumente verwerfen. Vage oder deutlich, sei’s auch nur für einen Augenblick, hatte er ein Sein ohne Maß wahrgenommen. Schwer vorstellbar, dass ihm das gleichgültig gewesen wäre. Fest steht immerhin, dass seine Nachfolger, nicht zuletzt Boethius, später Mühe darauf verwandten, dieses Sein ohne Maß zu vermessen. Transkribiert als ein Klangereignis, dem sich keine bestimmte Quantität zuschreiben ließ, sollte diese Resonanz andere in die von Pythagoras entdeckte Schmiede locken. Dort sollten sie lernen, ihrem Lehrer treu und ungetreu, die Harmonien einer Musik wahrzunehmen, die nicht mehr in Zahlen zu transkribieren war.
Zweites Kapitel Von gemessener Vielheit
Dass Boethius die Entdeckung der Zahlenverhältnisse der Konsonanzen Pythagoras zuschrieb, mag heute merkwürdig erscheinen. Zu seiner Zeit jedoch stand die Wahl des spätantiken Philosophen völlig in Einklang mit der Tradition. Die Pythagoreer waren in der klassischen Welt berühmt für ihre musikalischen und mathematischen Forschungen, und vielen klassischen Quellen zufolge waren die Pythagoreer der Meinung, dass die Eigenschaften des Klangs die Prinzipien der Zahl veranschaulichen. Mehr als tausend Jahre vor Boethius hatte Sokrates in der Politeia auf die Pythagoeer hingewiesen, die nach den arithmetischen Ursachen der hörbaren Konsonanzen gesucht hätten.[16] In dem Abschnitt der Metaphysik, der den Lehren der »sogenannten Pythagoreer« gewidmet ist, schreibt Aristoteles diesen frühen Denkern eine ähnliche Lehre zu. Sie beschäftigten sich, so berichtet der Philosoph,
als erste mit der Mathematik und brachten sie voran. Und da sie in ihr aufwuchsen, meinten sie, ihre Prinzipien seien die Prinzipien aller Dinge. Da unter den mathematischen Gegenständen die Zahlen ihrer Natur nach die ersten sind […] und da sie ferner sahen, dass die Eigenschaften und die Verhältnisse der Harmonien in den Zahlen beschlossen sind, […] nahmen sie an, die Elemente der Zahlen seien die Elemente aller Dinge, und der ganze Himmel sei Harmonie und Zahl.[17]
Ein Fragment, das aus einer verlorenen Abhandlung Über die Pythagoreer von Aristoteles stammen soll, wird deutlicher:
Da sie sich der Mathematik verschrieben hatten und die Genauigkeit ihrer Argumente bewunderten, weil unter den menschlichen Tätigkeiten nur sie allein Beweise zulässt, erkannten sie die Tatsachen der Harmonie und sahen, dass sie auf Zahlen beruhen; […] und sie erachteten die Tatsachen der Mathematik und deren Prinzipien für den allgemeinen Grund aller existierenden Dinge; jeder, der die Natur der existierenden Dinge zu verstehen sucht, sollte daher seine Aufmerksamkeit diesen zuwenden, das heißt den Zahlen und Proportionen, weil sie es sind, durch die alles klar wird.[18]
Klassische Quellen legen nahe, dass Pythagoras im sechsten vorchristlichen Jahrhundert lebte. Es heißt, er sei aus Samos gebürtig und habe Ionien verlassen, um sich etwa um 530 v. Chr. in einer Kolonie Großgriechenlands niederzulassen.[19] Keines seiner Werke, so es sie gab, hat überdauert. Obwohl es Belege für die Präsenz pythagoreischer Lehren in ganz Süditalien vom fünften Jahrhundert an gibt, sind die Texte seiner frühesten Schüler sämtlich verloren. Es gibt jedoch Hinweise darauf, dass die Zusammenfassungen der pythagoreischen Lehren, wie sie in der Politeia und in der Metaphysik enthalten sind, weitgehend zutreffen. Die existierende Literatur zu Hippasos von Metapont, dem ersten der in der Tradition genannten Schüler, legt es nahe, dass dieser sowohl Mathematiker als auch eine wichtige Figur auf dem Gebiet der frühen Harmonielehre war.[20] Die ältesten erhaltenen pythagoreischen Texte, die Philolaos von Kroton zugeschrieben werden, zeigen, dass er verschiedene Forschungen ähnlicher Art unternahm, zu denen die Untersuchung der Zahlen und die Theorie der musikalischen Proportionen gehörten. Eines seiner Fragmente behauptet, dass »alle wissbaren Dinge Zahlen enthalten, ohne die nichts gedacht oder gewusst werden könnte«.[21] Philolaos wird den Beweis für dieses Prinzip in den Gesetzmäßigkeiten der Konsonanzen gefunden haben, denn ein Großteil seiner Texte besteht aus arithmetischen Analysen von Intervallen. »Harmonie« (ἁρμονία) war für Philolaos, ebenso wie für Empedokles und Heraklit, der Name eines Prinzips der kosmischen Einheit, das in natürlichen Beziehungen ausgedrückt werden kann.[22] Doch der frühe Pythagoreer scheint diese Beziehungen für numerische gehalten zu haben. Darüber hinaus, so C.H. Kahn, »bestand das eigentümliche Merkmal von Philolaos’ Zahlen darin, dass sie nach Proportionen angeordnet sind, die den drei grundlegenden musikalischen Konsonanzen entsprechen«, also der Oktave, der Quinte und der Quarte.[23] Harmonische Überlegungen scheinen die Ausgangsthese seines sogenannten »Fragments 1« motiviert zu haben: »Die Natur des Kosmos folgt aus der Harmonie zwischen dem Unbegrenzten und dem Begrenzten.«[24]
Philosophen nach Philolaos, die in der Tradition des Pythagoras schrieben, legten der mathematischen Untersuchung der Gesetze der Konsonanz ähnliche Bedeutung bei. Archytas von Tarent, ein Zeitgenosse und angeblicher Freund Platons, erhob die Affinitäten zwischen den Bereichen von Arithmetik und Musik zu einem expliziten Lehrsatz: Die beiden Forschungsbereiche waren für ihn »verschwisterte Disziplinen« (μαθήματα ἀδελφά).[25] Spätere Denker, die sich auf Pythagoras beriefen, sollten an dieses Prinzip erinnern. In den ersten Jahrhunderten der christlichen Zeitrechnung, als immer mehr Werke den Anspruch erhoben, die Lehren des Altmeisters von Samos darzulegen, wurde die pythagoreische Behauptung, die Erforschung von Zahl und Klang bilde eine Einheit, zum Gemeinplatz. Als Nikomachos von Gerasa im zweiten Jahrhundert nach Christus seine einflussreichen Handbücher der Arithmetik und Harmonielehre verfasste, scheint an seiner Entscheidung, sie beide als pythagoreisch zu präsentieren, nichts Ungewöhnliches gewesen zu sein. Als dann ein Jahrhundert später Iamblichos von Chalkis sich bemühte, Leben und Lehren des frühgriechischen Denkers aufzuzeichnen, war die Lehre kanonisch geworden. Das dritte Buch seiner Summa pythagorica stellt »Musik« (μουσική) als eine Disziplin dar, die nicht minder mathematisch ist als Arithmetik und Geometrie. Alle drei sind »Glieder einer Kette, die ein einziges Band bildet, wie der verehrungswürdigste Platon sagt«.[26]
Es wäre irrig, aus solchen Tatsachen zu schließen, die antiken Autoren hätten Pythagoras als »Musiker« in irgendeinem heutigen Sinne des Wortes verstanden. Musik scheint den Weisen nicht als instrumentelle Praxis einer Kunst, sondern als Zweig des mathematischen Wissens im Sinne einer zugleich gewissen und notwendigen Erkenntnis interessiert zu haben. Boethius’ De institutione arithmetica ist in dieser Hinsicht besonders aufschlussreich. Die einleitenden Seiten bieten eine Darstellung der Untersuchungsbereiche, die den Pythagoreern vertraut waren. Wir erfahren, dass »alle Männer von alter Autorität« darin einig seien, die mathematische Erkenntnis als die eigentliche »Weisheit« zu verstehen, nach der die Philosophen streben. Ihrem Wesen nach definiert, ist »Weisheit« nämlich »das Erfassen der Wahrheit der Sachverhalte (res)«, die »ihre eigene, unveränderliche Substanz« besitzen; nämlich dessen, »was weder durch Ausdehnung wächst noch durch Verminderung verringert noch durch Wandel verändert wird, sondern sich selbst immer in dem eigenen Vermögen, gestützt auf die Mittel seiner Natur, bewahrt«.[27] Boethius stellt eine längere Liste solcher Entitäten auf: »Das aber sind Qualitäten, Quantitäten, […] Relationen, Akte, Dispositionen, Orte, Zeiten.« Sie alle sind »unkörperlich« und besitzen eine »unveränderliche Substanz«. Aber sie können »durch Teilhabe am Körper« verändert werden; dann gehen sie, als besondere Seiende, »durch die Berührung mit der wandelbaren Sache in wechselhafte Unbeständigkeit« über. Doch eine Quantität, eine Qualität, eine Relation, ein Akt oder eine Disposition lassen sich auch für sich, als reine Denkobjekte, betrachten. Solche Idealitäten, so erfahren wir, sind am treffendsten als »Seiendes« (essentiae) zu bezeichnen.
Boethius erklärt nun im Folgenden, dass Seiendes von zweierlei Art sei. Das der einen Art »ist kontinuierlich und mit seinen Teilen verbunden und nicht durch irgendwelche Grenzen eingeteilt, wie Baum, Stein und alle Körper dieser Welt«. Solche Kontinuitäten, erklärt er, könnten »im eigentlichen Sinne Größen (magnitudines) genannt werden«.[28] Das Seiende der anderen Art »ist diskret von sich her und abgegrenzt aufgrund seiner Teile und gleichsam wie ein Haufen zu einer Schar versammelt, wie Herde, Volk, Chor, Haufen und alles, dessen Teile von den eigenen Enden begrenzt werden und die von der Grenze eines anderen [sc. Teiles] unterschieden sind. Diese haben die spezifische Bezeichnung Vielheit (multitudo).«[29] Kontinuierliches Seiendes ist unbegrenzt teilbar. »Größe beginnt bei einer begrenzten Quantität«, erläutert Boethius, »und erhält bei der Teilung kein Maß (modus), denn sie nimmt völlig unendliche Teilungen ihres Körpers auf.«[30] Linie, Kreis oder Pyramide zum Beispiel können in ihrer Größe unbegrenzt reduziert werden; trotz beliebiger Verringerung ihrer Ausdehnung werden sie ihre Identität behalten. Diskontinuierliches Seiendes wiederum kann unbegrenzt vergrößert werden, so »dass das ganze Vermögen der Vielheit von einer Grenze fortschreitet und zu einer unendlichen Vergrößerung des Fortschreitens hin wächst«. Die Schafherde, das Volk, der Chor zum Beispiel mögen sich alle an Zahl vermehren; als Anzahl diskreter Elemente jedoch kann diese Addition von Einheiten an ihrem Sein nichts ändern.
Diesem Gegensatz zwischen dem Kontinuierlichen und dem Diskontinuierlichen, zwischen Größe und Vielheit, fügt Boethius eine weitere Unterscheidung hinzu, die die Art der gedanklichen Erfassung jedes Seienden betrifft. Jede Idealität lässt sich gemäß einer von zwei Formen begreifen: entweder »für sich« (per se) oder »durch ein anderes« (per aliud). Dieser Unterschied ist leicht zu erläutern. Ein stetiges Sein, etwa eine Linie, eine Figur oder ein Körper, lässt sich als Größe »für sich« definieren, denn sie enthält keine Beziehung zu anderem. Doch es gibt auch die kreisenden Himmelssphären, die ohne Bezug zu anderem nicht vorstellbar wären, da sie »immer in beweglicher Rotation um[laufen] und […] zu keinem Zeitpunkt zur Ruhe [kommen]«. Ähnlich kann man von bestimmten Vielheiten sagen, dass sie rein »für sich« existieren. Beispiele dafür sind »3 oder 4 oder […] jede beliebige Zahl, die – um zu sein – nichts bedarf«.[31] Solche Quantitäten können jedoch auch in Bezug zueinander aufgefasst werden. Den Beweis dafür liefern die arithmetischen Proportionen. Die Identität des »Doppelten« liegt in der Beziehung von zwei zu eins; die des »Sesquialter« in der Beziehung von drei zu zwei; die der »Sesquiterz« in der Beziehung von vier zu drei.
Diese Darstellung der Natur des Seienden bei Boethius ist keineswegs einmalig. Ähnliche Klassifikationen idealer Gegenstände der Philosophie sind in Abhandlungen mehrerer antiker Neuplatoniker zu finden, etwa bei Nikomachos, Iamblichos und Proklos. Die Theorie der Größen und Vielheiten, wie sie in De institutione arithmetica entwickelt wird, ist vor allem wegen der disziplinären Taxonomie, die sie einführt, bemerkenswert. Bei seiner Entwicklung der alten Idee eines umfassenden Zyklus allgemeiner Bildung (ἐγκύκλιος παιδεία) entnimmt Boethius der Lehre von den beiden Arten des Seienden die Elemente, die es ihm erlauben, eine systematische Typologie mathematischer Erkenntnis zu liefern.[32] Nach Boethius gibt es vier Typen, und sie bilden einen einzigen »vierfachen Weg« (quadrivium); damit prägt er einen Begriff, dem eine lange Geschichte beschieden war.[33] Jeder Typus steht in Beziehung zu einem Gegenstand, der seine »eigene, unveränderliche Substanz« besitzt; jeder ist daher »philosophisch« oder, einfacher gesagt, mathematisch. Größen für sich, so erfahren wir, sind die eigentlichen Gegenstände der Geometrie. Größen in Relation zu anderem gehören hingegen zur Astronomie, welche die kontinuierlichen sphärischen Entitäten betrachtet, die die Himmel durchlaufen. Vielheiten, für sich betrachtet, sind der ideale Gegenstand der Arithmetik. Vielheiten schließlich, die in Relation zueinander betrachtet werden, gehören zum Gebiet der »Musik« (musica).
Nach Boethius ist Musik also ein Bereich der Mathematik, der nicht weniger ideales, notwendiges und unveränderliches Seiendes betrachtet als Arithmetik, Geometrie und Astronomie. Genauer gesagt, ist Musik die Erkenntnis von Vielheiten in strenger Korrelation zur Arithmetik. Die Implikationen dieser Tatsache sind weitreichend und weniger offensichtlich, als es zunächst scheinen mag, und sei es nur wegen jenes trügerisch vertrauten Wortes »Arithmetik«. Für die Modernen bezeichnet dieser Ausdruck die Rechenkunst, eine Technik, bei der man Ziffern verwendet, um ein exaktes Maß zu berechnen. Die Alten hatten ein wesentlich anderes Verständnis dieses Wortes. Seit den Sokratikern unterschied das griechische mathematische Denken zwischen zwei Erkenntnisformen, mit denen Zahlen (ἀριθμοί) aufgefasst werden können: »Arithmetik« (ἀριθμητική) einerseits, »Logistik« (λογιστική) andererseits. Vielfach umgeschrieben, sollte diese Unterscheidung während der gesamten Antike grundlegend bleiben. »Logistik« war der Name für die Kunst, Quantitäten sinnlicher Dinge mit Hilfe von Zahlen zu messen und zu berechnen. »Arithmetik« war eine Erkenntnis anderer Ordnung. Sie betraf nicht die richtige Verwendung von Zahlen, sondern die wahre Erkenntnis ihrer Natur.
Bereits einige Platonische Dialoge stellen einen Gegensatz zwischen diesen beiden Bereichen her. In einem Abschnitt des Gorgias, der sich zum Teil im Charmides wiederholt, bezeichnet Sokrates die »Zahlenkunst« (Arithmetik) als die Wissenschaft, die ihr »Geschäft« »am Geraden und Ungeraden, wie groß jedes sei«, vollbringt. Die »Rechenkunst« (Logistik) hingegen untersucht, »wie Gerades und Ungerades unter sich und gegen einander sich verhält der Größe nach«.[34] Dieser Satz ist schwer zu deuten und hat zu mehr als einer Lesart geführt. Er legt jedenfalls nahe, dass Arithmetik und Logistik, Zahlen- und Rechenkunst, zwei unterschiedliche Aspekte der Zahl untersuchen: auf der einen Seite ihre Eigenschaften als reine Quantität (»am Geraden und Ungeraden, wie groß jedes sei«), auf der anderen ihre Eigenschaften in der Zusammensetzung von Vielheiten (»wie Gerades und Ungerades unter sich und gegen einander sich verhält der Größe nach«).
Die Unterscheidung zwischen Logistik und Arithmetik sollte sich bei den Neuplatonikern, deren Werke Boethius gut kannte, alsbald vereinfachen und verschärfen. Diese Denker stellten die Zahlen als Gegenstände des reinen Denkens (νοητά) den Zahlen als Gegenständen der Sinne (αἰσθητά) gegenüber. Arithmetik, lehrten sie, untersucht die Ersteren; Logistik hantiert mit Letzteren. So unterschied Proklos in einem Euklid-Kommentar zwischen Geschicklichkeit in Logistik und Geschicklichkeit in Arithmetik; »ebensowenig betrachtet der Rechenkundige die Eigenschaften der Anzahlen, wie sie in sich selbst sind [was der Anzahlenkundige tut], sondern [er betrachtet sie] an den sinnlich wahrnehmbaren Dingen«.[35] Eine anonyme neuplatonische Scholie zum Charmides enthält eine ähnliche Lehre: »Die Logistik ist eine Wissenschaft, die sich mit den gezählten Dingen, nicht aber mit den Anzahlen befasst, indem sie nicht die Anzahl, die in ihrem Sein selbst Anzahl ist, ergreift, sondern indem sie das, was jeweils eins ist [nämlich ein bestimmtes Ding], als die Eins selbst zugrunde legt […].«[36] Und Olympiodor erläutert in einer einflussreichen Scholie zum Gorgias: »Man muss wissen, dass folgender Unterschied besteht: die Arithmetik beschäftigt sich mit den Arten der Anzahlen, die Logistik dagegen mit ihrem Stoff.«[37]
Wenn Boethius also die Musik mit der Arithmetik verbindet, rückt er die Untersuchung des Klangs nicht in die Nähe des Rechnens, sondern der Erkenntnis der Eigenschaften von Zahlen. Nur Fragen, welche die Bestimmung des Wesens von Vielheiten betreffen, etwa die Eigenschaften von Gerade oder Ungerade, fallen in das Gebiet einer solchen »Arithmetik«; sämtliche Überlegungen, welche die Verwendungen und Anwendungen von Zahlen beinhalten, liegen außerhalb davon. Doch damit nicht genug; um den mathematischen Charakter der Musik im Sinne der Pythagoreer zu begreifen, muss noch eine weitere grundlegende Uneindeutigkeit aufgelöst werden. Es ist die des Ausdrucks »Zahl« selbst. Es gibt zwei gute Gründe für die These, dass die antiken griechischen und lateinischen Denker mit den Wörtern arithmoi und numeri etwas ganz anderes als unsere modernen »Zahlen« meinten.
Der erste Grund lässt sich aus der Definition der antiken numeri als »Vielheiten« erschließen. Nach diesem Postulat ist jede »Zahl« »diskret von sich her und abgegrenzt aufgrund [ihrer] Teile und gleichsam wie ein Haufen zu einer Schar versammelt, wie Herde, Volk, Chor, Haufen und alles, dessen Teile von den eigenen Enden begrenzt werden und die von der Grenze eines anderen [sc. Teiles] unterschieden sind«. Mit anderen Worten, jeder numerus muss diskret und diskontinuierlich sein – kurz, er muss ein Ganzes sein. Quantitäten, die sich nicht als »natürliche Zahlen« ausdrücken lassen, können daher keine arithmoi sein.
Auch der zweite Grund folgt aus der traditionellen Begrifflichkeit des Boethius. Diskontinuierlich als ein Ganzes und in jedem seiner Elemente, bildet ein arithmos eine aus vielen Einheiten zusammengesetzte Anzahl von Einheiten. Aus dieser schlichten Tatsache ergibt sich eine aufregende Konsequenz, deren Bedeutung kaum überschätzt werden kann: nämlich dass die klassische »Zahl«, arithmos oder numerus, immer größer sein muss als eins. Jahrhunderte vor Boethius hatte Aristoteles bereits diesen Punkt hervorgehoben: »Die kleinste Zahl«, erklärte er, »ist die Zwei«, noch kleiner ist nur die unteilbare Einheit.[38] Euklid selbst hatte zu Beginn des VII. Buches, das die arithmoi behandelt, ebenso gesagt: »Eine Zahl ist die aus Einheiten zusammengesetzte Menge.«[39] Im antiken und mittelalterlichen Denken sind numeri daher stets Mengen von zwei oder mehr Elementen von »eins«.
Man könnte einwenden, eine solche »Arithmetik« sei ideal und abstrakt, denn wo in der physikalischen Welt könnte man je eine Anzahl finden, die »diskret von sich her und abgegrenzt aufgrund [ihrer] Teile und gleichsam wie ein Haufen« ist, jede ebenso diskret und diskontinuierlich, mit Bezug auf andere, aufgereiht wie die Zahlen auf einer Linie? Wir haben gelernt, dass Kontinuität ein Gesetz der Natur ist, die keine Sprünge macht. Zugegeben: Dass die klassischen numeri ideal sind, ist kaum zu bestreiten; ihrer Definition nach unveränderlich, hängen sie in keiner Hinsicht von physikalischen Körpern, Eigenschaften und Ereignissen ab, auch wenn sie, um von uns wahrgenommen zu werden, mit Materie verbunden sein müssen. Doch die klassischen Denker würden kaum sagen, dass die Ewigkeit solcher Entitäten sie irreal machte. Ganz im Gegenteil: In der Regel erfasst »Erkenntnis« im Sinne des antiken Begriffs epistēmē nur das, was notwendig und unwandelbar ist. Darüber hinaus kann man bezweifeln, dass die Zahlen der klassischen Arithmetik, wenngleich ideal, als »abstrakt« betrachtet werden können; denn im Unterschied zu den Zeichen, die der modernen Mathematik vertraut sind, sind die antiken numeri definitionsgemäß Entitäten. Es sind, um Jacob Klein zu paraphrasieren, »bestimmte Anzahlen bestimmter Dinge«, sämtlich als Vielheiten zurückführbar auf das unteilbare Seiende, von dem man mehr als von allem anderen sagen kann, dass es die »Einheit« oder »Monade« (μόνας) ist, welche die Form von »eins« ist.[40]
Für die Pythagoreer musste jedoch die Realität der Mathematik nicht unbedingt einzig durch Argumente demonstriert werden. Sie konnte auch durch die Erfahrung veranschaulicht werden. Im Bereich der kontinuierlichen Quantitäten lieferte die Astronomie einen Beweis: An den Himmeln war die Bewegung der Sterne im Einklang mit den Gesetzen der Größe sichtbar. Man konnte sich auf physikalische Phänomene als Illustration geometrischer Gesetzmäßigkeiten berufen, wenn sie nur hoch genug über dieser wandelbaren Welt und jenseits unseres sublunaren Bereichs waren.[41] Doch der entscheidende Beweis für die Realität jener Entitäten lag nicht in Größen, sondern in Vielheiten. Rein kontinuierliche Quantitäten waren zwar am Himmel sichtbar, doch diskontinuierliche Quantitäten konnten, wie Pythagoras zeigte, auf der Erde wahrgenommen werden. Den Beweis dafür lieferte natürlich der musikalische Klang.[42] In den Tatsachen der Musik, in den Beziehungen der Intervalle ließ sich das Wesen der Zahlen entdecken, konnten ihre Eigenschaften und Gesetze festgestellt werden. Diese Wahrheit hatte sich Pythagoras in der Schmiede offenbart: Das Buch der Natur, so fand er, war in der Sprache der Arithmetik geschrieben.
Mehr als zweitausend Jahre lang studierten die Gelehrten die Seiten dieses Buches, verfeinerten ihre Fertigkeiten der Lektüre und verbesserten ihre Kenntnis seiner Buchstaben. Seit der Zeit des Philolaos und Archytas bis zum ausgehenden Mittelalter blieb die Harmonielehre derjenige Zweig der Philosophie, in dem wirkungsvoll gezeigt werden konnte, dass die sinnliche Natur mit mathematischen Mitteln zu erkennen ist. Am Scheitelpunkt dieser langen Geschichte reflektierte Boethius die Ziele dieser Tradition. Seine Einführung in die Musiktheorie war sowohl die umfassendste Wiedergabe der alten Lehren als auch die mit Abstand wichtigste Quelle für die mittelalterliche Erforschung der Kunst des harmonischen Klangs. Vor allem dieser Abhandlung wegen konnten die pythagoreischen Lehren das Altertum lange überleben.