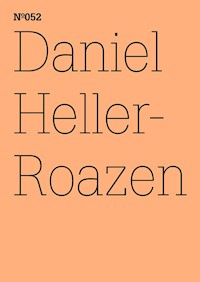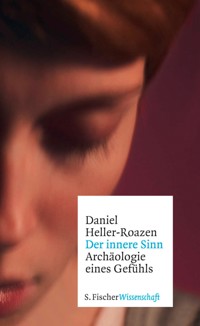
14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Es war vermutlich Aristoteles, der als Erster einen dem Menschen eigentümlichen Sinn entdeckte: den Sinn wahrzunehmen, dass man wahrnimmt. Daniel Heller-Roazen unternimmt in seinem Buch nun dessen Archäologie: In 25 Kapiteln zeichnet er die verschlungenen Wege dieses besonderen Sinns bei Denkern vom antiken Griechenland bis zum 20. Jahrhundert und in Disziplinen von der Philosophie über Psychologie und Literatur bis zu medizinischen Abhandlungen nach. »Der innere Sinn« ist eine originelle, elegante und weitreichende philosophische Untersuchung der Frage, was es bedeutet, dass man sich lebendig fühlt. »Daniel Heller-Roazens Archäologie eines Gefühls wirft ein völlig neues Licht auf eine Reihe von wesentlichen Momenten in der Geschichte der Philosophie und der Humanwissenschaften. Doch noch wesentlicher für diese außergewöhnliche Arbeit ist, dass sie ein faszinierendes Forschungsfeld entdeckt, das von allergrößte Bedeutung für das zeitgenössische Denken ist: des Gefühls, durch das wir – vor oder jenseits des Bewusstseins – fühlen, dass wir existieren.« Giorgio Agamben
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 625
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Daniel Heller-Roazen
Der innere Sinn
Archäologie eines Gefühls
Über dieses Buch
Es war vermutlich Aristoteles, der als Erster einen dem Menschen eigentümlichen Sinn entdeckte: den Sinn wahrzunehmen, dass man wahrnimmt. Daniel Heller-Roazen unternimmt in seinem Buch nun dessen Archäologie: In 25 Kapiteln zeichnet er die verschlungen Wege dieses besonderen Sinns bei Denkern vom antiken Griechenland bis zum 20. Jahrhundert und in Disziplinen von der Philosophie über Psychologie und Literatur bis zu medizinischen Abhandlungen nach. »Der innere Sinn« ist eine originelle, elegante und weitreichende philosophische Untersuchung der Frage, was es bedeutet, dass man sich lebendig fühlt.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Daniel Heller-Roazen, geboren 1974, ist Professor für Vergleichende Literaturwissenschaft an der Princeton University. Er studierte Philosophie und Literaturwissenschaft in Toronto, Baltimore, Venedig und Paris und hat zahlreiche Stipendien für seine Arbeit erhalten. Im Jahr 2010 wurde ihm die Medaille des Collège de France verliehen. Im S. Fischer Verlag ist zuletzt von ihm erschienen ›Der Feind aller. Der Pirat und das Recht‹ (2010).
Impressum
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2007 unter dem Titel
»The Inner Touch: Archaeology of a Sensation« im Verlag Zone Books, New York.
© Daniel Heller-Roazen 2007
All rights reserved
Für die deutsche Ausgabe:
© S. Fischer Verlag GmbH, Frankfurt am Main 2012
Covergestaltung: hißmann, heilmann, hamburg
Coverabbildung: Jason Hetherington / Getty Images
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-401377-0
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
[Motto]
Erstes Kapitel Murriana
Zweites Kapitel Das empfindende Wesen
Drittes Kapitel Die primäre Kraft
Viertes Kapitel Der Kreis und der Punkt
Fünftes Kapitel Sentio ergo sum
Sechstes Kapitel Schlaf
Siebtes Kapitel Erwachen
Achtes Kapitel Begleitung
Neuntes Kapitel Historia animalium
Zehntes Kapitel Selbstbefreundung
Elftes Kapitel Grundlegung der Ethik
Zwölftes Kapitel Der Jagdhund und das Wild
Dreizehntes Kapitel Wissen vom Leben
Vierzehntes Kapitel Der ungenannte König
Fünfzehntes Kapitel Psychologie der 449. Nacht
Sechzehntes Kapitel Der Ursprung und die Quelle
Siebzehntes Kapitel Wahrnehmung überall
Achtzehntes Kapitel Von den Verdiensten der Geschosse
Neunzehntes Kapitel Dornen
Zwanzigstes Kapitel Zu mir; oder Die große dänische Dogge
Einundzwanzigstes Kapitel Von fliegenden Geschöpfen
Zweiundzwanzigstes Kapitel Zönästhesie
Dreiundzwanzigstes Kapitel Phantome
Vierundzwanzigstes Kapitel Das empfindungslose Wesen
Fünfundzwanzigstes Kapitel Unberührbar
Literatur
hoi Stōikoi tēnde tēn koinēn aisthēsin entos haphēn prosagoreousi, kath’ hēn kai hēmōn autōn antilambanometha.
Die Stoiker halten den Gemeinsinn für einen inneren Tastsinn, mit dem wir uns selbst wahrnehmen.
Aëtius, Placita philosophorum 4.8.7
In memoriam Paul Roazen (1936–2005)
Erstes KapitelMurriana
Eine Vorrede zu diesem Werk, in welcher Hegel und E. T. A. Hoffmanns schreibender Kater die Beziehungen zwischen Empfindung und Bewusstsein erörtern
Es ist Nacht, doch ein Kater ist hellwach, und wenn wir ihn beim Wort nehmen, war er niemals so munter wie jetzt. Im Dunkeln, allein, fühlt sich der Erzähler von E. T. A. Hoffmanns Lebensansichten des Katers Murr überwältigt von der mächtigsten aller Empfindungen: dem »Gefühl des Daseins«, wie er es zu Beginn der Darstellung seines Lebens und Trachtens kühn benennt. »Es ist doch«, ruft der Kater aus, »etwas Schönes, Herrliches, Erhabenes um das Leben!« Und es tritt ihm der Held von Goethes Egmont vor Augen, der in dem »schmerzlichen Augenblick«, in dem er sich anschickt, dem Leben zu entsagen, an die »süße Gewohnheit des Daseins« zurückdenkt. Doch anders als jene tragische Gestalt fühlt sich der Kater springlebendig wohl und von dieser »süßen Gewohnheit« gänzlich durchströmt; ja, schon die Vorstellung, je von ihr abzulassen, dünkt ihm ganz unmöglich. Überall um sich herum spürt der Kater »die geistige Kraft, die unbekannte Macht, oder wie man sonst das über uns waltende Prinzip nennen mag, welches«, wie er hinzufügt, »mir besagte Gewohnheit ohne meine Zustimmung gewissermaßen aufgedrungen hat«. Seine Begeisterung hat ihn zu einem so »hohen Standpunkt« erhoben, wie sie ein Dichter, wenn überhaupt, nur selten erreicht. Kraft seiner Gefühle und der Flinkheit seiner vier Beine hat er sich behände zu den Dächern der Stadt, in der er lebt, emporgeschwungen – »hinaufgeklettert wäre richtiger«, berichtigt er sich selbst –, um sie in ihrem nächtlichen Glanz besser betrachten zu können. Seine Prosa verrät den unverkennbaren Ton eines Wesens, das sich der Vorteile erfreut, die ihm seine natürlichen Fähigkeiten ermöglicht haben: »Über mir wölbt sich der weite Sternenhimmel, der Vollmond wirft seine funkelnden Strahlen herab, und in feurigem Silberglanz stehen Dächer und Türme um mich her!«[1]
Was empfindet Murr auf seinem nächtlichen Thron hoch über der Stadt? Trotz seiner anfänglichen Anspielung auf den berühmten Ausbruch jenes »niederländische[n] Held[en] in der Tragödie« scheint es, als wolle der Kater dem Menschen die Fähigkeit bestreiten, seine existentiellen Gefühle in ihrer ganzen Kraft zu erfassen. Jedenfalls hegt Murr generell Zweifel an den Vermögen des zweifüßigen Spezies und ist keinesfalls bereit, das Herrschaftsrecht der Menschen über die anderen Tiere, mit denen sie den Erdball teilen, als selbstverständlich anzuerkennen. »Ist denn das auf zwei Füßen aufrecht Einhergehen etwas so Großes«, fragt Murr mit deutlicher Verachtung, »dass das Geschlecht, welches sich Mensch nennt, sich die Herrschaft über uns alle, die wir mit sichererem Gleichgewicht auf vieren daherwandeln, anmaßen darf?« Der Kater spielt jedoch nicht den Naiven und weiß wohl, dass die Menschen es verstanden haben, ihren Anspruch auf Überlegenheit trotz ihrer relativ lahmen Glieder zu rechtfertigen. »Aber ich weiß es«, fährt Murr fort, »sie bilden sich was Großes ein auf etwas, was in ihrem Kopfe sitzen soll und das sie Vernunft nennen.« Murr aber bleibt skeptisch. »Ich weiß mir keine rechte Vorstellung zu machen, was sie darunter verstehen«, bemerkt er, »aber so viel ist gewiss, dass, wenn, wie ich aus gewissen Reden meines Herrn und Gönners schließen darf, Vernunft nichts anderes heißt, als die Fähigkeit, mit Bewusstsein zu handeln und keine dummen Streiche zu machen, ich mit keinem Menschen tausche.«[2]
Wenig spricht dafür, dass Murr an der Existenz jenes Etwas, »was im Kopfe der Menschen sitzen soll und das sie Vernunft nennen«, Zweifel hegte. Und aus eigener Erfahrung scheint er durchaus imstande, die äußeren Anzeichen ihres Zentralorgans, des Bewusstseins, zu erkennen. Allerdings scheint der Kater der Meinung, dass dieses vielgerühmte Vermögen mancherlei Behauptung zum Trotz erheblich weniger bedeutend sei und dass sein Auftreten im Bereich des menschlichen Denkens und Handelns nicht der Natur, sondern der Gewohnheit entspringe. »Ich glaube überhaupt«, erklärt der Kater, »dass man sich das Bewusstsein nur angewöhnt.« Ganz anders verhält es sich mit dem, was alle Tiere, die menschlichen wie die nichtmenschlichen, miteinander teilen und was der Kater als eine ganz eigene Wonne empfindet: das Leben. »[D]urch das Leben und zum Leben«, erklärt Murr programmatisch, »kommt man doch, man weiß selbst nicht wie. Wenigstens ist es mir so gegangen, und wie ich vernehme, weiß auch kein einziger Mensch auf Erden das Wie und Wo seiner Geburt aus eigner Erfahrung, sondern nur durch Tradition, die noch dazu öfters sehr unsicher ist.«[3]
Für den sprechenden Kater hat Bewusstsein daher nur bescheidenen Wert, ist bestenfalls etwas Zweitrangiges. Es fällt jedoch schwer, Murrs Einstellung zu dieser Fähigkeit, die er so oft bei den Wesen seiner Umgebung beobachtet hat, genau zu bestimmen. Betrachtet er ihr Vorliegen bei den Menschen als nützlich, wenn auch unwesentlich? Als unnötig? Schädlich? Hat Murr, könnte man sich fragen, jemals die Möglichkeit erwogen, dieses Vermögen selbst zu erwerben? Gewiss mag in seinen Augen wie in denen vieler seiner Leser das Bewusstsein jenseits des Bereichs der animalischen Natur liegen. Vorstellbar ist aber auch, dass der Kater annimmt, den Feliden sei das Vernunftvermögen durchaus zugänglich. Vielleicht würde er einräumen, alle Tiere könnten – mindestens ebenso erfolgreich wie menschliche Wesen – Bewusstsein entwickeln, sollten sie danach verlangen oder es benötigen. Dies scheint die Position zu sein, die etwa von Kafkas Rotpeter vertreten wird, der in seinem »Bericht für eine Akademie« genau beschreibt, wie er in Gefangenschaft und durch Übung vom Affen zum Menschen wurde: »Und ich lernte, meine Herren. Ach, man lernt, wenn man muss; man lernt, wenn man einen Ausweg will; man lernt rücksichtslos.«[4] Dem Kater wäre die Frage in jedem Falle als akademisch erschienen. Hoffmanns feliner Erzähler hat niemals die Nöte von Kafkas eingesperrtem Affen auf verzweifelter Suche nach einem »Ausweg« aus seiner Knechtschaft kennengelernt, und der Kater scheint niemals den Zwang verspürt zu haben, sich die Gewohnheiten des animal rationale anzueignen. Offenbar war er auch niemals versucht, sich aus irgendeinem inneren Grund das Bewusstsein »anzugewöhnen«. Allem Anschein nach ist Murr zufrieden damit, sich dem Gefühl des Lebens und dessen »süßer Gewohnheit« vollends zu überlassen.
Gewiss, der Kater selbst macht wenig Aufhebens von seinen Gefühlsregungen und lehnt es ab, sie im Einzelnen mit denen der Menschen zu vergleichen, vielleicht weil er dem Bewusstsein misstraut. Doch Murrs Gefühle haben mit menschlichen Wahrnehmungen vielleicht mehr zu tun, als er zum Ausdruck bringt, und vielleicht eröffnen sie ihm sogar den Zutritt zu einer Seinsregion, die von dem Geschlecht der »auf zwei Füßen aufrecht Einhergehenden« mehr als einmal gesucht wurde. Es ist bemerkenswert, dass die Bedingungen, unter denen der Kater das Leben als »etwas [so] Schönes, Herrliches, Erhabenes« wahrnimmt, genau die gleichen sind, die einer seiner bekannteren Zeitgenossen, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, einmal zur Definition der Prinzipien verwandte, von denen die Philosophie der Natur und des Geistes auszugehen habe. Fünfzehn Jahre vor der Veröffentlichung der Lebensansichten des Katers Murr ging es Hegel darum, jene ungeschiedene »Einfachheit« zu charakterisieren, die jeder komplexen Tätigkeit des »subjektiven Geistes« vorausgeht und diese ermöglicht. Dazu beschrieb er einen Zustand, den er selbst als »furchtbar« bezeichnete, der aber offenbar dem sehr nahe kommt, den der Kater so freudig begrüßt. In seiner Jenaer Vorlesung von 1805 bis 1806 erläuterte Hegel, das »reine Selbst« sei ursprünglich nichts anderes als eine »leere […] Nacht«, in der das Vorstellungsbild völlig »bewusstlos« sei, »das heißt ohne als Gegenstand vor die Vorstellung herausgestellt zu sein«.[5] Und in seiner Abhandlung über die Differenz des Fichteschen und des Schellingschen Systems der Philosophie von 1801 übertrug der junge Philosoph dem gleichen Bild die Aufgabe, etwas noch Grundlegenderes darzustellen, das man durchaus als das eigentliche Prinzip der Prinzipien betrachten könnte. »Das Absolute«, schrieb Hegel in jenem bedeutenden Werk, »ist die Nacht, und das Licht jünger als sie […] – das Nichts das Erste, woraus alles Sein, alle Mannigfaltigkeit des Endlichen hervorgegangen ist.«[6]
Die Reflexionen von Hoffmanns Kater lassen sich vielleicht am ehesten im Lichte dieser »leeren […] Nacht« betrachten. Unschwer ist zu erkennen, dass Murr, wenn er über den Türmen und Dächern seiner Stadt balanciert, einem Prinzip ausgesetzt ist, das man als »Absolutes« bezeichnen könnte, einer ungeschiedenen und unüberwindlichen Kraft, die er wie jedes lebende Wesen über sich »waltend« fühlt, die ihm »ohne [s]eine Zustimmung gewissermaßen aufgedrungen« wurde und der er, philosophisch scheinbar naiv, einen alten und vertrauten Namen gibt: »Leben«. Zwar vermag die feline Kreatur nicht zu erkennen, was Hegel als definitionsgemäß »bewusstlos, das heißt ohne als Gegenstand vor die Vorstellung herausgestellt worden zu sein«, beschrieb. In der Nacht zumindest erkennt Murr gar nichts; in der augenscheinlichen Abwesenheit von Vorstellung und Denken bleibt die dunkle Nacht des Katers per definitionem völlig »bewusstlos«. Der Kater nimmt »das über uns waltende Prinzip« nicht mit dem Organ der Vernunft wahr, das »in ihrem [= der Menschen] Kopfe sitzen soll«, sondern mit einem letztlich animalischen Vermögen, nämlich der Sinneswahrnehmung oder, wie Murr sagt, dem »Gefühl«. Mehr benötigt er offenbar nicht; für ihn, so könnte man sagen, gilt wie für Faust: »Gefühl ist alles.« Denn es ist das Empfinden, durch das sich Murr in jene einfachste und allgemeinste Dimension aller Dinge, die selber kein Ding ist, hineingestellt sieht: ins Dasein.
Wer ist Kater Murr, und wie sollen wir das »Daseinsgefühl« verstehen, mit dem er das Vermächtnis seiner Gedanken und Taten eröffnet? Gewiss ist es möglich, die »Lebensansichten« des nachdenklichen Katers als Ausdruck einer entschieden menschlichen Phantasie natürlicher Einfachheit zu lesen, als die anthropomorphe Fiktion eines animalischen Behagens, unbelastet von den Schichten des Bewusstseins und Selbstbewusstseins, die dem belesenen Publikum des Hoffmannschen Buches zweifellos nur zu vertraut waren. Und genau dies scheint Meister Abraham, Murrs wohlmeinender Herr, anzudeuten, wenn er zu Beginn des Buches seinem Freund Kreisler »den Kater Murr, so habe ich ihn benannt«, mit den Worten vorstellt: »Es ist das gescheuteste, artigste, ja witzigste Tier der Art, das man sehen kann, dem es nur noch an der höhern Bildung fehlt.«[7]
In diesem Sinne ist der Kater vielleicht weniger ein Tier mit außerordentlichen Fähigkeiten als ein menschliches Wesen, dem die höheren geistigen Vermögen ermangeln; das in der Sprache der Jurisprudenz, an die Abraham erinnert, nicht als homo sui juris, Herr seiner selbst, gelten kann.[8] Unschwer sieht man jedoch, dass Hoffmanns Kater mindestens ebensosehr die avancierteste aller literarischen Figuren verkörpert – den Autor –, und von dem Eröffnungskapitel der Lebensansichten des Katers Murr könnte man sagen, es liefere ein Porträt des Dichters als Katzenjunges. Nicht nur heißt es von Murr, er gerate »häufig in jene sanften Reverien, in das träumerische Hinbrüten, in das somnambule Delirieren«, die weithin als äußere Zeichen von Phasen des »eigentlichen Empfanges genialer Gedanken«[9] gelten. Zu der Zeit, zu der wir ihm erstmals begegnen, hat der Kater bereits mehrere Bücher unterschiedlicher Genres geschrieben, deren wichtigste er in der Reihenfolge ihrer Abfassung aufzählt, »damit die Welt sich dereinst nicht zanke über die Zeitfolge meiner unsterblichen Werke«: den Roman Gedanke und Ahnung oder Kater und Hund; eine politische Abhandlung Über Mausefallen und deren Einfluss auf Gesinnung und Tatkraft der Katzheit; sowie eine Tragödie mit dem Titel Rattenkönig Kawdallor.[10]
Doch das literarische Schaffen des Katers reicht noch weiter, denn Murr ist auch der Verfasser ebender Seiten, die seine zahlreichen »Lebensansichten« festhalten. Freilich lässt E. T. A. Hoffmann, der »Herausgeber« des Bandes, im Vorwort der Lebensansichten des Katers Murr den Leser wissen, das gebundene Buch sei nur zum Teil die Schöpfung seines vorgeblich felinen Protagonisten. Der Herausgeber räumt ein, der Kater habe zweifellos diejenigen Seiten des Werkes verfasst, in denen er in eigenem Namen spricht. Murr habe jedoch, so erfahren wir, nichts mit den übrigen eingeschobenen Seiten zu tun, die sich mit dem Leben des verrückten Musikers Kreisler beschäftigen, dessen »exzentrische, wilde und spaßige« Auftritte in dem Band kaum zwanzig Jahre später Schumann zu seinen großen Phantasien für Klavier Op. 16, den Kreisleriana, anregen sollten.[11] »Nach sorgfältiger Nachforschung und Erkundigung« kam der Herausgeber endlich zu dem Schluss, dass die Passagen über den Musiker einem gedruckten Buch entstammten, das »die Biographie des Kapellmeisters Johannes Kreisler« enthielt und das sehr wahrscheinlich im Hause Murrs und seines Herrn herumlag. Beim Schreiben müsse der etwas zerstreute feline Autor hin und wieder achtlos die Blätter dieses Werkes zerrissen und »teils zur Unterlage, teils zum Löschen« verbraucht haben; später habe er sie wohl aus Versehen in sein eigenes Manuskript eingefügt.[12] Einigermaßen verlegen berichtet der Herausgeber, dass diese »fremde[n] Einschiebsel« beim Druck des Buches zu spät bemerkt wurden, um noch getilgt zu werden. Nur noch soviel war möglich, sie im Textkorpus durch editorische Abkürzungen zu markieren – Mak.-Bl. für »Makulatur-Blatt« und M.f.f. für »Murr fährt fort« –, damit sie nicht für etwas gehalten würden, was sie nicht waren. (Daher der volle Titel des veröffentlichten Werkes, ein Dokument der Redlichkeit seines Herausgebers: Lebensansichten des Katers Murr nebst fragmentarischer Biographie des Kapellmeisters Johannes Kreisler in zufälligen Makulaturblättern.)
Wer könnte jedoch sagen, was der Kater wirklich selbst schrieb? Man kann sich nur schwer des Eindrucks erwehren, dass der Herausgeber seinen Autor unterschätzt hat, denn die angeblich selbständige »Biographie« Kreislers erweist sich als eine Darstellung seines guten Freundes, Meister Abrahams, und enthält somit unvermeidlich auch das Porträt jenes »gescheuteste[n], artigste[n], ja witzigste[n] Tier[s] der Art«, das an anderer Stelle im eigenen Namen spricht. Man kann den Verdacht kaum unterdrücken, die Dopplung des Werkes sei gleichsam eine Katzenlist. So dass die Ansichten des Katers und die Geschichte des Musikers letztlich nur zwei Seiten einer einzigen Schöpfung wären, sozusagen zwei Sätze ein und desselben Musikstücks, der Murriana.
Als Kater und Künstler, Reißwolf und Autor zugleich bleibt Murr, wer und was immer er gewesen sein mag, Zeuge einer Erfahrung, welche die »auf zwei Füßen aufrecht Einhergehenden« selten mit solcher Klarheit wahrgenommen haben. Es ist die Erfahrung des einen Sinnes, der von allen einzelnen Sinnen geteilt und, wie schwach und lückenhaft auch immer, bei allem sinnlichen Wahrnehmen empfunden wird: die Empfindung des Empfindens als solchen, mit der wir uns – ähnlich wie der existentielle Kater der leeren Nacht, vor allem Bewusstsein oder jenseits davon – dem allgegenwärtigen Leben ausgesetzt fühlen, durch das und zu dem alle Wesen gelangen, »man weiß selbst nicht wie«. Wenige Lebewesen können sich so empfindlicher Sinne rühmen, wie sie der Kater im Dunkeln besitzt, und nur wenige werden es mit der Sinnesschärfe des nächtlichen Murr aufnehmen können, der mehr als einmal von jenem »unnennbare[n] Gefühl« in einen Zustand schierer Fühllosigkeit getrieben wird: »Das sonderbare Gefühl, gewebt aus Lust und Unlust, betäubte meine Sinne – überwältigte mich – kein Widerstand möglich, – ich fraß den Heringskopf!«[13]
Zweites KapitelDas empfindende Wesen
Von den antiken Philosophen, vornehmlich Aristoteles, die, wie der Kater, viel von Empfindung und wenig von Bewusstsein sprachen
Ähnlich wie der Kater sprachen die Alten wenig von Bewusstsein und viel vom Empfinden. Die klassischen griechischen Quellen verfügen über mehrere Ausdrücke zur Bezeichnung einer Tätigkeit der moralischen Introspektion, die derjenigen nahekommt, die wir heute als »Gewissen« ausweisen; die prominentesten unter ihnen sind syneidēsis und synnoia (sowie die entsprechenden reflexiven Verbkonstruktionen, bei denen die konjugierten Formen mit Personalpronomen im Dativ einhergehen konnten).[1] Bezeichnend ist jedoch, dass die Vokabulare des Griechischen wie des Lateinischen keinen einzelnen Terminus besitzen, der annähernd genau unserem »Bewusstsein« entspräche, wenn man das moderne Wort in seinem geläufigen und anerkannten Sinn als den Namen jener kognitiven Fähigkeit versteht, mit der wir unsere Gedanken uns selbst vorstellen.[2] Nicht dass die verschiedenen Erscheinungen, die wir heute mit Bewusstsein [consciousness] verbinden, in der Antike unbekannt gewesen wären. Von der klassischen Literatur könnte man kaum behaupten, es mangele ihr an Charakteren, die eine wache Bewusstheit [awareness] ihrer selbst und ihrer Handlungen ausdrücken, und es ist nie bestritten worden, dass zumal die antiken Philosophen der Geschichte des Denkens viele umfassende Darstellungen des Wesens der Reflexivität in der Tradition geliefert haben. Bemerkenswert ist jedoch, dass die klassischen Autoren, welche die Natur des Gewahrens und Selbstgewahrens [awareness and self-awareness] erörtert haben, nicht besonders dazu neigten, von diesem Gewahren als einem Wissen – oder eigentlich Unwissen – zu sprechen, und sie waren dabei offenbar nicht generell davon überzeugt, dass die fraglichen Phänomene ihrem spezifischen Wesen nach kognitive seien. Insofern unterschied sich ihre Terminologie grundlegend von der ihrer modernen Nachfolger, die Gewahren und Selbstgewahren weitgehend als Formen von Kognition betrachteten: als »Mit-Wissen« in den Sprachen, die sich, wie das Englische und die romanische Sprachfamilie, auf das lateinische conscientia stützen, oder als Form dessen, »was zu etwas Gewusstem geworden«, wofür von Christian Wolff im frühen achtzehnten Jahrhundert als Äquivalent der cartesischen cogitatio der Standardterminus Bewusstsein ins Deutsche eingeführt wurde.[3] Die antiken Philosophen, die über Gewahren und Selbstgewahren schrieben, benutzten notdürftig eine Reihe von Ausdrücken, die semantisch und etymologisch mit dem Namen jener Fähigkeit verknüpft waren, die – im Unterschied zur Vernunft – häufig als eines der niederen Seelenvermögen betrachtet wurde und öfter als Merkmal der tierischen, seltener der menschlichen Natur galt. Denn sie sprachen von Wahrnehmung (Perzeption) und, noch einfacher, von Empfindung (Sensation).
In den Werken der griechischen Philosophie ist es bekanntlich der Ausdruck aisthēsis, der die Bedeutungen »Empfindung«, »Wahrnehmung« und auch »Gefühl« trägt, ein Umstand, der die Interpretation der antiken Quellen über die Fähigkeiten von Lebewesen beträchtlich kompliziert.[4] Platon, Aristoteles, die Epikuräer, die Stoiker, die Neuplatoniker und andere, sie alle erörterten Formen der aisthēsis in ihren Werken, doch kaum einer (oder keiner) ihrer modernen Leser wäre so unbesonnen, ihre zahlreichen Ausdrücke mit einer einzigen Reihe entsprechender moderner Termini wiederzugeben. Die Frage, ob der Begriff »Wahrnehmung« mit seiner angedeuteten Aktivität dem Begriff »Empfindung« mit seiner implizierten Passivität vorzuziehen sei, bleibt grundsätzlich schwer entscheidbar. Doch das ist nur ein Teil des Problems. In Wahrheit war aisthēsis überhaupt kein terminus technicus in der griechischen Sprache; er konnte vielmehr in einer Bedeutungsspanne verwendet werden, die erheblich breiter war, als der Philosophiehistoriker sie für zulässig halten möchte, und die sich auf das Gebiet der oft flüchtigen Fähigkeit des Gewahrens erstreckte, die man später als die des Bewusstseins bezeichnete. Thukydides beispielsweise benutzte den Ausdruck in einem Sinne, der mit Wahrnehmung offenbar ebensowenig zu tun hat wie mit Empfindung; als englisches Äquivalent wurde in diesem Falle intellectual discernment vorgeschlagen,[5] deutsch also etwa »Auffassungsvermögen«. Selbst in den griechischen Schriften zur Seelenlehre war die Bedeutung des Terminus fließend und konnte sich vom Bereich der menschlichen Wahrnehmung sehr weit entfernen. Gelegentlich wurde er sogar verwandt, um die Affektionen des Unbelebten in genauem Gegensatz zum Belebten zu kennzeichnen: Eine Abhandlung aus dem hippokratischen Korpus des fünften Jahrhunderts benutzt das Verb aisthansthai beispielsweise, um die Wirkung des Windes auf unbelebte Gegenstände zu charakterisieren.[6]
Aus einer Reihe von guten Gründen hat man die Auffassung vertreten, die psychologische Bedeutung von aisthēsis sei so etwas wie eine attische Erfindung, die den ionischen Autoren und den frühgriechischen Denkern unbekannt, Platon und Aristoteles jedoch vertraut war und bei denen, die im Anschluss an die sokratische Schule schrieben, allgemein Anerkennung gefunden habe.[7] Die Diktion von Platons Dialogen zeigt jedoch, dass selbst in Athen die Bedeutung des Wortes erheblich schwanken konnte. Es ist aufschlussreich, unter diesem Gesichtspunkt den Theaitetos zu betrachten, der die vielleicht programmatischste Diskussion dieses Begriffs im Platon’schen Korpus enthält. Dort erwägen Sokrates und seine Gesprächspartner auf der Suche nach einer Definition von Erkenntnis [epistēmē] kurz die Möglichkeit, sie könne letztlich auf aisthēsis zurückführbar sein.[8] Die meisten Übersetzer des Dialogs haben den Ausdruck in diesem Zusammenhang mit »Wahrnehmung«, »Empfindung« oder einer begründeten Mixtur wie »Sinneswahrnehmung« wiedergegeben. Es ist jedoch klar, dass es in diesem Dialog um mehr als Sinnesdaten in irgendeinem modernen Sinne geht, denn die dramatis personae, die den Begriff erörtern, lassen keinerlei Zweifel daran, dass das Gebiet der aisthēsis ohne weiteres auch affektive sowie perzeptive Phänomene umfassen kann. Mit »Sinnen« [aisthēseis], erklärt Sokrates, meint man nicht nur »Gesicht, Gehör, Geruch, Erwärmung und Erkältung«, sondern auch »Lust und Unlust, […] Begierde und Abscheu, und andere gibt es noch, unbenannte unzählbare, sehr viele auch noch benannte«.[9] Dem Timaios zufolge lässt sich aisthēsis als eine der Affektionen (»Eindrücke«, pathēmata) des Körpers auffassen, und in anderen Platonschen Dialogen, etwa im Phaidon oder in der Politeia, finden wir, wie Sokrates und seine Gesprächspartner das Verb aisthanesthai in dieser Bedeutung für verschiedene Fälle des Gewahrens in Verbindung mit körperlichen Zuständen verwenden.[10] Doch selbst dann, schrieb ein Gelehrter, »wäre es voreilig anzunehmen, dass das Verb Sinneswahrnehmung bedeutet […], denn in diesen Fällen wird es beinahe austauschbar mit dokein und doxasthein, ›scheinen‹ und ›glauben‹, benutzt«.[11] An anderen Stellen könnte sich der Platon’sche Verwendungsbereich des Ausdrucks noch einmal erweitern: In einer Passage der Apologie heißt es, der Tod sei nichts anderes als die bloße Abwesenheit aller aisthēsis.[12] »Offenkundig«, schrieb ein Altphilologe, »war aisthēsis zu einer vielsinnig gebrauchten Chiffre geworden. Fast alles, was auf ein Lebewesen einwirkt, ließ sich darunter fassen.«[13]
Die Werke des Aristoteles, die sich mit der Beschaffenheit und dem Bau von Lebewesen befassen, sind zum großen Teil Zeugnisse dieser »Chiffre« und der zahlreichen Möglichkeiten, die sie bei der Betrachtung der Erfahrung von Tieren bietet. Ein Blick auf die traditionell als De anima bekannte Abhandlung über die Seele und die unter dem Titel Parva naturalia versammelten neun kleineren Schriften über Psychologie und Biologie der Lebewesen zeigt hinreichend, wie sehr die Aristotelische Seelenkunde in erster Linie eine Lehre von der aisthēsis darstellt. De anima beginnt mit einer doppelten Einführung. Die erste ist historischer Art und nimmt das gesamter Buch Alpha ein; die zweite, methodologisch ausgerichtete füllt die ersten vier Kapitel des Buches Beta. Ab dem fünften Abschnitt des Buches Beta wendet sich Aristoteles der Exposition seiner Lehre zu, die in einer Darlegung der logisch unterschiedenen Kräfte besteht, deren Einheit die Seele – als Prinzip des Lebens – bildet. In einem einzigen, dichten Kapitel erörtert der Philosoph das Ernährungsvermögen [threptikon], mittels dessen sich die Lebewesen erhalten; in drei weiteren behandelt er die kombinierten Vermögen der Bewegung [kinētikon kata topon] und der Begierde [orektikon]; und in den fünf, die bald darauf folgen, liefert er eine Darstellung der Struktur des Denkens [dianoētikon].[14]
Die Stellung des Empfindungsvermögens [aisthētikon] im Aufbau von De anima ist eine ganz andere. In der Mitte seiner Abhandlung widmet Aristoteles nicht weniger als zehn Kapitel der Empfindung; folgt man den mittelalterlichen Kommentatoren und ordnet das Kapitel über das Vorstellungsvermögen [phantastikon] denen zu, die sich mit den Sinnen beschäftigen, erhöht sich ihre Anzahl auf elf.[15] »Was die Ausführlichkeit der Behandlung angeht«, schreibt Charles H. Kahn, »duldet es keinen Zweifel: Aristoteles’ Werk über die Seele ist primär eine Abhandlung über die Empfindung.«[16] Ergänzt wird es darüber hinaus durch die ersten vier Abhandlungen der Parva naturalia, die den verschiedenen Sinneskräften weitere Aufmerksamkeit widmen und dabei die Lehren, die in dem größeren Werk über die Seele entwickelt werden, klären und gelegentlich ergänzen. Es sind dies die Schriften, die der Tradition als De sensu et sensibilibus, De memoria et reminiscentia, De somno et vigilia und De insomniis bekannt sind.
Die von Aristoteles in seinen psychologischen Schriften erörterten »Vermögen« sind stufenförmig angeordnet und erstrecken sich von dem elementarsten Ernährungsvermögen, das allen Lebewesen eigen ist, zu den höheren Vermögen, die auf ihm gründen, von den Bewegungs- und Begehrungskräften bis zu dem speziellsten Vermögen, dem Denken, von dem es heißt, es sei ausschließlich dem Menschen vorbehalten. Auf der Stufenleiter zunehmender Komplexität und Diversifizierung des Lebens befindet sich eine Trennschwelle zwischen Wesen, die mit einem Ernährungsvermögen, aber sonst nichts ausgestattet sind, und solchen Lebewesen, die über Seelen mit weiteren Fähigkeiten verfügen. Diese Schwelle ist die aisthēsis. Während pflanzliches Leben, so wie Aristoteles es darstellt, sich im Ernährungsvermögen [threptikon] erschöpft, das Erhaltung, Wachstum, Vermehrung und Vergehen einschließt, besitzen Tiere auch die Wahrnehmungskraft, die ihnen Zugang zu vielen noch höheren Vermögen eröffnet, die der bloßen Pflanzenseele verwehrt sind. »Wahrnehmungsvermögen« [aisthēsis], schreibt Aristoteles deshalb, »[muss] nicht notwendig in allem Lebenden« sein, Tiere jedoch könnten definitionsgemäß ohne es nicht existieren.[17] Diese Tatsache zeugt von einer Äquivokation im Grundbegriff des Lebens, einer Doppeldeutigkeit, die dadurch entsteht, dass, wie der Philosoph in einer charakteristischen Wendung erklärt, »Leben in vielfachem Sinne gebraucht wird« [pleonachōs de tou zēn legomenou].[18] Während die Grundkraft der Ernährung als solche genügt, um allem Lebenden Leben zuzusprechen, wird etwas allererst durch das Wahrnehmungsvermögen zum Tier.[19]
Aristoteles definiert Sinneswahrnehmung in De anima – mit Begriffen, die in seinen anderen Werken und in denen seiner Nachfolger wiederkehren – als »ein Bewegtwerden und Erleiden« (oder Affiziertwerden) [hē d’ aisthēsis en tōi kinesthai te kai paschein symbainei].[20] Die Terminologie, die er zu Erörterung des Phänomens entwickelt, ist komplex und erlaubt es ihm, grundsätzlich – wenn auch nicht immer faktisch – vier strukturell verschiedene Dimensionen zu unterscheiden, die sich im Akt der Sinneswahrnehmung regelmäßig verbinden: das Wahrnehmungsvermögen, das Aristoteles aisthētikon nennt; das Sinnesorgan, das heißt denjenigen Teil des Körpers, der zur Wahrnehmung fähig ist und den er aisthētērion nennt; das, was wahrnehmbar ist und was er im Allgemeinen mit dem Begriff aisthēton bezeichnet; und das aktuelle Wahrnehmungsereignis, das allein den Namen aisthēsis trägt.[21]
In Buch Beta von De anima lehrt Aristoteles, dass es fünf Sinne gibt [aisthēseis]: Gesicht, Gehör, Geruch, Geschmack, Tastsinn. Jedem von ihnen, so sagt er, entspricht ein eigener Gegenstand [idion], ein charakteristisches Medium [metaxu] und ein bestimmtes Organ [aisthētērion]. Nehmen wir zum Beispiel den Gesichtssinn. Sein Gegenstand ist das Sichtbare. Sein Medium ist das, was Aristoteles »das Durchsichtige« nennt [diaphanēs], dessen Wirksamkeit Helligkeit und dessen Potentialität Dunkelheit ist; es ist das Element, in dem das Sichtbare erscheinen kann.[22] Das Sehorgan schließlich lässt sich in den Augen lokalisieren. Wahrnehmen ist eine Art »Werkzeug« [ti mesotētos], denn es nimmt das Wahrnehmbare mit Hilfe seines Organs an einer bestimmten Stelle in einem Kontinuum zwischen zwei gegensätzlichen Qualitäten auf.[23] Der sichtbare Gegenstand beispielsweise, der mit den Augen gesehen wird, fällt immer zwischen die Extreme des Hellen und Dunklen. Und so klingt nach Aristoteles auch das Hörbare, das mit den Ohren gehört wird, in der Luft zwischen dem Leisen und dem Lauten, und – um noch ein Beispiel von einem anderen Sinn zu nehmen – das Schmeckbare, das im Wasser und in der Luft mit der Zunge und durch die Nase geschmeckt wird, lässt sich zwischen den beiden Extremen des Bitteren und Süßen anordnen.[24] Das wahrnehmbare Objekt, sein Medium und das Organ seiner Aneignung bilden somit formell unterschiedene Elemente der Sinneswahrnehmung, die sich bei einer aktuellen aisthēsis zur Form einer einheitlichen Erfahrung verbinden: Man begegnet dem Sichtbaren immer im transparenten Medium der Helligkeit an irgendeinem Punkt zwischen den Extremen des Hellen und Dunklen, und man nimmt das Hörbare stets mit den Ohren wahr, wenn es, laut oder leise, im Medium der Luft klingt.
Bis zu diesem Punkt stößt die in De anima vorgetragene Lehre von der Wahrnehmung offenbar nicht auf Komplikationen und scheint grundsätzlich auf jeden der fünf Sinne anwendbar. Doch bald wird die Darlegung ein gutes Stück undurchsichtiger, und die Analogien zwischen den Formen der Sinne scheinen immer ungewisser. Am hartnäckigsten werden die Schwierigkeiten bei demjenigen Sinn, den Aristoteles als elementarste Form der sinnlichen Affektion darstellt und den er, der Darstellung halber, als letzten unter den Sinnen behandelt.[25] »Als erstes Wahrnehmungsvermögen«, sagt Aristoteles, »kommt allen [Lebewesen] der Tastsinn zu« [aisthēseōs de prōton hyparchai pasin haphē].[26] Sinnliches Leben entsteht mit dem Tastsinn und endet vollkommen symmetrisch mit dessen Verlust.[27] Ein Unterschied in der Rangordnung trennt somit das taktile Vermögen von den anderen Sinnen: Die Existenz des einen begründet die der übrigen vier.[28] Doch der Tastsinn scheint sich noch stärker von ihnen zu unterscheiden – aus Gründen, die es unklar werden lassen, in welchem Sinne er überhaupt als Sinn im Sinne von De anima zu bezeichnen wäre.
Aristoteles vertrat klar die Auffassung, jedem Sinn entspreche ein Medium, ein Sinnesgegenstand und ein Organ. Doch in diesem Falle lassen sich die Elemente der Wahrnehmung, wenn überhaupt, nur schwer ausmachen. In welchem Sinne kann der Tastsinn ein Medium zulassen? Berührung scheint doch per definitionem unmittelbar. Aristoteles argumentiert jedoch, es sei nicht so: In Wirklichkeit trenne stets ein Zwischenraum das Berührende vom Berührten, und dieser eröffne überhaupt erst die Möglichkeit einer Empfindung. Betrachten wir zwei Körper, die im Wasser aufeinandertreffen. Da ihre Berührungsflächen nicht trocken sind, argumentiert Aristoteles, »[müssen sie] zwischen sich Wasser haben, von dem die Oberflächen voll sind«.[29] Bei der Berührung von Körpern in der Luft verhält es sich nicht anders: Wie nahe sie einander auch scheinen mögen, sind sie auch als trockene unweigerlich durch eine Schicht von Luft voneinander getrennt. Woher rührt dann der Eindruck, der Tastsinn kenne, im Unterschied etwa zum Gesichtssinn, keine Distanz? »[W]ir nehmen alles durch das Medium wahr, aber bei diesen [Fällen] entzieht es sich der Beachtung.«[30] Einzig bei der Berührung bleibt – anders als beim Sehen, Hören, Riechen – das Wahrnehmbare in zu großer Nähe, und wir können den Abstand nicht wahrnehmen, der uns von ihm trennt: und so kommt es, wie Aristoteles mehrfach schreibt, dass sich der Intervall unserer Beachtung entzieht [lanthanei].[31] Die Nähe der Berührung rührt von dieser Distanz her, die gleichwohl dafür sorgt, dass sie für den Sinn unentdeckbar bleibt. In diesem nicht wahrnehmbaren Raum zwischen dem Berührenden und dem Berührten kann ein Körper, wie nahe er auch sei, als vom anderen verschieden empfunden werden.
Ebenso wie die anderen Sinne impliziert also der Tastsinn ein Medium, auch wenn es per definitionem beim Wahrnehmungsakt aus der Wahrnehmung verschwindet. Doch welches ist das Organ dieses Sinnes? Eine naheliegende Antwort wäre: das Fleisch [sarx], doch in der Aristotelischen Lehre der aisthēsis haben die äußeren Schichten des Tierkörpers eine andere Rolle zu spielen. »[So] wie sich Luft und Wasser zum Gesicht und zum Gehör und zum Riechen verhalten, so [verhalten] sich Fleisch und Zunge zu ihrem Sinneswerkzeug.« Fleisch ist also das Medium des Tastsinns und kann deshalb nicht sein Organ sein. Die Herleitung ist logisch einwandfrei. Um das Argument zu veranschaulichen, liefert Aristoteles auch einen Beweis. Kommt es zum unmittelbaren Kontakt zwischen dem wahrnehmbaren Gegenstand und dem Sinnesorgan, so kommt kein Eindruck zustande. Wird zum Beispiel etwas Weißes aufs Auge gelegt, sieht man überhaupt nichts, und wenn man entsprechend etwas von einem bestimmten Geruch unmittelbar auf die wahrnehmende Membrane der Nase bringt, kann man nichts riechen.[32] Wäre Fleisch ein Organ, so verhielte es sich dergestalt; das Auflegen des Tastbaren auf es würde alle Empfindung verhindern. Doch natürlich ist das Gegenteil der Fall. Berührung tritt genau dort ein, wo das Fleisch mit dem Tastbaren in Kontakt kommt, jedoch getrennt von ihm durch die feinste aller Membranen, die als solche kaum wahrzunehmen ist.
Wohl räumt Aristoteles ein, dass das Fleisch unter den Medien der Wahrnehmung ein spezifisches Merkmal besitzt. Dieses Merkmal besteht ganz einfach darin, dass es von dem wahrnehmenden Körper nicht getrennt werden kann. Während man von Luft und Wasser sagen kann, dass sie beim Sehen und Hören »auf uns wirken«, kann man beim Berühren nicht sagen, dass das Fleisch auf uns einwirke, als wären wir von ihm klar unterschieden. Wir nehmen das Tastbare nicht »durch Einwirkung des Mediums wahr, sondern zusammen mit dem Medium […] beide werden zugleich angestoßen« [ouch hypo tou metaxu all’ hama tōi metaxu], da in diesem Falle das Medium von unserer eigenen Körperform nicht unterschieden ist.[33] Die Verlegenheit besteht jedoch weiter. Als Medium kann das Fleisch kein Organ sein. Aristoteles folgert, dass der für den Tastsinn zuständige Körperteil »im Innern ist« [entos], macht aber keine weiteren Angaben dazu. Man darf vermuten, dass die rätselhafte Behauptung wenigstens teilweise ein Zugeständnis an die Kohärenz seiner Lehre ist, der zufolge jeder Sinn, um zu funktionieren, nicht nur ein Medium und einen spezifischen Sinnesgegenstand, sondern ebensosehr ein Organ benötigt. Das Organ des Tastsinnes sei »im Innern«, schreibt Aristoteles, weil nur dann »es wie bei den andern Sinnen [geschieht]«.[34]
Das Problem des Berührbaren erweist sich zumindest als hartnäckig. Gesichtssinn, Gehör, Geruch und Geschmack lassen sich sämtlich durch ihre jeweiligen Sinneseigenschaften definieren und in unterschiedlichem Grade voneinander unterscheiden.[35] Das Sichtbare, als Gegenstand des Sehens, lässt sich zum Beispiel recht einfach vom Hörbaren abgrenzen: Sehend kann man keinen Laut und mit dem Gehör wohl kaum eine Farbe wahrnehmen. Doch so einfach ist es mit dem Tastsinn nicht. Ein erstes Problem betrifft seine Struktur selbst, die ihn offenbar für Sinnesqualitäten höchst unterschiedlicher Art empfänglich macht. Aristoteles hat gezeigt, dass jedem Sinn ein bestimmtes Paar gegensätzlicher Sinnesqualitäten entspricht: dem Sehen zum Beispiel das Weiße und das Schwarze; dem Hören das Hohe und das Tiefe; dem Geschmack das Bittere und das Süße. »Aber im Tastbaren gibt es viele Gegensätze, warm, kalt, trocken, feucht, rauh, weich und dergleichen mehr.«[36] In De generatione et corruptione erweitert der Philosoph die Liste noch: Die vom Tastsinn wahrgenommenen gegensätzlichen Sinneseigenschaften, so erfahren wir, schließen auch das Warme und das Kalte, das Trockene und das Feuchte, das Schwere und das Leichte, das Rauhe und das Glatte, das Dichte und das Dünne ein.[37] Wie könnte man einer solchen Vielfalt ein einziges differentielles Merkmal entnehmen, mit dem sich die Natur des Berührbaren bestimmen ließe? Aristoteles liefert keine Antwort. »Aber beim Tastsinn ist nicht klar«, schreibt er zum Abschluss dieser Erörterung einfach, »was das eine Zugrundeliegende ist wie beim Gehör der Schall.«[38]
Die grundlegendste der Wahrnehmungsformen, der Tastsinn, bleibt also in mehr als einem Sinne zugleich die am schwersten fassbare. Vor dem taktilen Vermögen scheinen die Kriterien, die Aristoteles zur Bestimmung der verschiedenen Wahrnehmungsformen entwickelt hatte, ihre Kraft zu verlieren und in ihrem Schwanken unweigerlich auf eine Folgerung hinauszulaufen, die in De anima selbst nirgends gezogen wird: Man muss schließen, dass trotz der klassischen Zählung der Tastsinn nicht ohne weiteres irgendeiner Fünfergruppe zugerechnet werden kann. Nicht nur vor, sondern auch nach dem Abschluss der Kapitel, die sich in De anima der Natur der aisthēsis widmen, bleibt beim Tastsinn nach den Worten des Philosophen »eine schwierige Frage, ob es mehrere Arten des Tastens gibt oder nur eine«.[39] Das taktile Vermögen, scheinbar das erste in der Reihe der Sinnesvermögen, birgt in sich offenbar die Möglichkeit aller anderen, die ihm in der Entwicklung und fortschreitenden Ausdifferenzierung der wahrnehmenden Seelenkräfte folgen. Denn insofern alle fünf Sinne in einem Medium und also mittels Kontakt operieren, »[nehmen] freilich auch die andern Sinneswerkzeuge durch Berührung wahr« [haphēi aisthanetai], wie Aristoteles im Schlusskapitel von De anima schreibt.[40]
So wird verständlich, warum der Philosoph en passant erklären konnte, mit dem Begriff »wahrnehmbar« meine er ganz einfach »tastbar«,[41] und wieso »tastbare Eigenschaften« für ihn letztlich »die Unterschiede des Körpers als Körpers« sind [diaphorai tou sōmatos hēi sōma].[42] Mit dem Tastsinn erreicht die Aristotelische Analyse des wahrnehmenden Gewahrens ihren elementarsten Begriff, aber auch ihre Grenze, den Punkt, an dem die Formen und Strukturen der Empfindung ihre gemeinsame Quelle in einem Prinzip finden, das so universell und so undeutlich wie das des tierischen Lebens selbst ist. In der antiken Theorie, die dem Bewusstsein oder seinem Fehlen keine besonderen Vorrechte zusprach, galt dieses Prinzip gleichermaßen für all jene Wesen, für die, schlicht gesagt, leben soviel hieß wie wahrnehmen. Nach klassischer Lehre war der wahrnehmenden Seele jegliche Art der Begegnung nicht anders als durch physische Berührung möglich, und der Bereich des tastbaren Körpers blieb überall so weit und so vielgestaltig wie der der aisthēsis selbst. Wo wären in einer solchen Welt die Grenzen zu setzen, über die sich der Tastsinn nicht hinauswagen kann, Grenzen, an denen der Sinn unempfindlich würde und seine Rechte subtileren Kräften überlassen müsste: Begehren und Bewegung, Einbildung, Gedächtnis und Denken? Im Zeitalter der Dominanz des erkennenden Wesens ist diese Frage dringlich, doch dem antiken Philosophen scheint sie sich nicht gestellt zu haben. Denkend oder gedankenlos, bewusst oder nicht: das Leben des Lebewesens blieb in seinen Augen vor allem anderen eine Sache des Tastsinns.
Drittes KapitelDie primäre Kraft
Welches die Aristotelische Lehre vom Gemeinsinn enthält, dem Grundvermögen, mit dem Lebewesen empfinden, dass sie empfinden
Die Behandlung des Tastsinns in De anima kündigt einen Übergang an. Das letzte Kapitel der Darstellung der Lehre von den fünf Sinnen, die Erörterung des Wesens der Berührung, führt zum Schluss eines wichtigen Abschnitts des Werkes, der in den modernen Editionen des klassischen Textes eine entscheidende Form annimmt, die kein Leser übersehen könnte: Bald nach Abschluss der Analyse des Tastsinns geht das zweite Buch der Abhandlung zu Ende und macht den Weg frei für eine Erörterung der differenzierteren Vermögen der Seele im dritten und abschließenden Teil des Werkes. Gewiss kann man diese Textaufteilung berechtigt finden und den Zusammenhang zwischen den Analysen des Gesichts, Gehörs, Geruchs, Geschmacks und Getasts und den unmittelbar darauf folgenden Überlegungen gering einschätzen, Überlegungen, die das Problem der Bestimmung der fünf Sinne eindeutig verlassen. Gleichwohl verfolgen die nächsten drei Kapitel den Weg der vorherigen entschieden weiter, und an keiner Stelle könnte man sagen, sie verließen das Gebiet der aisthēsis. Sie wenden sich immer energischer und präziser den komplexeren Kräften der Sinneswahrnehmung zu, beginnend mit einer dichten Erörterung der Frage, die zuerst bei der Betrachtung des Tastsinns aufgekommen war: nämlich der nach einer Wahrnehmungskraft, die den gesamten Körper des Lebewesens durchdringt und nicht auf die Betätigung eines einzelnen Sinnes zurückgeführt werden kann. Einige moderne Herausgeber von De anima haben deshalb bemerkt, dass diese Kapitel, obgleich sie von Buch Beta durch einen Buchwechsel getrennt sind, mit der vorangehenden Diskussion ebensoviel wie mit der ihnen folgenden zu tun haben.[1] Ganz offensichtlich aus diesem Grund hatten auch die klassischen arabischen Editoren des Aristotelischen Texts entschieden, mit philosophisch-philologischer Entschlossenheit einfach alle drei Abschnitte dem Ende von Buch Beta anzuhängen.[2]
Aristoteles beginnt seine Überlegungen mit der Formulierung einer klärungsbedürftigen Schwierigkeit. Jenseits der fünf bereits diskutierten, so sagt er, gibt es keine Sinne [aisthēseis] mehr, und doch können die aufgezählten Fähigkeiten nicht von der gesamten Spanne der Sinneserfahrung Rechenschaft geben. Der Philosoph eröffnet die Diskussion mit der Betrachtung eines Wahrnehmungsphänomens, auf das er bereits einmal früher angespielt hatte, die »gemeinsamen Sinnesqualitäten« [koina aisthēta]: Bewegung, Ruhe, Gestalt, Größe, Zahl.[3] Nimmt man zum Beispiel wahr, dass etwas sich bewegt, ruht, quadratisch, groß oder drei oder eins ist – mit welchem Sinn tut man das? Aristoteles macht deutlich, dass man von solchen Sinnesqualitäten nicht sagen kann, sie prägten sich durch irgendeine der bereits erörterten Wahrnehmungsformen der Seele auf. So wie er sie in den vorausgehenden Kapiteln definiert hatte, bleiben die fünf Sinne ausschließlich an ihre jeweiligen Gegenstände, welcher Natur sie auch seien, gebunden – vom Sichtbaren bis zum Tastbaren. Man kann von ihnen nicht sagen, sie fassten irgendwelche anderen als ihre eigentümlichen Qualitäten auf, allenfalls mittelbar und »nebenbei«, zufällig und akzidentell [kata symbebēkos], etwa wenn sich »dieses Weiße« dort, ein für sich wahrnehmbares Ding, als der Sohn von Diares oder Kleon erweist.[4] Doch der Philosoph will auch nicht zugeben, dass die gemeinsamen Qualitäten Gegenstände eines sechsten Sinns wären, die unabhängig aufgefasst und erst dann mit den Sinnesobjekten eines der oder aller fünf Sinne verbunden werden. Denn die gemeinsame Sinneseigenschaft ist, wie er bereits erklärt hat, »an sich« oder absolut »wahrnehmbar« [kath’ auto], und es gehört zu ihrer Natur, uno actu, doch mit mehr als einem Sinn wahrnehmbar zu sein.[5] Die Bewegung eines Körpers kann beispielsweise unmittelbar, durch Tast- oder Gesichtssinn, wahrgenommen werden, und von dieser elementaren Erfassung kann man wiederum die der übrigen gemeinsamen Sinnesqualitäten herleiten, Größe [megethos], Gestalt [schēma] und Ruhe [stasis], die alle in unterschiedlicher Weise Modifikationen der Bewegung sind.[6]
Man entrinnt dem Problem nicht. Die gemeinsamen Sinnesqualitäten lassen sich weder auf die Aktivität der fünf Sinne zurückbeziehen, jedenfalls nicht in dem Sinne, wie sie bisher definiert worden sind; noch lassen sie sich insoweit einem sechsten Sinn zuordnen, der speziell für ihre Erfassung geeignet wäre. Aristoteles bietet für diese Schwierigkeit keine unmittelbare Lösung an. Statt dessen geht er dazu über, eine weitere Wahrnehmungsform zu betrachten, welche über die Grenzen der fünf Sinne, so wie er sie dargestellt hat, hinausgeht. Es ist die Erfahrung einer komplexen Sinneswahrnehmung, bei der man in ein und demselben Moment eine Anzahl von Sinnesqualitäten unterschiedlicher Arten wahrnimmt. Jeder Sinn, das hat der Philosoph mittlerweise hinreichend gezeigt, trifft Unterscheidungen in seinem Wahrnehmungsgegenstand [krinei tas tou hypokeimenou aisthētou diaphoras]: der Gesichtssinn unterscheidet per definitionem das Helle vom Dunkeln, so wie der Geschmackssinn die Verschiedenheit zwischen Süßem und Bitterem feststellt.[7] Doch das Sinnesvermögen leistet noch mehr, wovon die Lehre von den fünf Sinnen nicht ohne weiteres Rechenschaft geben kann. Da wir nun aber, fährt Aristoteles fort, »auch das Weiße und das Süße und jedes Wahrnehmbare von jedem anderen unterscheiden«, bedarf es eines Prinzips, nach dem wir wahrnehmen, »dass sie verschieden sind«.[8] Anders als viele seiner modernen Kollegen will Aristoteles eine solche Wahrnehmung als Form des »Unterscheidens« [krinein] nicht in das Gebiet des Urteilens fallen lassen, das von den Sinnen unterschieden wäre.[9] Für ihn ist die Erfassung komplexer Sinneswahrnehmungen immer noch eine Sache der aisthēsis, wenngleich einer Art, deren Natur unklar bleibt. Wir nehmen, sagt er, die Unterschiede »natürlich durch die Wahrnehmung« wahr, »denn es handelt sich ja um Wahrnehmungsgegenstände.«[10]
Die Grenzen der bisher vorgebrachten Theorie der fünf Wahrnehmungsformen werden nun vollends deutlich. Der Gesichtssinn kann klar zwischen Hellem und Dunklem unterscheiden, so wie der Geschmacksinn den Unterschied zwischen Süßem und Bitterem feststellen kann. Doch wie kann man mit den Begriffen, die das zweite Buch von De anima anbietet, erklären, dass etwas als zugleich hell und süß ist oder, im anderen Falle, dass etwas als hell, aber nicht als süß empfunden wird? Der einzelne Sinn kann den Unterschied wahrnehmen, der den ihm eigentümlichen Gegenstand definiert, mehr aber nicht; die Erfassung der Konjunktion und Disjunktion von Sinnesqualitäten überschreitet seine Grenzen. Nachdem Aristoteles darauf beharrt hat, dass es nicht mehr als fünf Sinne gibt, wäre er zur Erklärung der Phänomene, die er selbst angeführt hat, eigentlich genötigt, unter den Vermögen der wahrnehmenden Seele ein weitere Kraft zu postulieren: eine Fähigkeit, welche die fünf Sinne koordiniert, vereint und unterscheidet, ohne dass sie mit einem der anderen zusammenfiele.
In De anima unternimmt der Philosoph jedoch einen solchen Schritt nicht. Er macht das Problem noch verwickelter, indem er die Frage nach einer weiteren Form von Sinneswahrnehmung aufwirft, die sich ebensowenig auf die Funktionen des Sehens, Hörens, Riechens, Schmeckens und Berührens wie auf die Wahrnehmung des gemeinsam Wahrnehmbaren und die komplexe Sinneswahrnehmung zurückführen lässt. Aus moderner Sicht ist dies vielleicht das verblüffendste Phänomen, das der antike Philosoph dem Reich der aisthēsis zuschreibt. Es ist die Empfindung des Empfindens, das bloße Gefühl, dass überhaupt etwas gefühlt wird. Aristoteles bemerkt, dass die Tätigkeit eines solchen Sinns nicht leicht zu erklären ist: »Da wir wahrnehmen, dass wir sehen und hören [epei d’aisthanometha hoti horōmen kai akoumen], muss einer entweder mit dem Gesichtssinn wahrnehmen, dass er sieht, oder mit einem anderen Sinn: Aber dann wird derselbe Sinn sich auf das Sehen und die gegebene Farbe [das Objekt des Gesichtssinns] richten. Und so würden sich zwei Sinne auf dieselbe Sache oder eben der eine Sinn auf sich selbst richten.«[11] Doch welche Kraft könnte von dem Sinn, der uns »wahrnehmen [lässt], dass wir sehen und hören«, und den Aristoteles für selbstevident hält, Rechenschaft geben? Oberflächlich betrachtet, führen beide Antworten, die der Philosoph in diesem Abschnitt vorschlägt, in ein Dilemma. Wenn wir mit dem Gesichtssinn wahrnehmen, dass wir sehen, so argumentiert er, dann müssen wir von dem Gesichtssinn sagen, dass er nicht einen, sondern zwei Gegenstände hat: Die eigentümliche Sinnesqualität des Sehens wird nicht nur das Sichtbare sein, wie er bisher behauptet hat, sondern darüber hinaus die bloße Tatsache des Sehens, und man wird die in den früheren Abschnitten der Abhandlung entwickelte Lehre zurückweisen müssen, wonach jeweils einem bestimmten Sinn eine bestimmte Qualität entspricht, die mit Hilfe eines Organs in einem Medium an einem Punkt zwischen zwei Extremen erfasst wird. Das Problem ist aber auch nicht beseitigt, wenn wir mit einem anderen Sinn als dem Gesichtssinn wahrnehmen, dass wir sehen. Es erscheint sogar noch dringlicher. Denn was wäre von diesem zweiten Sinn zu sagen: Nimmt auch er wahr, dass er die Tatsache des Sehens wahrnimmt?
Eine bejahende Antwort würde die Tür zu einem unendlichen Regress öffnen, in dem jedem Sinn ein weiterer entspräche, der für die Wahrnehmung der Tatsache seines Wahrnehmens verantwortlich wäre. Das Sichtbare würde vom Gesichtssinn wahrgenommen, und insoweit wäre die Aristotelische Analyse der Sinneswahrnehmung noch gültig; doch die Tätigkeit des Sehens würde von einem zweiten Sinn wahrgenommen, und die Tätigkeit dieses zweiten Sinns würde wiederum von einem dritten wahrgenommen – in einer schwindelerregenden Vervielfachung von Sinnen, der keine Grenze zu setzen wäre. Aristoteles zieht es vor, die Serie zu beenden, noch ehe sie begonnen hat. Er wählt die zweite von ihm vorgeschlagene Lösung, wie sehr sie auch seine Darstellung der je eigenen Gegenstände eines jeden Sinnes in Schwierigkeiten bringen mag. Bei der Erwägung der möglichen Lösungen des Dilemmas gelangt er zu seiner Entscheidung: Entweder, schreibt er, »würde es […] ins Unendliche weitergehen, oder eine [Wahrnehmung] würde sich auf sich selbst richten« [ē eis apeiron eisin ē autē tis estai hautēs].[12] Mit der Ablehnung des unendlichen Regresses, der in der Idee eines Sinnes impliziert ist, der sich auf ein von ihm selbst unterschiedenes Wahrnehmen richtet, gibt Aristoteles entgegen seiner bisherigen Analyse zu, dass die Sinne noch etwas anderes als ihre charakteristischen Sinnesobjekte wahrnehmen; er räumt ein, dass der Gesichtssinn beispielsweise noch etwas anderes aufnimmt als das Sichtbare und analog das Gehör noch etwas anderes wahrnimmt als das Hörbare. Sensu stricto kann also kein Sinn ausschließlich als der Sinn seines Sinnesobjekts betrachtet werden. Er muss darüber hinaus Sinn seiner selbst sein [autē hautēs], Sinn in zweiter Potenz. Neben seinem Vermögen, wahrzunehmen, was außerhalb seiner liegt, muss jeder Sinn gleichzeitig von seiner eigenen bloßen Fähigkeit, dies zu leisten, affiziert werden können.
In De anima wird dieses Thema nur knapp erörtert, und für sich genommen bleibt die Theorie der Sinneswahrnehmung, wie sie dort entwickelt wird, außerstande, die von ihr hervorgerufenen Schwierigkeiten zu lösen. Wie, möchte man wissen, kann man denn von einem Sinn sagen, dass er sich auf sich selbst richtet, und in welchem Verhältnis steht diese Wahrnehmungswahrnehmung zu der Wahrnehmung des jeweils einem Sinn eigentümlichen Wahrnehmbaren, wie sie Aristoteles in den vorangehenden Abschnitten seines Werkes dargestellt hatte? Liest man jedoch De anima zusammen mit den kleineren Abhandlungen der Parva naturalia, zeichnen sich bald die Grundzüge einer Antwort auf die Frage ab. In einer rätselhaften Formulierung in De anima, an der antike wie moderne Kommentatoren lange herumgekaut haben, erwähnt Aristoteles ein »gemeinsames« Empfindungsvermögen, um damit die Wahrnehmung von Ruhe, Bewegung, Gestalt, Zahl und Größe zu erklären: »Für die gemeinsamen Wahrnehmungsgegenstände«, sagt er in einem einzigen prägnanten Satz, »haben wir […] einen gemeinsamen Sinn« [tōn de koinōn ēdē aisthēsin koinēn].[13] Die kleinen naturgeschichtlichen Abhandlungen entwickeln das Postulat eines solchen Vermögens weiter, indem sie dessen Zuständigkeitsbereich so ausweiten, dass er die beiden weiteren Wahrnehmungsformen umfasst, die in der Abhandlung über die Seele jenseits der verschiedenen Tätigkeiten der fünf Sinne zu liegen scheinen.
Das Schlusskapitel von De sensu et sensibilibus enthält eine ausführliche Erörterung des Problems der komplexen Sinneswahrnehmung, welche die in De anima aufgeworfene Frage unmissverständlich formuliert: Wie ist es möglich, das Süße und das Weiße gleichzeitig wahrzunehmen?[14] Der Geschmack kann das Süße und der Gesichtssinn das Weiße wahrnehmen. Doch die Wahrnehmung des »Süßen und Weißen« ist ursprünglich einheitlich und kann nicht mit Bezug auf zwei verschiedene Wahrnehmungsakte erklärt werden, deren Kombination sie wäre. In Wahrheit, so erfahren wir, schließt das Phänomen der komplexen Sinneswahrnehmung die Existenz einer »einheitliche[n] Kraft in der Seele« ein, »mit der sie alles wahrnimmt«, also die Existenz eines umfassenden Sinnes [aisthētikon pantōn], der verbindend und vergleichend alles wahrnimmt, was von den fünf Sinnen erfasst wird.[15]
Dagegen kommt die Abhandlung De somno et vigilia auf das Problem der Wahrnehmung des Wahrnehmens in ähnlichen Begriffen wie De anima und De sensu zurück. Bei jedem Sinn, erklärt Aristoteles nun, muss man das, »was ihm eigentümlich ist« [ti idion], von dem unterscheiden, »was sie gemeinsam haben« [ti koinon] und was mit jenem regelmäßig einhergeht. Nur wenn man erklären kann, wie es geschieht, dass man beispielsweise beim Sehen wahrnimmt, dass man mit dem Gesichtssinn wahrnimmt, und beim Hören, dass man mit dem Gehör wahrnimmt – nur dann kann man eine kohärente Erklärung für die irreduzible Einheit der komplexen Sinneswahrnehmung liefern. Aristoteles schreibt:
Da nun bei jedem Sinn zu unterscheiden ist, was ihm eigentümlich ist und was sie gemeinsam haben, eigentümlich zum Beispiel beim Gesicht das Sehen, beim Gehör das Hören und so gleichermaßen auch bei den andern, daneben aber auch ein gemeinsames Vermögen, durch das man inne wird, dass man sieht und dass man hört – man kann ja doch nicht mit der Sehkraft sehen, dass man sieht, und man kann anderseits unterscheiden und unterscheidet auch, dass ›süß‹ und ›weiß‹ verschieden ist, weder mit dem Geschmack noch mit der Sehkraft, noch mit beiden zusammen, sondern mit einem für alle Sinne gemeinsamen Vermögen; denn es gibt nur ein Wahrnehmen, und das Grundvermögen der Wahrnehmung ist nur eines […].[16]
Hier erweitert Aristoteles die Kräfte der »gemeinschaftlichen« oder »gemeinsamen« Wahrnehmung [koinē aisthēsis], die in De anima bereits erwähnt wurden, deren Tätigkeit dort aber auf die Erfassung der gemeinsamen Sinnesqualitäten beschränkt schien. Nun heißt es, die komplexe Sinneswahrnehmung und auch die Wahrnehmung des Wahrnehmens zählten zu den Vermögen einer einzigen gemeinsamen Dimension der Wahrnehmung. Zusammen bilden sie die Funktionen des einen dominanten, »für alle Sinne gemeinsamen Vermögen[s]« [kyrion aisthētērion]. »Dieses Eine«, lesen wir ein paar Zeilen weiter, komme »ganz besonders« »dem Tastsinn zu« [d’ hama tōi haptikō malisth’ hyparchei].[17]
Oberflächlich betrachtet scheinen die Unterschiede zwischen den Darstellungen der Sinneswahrnehmung, wie sie in De anima beziehungsweise in den verschiedenen Abhandlungen der Parva naturalia geboten werden, unbestreitbar, gar unversöhnlich. Moderne Gelehrte haben sie in unterschiedicher Weise gedeutet. Viele, wenn nicht die meisten wollten sie lösen, indem sie Vermutungen zur Datierung anstellten. Manchen Autoren zufolge wurde De anima nach den kürzeren Abhandlungen verfasst; für andere wiederum stellen die kleineren Werke die Endstufe der Ausarbeitung der Aisthēsis-Lehre dar, wie sie zuerst in der großen Abhandlung über die Seele entworfen wurde.[18] Unklar bleibt jedoch, ob eine historische Anordnung der Aristotelischen Werke eindeutig geeigneter wäre, die Differenzen in der Lehre beizulegen, als eine philosophische Deutung. Eine Chronologie mag mehr oder weniger gut begründet sein, bleibt jedoch eine zutreffende oder unzutreffende Vermutung, und auf jeden Fall kann man das Korpus als Ganzes behandeln. Dies scheint der Weg zu sein, den die Denker der antiken und mittelalterlichen Tradition gegangen sind. Sie nahmen die verschiedenen Aristotelischen Erörterungen der gemeinsamen Sinneswahrnehmung als Ausgangspunkte für weitreichende Theorien eines Vermögens, das sie – in den Idiomen der griechischen, arabischen, hebräischen und lateinischen philosophischen Reflexion – durchweg »Gemeinsinn« nannten [koinē aisthēsis, al-h῾ḥiss al-mushtarak, ῾ḥush oder da῾at meshutaf und sensus communis], obgleich Aristoteles selbst einen ähnlichen Ausdruck höchstens dreimal benutzt hatte.[19]
Doch selbst wenn man De anima und die Abhandlungen der Parva naturalia als Elemente der Darstellung ein und derselben Lehre betrachtet, muss man einräumen, dass die Bemerkungen zu dem gemeinsamen Vermögen elliptisch und oft schwer zu deuten sind. Zumindest erführe man gern die Gründe für die Begriffswucherung – von dem »gemeinsamen Sinn« in De anima über den »Gesamtsinn« von De sensu und das »Grundvermögen« in De somno bis zu dem »ersten Sinn« [prōton aisthētikon], der in De memoria offenbar als Synonym für den »Gemeinsinn« [koinē aisthēsis] genannt wird. Man mag sich auch nach der verblüffenden Verbindung des »dominanten Sinnesorgans« in De somno mit dem Tastsinn fragen, einer Verbindung, die manche Kommentatoren zu Schlüssen geführt hat, die im Werk des Stagiriten selbst nirgendwo ausdrücklich gezogen werden: etwa wenn Michael von Ephesus bemerkt, dass »in Wahrheit Tastsinn und Gemeinsinn eines sind« [haphē kai koinē aisthēsis tauton estin].[20]
Es ist, als sperrte sich die gemeinsame Kraft dagegen, mit einem einzigen Namen angesprochen zu werden, als wäre jede Bezeichnung letztlich eine Art Katachrese, ein unpassender Titel für eine Kraft, der man keinen singulären Begriff beilegen und die man sich nicht ohne weiteres als eine unter anderen in der Seele der Lebewesen vorstellen kann. Moderne Gelehrte mussten sich von dieser schwer fassbaren Kraft unwiderstehlich angezogen fühlen, und zwar nicht nur wegen der rätselhaften und wandelbaren Rolle, die sie in den psychologischen Schriften des Aristoteles spielt. Als Seelenvermögen, mit dem wir »wahrnehmen, dass wir sehen und [dass wir] hören«, ähnelt der »Gemeinsinn« des Aristoteles offenbar weniger einer Form der Sinneswahrnehmung im gewöhnlichen Sinn als vielmehr der Form des Erkennens, das von den Philosophen der Moderne so gepriesen wird und dem es denkende Wesen im Unterschied zu allen anderen Dingen verdanken, dass man von ihnen sagen kann, sie seien ihrer selbst gewahr. Könnte der »Gemeinsinn« des Stagiriten, so fragten sich manche, ein Name für Bewusstsein sein?
Immer wieder wurde darauf hingewiesen, dass Aristoteles als Kind seiner Zeit offenbar kein exaktes Äquivalent für den modernen Begriff besaß. Gelegentlich wurde dieser Umstand als bloßer Mangel der sprachlichen Mittel dargestellt, etwa wenn Charles H. Kahn bemerkt, dass »das Griechische zu Aristoteles’ Zeiten über keinen Ausdruck verfügt, der der modernen Verwendung von ›Bewusstseinen‹ wirklich entspräche, für den Prozess oder die Situation des Gewahrens als solchen«, oder wenn Richard Sorabji beobachtet, dass »Aristoteles kein entsprechendes Wort für ›mentalen Akt‹ oder für Descartes’ cogitatio (Bewusstsein)« hat, oder wenn schließlich Deborah K. W. Modrak festhält, dass »Aristoteles keinen allgemeinen Begriff für Bewusstsein« besitzt.[21] Manchmal wurde jedoch auch die Meinung vertreten, diese Lücke sei für die Begriffe, die der antike Denker entwickelte, folgenreich gewesen. So schrieb Henry J. Blumenthal, Aristoteles habe »keinen formellen Bewusstseinsbegriff« gehabt und es sei »keineswegs klar, ob er überhaupt eine Vorstellung davon besaß«.[22] Manche gingen noch weiter und fanden im Fehlen dieses Begriffs sogar den Grund für die charakteristischen Schwächen der Aristotelischen Theorie des Geistes. D. W. Hamlyn, einer der modernen Editoren des klassischen Philosophen, betrachtete Aristoteles’ Darstellung der gemeinsamen Sinneswahrnehmung als den Versuch, nach »so etwas wie der Vorstellung einer Einheit des Bewusstseins oder Kants synthetischer Einheit der Apperzeption« zu suchen, mit dem bedeutsamen Vorbehalt jedoch, dass der Stagirit – anders als sein Königsberger Nachfolger – »keinen Bewusstseinsbegriff gehabt« habe.[23] In Hamlyns Augen hatte dieses Versäumnis schwerwiegende Folgen. Die Aristotelische »Beschäftigung mit dem Geist-Körper-Problem«, so erfahren wir, musste deshalb »flüchtig« bleiben; »Begriffe wie Bewusstsein tauchen in seinem konzeptuellen Schema gar nicht auf«; ein verständiger moderner Leser müsse daher »eine fast vollständige Vernachlässigung aller Probleme« beklagen, »die sich aus dem psychophysischen Dualismus und den Bewusstseinstatsachen ergeben«.[24]
Einfühlsamere Leser hatten den Wunsch, Aristoteles näher an die Begriffe der modernen Philosophie heranzurücken, und zögerten nicht, den peripatetischen »Gemeinsinn« dem modernen Erkenntnisvermögen anzuähneln. »Das zentrale Vermögen«, schrieb Kahn, »erfüllt offenkundig viele der Funktionen, auf die wir uns heute unter dem Titel ›Bewusstsein‹ beziehen.«[25] Ähnlich bemerkte L. A. Kosman, dass die Diskussion der »Wahrnehmung des Wahrnehmens« eine Darstellung dessen bildet, was eine »Art […] von Selbstbewusstsein zu sein scheint«.[26] In einem Artikel mit dem pointierten Titel »An Aristotelian Theory of Consciousness?« ging Modrak noch weiter. Bei ihrer Untersuchung der Frage, »welche der von Aristoteles beschriebenen seelischen Vermögen derart beschaffen sind, dass dem Inhaber dieses Vermögens Bewusstsein zugeschrieben werden könnte«, urteilte sie, der »wahrscheinlichste Anwärter« für diese Position sei der Gemeinsinn. Obwohl sie anerkannte, dass der griechische Philosoph »an der Natur von Bewusstsein als solchem offenbar nicht sonderlich interessiert war«, gelangte sie schließlich zu einem Urteil über das Denken des Aristoteles, das in seiner Schonungslosigkeit zumindest kühn war: »Seine Konzeption eines zentralen Sinnes ließe sich dazu verwenden, eine rudimentäre, jedoch vergleichsweise befriedigende Darstellung von Bewusstsein [zu] liefern.«[27]
Man kann sich nur schwer dem Eindruck entziehen, dass solche Studien – so begrifflich stringent sie immanent sein mögen – an einer schwerwiegenden unausgesprochenen Voraussetzung laborieren, welche die Ideen, die sie doch erhellen wollen, unweigerlich verdunkelt: der Voraussetzung nämlich, dass die Begriffe des antiken Philosophen letztlich ihre Bedeutung erst erlangen, wenn sie als »Anwärter« betrachtet werden, die sich mit unterschiedlichem Erfolg auf Positionen bewerben, die von modernen philosophischen Begriffen schon besetzt sind. Der Befund ist dann kaum verblüffend, dass der Aristotelische Gemeinsinn, misst man ihn an der Elle des Bewusstseins, zwar »vergleichsweise befriedigend«, doch bestenfalls »rudimentär« erscheint. Vielleicht wäre es fruchtbarer, die Argumentationsrichtung umzukehren. Es könnte sein, dass die Bedeutung des primären Sinnes des klassischen Philosophen nicht in seiner Nähe zum modernen Bewusstseinsbegriff, sondern in seiner Entfernung von ihm liegt. Denn die Distanz, aus der uns die antike Theorie erreicht, verbirgt eine Frage, die sich um so dringlicher stellt, als sie unzeitgemäß scheint: Wie, wenn die Tätigkeiten des Gewahrens und Selbstgewahrens, die dem modernen Vermögen zugeschrieben werden, nicht Formen des Erkennens, sondern des Wahrnehmens wären, wie Aristoteles behauptet hatte? Und wenn das Bewusstsein, mit einem Wort, eine Unterart von Berührung und Kontakt im buchstäblichen Sinn wäre, »ein innerer Tastsinn«, wie die Stoiker von dem »Gemeinsinn« gesagt haben sollen, »mit dem wir uns selbst wahrnehmen«?[28]