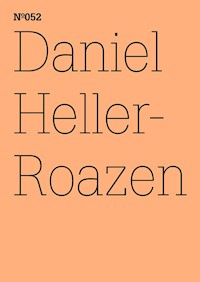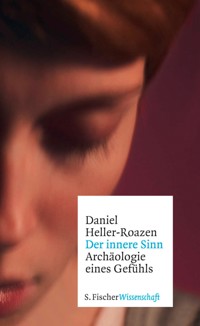18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER E-Books
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Sprache dient der Verständigung. Doch immer wieder hat es Menschen gegeben, die nicht wollten, dass alle sie verstehen. Deshalb haben sie Geheimsprachen entwickelt. Daniel Heller-Roazen unternimmt in seinem Buch einen Streifzug durch die Geschichte der künstlichen und geheimen Sprachen. Von den Sprachen der Gauner, den heiligen Sprachen bis zur Beschäftigung des großen Sprachforschers Ferdinand de Saussure mit Anagrammen, von der arkanen Sprachkunst der Druiden und Bibelkopisten bis zu Tristan Tzara, der die Dada-Bewegung mit begründete und zuletzt die Lieder von Villon zu entschlüsseln meinte, erkundet Heller-Roazen die Sprachkunst von Gaunern und von Rätselfreunden und zeigt: Diese Sprachen, die Klang und Sinn gegeneinander ausspielen, verbindet mehr mit der Poesie, als bislang angenommen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 375
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Daniel Heller-Roazen
Dunkle Zungen
Die Kunst der Gauner und Rätselfreunde
Über dieses Buch
Sprache dient der Verständigung. Doch immer wieder hat es Menschen gegeben, die nicht wollten, dass alle sie verstehen. Deshalb haben sie Geheimsprachen entwickelt. Daniel Heller-Roazen unternimmt in seinem Buch einen Streifzug durch die Geschichte der künstlichen und geheimen Sprachen. Von den Sprachen der Gauner, den heiligen Sprachen bis zur Beschäftigung des großen Sprachforschers Ferdinand de Saussure mit Anagrammen, von der arkanen Sprachkunst der Druiden und Bibelkopisten bis zu Tristan Tzara, der die Dada-Bewegung mit begründete und zuletzt die Lieder von Villon zu entschlüsseln meinte, erkundet Heller-Roazen die Sprachkunst von Gaunern und von Rätselfreunden und zeigt: Diese Sprachen, die Klang und Sinn gegeneinander ausspielen, verbindet mehr mit der Poesie, als bislang angenommen.
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Biografie
Daniel Heller-Roazen, geboren 1974, ist Professor für Vergleichende Literaturwissenschaft an der Princeton University. Er studierte Philosophie und Literaturwissenschaft in Toronto, Baltimore, Venedig und Paris und hat zahlreiche Stipendien für seine Arbeit erhalten. Im Jahr 2010 wurde ihm die Medaille des Collège de France verliehen. Im S. Fischer Verlag ist zuletzt von ihm erschienen »Der fünfte Hammer – Pythagoras und die Disharmonie der Welt« (2015), »Der Feind aller. Der Pirat und das Recht« (2010) sowie die von der Kritik gefeierte Studie »Der innere Sinn. Archäologie eines Gefühls« (2012).
Weitere Informationen finden Sie auf www.fischerverlage.de
Impressum
Erschienen bei FISCHER E-Books
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2013 unter dem Titel »Dark Tongues. The Art of Rogues and Riddlers« im Verlag Zone Books New York
© Daniel Heller-Roazen 2013
Für die deutschsprachige Ausgabe:
© 2018 S. Fischer Verlag GmbH, Hedderichstr. 114, D-60596 Frankfurt am Main
Covergestaltung: hißmann, heilmann, Hamburg / Gundula Hißmann
Coverabbildung: akg-images
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
ISBN 978-3-10-403215-3
Dieses E-Book ist urheberrechtlich geschützt.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
Dieses E-Book enthält möglicherweise Abbildungen. Der Verlag kann die korrekte Darstellung auf den unterschiedlichen E-Book-Readern nicht gewährleisten.
Wir empfehlen Ihnen, bei Bedarf das Format Ihres E-Book-Readers von Hoch- auf Querformat zu ändern. So werden insbesondere Abbildungen im Querformat optimal dargestellt.
Anleitungen finden sich i.d.R. auf den Hilfeseiten der Anbieter.
Inhalt
The howtosayto itiswhatitis humustwhomust [...]
Erstes Kapitel Gabelungen
Zweites Kapitel Coquillars
Drittes Kapitel Prinzipien der Gaunersprache
Viertes Kapitel Zeichen
Fünftes Kapitel Umschreibungen
Sechstes Kapitel Rätsel
Siebtes KapitelNomina divina
Achtes Kapitel Nomina sacra
Neuntes Kapitel Anaphone
Zehntes Kapitel Muster
Elftes Kapitel Tristan Tzaras Geheimnisse
Literatur
The howtosayto itiswhatitis humustwhomust worder schall.
A darktongues, kunning.
James Joyce, Finnegans Wake
Abb. 1:Liber vagatorum oder Der Betler orden, Augsburg 1512
Erstes KapitelGabelungen
Dass menschliche Wesen sprechende Wesen sind, ist eine alte und oftmals geäußerte Überzeugung. Vielleicht war Aristoteles der Erste, der sie zur Grundlage einer Definition machte, als er in einer berühmten Passage seiner Politik erklärte: »Der Mensch ist aber das einzige Lebewesen, das Sprache besitzt« (logon de monon anthrōpos echai tōn zōōn).[1] »Sprache« war jedoch ein dunkles Wort und ist es geblieben. Die Tatsache, dass das »sprechende Tier« des griechischen Philosophen auf Lateinisch in »vernünftiges Tier« (animal rationale) umbenannt werden konnte, liefert ein Beispiel dafür, wie ein Begriff für die Tatsache des Sprechens mehreren Interpretationen zugänglich ist. Der aristotelische logos bezeichnete im Griechischen ein Gestrüpp von Vorstellungen, die man heute gewöhnlich voneinander trennt: »Wort«, »Rede« und »Diskurs« natürlich, aber auch allgemeiner »Vernunft« und spezieller arithmetisches »Verhältnis« und musikalisches »Intervall«.[2] Das aristotelische Argument lässt sich jedoch in mehr als einer Weise umformen. Schon seine Grammatik ist als solche bezeichnend. Die Worte des Aristoteles weisen darauf hin, dass das, was menschliche Wesen gegenüber allen anderen auszeichnet, eine Fähigkeit ist, die mit einem Nomen im Singular benannt werden kann. Es ist das Sprachvermögen. So evident das heute scheinen mag, stößt diese Behauptung auf eine Realität, die verwickelter ist, als der antike Philosoph und viele seiner Nachfolger offenbar einräumen wollten. Man kann das einfach formulieren: Sprechende Wesen sprechen niemals Sprache, höchstens Sprachen.
Das Englische hat ein Wort für zwei sprachliche Gegenstände, die sich klar voneinander unterscheiden lassen: Mit language wird einerseits die allgemeine Tatsache der menschlichen Rede bezeichnet, andererseits die Vielzahl der gesprochenen Sprachen (wie Armenisch, Japanisch oder Arabisch). Einige »fremdsprachige« Idiome sind da klarer. Die romanischen Sprachen zum Beispiel lassen regelmäßig eine lexikalische Unterscheidung zwischen einem abstrakten Begriff für das Sprechen (wie lenguaje, linguagem, langage oder linguaggio) und einem spezifischen Ausdruck für eine Sprache mit ihren Wörtern und Regeln (idioma, lengua, langue, lingua) zu. Dass zwischen den Vorstellungen, die von diesen beiden Begriffsreihen ausgedrückt werden, eine Beziehung besteht, ist natürlich kaum zu bezweifeln. Sie verweist auf einen epistemologischen Zirkel, der explizit oder implizit eine Praxis der Definition durch Abstraktion in Gang hält. Die bloße Fähigkeit der Rede lässt sich nirgendwo anders als in Sprachen finden, die definitionsgemäß eine Mehrzahl bilden; doch können die Sprachen wiederum nur dann als Mitglieder einer Klasse betrachtet werden, wenn man den Begriff »Sprache« bereits vorausgesetzt hat.[3] Je nachdem, woran man interessiert ist oder welche Perspektive man einnimmt, kann man den Begriff oder seine Beispielfälle, das allgemeine Vermögen oder seine Varietäten betrachten. Doch der Ausgangspunkt unter sprechenden Wesen bleibt diese erste Gabelung. Wann immer es Sprache gibt in der bestimmten Einzahl, gibt es in Wahrheit Sprachen in unbestimmter und in der Tat unzählbarer Vielzahl; wann immer es Sprachen gibt im Plural, wird man den Schatten eines Sprachvermögens entdecken, immerhin deutlich genug, um seiner Definition nach von jedem Idiom unterschieden zu bleiben. Diese verzwickte Situation mag man feiern oder beklagen, aber leugnen lässt sie sich nicht. »Sprachen«, bemerkte Mallarmé, »unvollkommen insofern, als sie mehrere sind und die erhabenste fehlt.«[4]
Betrachtet man die Geschichte der wissenschaftlichen Erforschung der Natur der Sprache, drängt sich der Eindruck auf, dass der Diskurs über die Sprache in ihrer Einfachheit wenig Raum für die Vielheit von Idiomen gelassen hat. Dass menschliche Wesen sprechende Wesen sind, wurde so interpretiert, dass sie miteinander über Gut und Böse beraten und nicht nur Angenehmes und Unangenehmes signalisieren; dass sie bestrebt sind, so gut sie können, einander ihre Ideen und Auffassungen zu vermitteln, zu welchem Zweck es auch sei; dass sie designieren, handeln, argumentieren, berechnen oder kommunizieren. Der Möglichkeiten sind viele. Die »Theorie der Sprache« neigte jedenfalls dazu, ihren Gegenstand als singuläre Entität zu betrachten.
Das mag insoweit ein Erbe der Antike sein, zumindest was jene Wissensformen betrifft, die – wie Philosophie und Grammatik – beanspruchen, aus den Disziplinen Griechenlands und Roms hervorgegangen zu sein. Mehr als einmal wurde bemerkt, dass die Griechen und die Römer vergleichsweise wenig Interesse an den Idiomen zeigten, die, wie sie wohl wussten, sie umgaben. Um dieses Versäumnis zu erklären, haben die Gelehrten verschiedene Hypothesen vorgebracht. Vielleicht wollten sich Griechen und Römer nicht um fremde »Zungen« kümmern, weil sie glaubten, die Völker, die sie für »Barbaren« hielten, sprächen Idiome, die ihrem eigenen absolut unähnlich seien: nicht nur unerforscht, sondern zutiefst unerforschlich. Vielleicht galten fremde Sprachen den Griechen und Römern aber auch deshalb als wertlose Untersuchungsgegenstände, weil sie umgekehrt meinten, sie seien ihrer eigenen Sprache wesentlich ähnlich und nur in ihrem Vokabular unterschieden.[5] Bemerkenswert ist jedenfalls, dass die großen Exponenten so verschiedener und hochentwickelter klassischer Disziplinen wie Philosophie, Geographie, Geschichtsschreibung und Grammatik übereinstimmend keine Notwendigkeit sahen, die Vielheit der Sprachen als eine Tatsache zu betrachten, die eines besonderen Kommentars bedurft hätte.
Die homerischen Epen, die frühesten Monumente griechischer Literatur, schildern eine Welt, die kaum Dolmetscher benötigt und in der wichtige sprechende Subjekte, ob Achaier oder Troer, sich ungehindert in einer Sprache unterhalten. Gewiss, manche Passagen zeigen, dass der homerische Dichter durchaus ein Bewusstsein einiger fremder Idiome besaß: So erwähnt die Ilias die Karer, »ein Volk barbarischer Mundart« (barbarophōnoi), und die Odyssee verweilt kurz bei den Kretern, »Völker[n] von mancherlei Stamm und mancherlei Sprachen«.[6] Doch solche nichtgriechischen Sprachen mussten in der homerischen Welt als Zeichen ferner Wunder erscheinen. Die Philosophen sagten kaum mehr. Es besteht kein Zweifel, dass Platon zum Beispiel mit der Tatsache der sprachlichen Diversität vertraut war. Doch als er den Namen, ihrer Natur und ihrer Bildung einen Dialog widmete, verlor er kein Wort über die Differenzen zwischen dem Griechischen und anderen Idiomen, noch hielt es sein Sokrates für angebracht, danach zu fragen, warum die Formen der Rede zwischen den verschiedenen Teilen Griechenlands – von verschiedenen Völkern ganz zu schweigen – sich deutlich unterschieden. Die Welt des Kratylos ist die einer einzigen Sprache, in jedem Sinne. Aristoteles, der die menschlichen Völker als die einzigen Besitzer des logos definierte, stellte eine elaborierte Theorie der Sprache und der Logik auf, die er in Abhandlungen zu zahlreichen Themen entwickelte, etwa zu Bedeutung, Schlussfolgerung, Dichtung, Rhetorik, Politik und Biologie. Doch überall geht Aristoteles so vor, als könne der logos als einer behandelt werden.
Man könnte erwarten, dass die klassischen Historiker ein lebhafteres Interesse an Sprachunterschieden gehabt hätten, und in bestimmtem Grad ist das tatsächlich der Fall. Herodot, der Erste in der Tradition, notierte mit Interesse, dass man den Erdteilen, die doch eigentlich ein Ganzes bilden, drei Namen gegeben hat, und zwar Frauennamen: Europa, Asien, Libyen.[7] Darüber hinaus beobachtete er, dass offenbar von Kultur zu Kultur die gleichen Gottheiten jeweils unter einem anderen Namen wiedererscheinen.[8] Doch obwohl er es sich zur Aufgabe gemacht hatte, die Zeugnisse menschlicher Verschiedenheit zu untersuchen, sah Herodot keine Notwendigkeit, irgendeine Erklärung dafür zu wagen, und er lieferte auch keinen Kommentar zu der Verbreitung scheinbarer Synonyme unter den Völkern der Welt. Man hätte sich schon fragen können, wie es kommt, dass verschiedene Gemeinschaften die gleichen Dinge mit so vielen verschiedenen Namen benennen, selbst wenn man nicht so weit gegangen wäre, die grundlegende und unvermeidliche Frage zu stellen: Welchen Sinn soll man der Tatsache geben, dass das menschliche Sprachvermögen nur in einer Vielzahl von Sprachen Ausdruck findet?
Es wäre natürlich unwahr zu behaupten, die Denker der klassischen Welt hätten das Problem der Sprachunterschiede schlicht ignoriert. Hinweise auf dialektale und sprachliche Verschiedenheiten lassen sich mühelos finden, und gelegentlich taucht die Frage nach der Pluralität sogar in philosophischer Form auf. Zum Beispiel scheint Demokrit, der frühe Atomist, die Vielzahl von Sprachen für ein Phänomen gehalten zu haben, das der wissenschaftlichen Analyse bedarf. Diodor zufolge sprach der Materialist diese Frage in einem heute verlorenen Buch an; er behauptete, die Sprachvariationen ergäben sich aus Unterschieden von Geographie und Klima.[9] Aber seine Erörterung, wenn es sie denn tatsächlich gab, stellte eher die Ausnahme als die Regel dar. Der Augenschein zeigt, dass die klassischen griechischen und römischen Denker Sprache weitgehend für etwas hielten, von dem ihre Pluralität gleichsam subtrahiert werden kann, und wenn nicht in der Realität, so doch gewiss im Rahmen der theoretischen Spekulation. Sie räumten der Tatsache, dass Sprache immer in Sprachen verteilt ist, nur geringe Bedeutung ein. Zumindest insoweit war ihre Auffassung nicht unvereinbar mit derjenigen der Bibel, die auf das spätere Denken über das Wesen des sprechenden Tiers so großen Einfluss ausüben sollte. Dem Autor der Genesis zufolge gab es eine Zeit, in der »alle Welt einerley zungen vnd sprache [hatte]«. In göttlicher, vorgeschichtlicher Zeit konnte Sprache also vom Unterschied der Sprachen säuberlich geschieden werden. Die Verwirrung kam erst später.[10]
Heute gibt es natürlich eine Form der Forschung und des Wissens, welche die Diversität der Sprachen als grundlegend betrachtet: die Wissenschaft der Sprache. Die Linguistik muss als Axiom einräumen, dass es nicht nur eine Unterscheidung zwischen Sprache und Nichtsprache, sondern auch eine zwischen einer Sprache und einer anderen gibt. Gewiss, Linguisten können diese Unterscheidung auf mehrere Arten definieren, indem sie beispielsweise bestehende soziologische Bestimmungen anerkennen, etwa die Kennzeichnungen als Nationalsprache oder Dialekt, oder indem sie diese Unterscheidung im Bewusstsein von Gruppen sprechender Subjekte zu fundieren versuchen. Doch so viel muss die Linguistik zugeben: dass es systematische formale Unterschiede zwischen Sprachen gibt. Jede grammatische Analyse im traditionellen Sinne wird diese Tatsache bestätigen.
Doch wenn sich die Linguistik von der Grammatik im alten Sinne unterscheidet, dann eben darin, dass sie von der Verschiedenheit solcher Idiome zu allgemeineren Betrachtungen übergeht. Unter der Voraussetzung, dass es verschiedene Sprachen gibt, die Eigenschaften teilen, welche – einmal abstrahiert und kombiniert – das Sprachvermögen definieren, können Linguisten zum Beispiel historische und genetische Beziehungen zwischen Sprachen herstellen: Derivationen und Divergenzen, Ähnlichkeiten und Unähnlichkeiten. Gelegentlich kann die Linguistik so eine klare historische Antwort auf das Rätsel der sprachlichen Diversität geben: Man kann zeigen, dass sich zahlreiche Einzelsprachen von einer Sprache herleiten lassen. Die indoeuropäische Philologie liefert das vielleicht überzeugendste Beispiel dafür. Durch genaue Untersuchung der distinktiven Merkmale einer Menge europäischer und asiatischer Sprachen gelang es den Gelehrten des neunzehnten Jahrhunderts, eine Reihe verblüffender Korrelationen aufzudecken, die eine gemeinsame, für uns verlorene Quelle annehmen lassen: das »Indogermanische«, wie es damals bezeichnet wurde, oder »Proto-Indoeuropäische«, wie es die Fachgelehrten heute lieber nennen.
Die Strenge einer solchen wissenschaftlichen Forschung hängt jedoch von den Grenzen ab, die sie sich selbst setzt. Kein ernstzunehmender komparatistischer Linguist hat je zu behaupten versucht, alle Einzelsprachen gingen aus einer einzigen Quelle hervor, und zwar aus sowohl methodologischen wie materiellen Gründen. Die vergleichende Sprachanalyse beruht auf der Annahme, dass sich Sprachen generell in ihren Regeln und Elementen unterscheiden. Nur aus dieser Perspektive sind Korrelationen und Analogien signifikant. Wenn zum Beispiel gemeinsame Merkmale des Griechischen und des Sanskrit oder des Altirischen und des Lateinischen auffällig und erklärungsbedürftig sind, so deshalb, weil sie im Prinzip unerwartet sind. Nur wo die natürliche Diversität der Idiome zu fehlen scheint, wird man daran denken, Argumente für eine gemeinsame Quelle vorzubringen. Und man sollte hinzufügen, dass offenbar nur wenige Sprachen in einer solchen Form aufeinander bezogen sind. Es gibt viele europäische und indische Sprachen, etwa das Baskische, Ungarische und die zahlreichen dravidischen Sprachen, die sich auf die »indoeuropäische« Gruppe eindeutig nicht zurückführen lassen. Es gibt, wichtiger noch, ganze Gruppen und »Familien« von Idiomen, die keine wesentlichen genetischen Verbindungen untereinander aufzuweisen scheinen. Die afroasiatischen oder »hamitisch-semitischen« Sprachen zum Beispiel scheinen weder von derselben »Protosprache« abzustammen wie das Indoeuropäische, noch kann man beweisen, dass sie sich von denselben Wurzeln wie das Altaische, das Sinotibetanische oder die irokesischen Sprachen herleiten, um nur einige Beispiele aus vielen möglichen auszuwählen. In der linguistischen Forschung bleibt die grammatische Diversität ein Faktum, das man voraussetzen muss. Nur in Ausnahmefällen ist es erklärbar.
Wenn sie ein einziges Objekt besitzen soll, muss die Sprachwissenschaft deshalb durch Abstraktion von Sprachen zu Sprache übergehen: zu dem Vermögen zu sprechen. Dieser Übergang mag durchaus an den Schluss erinnern, mit der die Philosophen der Antike von einer einzelnen Sprache, dem Griechischen, zu einem allgemeinen Prinzip, dem logos, übergingen. Die Linguistik hat jedoch aus diesem Verfahren den ersten Schritt der Begründung einer neuen Forschungsmethode gemacht, die zu einer wichtigen sprachwissenschaftlichen Entdeckung geführt hat. Sie ist es wert, heute in Erinnerung gerufen zu werden, schon deshalb, weil sie offenbar zunehmend in Vergessenheit gerät. Seit dem Auftauchen der komparativen Grammatik im neunzehnten Jahrhundert hat die Sprachwissenschaft immer präziser gezeigt, dass die Äußerungen sprechender Subjekte insgesamt systematisch eine begrenzte Menge formaler Regeln der Grammatik selbst dort befolgen, wo die sprechenden Subjekte selbst keine bewusste Kenntnis davon haben: syntaktische Regeln, die die Anordnung von Satzstrukturen unabhängig von ihrem Inhalt vorschreiben; morphologische Regeln, die die möglichen Formen festlegen, die Ausdrücke innerhalb von Redesequenzen annehmen können; schließlich phonologische Regeln, welche sich auf eine beschränkte Menge von Lauten beziehen, die als solche keine Bedeutung haben, die aber jeder Sprecher einer Sprache irgendwie zu ordnen, zu kombinieren und zu verstehen weiß.
Eines jedoch ist heute nicht weniger rätselhaft, als es in der Antike war: Sprechende Subjekte sprechen nur Sprachen, und deren Grundelement ist Undurchsichtigkeit. Natürlich kann ein Einzelner durch Übung und Vertrautheit die Dunkelheit unbekannter Idiome teilweise zerstreuen, doch im Allgemeinen scheinen sich fremde Sprachen den sprechenden Subjekten gegen Verständnis und Aneignung zu sperren. Man kann sogar in der elementaren Wahrnehmung von Unverständlichkeit den einfachsten Index für den Unterschied von Sprachen sehen. Zwei Sprachen lassen sich als verschieden betrachten, wenn ihre jeweiligen Sprecher unter Verwendung ihrer jeweiligen Idiome bei dem Versuch, einander zu verstehen, systematisch scheitern. Man kann daher gemäß einer alten philosophischen Tradition die These vertreten, dass es Sprache von dem Moment an gibt, in dem es Bedeutung, Denken und artikulierte Intention gibt. Man kann auch einräumen und damit die Gültigkeit der linguistischen Forschung bestätigen, dass es Sprache von dem Moment an gibt, in dem man in einem einzelnen Idiom ein endliches grammatisches System entdeckt, das sprechende Subjekte unwissentlich befolgen, wenn sie eine Unendlichkeit von Äußerungen hervorbringen. Gleichwohl kann man sicher sein, dass es Sprachen – im Plural – gibt, wenn solche Weisen des Verstehens systematisch zum Erliegen kommen, weil Regeln zur Bildung korrekter Äußerungen in einem Idiom mit denen in einem anderen kollidieren. Sprache in ihrer Singularität lässt sich als eine Verständigungsweise auffassen, die alle Menschen als Mitglieder einer vernünftigen Spezies – oder Gemeinschaften, die sich durch die Befolgung grammatischer Regeln konstituieren – miteinander teilen. Aber Sprachen in ihrer Vielheit verweisen auf Undurchdringlichkeit und Inkommensurabilität, die zwischen den Sprechenden unaufhörlich Trennungen schaffen.
Am deutlichsten zeigt sich der Riss, der durch Sprachen entsteht, immer dann, wenn sprechende Gemeinschaften, die in Kontakt miteinander treten, entdecken, dass ihre Idiome, die als Kommunikationsmittel sonst einigermaßen verlässlich sind, jegliches Verständnis verwehren. Es war immer bekannt, dass unter solchen Umständen wenig weniger beredsam ist als die Rede; dass wenig so hartnäckig unverständlich – mit einem Wort, weniger sprachähnlich – ist als eine Sprache. Was könnte per se unergründlicher sein als die Bedeutungen, die in einem unbekannten Idiom verschlossen sind, in Sätzen, Wörtern oder gar so kleinen Lautierungen wie einem Wechsel in der Vokalquantität, einer Erhöhung oder Senkung der Tonhöhe, in der Hinzufügung einer Aspiration zu einer Kette von Konsonanten und Vokalen, etwa der des Buchstabens h? Wer eine Sprache spricht, weiß irgendwie, dass solche Elemente allentscheidend über Bedeutungen sein können, die auf die physischen Merkmale des Sprechens nicht zurückgeführt werden können. Verschiedene Denker haben deshalb von jeher empfohlen, man solle, wenn man mit der Pluralität der Idiome konfrontiert ist, Wortsprachen beiseitelassen. Klüger sei es dann, sich Ausdrucksformen zuzuwenden, die von grammatischen Subtilitäten unbelastet sind: Formen wie der Gestik, der »allen Menschen gemeinsame Rede« (ominium hominum communis sermo),[11] wie Quintilian schrieb, der »Pantomime«, die Rousseau für älter und vorrangig gegenüber den Einzelsprachen hielt,[12] dem Tanz, der Bedeutungen ohne Worte vermitteln kann, wie Lukian glaubte,[13] oder der Musik, die so oft als universelles Ausdrucksmittel gepriesen wurde.
In Wahrheit braucht man aber nicht auf Begegnungen zwischen verschiedenen sprachlichen Gemeinschaften zu blicken, um den Beweis dafür zu finden, dass die Idiome die sprechenden Subjekte einander undurchdringlich werden lassen. Es gibt Gelegenheiten, bei denen Sprachverwirrung sich innerhalb der Grenzen dessen bemerkbar macht, was in allen anderen Hinsichten ein einzelnes grammatisches System zu sein scheint. Dann lässt sich eine neue und unerwartete Entzweiung beobachten.
Es ist dies nicht nur eine Folge des beständigen sprachlichen Wandels, der bestimmt, dass in der Rede, wie Dante schrieb, »jede Variation als solche variiert«,[14] so dass von Zeit zu Zeit eine einzelne Sprache denen, die Gebrauch von ihr machen möchten, immer opaker wird. Man muss noch einen grundlegenden Aspekt des Sprachvermögens berücksichtigen, der bei den Philosophen und Linguisten nicht die Aufmerksamkeit gefunden hat, die ihm gebührt. Zu den Fähigkeiten, die im Sprachvermögen implizit enthalten sind, gehört die allen sprechenden Subjekten – wenngleich in Grenzen – gemeinsame Fähigkeit, eine einzelne Sprache weiter zu zerlegen und neu zusammenzusetzen. Eine Sprache kann sich als solche gabeln, nicht nur weil es in ihrer Natur liegt, sondern auch willentlich und künstlich. Im privaten wie im öffentlichen Bereich behalten die Sprecher einer Sprache die Fähigkeit, aus ihrer Kenntnis von deren Grammatik die Elemente einer neuen und kryptischen Sprachvarietät zu gewinnen. Ein solcher »Dialekt« mag spielerisch oder ernsthaft sein, ein Geheimnis, das Kinder bei ihren Spielen teilen oder Erwachsene bei ihrer Arbeit. Er mag einzelne Wörter oder Sätze betreffen, Phoneme oder Flexionen, Formeln oder Sätze, einzeln oder verbunden. Er mag so fremd erscheinen wie eine Fremdsprache, nur leicht verschieden von dem Idiom, dem er entstammt, oder fast ununterscheidbar von der Sprache, aus der er gemacht wurde, so dass seine Merkmale ebenso unwahrnehmbar werden wie sein verborgener Sinn. Im Grenzfall kann die Existenz eines solchen okkulten Idioms selbst zweifelhaft werden, zur Hypothese eines verborgenen Gegenstands, die man bejahen oder verneinen kann. Der Möglichkeiten, die Sprache zu spalten, sind viele, gewiss nicht weniger zahlreich als ihre Anlässe. Doch jedes Mal wenn sich ein Idiom durch Bemühung und Geschick entzweit oder auch nur zu entzweien scheint, lässt sich die gleiche verblüffende Tatsache beobachten. Es scheint, dass Menschen nicht nur sprechen und Sprachen sprechen. Sie zerlegen und verstreuen sie auch mit aller Kraft ihrer Vernunft in die Laute und Buchstaben von Idiomen, die dadurch vielfältig und dunkel werden.
Zweites KapitelCoquillars
1890 erschien in den Mémoires de la Société linguistique de Paris ein Artikel des dreiundzwanzigjährigen Marcel Schwob, der zu dieser Zeit seine dichterischen und erzählerischen Werke, die ihn später bekannt machen sollten, noch nicht veröffentlicht hatte. Dieser Essay war die Untersuchung eines mittelalterlichen Manuskripts aus den städtischen Archiven von Dijon, das Schwob transkribiert, annotiert und mit einer Einführung versehen hatte. Von der Existenz dieses Kodex hatte er aus einer bibliographischen Notiz erfahren, die Joseph Garnier, Archivar der Côte-d’Or in Burgund, ihm 1848 gewidmet hatte. Garnier hatte entschieden, die von ihm bekanntgemachten Materialien nicht selbst im Einzelnen zu kommentieren, und der herausragende französische Philologe Francisque Michel, dem Garnier eines der vierzig Faszikel des Manuskripts gesandt hatte, hatte sich dazu ebenso wenig in der Lage gesehen. So wurde Schwob der Erste, der ein Bündel von Akten untersuchte, die sehr wahrscheinlich seit der Zeit ihrer Abfassung im fünfzehnten Jahrhundert unerforscht geblieben waren, und sein Essay enthüllte der Öffentlichkeit ihren merkwürdigen Inhalt.
Das Manuskript enthielt eine Gerichtsakte aus den Archiven der burgundischen Hauptstadt und befasste sich mit einer Gaunerbande, die im Jahr 1455 festgenommen, vor Gericht gestellt und verurteilt worden war. Die Vergehen, die den Übeltätern vorgeworfen wurden, scheinen auf den ersten Blick an sich nicht sehr bemerkenswert. Die Behörden verdächtigten die Vagabunden, in Dijon und der ländlichen Umgebung verschiedene Gewaltdelikte begangen zu haben: das Aufbrechen von Schlössern, Plünderung von Truhen, Raubüberfälle auf unglückliche Reisende, Ausplündern argloser Kaufleute, mit denen sie in Herbergen das Zimmer teilten. Es hieß, einige der Herumtreiber seien geschickt in den Künsten der Falschspieler und Schwindler gewesen; andere sollen um der Beute willen auch zum Mord bereit gewesen sein. Es bestand kein Zweifel, dass die Schurkenbande keine eigenen Reichtümer besaß. Doch da Armut bekanntlich die Mutter der Erfindung ist, hatten die Briganten eine geistreiche Technik entwickelt, die es ihnen ermöglichte, etwas in Beschlag zu nehmen, das sie und ihre Landsleute sonst gemeinsam besaßen. Diese Tatsache verlieh ihren zahlreichen Verbrechen eine gewisse Originalität. Bevor sie sich von den Bürgern, Klerikern und Adligen, unter denen sie lebten, irgendwelche wertvollen Güter aneigneten, hatten die burgundischen Banditen des fünfzehnten Jahrhunderts nach der Sprache gegriffen. Sie hatten die Umgangssprache ihrer Zeit in einen Jargon verwandelt, »eine exquisite Sprache«, wie die städtischen Behörden berichten, »die andere Leute nicht verstehen können« (un langaige exquiz, que aultres gens ne scevent entendre).[1]
An erster Stelle unter den Ausdrücken mit dunkler Bedeutung, die die Vagabunden geprägt hatten, stand der Name, mit dem sie einander erkannten: »Coquillars«, »Coquillarden«, »die Leute der Muschel«.[2] Die Auszüge aus dem Manuskript, das von Schwob veröffentlicht wurde, begannen mit einer Bemerkung über ebendiesen Terminus. »Es ist wahr, dass die vorerwähnten Personen untereinander eine gewisse Jargonsprache [certain langaige de jargon] und andere Zeichen haben, an denen sie sich gegenseitig erkennen; und diese Banditen nennen sich Coquillars, was in der Weise zu verstehen ist, dass sie ›die Muschelbrüder‹ sind, die, wie es heißt, unter sich einen König haben, der ›der König der Muschel‹ genannt wird.«[3] Erst nach dieser ersten Identifizierung berichtete das Manuskript im Einzelnen von den verschiedenen Verbrechen, für die die Coquillars verurteilt worden waren:
Es ist ebenso wahr, wie schon gesagt, dass einige der vorerwähnten Coquillars Schlösser, Koffer und Truhen aufbrechen. Andere sind Betrüger und berauben beim Wechseln von Münzen gegen Gold oder Gold gegen Münzen oder beim Kauf von Handelsware. Andere produzieren, tragen und verkaufen falschen Goldfaden oder falsche Goldketten. Andere tragen und verkaufen oder produzieren falsche Preziosen und behaupten, es seien Diamanten, Rubine und andere Edelsteine. Andere teilen in einem Wirtshaus das Zimmer mit einem Kaufmann, stehlen von ihren eigenen Dingen und denen des Kaufmanns, beklagen lauthals ihr Schicksal zusammen mit dem beraubten Kaufmann, während sie einen Kumpan haben, der für sie arbeitet und mit dem sie anschließend die Beute teilen. Andere betrügen beim Würfelspiel und gewinnen alles Geld derer, mit denen sie spielen. Sie kennen die Feinheiten des Kartenspiels und des Brettspiels, und niemand kann gegen sie gewinnen. Und was schlimmer ist, viele von ihnen sind Spione und lauern als Diebe und Mörder den Reisenden in den Wäldern und auf den Landstraßen auf. Man darf annehmen, dass sie dort ihr liederliches Leben führen. Haben sie all ihr Geld ausgegeben, brechen sie ohne irgendetwas auf, lassen manchmal sogar ihre Kleider zurück und kommen bald wieder, zu Pferde und wohlgekleidet, fein geschmückt mit Gold und Silber, wie schon gesagt.[4]
Man darf mit Sicherheit annehmen, dass all solche ruchlosen Taten schon vor dem Auftreten der Räuber belegt sind, die 1455 verurteilt wurden. Wohl deshalb hielten sich die städtischen Akten weniger bei den Taten der Coquillars auf als bei dem besonderen Mittel, das sie dabei anwandten. Die Gerichtsdokumente lassen keinen Zweifel daran, dass dieser Behelf ein sprachlicher und, genauer gesagt, einer der Benennung war. Jean Rabustel, öffentlicher Ankläger und Gerichtsbeamter am Gerichtshof der Grafschaft Dijon, machte das im Tenor seiner Anklageschrift gleich zu Beginn sehr deutlich: »Jede Gaunerei, die sie verüben, hat ihren Namen in ihrem Jargon, und niemand versteht ihn, der nicht zu ihrem verschworenen Haufen zählt oder dem er nicht von einem von ihnen offenbart wird.«[5]
Als Beweisquelle führte Jean Rabustel »Perrenet le Fournier« an, »Barbier, wohnhaft in Dijon, im Alter von ungefähr sechsunddreißig Jahren«. Perrenet sagte aus, er habe aus freien Stücken die Muschelbrüder aufsuchen wollen, selbstredend nicht, um sich ihrer perfiden Kumpanei ernsthaft anzuschließen, sondern um »bestimmte Geheimnisse herauszufinden, damit er gegen Täuschung gewappnet wäre, sollte er einmal dorthin geraten, wo böse Saat ausgesät wird«.[6] So konnte der Barbier die Tatsache bezeugen, dass die Coquillars »alle Angelegenheiten ihrer Sekte in ihrer Sprache ordentlich benennen, welche Angelegenheiten ihm von vielen von ihnen enthüllt wurden, die ihm nicht misstrauten, da er vorgab, ebenso raffiniert zu sein wie sie«.[7] Seine Auskünfte wurden von anderen Quellen bestätigt, etwa »Jean Vote, bekannt als ›der Auvergnate‹, Steinbrucharbeiter, wohnhaft in Dijon, ungefähr sechsunddreißig Jahre alt«.[8] Der Auvergnate bezeugte, dass es für jeden der üblichen Namen für ihre Tricks und Verbrechen in der Spezialsprache der Coquillars einen Geheimnamen gab, dessen Sinn die Briganten sorgsam für sich behielten.
»Wenn sie in ihrem vorerwähnten Jargon sprechen«, berichten die Quellen, »und einer von ihnen sagt ein wenig zu viel an einem Ort, wo es Leute geben könnte, die ihnen schaden oder sie verraten könnten, so wird der Erste unter ihnen, der dies bemerkt, sich zu räuspern beginnen, in der Art eines Mannes, der an einer Erkältung leidet und seinen Speichel nicht hervorzubringen vermag.« Abrupt »verfällt dann jeder der Muschelbrüder in Schweigen oder wechselt das Thema und spricht von etwas anderem«.[9]
Doch manchmal entfleuchten die kostbaren Ausdrücke dennoch dem Gehege ihrer Zähne, und dann konnten Zuschauer und Lauscher in ihre Geheimsprache eindringen. Das burgundische Manuskript widmet größte Aufmerksamkeit der lexikalischen Information, die daraus zu gewinnen war. Nach einer summarischen Beschreibung der Vagabunden und der Arten ihrer Gewalttaten bot Jean Rabustel ein regelrechtes Glossar verborgener Begriffe und Phrasen, füllte Seite um Seite mit Definitionen der Ausdrücke, die die Coquillars geheim zu halten bestrebt waren. Er räumte ein, dass er mit seinen Bemühungen auf eine Synthese hinauswollte, und lieferte ein Kompendium von Termini, das strenggenommen kein einziger Muschelbruder verwendet hätte. »Die Vorerwähnten und andere Männer, die zur Bruderschaft der Coquillars gehören«, erklärte er, »haben viele Namen in ihrer Sprache, und sie verfügen nicht über sämtliche der Kenntnisse oder Gaunereien, die hier Erwähnung fanden«, denn manche sind »geschickt darin, etwas Bestimmtes zu tun«, und andere darin geübt, etwas anderes zu machen.
Als Erstes bot der öffentliche Ankläger eine Aufzählung der professionellen Tätigkeiten, in die sich die Klasse der Schurken unterteilen ließ: ein Katalog von noms de métier der obskursten und ungeheuerlichsten Sorte. Dann lieferte er einen umständlichen Schlüssel und erklärte in langer Reihe Satzteile sowie Namen:
Ein crocheteur ist jemand, der Schlösser aufbricht. Ein vendegeur ist ein Taschendieb. Ein beffleur ist ein Dieb, der Ahnungslose mit ins Spiel zieht. Ein envoyeur ist ein Mörder. Ein desrocheur ist jemand, der der Person, die er beraubt, nichts übrig lässt. […] Ein blanc coulon ist jemand, der mit einem Kaufmann oder jemand anderem übernachtet und ihm sein Geld, seine Kleider und alles, was er hat, raubt und es seinem Kumpanen, der unten wartet, aus dem Fenster wirft. Ein baladeur ist jemand, der zu einem Kirchenmann oder jemand anderem eilt, um ihm eine gefälschte goldene Kette oder einen falschen Edelstein anzubieten. Ein pipeur ist ein Würfelspieler oder Spieler eines anderen Spiels, bei dem mit List und Betrug gearbeitet wird. […] Fustiller heißt, die Würfel vertauschen. Den Gerichtshof eines Ortes nennen sie marine oder rouhe. Die Sergeanten nennen sie gaffres. […] Ein einfacher Mann, der nichts von ihren Gewohnheiten weiß, ist ein sire oder ein duppe oder ein blanc. […] Eine Tasche ist eine fellouse. […] Einen roy David machen heißt, ein Schloss, eine Tür, eine Truhe öffnen und wieder verschließen. […] Bazir heißt, jemanden töten. […] Jour ist die Folter. […] Wenn einer von ihnen sagt: »Estoffe!«, bedeutet das, dass er nach seinem Anteil aus gewissen Einkünften verlangt, die sich irgendwie aus dem Wissen der Muschel ergeben haben. Und wenn er sagt: »Estoffe, ou je faugerey!«, so heißt das, dass er jeden verraten wird, der ihm nicht seinen Anteil auszahlen wird.[10]
Diese Liste gibt nur eine Auswahl wieder, doch sie genügt, um einen Grundzug der Geheimsprache der Coquillars deutlich zu machen: nämlich dass sie in einer beabsichtigten Deformation der Sprache bestand, die im Spätmittelalter im nördlichen Frankreich allgemein üblich war. Die Wörter, die in den Gerichtsdokumenten enthalten sind, wären den Einwohnern Burgunds weitgehend bekannt gewesen, doch nicht in den Bedeutungen, die ihnen die Muschelbrüder gegeben hatten. Mit anderen Worten, die Schurken hatten bestimmte Wörter und Wortverbindungen ausgewählt, ihnen den gewöhnlichen Sinn entzogen und ihnen eine neue und undurchdringliche Bedeutung verliehen. Die Verfahren, mit denen sie die Bedeutungen von Begriffen veränderten, waren zahlreich. Es gibt mehrere Stränge, die einen mittelfranzösischen Ausdruck mit seinem Homonym im Jargon verbinden. In manchen Fällen lässt sich ein direktes lexikalisches Band entdecken, etwa wenn crocheteur, »Einbrecher«, denjenigen bezeichnen soll, »qui sait crocheter serrures«, »der Schlösser aufzubrechen versteht«. In anderen Fällen prägten die Coquillars ihre Begriffe mit raffinierteren rhetorischen Mitteln. Manchmal setzten sie Metonymien ein, etwa wenn sie den Gerichtshof als »Rad« (rouhe) bezeichneten, in Anspielung auf jenes Werkzeug, das sich im ungünstigen Falle durchaus als das ultimative Instrument ihrer Bestrafung erweisen konnte. Bei anderen Gelegenheiten arbeiteten sie mit Metaphern, etwa wenn sie das unschuldige Opfer ihrer betrügerischen Künste als dupe, »Tölpel«, bezeichneten oder auch als huppe, »Taube«, das heißt als einen Vogel, den man tötet und genüsslich verspeist.[11] Doch in vielen Fällen kann der Zusammenhang zwischen der gewöhnlichen Bedeutung eines Begriffs und seinem technischen Sinn zwar rückblickend verständlich erscheinen, aber von keiner vorliegenden Regel antizipiert werden. Die Möglichkeiten der Andeutung, Ersetzung und Abkürzung waren zu zahlreich. Man betrachte die exklamatorische Äußerung »Estoffe!« in dem von Rabustel angegebenen Sinn. Um dieses einzelne Wort als Kürzel für eine Aussage oder als Aufforderung zu verstehen, müsste man Prinzipien der Anspielung und der Trunkierung nach einem Muster auf es anwenden, das sich nicht ohne weiteres oder überhaupt nicht erahnen lässt.
Gewiss, die mittelalterliche Gerichtsakte machte sich nicht die Mühe, die verschiedenen Mechanismen zu analysieren, welche die Coquillars bei ihren Erfindungen benutzt hatten. Doch sie ließ keinen Zweifel über die Art der Sprache, die sie hervorbrachten, denn sie bezeichnete das Idiom der Banditen als langaige exquis, als einen im buchstäblichen Sinn gesuchten Diskurs (das Verb exquerre bedeutet ursprünglich »heraussuchen«) und im weiteren Sinne als »bemerkenswerten«, »raffinierten« und »kultivierten« Diskurs. Häufiger bezog sich das Manuskript auf das Idiom der Muschelbruderschaft mit einem hochambivalenten Begriff: jargon. Dieser Ausdruck des mittelalterlichen Französisch und seine zugehörigen Formen (jargoun, gargon, ghargun, gergon, gorgon) hatten lange Zeit nicht so sehr eine sinnvolle Rede wie vielmehr die Erzeugung von Geräuschen bezeichnet, die ihr ähneln, von animalischen Lauten bis zum Brabbeln, Plappern und Schwatzen.[12] In dem frühesten Beleg für das Wort, der vom Ende des zwölften Jahrhunderts datiert, benennt gagun zum Beispiel einen Akt sinnhaltiger, jedoch nichtmenschlicher Kommunikation: Zwitschern. In einer Fabel evoziert Marie de France eine Ratsversammlung der Vögel, auf der »alle in ihrem Jargon redeten und mit Vernunft ihre Sache vertraten« (Tuit diseient en lur gargun / e afermoënt par resun).[13] Drei Jahrhunderte später benutzte Charles d’Orléans das Nomen immer noch in einem ähnlichen Sinn: »Kein Tier, kein Vogel, der nicht in seinem Jargon singt oder ruft, wenn die Jahreszeit ihren Mantel von Wind, Kälte und Regen abgeworfen hat« (Il n’y a ne beste n’oyseau / Qu’en son jargon ne chante et crie: / Le tems a laissié son manteau / De vent, de froidure et de pluye).[14] Später sollte der Begriff in einem sekundären Sinn eine fremde und unverständliche »Zunge« bedeuten.[15] In Richars li Biaus, einer anonymen altfranzösischen Romanze aus dem dreizehnten oder vierzehnten Jahrhundert, erscheint das Wort in einer Bedeutung ähnlich derjenigen, in der es die burgundischen Beamten verwenden; es verweist auf eine eigentümliche Sprache der Diebe, die nur denen zugänglich ist, die mit ihren betrügerischen Künsten vertraut sind.[16]
Dass sich Marcel Schwob zu den burgundischen Briganten vor allem wegen der Sprache hingezogen fühlte, die sie erfunden hatten, ist aus dem Titel zu erschließen, den er seinem Essay von 1890 gegeben hatte: »Der Jargon der Coquillars im Jahr 1455«. Ein Jahr zuvor hatte er in Zusammenarbeit mit seinem Freund Georges Guieyesse als Beitrag für die Mémoires de la Société linguistique de Paris eines der ersten Werke geliefert, die die Methoden der modernen Sprachwissenschaft auf die besonderen Idiome anwandten, die von den gefährlichen Gesellschaftsklassen kultiviert werden: einen Aufsatz mit dem Titel »Studie über den französischen Argot«.[17] Schwob präsentierte seine Untersuchung über das mittelalterliche Manuskript aus den Archiven von Dijon als natürliche Fortsetzung dieses Essays. In seinen einführenden Bemerkungen wies er darauf hin, dass die Historiker des französischen Argots nur über eine geringe Zahl grundlegender Texte verfügten. Bis heute, schrieb er, bestünden die »Jargonquellen« im Wesentlichen aus ein paar wenigen literarischen und historischen Textgruppen, die einzelne Wörter oder Wortverbindungen enthalten. Dazu gehörte etwa der in mittelalterlichen Chroniken vorkommende Ausdruck marié, »der falsch interpretiert wurde und gehenkt bedeutet«; das Wort dupe, in einem Polizeidokument von 1426 aufgezeichnet und glossiert, als Name für das Opfer schurkischer Tricks; Formeln, die in spätmittelalterlichen Farcen, Liedern und Balladen von Verfassern wie Eustache Deschamps und Charles d’Orléans enthalten sind; und humoristische Lehrstücke von Autoren der Zeit vor Rabelais, etwa von Jean Molinet. In seinem kurzen Überblick über alte Jargonquellen nannte Schwob drei herausragende Textgruppen: die von Raoul Tanguy vor 1425 kopierten Manuskripte, die Werke von Deschamps, Jacques de Cessoles und Froissard enthalten; sechs in Jargon verfasste Balladen, die lange François Villon zugeschrieben wurden; und fünf Jargonballaden, die als Abschrift in einem Manuskript erhalten sind, das der Königlichen Bibliothek von Stockholm gehört und kurz zuvor von Auguste Vitu publiziert wurde, der ebenfalls Villon für den Verfasser hielt.[18]
Verglichen mit den Gerichtspapieren, die die Coquillars betreffen, erscheinen all diese dokumentarischen Quellen jedoch relativ unbedeutend, wie Schwob als Erster bemerkte. »Den Akten eines Kriminalprozesses, die in den regionalen Archiven von Côte d’Or erhalten geblieben sind«, erklärte er in seinem Vorwort, »ist es zu verdanken, dass ich heute die (mit Ausnahme der Balladen) wichtigste aller Quellen aus dem fünfzehnten Jahrhundert veröffentlichen kann, sowohl was die Zahl der behandelten Ausdrücke als auch was die Einzelheiten betrifft, die im Verlauf der Verhandlungen erwähnt wurden.«[19] Die Gerichtsakten waren unübertroffen in ihrem sprachlichen Reichtum und, worauf Schwob hinwies, nur mit den sechs Balladen vergleichbar, die traditionell Villon zugeschrieben werden. Gewiss enthielten jene mittelfranzösischen Epen mindestens ebenso viele Evokationen der dunklen Gaunersprache wie die burgundischen Gerichtsakten. Doch es war Jean Rabustel, der Ankläger von Dijon, der sich die Mühe gemacht hatte, jede obskure Benennung, jede dunkle Wortverbindung zu glossieren, Kommentare und Umformulierungen für die Ausdrücke der Banditen zu liefern. Niemand sonst ließ so viel grammatische Sorgfalt walten, auch jener Autor nicht, der das Geschick besaß, die geheimen Jargonwörter in Verse und Strophen zu bringen.
Schwob äußerte sich nicht zu der unverkennbaren, ja überraschenden Koinzidenz zwischen den Interessen des Anklägers und denen des Philologen, des Juristen und des Linguisten. Ihm kam es wohl hauptsächlich auf die Verbindung zwischen dem Dichter und den Banditen an. Bei der Edition der Akten zum Prozess gegen die Coquillars betonte Schwob vor allem diese beiden Punkte: das Alter dieser Jargonquelle und die Tatsache, dass sie neues Licht auf einen Dichter warf, der für ihn »den höchsten poetischen Ruhm in seinem Jahrhundert erlangte«.[20] In Wahrheit aber betrafen Schwobs Funde vor allem die Werke Villons, die traditionell als die am wenigsten ruhmreichen galten: nicht das Große oder das Kleine Testament oder sonst eines der bemerkenswerten Gedichte, derentwegen Villon so geliebt wurde, sondern die sechs (und vielleicht elf) Balladen, die in dem fremdartigen und scheinbar hermetischen Gauner-Argot verfasst wurden.
Bereits 1489 in der ersten gedruckten Ausgabe der Werke des Dichters hatte Pierre Levet diese Texte von den übrigen abgetrennt und nannte sie »Balladen im Jargon der Gauner und Falschspieler« (Ballades en jargon et jobelin). Es war offensichtlich, dass sie alle an Verbrecher verschiedener Arten und Spezialitäten gerichtet waren, nicht zuletzt das zweite in der Reihe, das mit einer dunklen, wenngleich unverkennbaren Anrede an die Muschelbruderschaft begann: »Coquillars enruans à ruel.«[21] Und jahrhundertelang hatte kaum jemand bezweifelt, dass das seltsame Idiom dieser sechs Balladen den wohlweislich undurchdringlichen Jargon von Schurken evozieren sollte. Doch der Status dieser merkwürdigen poetischen Sprache war Gegenstand beträchtlicher Auseinandersetzungen.
Villons frühe Leser waren offenbar geneigt, die Rede der Balladen trotz der möglicherweise peinlichen Konsequenzen, die eine solche Lektüre für die Biographie des Dichters einschloss, als getreue Wiedergabe der Sprechweise mittelalterlicher Schurken zu betrachten. Als er daranging, eine Gesamtausgabe von Villons Werken im sechzehnten Jahrhundert herauszugeben, rühmte Clément Marot »die alte und vornehme Sprache« von Villons großen Dichtungen, wovon er die sechs Balladen ausnahm, die zu edieren er sich weigerte. »Was den Jargon angeht«, kommentierte er, »überlasse ich alle Korrekturen und Kommentare Villons Nachfolgern in der Kunst von Zange und Brecheisen« (Touchant le jargon, je le laisse à corriger et exposer aux successeurs de Villon en l’art de la pinse et du croq).[22] Geoffroy Tory, der zur selben Generation gehörte, war nicht weniger streng. Gleich auf der ersten Seite seiner Abhandlung Champ fleury verurteilte er »drei Arten von Menschen, die darin wetteifern, die Sprache zu verderben und zu entstellen«: »solche, die das Französische latinisieren, Witzbolde und jargonneurs«. Er räumte jedoch sofort ein, dass sich unter den dritten ein Dichter befunden habe: »Wenn jargonneurs ihren tückischen Jargon und ihre verderbte Sprache von sich geben«, schrieb er, »zeigen sie, wie mir scheint, nicht nur, dass sie für den Galgen bestimmt sind, sondern dass sie besser gar nicht geboren wären. Ich gebe zu, dass Meister François [Villon] zu seiner Zeit höchst erfinderisch war; gleichwohl hätte er besser daran getan, sich für etwas anderes, Besseres anzustrengen.«[23] Villons spätere Leser brachten oft eine ähnliche Unzufriedenheit mit den ungebärdigen Balladen zum Ausdruck, die manche Herausgeber in ein der Standardsprache näheres Französisch zu übersetzen beliebten. Einige leugneten, dass diese Gedichte tatsächlich authentische Werke des Verfassers des Kleinen und des Großen Testaments seien. Andere behaupteten, ihre Sprache sei weniger die Wiedergabe irgendeiner historisch belegten Sprechweise als vielmehr eine bizarre und barocke Erfindung: »eher eine Einbildung des Dichters«, wie Lucien Schöne 1888 argumentierte, »als das einzigartige Monument einer verschwundenen Sprache«.[24]
Schwobs Edition der Akten von 1455 und seine Studie dazu setzten dieser Debatte ein Ende. In einem Vortrag, den er 1890 vor der Académie des Inscriptions et Belles-Lettres hielt, führte er einen strengen philologischen Beweis, dass das Idiom der Balladen weitgehend dasjenige der in Dijon verurteilten Coquillars war. Natürlich konnte man weiterhin historische und biographische Indizien im Werk des Dichters daraufhin interpretieren, in welcher Verbindung Villon mit der Muschelbruderschaft mutmaßlich gestanden hatte. Schwob selbst versuchte nichts anderes in seinem »Phantasieleben« des Dichters aus dem fünfzehnten Jahrhundert. Doch so viel war von nun an gewiss: Die Tatsache der sprachlichen Identität ließ sich einwandfrei bestätigen. Schwob zeigte, dass nicht weniger als vierundzwanzig der dunklen Ausdrücke in den Gedichten auch in den burgundischen Prozessakten vorkamen, wo sie erklärt und von einer Sprachregion in die andere übersetzt worden waren. »Da diese Wörter mehrfach wiederholt werden«, fuhr Schwob fort, als wolle er durch eine höhere Zahl der lexikalischen Einheiten seinen Beweis verstärken, »bilden sie eine Summe von achtundfünfzig Ausdrücken, über deren Nuancen und Etymologie man allenfalls künftig noch diskutieren kann, während ihre Bedeutungen eindeutig feststehen.«[25] »Die Tatsache, dass eine so große Zahl von Wörtern der Sprache Villons und derjenigen der Coquillars gemeinsam sind«, schloss er, »zeigt hinreichend, dass diese Stücke wahrhaftig im Gaunerjargon geschrieben wurden.«[26]
Nun erhob sich jedoch eine grundlegende Frage, die mit strenger historischer und philologischer Beweisführung allein nicht zu lösen war. Schwob hatte das älteste und wichtige Zeugnis für das geheime Idiom der Schurken ausgegraben; er hatte darüber hinaus gezeigt, dass es zum Medium des Werkes eines Dichters werden sollte. Aus seiner Forschung konnte man den Schluss ziehen, dass »die Kunst von Zange und Brecheisen« und die Verskunst strikt untrennbar geworden waren, nicht langsam oder allmählich, sondern fast unmittelbar und innerhalb der ersten Jahre, in denen die Gaunersprache offenbar entstanden war. Die Verbindung dieser beiden Künste hätte kaum rascher geschehen können. Doch welchen Sinn sollte man dem geben? Man könnte natürlich annehmen, dass die Begegnung der Idiome des Dichters und der Vagabunden so einmalig war wie das Œuvre Villons, Ausdruck einer einzigartigen Biographie oder Berufung oder beider. Vielleicht war es nicht mehr als ein zufälliges Vorkommnis, das eine künstliche Sprache in die Nähe einer anderen brachte oder sie gar mit ihr vereinte. Man kann aber auch umgekehrt argumentieren, freilich auf die Gefahr hin, nach einer Wahrheit zu suchen, wo nur ein Zufall ist. Könnte es irgendeine verborgene Verbindung zwischen zwei hermetischen Formen der Rede geben, die aus dem Vers eine Art Ganovensprache oder aus dem Jargon eine Art Dichtung macht? Diese Frage lässt sich schwerlich vermeiden, auch wenn Schwob seinerseits genau das getan zu haben scheint. Wegen seiner wissenschaftlichen Methode, seines schriftstellerischen Könnens oder weil ihm nur noch wenige Lebensjahre vergönnt waren, zog Schwob nicht die Konsequenzen aus seiner Entdeckung. Heute, über ein Jahrhundert später, sind sie daher immer noch zu entfalten.
Drittes KapitelPrinzipien der Gaunersprache
Abb. 2: Richard Head, The Canting Academy, zweite Auflage, London 1674
Unsere Sprache besitzt mehrere Wörter für kleinere Varietäten der Standardsprache. »Slang« bezieht sich auf Wörter und Sätze, die innerhalb einer Einzelsprache bestimmten Segmenten der Gesellschaft zugehören, die durch Stellung, Klasse und Gruppe definiert sind. Solche Ausdrücke sind tendenziell kurzlebig, ihr Schicksal ist an Moden gebunden. »Jargon« im üblichen englischen Wortgebrauch meint hingegen Ausdrücke und Formulierungen, die von Leuten verwandt werden, die Praktiken, Tätigkeiten oder Fachkenntnisse miteinander teilen. Solche Arten der Sprache werden gewöhnlich wissentlich oder unwissentlich von jenen benutzt, die im Besitz bestimmter Künste und Fertigkeiten sind – Handwerker und Ärzte, Studenten und Lehrer. Doch es gibt noch eine dritte Sprachvarietät, die sich vom Slang wie vom Jargon unterscheidet. Seit der Renaissance wird sie im Englischen als cant bezeichnet, ein Ausdruck, der offenbar eine anglisierte Form des lateinischen Wortes für Kirchengesang, cantus, darstellt.[1] Dieses Wort bezieht sich auf eine dunkle Art der Rede, die vor allem im Dienste des Verbrechens benutzt wird. »Cant«, schrieb eine Historikerin kürzlich in einer Untersuchung zu diesem Thema, »geht einen Schritt weiter als jargon. Sein primärer Zweck ist zu täuschen, zu betrügen und zu verschleiern. Es ist die Sprache, die von Bettlern und Verbrechern verwandt wird, um ihr ruchloses und gesetzwidriges Tun vor potentiellen Opfern zu verbergen. Gelegentlich wird es als abwertendes Synonym für jargon benutzt und auf andere Gruppen, namentlich religiöse Heuchler, manchmal auch auf Immobilienmakler angewandt.«[2]