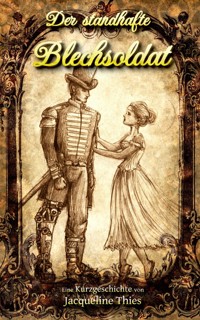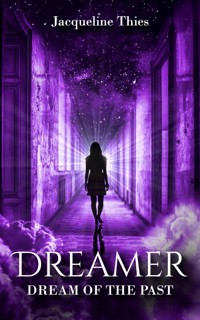Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: epubli
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Verflucht zu begehren. Verbunden durch das, was sie zerstört. Als die sechzehnjährige Lil gegen ihren Willen in ein Mädcheninternat geschickt wird, gerät ihre Welt aus den Fugen. Dort erfährt sie das Unfassbare: Sie ist eine Succubus - gezwungen sich von sexueller Energie zu ernähren. Während ihre Freundin Malorie scheinbar mühelos ihre Rolle im Zirkel des gehörnten Gottes einnimmt, fühlt Lil sich zerrissen zwischen Scham, Sehnsucht und einer dunklen Begierde. Es ist ihr Fluch, der sie zwingt Grenzen zu überschreiten, die sie alles kosten könnten, was wichtig ist. Und plötzlich werden aus Opfern Täter. Ein atmosphärischer Young-Adult-Roman über Freundschaft, dunkle Begierde und die Frage, wie weit man bereit ist zu gehen, um sich selbst zu retten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 371
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Der gehörnte Gott
Von Jacqueline Thies
Verflucht zu begehren.
Verbunden durch das, was sie zerstört.
Als die sechzehnjährige Lil gegen ihren Willen in ein Mädcheninternat geschickt wird, gerät ihre Welt aus den Fugen. Dort erfährt sie das Unfassbare: Sie ist eine Succubus - gezwungen sich von sexueller Energie zu ernähren. Während ihre Freundin Malorie scheinbar mühelos ihre Rolle im Zirkel des gehörnten Gottes einnimmt, fühlt Lil sich zerrissen zwischen Scham, Sehnsucht und einer dunklen Begierde. Es ist ihr Fluch, der sie zwingt Grenzen zu überschreiten, die sie alles kosten könnten, was wichtig ist. Und plötzlich werden aus Opfern Täter.
Ein atmosphärischer Young-Adult-Roman über Freundschaft, dunkle Begierde und die Frage, wie weit man bereit ist zu gehen, um sich selbst zu retten.
Von Jacqueline Thies
Texte, Cover und Layout:
© Copyright by Jacqueline Thies
1. Auflage, Oktober 2025
© 2025 Alle Rechte vorbehalten.
Selfpublisher:
Jacqueline Thies
Horather Straße 161
42111 Wuppertal
Druck:
Papyrus Testverlag, Berlin – ein Service der neopubli GmbH, Berlin
Logo: Florin Sayer-Gabor – www.100covers4you.com
Triggerwarnung
Dieses Buch enthält teilweise explizite Darstellungen von Gewalt und sexuellem Missbrauch. Solltest du dich beim Lesen übermäßig unwohl fühlen oder merken, dass bei dir belastende Gedanken oder Bilder auftauchen, dann schäme dich nicht, dir Hilfe zu holen oder mit einer Vertrauensperson zu reden.
Für alle,
denen die freie Entscheidung über ihren Körper genommen wurde.
Es war nie eure Schuld.
Ihr seid immer noch wertvoll.
Vergesst das nie.
Für meinen Mann,
weil wir so viel gemeinsam durchgestanden haben.
Ohne dich hätte ich es nicht geschafft.
Prolog
Mein Körper sieht blass aus im Mondlicht. Wäre er nicht so heiß, könnte man glauben, er wäre aus Eis. Ich liege nackt auf meinem Bett und betrachte mich. Meine Hände gleiten zwischen meinen Schenkeln auf und ab.
Auf und Ab. Immer schneller reiben meine Finger und ich beginne zu stöhnen. Leise. Verstohlen. Ich will nicht, dass Dad mich hört.
Wobei er sowieso nicht ins Zimmer kommen würde. Und ich nicht hinaus. Er hat mich bis zum nächsten Morgen eingeschlossen. Zu meinem Schutz, wie er sagt. Seit drei Jahren macht er das in jeder Vollmondnacht. Und mittlerweile bin ich froh darüber.
Mein Körper glüht im Mondlicht, welches durch das geöffnete Fenster fällt. Ich spüre die kühle Nachtluft und schwitze doch vor Hitze und Erregung. Es ist, als würde mein Körper in Flammen stehen. Und ich tue das Einzige, was das Brennen in mir lindert.
Meine Finger treiben mich zum Höhepunkt. Gleiten an mir, in mir. Mein Körper bäumt sich mit einem nicht einhaltbaren Stöhnen auf. Meine Beine zucken bis in die Fußsohlen. Meine Augenlider flackern. Trotzdem sehe ich die dunkle Atemwolke über mir aufsteigen. Grauschwarz wie Rauch.
Die Hitze lässt nach. Ich bleibe nackt im Bett liegen bei geöffnetem Fenster. Diese Nacht wird niemand mehr in mein Zimmer kommen. Ich schließe die Augen und endlich kann ich schlafen.
Kapitel 1
Es ist halb zehn an einem Montagmorgen und meine Matheaufgaben verspotten mich. Trigonometrie ist echt nicht meine Stärke. Resignierend lasse ich den Kopf auf den Küchentisch sinken. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich einmal nach meiner alten Mathelehrerin aus der siebten Klasse sehnen würde. Nach dieser stocksteifen Vogelscheuche, die einen tadelnd über ihre Geiernase hinweg ansah, wenn man Nenner und Teiler vertauschte. Jetzt würde ich mich freuen, in ihrer Klasse zu sitzen. Oder überhaupt in irgendeiner Klasse. In irgendeiner Schule. Doch ich sitze in der Küche und statt eines Lehrers ist da nur Dad.
»Lil, ich glaube nicht, dass du die Rechnung besser verstehst, wenn du deine Nase aufs Papier drückst«, ruft Dad von der Küchenzeile, wo er gerade das Geschirr von Hand spült.
»Immerhin auch nicht schlechter«, gebe ich zurück, hebe aber den Kopf an. »Kannst du es mir bitte noch mal erklären?«
Dad wendet sich zu mir um. Er ist kein großer Mann, aber er hat eine kraftvolle Ausstrahlung. Ein ernster Blick aus grauen klaren Augen, ein markantes Kinn und breite Unterarme an dessen Haaren der Schaum vom Geschirrspülen hängt.
»Ich habe es dir bereits dreimal erklärt. Du musst es nur genauso machen, wie ich es dir gezeigt habe.«
»Das mache ich doch.« Ich will nicht genervt klingen. Na gut, vielleicht ein bisschen. Aber wie soll man auch nicht genervt sein, wenn man seit einer Stunde auf einem unbequemen Holzstuhl sitzt und versucht, Winkel in Dreiecken zu berechnen? »Aber wenn ich es genauso mache, wie du sagst, komme ich nicht auf die Werte aus dem Lösungsbuch.«
Dad zuckt gleichmütig mit den Schultern.
»Dann musst du eben so lange rechnen, bis du den Fehler gefunden hast.«
Er ist kein sonderlich zugewandter Lehrer, wenn auch kein schlechter. Dafür hat er schon zu viele Konfirmandengruppen geleitet. Früher.
»Oder ich schreibe einfach die Lösungen aus dem Buch ab«, versuche ich es frech.
»Lil«, warnt mein Vater.
Er nennt mich immer Lil. Nie bei meinem vollen Namen. Nicht einmal wenn er wütend ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er den Namen, den meine Mutter für mich ausgesucht hat, nicht leiden kann. Wahrscheinlich klingt er geradezu blasphemisch in seinen Ohren.
Lilith, die Nachtdämonin. Die Versucherin. Sie war die erste Frau Adams, die ihm den Gehorsam verweigerte, woraufhin sie aus dem Paradies verbannt wurde und sich den Dämonen hingab in ihrer Wollust. Kein guter Name, wenn man die Tochter eines ehemaligen Pastors ist. Also bin ich für ihn nur Lil.
Ich seufze und beuge mich schicksalsergeben zurück über meine Aufgaben. Wahrscheinlich wird Dad irgendwann Erbarmen haben und mich an meinem Englischaufsatz oder den Physikaufgaben weitermachen lassen. Nicht dass das spannender wäre. Aber wie soll Homeschooling mit Dad auch spannend sein?
»Warum kann ich nicht wieder in die Schule gehen?«, frage ich, als ich die Winkelberechnung beim dritten Versuch zumindest teilweise lösen kann.
Leider ist seine Antwort so typisch Dad, dass ich mir die Frage lieber gespart hätte.
»Es ist gut, auf den Herrn zu vertrauen und nicht sich zu verlassen auf Menschen«, zitiert er irgendeinen Quark aus der Bibel.
»Ah, ja«, sage ich zweifelnd, »Und was soll mir das sagen?«
»Dass du darauf vertrauen kannst, dass es so besser für dich ist.«
Ich werfe meinen Stift härter als beabsichtigt auf den Tisch. Er rollt mit Schwung über die Kante.
»Es fühlt sich aber nicht besser an.« Meine Stimme wird laut und ich sehe Dads mahnenden Blick. Aber immer häufiger ist er mir egal. Der Blick und das alles hier. »Ich habe das Gefühl, mir fällt hier die Decke auf den Kopf. Ich wünschte, –«
Doch ich komme nicht mehr dazu, meine Wünsche zu äußern, denn in diesem Moment klingelt es an der Tür.
Dad wendet sich von mir ab und greift nach dem Küchenhandtuch.
»Wer kann das sein?«, fragt er, während er sich die Hände abtrocknet und in Richtung Tür läuft. Wie immer wirft er einen flüchtigen Blick durch das kleine Fenster neben der Haustür, bevor er nach der Klinke greift und sie öffnet.
Ich recke den Hals in der sinnlosen Hoffnung, dass es jemand Spannendes ist. Vielleicht Bauer Gregor mit einem seiner Söhne oder Katie, die früher Schulschluss hat und mich erlösen will. Doch es ist wie meistens nur Mrs. Collman die Postbotin.
»Guten Morgen, Mrs. Collman«, grüßt mein Vater gut gelaunt und lässt sie hinein.
Sie streicht sich die blonden Locken mit den leicht ergrauten Spitzen aus dem freundlichen Gesicht.
»Guten Morgen, Pater«, sagt sie mit einem Wimpernaufschlag.
Ich frage mich schon länger, ob sie nicht ein Auge auf Dad geworfen hat. Katie hat mich darauf aufmerksam gemacht. Auch darauf, dass es daran liegt, dass mein Vater nicht nur ledig, sondern wohl attraktiv für sein Alter ist. Nicht unbedingt das, worüber ich mir im Zusammenhang mit meinem Dad bisher Gedanken machen wollte. Mir doch egal, wie er aussieht. Aber eine Partnerin für Dad fände ich gut. Vielleicht würde ihn das von mir ablenken und von seinem Vorhaben, mich sittsam und christlich zu erziehen.
»Nennen Sie mich nicht Pater«, bittet Dad nicht zum ersten Mal. Es fällt den Leuten immer noch schwer, zu akzeptieren, dass er sein Priesteramt vor zwei Jahren niedergelegt hat. Meinetwegen, das weiß ich, auch wenn ich es nicht verstehe.
Mrs. Collman errötet leicht, was sie noch hübscher macht. »Entschuldigen Sie, Mr. Rogers.«
»Schon gut.« Mein Vater winkt ab. »Was haben Sie denn heute für mich?«
»Nur einen Brief«, sagt sie und wühlt in ihrer sperrigen Zustellertasche.
»Ich hoffe doch keine Rechnung«, scherzt mein Vater, der sonst immer wenig Spaß zu verstehen scheint.
Mrs. Collman schüttelt lächelnd den Kopf. »Keine Sorge. Rechnungen verbrenne ich immer sofort.«
Sie hat endlich den Brief gefunden und zieht ihn aus der Tasche. Ich sehe den weißen Umschlag und versuche, zu erkennen, von wem er ist. Die Schrift sieht aus wie aufgedruckt. Nicht geschrieben. Also eher kein privater Brief von alten Freunden oder Bekannten. Nicht dass wir viele davon hätten.
»Danke«, sagt Dad, doch das Lächeln ist aus seinem Gesicht verschwunden. Er dreht den Brief um und wirft einen Blick auf den Absender. Seine Stirn legt sich in Falten.
Wenn ich doch nur einen Blick auf den Brief werfen könnte. Nachfragen brauche ich nicht. Dad erzählt mir nie die spannenden Dinge. Die muss man schon selbst herausfinden in diesem Haus. Wie zum Beispiel die Sache mit der Periode und dem Kinderkriegen. Man was habe ich mir gewünscht, er hätte mich aufgeklärt, bevor er mich mit vollgebluteter Unterwäsche aus der Schule abholen musste. Das war nun fast drei Jahre her.
Mrs. Collman betrachtet Dad einen Augenblick neugierig, der jedoch ganz auf den Brief konzentriert ist. Dann sagt sie: »Wenn Sie noch etwas haben, was Sie zur Post bringen müssen, kann ich das gerne mitnehmen.«
»Hm.« Dad schreckt aus seinen Gedanken, dann schüttelt er den Kopf. »Nein, heute nichts. Danke.«
Damit ist das kurze Gespräch, das mich aus der alltäglichen Homeschooling-Tortur rettet, auch schon wieder vorbei und Mrs. Collman verabschiedet sich, um die nächsten Briefe zuzustellen.
»Von wem ist der Brief?«, versuche ich es nun doch, weil ich hoffe, noch ein paar Minuten herausschlagen zu können, bevor Dad auffällt, dass ich nicht weiter rechne.
»Nichts für dich«, sagt er nur und geht wieder zum Waschbecken. Statt jedoch, wie ich angenommen habe, weiter abzuspülen, legt er das Handtuch neben die Spüle und geht weiter, bis er vor seiner Arbeitszimmertür steht.
Er dreht sich zu mir um. »Ich muss eben etwas erledigen. Du machst so lange deine Aufgaben weiter, okay?«
Sein Verhalten irritiert mich so sehr, dass ich, ohne zu überlegen oder nur den geringsten Widerspruch einzulegen, nicke.
Dann ist Dad auch schon im Arbeitszimmer verschwunden und schließt die Tür hinter sich.
Es muss an dem Brief liegen, denke ich und will nur noch dringender wissen, wer geschrieben hat. Vielleicht ist es doch eine Rechnung. Rechnungen bedrücken Dad oft. Es sind einfach zu viele und ohne sein altes Priestergehalt ist das Geld manchmal knapp. Aber dann hätte Dad eher genervt reagiert. Vielleicht hätte er sogar darüber gemeckert, dass diese Hampelmänner, ein schlimmeres Schimpfwort hörte man nie von ihm, den Hals wohl nie voll bekamen. Doch das hatte er nicht. Also keine Rechnung. Was dann?
Ich grübele den ganzen Vormittag darüber. Während der gesamten Matheaufgaben, während des Englischaufsatzes und noch, als ich die Kartoffeln schäle, nachdem Dad mich darum bittet. Nach dem Mittagessen allerdings vergesse ich das Ganze schon wieder. Denn so ist mein Alltag nun einmal. So langweilig und stumpfsinnig, dass ein Brief von unbekannter Stelle das Spannendste ist was passiert. Und meist ist es dann doch nichts Interessantes. Dieses Mal sollte das anders sein.
Kapitel 2
»Du hättest sehen sollen, wie Kimberly rumgelaufen ist im Sportunterricht. Ihr Tanga hing ihr fast bis an die Rippen.«
Das glaube ich kaum, dennoch sauge ich die neusten Informationen aus der Schulwelt in mich auf. So wie jedes Mal, wenn ich mich mit Katie treffe. Meiner besten und leider einzigen Freundin. Aber wie soll ich auch Freunde finden, wenn ich nicht in die Schule darf?
»Die Jungs haben natürlich alle geglotzt.« Katie lacht, als sie den dummen Blick der Jungs nachmacht. »Wahrscheinlich hätten die nie einen Ball getroffen, wenn Mr. Smith sie nicht zur Sau gemacht hätte. Echt peinlich.«
Ich erwidere das Lächeln. Mehr weil es schön ist, wenn Katie strahlt, denn innerlich quält es mich zunehmend, dass ich all diese kleineren und größeren Highlights des jugendlichen Alltags verpasse. Scheinbar sieht man mir das an.
»Was ist los?«, fragt Katie und schlägt die Beine unter.
Wie so oft sitzen wir zusammen auf ihrem Bett mit Blümchenmusterbettwäsche und von allen Wänden starren uns Stars und Sternchen von ihren fünf Millionen Postern an. Wir essen Kekse, allerdings die ohne Schokolade, schließlich wollen wir nicht fett werden, tratschten und lachen und tauschen uns über unsere Woche aus.
Ich zögere einen Moment, gebe dann aber zu: »Es wird immer schlimmer mit Dad.«
Was nicht daran liegt, dass Dad sich irgendwie anders verhalten würde als in den Wochen und Monaten davor. Nur macht es mir immer mehr aus. Ich bin es die sich verändert. Ob das meinem Dad passt oder nicht.
»Will er dich immer noch nicht in die Schule lassen?«, fragt Katie und bricht ihren Keks in zwei Hälften, bevor sie sich die eine Hälfte in den Mund steckt. Eine wahrlich merkwürdige Angewohnheit.
Ich drehe meinen eigenen Keks appetitlos hin und her.
»Wenn es nach ihm geht, bleibe ich zu Hause, bis zu meinem Abschluss. Und ob ich danach an die High-School darf, bleibt fraglich.«
Ich wusste es auf jeden Fall nicht. Und Dad wollte nicht darüber reden. Lass uns am Ende des Monats reden, war seine Antwort auf meine Nachfragen. Und das seit zwei Jahren.
»Das ist doch nicht normal.« Katie gestikuliert mit der zweiten Kekshälfte in meine Richtung und krümelt dabei ihr Bett voll. »Ich meine, du bist sechzehn. Der muss echt lernen, loszulassen. Er kann dich ja nicht ewig einsperren.«
»Vielleicht«, sage ich nur. Denn ich bin mir da nicht so sicher.
Ich denke daran, wie er den Schlüssel erst vor wenigen Tagen umgedreht hat und meine Zimmertür verschlossen hat. Wie in jeder Vollmondnacht. Denke daran, warum er es tut. Doch ich kann es Katie nicht erzählen. Wie soll ich erzählen, dass ich in diesen Nächten den unwiderstehlichen Drang verspüre, mich zu berühren? In mich einzudringen.
Klar weiß ich, dass Sex kein Tabuthema bei Jugendlichen ist. Katie hat mir vor Kurzen selbst gestanden, dass sie und ihr Freund David überlegen, ES bald auszuprobieren, auch wenn sie unsicher ist, ob sie schon bereit dafür ist. Ich habe ihr zugehört und versucht, das Kribbeln zwischen meinen Beinen abzustellen. Meistens kann ich es unterdrücken. Außer in Vollmondnächten.
»Du musst doch lernen, mit anderen umzugehen, Kontakte knüpfen, Jungs kennenlernen«, redet Katie weiter, die nicht zu bemerken scheint, dass ich mit meinen Gedanken ganz, wo anders war.
Sicherlich nicht, was Dad will, denke ich, aber halte den Mund. Ich weiß, dass Jungs-Kennenlernen für Katie an oberster Stelle steht. Und ehrlicherweise würde ich gerne versuchen, mit Jungs Kontakt aufzunehmen. Oder sie zumindest heimlich anzuschmachten. Bisher bleiben mir nur die Bilder in den Jugendzeitschriften und die wenigen Fotos, die Katie mir ab und zu auf ihrem Handy zeigt. Ein eigenes besitze ich natürlich nicht.
»Wenn sich Jungs nicht plötzlich scharenweise im Sonntagsgottesdienst aufhalten, werde ich wohl keine mehr kennenlernen«, sage ich resignierend.
Der einzige Junge in meinem Alter, der sich ab und zu dorthin verirrt, ist Steven. Der pickelige Sohn unserer Küsterin. Nicht unbedingt jemand, den man angraben will. Trotzdem habe ich es in meiner Verzweiflung versucht. Bis Dad den armen Jungen so böse angesehen hat, dass der sich sicher sein musste, dass sich die Höllentore unter ihm auftun, wenn er nur einen weiteren Satz mit mir wechselt. Und so sitze ich weiter jeden Sonntag zwischen Rentnern und völlig verklärten Gottesheuchlern und betete für ein schnelles Ende der Veranstaltung.
»Was ist den mit der Mall?«, fragt Katie. Ihre Hand wandert schon wieder in die Kekstüte. Aber irgendwoher müssen die hübschen Rundungen an ihrem Körper ja kommen. »Kannst du nicht da versuchen, ein paar Jungs kennenzulernen? Dort treiben sich früher oder später eh alle rum.«
Was genau der Grund ist, warum Dad mich auch dorthin nicht mehr alleine gehen lässt. Wer wusste schon, welches Gesindel sich dort rumtrieb. Und ich habe sowieso zu abartige Ideen.
Abartige Ideen sind wohl Dads Ausdruck für das, was er mir zwar mehrfach verboten hat, nachdem er mich erwischt hat. Aber was ich dennoch nicht aufhören kann. Zumindest nicht, wenn der Mond voller wird. Und ehrlicherweise will ich es nicht aufhören. Ich fühle mich danach besser. Zumindest ein bisschen. Aber das erkläre ich Dad lieber nicht.
Ich schüttel den Kopf.
»Mit Dad an der Seite wird mich wohl kaum jemand ansprechen.«
»Dann musst du ohne ihn gehen«, sagt Katie. Auf ihrem Gesicht liegt ein Ausdruck der Überzeugung, die mich nicht so ganz überkommt. »Einfach mal abhauen.«
»Und wie bitte soll ich das machen?«, frage ich resigniert. Der Keks in meiner Hand wird warm und weich. Essen mag ich ihn längst nicht mehr, so mulmig wie mir im Magen zumute ist. »Ich habe keinen Führerschein und selbst wenn, wird Dad mich lynchen, wenn ich mir einfach das Auto nehme.«
»Und was wenn wir zusammen fahren?« Katies runde Augen beginnen zu leuchten.
Ich sehe die Gedanken, die sich hinter ihrer Netzhaut formen und schüttel den Kopf.
»Ich glaube nicht, dass –«
Doch sie hört mir gar nicht zu.
»Ich könnte Mum bitten, mir das Auto zu leihen. Sie sagt sicher nicht nein. Und dann fahren wir in die Mall.« Sie lächelt und ihre rosigen Wangen strahlen. »Alles kein Problem.«
»Außer Dad erfährt davon.«
»Hast du vor, es ihm zu erzählen?«, fragt Katie provokant und streicht Kekskrümel von ihren Beinen.
»Natürlich nicht.«
So doof bin ich dann doch nicht. Auch wenn man das vielleicht von mit denkt. Die Hinterwäldlerin, die von ihrem gottgläubigen Vater zu Hause im Beten und Frommsein unterrichtet wird. Dabei war ich in beidem bekanntermaßen nicht gut.
Trotzdem bleibt die Angst, dass Dad davon erfahren könnte. Irgendwie.
Katie springt schon halb aus dem Bett und packt irgendwelchen Krempel vom Schreibtisch in ihre bereits überfüllte Handtasche.
»Wie lange ist dein Dad noch unterwegs?«
Ich schaue auf die Uhr an der Zimmerwand.
»Knappe zwei Stunden schätze ich. Er wollte noch bei den Vorbereitungen für das Kirchfest nächste Woche aushelfen.«
»Das reicht locker.« Katie schnappt die Kekstüte mit den letzten Resten, die sie übrig gelassen hat, und stopft sie in die Handtasche. »Bis zur Mall brauchen wir knapp zwanzig Minuten pro Strecke. Bleibt noch genug Zeit, um ein Eis zu essen und uns ein wenig umzusehen.«
Nach hübschen Jungs nehme ich an. Und ehrlicherweise klingt der Gedanke ziemlich verlockend. In die Mall ohne Dad mochte tatsächlich Spaß machen. Dennoch habe ich leichte Bauchschmerzen.
»Ich weiß nicht«, sage ich zögerlich.
Katie sieht mich mit ihren Kulleraugen an wie ein unterfütterter Hundewelpe.
»Ach komm schon Lil. Du musst dir doch mal ein bisschen Spaß gönnen und gegen ein Eis kann selbst dein Dad nichts haben.«
Wenn es nur das Eis wäre. Ich knete den abgegriffenen Keks zwischen meinen Fingern. Ein sehnsüchtiges Zerren macht sich in mir breit. Es kann doch nicht verboten sein mit seiner besten Freundin in der Mall ein Eis essen zu gehen. Das dürften sogar schon die meisten Zwölfjährigen. Es ist doch nur ein Eis.
Ich weiß, ich rede mir das Ganze selber schön, aber anders finde ich wohl niemals den Mut für meine nächsten Worte.
»Du zahlst«, sage ich.
Und Katie nimmt mich mit einem fröhlichen Jauchzen in den Arm, als hätte ich ihr Konzertkarten des nächsten Fleetstreet-Konzerts geschenkt. Der Keks in meiner Hand ist nur noch Brösel.
»Das wird super werden«, verspricht Katie und klopft mir die Brösel einfach aus der Hand auf den Boden zu den anderen. »Richtig super.«
Ich bücke mich nach meinem Rucksack und hoffe mit einem flauen Gefühl im Magen, dass sie recht hat.
Kapitel 3
Erst ist da eine Mischung aus Panik und Überforderung, doch dann ist es geil. Ich laufe neben Katie an den Läden vorbei, quatsche über die neuesten Trends, soweit ich davon Ahnung habe, und schlecke meine Eiskugel mit Zitronengeschmack. Meine Zunge prickelt bereits vor Kälte, als Katie mit einem Aufschrei vor einem Laden stehen bleibt.
»Schau!«, kreischt sie.
Und ich schaue mich um. Ängstlich in alle Richtungen. Unsicher, ob ich eine Naturkatastrophe, eine Horde wilder Nashörner oder, was noch schlimmer wäre, meinen Dad erwarten soll. Doch es ist nichts von alledem.
Sie hechtet nach vorne und packt eine Handtasche mit hässlichem babyblauem Plüsch.
»Die war letztens überall ausverkauft«, jauchzt sie und pfriemelt den Träger von der Verkaufsstange. »Die muss ich haben.«
Noch ehe ich nachfragen kann, was es mit der Tasche auf sich hat, oder einwerfen kann, dass sie mit ihrer Handtaschensammlung längst die gesamte Jahrgangsstufe ausstaffieren kann, verschwindet sie im Laden und lässt mich auf der Shoppingmeile stehen.
Ich atme tief durch und ergebe mich meinem Schicksal. Mit etwas Glück geht Katie direkt an die Kasse. Wahrscheinlicher braucht sie eine Weile und wird schlussendlich mit zwei Handtaschen, drei Shirts und einem Paar neuer Ohrringe heraus kommen.
Klar hätte ich ebenfalls in den Laden gehen können. Doch da ich kein Taschengeld dabei habe und ich es hasse, mit Essen durch Läden zu laufen, schaue ich mich einfach einen Moment in der Mall um. Eine völlig neue Erfahrung, wenn man dabei nicht von einer Freundin zugetextet wird oder von Dad durch die Läden geschoben wird, um schnell das Notwendigste zu besorgen.
Ich sehe das herbstliche Sonnenlicht, das durch das Glasdach scheint. Sehe die Dekoration an den Läden. Kürbisse, Herbstlaub und ulkig dreinblickende Geister. In einem Schaufenster stehen Kostüme und ich bewundere das Hexenoutfit. Ein großer Spitzhut und ein enges Kleid mit Tüllrock und Netzstrümpfen. Wahrscheinlich würde ich mich nicht einmal trauen, es anzuprobieren. Geschweige denn, dass ich es kaufen dürfte. Das letzte Mal, dass ich mich an Halloween verkleidet habe, war in frisch an der Middle-School. Damals musste ich als Mumie gehen. Nicht sonderlich kreativ.
Das waren die Zeiten, als ich noch wie andere Kinder sein durfte. So ein bisschen zumindest. In die Schule gehen. Mit Freunden treffen und durch die Vororte radeln. Doch kaum, dass ich anfing, meinen ersten BH zumindest ansatzweise auszufüllen, hatte sich alles geändert. Nun kam ich mir mehr vor wie Rapunzel im Turm. Nur mit dunklen und viel zu kurzen Haaren.
Ich laufe einige Schritte rückwärts über den Gang, während ich die Menschen auf der Rolltreppe beobachte. So viele Menschen, die es nicht im Geringsten interessiert, dass ich hier bin und sie anstarre, ihren Anblick in mir aufsauge, um zumindest die Illusion eines normalen Lebens zu bekommen.
Ich mache noch einen Schritt.
Und Klatsch.
Mein Gesicht landet im Eis, als ich mit jemandem zusammenstoße. Ganz schön kalt an meiner Nase. Und verdammt peinlich als ich mich umdrehe, um den Rempler anzumotzen.
Vor mir steht ein Junge. Nicht irgendein Junge. Ein gut aussehender Junge, fast schon ein Mann. Ich vergesse, was ich sagen wollte. Vergesse das Eis, das noch an meiner Nasenspitze klebt. Vergesse, höchstwahrscheinlich sogar den Mund zuzumachen. Denn ich kann nicht aufhören, ihn anzuglotzen. Seine lange Statur. Das dunkle Haar. Die schmale Nase. Und erst seine Augen. Oh, Mann.
»Tut mir Leid«, sagt er und ein entschuldigendes Lächeln verzaubert sein Gesicht, »Ich habe nicht damit gerechnet, dass du einen Schritt nach hinten machst.«
»Mache ich normalerweise auch nicht.«
Was für eine bescheuerte Antwort.
Aber man muss mir verzeihen, schließlich bin ich es sonst nur gewohnt Gesangsbücher zu verteilen und mit der Postbotin zu reden. Sicherlich habe ich keine Erfahrung damit, wie man einen fremden überaus attraktiven Jungen anspricht. Gar keine.
Einen Moment sagt niemand etwas und wir starren uns beide nur an. Mein Herz klopft unerträglich laut, dass ich mir sicher bin, dass er es hören muss. An die hochrote Birne, die ich habe, will ich gar nicht erst denken. Oder könnte es einen anderen Grund geben, warum er mich ansieht. Gefalle ich ihm vielleicht sogar. Also so ganz unwahrscheinlich.
»Du hast Eis an deiner Nase«, sagt er und die Magie meiner eigenen Träume zerplatzt wie Seifenschaum.
Peinlich berührt wische ich mir über die Nasenspitze und den Mund. Die Hitze in meinem Kopf gleicht einer Herdplatte und wahrscheinlich leuchte ich im Dunkeln wie eine Verkehrsampel.
»Danke«, murmel ich und wünsche mir, dass mich jemand aus dieser Situation erlöst.
Oder vielleicht auch nicht.
Immerhin schaut er mich freundlich an und lacht nicht über mich. Und ich kann ihn weiter anschmachten. Vielleicht sollte ich ihn etwas fragen. Ihn um seine Nummer bitten. Auch wenn ich nicht weiß, was ich damit soll, wo ich doch kein Handy habe.
Natürlich sage ich nichts.
Der Junge reibt sich über den Nacken, und wenn mich nicht alles täuscht, sind auch seine Wangen und dieser zauberhafte Nasenrücken leicht gerötet. Hoffentlich nicht, weil er mich so peinlich findet.
»Bist du öfters hier?«, fragt er, »Also ich habe dich bisher nie hier gesehen.«
Ich war ihm auch nie begegnet, da war ich sicher. So einen Jungen hätte ich nicht vergessen.
»Nein.« Ich schüttel den Kopf. »Also ich meine, ich bin selten hier.«
Viel zu selten, denke ich, jetzt mit dem Geschmack von Zitroneneis auf der Zunge und im Gespräch mit einem Jungen ohne Pickel und Topffrisur.
»Möchtest du vielleicht –«, beginnt er seinen nächsten Satz, doch ich erfahre nicht mehr, was ich möchten könnte.
»Lil!«
Ich wünschte, ich könnte sagen, dass es Katie ist, die nach mir ruft. Doch die Stimme ist zu tief, zu laut und sie ist zornig. So zornig, wie nur Dad sein kann, wenn er mich bei etwas Verbotenem erwischt. Etwas wirklich Verbotenem.
Seine Hände sind zu Fäusten geballt und sein bärtiges Gesicht erinnert an eine zornige Bulldogge. Ich sehe, wie er mit großen Schritten auf mich zukommt. Glaube, den Aufprall seiner Füße auf dem Boden zu spüren. Oder ist das nur mein Herzschlag?
Meine eigene Überraschung spiegelt sich in den Augen des Jungen, die eben noch nur auf mich gerichtet waren. Jetzt sehe ich darin Fluchtgedanken. Und die habe ich auch. Scheiße, das wird Ärger geben.
»Lil, was zum Geier machst du hier?« Dad hat mich erreicht und baut sich vor mir auf. Die Hände fest in die Seiten gedrückt.
»Ich …«, stottere ich und mein Blick hastet zwischen dem Jungen, dem Laden in dem Katie verschwunden ist und meinem Eis hin und her. Nur nicht Dad in die Augen schauen. Das könnte ihn bloß noch wütender machen.
Ich halte zitternd meine Eiswaffel hoch.
»Ich esse ein Eis mit Katie.«
Dad schaut an mir vorbei zu dem Jungen.
»Mit Katie?« Dad zieht die buschigen Augenbrauen hoch. »Katie sah letztens noch ganz anders aus.«
Mir wird klar, dass die Situation anders aussieht. Ganz anders. Und dass das für alle ein Problem bedeuten könnte.
»Es ist nicht …«, verhaspel ich mich, »Ich kenne ihn nicht. Ich …«
Endlich kommt Katie aus dem Laden gesprungen, die Sachen nur halb in die Tüte gestopft, als hätte sie mitbekommen, dass hier draußen gerade die Welt untergeht. Also meine Welt.
»Hi, Mr. Rogers«, sagt sie völlig außer Atem und doch mit einem Lächeln, was wohl möglichst freundlich und brav aussehen soll, »Schön Sie hier zu sehen. Lil und ich wollten nur ein Eis essen und ich war kurz –«
Doch Dad geht gar nicht auf sie ein.
»Du weißt, dass du ohne mich in der Mall nichts zu suchen hast.« Seine Stimme ist so anklagend, dass ich vor Scham am liebsten im Boden versinken würde. Vor allem, weil auch andere Menschen nach und nach auf uns aufmerksam werden. Nun war ich es, die von allen angeglotzt wurde.
»Ja, ich weiß«, versuche ich es entschuldigend, »Und wir wollten auch gar nicht lange bleiben. Nur kurz ein kleines Eis essen.«
Dads Blick gleitet wieder an mit vorbei zu dem Jungen.
»Und was willst du hier?«, fragt Dad.
So unhöflich ist er sonst nie zu anderen. Doch den Jungen schaut er an, als würde er ihn am liebsten die schöne Nase brechen. Nicht dass Dad gewalttätig wäre. Kein bisschen. Er weint sogar, wenn in den Nachrichten kleine Hundebabys gezeigt werden. Doch dass kann der Junge nicht wissen. Kein Wunder also, dass sein Gesicht leicht gräulich anläuft.
»Ich bin nur zufällig vorbeigekommen«, sagt er und macht einen Schritt von mir weg.
Kurz überkommt mich der Wunsch, die Distanz zwischen uns wieder zu verringern. Ihn zu berühren. Ein Brennen und Prickeln in meinen Fingerspitzen, dass mir Angst macht. Doch ich bleibe regungslos stehen.
»Dann schau, dass du genauso zufällig wieder verschwindest.« Damit ist die Sache für Dad wohl erledigt.
Für mich leider nicht.
»Komm, Lil«, sagt Dad und legt eine Hand in meinen Rücken und schiebt mich in Richtung Ausgang.
»Was ist mit Katie?«, frage ich und drehe mich zu meiner Freundin um, die mir einen so mitleidvollen Blick zuwirft, als ginge es zu meiner Kreuzigung.
»Sie wird auch ohne dich nach Hause kommen«, sagt Dad, »Da bin ich mir sicher.«
Wahrscheinlich. Trotzdem wäre ich jetzt lieber bei ihr geblieben und hätte sie als Schutzpanzer zwischen mir und Dad. Immerhin war sie schuld an dem Ganzen hier. Sie und ihre blöden Ideen.
Das Eis in meiner Hand beginnt zu schmelzen und klebriges Zitroneneis läuft über meine Finger. Der Appetit auf Eis ist mir erst mal vergangen.
Ich schmeiße das Eis weg und folge Dad mit vor Scham glühender Birne. Vielleicht hätte ich nicht auf Katie hören sollen. Vielleicht war es das Risiko nicht wert gewesen.
Ich sehe mich ein letztes Mal nach Katie um und sehe etwas hinter ihr den Jungen stehen. Ein kleines mitfühlendes Lächeln liegt auf seinem Gesicht und er hebt schüchtern die Hand zu einem Abschiedsgruß. Unauffällig hebe auch ich die Hand, bevor Dad mich hinausschiebt. Und irgendwie war es das doch wert.
Kapitel 4
Wusstet ihr, dass man Schneisen in einen Teppich laufen kann? Also Dad kann das. Beeindruckt und beunruhigt starre ich auf die langen Bahnen, die von einer Seite des grauen Bodenbelags zur anderen führen. Sehe, wie Dad die kurzen Borsten immer wieder in dieselbe Richtung knickt, während er durchs Wohnzimmer auf und ab marschiert. Schweigend. Was mich allmählich in den Wahnsinn treibt.
Eigentlich war ich mir sicher, dass er mich anbrüllen würde, sobald die Autotüren sich hinter uns schlossen. Doch zu meiner Verwunderung hat er geschwiegen. Das bin ich nicht gewohnt von ihm. So reagiert er nie, wenn ich Mist gebaut habe. Was mir klar macht, wie schlimm der Mist dieses Mal ist. Nicht, dass ich es verstehe. Was bitte ist so schlimm daran, wenn man mit seiner Freundin shoppen geht?
»Ich weiß, du willst nicht, dass ich ohne dich durch die Stadt laufe«, sage ich, als ich das Schweigen nicht mehr ertrage, »Aber zum einen war ich nicht alleine. Katie war mit mir da. Und zum anderen ist es die Mall. Nicht ein Treffpunkt für Drogensüchtige und Huren am Bahnhof.«
Ich weiß, meine Worte sind etwas provokant. Aber wie sonst soll ich Dad dazu bringen, mit mir zu reden?
»Ich möchte nicht, dass du dieses Wort benutzt«, ist alles, was Dad dazu sagt, während sein Blick durch mich hindurch geht. Fast scheint es, dass er gar nicht in diesem Raum ist. »Auch diese armen Mädchen haben es verdient, mit Respekt behandelt zu werden.«
Als interessierte es die Prostituierten, wie ich sie nenne, wenn sie mich nicht einmal hören. Aber Dad besteht auf die Bezeichnung leichte Mädchen. Als wäre das weniger schlimm. Immerhin sind Mädchen noch keine Frauen. Keine sündigen Wesen, zu denen ich mich wohl besser nie entwickel.
Nach diesem kurzen Einschub verfällt Dad wieder in seine schweigende Bewegung. Irgendetwas stimmt hier nicht. Da bin ich mir sicher.
»Könntest du vielleicht endlich etwas sagen?«, frage ich nervös. Vielleicht ist das eine neue Form der Bestrafung. Falls es so ist, funktioniert es hervorragend. Ich fühle mich mies und verunsichert.
Aber Dads verwirrter Blick, als er zu mir aufsieht, sagt mir, dass er das nicht tut, um mich zu bestrafen.
»Lil, ich wünschte, du könntest verstehen, warum ich das alles tue. Warum ich es tun muss.«
Er klingt schrecklich müde und mir fallen die dunklen Ringe unter seinen Augen auf. Dunkler, als sowieso schon oft. Was macht ihm solche Sorgen?
Ich fühle mich noch schlechter damit, ihm das Leben zusätzlich schwer zu machen. Was mich nicht von meinen Fragen abhält. Ich bin ehrlich nicht gut darin, Dinge nicht zu hinterfragen.
»Was musst du tun?« Ich schüttel verständnislos den Kopf, während ich aus meinem Schneidersitz aufstehe, um mich vor Dad zu stellen. »Geht es um die Stadt? Darum, dass ich nicht in die Schule darf? Was ist eigentlich das Problem?«
Dad blickt zu mir. In seinen Augen sehe ich Traurigkeit. Einen tiefen Seelenschmerz, den unmöglich ich verursacht haben kann. Was sollte ich falsch gemacht haben, dass es Dad so schlecht geht? Ich versuche doch, immer alles richtig zu machen. Versuche, mich an seine Regeln zu halten. Egal wie bescheuert ich sie finde.
Er tritt vor mich und streicht mir das kinnlange Haar hinter die Ohren.
»Ich will doch nur nicht, dass du wie sie wirst.«
»Wie wer wirst?«
Ich verstehe Dad nicht. Also noch mehr als ich ihn sowieso oft nicht verstehe mit seinen Bibelzitaten und seinen Reden darüber, was ein guter Mensch ist. Nicht dass er mit allem Unrecht hätte.
»Deine Mutter war nie eine einfache Frau.«
Meine Mutter? Wieso ging es plötzlich um meine Mutter?
Also meine Mutter ist nicht tot, falls das irgendwer denkt. Aber so selten, wie ich sie sehe und wir über sie reden, könnte sie es sein. Meine Mutter und mein Dad haben sich kurz nach meiner Geburt getrennt. Und nach allem, was Dad so erzählt hat, war meine Mutter nicht in der Lage, oder ihr fehlte die Lust, mich großzuziehen.
Sie war sehr jung, sagt Dad, wenn ich nach den Gründen frage. Jünger als Dad auf jeden Fall. Ich habe versucht, genauer zu recherchieren, und schätze, dass meine Mutter kaum älter war als ich bei meiner Geburt. Siebzehn vielleicht. Höchsten achtzehn. Und warum sie sich ausgerechnet mit meinem Dad eingelassen hat, der nicht nur gute zehn Jahre älter ist als sie, sondern auch Vikar in der Kirchengemeinde war, ist mir ein Rätsel. Eines von vielen. So wie das Rätsel, was das alles jetzt schon wieder mit meiner Mutter zu tun hat.
»Wieso denkst du, dass ich wie sie bin?«, frage ich zornig und stemme die Hände in die Hüften. So wie Dad es immer tut.
Ich bin ihm in vielen ähnlich. Und trotzdem – trotzdem scheint er zu glauben, dass ich wie meine Mutter werde. Eine Frau, die Mann und Kind verlassen hat. Die mehr Männer an ihrer Seite hatte als ich Finger an den Händen. Eine Frau, von der man nie wusste, ob und wann sie sich mal meldet, und die nie für mich da war. Das ist nicht fair.
»Darf ich deswegen nicht zur Schule, niemanden kennenlernen? Denkst du ich bin auch so blöd, mich schwängern zu lassen und dir dann noch ein lästiges Kind zu hinterlassen, um das du dich kümmern musst? Noch einen Klotz am Bein.«
Ich bin viel zu aufgewühlt, um auch nur zu versuchen, meine Worte abzumildern. Doch warum sollte ich? Schließlich schein genau das Dads Problem zu sein. Nur weil die einzige Frau, die er je an sich herangelassen hat, ihn sitzen ließ, heißt das doch nicht, dass alle Frauen so sind. Dass ich so werde.
»Du bist kein Klotz am Bein«, sagt Dad und legt die Hände auf meine Oberarme. Sein Griff ist fest, eindringlich. »Das darfst du niemals denken.«
Ich höre seine Worte, spüre, dass sie wahr sind. Weiß doch, dass er mich liebt. Dad hat mich immer geliebt. Und trotzdem verfluche ich mich für die Tränen, die mir in die Augen steigen. Mann, ich bin doch kein kleines Kind mehr.
Es tut gut, als Dad mich in den Arm nimmt. Ich rieche sein Aftershave und spüre den rauhen Stoff seines Hemdes an meiner Wange. Atme tief durch.
»Ich liebe dich, Kleines. Okay?«, höre ich Dad leise sagen. »Und du bist das Wundervollste, was mir im Leben passiert ist.«
Eine Träne rollt mir aus den Augenwinkel und ich schniefe.
»Es tut mir Leid, dass ich einfach mit Katie in die Stadt gefahren bin«, schluchze ich, »Wir wollten wirklich nur ein Eis essen. Halt wie ein ganz normaler Teenager.«
Ich will doch nur normal sein dürfen. Einfach sein, wie ich bin. Nicht eingesperrt und unter Generalverdacht, nur weil ich eine Vagina habe.
»Ich weiß«, sagt Dad und hält mich fest. Auch sein Atem zittert. »Und ich weiß, dass ich manches nicht aufhalten kann. Manches nicht.«
Ich löse mich aus der Umarmung und schaue ihn verwundert an. Was soll diese Aussage jetzt wieder?
Seine Hände liegen auf meinen Armen und er schaut mich ernst an.
»Ich wollte es dir eigentlich nicht so sagen, aber besser du erfährst es, bevor –«
Ein unerwartetes Türklingeln schreckt uns aus unserem Gespräch und sofort lässt Dad meine Arme los und steht stocksteif. Seine Gesichtszüge verschließen sich. Er sieht auf die Uhr.
»Sie sind zu früh«, sagt er grimmig, »Aber warum sollte sie sich auch an die Uhrzeit halten?«
Ich will fragen, wen er erwartet und warum er dabei so mürrisch guckt. Doch irgendetwas an Dads Miene hält mich auf. Stattdessen sehe ich zu, wie er mit wenigen schnellen Schritten an die Tür geht und die Klinke herunterdrückt.
Vielleicht hätte ich länger gebraucht, um die Frau zu erkennen, die unser Haus betritt. Schließlich habe ich sie lange nicht gesehen. Sicherlich anderthalb Jahre nicht. Doch nachdem ich gerade erst an sie gedacht habe, weiß ich, wer die Frau hinter dem eleganten Wollschal mit den hohen Pumps ist, die klackernd auf unseren Dielenboden spaziert.
»Hallo Tom«, sagt sie zu meinem Dad mit einem beinahe aufreizenden Lächeln ihres rot geschminkten Munds. »Schön dich zu sehen. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, dass wir etwas zu früh sind.«
Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie genau weiß, wie sehr es Dad stört, dass sie zu früh ist. Dass sie überhaupt hier ist. Auch ich bin nicht glücklich darüber, meine Mutter zu sehen. Noch weniger als dieser Typ nach ihr hereinkommt.
Schon wieder so ein eitler Fritze im Anzug, denke ich und bin mir sicher, dass das ihr neuster Lebensabschnittsgefährte ist. Ein Mann für gewisse Zeiten und Stunden im Leben. Nein, ich werde nicht wie meine Mutter werden.
In dem Moment, als ich das denke, sieht sie mich auch schon. Sie hebt die Hände vor den Mund. Perfekt manikürte Finger, die ich gerne hassen würde, wenn sie nicht so wunderschön aussähen.
»Lilith, bist du groß geworden«, sagt sie und kommt zu mir herüber. »Und so schön.«
Das bezweifele ich allerdings. Zumindest nicht so schön wie meine Mutter, die selbst auf den höchsten Schuhen einen Raum wie eine Löwin durchschreiten kann. Unvorstellbar, dass diese Frau einmal das Bett mit meinem Vater geteilt hat. Ich will es mir auch nicht vorstellen.
»Hallo Mum«, sage ich unsicher darüber, wie ich mich verhalten soll.
Normalerweise sehen wir uns höchstens mal an Geburtstagen oder zu besonderen Anlässen. Dass Dad diesmal nicht einmal gesagt hat, dass meine Mutter vorbeikommen würde, verursacht mir ein unangenehmes Gefühl in der Magengegend.
Sie setzt sich ungefragt auf die Couch, während ihr Begleiter sich hinter sie stellt. Seine glänzende Ledertasche drapiert er vor sich auf der Lehne unseres alten Polstersofas, was dadurch noch heruntergekommener wirkt. Dann wendet meine Mutter sich wieder an meinen Dad.
»Hast du ihr gesagt, warum ich hier bin, Tom?«
Ich schaue fragend von meiner Mutter zu meinem Dad, dann wieder zu meiner Mutter.
»Du brauchst einen Grund, um mich sehen zu wollen?«, frage ich und ignoriere Dads Blick.
Mir doch egal, dass man so nicht mit seinen Eltern sprechen sollte. Von wegen viertes Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Hätten die alten Hebräer meine Mutter gekannt, hätten sie sicher Verständnis dafür gehabt, wenn man sich nicht immer an diese Regel hält.
Meine Mutter wendet sich mir zu.
»Natürlich sehe ich dich auch so gerne, aber du weißt, dass ich viel zu tun habe.«
Obwohl meine Mutter mich anlächelt, bin ich mir unsicher, was sie denkt und fühlt. Wie auch? Ich kenne sie ja kaum. Aber, dass sie ständig arbeitet und dabei rund um die Welt reist, entspricht der Wahrheit. Ich gebe es zwar nicht gerne zu, aber ich bewahre die Postkarten, die sie mir ab und zu von überall her schickt unter meinem Bett auf. Dann kann ich mir zumindest manchmal einreden, ich hätte eine Mutter, die sich für mich interessiert.
Dad kommt zu uns in den Wohnbereich und stellt sich demonstrativ neben mich.
»Ich wollte es ihr gerade erklären.«
Ich versuche, Dads Blick zu erhaschen, doch er ist auf meine Mutter fixiert. Ich frage mich, ob er manchmal noch traurig ist, dass sie ihn verlassen hat. Oder eher dankbar.
»Erklären?«, fragt meine Mutter und hebt die Augenbrauen. Sie sind so dunkel wie ihr hochgestecktes Haar. So dunkel wie mein Eigenes. »Was muss man da erklären? Es ist doch eine ganz einfache und tolle Sache.«
Ich bin es Leid, dass alle drumherum Reden und platze heraus: »Was für eine tolle Sache? Könntet ihr bitte einfach sagen, was hier los ist.«
Wieder ist meine Mutter schneller.
»Du wirst wieder zur Schule gehen.«
»Was?« Überrascht starre ich sie an.
Es sind die Worte, auf die ich jeden Tag gehofft habe, seit Dad mir vor zwei Jahren mitgeteilt hat, dass ich ab jetzt von ihm im Homeschooling unterrichtet werde. Worte, die ich herbeigesehnt habe. Trotzdem dachte ich, dass Dad sie mir eines Tages sagen würde und nicht meine Mutter einfach so, während sie mit ihrem neuen Lover in unserem Wohnzimmer sitzt.
»Als ich erfahren habe, dass dein Vater sich weigert, dich zur Schule zu schicken, habe ich getan, was notwendig war«, sagt sie und wendet sich zum ersten Mal an ihren Begleiter, »Und mein Anwalt hat ganze Arbeit geleistet.«
Der Typ ist also ihr Anwalt, nicht ihr Lover. Wobei vielleicht ist er ja beides, bei dem Blick, den die beiden sich zuwerfen.
Wie auf ein Kommando öffnet ihr Anwalt die Aktentasche und zieht einen Zettel daraus hervor, den er meiner Mutter reicht.
»Jetzt, nach langem Streit habe ich es Schwarz auf Weiß.« Sie reicht meinem Vater das Blatt, das er mit zusammengebissenen Zähnen entgegennimmt.
»Die Entscheidung darüber, ob Lilith zur Schule geht oder nicht, darf nicht ohne meine Zustimmung getroffen werden. Und deswegen …« Sie lächelt mich an. So selbstgefällig, dass alle Freude, welche die Nachricht in mir ausgelöst hat, in sich zusammenschrumpft. »Wirst du wieder in die Schule gehen. Ich hoffe, das ist in deinem Sinne.«
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. In mir streiten zwei Gefühle. Auf der einen Seite ist da die Freude. Unbändige Freude darüber, nicht mehr jeden Tag alleine mit Dad in diesen vier Wänden zu sitzen. Wieder mit Katie und den anderen zu lernen. Vielleicht neue Freunde zu finden und nicht mehr dieses Leben aus zweiter Hand zu führen.
Auf der anderen Seite ist da aber auch Dad. Ich sehe ihn von der Seite an und weiß, wie sehr ihn das trifft. Dass er seinen Job geopfert hat, um für mich da zu sein. Dass es sich wie ein Verrat für ihn anfühlen muss, wenn ich mich jetzt freue.
Also sage ich gar nichts und warte ab.
Dad streicht angespannt das Papier glatt. »Ich bin aber nicht damit einverstanden, dass sie auf eine dieser staatlichen Bildungseinrichtungen geht, wo sie mit Gott weiß wem Kontakt hat und nur Unsinn beigebracht bekommt. Auch meine Meinung hat hier Gewicht, Elenore.«
Seine Stimme klingt drohend, als er den Namen meiner Mutter ausspricht, und ich frage mich, wie weit er bereit ist zu gehen in diesem Streit.
Doch wie mir scheint, hat er ihn längst verloren, denn meine Mutter lässt sich einen weiteren Zettel anreichen.
»Deswegen wird sie nicht zurück auf eine staatliche Schule gehen.«
Sie reicht auch das zweite Blatt an meinen Vater weiter und ich will, nein muss, einen Blick darauf werfen. Was soll das heißen, ich werde nicht an eine staatliche Schule zurückgehen?
»St. Christophorus High Mädcheninternat«, liest mein Vater den Anmeldebogen der Schule vor. Die Schule, die ich wohl bald besuchen soll nach dem Willen meiner Mutter.
»Keine schlechten Einflüsse«, sagt meine Mutter mit einem spöttischen Lächeln. »Vorbildlicher Unterricht. Eine christliche Erziehung. Das sollte ganz in deinem Sinne sein, Tom.«